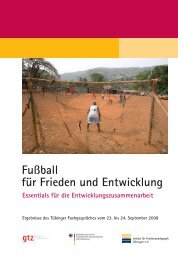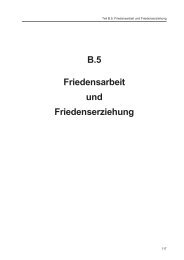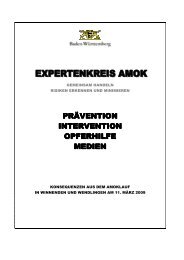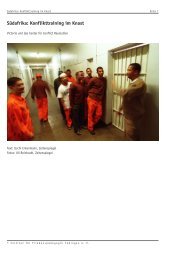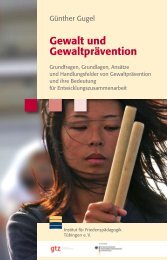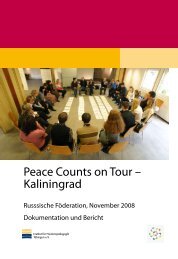PDF 6.768kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
PDF 6.768kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
PDF 6.768kB - TOBIAS-lib - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
fördernde zivile Instrumente passten seiner Meinung nach nicht in umkämpfte Gebiete,<br />
da die Konfliktlage oft zu komplex und gefährlich sei. Dr. Andreas Heinemann-<br />
Grüder gab außerdem zu Bedenken, dass eine Intervention in einer Krisenregion eine<br />
hohe Verantwortung mit sich bringe. Er sei sich nicht sicher, ob NGOs bereit seien,<br />
sich dieser Verantwortung zu stellen.<br />
Ein gravierendes Problem stelle die<br />
Finanzierung der zivilen Kräfte dar, fand<br />
Steffen Emrich. Wenn Entwicklungs- und<br />
Friedensorganisationen aufgrund ihrer<br />
Abhängigkeit von Spenden oder Fördergeldern<br />
ein Krisenland verließen/verlassen müssten,<br />
bliebe häufig nichts von ihrer Arbeit übrig. Der<br />
Zivile Friedensdienst, der über keine großen<br />
Ressourcen verfügt, verfolge deshalb eher die<br />
Strategie, Partner vor Ort zu unterstützen und<br />
Friedensprozesse in Gang zu bringen, statt sie<br />
selbst zu leiten.<br />
Der Zufluss von Spenden für<br />
Hilfsorganisationen, so Steffen Emrich, sei<br />
immer abhängig von der medialen Aufmerksamkeit für einen Konflikt. Außerdem<br />
müssten sich nichtstaatliche Entwicklungsorganisationen an den Förderrichtlinien der<br />
Europäischen Union (EU) oder des BMZ orientieren, die bestimmte Schwerpunktländer<br />
vorgeben. Botschafter Friedrich Däuble stimmte zu, dass nichtstaatliche Organisationen<br />
keine frei einsetzbaren Gelder zur Verfügung hätten, sondern Förderungsanträge<br />
an das Ministerium stellen müssten, die in den vorgegebenen politischen Rahmen<br />
passen.<br />
Dr. Andreas Heinemann-Grüder merkte kritisch an, dass NGOs allzu häufig „Kriegsgewinnler“<br />
darstellten, wenn sie Teil des „Interventionsmechanismus“ geworden seien.<br />
Da Spenden solange fließen, wie in einer Region Konflikte herrschen, bilde sich<br />
ein regelrechtes Entwicklungshilfe-Business aus, das mit Altruismus wenig zu tun habe.<br />
Chancen und Probleme von ziviler Krisenprävention<br />
Eine wichtige Rolle in der Debatte über ziviles Engagement spielte die präventive<br />
Wirkung der Einsätze. Rainer Arnold nannte Mazedonien als Beispiel für eine erfolgreiche<br />
Prävention. Dort sei der Gewaltausbruch verhindert worden.<br />
Steffen Emrich betonte ebenfalls die präventive Stärke des zivilen Engagements, die<br />
im Diskurs über die ZKB zu kurz komme. Trotz anfänglicher Fehler in der Entwicklungszusammenarbeit<br />
gebe es viele Erfahrungswerte von Fachleuten, die genutzt werden<br />
müssten. Er bemängelte jedoch, dass die öffentliche Wahrnehmung über Mittel<br />
entscheide, wodurch es an finanzieller Unterstützung für „vergessene Krisen“ und vor<br />
allem an deren Prävention fehle. Dr. Matthias Ries stimmte ihm zu, dass die zivile<br />
Krisenprävention intensiviert werden müsse, auch wenn ihre Finanzierung aufgrund<br />
von mangelnder Medienwirksamkeit Probleme bereite. Es gebe schon ausgearbeitete<br />
„lessons-learned Ansätze“ der ZKB, die unter Berücksichtigung kultureller Unterschiede<br />
auch auf andere Krisenregionen angewendet werden könnten. Vor allem der<br />
32