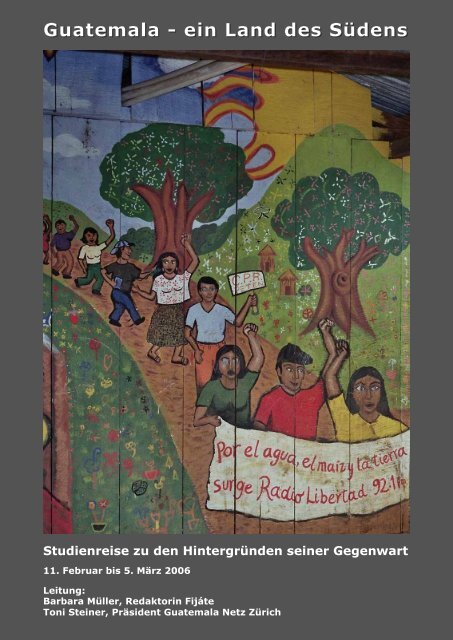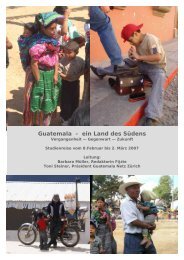Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Guatemala - ein Land des Südens<br />
Studienreise zu den Hintergründen seiner Gegenwart<br />
11. Februar bis 5. März 2006<br />
Leitung:<br />
Barbara Müller, Redaktorin Fijáte<br />
Toni Steiner, Präsident Guatemala Netz Zürich
In Santa María Nebaj<br />
Und ich hatte geglaubt,<br />
dass man die Campesinos zur Erntearbeit<br />
längst nicht mehr auf Lastwagen pfercht.<br />
Heute<br />
hab ich sie wegfahren sehen<br />
in Santa María Nebaj;<br />
samt ihren Hunden,<br />
samt ihren Hühnern,<br />
samt ihren Flicken<br />
samt ihrer Trauer,<br />
samt ihrem winzigen Stück Hoffnung.<br />
Humberto Ak'abal<br />
Die TeilnehmerInnen der Reise haben Berichte über die Begegnungen der Gruppe mit<br />
Menschen und Organisationen sowie ihre persönlichen Eindrücke in Tagebuchberichten<br />
festgehalten. Dieser Reisebericht möchte ein Stück Erinnerung einer sehr eindrücklichen,<br />
schönen, lehrreichen und manchmal auch bedrückenden Reise sein.<br />
Wir haben die Berichte mit Links, Adressen und mit einem Anhang mit weiterführenden<br />
Informationen zum jeweiligen Thema ergänzt.<br />
Der Bericht kann auch im Internet heruntergeladen werden:<br />
http://www.guatemalanetz.ch<br />
das Redaktionsteam: Barbara und Yvonne<br />
Layout: Piero
Inhalt<br />
Antigua Guatemala (Peter Freybe) ............................................ 12.02.06 S. 1<br />
Auf Columbus' Spuren S. 1<br />
Iximché (Mila Cristóbal) ............................................................ 13.02.06 S. 3<br />
Colomba (Ilse Süsser) ............................................................... 14.02.06<br />
Kirchezentrum Colomba S. 4<br />
Finca Santa Rosa S. 5<br />
Finca Santa Anita S. 5<br />
Tecún Umán (Genviève Bichsel) ................................................. 15.02.06<br />
Casa de la Mujer S. 7<br />
Bananenplantage S. 7<br />
Casa del Migrante S. 8<br />
Concepción Chiquirichapa (Christine Fuchs-Huser) ..................... 16.02.06<br />
Poder local – Treffen mit verschiedenen Organisationen S. 9<br />
Xela: Coordinadora Departamental de Comadronas CODECOT S. 10<br />
San Rafael, San Antonio, San Marcos (Ilse Süsser) ................... 18.02.06<br />
Maisfest in San Rafael S. 11<br />
Gesundheitszentrum San Antonio S. 12<br />
REMHI S. 13<br />
San Marcos ............................................................................. 19. und 20.02.06<br />
Finca Las Delicias (Ann Schwarz) S. 15<br />
Bischof Ramazzini (Peter Freybe) S. 18<br />
San Miguel Ixtahuacán (Peter Freybe) S. 18<br />
Hueheutenango – Sacapulas – Nebaj (Adelheid Honecker) ......... 21.02.06 S. 20<br />
Nebaj (Adelheid Honecker) ......................................................... 22.02.06<br />
Rigoberto Pérez und MitarbeiterInnen S. 21<br />
La Pista S. 22<br />
Xix (Yvonne Joos) ..................................................................... 23.02.06<br />
Asociación de Poblaciones Desarraigadas K'iche S. 25<br />
Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral S. 26<br />
Centro de Formación Nuevos Mayas S. 28<br />
San Bartolomé Jocotenango (Ann Schwarz) .............................. 24.02.06 S. 30<br />
Chichicastenango (Yvonne Joos) ............................................... 25.02.06<br />
Pastoral de la Tierra Quiché S. 31<br />
Lago Atitlán, Panabaj (Barbara Müller) ...................................... 26.02.06<br />
Asociación Maya Neuvo Sembrador S. 29<br />
Sololá (Mila Cristóbal) ............................................................... 27.02.06<br />
Hurrican Stan - Luis Palacios S. 36<br />
Petén (Yvonne Joos) ................................................................. 28. und 29.02.06<br />
CPR Santa Rita S. 38<br />
Alianza por la Vida y la Paz S. 40<br />
Guatemala Stadt ..................................................................... 1. – 4. 03.06<br />
CAFCA (Yvonne Joos) S. 35<br />
De Víctimas a Actoras del Cambio (Yvonne Joos) S. 43<br />
Archive der Nationalen Polizei (Barbara Müller) S. 47<br />
Schweizer Botschaft (Peter Freybe) S. 50<br />
ACOGUATE (Yvonne Joos) S. 51<br />
Centro de Estudios de Guatemala (Yvonne Joos) S. 53
11. 02. 06: Der 1. Tag auf Columbus’ Spuren<br />
Nach langer gründlicher Vorbereitung (wie wir<br />
auf Schritt und Tritt erstaunt und dankbar bemerken),<br />
treffen wir uns am 1<strong>1.2</strong>.2006 in Zürich<br />
auf dem Flughafen. Toni empfängt uns,<br />
wir checken ein bei Iberia. Und dann sind wir<br />
schon in Madrid. Was Christoph Columbus im<br />
Auftrag des spanischen Königs 1492 unternahm<br />
– auf einem langen Seeweg Amerika zu<br />
entdecken! –, dazu traten wir (unsere auf 10<br />
Personen geschrumpfte Gruppe) auf Einladung<br />
von Toni und Barbara an, um unsere Entdeckungs-<br />
und Studienreise nach Guatemala zu<br />
12. 02. 06: Ein Tag in Antigua<br />
«Die größte Sache seit der Erschaffung der Welt und<br />
seit der Fleischwerdung und dem Tod Christi am<br />
Kreuz ist die Entdeckung Indiens; deshalb nennt<br />
man es auch neue Welt, und man nennt es nicht nur<br />
deshalb ‹neu›, weil es neu entdeckt ist, sondern<br />
weil es von riesiger Ausdehnung ist, fast so groß wie<br />
die Alte Welt, die Europa, Afrika und Asien umfasst.»<br />
(Francisco Lopez de Gomara, 1522<br />
– nachzulesen bei Mila)<br />
Wir erleben in Antigua<br />
eine Stadt europäischen,<br />
besonders spanischen<br />
Zuschnitts. Wir kommen<br />
also wie Columbus von<br />
Osten her hier im Westen<br />
an. Was werden wir entdecken<br />
auf den Spuren<br />
der conquistadores, der<br />
Eroberer dieses schönen<br />
Erdteils? Mit Pferden und<br />
Schiesseisen waren sie<br />
gekommen, haben die<br />
Ureinwohner der indianischen<br />
Stämme als interessante<br />
Fremde beeindruckt,<br />
haben die Missionare<br />
nachkommen lassen<br />
– bis schliesslich die<br />
menschenverachtende<br />
Unterdrückung und Ausrottung<br />
grosser Teile der<br />
indigenen Bevölkerung<br />
das Ergebnis und der<br />
grausame Erfolg der<br />
«Mission» derer war, die aus Madrid gekommen<br />
waren. Werden wir auch Spuren von Bartolome<br />
de Las Casas wieder finden?<br />
1<br />
unternehmen. 6.15 Uhr treffen wir uns in Kloten<br />
auf dem Flug- (nicht See-) Hafen. Kurzbesuch<br />
und Zwischenstation ist in der Heimat<br />
des Columbus in Madrid. Gegen 23 Uhr landeten<br />
wir in Guatemala-City – sicher gestartet,<br />
gut geflogen, ordentlich gelandet. Zu unserer<br />
Freude empfängt uns Barbara, die Land und<br />
Leute so gut kennt und unsere sachkundige<br />
und engagierte Begleiterin wird. Antonio, der<br />
unser treuer ortskundiger Chauffeur sein wird,<br />
ist auch schon da. Und los geht’s in die Nacht<br />
bei Vollmond nach Antigua.<br />
Was für seltsame Nachfahren sind wir auf dem<br />
Weg von Madrid hierher? Was wollen wir hier?<br />
Wie werden wir dem Erbe der spanischen Eroberer<br />
und dem Erbe der immer noch unterdrückten<br />
indigenen Völker begegnen?<br />
Antigua – 1543 gegründete Stadt, die bald zur<br />
Kolonialhauptstadt wurde. Am 26.7.1773 zerstörte<br />
ein schweres Erdbeben die Stadt vernichtend.<br />
Im ehemaligen Dominikaner-Kloster<br />
Santo Domingo<br />
(heute ein vornehmes<br />
Luxus-Touristen-Hotel) erinnert<br />
uns Toni an die Geschichte.<br />
Francisco Antonio<br />
De Fuentes y Guzman<br />
schrieb im 17. Jahrhundert<br />
mit bewegten Worten über<br />
die Schönheit und Fruchtbarkeit<br />
des Landes.<br />
Die «Kreuzzüge» der conquistadores<br />
hatten in Antigua<br />
zur Errichtung und Blüte<br />
von ca. 50 Kirchen und Klöstern<br />
(!) geführt. Heute sehen<br />
wir neben der nur teilweise<br />
wieder hergerichteten Kathedrale<br />
überall in der Stadt<br />
markante Zeugnisse alter<br />
Pracht: riesige Kirchenruinen<br />
immer wieder zwischen den<br />
kleinen nach spanischem<br />
Muster errichteten eingeschossigen<br />
Häuserzeilen. Der<br />
Vulkan Agua am Rande der<br />
Stadt hat bestimmt, dass die Häuser zu allermeist<br />
nur eingeschossig «erdbebensicher» gebaut<br />
sind. 1976 wurde die Stadt freilich erneut
Opfer eines verheerenden Erdbebens. Wie im<br />
Planquadrat am Reißtisch konzipiert, ist die<br />
Stadt nun längst zu einem Touristenzentrum,<br />
seit 1979 Weltkulturerbe der UNESCO, geworden.<br />
Und es zeichnet sich schon heute ab: Antigua<br />
ist eine wohlhabende Enklave in einem<br />
bitterarmen Land.<br />
Und was mir am ersten Tag noch aufgefallen<br />
ist:<br />
• eine wunderschöne Natur und Landschaft<br />
mit bunten Blütenbäumen;<br />
• die Fülle von Früchten auf dem großen<br />
bunten Markt;<br />
2<br />
• die Polizei private Sicherheitsleute als<br />
«kleine Jungens» überall mit Gewehr<br />
im Anschlag präsent;<br />
• die Mütter mit den kleinen Kindern auf<br />
den Armen sind selbst noch kleine Mädchen;<br />
• es gibt so viele Kinder auf den Straßen<br />
überall.<br />
Abschied in Antigua mit Blick von der Klosterruine<br />
über die Dächer der Stadt:<br />
Was wäre die Welt ohne die Entdeckung des<br />
Columbus ?<br />
Was wäre die Welt ohne Klöster ?
13. 02. 06: Antigua - Iximché - Santa Anita<br />
Salimos de Antigua hacia Iximche, la capital<br />
de los Kaqchikeles antes de la llegada de los<br />
españoles y escenario de la brutal conquista y<br />
aplastamiento de la resistencia quiché por Pedro<br />
de Alvarado. Las ruinas de Iximche en un<br />
paisaje apacible y bellísimo se presentan bien<br />
conservadas. Los paneles de información con<br />
ilustraciones facilitan el recorrido al visitante.<br />
Dentro del parque existen altares mayas: sencillos<br />
redondeles de cemento, con una pequeña<br />
concavidad en el centro donde la población<br />
indígena realiza sus ceremonias. Se<br />
ofrendan flores, frutos, productos de las cosechas<br />
y bebidas. Hay sacerdotes mayas. Todo<br />
ello, se inscribe en el marco de la política acordada<br />
en los Acuerdos de Paz de respetar y recuperar<br />
la cultura indígena.<br />
Sotero uno de los responsables de la conservación<br />
del parque arqueológico, pausado y<br />
competente, nos informa de las dificultades de<br />
su tarea. Por una parte, hay que combatir las<br />
plagas que atacan a los pinos; por otra, educar<br />
a la población para proteger el medioambiente<br />
porque la limpieza y cuidado del bosque son el<br />
mejor medio de frenar la invasión de los<br />
parásitos. Una vez desarrollada la enfermedad<br />
es la tala de los ejemplares afectados el único<br />
medio de impedir su propagación. En lo que<br />
respecta a la colaboración de la población, Sotero<br />
señala contradicciones como que la gente<br />
3<br />
se oponga, por una parte, a la tala de árboles<br />
y, por otra se abandonen descuidadamente basuras<br />
en el entorno. La municipalidad de<br />
Tecpan ha editado un sencillo folleto que informa<br />
con precisión sobre los mecanismos de<br />
propagación. También se han repartido bolsas<br />
para recoger la basura, pero hasta ahora los<br />
resultados dejan mucho que desear.<br />
En mi opinión, se plantea el reto de cómo lograr<br />
que la consideración de la naturaleza<br />
como sagrada en la cultura maya, se traduzca<br />
en una protección efectiva del medio ambiente.<br />
Para comer viajamos hasta el Restaurente El<br />
Pedregal, donde tomamos contacto con una<br />
cooperativa de tejedoras.<br />
Por la tarde llegamos a Santa Anita, la plantación<br />
de café propiedad (aunque muy hipotecada)<br />
de un grupo de exguerrilleros. La tierra<br />
olía divinamente y, en mi opinión, la cena fue<br />
sencilla pero fantástica. Nos alojamos en la<br />
antigua casa patronal, reconvertida en alojamiento<br />
turístico. La casa tiene posibilidades,<br />
aunque no debidamente explotadas, cara a<br />
implantarse como alojamiento de turismo rural<br />
que es lo que desean los dueños. La gente cordialísima.
14. 02. 06: Colomba, Santa Rosa, Santa Anita<br />
Kirchenzentrum Colomba<br />
Die Hähne auf der Finca Santa Anita wecken<br />
uns schon um 3 Uhr am Morgen zum ersten<br />
Mal. Nach einem wunderbaren Frühstück<br />
chauffiert uns Antonio nach Colomba in das<br />
dortige Kirchenzentrum. Wir werden zunächst<br />
von Schwester Armelina begrüsst, die uns das<br />
Gesundheitszentrum mit seinen Behandlungsräumen,<br />
der Apotheke und den zwei Büros<br />
zeigt. Im Vorraum warten Leute auf einer<br />
Bank, bis sie aufgerufen werden. Sie selbst ist<br />
zusammen mit einem Arzt für die Naturheilkunde<br />
zuständig. Die Apotheke ist öffentlich,<br />
d.h. Leute aus dem Ort können kommen und<br />
Medikamente einkaufen, allerdings muss vorher<br />
die Diagnose und Behandlungsart (ob Naturmedizin<br />
oder herkömmliche Medikamente)<br />
der PatientInnen geklärt sein. Ausserdem werden<br />
hier Kurse in Gesundheitserziehung und -<br />
aufklärung abgehalten. Ein Regal mit vielen<br />
getrockneten Kräutern unterschiedlicher Art<br />
hat mich sehr beeindruckt.<br />
Im Anschluss besuchen wir noch kurz die Kirche<br />
und treffen dort Padre Leoni, den zuständigen<br />
Pfarrer, der erst seit kurzer Zeit hier ist.<br />
Wir unterhalten uns mit ihm über den schwarzen<br />
Christus, der uns in einer Nische der Kirche<br />
aufgefallen ist. Die Kirche selbst ist erst<br />
ca. 50 Jahre alt und wirkt ziemlich nüchtern<br />
und kahl.<br />
Danach gehen wir zu Fuss zu einem weiteren<br />
Projekt, das durch die Initiative der Kirchengemeinde<br />
entstanden ist: in eine Bäckerei. Herrlicher<br />
Duft nach frischem Brot empfängt uns,<br />
und sehr fotogen steht eine der dort arbeiten-<br />
4<br />
den Frauen an einem Tisch und beginnt Teig<br />
für neues Brot zu mischen und zu kneten.<br />
Hermelinda und Isabel Perez, die beiden Frauen,<br />
berichten uns von dem Werdegang des<br />
Projekts. Der Vorschlag, mit dieser Arbeit zu<br />
beginnen, kam von Schwester Armelina, sie<br />
hatte die Idee, Brot, das mit Sojamehl zur<br />
besseren Eiweissversorgung angereichert ist,<br />
herzustellen.<br />
Drei Jahre dauerte die Einarbeitungsphase. In<br />
der ersten Zeit arbeiteten 30 Frauen in nur<br />
kurzen Schichten mit. Jetzt sind es noch fünf,<br />
diese arbeiten Vollzeit in Schichten. Die anderen<br />
sind ausgeschieden, da das Gehalt nicht<br />
ausreichte, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.<br />
Im Augenblick genehmigen sich die<br />
Frauen einen monatlichen Betrag von 200<br />
Quetzales. Einige Jugendliche, die von der Kirchengemeinde<br />
bezahlt werden, helfen ebenfalls<br />
mit. Gebacken wird pan frances, pan dulce<br />
und verschiedene Spezialbrötchen. Mittwochs<br />
wird mehr produziert, da an diesem Tag<br />
mehrere Frauen aus<br />
den umliegenden Dörfern<br />
in ihren Gemeinden<br />
Brot verkaufen und<br />
so einen kleinen Zwischengewinn<br />
für sich<br />
erwirtschaften können.<br />
Am Donnerstag wird<br />
nicht gebacken, da an<br />
diesem Tag die wöchentliche<br />
Teamsitzung<br />
stattfindet.<br />
Anfänglich waren sie in<br />
einem gemieteten<br />
Häuschen mit Backofen,<br />
das einem Bäcker<br />
gehört, untergebracht.<br />
Inzwischen konnten sie<br />
mit Hilfe einer Stiftung<br />
von ausserhalb dieses<br />
Haus erwerben. Verkauft<br />
wird in einem Laden im Ort, aber ob sie<br />
dort auf Dauer bleiben können, ist noch nicht<br />
gesichert. Das Restbrot wird gemahlen, mit<br />
Soja und Mais angereichert und als Grundstoff<br />
für ein Atol-ähnliches Getränk angeboten. In<br />
der ersten Zeit half das Büro im Gemeindezentrum<br />
bei der Buchhaltung, Einkäufen etc. Inzwischen<br />
arbeitet eine Frau dort und die Gruppe<br />
ist selbstständig. Im Anschluss an unseren<br />
Besuch bekommen wir noch einen wunderbaren<br />
Saft und dazu selbstgebackene Biskuitrolle<br />
angeboten.
Finca Santa Rosa<br />
Als Nächstes steht auf dem Programm ein Besuch<br />
auf der Finca Santa Rosa Nueva. Wir werden<br />
von mehreren Mitgliedern an einer langen<br />
Tafel zum Mittagessen empfangen. Herlindo<br />
Chamorro, der Vorsitzende der Junta Directiva,<br />
und die anderen Anwesenden berichten uns<br />
von den Problemen, die es hier gibt. 450 Familien<br />
mit ca. sieben Personen pro Familie leben<br />
hier seit 19 Jahren auf relativ kleiner Fläche.<br />
Sie wurden damals entlassen, weil sie eine<br />
Lohnerhöhung gefordert hatten.<br />
Gesetzlich ist festgelegt, dass jeder, der entlassen<br />
wird eine Wiedergutmachung bekommt.<br />
In ihrem Fall überliess der Finquero ihnen ein<br />
Stück Land, dessen Grösse sich jeweils nach<br />
der Dauer der Arbeitszeit richtete. Es ist jedoch<br />
so klein, dass die Familien nicht davon leben<br />
können. Die Kaffeekrise trug das ihrige<br />
dazu bei.<br />
So migrierte ein Teil der Arbeiter nach Mexiko.<br />
Doch auch dort ist das Gehalt niedrig, das Essen<br />
ist schlecht und die Arbeit ist nicht besser.<br />
Beschäftigung ausserhalb zu finden ist schwierig,<br />
es ist höchstens möglich, auf den Kartoffelplantagen<br />
in der Umgebung als Taglöhner<br />
etwas dazu zu verdienen. Einige arbeiten auf<br />
der bisherigen Finca, für 21 Q. pro Tag, aber<br />
ohne Sozialversicherung. Frauen verdienen die<br />
Hälfte, der staatlich<br />
festgelegte Mindestlohn<br />
beträgt 37 Q. GewerkschaftlicheOrganisation<br />
wird systematisch<br />
verhindert.<br />
Es gibt eine Schule, der<br />
Weg nach Colomba<br />
wäre für die Kinder zu<br />
weit und zu gefährlich.<br />
Unterstützung bekommen<br />
die Leute von der<br />
Kirchengemeinde in<br />
Colomba. Vor allem für<br />
die Frauen gibt es Ernährungsberatung<br />
und<br />
Nahrungsmittelhilfe, da<br />
viele Kinder unterernährt<br />
sind. Weiterbildungen,Impfprogramme<br />
und praktische Unterweisungen<br />
im Umgang mit Kindern und Jugendlichen<br />
finden ebenfalls statt. An diesen<br />
Programmen nehmen 30 Frauen teil. Ein Gesundheitszentrum<br />
gibt es nur in Colomba.<br />
Hebammen, die auch in Colomba ausgebildet<br />
werden, leben auf der Finca.<br />
Neben der katholischen Kirche gibt es hier elf<br />
5<br />
verschiedene evangelikale Sekten. Hier wurde<br />
uns deutlich, was diese «Kirchen» in Guatemala<br />
anrichten: Die Menschen reden nicht mehr<br />
miteinander, und es gibt durch diese Spaltungen<br />
in den Gemeinden viel Misstrauen und Gewalt.<br />
Eine Doktrin heisst: «Man darf sich nicht<br />
organisieren.» Heilung von Krankheiten erfolgt<br />
über das Gebet, nicht mit Hilfe eines Arztes.<br />
Die Prediger locken die Menschen erst mit Geschenken<br />
in die Kirchen und anschliessend,<br />
wenn sie Mitglieder sind, müssen sie den<br />
«Zehnten» bezahlen. Das einzig Gute mag<br />
vielleicht das Verbot sein, Alkohol zu konsumieren.<br />
Jedenfalls stellten wir fest, dass diese<br />
Sekten das fertig bringen, was die Conquista<br />
nicht geschafft hat: Sie spalten die Bevölkerung<br />
und verhindern das gemeinsame sich<br />
Wehren gegen Ungerechtigkeit und Repression.<br />
Im Anschluss besuchen wir noch die unterhalb<br />
liegende Finca La Rosaria Bola de Oro, bestaunen<br />
dort mit gemischten Gefühlen den Garten<br />
des Finqueros mit Schwimmbad, gepflegtem<br />
Rasen, die Anlage mit allerlei Früchten, z.B.<br />
Macadamianüssen, Riesenzitronen etc,. einem<br />
Teich und natürlich dem grossen Haus, in dem<br />
nur selten jemand wohnt. Gegenüber liegen<br />
die Minihäuser für die Fincaarbeiter und ihre<br />
Familien.<br />
Finca Santa Anita<br />
Nach der Rückkehr nach Santa Anita haben wir<br />
noch Gelegenheit, mit einer der Bewohnerinnen<br />
einen Gang durch die Pflanzungen zu einem<br />
Mirador zu machen und erfahren sowohl<br />
bei diesem Spaziergang als dann auch am<br />
Abend von Marconi und Clara etwas über die
Entstehung dieser Kooperative, und auch über<br />
die Visionen, die sie für die Zukunft haben.<br />
Etwa 130 ehemalige Guerilleros/-as fanden<br />
sich nach der Demobilisierung im Jahr 1998<br />
zusammen und beschlossen, sich gemeinsam<br />
auf einem Stück Land niederzulassen. Sie erwarben<br />
diese Finca, die seit acht Jahren nicht<br />
mehr bewirtschaftet wurde und entschieden<br />
sich dafür, hier biologischen Kaffee anzubauen.<br />
Gleichzeitig traten sie einer Organisation von<br />
kleinen Maya-ProduzentInnen bei.<br />
Die Finca kostete 2'063'000 Quetzales, sie ist<br />
1'500 Cuerdas (67'500 ha) gross. In den ersten<br />
fünf Jahren mussten keine Zinsen und<br />
auch keine Tilgung bezahlt werden, inzwischen<br />
sind jährlich 12% Zinsen fällig. Zunächst lief<br />
der Kaffeeexport über den fairen Handel gut.<br />
Inzwischen gibt es Probleme wegen der Kaffeekrise.<br />
Durch den Anbau von billigem und<br />
minderwertigem Kaffee in Vietnam, der den<br />
Weltmarkt überflutet, haben sich die Absatzmöglichkeiten<br />
verschlechtert, und an eine Tilgung<br />
des Darlehens ist im Augenblick nicht zu<br />
denken. Als nächstes droht das Schreckgespenst<br />
der Freihandelszone.<br />
Dazu kamen interne Probleme in der Gruppe.<br />
Zunächst bewirtschafteten alle das ganze Land<br />
gemeinsam. Mit der Zeit bekamen einige Mitglieder<br />
gut bezahlte Arbeit ausserhalb und<br />
pflegten das ihnen zugeteilte Land nicht mehr,<br />
d.h. andere mussten für sie arbeiten. Das<br />
führte zu Uneinigkeiten. Und vor allem durch<br />
ein Mitglied wurde erreicht, dass das ganze<br />
Land nach bestimmten Kriterien parzelliert<br />
wurde. Vermarktet wird weiterhin gemeinsam,<br />
aber jede Familie kann nun entscheiden, wie<br />
viel sie anbauen will. Uns schien diese Entwicklung<br />
der Anfang vom Ende zu sein. So<br />
6<br />
werden z.B. durch Vererbung die einzelnen<br />
Parzellen immer kleiner und es stellt sich die<br />
Frage, ob das ursprüngliche Gemeinschaftsprojekt<br />
nicht zum Scheitern verurteilt ist. Ausserdem<br />
müsste die Kaffeepflanzung dringend<br />
verjüngt werden, doch dazu fehlt das Kapital.<br />
Es gibt inzwischen Überlegungen, in den Anbau<br />
von Gemüse einzusteigen. Bananen werden<br />
für die Vermarktung im Inland angebaut,<br />
ausserdem züchten sie seit einiger Zeit einen<br />
Baum namens Palo blanco, der ein besonders<br />
hartes Holz liefert, das zur Herstellung von<br />
Möbeln und zum Hausbau geeignet ist.<br />
Ein weiterer Plan besteht darin, ein Ökotourismus<br />
-Projekt zu starten. Der Gedanke dabei<br />
ist, TouristInnen, die in Xela eine Sprachschule<br />
besuchen, zu einem Aufenthalt auf der Finca<br />
zu motivieren. Sie sollen das Leben hier kennen<br />
lernen, evtl. mitarbeiten, und in dem bis<br />
jetzt noch nicht optimal ausgestatteten Gästehaus<br />
untergebracht werden. Auch dieser Gedanke<br />
schien uns wegen der Abgelegenheit der<br />
Finca und dem schlechten Zufahrtsweg recht<br />
illusionär.<br />
Die Finca hat eine eigene Basisschule und seit<br />
zwei Jahren eine Sekundarschule. Es gibt einen<br />
Lehrer und eine Lehrerin. Im Kindergarten<br />
arbeiten zwei Mütter und eine Erzieherin. Ausserdem<br />
gibt es einen Gesundheitspromotor mit<br />
einer kleinen Apotheke und eine Tienda, in der<br />
das Notwendigste angeboten wird.<br />
Ich fühlte mich in den Tagen bzw. Nächten,<br />
abgesehen von einigen Magenproblemen,<br />
recht wohl und hätte gerne noch mehr Zeit gehabt,<br />
die Umgebung kennen zu lernen.<br />
-> E-Mail: cafeorgsantaanita@hotmail.com
15. 02. 06: Tecún Umán<br />
Casa de la Mujer, Bananenplantage, Casa del Migrante<br />
Casa de la Mujer<br />
Über die Ruta Pacífica, die Hauptverkehrsachse<br />
Mittelamerika/Mexiko/USA, gelangen wir nach<br />
Tecún Umán, der Grenzstadt zu Mexiko. Vorbei<br />
an Plantagen (Palmöl, Papaya, Mango, Tabak,<br />
Gummibäumen), aber auch an einer<br />
grossen Militäranlage, die düstere Erinnerungen<br />
an Verfolgung, Folter und Tod weckt, geht<br />
die Fahrt.<br />
In Tecún Umán besuchen wir als erstes die<br />
Casa de la Mujer, ein von Schwestern der Congregación<br />
Oblatas del Santisimo Redentor geleitetes<br />
und von der Caritas Schweiz unterstütztes<br />
Projekt. Hier werden Frauen, die auf<br />
dem Weg in die Migration in Tecún Umán gestrandet<br />
sind und ins Milieu der Prostitution zu<br />
gleiten drohen oder bereits geglitten sind, aufgenommen,<br />
unterstützt und betreut. Erste<br />
Kontakte mit diesen Frauen aus Nicaragua,<br />
Honduras, El Salvador und Guatemala werden<br />
von den Schwestern Angelica und Norma in<br />
der Stadt, in den Bars, in den entsprechenden<br />
Etablissements geknüpft. Behutsam wird Vertrauen<br />
aufgebaut und Beratung angeboten.<br />
Im Centro de Salud erhalten die Frauen Informationen<br />
und Unterstützung in gesundheitlichen<br />
Fragen, in der Vorsorge, werden über<br />
Aids und die gesundheitlichen Risiken auf der<br />
Strasse aufgeklärt. Im Centro de Capación<br />
werden die Frauen über ihre Rechte informiert<br />
(grundlegende Menschenrechte, Schutz von<br />
Minderjährigen, Misshandlungen, Ausbeutung),<br />
erhalten psychologische Unterstützung und<br />
sollen für ihre ganz persönliche Stärke und<br />
7<br />
Würde sensibilisiert werden. Dazu gehören<br />
auch die Ausbildungen, z.B. das Alphabetisierungsprogramm<br />
und die Ausbildung zur Coiffeuse<br />
oder Schneiderin, die das Zentrum den<br />
Frauen anbietet. Mit dem Verkauf selbsthergestellter<br />
Putzmittel wird zur Finanzierung etwas<br />
beigetragen.<br />
So gestärkt verlassen die Frauen das Zentrum<br />
nach durchschnittlich<br />
ein bis zwei Jahren,<br />
selbstbestimmter und<br />
freier als zuvor. Einige<br />
Frauen entschliessen<br />
sich für den Weg weiter<br />
in die Migration<br />
oder auch für den<br />
Weg zurück in die<br />
Prostitution. Für viele<br />
andere aber bedeutet<br />
der Weggang der Beginn<br />
eines neuen Lebens<br />
im Heimatland<br />
oder hier, mit einem<br />
Beruf, mit einem erstarktenSelbstbewusstsein<br />
und neuen<br />
inneren und äusseren<br />
Fähigkeiten.<br />
-> E-mail:casadelamujer@intelnett.com<br />
Bananen, Bananen<br />
Anschliessend folgt ein eindrücklicher Besuch<br />
in einer Bananenplantage, deren Bananen für<br />
Chiquita bestimmt sind. Nach ausgeklügeltem<br />
zeitlichem System werden die Bananenblüten<br />
nach dem Heranreifen von 5 bis 6 Bananenstauden<br />
abgeschnitten (55 Tage), die Bananenstauden<br />
gewaschen, nach Grösse und Güte<br />
aussortiert (Kompost, Viehfutter, Inland, Export),<br />
zur Reiferetardierung chemisch behandelt<br />
und in den bekannten Bananenschachteln<br />
verpackt. Diese Plantage exportiert vornehmlich<br />
in die USA, wo die Früchte in den Lagerhallen<br />
wiederum chemisch behandelt werden,<br />
um den Reifungsprozess erneut in Gang zu<br />
bringen.<br />
Die Arbeit in den Plantagen und in den Verarbeitungshallen<br />
ist anstrengend und intensiv.<br />
Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden angehalten,<br />
sich mit Schutzkleidern und Handschuhen<br />
vor den chemischen Zusätzen zu schützen,<br />
doch die Haut mancher Hand zeugt da-
von, dass die Umsetzung der Vorschriften nicht<br />
allzu genau genommen wird. Unter grossem<br />
Zeitdruck werden die Bananen aussortiert,<br />
gewogen und im Akkord in die Schachteln verpackt<br />
(18 kg pro Schachtel), in Lastwagen verladen<br />
und in Puerto Barrios und Puerto Quetzal<br />
verschifft.<br />
Casa del Migrante<br />
Autorität und Ausstrahlung ihres Leiters, Padre<br />
Ademar Barilli, prägen die Casa del Migrante.<br />
Nicht zuletzt diesem dem Orden der Scalabriner<br />
angehörenden Brasilianer ist es zu verdanken,<br />
dass die Casa del Migrante hier in Tecún<br />
Umán für die Migrantinnen und Migranten ganz<br />
Mittelamerikas zur Anlauf- und Beratungsstelle,<br />
aber auch zum Ort des Auftankens und kurzen<br />
Innehaltens geworden ist. Im Durchschnitt<br />
werden hier täglich bis zu 120 Menschen aufgenommen,<br />
betreut, über ihre Rechte aufgeklärt,<br />
über die Bedingungen, Gefahren und<br />
Aussichten ihres Migrationsweges informiert.<br />
Jetzt, wo sich Migration und Drogenhandel zu<br />
einem hochexplosiven Gemisch und lukrativem<br />
Geschäft verbinden, wo eine 8000 Mio. Dollar<br />
teure Mauer Migrationswillige abschrecken soll,<br />
ist die Casa oft letzter Zufluchtsort. Hier ist der<br />
Migrant, die Migrantin nicht illegal, sondern<br />
8<br />
papierlos, vor allem aber Mensch mit seiner<br />
unantastbaren Würde. Die MigrantInnen haben<br />
hier ein Dach über dem Kopf, erhalten medizinische<br />
und rechtliche Beratung und müssen<br />
nach spätestens drei Tagen ihren Weg, wohin<br />
er sie auch führen wird, weitergehen.<br />
Das Problem der Migration steht nicht wirklich<br />
auf der politischen Agenda mittelamerikanischer<br />
Staaten. Der Geldfluss, der durch die<br />
Exil-GuatemaltekInnen (12% der Bevölkerung)<br />
nach Guatemala zurückfliesst, ist für den guatemaltekischen<br />
Staat unverzichtbar. Somit ist<br />
es auch gar nicht in seinem Interesse, der<br />
Migration wirksame Massnahmen entgegenzusetzen.<br />
Auch wenn natürlich im Vorfeld des<br />
kurz vor Abschluss stehenden Freihandelsabkommens<br />
mit den USA das Gegenteil beteuert<br />
wird. In Wirklichkeit bedroht dieses unter anderem<br />
die Lebensgrundlagen der campesinos/as,<br />
die mit ihrer bescheidenen Maisproduktion<br />
den Maisexporten des nordamerikanischen<br />
Nachbarn kaum etwas entgegenzusetzen haben<br />
und in ihrem Überleben bedroht sind. Als<br />
möglicher, viel eher unmöglicher Ausweg bietet<br />
sich wiederum die Migration an.<br />
Padre Ademar’s Aufgabe wird nicht einfacher<br />
werden, seine Arbeit nicht weniger, sein Einsatz<br />
noch schwieriger.
16. 02. 06: Concepción Chiquirichapa und Quetzaltenango (CODECOT)<br />
Nach den Kaffeeplantagen von Santa Anita<br />
(700 m ü. M.) geht die Fahrt weiter in die<br />
Höhe, wo bis in die höchsten und steilsten Gebiete<br />
Kartoffeln, Zwiebeln und Kohl angepflanzt<br />
werden. Unser Ziel ist Concepción<br />
Chiquirichapa. Die Gemeinde von Concepción<br />
Chiquirichapa hat ca. 22'000 EinwohnerInnen.<br />
Viele BewohnerInnen emigrieren wegen mangelnder<br />
Verdienstmöglichkeiten.<br />
Der Zweck unseres Besuches ist, zu sehen,<br />
wie sich die Gemeinde von der Basis her organisiert.<br />
Diese Dynamik kam vor allem unter<br />
dem letzten Bürgermeister zustande. Der jetzige<br />
Bürgermeister scheint daran weniger interessiert<br />
zu sein.<br />
Wir werden von Felix Cabrera, Präsident und<br />
Koordinator des kommunalen Radios, auf dem<br />
Marktplatz empfangen. In einem kleinen, kargen<br />
Raum der Radiostation treffen wir VertreterInnen<br />
von verschiedenen lokalen Organisationen,<br />
welche uns ihre Aktivitäten vorstellen.<br />
Kinderrat: Der Kinderrat (Consejo Municipal<br />
Infantil) ist wie ein Verein organisiert. Er wurde<br />
von CEIBA, einer kirchlichen Organisation,<br />
gegründet, welche die Lehrerinnen motivierte,<br />
mit den SchülerInnen verschiedene Themen<br />
(Drogen, Armut, etc.) anzusprechen. Aus dieser<br />
Initiative entstand der Kinderrat, welcher<br />
soziale und sportliche Aktivitäten organisiert.<br />
Der Rat strukturiert sich selber und wird vom<br />
Kinderbürgermeister geleitet. Der «offizielle»<br />
Bürgermeister gibt finanzielle, logistische und<br />
moralische Unterstützung.<br />
Kredit-Kooperative: Die Kooperative ist eine<br />
Organisation, welche den gegenwärtig 800<br />
Mitgliedern aus «Conce» und den umliegenden<br />
Dörfern ermöglicht, ihr Geld in einer Sparkasse<br />
anzulegen und Kleinkredite zu beziehen. Darlehen<br />
können z.B. für Saatgut zu einem Zinssatz<br />
von 1% (Banken 9%) bezogen und nach<br />
der Ernte rückerstattet werden. Das Startkapital<br />
kam von einer anderen Organisation. Heute<br />
ist die Kooperative aber schuldenfrei und<br />
selbsttragend. Für eine Ausweitung ihrer Aktivitäten<br />
wäre sie allerdings froh um mehr<br />
Fremdkapital.<br />
Das Eigenkapital besteht aus den jährlichen<br />
Beiträgen der Mitglieder (socios). Die Darlehenshöhe<br />
hängt von der möglichen Garantie<br />
(Haus, Land, etc.) ab. Dieses Modell der<br />
Selbsthilfe im Bereich Mikrokredite scheint gut<br />
zu funktionieren.<br />
Frauenkomitee: Das Frauenkomitee ist eine<br />
9<br />
private Organisation, die noch keinen Rechtsstatus<br />
hat und deshalb noch keine Projekte<br />
einreichen kann. Es wurde auf Initiative des<br />
vorherigen Bürgermeisters 2001 gegründet.<br />
Die 35 Mitglieder sind ausschliesslich Maya-<br />
Frauen. Sie werden von einer Junta Directiva<br />
(Vorstand) geleitet und organisieren mit finanzieller<br />
Unterstützung anderer Organisationen<br />
Workshops, talleres, über verschiedene relevante<br />
Themen wie Gender, Gewalt gegen Frauen,<br />
innerfamiliäre Gewalt etc. und organisieren<br />
an Weihnachten, am internationalen Tag der<br />
Frau und am Muttertag öffentliche Veranstaltungen.<br />
Das Komitee ist sehr engagiert, hat aber trotzdem<br />
Schwierigkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen.<br />
Viele Frauen wohnen zu weit weg und<br />
können die Transportkosten nicht bezahlen.<br />
Die Ehemänner sind oft gegen eine Teilnahme,<br />
weil sie nicht akzeptieren wollen, dass sich die<br />
Frauen organisieren. Aber auch viele Frauen<br />
leben weiterhin im hergebrachten Rollenverhalten<br />
und wollen deshalb nicht mitmachen.<br />
Das Komitee ist aber zuversichtlich, dass sich<br />
mit ständiger Überzeugungsarbeit die Aktivitäten<br />
ausweiten lassen.<br />
Komitee für die Verbesserung der Infrastruktur<br />
der Gemeinde: Dieses Komitee<br />
besteht aus Freiwilligen, welche sich alle Mühe<br />
geben, gefährdete Infrastrukturen in Stand zu<br />
halten (z.B. Reparatur von Wasserleitungen<br />
nach dem Wirbelsturm Stan). Allerdings erhält<br />
es von der neuen Gemeinderegierung im Gegensatz<br />
zu früher keine finanzielle Unterstützung<br />
und es findet keine Zusammenarbeit<br />
statt. Lediglich das Material wird von einer Regierungsorganisation<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Umweltschutz-Komitee: Dieses Komitee beschäftigt<br />
sich mit Umweltfragen innerhalb der<br />
Gemeinde. Seine Aufgabe sind Aufforstung<br />
und Schutz der Wälder, Schutz der Wasserquellen<br />
und Schutz der altares mayas, den<br />
heiligen Orten der Maya in den Wäldern. Das<br />
Komitee wird von Helvetas unterstützt. Verschiedene<br />
Anwesende sind allerdings der Meinung,<br />
dass es seine Aufgaben nur ungenügend<br />
wahrnimmt.<br />
Lokalradio: Felix Cabrera hat dieses Radio<br />
vor fünf Jahren (mit-)gegründet und koordiniert<br />
das Programm. Es hat zwar keine Radiokonzession,<br />
sendet aber täglich von 5 bis 21<br />
Uhr in Spanisch und Mam. Früher wurde die<br />
Infrastruktur durch die Gemeinde zur Verfügung<br />
gestellt. Heute muss alles selber finan-
ziert werden, was sehr schwierig ist. Das Personal,<br />
auch die SprecherInnen, arbeitet ohne<br />
Salär. Strom, Licht und Telefon können kaum<br />
von der gelegentlichen Werbung bezahlt werden.<br />
Dank der intensiven Zusammenarbeit mit<br />
NGOs können aber die Programme im Bereich<br />
Ausbildung, Gesundheit, Umwelt und Kulturelles<br />
aufrechterhalten werden. Die News und andere<br />
Informationen werden im Internet gesucht.<br />
Schlussfolgerung: Dank dem aufgeschlossenen,<br />
früheren Gemeinderat entstand eine sehr<br />
interessante und ermutigende Dynamik der<br />
«Organisation von unten». Allerdings unterstützt<br />
der heutige Gemeinderat die Komitees<br />
nur zögerlich oder gar nicht mehr und scheint<br />
sich über die Bedürfnisse der Gemeinde hinweg<br />
zu setzen, um eigene Interessen zu verfolgen.<br />
Die Leute geben sich darüber Rechenschaft<br />
und hoffen, dass sich bei den nächsten<br />
Wahlen wieder einiges ändern wird. Fazit: Ein<br />
spannender Ansatz, der heute dank dem Engagement<br />
Einzelner noch weiterlebt, aber eine<br />
politische Änderung braucht, um wirklich erfolgreich<br />
zu sein. Wir haben den Eindruck,<br />
dass der herzliche Empfang und das offene<br />
Gespräch ein Zeichen war, dass die Menschen,<br />
die sich für das Gemeinwohl einsetzen, unseren<br />
Besuch geschätzt haben und darin einen<br />
«Kontakt nach aussen» und Solidarität sehen.<br />
Am Mittag geht es weiter von Concepción Chiquirichapa<br />
nach Quetzaltenango. Uns interessiert<br />
insbesondere das Zentrum der<br />
CODECOT (Coordinadora Departemental<br />
de Comadronas Tradicionales), dem<br />
Koordinationszentrum der indigenen<br />
Hebammen. Wir werden von der Junta<br />
Directiva in ihren traditionellen Trachten<br />
wie alte Bekannte herzlichst empfangen<br />
und gleich mit einem exquisiten<br />
Mittagsmahl verwöhnt. Diese traditionellen<br />
Hebammen leben in und mit der<br />
Bevölkerung, haben ein grosses, jahrhundertealtes<br />
Wissen und begleiten<br />
80% der schwangeren Frauen mit ihren<br />
Neugeborenen vor, während und nach<br />
der Geburt. CODECOT wurde im Jahr<br />
2000 gegründet. Sie möchte den traditionellen<br />
Hebammen eine Plattform zu geben, um ihre<br />
professionelle, soziale und kulturelle Kompetenz<br />
zu valorisieren. Das Gesundheitssystem<br />
marginalisierte die traditionellen Hebammen.<br />
Sie wurden nicht anerkannt, nicht entlöhnt<br />
und in den Institutionen des Gesundheitswesens<br />
diskriminiert. Ihnen wurde unter anderem<br />
die hohe Kindersterblichkeit zu Last gelegt.<br />
Deshalb wuchs die Überzeugung, dass<br />
10<br />
nur mit staatlicher Anerkennung und guter<br />
Ausbildung, welche neben der traditionellen<br />
auch die moderne Geburtshilfe miteinbezieht,<br />
der wichtige Beruf der traditionellen Hebamme<br />
gerettet werden kann.<br />
Mit Unterstützung der «Centrale Sanitaire Suisse»<br />
und dem «Global Fund for Women» begann<br />
die CODECOT, ihren Mitgliedern Weiterbildungskurse<br />
zu offerieren. 2004 wurde der<br />
erste Kurs, dem weitere folgten, erfolgreich<br />
mit der «Promotion» abgeschlossen. 2004<br />
wurde diese Anstrengung insofern honoriert,<br />
als CODECOT die Anerkenung der Regierung<br />
erhielt und nun offiziell Hebammen ausbilden<br />
kann, welche in traditioneller und moderner<br />
Geburtshilfe ausgebildet werden. Der Lehrplan<br />
ist mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen.<br />
Das nächste Projekt ist nun der Bau einer<br />
Schule von Hebammen für Hebammen. Die<br />
Gemeinde hat dazu ein Terrain zur Nutzung<br />
während 25 Jahren zur Verfügung gestellt. Allerdings<br />
müssen sie den Bau innert zweier Jahre<br />
erstellen. Mit dem Gesundheitsministerium<br />
wird bereits über die Anerkennung der Schule<br />
verhandelt.<br />
Die offene, engagierte und herzliche Diskussion<br />
beweist uns, dass das ganze Projekt mit<br />
viel Engagement, Kraft und Überzeugung vorangetrieben<br />
wird. Es ist durchaus möglich,<br />
dass dieses Projekt dank der Persönlichkeit<br />
und der Hartnäckigkeit der führenden Hebam-<br />
men der CODECOT zu einem Erfolg wird und<br />
der für den kulturellen Zusammenhang so<br />
wichtige Beruf der traditionellen Hebamme<br />
eine neue Bedeutung erhalten wird.<br />
Wir würden gerne noch weiter diskutieren.<br />
Aber die vorgerückte Stunde erlaubt uns nur<br />
noch, unseren Gastgebern ein Geschenk in<br />
Form eines Modells eines weiblichen Beckens<br />
zu übergeben.<br />
-> E-mail: codecot@intelnett.com
18. 02. 06: Maisfest San Rafael, San Antonio Sacatepequez,<br />
REMHI San Marcos<br />
Maisfest San Rafael<br />
Von Xela aus starten wir am Morgen in Richtung<br />
San Rafael. Wir sind dort zu einem traditionellen<br />
Maisaussaatfest, das immer im Februar<br />
gefeiert wird, eingeladen. Die eigentliche<br />
Aussaat findet einige Wochen später, zum Beginn<br />
der Regenzeit statt. Dieses Fest wird nach<br />
einer alten Mayatradition, die vermischt ist mit<br />
christlichen Werten, gefeiert. Wir kommen an,<br />
auf dem Platz vor der Kirche haben sich schon<br />
viele Indígenas in wunderschönen Trachten<br />
versammelt und es beginnt ein Ritus, der alle<br />
Sinne anspricht. Man muss ihn erlebt haben:<br />
die Farben, das Räuchern, das Tanzen, die Musik,<br />
das Explodieren der Knallkörper, der Ernst,<br />
mit dem die Menschen dabei sind und gleichzeitig<br />
ihre Fröhlichkeit<br />
und schliesslich<br />
das Essen.<br />
Wir werden lautstark<br />
durch das Mikrofon<br />
von allen wichtigen<br />
Mitgliedern der Kirchengemeinde<br />
und<br />
des Kirchenvorstandes<br />
begrüsst. An der<br />
Kirchenwand ist ein<br />
Altar mit vielen Blumen<br />
aufgebaut, auf<br />
dem Boden wie ein<br />
Mandala ebenfalls<br />
ein Altar, der für die<br />
Mayas eine besonders<br />
zentrale Bedeutung<br />
hat. Dort liegen<br />
die Maiskolben in ihren<br />
verschiedenen<br />
Farben: weiss, gelb,<br />
11<br />
rot und schwarz und daneben Kerzen in den<br />
entsprechenden Farben. Sie haben eine wichtige<br />
symbolische Bedeutung: weiss ist die Farbe<br />
des Nordens, ein Symbol für die Luft, den<br />
Geist, die menschlichen Knochen, die weisse<br />
Rasse. Gelb ist das Symbol des Südens und<br />
des Wassers, die Farbe der menschlichen Haut,<br />
Symbol für die Hoffnung auf Nahrung und die<br />
gelbe Rasse. Rot steht für den Osten,<br />
den Sonnenaufgang, das Feuer, das<br />
menschliche Blut, den Beginn des Lebens<br />
und die rote Rasse. Schwarz bedeutet<br />
den Westen, die Erde, den Sonnenuntergang,<br />
das menschliche Haar,<br />
den Beginn der Nacht, die Ruhe, die<br />
schwarze Rasse. Ein Teil der Maiskolben<br />
ist als Puppen angekleidet. In der<br />
Mitte liegen blaue und grüne Kerzen,<br />
sie sind das Zentrum: grün ist die Natur,<br />
die Mutter Erde und die Fruchtbarkeit,<br />
blau ist die Farbe des Himmels,<br />
das Symbol für den Vatergott und die<br />
Transzendenz. Auch dieser Altar ist mit<br />
Blumen geschmückt. Ausserdem stehen<br />
Tonfiguren da, die Indígenas darstellen.<br />
Die Zeremonie beginnt mit Gebeten und Dank<br />
an die gesamte Schöpfung, mit Verneigungen<br />
nach allen Himmelsrichtungen und der Aussage:<br />
«Wir kommen aus dem Mais und wir sind<br />
der Mais» aus dem Schöpfungsmythos der Mayas.<br />
Von grosser Bedeutung ist auch die Einheit<br />
des Männlichen und Weiblichen. Und immer<br />
wieder wird geknallt.
Dann beginnt der Tanz: eine Frau und ein<br />
Mann tanzen mit kleinen Schritten, in der<br />
Hand je eine Maispuppe, im Rhythmus der Marimbamusik,<br />
sie tanzen nebeneinander und<br />
aufeinander zu, bis dann ein zweites Paar genauso<br />
tanzend die Fläche betritt. Weitere Paare<br />
kommen dazu, Kinder und Jugendliche und<br />
schliesslich ist die Tanzfläche voll und auch wir<br />
werden aufgefordert, teilzunehmen. Einige<br />
Tanzende stellen während des Tanzens mimisch<br />
die Arbeit auf dem Feld (Hacken, Ernten<br />
etc.) oder auch im Haus (z.B das Backen von<br />
Tortillas) dar.<br />
Nachdem die Zeremonie zu Ende ist, werden<br />
wir in die Kirche an eine lange Tafel zu einer<br />
wunderbaren Suppe, einem Caldo de Res, mit<br />
Tamales eingeladen, die die Frauen inzwischen<br />
zubereitet haben.<br />
Wir verabschieden uns und machen noch einen<br />
kurzen Abstecher auf den Friedhof. Pfarrer Toribido<br />
Pineda von der Diözese San Marcos begleitet<br />
uns und beantwortet unsere Fragen zur<br />
Bestattungskultur und zu den Farben auf den<br />
Friedhöfen hier im Land, die uns während der<br />
bisherigen Reise aufgefallen sind. Offenbar<br />
sind sie aber ohne besondere Bedeutung. Oft<br />
findet die Beerdigung mit einem Katecheten<br />
auf dem Friedhof statt, in der Kirche wird eine<br />
Messe gelesen. Die Solidarität mit der betroffenen<br />
Familie in der Gemeinde ist gross, es<br />
gibt Geschenke, damit das Grab finanziert<br />
werden kann. Die Beerdigung muss nach Gesetz<br />
innerhalb von 24 Stunden stattfinden. An<br />
Allerheiligen wird auf den Friedhöfen ein grosses<br />
Fest mit Essen und Trinken auch für die<br />
Verstorbenen gefeiert. Die Trauerfarbe ist<br />
schwarz oder weiss.<br />
12<br />
Gesundheitszentrum in San Antonio Sacatepequez<br />
Maricarmen, die selbst als Ausbilderin im Zentrum<br />
arbeitet, und bei der auch Toni gelernt<br />
hat, begrüsst uns. Sie führt uns durch die bisherigen<br />
und vor allem durch die neuen Räume,<br />
die mit Hilfe von Spenden der Gruppe der<br />
letztjährigen Reise mitfinanziert werden konnten.<br />
Es sind Schlafräume, Duschen und Toiletten,<br />
die neu gebaut werden konnten. So wurde<br />
ermöglicht, dass die Gruppen, die ihre Ausbildung<br />
in Naturmedizin machen, hier im Haus<br />
wohnen können. Unten im Haus gibt es einen<br />
Versammlungsraum, in dem auch Konferenzen<br />
stattfinden. Es gibt unterschiedliche Kursangebote,<br />
die Kurse in Naturmedizin werden vor allem<br />
von Frauen besucht. Angeboten werden<br />
verschiedene alternative Therapien: Homöopathie,<br />
Bachblüten, Kinesiologie, Urintherapie,<br />
Reiki, Pflanzenheilkunde, Therapie<br />
mit Umschlägen usw.<br />
Viele der angewandten Therapien<br />
stammen aus der Mayatradition,<br />
z.B. die Energiearbeit.<br />
Das Zentrum soll für die PatientInnen<br />
ökonomisch gut zugänglich<br />
sein. Wer rasche Hilfe<br />
benötigt, z.B. mit Aspirin, kann<br />
auch das erhalten. Die am<br />
häufigsten vorkommenden<br />
Krankheiten sind:<br />
Atemwegsinfekte, Störungen<br />
im Magen-Darmtrakt, Arthritis,<br />
Hautkrankheiten und Diabetes.<br />
Diese Naturmedizin, die inzwischen<br />
auch öffentlich anerkannt<br />
ist, soll sich möglichst<br />
selbst finanzieren. Die Kurse<br />
sind kostenlos, für mehrtägige<br />
Kurse kann bei der Diözese San Marcos ein<br />
Stipendium beantragt werden. Das Startkapital<br />
kam von aussen, es reichte für 18 Mitarbeiter-<br />
Innen. Das Gehalt für eine Stunde beträgt<br />
6,50 Q. Die MitarbeiterInnen sind nicht fest<br />
angestellt.<br />
Auf die Frage, woher die Kräuter bezogen werden,<br />
berichtet uns Maricarmen, dass sie zum<br />
Teil selbst gesammelt oder angepflanzt würden,<br />
der Rest werde zugekauft. Das Zentrum<br />
soll auch für andere Gruppen offen sein. Wir<br />
erfahren vom Pfarrer, dass hier auch KatechetInnen<br />
ausgebildet werden. Ausserdem gibt es<br />
die Möglichkeit, eine Schreinerlehre zu machen<br />
oder Schneiderin zu werden.<br />
Ein Kaffee mit Gebäck im Pfarrhaus stärkt uns<br />
für den weiteren Verlauf des Tages und beim
Abfahren entdecken wir jede Menge Ringelblumen<br />
auf dem Platz vor der Kirche. Ob sie wohl<br />
geerntet und verarbeitet werden?<br />
San Marcos: REMHI<br />
Nach diesem ereignisreichen Tag besuchen uns<br />
am Abend im Hotel in San Marcos noch der<br />
Leiter des Büros von REMHI (San Marcos), Rodolfo<br />
Godínez und ein Mitarbeiter namens Oscar<br />
und erzählen uns von ihrer Arbeit im hiesigen<br />
Departement.<br />
REMHI bedeutet Recuperación de la Memoria<br />
Histórica, das heisst auf deutsch «Wiedererlangung<br />
des historischen Gedächtnisses». Es<br />
handelt sich um ein Projekt, das 1994 nach<br />
dem Abkommen über die Menschenrechte in<br />
Oslo von Bischof Gerardi initiiert wurde. Seine<br />
Idee war, der Bevölkerung zu ermöglichen,<br />
sich an ihre Geschichte zu erinnern und sie so<br />
aufzuarbeiten, denn «Ein Volk, das seine Geschichte<br />
vergisst, ist dazu verdammt, die Geschichte<br />
zu wiederholen.» Er gründete die sogenannte<br />
Wahrheitskommission und begann,<br />
die Bevölkerung über Plakate und durch das<br />
Radio über das Ziel des Projektes aufzuklären.<br />
Die Hälfte der Gemeinden im Bereich San Marcos<br />
wollten sich zunächst nicht mit der Sache<br />
befassen, sie hatten keinen Mut und fürchteten<br />
um ihre KatechetInnen, da noch lange nicht<br />
klar war, wie stabil der bisherige Friede war.<br />
In der ersten Phase des Projekts wurden die<br />
KatechetInnen ausgebildet. Sie wurden über<br />
die Inhalte der Friedensabkommen, die Rolle<br />
der katholischen Kirche und die Ursachen der<br />
Konflikte in der Vergangenheit aufgeklärt. Sie<br />
lernten, Interviews zu führen und mit Hilfe von<br />
psychologischer Begleitung zu ertragen, was<br />
die Menschen ihnen erzählten. Daran beteiligten<br />
sich 40 Männer und Frauen.<br />
In der zweiten Phase gingen diese ausgebildeten<br />
Menschen zu den Betroffenen und versuchten<br />
dort, einen Rahmen des Vertrauens zu<br />
schaffen und deren Ängste zu überwinden,<br />
denn keiner traute dem anderen mehr. Der Zugang<br />
zu den Frauen war offenbar leichter,<br />
denn 80% der Berichte stammen von Frauen.<br />
Das Kernstück des Projekts sind die sog. Testimonios,<br />
diese waren oft sehr schmerzhaft für<br />
die Menschen, sie benötigten sehr viel Zeit,<br />
Zeit zum Reden, Zeit zum Weinen, aber es war<br />
auch eine Befreiung, endlich über alles sprechen<br />
zu können, oft nach mehr als zehn Jahren.<br />
Alle Interviews wurden gesammelt, in das<br />
Büro des Erzbischofs gebracht und dort zu<br />
dem Bericht Guatemala Nunca Más zusammengefügt.<br />
Am 24.5.1998 wurde der Bericht<br />
der Öffentlichkeit vorgestellt und keine 50<br />
13<br />
Stunden später wurde Bischof Gerardi ermordet.<br />
In der Hauptstadt gibt es inzwischen eine<br />
Gedenkstätte für ihn, im April ist ein Gedächtnismarsch<br />
für Gerardi geplant.<br />
Die Ermordung Gerardis bedeutete zunächst<br />
einen Stopp für das gesamte Projekt, die alten<br />
Ängste tauchten wieder auf. Doch die Diözese<br />
San Marcos führte trotzdem ihre Arbeit fort.<br />
Inzwischen sind vier Bände mit unterschiedlichen<br />
Titeln und Themen erschienen, ausserdem<br />
gibt es eine populäre Version mit vielen<br />
Bildern, die wir auch für uns erwerben konnten.<br />
Als nächster Wunsch kam aus der Bevölkerung<br />
die Bitte um die Exhumierung der Toten. Für<br />
die Mayas haben der Tod und der Ort der Bestattung<br />
eine grosse Bedeutung. Durch die Ermordungen<br />
war der Zyklus Geburt – Tod unterbrochen<br />
worden, denn oft wurden die Toten<br />
entweder von den Angehörigen oder vom Militär<br />
ohne Ritus ganz schnell in Massengräbern<br />
verscharrt .<br />
Der Bischof der Diözese, Alvaro Ramazzini,<br />
fördert das Projekt mit viel Mut und Engagement.<br />
Er hat viele Auslandkontakte, dadurch<br />
wird es auch finanzierbar. In den Kirchengemeinden<br />
werden weiterhin AnimatorInnen ausgebildet,<br />
die ihr Wissen weitergeben sollen und<br />
können.<br />
Die Regierung versucht immer wieder, das Projekt<br />
zu stoppen. Die Opfer werden immer älter<br />
und eine Wiedergutmachung, die auch gefordert<br />
wird, kann evtl. nicht mehr stattfinden,<br />
weil sich alles in die Länge zieht. Doch es gibt<br />
auch immer wieder positive Prozesse, die Mut<br />
machen, fortzufahren. Mit Schulen wird zusammengearbeitet,<br />
so erfahren die Kinder die<br />
Geschichte ihrer Eltern und die Vergangenheit<br />
wird nicht vergessen. Gruppen, die sich gebildet<br />
haben, versuchen, einen legalen Status zu<br />
erreichen, um so den Zugang zu Geldern zu<br />
bekommen.<br />
Inzwischen ist der Hauptbereich ihrer Arbeit<br />
die Exhumierung. Deren Finanzierung ist problematisch,<br />
denn die psychologische Begleitung<br />
der Betroffenen und die Beerdigungen sind<br />
teuer. Und immer wieder gibt es noch neue<br />
Testimonios.<br />
Unsrerseits gibt es noch verschiedene Fragen,<br />
zum Beispiel:<br />
Welche war die Rolle der Kirche während des<br />
Prozesses? – Sie stand offenbar auf der Seite<br />
der Verfolgten, beeinflusst von der Befreiungstheologie.<br />
Das war auch der Grund dafür, dass<br />
die KatechetInnen verfolgt und bedroht wurden.
Wie steht es mit der Entschuldigung der Verantwortlichen?<br />
– Die Justiz ist langsam und<br />
blind. Ríos Montt hat 440 Dörfer ausradiert,<br />
hier in der Nähe wurden in einem Dorf in einer<br />
Nacht 47 Menschen massakriert. Eine Entschuldigung<br />
dafür gibt es bis heute nicht. Es<br />
gibt auch keinen Willen, das Geschehene als<br />
Genozid anzuerkennen. Wohl gab es in Rabinal<br />
eine Pseudoentschuldigung vom derzeitigen<br />
Präsidenten Berger, aber das Volk will mehr:<br />
eine echte Entschuldigung und eine Wiedergutmachung.<br />
Wer sind die politischen Verbündeten des Projekts?<br />
– Das sind auf jeden Fall die Menschenrechtsorganisationen.<br />
Manchmal scheint auch<br />
der Kongress zu helfen, was jedoch den Hintergrund<br />
hat, bei der Bevölkerung gut dazustehen,<br />
um Wählerstimmen zu bekommen.<br />
Viele, die sich zunächst für die Arbeit einsetzten,<br />
liessen die Menschen allein, in dem Moment,<br />
als sie einen offiziellen Posten bekamen.<br />
Bestes Beispiel dafür ist Rigoberta Menchú: Als<br />
Präsidentin der staatlichen Menschenrechtsorganisation<br />
hat sie ihre Landsleute verraten und<br />
alleine gelassen.<br />
Weshalb wählen noch so viele Ríos Montt? – Es<br />
ist die historische Amnesie, die chronische Vergesslichkeit<br />
der Menschen. Als er regierte, gab<br />
es feste Gesetze, heute herrscht ein quasi gesetzloser<br />
Zustand im Land. Die Menschen hoffen<br />
in dieser Hinsicht auf eine Veränderung,<br />
können aber die Zusammenhänge nicht herstellen.<br />
Ausserdem ist er eine starke Führerpersönlichkeit<br />
mit einer klaren Strategie, die er<br />
seit Jahren verfolgt. Er sorgt für seinen politischen<br />
Nachwuchs, was die anderen Parteien so<br />
nicht machen. Z.B. hat er seine Tochter in die<br />
politische Szene eingeführt. Hier in San Marcos<br />
wurde während der letzten Wahlen viel Bewusstseinsarbeit<br />
gemacht, dadurch war das<br />
Wahlergebnis ordentlich. Im Quiché war das so<br />
nicht möglich, da durch den Mord von Gerardi<br />
die Arbeit gestoppt wurde, und so bekam die<br />
FRG viele Wählerstimmen. Und schliesslich<br />
gibt es keine Partei im Land, die wirklich das<br />
Volk vertritt, auch das ist ein wesentlicher<br />
Grund für diese Wahlergebnisse.<br />
Müde nach diesem ereignisreichen Tag mit so<br />
unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen<br />
gehen wir zu Bett.<br />
14
19. 02. 06: San Marcos – Las Delicias (MTC)<br />
An diesem sonnigen Morgen empfangen uns<br />
Ana und Fernando, die als spanische LaienmissionarInnen<br />
in der technischen Equipe des Movimiento<br />
de Trabajadores Campesinos (MTC)<br />
tätig sind, in ihrem Büro in San Marcos für<br />
ein ausführliches Briefing.<br />
Das MTC will die ArbeiterInnen im Altiplano<br />
und in den Fincas stärken und sie unterstützen,<br />
wenn sie ihre Rechte einfordern. Das Ziel<br />
ist die integrale menschliche und soziale Entwicklung.<br />
Die Bewegung hat rund 2000 Mitglieder,<br />
zum grösseren Teil Frauen (weil die<br />
Frauen, deren Männer als Emigranten in den<br />
USA arbeiten, sehr aktiv sind).<br />
Das Departement San Marcos war nebst<br />
Quiché am stärksten vom Krieg betroffen. San<br />
Marcos ist die ärmste Gegend Guatemalas;<br />
das Gebiet liegt isoliert und weit entfernt von<br />
der Hauptstadt. Das Land im Altiplano ist karg<br />
und reicht nur für Subsistenzwirtschaft (Mais,<br />
Kartoffeln und Getreide für die Selbstversorgung).<br />
Viele Indígenas müssen deshalb zur<br />
Kaffeeerntezeit als temporäre ArbeiterInnen,<br />
so genannte Eventuales, auf den Fincas in der<br />
Bocacosta arbeiten, oft mit ihren ganzen Familien<br />
(das bedeutet, dass die Kinder das Schuljahr<br />
nicht beenden können). Die «Colones»<br />
hingegen sind fest angestellte ArbeiterInnen,<br />
die ständig auf den Fincas leben. Das Land der<br />
Bocacosta ist sehr fruchtbar, praktisch ausnahmslos<br />
in Grossgrundbesitz. Ganz selten besitzen<br />
die Einheimischen eigenes Land. Die<br />
Finqueros sind meist Leute aus dem Ausland,<br />
die hier ihr Vermögen gemacht haben, Nachkommen<br />
von Deutschen und Spaniern, heute<br />
naturalisierte GuatemaltekInnen mit mittelalterlichen<br />
Vorstellungen von Landbesitz und<br />
dem Umgang mit Angestellten. Die Finqueros<br />
sind nicht nur die Besitzer des Landes, sondern<br />
auch der Leute, die sie wie Sklaven halten.<br />
Dazu kommt der Rassismus: Die Indígenas<br />
werden als minderwertige Menschen betrachtet<br />
und behandelt.<br />
Das der Diözese San Marcos angegliederte<br />
Technische Büro des MTC arbeitet in den fünf<br />
Bereichen Indigenes Recht, lokale Machtverhältnisse,<br />
Zugang zu Land, Arbeitsrecht und<br />
Suche nach solidarischer Ökonomie. Der bisherige<br />
Schwerpunkt der Tätigkeit lag in der<br />
Stärkung der lokalen Führer und im Arbeitsrecht.<br />
Zurzeit arbeiten sie mit Leuten von sieben<br />
Fincas; in zwei Fincas werden Protestaktionen<br />
durchgeführt. Es geht um ungerechtfertigte<br />
Entlassungen, Mindestlöhne und endlose<br />
Reihen von Menschenrechtsverletzungen.<br />
Das Justizwesen ist blind und langsam, Prozes-<br />
15<br />
se ziehen sich über Jahre hin, und der Gewinn<br />
eines Prozesses bedeutet noch lange nicht,<br />
dass das gerichtlich zugesprochene Recht auch<br />
durchsetzbar ist. Während dieser Zeit sind die<br />
Leute in total ungesicherter Situation, ohne<br />
Geld. Ein Recht auf Bezahlung haben sie ohnehin<br />
nur dann, wenn sie auf der Finca wohnen<br />
bleiben. Die Situation ist vergleichbar mit derjenigen<br />
der Minenarbeiter. Ana ist überzeugt,<br />
dass die Menschenrechte nicht eingehalten<br />
werden können, solange das Finquero-System<br />
existiert. Die Fincas und alles, was sich darauf<br />
befindet, also auch die Schule und der Gesundheitsposten,<br />
sind Privatbesitz. Deshalb<br />
werden die sozialen Rechte hier kontinuierlich<br />
verletzt. Guatemala werde wirtschaftlich gesehen<br />
von 20 Familien regiert: Sie besitzen Fabriken,<br />
Plantagen, Fincas und würden von den<br />
Freihandelsabkommen profitieren. So ist etwa<br />
der aktuelle Präsident Viehzüchter und Zuckerrohrproduzent.<br />
Die lokalen Leader des MTC leben gefährlich,<br />
sie werden immer wieder bedroht. Die Arbeit<br />
an der Basis machen die KatechetInnen in den<br />
Gemeinden. Bei Protestaktionen wurden zum<br />
Beispiel die Strassen gesperrt und zum Zeitpunkt<br />
des Erntebeginns alle Transporte blockiert<br />
mit dem Ziel, die Regierung zu zwingen,<br />
sich mit der Problematik der miserablen<br />
Rechtsstellung der Landarbeiter auseinanderzusetzen.<br />
Allerdings müssen sie mit den Aktionen<br />
sehr vorsichtig sein, denn die Repression<br />
zielt auf die lokalen Leader. Den Leuten gehe<br />
jetzt aber langsam die Geduld aus, sie seien<br />
zunehmend bereit, weiter zu gehen.<br />
Im Hinblick auf den Besuch der «Marlin»-Goldmine<br />
zwischen Sipacapa und San Miguel erhalten<br />
wir von Fernando auch eine Einführung<br />
in die Minenproblematik: Die Metallminen seien<br />
in den letzten Jahren «entdeckt» worden.<br />
Im ganzen Land gebe es ca. 200 Punkte, wo<br />
Abbaumöglichkeiten geprüft werden – und in<br />
keinem Fall sei die lokale Bevölkerung konsultiert<br />
worden (wie es das internationale Abkommen<br />
über die Rechte der indigenen Völker verlangt).<br />
«Glamis Gold» kam im Jahr 2003 in die<br />
Region und versprach gut bezahlte Arbeit. Die<br />
Firma begann, Land zu kaufen und bezahlte<br />
das Dreifache der üblichen Preise – ohne zu informieren,<br />
wozu. Schon längst ist aber klar,<br />
dass es um Tagbau geht, wobei das Gestein im<br />
Zyanidbad vom Metall getrennt wird. Das Projekt<br />
hat enorme Umweltschäden wie Abholzung,<br />
Erosion und Wasserprobleme zur Folge.<br />
In einer Region mit Wasserknappheit wird für<br />
den Abbau eine Viertelmillion Liter Wasser pro
Stunde benötigt. Zudem besteht die grosse<br />
Gefahr, dass das hochgiftige Zyanid ins Grundwasser<br />
gelangt.<br />
Das Projekt ist auch nicht nachhaltig; nach<br />
dem Aufbau der Infrastruktur sind praktisch<br />
alle Arbeitsplätze für die Ansässigen weggefallen,<br />
denn Ingenieure und Maschinenführer sind<br />
Auswärtige. Die Mine ist jetzt im ersten Betriebsjahr;<br />
nach zehn Jahren Ausbeute soll sie<br />
geschlossen und der Krater von 800 m Durchmesser<br />
und 600 m Tiefe<br />
rekultiviert werden.<br />
Das wird von den Lokalen<br />
aber stark bezweifelt.<br />
Am 18. Juni 2005 hat<br />
die Gemeinde Sipacapa<br />
ohne Unterstützung<br />
von Bürgermeister und<br />
Regierung eine Volksbefragungdurchgeführt.<br />
Dabei stimmten<br />
11 Dörfer gegen die<br />
Mine und eines dafür<br />
(bei einer Stimmenthaltung).<br />
Die Regierung<br />
klärt immer noch<br />
ab, ob diese Abstimmung<br />
legal war… (unterdessen<br />
hat das Verfassungsgericht<br />
ihre<br />
Legalität bestätigt).<br />
Zudem kam es im Januar<br />
2005 bei Sololá<br />
zu einem gewalttätigen Zusammenstoss zwischen<br />
den 1500 Polizisten und 150 Soldaten,<br />
die den Transport des für die Mine bestimmten<br />
Zylinders begleiteten, und den Lokalen, die<br />
den Transport verhindern wollten. Obwohl eine<br />
Person getötet und 20 verletzt wurden, hat die<br />
Regierung keine Untersuchung veranlasst. Man<br />
nimmt an, dass sowohl Präsident wie Vizepräsident<br />
wirtschaftliche Interessen an der Mine<br />
haben.<br />
Nach dem ausgedehnten Briefing bringt uns<br />
der Bus über eine kurvenreiche Strasse mit<br />
fantastischen Ausblicken Richtung Pazifik in die<br />
Bocacosta. Immer wieder schrecken die Spuren<br />
von Hurrikan «Stan»; helle Furchen in den<br />
steilen, dicht bewachsenen Abhängen zeigen,<br />
wie extrem die Niederschläge im letzten Oktober<br />
waren. Plötzlich eine Umleitung auf eine<br />
Staubstrasse: Sie führt zu einem gigantisch<br />
breiten Flussbett voller riesiger abgeschliffener<br />
Steine. Von der Notbrücke über einen heute<br />
wieder bescheidenen Wasserlauf sehen wir die<br />
vom hochgegangenen Fluss weggerissene,<br />
16<br />
jetzt im Leeren endende Asphaltstrasse – alles<br />
vermittelt einen tiefen Eindruck von der Wucht<br />
der Wassergewalten. Dann holpert der Bus<br />
über verlottertes Kopfsteinpflaster durch die<br />
grüne Wildnis der Bocacosta. Hier wachsen die<br />
Kaffeepflanzen im Halbschatten hoher Bäume<br />
und üppiger Bananenstauden.<br />
Endlich Ankunft auf der Finca «Las Delicias» –<br />
wo wir sogleich zum Mittagessen in eine Holzhütte<br />
mit Wellblechdach geführt werden, halb<br />
Wohn-, halb Schlafraum.<br />
Etwas später, draussen im Halbrund unter hohen<br />
Bananenstauden, begrüsst uns Salvador<br />
Fuentes im Namen der 26 Familien, die hier<br />
für ihre Rechte kämpfen und einen Teil der Finca<br />
besetzt halten. Nach einleitenden Gebeten<br />
erklären uns verschiedene RednerInnen die Situation.<br />
Die ArbeiterInnen wurden im Januar<br />
2001 wegen der Kaffeekrise entlassen, und<br />
fordern seither die ihnen zustehenden und<br />
auch gerichtlich zugesprochenen Entschädigungszahlungen.<br />
Würden diese bezahlt, so<br />
hätten sie ganze 30 Tage Zeit, um das Gelände<br />
zu verlassen – aber wohin? Sie haben ihr Leben<br />
hier verbracht, schon ihre Grosseltern haben<br />
hier gelebt. Diese Familien mit ihren 185<br />
Kindern brauchen eigenes Land. Sie fordern<br />
die Hälfte der ihnen zustehenden Entschädigung<br />
in Form von 1500 cuerdas flachem Land<br />
– das würde ihnen ermöglichen, den Lebensunterhalt<br />
zu sichern.<br />
Die Landbesitzerin war nur einmal hier, um mit<br />
den entlassenen ArbeiterInnen zu verhandeln;<br />
der nicht besetzte Teil der Finca wird nicht<br />
mehr von ihr, sondern von einem Vertreter der
Bank, wo offene Hypothekarschulden bestehen,<br />
verwaltet.<br />
Die unsichere Situation belastet die Familien<br />
stark. Wichtig wäre Weiterbildung, damit die<br />
entlassenen ArbeiterInnen alternative Arbeitsmöglichkeiten<br />
hätten, etwa im Bereich Maurer-<br />
In, SanitärIn, KonditorIn oder SchneiderIn, um<br />
aus der auswegslosen Situation der campesinos/-as<br />
herauszufinden. Die Folgen der Entlassungen<br />
waren auch für die Kinder sehr hart,<br />
weil die Finca-Schule geschlossen wurde. Die<br />
Kinder gingen danach zwei Jahre überhaupt<br />
nicht zur Schule – jetzt besuchen sie wieder<br />
den Unterricht, aber in verschiedenen, zum<br />
Teil weit entfernt gelegenen Schulen. Denn nur<br />
mit besserer Bildung werden sie in der Lage<br />
sein, irgendwann aus dem Teufelskreis der Existenz<br />
als landlose LandarbeiterInnen auszubrechen.<br />
Heute bestreiten die Familien den Lebensunterhalt<br />
durch Taglohn- und Gelegenheitsarbeiten;<br />
zudem leistet die Diözese Nahrungsmittelhilfe.<br />
17<br />
Die Leute von Las Delicias drücken auf ganz<br />
verschiedene Weise aus, dass unser Besuch sie<br />
erfreut, aber auch erstaunt hat. Julio spricht<br />
gar von einem Opfer, das wir mit unserem Besuch<br />
gebracht hätten.<br />
Auf der Fahrt zurück nach San Marcos besuchen<br />
wir kurz eine vom MTC neu geschaffene<br />
Produktion von Bausteinen, la bloquera. Hier<br />
werden täglich 650 Lochbausteine hergestellt<br />
– was vier Männern von der Finca eine Beschäftigung<br />
verschafft. Sie arbeiten abwechselnd,<br />
verdienen aber mit Ausnahme des Maschinisten<br />
nichts dabei. Die Steine sind sehr<br />
gefragt, denn die Gemeinden bauen zurzeit<br />
viele Häuser für die Opfer des Hurrikans. Allerdings<br />
hat es Probleme gegeben, weil die Steine<br />
billiger sind als der aktuelle Marktpreis.<br />
Die Landschaft ist grandios; wilde Wolkenbilder<br />
und dramatische Beleuchtung gegen Westen<br />
machen die Rückfahrt in die Höhe und in den<br />
Abend unvergesslich.
20. 02. 06: Gespräch mit Bischof Ramazzini<br />
und Besuch in San Miguel Ixtahuacán<br />
Gespräch mit Bischof Ramazzini in San<br />
Marcos<br />
Nach gut 1/3 der Reise haben wir wieder einen<br />
besonderen Höhepunkt. Bischof Alvaro Ramazzini<br />
(seit 17 Jahren Bischof der Diözese San<br />
Marcos und seit kurzem Vorsitzender der Bischofskonferenz<br />
der katholischen Bischöfe in<br />
Guatemala) macht auf uns alle einen starken<br />
Eindruck. Seine Persönlichkeit hat eine Ausstrahlung,<br />
seine Klarheit ist überzeugend, seine<br />
Offenheit gewinnend. Nach einer Einführung<br />
in die Situation kommt es zu einem engagierten<br />
Gespräch.<br />
San Marcos ist die von Armut am stärksten betroffene<br />
Diözese. Im Augenblick gibt es für Ramazzini<br />
drei besonders aktuelle Probleme:<br />
1. In der Küstenregion nimmt die Gewalt erschreckend<br />
zu; der Grund liegt in starkem<br />
Masse am Drogenhandel.<br />
2. Vor kurzem ist es zu einem Konflikt zwischen<br />
zwei Mam-Dörfern gekommen. Bewohner<br />
des einen haben 15 Häuser des anderen<br />
Dorfes abgebrannt; durch ihre starke<br />
Bewaffnung waren sie überaus bedrohlich;<br />
es gab keine toten Menschen, aber mehrere<br />
verletzte. Und es gibt neue Angst.<br />
3. Der Bergbau der ersten Goldmine in San<br />
Marcos seit Herbst 2005 spaltet die Bevölkerung<br />
und zerstört die Natur verheerend<br />
nachhaltig.<br />
Zum andern ist die Diözese das durch den<br />
Hurrican «Stan» am schlimmsten betroffene<br />
Gebiet. Die Armen trifft es wieder am schwersten.<br />
Was kann die Kirche in dieser Situation tun?<br />
Der Bischof spricht von einer Krise des Christentums.<br />
95 % der ChristInnen seien nicht<br />
«christlich», d.h. leben nicht nach der Bergpredigt.<br />
Die Bischofskonferenz sucht Kontakt<br />
und führt Gespräche mit der Regierung, tut<br />
dies aber nicht um jeden Preis. Zur katholischen<br />
politischen Klasse hält sie deutlich Distanz.<br />
Gegebenenfalls stellt sie sich klar auf<br />
die Seite der Armen – und auch des Widerstands.<br />
Dabei erhält sie (bislang) die Unterstützung<br />
durch den Nuntius aus Rom. Vor kurzem<br />
hat die Bischofskonferenz einen Brief an<br />
die Bischofskonferenz der USA geschrieben.<br />
Eindringlich trägt sie die Bitte um deren Unterstützung<br />
vor, gegen die Gesetzesvorlagen im<br />
amerikanischen Kongress zur Verschärfung der<br />
Migrationspolitik zu lobbyieren. Zu anstehenden<br />
Verträgen eines Freihandelsabkommens<br />
mit den USA übergab die Bischofskonferenz an<br />
18<br />
die eigene Regierung eine 10-Punkte-Forderung<br />
gegen die Ungerechtigkeit und Unrechtmässigkeit<br />
eines solchen Abkommens. Dazu<br />
sollen in nächster Zeit Gespräche stattfinden.<br />
(Noch während unseres Aufenthaltes hat ein<br />
solches Gespräch mit Präsident Berger und Vizepräsident<br />
Stein stattgefunden. Auf konstruktive<br />
Auswirkungen müssen wir warten.)<br />
Zum ungelösten Problem einer angemessenen<br />
Landverteilung äussert sich der Bischof dahingehend,<br />
dass eine ständige Landverteilung und<br />
«Landzerteilung an alle» nicht die Lösung des<br />
Problems sein kann. Seine Forderung ist die<br />
Schaffung neuer Arbeitplätze. Bei den Kirchen<br />
gibt es auch eine ökumenische Gemeinschaft<br />
zwischen KatholikInnen, LutheranerInnen,<br />
AnglikanerInnen und PresbyterianerInnen. Von<br />
den Pfingstkirchen und evangelikalen Bewegungen<br />
grenzt sich Ramazzini scharf ab: deren<br />
Führer seien auf eigene Bereicherung und Vertröstung<br />
der anderen aus. Seine Hauptkritik<br />
richtet sich gegen die Ignoranz dieser Gruppen<br />
bei der Aufarbeitung der bösen Folgen des<br />
Bürgerkrieges. Dennoch sucht er immer wieder<br />
Gespräche und Kontakte, um sich nicht gegenseitig<br />
zu isolieren. Gegenüber der stark<br />
wachsenden Zahl dieser aus den USA finanzierten<br />
«evangelischen Kirchen» setzt er auf<br />
das authentische Zeugnis des Glaubens im<br />
Sinne der Bergpredigt auf der Seite der Armen.<br />
(Ich erinnere mich an die «Option für die<br />
Armen» der Befreiungstheologen vor 40 Jahren.)<br />
Fazit:<br />
• Aufgabe der Kirche ist das Gemeinwohl des<br />
Volkes und der Einsatz für soziale Gerechtigkeit.<br />
• Diese geschieht wesentlich durch Bildung<br />
und die Authentizität gelebten Glaubens.<br />
• Bei den politischen Parteien habe «keiner»<br />
das Gemeinwohl auf dem Programm.<br />
• Mit Blick auf die Neuwahlen 2007 sieht der<br />
Bischof noch keine Konturen.<br />
• Es gibt keine gemeinsame Idee!<br />
Siehe auch "Die katholische Kirche stärkt ihre soziale<br />
Linie" (Anhang S. 4)<br />
Besuch in San Miguel Ixtahuacán<br />
Eine stundenlange Fahrt durch die Diözese von<br />
Bischof Ramazzini über Berg und Tal und Stock<br />
und Stein durch das Hochland mit wunderschönen<br />
weiten Ausblicken zeigt uns unter-
wegs: Felder der Bauern an den Steilhängen<br />
der Berge, grüne Wälder ringsum auf den Hügeln,<br />
überall dazwischen die Wellblechdächer<br />
der kleinen Hütten, Spuren von Erdrutschen,<br />
Blumen und leuchtend bunte Blüten und immer<br />
wieder Menschen und Tiere am Wegesrand:<br />
Kinder und Alte, Schülergruppen und Arbeiter<br />
und Hühner, Schweine, Schafe, Kühe,<br />
Ziegen, Pferde, Hunde, Katzen, Gänse – und<br />
ein Aasgeier.<br />
Eusebio Juárez Díaz (Mitarbeiter des<br />
Movimiento de Trabajadores Campesinos<br />
MTC) begrüsst uns alle als hermanos<br />
y hermanas – Brüder und<br />
Schwestern. So wie die Mam sich alle<br />
als Kinder Gottes verstehen, gehören<br />
wir dazu. Er betet mit uns zum gemeinsamen<br />
Mittagessen – gastfreundlich<br />
sind sie – und schliesst mit<br />
dem gemeinsamen «Unser Vater».<br />
Heute ist das bedrängende Thema:<br />
Die Gold-Mine, die seit Herbst 2005<br />
im Gebiet von San Miguel in Betrieb<br />
genommen ist. 13 VertreterInnen der<br />
indigenen Bevölkerung erwarten und<br />
erzählen uns. Wir hören den Zeugnissen<br />
persönlicher Erfahrungen seit Ankunft<br />
der Minenvertreter der kanadischen<br />
Minengesellschaft «Montana» gespannt<br />
zu.<br />
Eusebio: Das Volk fühlt sich betrogen: Es war<br />
nicht bekannt gegeben, dass es beim Land-Ankauf<br />
um «Gold-Land» ging. Das hat das Volk<br />
gespalten. Persönliche Bedrohungen verbreiteten<br />
erneut Angst und Schrecken bei dem<br />
Volk der Indigene (=Eingeborene, ursprüngliche<br />
Landbesitzer). Von 10’000 zugesagten Arbeitsplätzen<br />
sind es etwa 1000 (zumeist für<br />
Auswärtige!) geworden. Der Alkoholismus hat<br />
sich sprunghaft ausgebreitet unter den Minenarbeitern,<br />
die dann im Dorf randalieren. Alle<br />
Gespräche mit der Mine, mit dem Präsidenten<br />
Berger (der zur Einweihung dabei war), mit<br />
Bürgermeister und Pfarrer waren erfolglos. Sie<br />
fühlten sich von niemandem ernst genommen.<br />
Junger Mann: Er fühlt sich im Stich gelassen.<br />
Er hat nie Aufklärung über die Bodenschätze<br />
Gold und Silber in seinem Land erhalten. Die<br />
Spaltungen zwischen denen, die Arbeit haben<br />
und denen, die keine haben, führen bis zu Todes-Drohungen.<br />
Die Polizei nimmt seine Klage<br />
nicht an. In San Marcos konnte er seine Klage<br />
bei der Menschenrechtskommission wenigstens<br />
hinterlegen.<br />
Junge Frau: Bei Landaufkauf haben die Käufer<br />
das Unwissen der Indigenen bewusst ausgespielt,<br />
obwohl sie dreimal so viel Geld bezahlt<br />
haben. Die Frau hat keine Arbeit bekommen.<br />
Die Ausländer treten diskriminierend auf. Es ist<br />
19<br />
ein großer Betrug: Durch vage Versprechungen<br />
wurden Hoffnungen geweckt und enttäuscht.<br />
Angesichts des grossen Gewinns sind<br />
es Hungerlöhne, die gezahlt werden.<br />
Frau: Früher haben sie hier friedlich gelebt.<br />
Die grossen Versprechungen – Bau von Strassen,<br />
Plätzen, Spital – sind nicht eingehalten<br />
worden. Frauen, die jetzt hier als Prostituierte<br />
arbeiten, sind von ausserhalb geholt worden.<br />
Viele Minenarbeiter tragen Waffen und verbreiten<br />
Angst.<br />
Ein ehemaliger Bürgermeister ergänzt: Die<br />
Minengesellschaft beutet ihr Land aus – und<br />
zahlt nicht einmal Steuern an den Staat (der<br />
Staat ist selbst korrupt). Der versprochene<br />
Fortschritt wird nicht kommen. Das Zyanid,<br />
mit dem das Gold ausgewaschen wird, wird die<br />
gesamte Region vergiften. Über Nachfolgeschäden<br />
und etwaige Renaturierung wird gar<br />
nicht gesprochen.<br />
Sie alle wollen mit ihrem Protest und Widerstand<br />
nicht nachlassen! Ihr Vorhaben ist es,<br />
mit einem internationalen Manifest Aufmerksamkeit<br />
zu erzwingen – zumal in San Miguel<br />
keine consulta popular (Volkbefragung) wie in<br />
Sipakapa stattgefunden hat.<br />
Leider ist die Frage der Besitzverhältnisse historisch<br />
und juristisch sehr kompliziert und ungeklärt.<br />
Dennoch ist das Verfahren nicht hinzunehmen.<br />
Wer sein Land nicht verkaufen<br />
wollte, wurde bedroht. Die Einschüchterungen<br />
vergiften jetzt schon das menschliche Klima.<br />
-> Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC):<br />
http://www.mtcguatemala.com/<br />
-> E-mail MTC: diocesismtc@itelgua.com<br />
-> offizielle Webseite der Minenbetreiberin Glamis<br />
Gold: http://www.glamis.com/spanish/properties/guatemala/marlin.html<br />
Siehe auch "Volksbefragungen: Ein Sieg der (oder<br />
über die) Demokratie?" (Anhang S. 7)
21. 02. 06: Von Huehuetenango nach Nebaj<br />
Sämtliche Gepäckstücke, angereichert durch<br />
etliche grössere Tontöpfe und Comales werden<br />
wieder im Bus verstaut. Ab jetzt geht die Fahrt<br />
von Huehuetenango (1900 m.ü.M.) Richtung<br />
Osten hügelauf und hügelab – hauptsächlich<br />
letzteres! – nach Aguacatán. Heute ist Natur<br />
angesagt, keine Treffen oder Begegnungen,<br />
eher Sehen (leider viel beim Fahren vom Bus<br />
aus, aber selbst so ist die Landschaft oft überwältigend!).<br />
Nach ca. 25 Kilometern erreichen<br />
wir Aguacatán und erkämpfen 20 Minuten<br />
Aussteigen, um Strassen, Markt, Gerüche auf<br />
uns wirken zu lassen. Aguacatán leitet seinen<br />
Namen vom «Überfluss an Aguacates» (= Avocados)<br />
ab. Die Frauen tragen einen quergestreiften<br />
roten oder dunklen corte, wunderschöne<br />
weisse, reich bestickte huipiles und<br />
sind sehr fotoabgeneigt – was man durchaus<br />
verstehen kann. Gleich hinter dem Dorf kommen<br />
wir zum Nacimiento del Río San Juan,<br />
sprich zur Quelle des Río Blanco. Das Wasser<br />
kommt eiskalt und wasserfallartig aus dem<br />
Gestein, wir staunen über die eher exotische<br />
Vegetation mit riesigen Farnen und grossen<br />
Schattenbäumen. Ein wunderschöner Ort, eine<br />
wahre Oase der Ruhe nach allem, was wir kurz<br />
davor über den Goldabbau zu hören bekommen<br />
haben. Toni liest uns sehr passend Gedichte<br />
von Humberto Ak`abal (K`iché) aus<br />
dem Band «Trommel aus Stein» vor.<br />
Weiter geht es, die fruchtbare Erde und der<br />
Wasserreichtum erlauben hier unten den Anbau<br />
von Gemüse, von Zwiebeln und Knoblauch.<br />
Sobald wir wieder höhere Regionen erreichen,<br />
wird es jetzt in der Trockenzeit sehr<br />
staubig, karge, spärlich besiedelte Gegenden,<br />
die im Regenschatten der Cuchumatanes liegen,<br />
eher ein deprimierender Anblick, ich frage<br />
20<br />
mich, wovon die Menschen hier leben können!<br />
Dann erreichen wir Sacapulas, im Tal des Río<br />
Negro, auch Río Chixoy genannt. Sacapulas ist<br />
berühmt wegen der «friedlichen Missionierung»<br />
der Indígenas durch Fray Bartolomé de<br />
Las Casas im 16. Jahrhundert. Bezeichnend<br />
dagegen für die blutige Geschichte der 80er-<br />
Jahre gerade in dieser Gegend ist, dass jetzt<br />
erst, zum 25. Jahrestag im Februar 2006, in<br />
dieser Kirche ein Gedenkgottesdienst für den<br />
1981 ermordeten spanischen Padre Juan Alonso<br />
López gefeiert werden konnte, unter grosser<br />
Beteiligung der Bevölkerung, die ihn nicht<br />
vergessen hat.<br />
Nach kurzer Stärkung folgt die letzte Etappe<br />
unserer heutigen Reise, hinauf in die Cuchumatanes<br />
Richtung Ixildreieck. Vor acht Jahren<br />
bin ich diese Strecke zum letzten Mal gefahren<br />
(in total überfülltem uraltem Landbus),<br />
und ich traue meinen Augen nicht: statt<br />
schrecklichster löchriger, staubiger, gefährlicher<br />
Strasse fährt unser Turismo-Bus zügig<br />
eine neue Asphaltstrasse entlang, steil, kurvig,<br />
aber höchst bequem! Nun, durchgängig ist die<br />
neue Trasse zwar noch nicht, aber Dutzende<br />
von Arbeitern sind hier beschäftigt. Ein kurzer<br />
Halt, ein Fotoblick zurück in das tief eingeschnittene<br />
Chixoytal – das ist eines der unvergesslichen<br />
Bilder von der Schönheit Guatemalas!<br />
Kurz darauf ebenfalls ein starker<br />
Eindruck: die gerade noch staubtrockene<br />
Landschaft wird plötzlich grün und<br />
feucht, innerhalb weniger Kilometer erleben<br />
wir eine überraschende Klimagrenze,<br />
die Nordseite der Cuchumatanes.<br />
Bald darauf wird in einer Talmulde<br />
noch weit unten Nebaj sichtbar, das<br />
mit San Juan Cotzal und Chajul zusammen<br />
das bereits erwähnte Ixildreieck<br />
bildet, ein sehr abgelegenes, fast<br />
nur von Indígenas mit eigener Sprache<br />
(eben Ixil) bewohntes Gebiet.<br />
Am Spätnachmittag laufen wir in unserem<br />
hübschen Quartier mit Innenhof<br />
ein – und alsbald beginnt eine rege<br />
Wäschewaschaktion, dann ein Bummel<br />
durch das Dorf Nebaj.<br />
Am Abend – wir haben ungefähr Halbzeit<br />
– folgt eine Feedback-Runde über Eindrükke,<br />
Gefühle und Empfindungen der bisherigen<br />
Reise. Fast durchgängig wird das Programm<br />
als sehr gut vorbereitet erlebt, auch als sehr<br />
voll und intensiv – andererseits: was wollten<br />
wir missen und wer weiss, was noch alles auf<br />
uns wartet! Wir sind gespannt und voller Erwartungen.
22. 02. 06: Nebaj<br />
Nach dem gestrigen «Ausruhetag» wird es<br />
heute – und generell im Ixildreieck – eher zu<br />
emotional belastenden Begegnungen kommen.<br />
Ich habe mich bewusst für diesen Teil des Reiseberichts<br />
gemeldet, weil ich die Region seit<br />
1993 kenne, und in sehr verschiedenen Phasen<br />
– vor und nach der Unterzeichnung der<br />
Friedensverträge – besucht und von hier lebenden<br />
Freunden viel erfahren habe.<br />
Wir treffen uns im Gemeindesaal mit Padre Rigoberto<br />
Pérez C. und MitarbeiterInnen. Padre<br />
Rigoberto kommt ursprünglich aus dem Osten<br />
von Guatemala, arbeitet aber seit 15 Jahren<br />
im Quiché und seit fünf Jahren in Nebaj, gezielt<br />
aus Interesse an der Arbeit mit REMHI<br />
(Recuperación de la Memoria Histórica – Projekt<br />
der kath. Kirche zur «Wiedererlangung<br />
des historischen Gedächtnisses», also Aufarbeitung<br />
des Bürgerkriegs).Was uns erwartet:<br />
1) Spezielle Geschichte der Gegend hier, Kontext<br />
im Ixil<br />
2) Marcelino aus La Pista (siehe später) lebte<br />
17 Jahre in den CPR (Geheime Widerstandsdörfer),<br />
arbeitet seit nun zehn Jahren<br />
in der Gemeinde Nebaj, seit drei Jahren<br />
im Radio der Kirchengemeinde<br />
3) Emilia, Schwester von Padre Rigoberto, ist<br />
für die Exhumaciones zuständig.<br />
Sie werden uns einen Einblick in die Verarbeitung<br />
des Geschehenen geben, posguerra genannt,<br />
also Nachkriegszeit, denn «die Gegenwart<br />
kann man nur aus der Vergangenheit verstehen».<br />
Noch in den 50er-Jahren war das Ixildreieck<br />
sehr isoliert, der einzige Zugang führte durch<br />
die Berge, mindestens zwölf Stunden von der<br />
Hauptstadt, nur zweimal wöchentlich fuhr ein<br />
Bus, die Bevölkerung, Ixiles, war extrem arm.<br />
Diese Isolierung, die Entfernung zur Hauptstadt<br />
und das Desinteresse der Regierung hatten<br />
zur Folge, dass kein Bezug zum Staat existierte.<br />
Noch heute werden Geburten und Heiraten<br />
nicht aus Einsicht, BürgerInnen des Landes<br />
zu sein, sondern nur durch Druck registriert.<br />
Wirklich schlechte Erfahrungen mit dem Staat<br />
gab es schon früher: ca. 1930, unter dem<br />
grössenwahnsinnigen Diktator Ubico, reichten<br />
einige mutige Männer Nebajs eine Klage wegen<br />
ungerechtester Lohnarbeit ein. Sie wurden<br />
an der Kirchenmauer erschossen.<br />
Die verstreut lebenden Ixiles waren, um überleben<br />
zu können, gezwungen als Saisonarbeiter<br />
an die Küste zu gehen, oft ohne Transportmittel,<br />
zu Fuss, viele starben schon unterwegs,<br />
21<br />
andere ertrugen den extremen Klimawechsel<br />
und die harten Arbeitsbedingungen nicht.<br />
In den 60er-Jahren entstanden erste bewaffnete<br />
Aufstandsbewegungen in Guatemala,<br />
wurden jedoch niedergeschlagen. Die Aufständischen<br />
flohen nach Mexiko ins Exil, kamen<br />
später über den Ixcán (Urwaldgebiete) wieder<br />
zurück und von dort auch ins Ixildreieck.<br />
Nach dem 2. Vatikanischen Konzil kamen viele<br />
ausländische Priester ins Land. Sie waren entsetzt<br />
über die Armut und die miserablen Lebensbedingungen<br />
der Menschen. Es kam zu einem<br />
«Erwachen», zu Veränderungen sozialer<br />
Art, Evangelisation praktisch. Gemeindearbeit,<br />
produktiverer Anbau (auch mit Düngemitteln),<br />
sogar Fussballplätze entstanden, kurz: sie<br />
setzten sich ein für ein besseres Leben der<br />
Menschen. Das heisst: nicht etwa durch den<br />
Staat, sondern dank Aktivierung der Gemeinden,<br />
z. B. durch die Acción Católica wird eine<br />
Verbesserung im täglichen Leben erreicht.<br />
Es gab also 2 Bewegungen: die bewaffneten<br />
Gruppen und der Aufbruch in den Gemeinden.<br />
Klar, die Motive waren zwar verschieden – die<br />
Guerilla wollte den Staat stürzen, die Acción<br />
Católica die Lebensumstände der Bevölkerung<br />
verbessern –, aber die Auswirkungen wurden<br />
gleich gesetzt, beides wurde als subversiv eingestuft.<br />
Wer sich dafür einsetzte (promotores<br />
de salud, catequistas, profesores, padres...),<br />
war verdächtig!<br />
Wenige Gruppierungen, die untereinander zusammenhängen,<br />
beherrschen Guatemala:<br />
die Oberschicht (manche sprechen von 20 Familien)<br />
d.h. Reichtum, Regierung, Militär, Justiz,<br />
Grossgrundbesitzer etc. Das bedeutet<br />
Macht!<br />
Guatemala ist landwirtschaftlich stark (Kaffee,<br />
Baumwolle, Zuckerrohr, Bananen...), nicht industriell.<br />
La tierra ist Symbol! Landbesitz führt<br />
zu Reichtum, das ist so seit der Ankunft der<br />
Spanier. Die Landverteilung ist ein bereits historischer<br />
Kampf, führte aber ab ca. 1980 zur<br />
Eskalation. Der Vorwand war gegeben: sozialer<br />
Einsatz = Kommunismus und Terrorismus.<br />
«Krieg» bedeutet eigentlich, dass zwei bewaffnete<br />
Gruppen gegeneinander kämpfen, aber:<br />
Von zehn Menschen, die im bewaffneten Konflikt<br />
starben, waren nur zwei Guerilleros, alle<br />
anderen waren Mitglieder der Zivilbevölkerung.<br />
Überliefert sind heute ca. 600 Massaker mit<br />
zwischen drei und 300 Toten am selben Tag!<br />
1988 gab die Bischofskonferenz den Hirtenbrief<br />
Clamor por la Tierra, (Schrei nach Land)<br />
heraus, Bischof Gerardi veröffentlichte Busquéda<br />
de la Verdad, den Wahrheitsbericht, und
wurde kurz darauf ermordet. Und was macht<br />
die Regierung? Laut Rigoberto no pasa nada,<br />
absolutes Schweigen auch nach Unterzeichnung<br />
der Friedensverträge. REMHI versuchte,<br />
internationales Völkerrecht anzuwenden, aber<br />
das greift nicht, was hier passierte kommt dort<br />
nicht vor.<br />
1996 wurden die letzten Friedensverträge unterzeichnet.<br />
Aber: Jetzt werden Kaibíles (Elitetruppen<br />
des Militärs = «Tötungsmaschinen»)<br />
als «Friedenstruppe» nach Afrika entsandt,<br />
um an den Friedenseinsätzen der UNO teilzunehmen.<br />
Absurd!<br />
Das Ixildreieck war ein Epizentrum damals im<br />
Bürgerkrieg. Rigoberto: Hay mucho que hacer,<br />
es gibt so viele Herausforderungen die angegangen<br />
werden müssten. Was bis jetzt geschah,<br />
ist etwas Lack über die Geschichte gepinselt.<br />
Die Ursachen des Krieges sind nicht<br />
gelöst, die heutige abnorme Gewalt in Guatemala,<br />
die als «normale» Delinquenz, Drogenhandel,<br />
Bandenkriminalität usw. bezeichnet<br />
wird, hat weithin dieselben Ursachen wie damals:<br />
extreme Armut, ungerechte Landverteilung,<br />
Mangel an Zukunftschancen...<br />
Rigoberto möchte nicht bei einer frustrierten<br />
Sicht der Lage stehen bleiben, er sieht wichtige<br />
Anhaltspunkte, mutige Personen wie z. B.<br />
Bischof Ramazzini, der unerschrocken seine<br />
(unbequeme) Position verteidigt trotz Morddrohungen,<br />
ebenso viele Menschen der einfachen<br />
Bevölkerung, die Zeugenaussagen machen<br />
und für ein besseres Miteinander sich<br />
einsetzen. Wir sind ziemlich betroffen und<br />
deshalb gibt es eine Fragerunde im Anschluss:<br />
Wie wird die Vergangenheit angegangen? Ist<br />
sie ein Thema in den Familien? – Es gibt viel<br />
Betroffenheit, viele Traumata, manches kann<br />
(noch) nicht angesprochen werden, aber es<br />
gibt Initiativen und psychosoziale Betreuungsangebote,<br />
meist von der Kirche.<br />
Wie sieht das international aus? – Im Ausland<br />
vertritt Bischof Ramazzini bei den heiklen Themen<br />
(Goldabbau, Migration, Drogenanbau<br />
etc.) die engagierten Leute und nicht der Präsident<br />
bzw. Regierungsvertreter.<br />
Ein authentischer Friede wäre nur möglich als<br />
nationale Bewegung mit internationaler Unterstützung,<br />
dem ¡Nunca Más! entsprechend.<br />
Wie steht es mit der Verarbeitung von offizieller<br />
Seite, z. B. in den Schulen, im Geschichtsunterricht?<br />
– Es wird darüber geredet auch an<br />
den Unis. Aber: fundierte Ergebnisse des REM-<br />
HI werden nicht akzeptiert, es hat offiziell keine<br />
Umkehr stattgefunden.<br />
22<br />
Problem Tierra: Enteignungen gab es seit der<br />
Ankunft der Spanier, dann 1871 unter Rufino-<br />
Barrios. Oder wenn das Land des Nachbarn<br />
grösser oder besser war, wurde er umgebracht,<br />
und damit hatte sich die Landaneignung<br />
erledigt. Wobei es auch Finqueros gibt,<br />
die tatsächlich durch eigene harte Arbeit zu<br />
Besitz gekommen sind. In Nebaj wurden 90%<br />
der BewohnerInnen im Krieg vertrieben – wer<br />
weiss, wer heute auf seinem ursprünglichen<br />
Land wohnt und wie er es wiederbekommen<br />
hat? So viele sind nie mehr zurückgekommen<br />
und Landtitel gab es nicht, oder sie existieren<br />
auch nicht mehr.<br />
Die «Verschwundenen»: Man weiss oft, dass<br />
sie ermordet wurden (es gibt etwa Augenzeugen),<br />
aber das ist kein Beweis und wird nicht<br />
anerkannt. Rosalina Tuyuc (von Conavigua =<br />
Coordinadora Nacional de Viudas, Witwenvereinigung<br />
Guatemalas) sagt, mit Entschädigungen<br />
hätte nicht begonnen werden können, weil<br />
absichtlich die Anforderungen zu hoch seien,<br />
man müsste z. B. einen Totenschein vorlegen<br />
können. So sind jedoch aus dieser Zeit in der<br />
Klinik von Santa Cruz del Quiché die Totenscheine<br />
nur auf «natürliche Todesursache»<br />
ausgestellt.<br />
Marcelino kann als direkt Beteiligter und Betroffener<br />
noch konkreter über die Vergangenheit<br />
und über REMHI sprechen. Zwei Fragen<br />
stehen an:<br />
1) Warum kam es zur Verfolgung innerhalb<br />
der Kirche?<br />
2) Wie erlebte er den bewaffneten Konflikt?<br />
Nebaj liegt in einer armen Gegend, es gibt fast<br />
nur Mais und Bohnen. Daher war die Bevölkerung<br />
gezwungen, Saisonarbeit an der Küste zu<br />
suchen. Um 1970 kamen die Padres del Sagrado<br />
Corazón hierher, damit die Acción Catolica,<br />
und die Idee, sich zusammenzuschliessen, um<br />
eine Verbesserung der Lebenssituation zu erreichen<br />
– nicht mehr jeder seine kleine Parzelle<br />
individuell zu beackern. Es entstanden Cooperativas,<br />
Schulen, Puestos de Salud, sogar<br />
Bienenzucht, Fussballplätze, und die Basisarbeit<br />
der KatechetInnen wurde aufgebaut. Ab<br />
dieser Zeit hörte man auch verborgen über die<br />
Guerilla im Ixcán, ab 1978/79 konkret im<br />
Ixildreieck. Bei Versammlungen und in Informationsrunden<br />
stellte man erstaunt fest, dass<br />
die Aussagen sehr verwandt klangen zwischen<br />
dem, was die Guerilla und dem, was die Padres<br />
und die catequistas sagten. Das alles wurde<br />
alsbald als subversiv eingestuft, es kam zu<br />
starker Militärpräsenz, der Ermordung von drei<br />
Padres und sehr vielen KatechetInnen (als
líderes und lideresas), viele wurden nachts<br />
entführt, man hörte nie wieder von ihnen. Es<br />
wurden zuerst also selektive Ermordungen<br />
verübt, um «der Schlange den Kopf zu zertreten».<br />
Aber dann wurde einfach alles zerstört,<br />
ermordet, wurden Ernten verbrannt, Tiere abgeschlachtet.<br />
Einige konnten in die Berge fliehen.<br />
Die Grausamkeiten kann man sich unter<br />
menschlichen Wesen gar nicht vorstellen. Nur<br />
ein Beispiel: Mehrere Menschen hatten sich in<br />
die Kirche gerettet und wurden dort lebendig<br />
verbrannt, Männer, Frauen, Kinder, Alte ohne<br />
jeden Unterschied. In der ersten Hälfte der<br />
80er-Jahre wurde hier alles zerstört, manche<br />
konnten schnell über die Grenze nach Mexiko<br />
fliehen, andere in die Berge und Wälder als interne<br />
Vertriebene, wo sie CPR (Comunidades<br />
de Población en Resistencia, Geheime Widerstandsdörfer)<br />
aufbauten. Es gibt hier keine<br />
einzige Familie ohne Ermordete oder Verschwundene,<br />
in Marcelinos Familie sind es 9<br />
Personen, 7 durch das Militär, 2 durch die Guerilla!<br />
Marcelino konnte fliehen.<br />
Wie war das Leben in den CPR? Marcelino lebte<br />
von 1980 bis 1996, also bis zur Unterzeichnung<br />
der Friedensverträge, total im Verborgenen,<br />
in den Bergen, hatte kaum Kontakte mit<br />
der Aussenwelt, kaum Nahrungsmittel, spärlichste<br />
Maisfeldchen, keine Ersatzkleidung, weil<br />
sie nie solange an einem Ort bleiben konnten,<br />
immer auf der Flucht vor dem Militär waren...<br />
Er erlebte die tägliche Bedrohung durch Mili-<br />
23<br />
tärpatrouillen, Hubschrauberbeschuss, vergiftetes<br />
Salz unter den Toten, die sie begraben<br />
wollten. Keine Zeit mehr zu haben zum Innehalten,<br />
zum Beten, um Gottesdienste zu feiern,<br />
zermürbte, es war der Kampf ums nackte<br />
Überleben. Wer gefangen wurde und am Leben<br />
blieb, wurde in die Modelldörfer zwangseingeliefert.<br />
Eine Bibel im Haus oder bei sich zu tragen,<br />
galt als «Waffe», also war der- oder diejenige<br />
einE RevolutionärIn und musste «ausser Gefecht»<br />
gesetzt werden. Zwei Katecheten begannen<br />
ohne autorización zu taufen, Ehen zu<br />
schliessen unter diesen Ausnahmebedingungen,<br />
geweihte Hostien trugen sie versteckt bei<br />
sich. Zu ihrer Erleichterung bedankte sich der<br />
Bischof (Julio Cabrera) später bei ihnen und<br />
ermächtigte sie noch nachträglich.<br />
1991 gab es eine Resolution aller Menschen<br />
der CPR. Sie wurde verschiedenen Gruppen,<br />
Menschenrechtsorganisationen, JournalistInnen,<br />
JuristInnen, Internationalen...in der<br />
Hauptstadt übergeben. Die CPR starteten eine<br />
Offensive aparecer a la luz, traten ans Licht<br />
der Öffentlichkeit über Radio, Zeitung, denn<br />
offiziell gab es keine interne Flüchtlinge. Die<br />
Botschaft war: Wir als campesinos und campesinas<br />
werden seit Jahren vom eigenen Militär<br />
verfolgt, aber entregarnos (como subversivos)<br />
nunca (uns als Subversive zu ergeben, nie)!<br />
Die angebotene Amnestie von Ríos Montt<br />
mussten sie ablehnen, sonst wären sie der<br />
Guerilla gleichgestellt worden. Nach den Frie-
densverträgen erhielten die CPR de la Sierra<br />
vier Fincas, drei davon an der Südküste, eine<br />
in der Gegend von Nebaj, dazu fünf Siedlungen<br />
(asentamientos), so zum Beispiel La Pista,<br />
wo Marcelino wohnt. Das Leben dort ist immer<br />
noch extrem hart, die Leute sehr arm – geändert<br />
oder gar gebessert hat sich eigentlich<br />
nichts.<br />
Emilia, Schwester von Padre Rigoberto, ist Ansprechperson<br />
für die Exhumaciones. Sie arbeitet<br />
innerhalb der Kirche – p or la verdad, la justicia<br />
y el perdón, la reconciliación y la paz (für<br />
die Wahrheit, die Gerechtigkeit und die Vergebung,<br />
für Versöhnung und Frieden).<br />
Als REMHI mit der Arbeit begann, waren zunächst<br />
nur wenige der Überlebenden bereit,<br />
Zeugnis abzulegen, die Angst war immer noch<br />
viel zu gegenwärtig. Aber der Wunsch, ihre Toten<br />
zu finden und in geweihter Erde beizusetzen,<br />
war stärker. Erst 1998 begannen Exhumierungen<br />
der Geheimen Friedhöfe im Quiché.<br />
Dies war das Jahr der Ermordung von Monseñor<br />
Gerardi, was erneut grosse Angst auslöste<br />
und der Bewegung einen empfindlichen<br />
Rückschlag versetzte. Trotzdem fand am 1. Juli<br />
1998 die erste Exhumierung statt, zum Auftakt<br />
eine Maya-Zeremonie mit vielen Blumen, Kerzen<br />
in den zeremoniellen Farben, Weihrauch<br />
und Gebeten.<br />
Der Hintergrund wird deutlich am Beispiel von<br />
Las Hoyas: Die Guerilla hatte einen Unterschlupf<br />
in der Nähe, was einem Comisionado<br />
Militar zu Ohren gekommen war. Eine Gruppe<br />
der PAC (Patrullas de Autodefensa Civil, Zivilpatrouillen)<br />
erschien mit weissen Fahnen, wurde<br />
gefesselt, andere PAC mussten sie umbringen.<br />
Darauf wurden die Guerilleros erschossen,<br />
32 Männer und Jungen insgesamt. Erst<br />
nach drei Tagen durften Angehörige an diese<br />
Stätte – mit viel Angst vor einer Falle. 1998<br />
24<br />
kam es zur Exhumierung, also 15 Jahre nach<br />
dem Massaker. Dabei konnten etliche Fotos gemacht<br />
werden, die jetzt im Gemeindesaal ausgestellt<br />
sind.<br />
Ein anderes Beispiel ist Chol bei Chajul: 42<br />
Menschen, und zwar ausschliesslich Alte, Frauen<br />
und Kinder, wurden im Dorf umgebracht,<br />
11 aus einer Familie – die Männer waren beim<br />
Maispflanzen in den Bergen gewesen! Bei der<br />
Exhumierung konnten die Überreste von 38<br />
Personen geborgen werden.<br />
Die Ausstellung im Gemeindesaal von Nebaj<br />
gibt ein eindrückliches Zeugnis der grausamen<br />
Vergangenheit.<br />
Don Antonio, Mitarbeiter in der Kirchengemeinde<br />
und Betroffener sagt: «Wir wollen,<br />
dass die Welt weiss, dass wir keine Guerilleros<br />
sind, dass unsere Familienangehörigen ermordet<br />
worden wurden, obwohl sie unschuldig waren!<br />
Wir waren weder Diebe noch kriminell,<br />
sondern ehrlich und fleissig, wir sind arm, aber<br />
sie taten nichts Schlechtes, trotzdem wurden<br />
sie umgebracht.»<br />
Im Februar 2002 wurde in Nebaj das Pfarrhaus<br />
angezündet, Gott sei Dank kamen keine Personen<br />
zu Schaden! Padre Rigoberto und seine<br />
Mitarbeiter geben nicht auf. Am 18. Februar<br />
2006 wurde der Grundstein für das neue Pfarrhaus<br />
gelegt.<br />
¡La esperanza del futuro se refleja en los<br />
rostros de los niños sonrientes del Triangulo<br />
Ixil! (In den lachenden Gesichtern der Kinder<br />
des Ixildreiecks erscheint die Hoffnung für die<br />
Zukunft!)<br />
Siehe auch "CPR: Comunidades de Población en Resistencia"<br />
(Anhang S. 3)
23. 02. 06: Xix (APDK, AMDI, Instituto «Nuevos Mayas»)<br />
Beneficio «Asociación de Poblaciones<br />
Desarraigadas K‘iche» (APDK)<br />
Wir werden vom Präsident und dem Schatzmeister<br />
des Beneficios empfangen. Organisationsform<br />
des Beneficios ist eine asociación, ein<br />
Verein, und ist während der Zeit der Aufstandsbekämpfung<br />
entstanden. Die Leute von<br />
Xix mussten damals in die Berge fliehen, daher<br />
der Name «Verein Entwurzelter Quiché-Bevölkerung».<br />
Nach dem Krieg hatten sie insofern<br />
Glück, als sie auf ihr eigenes Land zurückkehren<br />
konnten. Da sie sich gezwungen sahen,<br />
den Kaffee besser zu produzieren und zu vermarkten,<br />
gründeten sie APDK und produzierten<br />
Biokaffee. Der Verein zählt 230 Mitglieder<br />
aus 32 umliegenden Gemeinden, darunter<br />
auch Ixiles, die ihren Kaffee ins Beneficio der<br />
APDK bringen. Hier in Xix sind die Leute<br />
Quiché, teilweise sind ihre Grosseltern von<br />
Xela (Quetzaltenango) und anderen Orten auf<br />
der Suche nach Land und Arbeit hierher gekommen.<br />
Deshalb leben sie als Quiché hier im<br />
Ixil-Dreieck.<br />
Vor einem Jahr überprüfte eine kolumbianische<br />
Biolabel-Organisation, die auch eine Niederlassung<br />
in Nicaragua hat, ob die Kaffeeproduktion<br />
der APDK-Mitglieder die Kriterien des biologischen<br />
Anbaus erfüllte. Diese Prüfung ist positiv<br />
ausgefallen, doch wartet die APDK noch immer<br />
auf die offizielle Zertifizierung, um von der<br />
nächsten Ernte an Biokaffee verkaufen zu können.<br />
Die Zertifizierung kostet die asociación<br />
etwa 35‘000 Q. und muss jährlich wiederholt<br />
werden. Diese Ausgaben belasten sie sehr.<br />
Die Mitglieder sollen befähigt werden, den Kaf-<br />
25<br />
feeanbau und die biologische Produktion noch<br />
zu verbessern. Um selbst solche Weiterbildungen<br />
hier in Xix durchführen zu können, möchte<br />
die APDK ein Gebäude einrichten.<br />
Die asociación hat einst auch Kardamom angebaut.<br />
Doch weil dessen Preis in den Keller gefallen<br />
ist, konzentriert sie sich nun ganz auf<br />
Kaffee. Diesen musste sie bisher an nationale<br />
Zwischenhändler verkaufen. Mit der Zertifizierung<br />
ändert sich dies, und sie kann ihren Kaffee<br />
auch zu einem besseren Preis verkaufen.<br />
Der direkte Verkauf ins Ausland bringt aber<br />
auch Probleme mit sich, die APDK benötigt<br />
noch weitere Papiere (z.B. eine Exportlizenz<br />
von ANACAFE, dem nationalen Kaffeeinstitut),<br />
Stempel und Zertifizierungen, damit ihr Kaffee<br />
im Abnehmerland mit dem gewünschten Label<br />
(bio, fair trade) verkauft werden kann. Und<br />
wie für das Bio-, so muss auch für das Fair<br />
Trade-Zertifikat jährlich ein bestimmter Betrag<br />
hingeblättert werden. Die APDK möchte auch<br />
dieses Zertifikat erwerben, um ihren Kaffee zu<br />
einem besseren und<br />
von Kaffeemarkt-Krisen<br />
unabhängigeren Preis<br />
verkaufen zu können.<br />
Die genauen Kriterien,<br />
die für die Fair Trade-<br />
Zertifizierung nötig<br />
sind, können uns die<br />
Vertreter der APDK<br />
nicht nennen – vieles<br />
rund um den internationalen<br />
Kaffeemarkt<br />
und die verschiedenen<br />
Labels ist den KaffeebäuerInnen<br />
noch<br />
fremd. Sie erzählen<br />
uns aber, dass darauf<br />
geschaut werde, wie<br />
ein Verein oder eine<br />
Kooperative organisiert<br />
sei und welchen Preis<br />
die BäuerInnen für den<br />
Kaffee erhielten. Auch müsse der Verein seine<br />
Buchhaltung einreichen.<br />
Die BäuerInnen trocknen den Kaffee selbst,<br />
bevor sie ihn mit Maultieren und Lastwagen<br />
hierher ins Beneficio bringen. Wenn die Kaffeebohnen<br />
gepflückt werden, sind sie rot. Dann<br />
werden die weissen Bohnen aus den Kirschen<br />
herausgeschält und an der Sonne getrocknet.<br />
Jene Bohnen, die wieder ausgesät werden,<br />
dürfen nur zwei Stunden getrocknet werden<br />
und werden deshalb bereits bei der Ernte aus-
sortiert. Die getrockneten weissen Kaffeebohnen<br />
nennt man «Pergamino», weil sie noch in<br />
ein feines Häutchen gehüllt sind. Wenn das<br />
Häutchen entfernt ist, spricht man von «Oro».<br />
Die APDK hat bisher Pergamino produziert,<br />
möchte nun aber den zusätzlichen Arbeitsgang,<br />
um Oro herstellen zu können, selbst<br />
durchführen. Die Rigoberta Menchú-Stiftung<br />
hat ihr über eine baskische Organisation die<br />
dafür nötige Maschine und den Bau des Beneficios<br />
finanziert – sich aber darüber hinaus um<br />
nichts gekümmert. So ist die asociación zwar<br />
im Besitz der Maschine, darf sie aber nicht benutzen,<br />
da es für die Herstellung von Oro eine<br />
entsprechende Bewilligung braucht (wahrscheinlich<br />
die Exportlizenz).<br />
Für einen 50kg-Sack Pergamino erhält die<br />
APDK von den coyotes 650 Q. Wenn sie Oro<br />
direkt an einen Exporteur verkaufen kann, erhält<br />
sie dafür einen besseren Preis. Im Moment<br />
verkauft sie ihren Kaffee (Pergamino) an<br />
einen Grosshändler und erhält dafür 700 Q.<br />
Die Mitglieder müssen nun etwas ausharren,<br />
bis die asociación im Besitz des Bio- und des<br />
Fair Trade-Zertifikats ist und den Kaffee gegen<br />
Dollars verkaufen kann. Obwohl sie auch noch<br />
über keinen Fonds (Eigenmittel) verfügt und<br />
von den 700 Q. pro Sack noch etwas für die<br />
asociación abfällt, lohnt es sich für die Mitgliederfamilien,<br />
ihren Kaffee an die APDK und<br />
nicht direkt an einen coyote zu verkaufen.<br />
Wieviel die Familien schlussendlich pro Sack<br />
Kaffee erhalten, erfahren wir nicht.<br />
Im Moment stehen die BäuerInnen der APDK<br />
am Anfang der diesjährigen Kaffee-Ernte (es<br />
stehen erst wenige gefüllte Säcke in der grossen<br />
Halle). Die asociación rechnet mit etwa<br />
2000 Säcken, das wären doppelt so viele wie<br />
vor einem Jahr.<br />
Nebst dem Beneficio betreibt die APDK eine<br />
Baumschule, wo pinos (Fichten) und Erlen gezüchtet<br />
werden, insgesamt 10‘000 Pflanzen.<br />
Diese gibt sie den soci@s (Mitglieder der asociación)<br />
als Holzlieferanten für Bretter, Möbel<br />
etc. ab. Ein Vorteil dieser Pflanzen besteht darin,<br />
dass sie nicht gegossen werden müssen.<br />
-> Lorenzo Acabal Hernández (Presidente y Representante)<br />
E-mail: apdk_xix@yahoo.com<br />
26<br />
Asociación de Mujeres para el Desarrollo<br />
Integral (AMDI)<br />
Nach dem Mittagessen (Suppe mit Fleisch und<br />
Gemüse, Tortillas) werden wir von folgenden<br />
Frauen begrüsst: Cristina López (Rechtsvertreterin),<br />
Juana (erste Sprecherin), Marcela (Mitglied<br />
der junta directiva), Maria (Beirätin), Juana<br />
(Sekretärin). Die Frauen haben die AMDI<br />
im Jahr 2002 gegründet. Die EU hat sie bei der<br />
Legalisierung der Organisation unterstützt und<br />
ihr ein paar kleinere Dinge wie Stühle, Tische<br />
und Stacheldraht finanziert. Im ersten Jahr haben<br />
die Frauen mittels Krediten Kühe gekauft.<br />
Seit den beiden letzten Jahren betreiben 65<br />
Frauen ein neues Projekt mit Schafen, das sie<br />
dank der Unterstützung des Bürgermeisters<br />
von Chajúl starten konnten. Sie erhielten das<br />
Geld dafür geschenkt, müssen also nichts zurückbezahlen.<br />
Bei den Kühen war das anders,<br />
da mussten sie mit dem Gewinn aus dem Projekt<br />
den Kredit abzahlen. Trotzdem blieb auch<br />
damals ein kleiner Gewinn, mit dem sie neue<br />
Kühe kaufen konnten. Das Projekt haben sie<br />
heute noch. Wie bei den Kühen, so geht es ihnen<br />
auch bei den Schafen v.a. ums Fleisch,<br />
nicht um die Wolle. Ihre Grossmütter hatten<br />
noch gesponnen, sie selbst tun das nicht mehr.<br />
Jede Frau hat zwei Schafe, einen Bock und<br />
eine Kuh erhalten. Die Aufgabe der Männer ist<br />
es, die Weiden zu pflegen und sauber zu halten.<br />
Zum Projekt gehört auch, dass jede Frau<br />
einen Stall hat für die Tiere.<br />
Die AMDI ist eine reine Frauengruppe – da sich<br />
die Frauen in gemischten Gruppen oft nicht zu<br />
sprechen trauen.<br />
Die asociación wollte auch ein Projekt mit Medizinalpflanzen<br />
aufziehen, doch da sie keine<br />
Trocknungsanlage kriegte, scheiterte es. Nun<br />
hat jede Frau bei sich im Garten einige Kräuter.<br />
Wahrscheinlich, so die Frauen der AMDI, ist es<br />
ein Überbleibsel der CPR, dass die Leute hier<br />
so gut organisiert sind. Jene, die aus den CPR<br />
(comunidades de población en resistencia) zurückgekommen<br />
sind, haben ihre Organisationen<br />
beibehalten, wer später dazugekommen<br />
ist, hat sich ebenfalls organisiert. Auch hier<br />
waren die Männer in die PAC (patrullas de autodefensa<br />
civil) gezwungen worden – auch diese<br />
Organisationen sind erhalten geblieben. Die<br />
verschiedenen Organisationen haben nun unterschiedliche<br />
Aufgaben (z.B. Kaffee: APDK;<br />
Schafe: AMDI etc.). In den CPR hatte es keine<br />
Frauenorganisation gegeben, aber ein Frauenkomitee.<br />
Die Frauen in der AMDI werden von<br />
ihren Männern unterstützt.<br />
Seit ihrer Gründung arbeitet die Asociación<br />
auch mit Kindern. Sie hatten schon 28 Fälle
unterernährter Kinder aufs Mal, im Moment<br />
sind es «nur» 10. Die Frauen der Umgebung<br />
werden hierher eingeladen, wo sie von einer<br />
Fachfrau über Ernährung, Stillen und Familienplanung<br />
informiert werden. Unterdessen sind<br />
die Frauen von AMDI<br />
selbst zu Promotorinnen<br />
geworden. Die<br />
«Technikerinnen» von<br />
aussen sprechen oft<br />
nur Spanisch, was aber<br />
viele Frauen hier nicht<br />
verstehen. Unter den<br />
Gesundheitspromotorinnen<br />
sind auch Hebammen.<br />
Das Hauptproblem in<br />
Bezug auf die Kinder<br />
ist weniger fehlende<br />
Ernährung als viel<br />
mehr die mangelnde<br />
Hygiene, wegen der<br />
die Kinder Durchfall<br />
bekommen. Hygiene<br />
ist deshalb ein wichtiges<br />
Thema in den Kursen<br />
der AMDI.<br />
Es hat hier im Dorf eine Schule für die ersten<br />
sechs Jahre. Danach müssen die Kinder eine<br />
entferntere Schule besuchen, was aber wegen<br />
der Unterkunft und des Essens teuer ist. Trotzdem<br />
gibt es hier in Xix einige, deren Kinder<br />
weiter studieren, so z.B. auch der Sohn von<br />
Cristina.<br />
Die Primarschule ist obligatorisch. Für die weiterführende<br />
Schule stellt das hier ansässige<br />
Institut «Nuevos Mayas» (s. unten) Stipendien<br />
zur Verfügung. In der öffentlichen Schule erhalten<br />
die Kinder in der Pause einen Atól<br />
(Maisgetränk) o.ä., aber keine Milch. Im Institut<br />
dagegen kriegen die unterernährten Kinder<br />
jeden Morgen ein Glas Ziegenmilch.<br />
Arbeit gibt es in Xix nicht viel. Die meisten<br />
Leute sind gezwungen, für Arbeit an die Küste<br />
zu fahren. Daneben haben sie noch die Selbstversorgung.<br />
Dank der Projekte geht es den Frauen besser:<br />
Sie haben auf einem bestimmten Gebiet Erfahrungen<br />
gesammelt und auch nicht mehr so<br />
grosse Scheu, in einer Gruppe oder gar auf<br />
Spanisch zu sprechen. Cristina hat Spanisch<br />
aus Notwendigkeit gelernt, z.T. von ihrer Mutter.<br />
Wenn eine Organisation die AMDI mit dem nötigen<br />
Geld unterstützen würde, würde sie ihren<br />
Mitgliedern gerne Kleinkredite zur Verfügung<br />
stellen, damit diese ein kleines Geschäft eröff-<br />
27<br />
nen oder zusätzliche Tiere kaufen könnten.<br />
Kredite auf der Bank zu erhalten, ist schwierig,<br />
und den meisten Frauen wird der Zugang zu<br />
Krediten zusätzlich durch die Sprache (Spanisch)<br />
verwehrt. Zudem müssen die Kredit-<br />
nehmerInnen ihre Papiere auf der Bank abgeben,<br />
was viele nicht tun wollen – aus Angst,<br />
sie nicht mehr zurückzuerhalten. Die asociación<br />
hat unterdessen ein kleines Kapital von<br />
5000 Q., das sie für Kleinkredite einsetzt. Anfangs<br />
hat sie von einem Projekt in Ixil Beratung<br />
erhalten, unterdessen haben die Frauen<br />
eigene Erfahrungen gemacht und schreiten<br />
langsam vorwärts, lernen stetig dazu.<br />
Die asociación hätte auch gerne ein Vereinslokal.<br />
Der Raum, in dem sie uns empfangen haben<br />
und in dem sie ihre Treffen und Kurse abhalten,<br />
gehört Cristina, die ihn dafür zur Verfügung<br />
stellt.<br />
Erwachsenenbildung kann die AMDI nicht anbieten,<br />
obwohl der Bürgermeister ihnen dafür<br />
eine Lehrperson zur Verfügung gestellt hätte.<br />
Dem Verein fehlt das Geld, um diese Person<br />
bezahlen zu können.<br />
Zum Schluss erzählen die Frauen noch von ihrem<br />
Aufforstungsprojekt. Nur jene Frauen können<br />
bei der Aufforstung mitarbeiten, die ein<br />
Stück eigenes Land haben, wo sie die Bäume<br />
anpflanzen können. Da es nicht genug Land<br />
für alle hat, können also nicht alle Frauen in<br />
diesem Projekt mitmachen.
«Centro de Formación Nuevos Mayas»<br />
Wir werden vom Direktor des Zentrums, Don<br />
José, empfangen. Er erzählt uns, dass das Institut<br />
im Jahr 2002 gegründet wurde. José war<br />
während der Aufstandsbekämpfung drei Jahre<br />
in den Bergen gewesen. Danach hatte er die<br />
Gelegenheit, bei Schwestern zu studieren. Bereits<br />
in den Bergen hatte ihn der Gedanke verfolgt,<br />
dass die Kinder auf dem Land das lernen<br />
können sollten, was sie hier brauchen. Deshalb<br />
gründete er nach seiner Rückkehr eine asociación,<br />
die dann diese Schule gründen sollte. Zuerst<br />
führte die asociación aber eine Umfrage<br />
zur Bedürfnisabklärung durch. Dabei hatten er<br />
und seine compañer@s herausgefunden, dass<br />
nur fünf von zehn Kindern bis über die 5. Klasse<br />
hinauskommen und dass von diesen fünf<br />
vier Knaben sind. Hier im Ixil gab es noch<br />
2002 eine AnalphabetInnenrate von 70%.<br />
Gründe dafür sind die Armut der Leute und die<br />
weite Entfernung der Ausbildungsmöglichkeiten<br />
von ihren Wohnorten. Deshalb entschlossen<br />
sich José und seine compas, dieses Institut<br />
«Nuevos Mayas» zu gründen, das ausschliesslich<br />
für Indígenas ist.<br />
Die Schule soll selbsttragend sein, was ein<br />
hoch gestecktes Ziel ist. Es ist den BetreiberInnen<br />
deshalb wichtig, weil der Staat keine<br />
Schulen finanziert, die über die Primarschulstufe<br />
hinausgehen. Der Staat, so José, baue<br />
Strassen u.ä., gebe aber viel zuwenig Geld für<br />
Bildung aus.<br />
Die Idee von «Nuevos Mayas» ist es, dass die<br />
SchülerInnen nach ihrer Ausbildung entweder<br />
weiter studieren oder wieder in ihre Dörfer zu-<br />
28<br />
rückkehren und dort als PromotorInnen für<br />
Entwicklung arbeiten. Somit geht es dem Institut<br />
nicht nur um die individuelle Förderung<br />
einzelner Kinder. Auf der Sekundarstufe (basico)<br />
beschäftigen sich die SchülerInnen nicht<br />
nur mit Allgemeinbildung, sondern auch mit<br />
der Landwirtschaft. Sie lernen z.B., wie man<br />
Samen gewinnt, den Boden fruchtbar hält etc.<br />
Dieses Wissen sollen sie dann als PromotorInnen<br />
in ihre Dörfer tragen. Sie lernen auch, vor<br />
Leute hinzustehen, zu sprechen und Vorträge<br />
zu halten.<br />
Hier in der Schule werden Versuche durchgeführt,<br />
um herauszufinden, was gut wächst,<br />
was funktioniert und was nicht. Nur diese Dinge,<br />
die in der Praxis erfolgreich sind (also kein<br />
abstrakt-theoretisches Wissen, das vielleicht<br />
für die Praxis in dieser Umgebung unnütz ist),<br />
tragen die SchülerInnen in ihre Dörfer zurück.<br />
Die SchülerInnen der<br />
Sekundarstufe sollen<br />
auch hier in Xix und in<br />
den umliegenden comunidades<br />
als HilfslehrerInnenÜbersetzungsarbeit<br />
leisten, da die LehrerInnen<br />
oft die Sprache<br />
der Kinder (eine Mayasprache)<br />
nicht verstehen.<br />
Von Januar bis Oktober<br />
findet im «Nuevos Mayas»<br />
der Unterricht statt<br />
(für die PrimarschülerInnen<br />
jeweils nachmittags,<br />
für die SekundarschülerInnen<br />
ganztags – morgens<br />
Schule, nachmittags<br />
LdW), im November<br />
und Dezember sollen die<br />
SchülerInnen in ihren<br />
comunidades Nachhilfeunterricht<br />
für Kinder und auch für Erwachsene<br />
erteilen. Dies tun sie während zwanzig Stunden,<br />
der Rest dieser zwei Monate steht ihnen<br />
als Ferien zur Verfügung. Der Bürgermeister<br />
oder eine andere zuständige Person stellt ihnen<br />
danach eine entsprechende Bestätigung<br />
aus.<br />
Der Unterricht im Institut ist zweisprachig, damit<br />
die Kinder auch die Mayasprachen schätzen.<br />
Nebst dem spanischsprachigen Unterricht<br />
erhalten die SekundarschülerInnen, je nach<br />
Muttersprache, Unterricht in Quiché oder Ixil,<br />
in nach Sprachen getrennten Klassen. Auf der<br />
Primarstufe wird kein Ixil unterrichtet, da die<br />
Kinder auf dieser Stufe alle von hier und also
Quichés sind. Die Kinder sollen ihre Sprache<br />
nicht nur sprechen, sondern auch lernen, sie<br />
zu lesen und zu schreiben. Dazu haben die<br />
LehrerInnen hier, zusammen mit einem Zentrum<br />
in Chichicastenango, ein Computerprogramm<br />
entwickelt.<br />
Da die Umfrage vor der Gründung des «Nuevos<br />
Mayas» gezeigt hat, dass nur sehr wenige<br />
Mädchen länger als fünf Jahre zur Schule gehen,<br />
möchte das Institut Mädchen gezielt fördern,<br />
indem es mehr Mädchen als Knaben aufnimmt.<br />
Fürs Internat wird nur zugelassen, wer<br />
mehr als zehn Fussstunden von einer Schule<br />
entfernt wohnt. Auch werden Kinder bevorzugt,<br />
deren Familien während der Zeit der violencia<br />
von Repression betroffen waren.<br />
Die Kinder aus der Umgebung bezahlen pro<br />
Monat 60 Q., jene von weiter her, die im Internat<br />
wohnen, bezahlen 200 Q., v.a. für Essen<br />
und Unterkunft. Wenn die Eltern diesen Betrag<br />
nicht bezahlen können, kann der Vater ein<br />
paar Tage hier auf dem Schulgelände arbeiten,<br />
wofür er 30 Q. pro Tag erhält. Diese Möglichkeit<br />
ist in Guatemala einzigartig.<br />
Für den Bau der Schule erhielt das Institut<br />
eine zusätzliche Unterstützung, eine Art Patenschaft,<br />
von Schweden.<br />
Jene sechs LehrerInnen, die auf der Primarstufe<br />
unterrichten, werden vom Staat bezahlt.<br />
Von den vier LehrerInnen der Sekundarschule<br />
werden zwei von den Beiträgen der Familien<br />
bezahlt. Alle LehrerInnen waren an der Uni<br />
oder sind noch immer dort und führen ihr Studium<br />
weiter (jeweils samstags). Die meisten<br />
werden im Jahr 2008 ihr Pädagogik-Studium<br />
abschliessen. Dann möchten sie dieses Wissen<br />
auch hier an der Schule vermitteln.<br />
Momentan werden hier 120 Kinder auf der Primar-,<br />
60 auf der Sekundarstufe unterrichtet.<br />
Die Primarschule gibt es erst seit diesem Jahr,<br />
seither leidet die Schule an Platzmangel: Es<br />
gibt lediglich drei Schulzimmer, unterrichtet<br />
wird z.B. auch im Essraum. Nun sollen sechs<br />
Schulräume angebaut werden, die von internationalen<br />
Organisationen finanziert werden.<br />
Die Nachhaltigkeit ist dem Institut sehr wichtig.<br />
Don José hat z.B. die Idee, eine Fabrik für<br />
Atól aufzubauen, den er übers Erziehungsministerium<br />
verkaufen möchte. Denn dieses ist<br />
verpflichtet, den SchülerInnen eine Pausenver-<br />
29<br />
pflegung anzubieten.<br />
Die Schule möchte auch persönliche Patenschaften<br />
für einzelne SchülerInnen fördern,<br />
um den Kindern die Ausbildung hier zu ermöglichen.<br />
V.a. für Mädchen sollen PatInnen gesucht<br />
werden. Die Patenkinder müssen pro<br />
Jahr drei Briefe an ihre Patin oder ihren Paten<br />
schreiben: einen im Januar, in dem sie über<br />
die Ferien, über die Festtage und ihre Familie<br />
berichten, einen im Juni, in dem sie erzählen,<br />
was sie im ersten Halbjahr gelernt haben, was<br />
sie gerne machen und was ihnen Schwierigkeiten<br />
bereitet und einen im November, in dem<br />
sie die Themen des zweiten Briefs aufs zweite<br />
Halbjahr bezogen erläutern. Don José bittet<br />
uns, bei uns zu Hause von der Möglichkeit,<br />
eine Patenschaft zu übernehmen, zu berichten.<br />
Das Schulmaterial, das in den öffentlichen<br />
Schulen verwendet wird, hat nichts mit der<br />
Realität der Kinder zu tun. Deshalb arbeiten<br />
sie hier im «Nuevos Mayas» auch mit anderem<br />
Material. Für die Kinder im Kindergarten gibt<br />
es vier thematische Ecken, in denen sie sich<br />
mit unterschiedlichen Materialien (z.B. mit<br />
Malutensilien) und mit unterschiedlichen Themen<br />
beschäftigen können. Das Erziehungsministerium<br />
besteht darauf, dass an allen Schulen<br />
mit den üblichen Schulbüchern gearbeitet<br />
wird. Die Schule hat dem Ministerium nun einen<br />
Brief geschrieben, dass diese Bücher nicht<br />
der Realität der Kinder hier entsprächen. Sie<br />
möchte nun mit Unterstützung einer US-Organisation<br />
eigenes Schulmaterial erarbeiten.<br />
Auch bei der Wahl der LehrerInnen hat das Institut<br />
einen ständigen Kampf mit dem Erziehungsministerium<br />
auszufechten, da das «Nuevos<br />
Mayas» LehrerInnen aus der Region anstellen<br />
möchte. Nun beschäftigt es drei fest<br />
angestellte LehrerInnen von hier und drei aus<br />
Quiché, die jedes Jahr neu eingestellt werden<br />
müssen.<br />
Die Schule arbeitet mit den Kindern auch zur<br />
jüngsten Geschichte Guatemalas. Sie hat ein<br />
Denkmal errichtet, das an die schlimmen Ereignisse<br />
während der Aufstandsbekämpfung<br />
erinnert. Jeweils am 16. Februar organisiert<br />
sie einen Tag der Erinnerung – an jenem Tag<br />
hatte das grösste Massaker in der Umgebung<br />
stattgefunden. Deswegen hat die Schule bereits<br />
Drohungen erhalten.
24. 02. 06: San Bartolomé Jocotenango – San Pedro Jocotenango<br />
Abschied von Nebaj – ein letzter Blick in das<br />
idyllische Tal hinunter zeigt die Grösse des Kirchengevierts<br />
inmitten der Strassenquadrate.<br />
Antonio lenkt den Bus sicher durch die heiklen<br />
Passagen der zum Teil engen Passstrasse; die<br />
Landschaft ist grün, in dieser Gegend gibt es<br />
genug Wasser. Wieder die schmalen, bis hoch<br />
hinauf und extrem steil angelegten Felder.<br />
Beim Fotostopp mit Blick über die Bergketten<br />
entpuppt sich ein grosses Insekt an einem<br />
Busch plötzlich als Kolibri!<br />
Wir durchqueren wieder Sacapulas und fahren<br />
nach San Bartolomé Jocotenango. Die<br />
Staubstrasse windet sich endlos entlang einer<br />
dunkel bewaldeten Bergkette; San Bartolome<br />
liegt am Ende der Welt. Hier gibt es 13 evangelikale<br />
Kirchen – die wenigen Gebäude, die<br />
frisch bemalt und in gutem Zustand sind.<br />
Offenbar sind viele KatechetInnen gezwungen<br />
worden, zu den Evangelikalen überzutreten.<br />
Bei der Fahrt durch die Ortschaft<br />
fallen uns auch die überaus zahlreichen<br />
Parteiparolen und Parteikürzel auf den<br />
Hausmauern auf.<br />
Ulrike Morsell, eine Deutsche, die 1972 mit<br />
der katholischen Entwicklungshilfe nach<br />
Guatemala gekommen ist, ein Jahr in San<br />
Bartolomé verbracht hat und heute den diözesanen<br />
Caritas-Verband in Quiché leitet,<br />
trifft uns hier. Sie hat die betagte Manuela<br />
Makzoy und ihre Tochter Margarita ins Kloster<br />
der kolumbianischen Suoras de Madre<br />
Laura mitgebracht, wo wir das Mittagessen<br />
zusammen mit den vier Klosterschwestern<br />
einnehmen.<br />
Manuelas Mann und ihre drei Söhne wurden<br />
im Krieg umgebracht. Margarita erzählt,<br />
dass die Bevölkerung hier und ganz speziell<br />
die Frauen unter der violencia extrem gelitten<br />
haben. Hier gab es keine Rechte für<br />
Frauen; eine Frau konnte auch kein Land<br />
erben. Marguerita erkämpfte sich dann mit<br />
Hilfe der Caritas vor dem Gericht in Quiché<br />
nach einer rund 6-jährigen Prozessdauer<br />
das Recht auf das Land ihres Vaters.<br />
San Bartolomé hinterlässt einen desolaten<br />
Eindruck – eine Ortschaft voll drückender<br />
Hoffnungslosigkeit, weit abgelegen und vergessen.<br />
Der Klosterhof mit den Blumen darin<br />
hat etwas Irreales, die Klosterfrauen scheinen<br />
auf einer Insel zu leben, mit wenig Bezug zur<br />
Aussenrealität.<br />
Auf der Weiterfahrt Richtung Quiché machen<br />
wir in San Pedro Jocotenango Halt. In einem<br />
an den Kirchhof grenzenden Gemeinde-<br />
30<br />
saal gibt uns die Gruppe «Xocopila» ein begeisterndes<br />
und nach dem Besuch in San Bartolomé<br />
besonders wohltuendes Marimba-Konzert.<br />
Gleichzeitig findet eine Hochzeit statt –<br />
es ist amüsant, zuzuschauen, wie der Zug mit<br />
der Braut sich auf die Zeremonie vorbereitet<br />
und schliesslich Richtung Kirche entschwindet.<br />
Mit Hingabe lassen die Schüler der Basico-Stufe<br />
die Schlagstäbe mit den Gummiköpfen auf<br />
die Holzstücke niedersausen. Dazu kommen<br />
auch ein Piccolo, Perkussion, auch auf einem<br />
Schildkrötenpanzer, und Schlagzeug.<br />
Die Marimba ist das typische Landesinstrument:<br />
Ein riesiges Xylophon, der Klangkörper<br />
aus Ameisenbaum, darunter hölzerne Resonanzkästen.<br />
Ein eingesetztes Stück Schweinedarm<br />
verstärkt die hölzernen Nachklänge zusätzlich.<br />
In dieser Gegend sind die Häuser hauptsächlich<br />
aus Lehm, mit Ziegeldächern – im Gegensatz<br />
zu San Marcos, wo die Behausungen vor<br />
allem aus Zementbacksteinen und Wellblechdächern<br />
bestehen. Auf der Weiterfahrt halten<br />
wir kurz in Quiché und treffen dann schon<br />
nach dem Eindunkeln in Chichicastenango<br />
ein, wo uns ein Schild am Strassenrand mit Bienvenidos<br />
en el Mecca del Turismo begrüsst.
25. 02. 06: Chichicastenango, Pastoral de la Tierra Quiché<br />
Felipe Zapeta von Caritas Quiché besucht uns<br />
im Hotel und erzählt uns von den Problemen,<br />
mit denen er bei seiner Arbeit konfrontiert ist.<br />
Viele der gegenwärtigen Probleme sind älter<br />
als 100 Jahre. Das Landproblem hat mit der<br />
Kolonialisierung begonnen. Mit immer wieder<br />
neuen Gesetzen wurden die Indígenas um ihr<br />
Land gebracht.<br />
Das beste Land ist an der Pazifikküste, wo es<br />
flach ist. Dort gibt es grosse Fincas für Exportprodukte<br />
wie Zucker oder Baumwolle. Daneben<br />
gibt es das Hochland sowie die Ebene im<br />
Petén, die nicht sehr fruchtbar ist und wo bis<br />
vor kurzem Urwald stand (und zum Teil immer<br />
noch steht). Die Ländereien an der Küste werden<br />
von wenigen Familien beansprucht: viel<br />
Land gehört einigen wenigen Leuten.<br />
Das Landproblem ist ein historisches und<br />
strukturelles Problem – strukturell deshalb, da<br />
die Enteignungen juristisch legalisiert wurden.<br />
Viele Leute besitzen ein wenig Land, haben<br />
ihre Besitzrechte aber nicht juristisch abgesichert.<br />
Oft fehlen ihnen auch die Mittel, um das<br />
Land richtig fruchtbar machen zu können.<br />
Verschiedene comunidades haben angefangen,<br />
das Land, das ihnen weggenommen wurde,<br />
zurückzufordern. Keine der bisherigen Regierungen<br />
hat das Landproblem gelöst.<br />
Das Departement Quiché zählt ca. 650‘000<br />
EinwohnerInnen, davon sind rund 55% Frauen<br />
und über die Hälfte unter 18 Jahren alt. 85%<br />
der EinwohnerInnen leben auf dem Land, 87%<br />
sind Mayas, davon ein Grossteil Quiché. Nach<br />
den Departementen von San Marcos und Alta<br />
Verapaz ist Quiché das drittärmste Departement<br />
Guatemalas. 65% der Leute hier sind<br />
arm.<br />
In Bezug auf das Land stellen sich den Leuten<br />
v.a. drei Fragen: Wem gehört das Land? Was<br />
produzieren wir darauf? Was machen wir mit<br />
den Produkten?<br />
Der Staat kümmert sich kaum um die Landwirtschaft<br />
im Quiché. In den letzten Jahren hat<br />
er ein paar Strassen gebaut, das war alles. Die<br />
jetzige Regierung (Oscar Berger) handelt im<br />
Interesse der grossen Unternehmen. Zwei Beispiele<br />
dafür sind der Bergbau und der Freihandel.<br />
Der Quiché war schon immer ein Reservoir für<br />
Arbeitskräfte. Im Süden des Departements migrierten<br />
jeweils 85% während der Erntezeit<br />
auf die Fincas an der Küste. Wegen der seit<br />
etwa vier Jahren andauernden Kaffeekrise sind<br />
es heute weniger. Einige fanden auf den Zuckerrohrfincas<br />
Arbeit, andere migrieren in die<br />
31<br />
Stadt, wo sie als StrassenverkäuferInnen arbeiten,<br />
wieder andere gehen in den Norden.<br />
Seit 1984 führt die Caritas im Quiché Projekte<br />
durch. In den ersten ging es darum, die Leute<br />
zu unterstützen, dass sie wieder zu Tieren kamen.<br />
1988 zog sie ein Kreditprojekt auf, damit<br />
die Leute Land kaufen konnten. Die Pastoral<br />
de la Tierra unterstützt die BäuerInnen darin,<br />
selbst biologischen Dünger herzustellen und<br />
auf der nicht sehr fruchtbaren Erde eine nachhaltige<br />
Produktion zu betreiben. Denn die Leu-<br />
te arbeiten z.T. von morgens 4 Uhr bis abends<br />
18 Uhr, um das Geld für die chemischen Düngemittel<br />
zu verdienen. Caritas möchte die Leute<br />
auch davon überzeugen, die Produktion zu<br />
diversifizieren, nicht nur Mais und Bohnen anzubauen.<br />
Ein weiterer Bereich der Caritas-Arbeit sind die<br />
juristischen Probleme des Landbesitzes. Hier<br />
im Quiché gibt es nur sehr wenige Fincas. Das<br />
Problem der Landbesetzung (vgl. 14. 02. 06:<br />
Colomba) gibt es deshalb hier nicht. Das Problem<br />
ist, dass die Leute keine juristische Besitzbescheinigung<br />
für ihr Land haben.
Vor zwei Jahren begann die Caritas Quiché, in<br />
einem dritten Bereich zu arbeiten: in der Vermarktung<br />
der Produkte. Damit möchte sie den<br />
gerechten Handel fördern, nicht einfach nach<br />
Marktprinzipien arbeiten. Ihr Ziel ist es, unter<br />
den BäuerInnen das Bewusstsein zu schärfen<br />
für die Bedeutung von Organisation und Solidarität,<br />
und die Zwischenhändler hier auf dem<br />
Land umgehen zu können. Die Leute sollen<br />
nicht unbedingt mehr Mais produzieren, sondern<br />
sie sollen unabhängiger werden von äusseren<br />
Umständen, wie z.B. billigen US-Importen<br />
oder teuren Düngemitteln. Gegen Freihandelsabkommen<br />
beispielsweise mit Taiwan oder<br />
Kolumbien hat Felipe nichts einzuwenden,<br />
doch jenes mit den USA macht die KleinbäuerInnen<br />
abhängig. Die USA produzieren mit 4%<br />
der Bevölkerung 21% der Güter weltweit und<br />
wollen sie den anderen aufdrängen. Es geht<br />
ihnen nicht um einen partnerschaftlichen Handel,<br />
sondern um die natürlichen Ressourcen<br />
(Öl, Edelmetalle etc.) und darum, ihre Überproduktion<br />
loszuwerden.<br />
In beiden Fällen – Minen und Freihandelsabkommen<br />
– wurde die Bevölkerung weder informiert<br />
noch befragt. Nur 23 von 158 Kongressabgeordneten<br />
waren überhaupt interessiert,<br />
mehr über das Freihandelsabkommen mit den<br />
USA zu erfahren. Alle anderen haben einfach<br />
abgestimmt. Das Abkommen wurde im März<br />
2005 vom Kongress ratifiziert. Da die Politiker-<br />
Innen wussten, dass sie damit eine Protestwelle<br />
auslösen würden, haben sie im Vorfeld zwölf<br />
sozialpolitische Gesetze versprochen. Davon<br />
wurden unterdessen gerade mal vier verabschiedet<br />
– und gleichzeitig verhandelt der Kongress<br />
neue neoliberale Gesetze. Der Druck der<br />
USA, diese Gesetze durchzubringen, ist natürlich<br />
um einiges grösser als der Druck der Bevölkerung,<br />
die sozialen Gesetze zu realisieren.<br />
Alle zentralamerikanischen Staaten ausser<br />
Costa Rica haben CAFTA, das Freihandelsabkommen<br />
zwischen Zentralamerika und den<br />
USA, ratifiziert. Doch für die Inkraftsetzung<br />
braucht es in den einzelnen Ländern noch verschiedene<br />
Gesetze. Deshalb verhandeln die<br />
USA nun einzeln mit den jeweiligen Staaten.<br />
Das Abkommen berücksichtigt keine Organisationen<br />
und keine lokalen Besonderheiten. Es<br />
bringt z.B. einen Grossgrundbesitzer in den direkten<br />
Wettbewerb mit einem Landarbeiter,<br />
der 400 Q. im Monat verdient.<br />
Felipe ist der Meinung, dass man in Guatemala<br />
einsehen müsse, nicht ewig von der Landwirtschaft<br />
leben zu können. Man müsse die Produktion<br />
erweitern und auch veredelte Produkte<br />
32<br />
verkaufen (z.B. Kaffee, Kardamom). Auch birgt<br />
die Förderung des Binnenhandels, nebst dem<br />
Aussenhandel, ein grosses Potential, das bislang<br />
weitgehend ausser Acht gelassen wurde.<br />
Vier Wirtschaftsbereiche könnten für Guatemala<br />
und die Leute im Quiché interessant sein:<br />
Ökotourismus, Weiterentwicklung der LdW für<br />
den Export (Veredelung der Produkte), Textilindustrie,<br />
Waldwirtschaft und Aufforstung.<br />
In den Ländern des Nordens braucht es verstärkte<br />
Aufklärung über die Kaffeeproduktion,<br />
über Arbeitsbedingungen etc. Den hohen Preis,<br />
den wir in der Schweiz für eine Tasse Kaffee<br />
bezahlen, kommt nicht den KleinbäuerInnen<br />
zugute…<br />
Zum Schluss kommen wir noch auf das Thema<br />
Wasser zu sprechen. Felipe erzählt, dass es<br />
momentan noch keine internationale TNCs<br />
(transnationale Konzerne) gibt, die im Wassergeschäft<br />
Guatemalas mitmischen. Aber es gibt<br />
guatemaltekische Firmen, denen die Wasserleitungen/Zulieferungssysteme<br />
z.T. gehören<br />
und die z.B. hier im Quiché, wo Wasser knapp<br />
ist, abgefülltes Wasser verkaufen.<br />
In CAFTA kommt das Thema Wasser im Artikel<br />
«natürliche Ressourcen» vor. Das Problem ist –<br />
wie immer –, dass niemand genau weiss, was<br />
in diesem Artikel drin steht.<br />
Weitere Informationen zur Wasserproblematik<br />
in Guatemala:<br />
-> Centro de Acción para el Desarrollo y el<br />
Derecho: Información sobre ley de Agua<br />
en Guatemala: http://homepage3.nifty.com/<br />
CADE/Espanol/Agua/agua.html<br />
-> Evaluación de Recursos de Agua de Guatemala:<br />
http://www.sam.usace.army.mil/en/<br />
wra/Guatemala/Guatemala%20WRA%20Spanish.pdf
26. 02. 06: Panabaj (Santiago Atitlán)<br />
Panabaj ein halbes Jahr nach «Stan»<br />
Die Berge rund um den Atitlán-See sind von<br />
Narben gezeichnet. Narben von Erdrutschen<br />
und Schlammlawinen, die im letzten Oktober<br />
in Folge der Regenfälle des Hurrikan Stan herunterbrachen<br />
und Strassen, Häuser, Anpflanzungen<br />
und Menschen verschütteten. «Vor<br />
Stan» bzw. «nach Stan» ist zu einem Referenzpunkt<br />
in fast allen Erzählungen der GuatemaltekInnen<br />
geworden.<br />
Ein Besuch in Panabaj und Tzanchaj ein halbes<br />
Jahr nach «Stan» zeigt die unterschiedlichen,<br />
persönlichen oder politischen Bedürfnisse<br />
und Interessen, welche die Diskussion um<br />
den Wiederaufbau prägen. Panabaj und Tzanchaj<br />
sind Vororte von Santiago Atitlán und<br />
gehören zu den von Stan am stärksten betroffenen<br />
Orten überhaupt.<br />
Bereits vor «Stan» zusammengeschlossene<br />
Leute fanden in ihren Organisationen eine<br />
wichtige Unterstützung, andere schlossen sich<br />
in der Stunde der Not zu als Selbsthilfegruppen<br />
funktionierenden Nachbarschaftskomitees<br />
zusammen. Nochmals andere warten darauf,<br />
von einem Hilfsprojekt der guatemaltekischen<br />
Regierung oder einer internationalen Nichtregierungsorganisation<br />
begünstigt zu werden.<br />
Ängstlich-angespannt warte ich auf den Moment,<br />
wo unser Boot in die Bucht von Santiago<br />
Atitlán einbiegt und ich den Vulkan Tolimán<br />
von der Seite zu sehen bekomme, auf der am<br />
5. Oktober 2005 eine Schlammlawine herunterkam,<br />
sich über Kilometer durch die Land-<br />
33<br />
schaft schob und im Dorf Panabaj rund 150<br />
Häuser und rund 700 Personen (600 davon<br />
konnten bisher nicht geborgen werden und<br />
gelten als vermisst) unter sich begrub.<br />
Unser Besuch gilt der Asociación Maya Nuevo<br />
Sembrador Integral (AMNSI), die im an Panabaj<br />
angrenzenden Tzanchaj ein Beneficio de<br />
Café, eine Kaffeeverarbeitungsanlage betreibt.<br />
Als wir im letzten Oktober von der Verschüttung<br />
von Panabaj und Tzanchaj lasen, warteten<br />
wir zwei bange Wochen lang auf Nachrichten<br />
von den FreundInnen aus Tzanchaj, deren<br />
Projekt vom Guatemala-Komitee seit Jahren<br />
unterstützt wird. Als wir dann von ihnen hörten,<br />
klangen ihre Berichte nach Schrecken und<br />
Trauer.<br />
Auf dem Weg nach Tzanchaj machen wir Halt<br />
beim Parque de la Paz, einer Gedenkstätte für<br />
die 13 Personen, die im Jahr 1991 bei einem<br />
der letzten Massaker des Krieges vom Militär<br />
erschossen wurden. Die Bevölkerung von Santiago<br />
Atitlán setzte sich vehement für einen<br />
Abzug des Militärs aus ihrem Dorf ein, was<br />
nach dem Massaker auch tatsächlich geschah,<br />
weshalb die 13 Toten als eine Art Heilige gelten.<br />
Der Parque de la Paz ist von der<br />
Schlammlawine verschont geblieben. «Er ist<br />
für uns ein heiliger Ort,<br />
auf dem die Gräber<br />
von 13 HeldInnen liegen.<br />
Weil es ein heiliger<br />
Ort ist, blieb er<br />
verschont», erklärt unsere<br />
Begleiterin Luisa<br />
Tacaxoy Coquix.<br />
Gleich hinter dem Parque<br />
beginnt Panabaj.<br />
Links und rechts der<br />
Strasse stehen bereits<br />
wieder die ersten Häuser,<br />
dazwischen lassen<br />
Trümmer und eingestürzte<br />
Hausteile eine<br />
Vorstellung aufkommen,<br />
wie es im Oktober<br />
hier ausgesehen<br />
haben muss. Zwischen<br />
alten und neuen Häusern<br />
kann man einen<br />
Blick darauf erhaschen,<br />
was einmal der Kern<br />
von Panabaj war: Eine grosse Wüste aus Erde<br />
und Steinen.<br />
Stärkung der Organisation<br />
In Tzanchaj werden wir von den Leuten von<br />
AMNSI erwartet. Die Organisation wurde 1999
gegründet, zwei Jahre nach den Friedensabkommen.<br />
Die Mitglieder sind in ihrer Mehrheit<br />
ehemalige KämpferInnen der URNG oder deren<br />
Familienangehörige. Ihr Ziel ist, gegen die<br />
Armut und den Ausschluss der Maya-Tzutujil-<br />
Bevölkerung in der Gemeinde Santiago Atitlán<br />
zu kämpfen. Auf den ersten Blick sieht es bei<br />
ihnen aus wie bei früheren Besuchen, doch bei<br />
einem Rundgang auf ihrem Gelände erklären<br />
sie uns, dass sich auf dem ganzen Gelände das<br />
Niveau des Bodens um rund einen Meter angehoben<br />
und alles unter sich begraben hat: Die<br />
Maschinen der Kaffeeverarbeitungsanlage, die<br />
Betonbecken, in denen der Kaffee gewaschen<br />
und geschält wird, die Hühner- und Schweinezucht,<br />
die der Organisation zu zusätzlichen<br />
Einkünften verhalf und die Kaffee- und Gemüseanpflanzungen,<br />
die den Organisationsmitgliedern<br />
zur Selbstversorgung dienten.<br />
«Stan hat unsere Organisation gestärkt», erklärt<br />
Juan Tacaxoy Botán, Präsident von AMN-<br />
SI. «Arbeit war die beste Therapie gegen die<br />
Verzweiflung und Trauer, die wir alle verspürten.»<br />
Tatsächlich ist es beeindruckend, was<br />
hier bereits an Wiederaufbauarbeit geleistet<br />
wurde. Anstatt den meterhohen Schlamm aus<br />
der riesigen Lagerhalle zu schaufeln, und diese<br />
somit um einen Meter tiefer als das Aussengelände<br />
zu setzen, wurde kurzerhand die Türe<br />
um einen Meter hinaufgesetzt, der Boden ausnivelliert<br />
und ein neuer Betonüberzug daraufgegossen.<br />
Der einzige Unterschied zu früher<br />
ist, dass der Lichtschalter nun auf Kniehöhe<br />
ist.<br />
Die zugeschüttete Anlage wurde ausgebuddelt,<br />
kaputte Maschinen geflickt, die «Höfe», auf<br />
denen der Kaffee zum Trocknen ausgebreitet<br />
wird, neu betoniert. Zur Kaffeeernte, die im<br />
Dezember begann, war das Beneficio der AMN-<br />
SI bereits wieder funktionsfähig.<br />
Was bleibt, sind die Narben in der Landschaft<br />
und in der Seele. Das Land der AMNSI erstreckt<br />
sich bis zum Ufer des Atitlán-Sees.<br />
Normalerweise gleicht es einem grossen Gemüsegarten,<br />
jetzt einem Sandbadestrand. Da<br />
es sich bei der Schlammlawine um Lava-Erde<br />
handelt, die schwefelhaltig ist, erstickt sie den<br />
Boden und die Pflanzen, die darin wachsen.<br />
Ganze Bäume und die Kaffeepflanzungen hätten<br />
keinen Sauerstoff mehr gekriegt und seien<br />
vertrocknet, erklären die Leute von AMNSI. Es<br />
würde wohl etwa sieben Jahre dauern, bis sich<br />
der Boden erholt habe. Dort wo Gemüse angepflanzt<br />
wird, bleibt nichts anderes übrig, als<br />
diese Erde wegzuschaufeln, eine Arbeit, mit<br />
der bereits begonnen wurde.<br />
So stolz sie auf ihr eigenes Wiederaufbau-Werk<br />
34<br />
sind, umso trauriger werden die Leute, wenn<br />
sie von ihren persönlichen Schicksalen erzählen.<br />
Sie habe im Hospitalito von Panabaj gearbeitet,<br />
erzählt Luisa Tacaxoy Coquix, einem<br />
vor kurzem fertiggestellten gemeinnützigen<br />
Projekt, das den PatientInnen Gesundheitsversorgung<br />
zu günstigen Preisen anbieten will.<br />
Das Hospitalito wurde gänzlich unter dem<br />
Schlamm begraben, ein Arzt konnte sich mit<br />
den letzten PatientInnen gerade noch auf das<br />
Dach retten. Jetzt musste sich das Hospitalito<br />
provisorisch in einem Haus in Santiago Atitlán<br />
einmieten. Da das Projekt mit ausländischen<br />
Spendengeldern finanziert wurde und unklar<br />
ist, ob solche für einen Wiederaufbau erneut<br />
fliessen werden, befürchtet Luisa, dass der soziale<br />
Aspekt des Projekts aufgegeben werden<br />
muss und normale, sprich für die meisten<br />
Menschen unerschwingliche Preise für die Behandlungen<br />
verlangt werden müssen.<br />
Sein Haus stehe zwar noch, erzählt Luisas Vater<br />
Juan Tacaxoy Botán, doch stehe es auf<br />
dem vom «Nationalen Komitee zur Reduktion<br />
von Katastrophen» (CONRED) als Risikozone<br />
erklärten Gebiet. Es sei für ihn als Maya unmöglich,<br />
an einen Ort zurückzukehren, an dem<br />
noch Hunderte von Menschen unter der Erde<br />
begraben seien. Doch die Regierung wolle kein<br />
anderes Land zur Verfügung stellen. Juan<br />
wohnt im Moment mit seiner Familie in einem<br />
gemieteten Zimmer in Santiago Atitlán. Die
Allerwenigsten, die ihre Unterkünfte in Panabaj<br />
verloren haben oder nicht dorthin zurück wollen<br />
oder können, haben eine neue feste Bleibe<br />
gefunden. Viele leben in Provisorien, einige<br />
immer noch in den Notherbergen. Zwischen<br />
den Regierungsplänen und den unterschiedlichen<br />
Interessen der Bevölkerung gibt es eine<br />
grosse Diskrepanz.<br />
Nachbarschaftliche Selbthilfe<br />
Panabaj wurde von der guatemaltekischen Regierung<br />
zum «Symbol des Wiederaufbaus» erklärt.<br />
Anfänglich lief alles Bestens: Auf einem<br />
von der Kirche zur Verfügung gestellten Gelände<br />
wurden temporäre Notunterkünfte aufgebaut,<br />
es wurden Pläne für die neuen Häuser<br />
gezeichnet, es fehlte nur noch die Auftragsvergabe.<br />
Nicht gerechnet wurde hingegen damit,<br />
dass die Geschädigten ihre traditionelle Rolle<br />
als NothilfeempfängerInnen durchbrechen,<br />
sich in einer Organisation zusammenschliessen<br />
und ihre eigenen Forderungen aufstellen.<br />
Noch während der Tragödie gründeten die<br />
NachbarInnen, die bei der Bergung von Toten<br />
und Verletzten halfen, das «Notkomitee zur<br />
Unterstützung der Maya-Tzutujil-Bevölkerung».<br />
Es wurden Gemeinschaftsküchen aufgebaut,<br />
Statistiken über die Zerstörung geführt und<br />
Antworten auf die dringendsten Fragen der unter<br />
Schock stehenden Bevölkerung gesucht.<br />
Schnell merkte das Notkomitee, dass, wenn<br />
erst mal die Nothilfe vorbei ist, an einen Wiederaufbau<br />
gedacht werden musste, der eine<br />
mittel- und längerfristige Perspektive haben<br />
und eine reale Verbesserung ihrer Lebenssituation<br />
einschliessen musste. So wurde das Notkomitee<br />
in den «Verein zur Gemeindeentwicklung<br />
von Panabaj» (ADECCAP) umgewandelt,<br />
eine gemeinnützige Organisation mit legalem<br />
Status, die schnell 480 Mitglieder zählte.<br />
ADECCAP hat kurz- und langfristige Ziele im<br />
Auge, will sich in einer partizipativen Gemeindepolitik<br />
üben, Einfluss auf die kommunalen<br />
Entwicklungsräte (COCODE) nehmen, eine soziale<br />
Kontrolle über die Gemeindegelder und<br />
die Tätigkeiten der Gemeindebehörden ausüben<br />
sowie die Interessen der betroffenen Bevölkerung<br />
im Wiederaufbau und bei der längerfristigen<br />
Gemeindeentwicklung vertreten.<br />
Am 13. Januar veranstaltete ADECCAP ein öffentliches<br />
Forum, um unter breiter nationaler<br />
und internationaler Präsenz seine bisherige Arbeit<br />
und zukünftigen Ziele bekannt zu geben.<br />
Dabei wurde u.a. gefordert, dass die für den<br />
Wiederaufbau zuständige nationale Institution<br />
FONAPAZ mit dem Bau von Häusern wartete,<br />
bis eine Risikoanalyse gemacht war. FONAPAZ<br />
hat nämlich vor, die neuen Häuser in Panabaj<br />
35<br />
genau an dem Ort aufzustellen, wo der Erdrutsch<br />
niederkam und wo noch Hunderte von<br />
Leichen unter dem unterdessen eingetrockneten<br />
Schlamm liegen. ADECCAP hingegen fordert<br />
die Regierung auf, je nach Ergebnis der<br />
Risikoanalyse, die nahegelegene Finca La Providencia<br />
zu kaufen und für den Häuserbau zur<br />
Verfügung zu stellen. Das Resumée des Präsidenten<br />
von ADECCAP nach diesem Forum:<br />
«Wir haben eine Tür geöffnet zu einem Thema,<br />
das bisher nie öffentlich und unter Beteiligung<br />
der Bevölkerung diskutiert wurde.»<br />
Unterschiedliche Interessen<br />
Die Forderung nach einer Risikoanalyse vor<br />
dem Wiederaufbau wurde von CONRED, dem<br />
«Nationalen Komitee zur Reduktion von Katastrophen»,<br />
aufgenommen, von den Lokalbehörden<br />
von Santiago Atitlán jedoch nicht. Man<br />
wolle Häuser, keine Studien, war die Meinung<br />
des Bürgermeisters, unterstützt vom Hilfsbürgermeister<br />
von Panabaj und dem Leiter der<br />
Notunterkünfte.<br />
So hat man sich gegenseitig in eine Pattsituation<br />
manövriert: Die Regierung vertritt die Position,<br />
man könne nicht mit dem Wiederaufbau<br />
beginnen, solange sich die Bevölkerung uneinig<br />
sei, VertreterInnen von ADECCAP werfen<br />
der Regierung vor, ihre Bedürfnisse und längerfristig<br />
angelegten Vorschläge nicht zu berücksichtigen,<br />
während die dritte Gruppe den<br />
sofortigen Hausbau fordert, egal wo. An einer<br />
Volksversammlung vom 21. Januar, die eigentlich<br />
zu einer Klärung des Konflikts beitragen<br />
sollte, wurden die beiden Gruppen noch mehr<br />
gespalten, der Präsident von ADECCAP verliess<br />
unter Protest und in Begleitung von 300 Personen<br />
die Versammlung. CONRED hat sich unterdessen<br />
klar für eine Risikoanalyse ausgesprochen,<br />
FONAPAZ erklärte sich bereit, mit CON-<br />
RED zusammenzuarbeiten, ob aber die Familien,<br />
die sich weigern, in die Risikozone zurückzukehren,<br />
von der Regierung irgendeine Unterstützung<br />
bekommen, ist unklar.<br />
Soweit der Stand der Dinge Anfang März. Es<br />
wird sich zeigen, ob Santiago Atitlán zu einem<br />
«Symbol des Wiederaufbaus» wird und ob sich<br />
die Regierung an ihren selbst proklamierten<br />
Grundsatz hält, der heisst: «Förderung der<br />
Kommunikation, Konsenssuche und Koordination<br />
zwischen den Arbeiten der Bevölkerung und<br />
der Regierung, Stärkung der BürgerInneninitiativen<br />
sowie Transparenz seitens der Regierung,<br />
Einbezug einer sozialen Kontrolle und lokaler<br />
Bedürfnisse bei den Wiederaufbauplänen.»<br />
Entrevista con el arquitecto Luis Alberto Palacio.<br />
En la entrevista participaron también dos<br />
alcaldes de comunidades cercanas.
27. 02. 06: Sololá<br />
Luis Alberto Palacios dirige una organización<br />
sin ánimo de lucro, dedicada a la construcción<br />
de escuelas. A la organización se la conoce<br />
como «Amigos de Alemania» por estar financiada<br />
por tres ONGs alemanas, llamadas La Esperanza,<br />
Oyak y Freundeskreis. El proyecto,<br />
cuyo ámbito geográfico se limita actualmente<br />
al Departamento de Solalá, funciona desde<br />
hace 20 años y tiene como principal objetivo la<br />
construcción de escuelas y en segundo lugar el<br />
intercambio profesional intercultural. Los padres<br />
de los alumnos ayudan en la ejecución material<br />
de las construcciones. Hasta el momento<br />
de producirse la catástrofe del Stan, se habían<br />
construído 20 escuelas, de las cuales todas excepto<br />
una resistieron el huracán, lo cual es un<br />
indicador de la calidad de la obra. Todos los<br />
años, voluntarios de alemania pasan una<br />
estancia de dos meses en Sololá visitando las<br />
obras e intercambiando experiencias.<br />
El impacto del huracán Stan<br />
El Stan, huracán de grado 1, puso de manifiesto<br />
la extrema vulnerabilidad del país, tanto por<br />
los déficits de infraestructuras como por la incapacidad<br />
de la maquinaria del Estado para<br />
dar una respuesta rápida y proporcionada a la<br />
magnitud de la emergencia.<br />
La institución de Luis Alberto Palacios intentó<br />
ponerse, al producirse la catástrofe, a disposición<br />
de la representación departamental del<br />
Gobierno para colaborar voluntariamente. Pero<br />
no fue posible, ya que los funcionarios no<br />
estaban en sus puestos y sólo empezaron a<br />
aparecer al cabo de tres días. Con ellos llegaron<br />
a la zona representantes del Comité Nacional<br />
de Emergencia, quienes no tenían una idea<br />
clara del proceso a seguir. A falta de directrices<br />
gubernamentales, la población se autoorganizó<br />
a través de las radios comunitarias.<br />
Las organizaciones alemanas patrocinadoras<br />
de «Amigos de Alemania» establecieron contacto<br />
con Luis Alberto Palacios y enviaron<br />
22.000 euros. Para aplicarlos, se hizo una evaluación<br />
de las necesidades más urgentes y se<br />
optó como medida prioritaria por restablecer el<br />
suministro de agua corriente a fin de garantizar<br />
la supervivencia de la población y de los<br />
cultivos de verduras, pilares a su vez de la<br />
economía de subsistencia de gran parte del<br />
campesinado afectado. En esa línea, las comunidades<br />
presentaron proyectos a los que se<br />
asignaron materiales y asesoramiento técnico<br />
en función de su viabilidad. De los dos alcaldes<br />
36<br />
comunitarios presentes en la entrevista, la<br />
comunidad de uno obtuvo por esta vía los recursos<br />
para reparar sus conducciones de agua<br />
potable, tarea hoy día ya finalizada; la comunidad<br />
del otro tramitó su solicitud de reparación<br />
de infraestructuras a través de un proyecto<br />
gubernamental, del cual había recibido<br />
hasta la fecha sólo una parte del material, por<br />
lo cual funciona la reconstrucción más lentamente.<br />
En los días críticos de la catástrofe se presentaron<br />
ONGs desconocidas que solicitaban informes<br />
de la municipalidad a la vez que ofrecían<br />
subvenciones y que de la noche a la mañana<br />
desaparecieron. Con sus demandas sobrecargaron<br />
el trabajo de las instituciones.<br />
La reconstrucción<br />
Pasados los momentos agudos de la crisis, la<br />
realización de la reconstrucción fue muy cuestionada.<br />
La municipalidad de Sololá estimó en<br />
150.000 euros el presupuesto de reconstrucción.<br />
En opinión de Luis Alberto Palacios, con<br />
la ayuda internacional, que llegó inmediatamente,<br />
se podrían haber cubierto los gastos.<br />
Había proyectos de reconstrucción cuyo monto<br />
no pasaba de 350 euros y cuya mano de obra<br />
la aportaban los propios vecinos. Sin embargo,<br />
subrayan los alcaldes comunitarios, hubo factores<br />
que entorpecieron el proceso. La respuesta<br />
a las necesidades de los habitantes fue en<br />
primer lugar demasiado lenta: (por ejemplo<br />
150 familias se quedaron treinta días sin<br />
agua); además, se calcula que de la ayuda<br />
destinada a los afectados, llegó a sus manos<br />
menos de un 50% y, aunque la ayuda fue donada,<br />
la administró Fonapaz (Fondo para la<br />
Paz) canalizándola en forma de préstamos;<br />
tampoco se entregó a los Municipios la gestión<br />
de los recursos concedidos, sino que éstos se<br />
administraron de manera centralizada desde la<br />
Secretaría de la Presidencia con el aumento<br />
consiguiente de burocracia y la falta de conocimiento<br />
de la realidad concreta; por último, a<br />
veces se recibieron los materiales pero sin<br />
acompañarlos del apoyo técnico necesario para<br />
la optimización del resultado.<br />
En el tema de obras públicas, situaciones corregibles<br />
como reconstrucción de puentes y asfaltado<br />
de calzadas no se habían abordado<br />
hasta dos semanas antes del momento de la<br />
entrevista. Y entretanto la próxima estación de<br />
lluvias ya estaba a la puerta.<br />
Existe el sentimiento de que las víctimas fueron<br />
utilizadas políticamente. Dicen que en<br />
Sololá fueron especialmente importantes los
daños humanos y que el Gobierno utilizó las<br />
cifras para „dar lástima“ y recaudar más ayuda<br />
internacional. Por otra parte, cuando se habla<br />
de víctimas se manejan sólo cifras, pero los<br />
casos personales se olvidan o ni se mencionan<br />
porque no son rentables políticamente. Qué<br />
pasa, por ejemplo con las mujeres solas o con<br />
los huérfanos?<br />
Mirando al futuro<br />
Según el arquitecto, no se ha detectado una<br />
mejora notable en la atención a la región por<br />
parte del Gobierno en los años que han seguido<br />
a los Acuerdos de Paz. Cada cuatro años<br />
llega un nuevo equipo gubernamental que trabaja<br />
sin continuidad con el anterior. Lo fundamental,<br />
dice, es que hace falta una planificación<br />
territorial que no existe. Después del huracán,<br />
la gente se sigue instalando en lugares<br />
de alto riesgo, en parte porque no saben a<br />
37<br />
dónde ir y en parte porque carecen de formación<br />
para comprender que el peligro no depende<br />
sólo de la casualidad. De esta manera,<br />
la repetición de semejantes catástrofes está<br />
casi programada de antemano. La diseminación<br />
de las viviendas sin orden ni concierto incrementa,<br />
por otra parte, los gastos de infraestructura.<br />
Es el Estado quien debiera planificar<br />
dónde y cómo se ubican los asentamientos<br />
para reducir riesgos y gastos.<br />
Por otra parte, los donantes debieran<br />
controlar mejor el uso y destino de los<br />
fondos donados. Habría también que<br />
otorgar más competencias a las Municipalidades<br />
para que a través de los Comités<br />
Comunitarios de Desarrollo organicen<br />
y controlen el empleo de las ayudas.<br />
La tarea que está por delante es el empoderamiento<br />
de la población para que<br />
haga uso de sus derechos. La eficaz organización<br />
desarrollada por los vecinos<br />
para hacer frente a los efectos del huracán<br />
no parece haberse traducido en<br />
una toma de conciencia de sus capacidades.<br />
Los alcaldes comunitarios cuando<br />
hablan de la pérdida de los cultivos dicen<br />
„la gente aguantó“ o como conclusión:<br />
„Si uno solicita al gobierno o municipalidad,<br />
se tarda mucho; mejor se dirige<br />
uno a otra parte“. Es decir a las ONGs<br />
que atienden a las necesidades más urgentes<br />
de la población y suplen a un<br />
estado que ha dimitido de sus funciones<br />
Los Comités Comunitarios de Desarrollo<br />
son en este momento la vía disponible<br />
para la participación y el empoderamiento.<br />
Creados bajo el gobierno de Portillo<br />
como parte de los Acuerdos de Paz tienen reconocimiento<br />
legal y en esa medida pueden<br />
constituir una fuerza política y presionar. Su<br />
impulso y fortalecimiento parecen ser una de<br />
las tareas prioritarias de los proyectos de desarrollo.<br />
Siehe auch "Der erste Winter nach Hurrikan Stan"<br />
(Anhang S. 8)
28. 02. 06: La Libertad, Petén<br />
CPR Santa Rita<br />
Juan Carlos, der in der Junta Directiva<br />
(Vorstand) der comunidad und im Bildungsbereich<br />
arbeitet, empfängt uns in einem Zimmer<br />
der Schule, die sie in Santa Rita haben, und<br />
führt uns danach durch die Siedlung.<br />
Ab 1980 lebte ein Teil der Leute, die heute in<br />
Santa Rita wohnen, als CPR (Comunidad de<br />
Población en Resistencia – s. 22. 02. 06: Nebaj)<br />
während 17 Jahren versteckt im Urwald.<br />
Erst 1997 sind sie aus dem Wald hierher in<br />
diese Gemeinde gekommen, die sie aus Eigeninitiative<br />
aufgebaut haben. Sie bauen auf drei<br />
Pfeiler, die ihnen bereits im Krieg wichtig waren:<br />
- Bildung: Ein Ziel der CPR von Santa Rita ist<br />
es, die politische Bildung wiederzubeleben.<br />
- Gesundheit: Sie haben in Santa Rita ein Gesundheitszentrum<br />
aufgebaut, das auch Leute<br />
aus den umliegenden Gemeinden behandelt.<br />
Besonderen Wert legen sie auf Prävention.<br />
Sie praktizieren auch Alternativmedizin,<br />
z.B. Akupunktur.<br />
- Organisation: Alle in der Gemeinde sind auf<br />
irgendeine Weise in die Organisationsstrukturen<br />
eingebunden, sind Teil einer Gruppe.<br />
Dies ist ihnen sehr wichtig.<br />
Das oberste Organ der Gemeinde ist die Vollversammlung,<br />
in der sich die Mitglieder regelmässig<br />
treffen. Es gibt auch eine VV der SchülerInnen,<br />
damit sie frühzeitig lernen, ihre<br />
Rechte zu vertreten. Nebst der VV gibt es die<br />
Junta Directiva (Vorstand) und verschiedene<br />
Komitees, z.B. ein Frauenkomitee, ein Jugendkomitee,<br />
ein Komitee, das für die Kontakte gegen<br />
aussen zuständig ist etc. Zwar gibt es einen<br />
Hilfsbürgermeister in der Gemeinde, doch<br />
hat er lediglich eine repräsentative Funktion<br />
gegen aussen. In der Gemeinde spielt er keine<br />
wichtige Rolle.<br />
Die Gemeinde zählt etwa 300 Stimmberechtigte.<br />
Für Entscheide, die «legal» sein müssen,<br />
sind es ca. 70 Personen. Viele Leute wollen in<br />
die asociación aufgenommen werden, um auch<br />
bei den «legalen» Entscheiden mitbestimmen<br />
zu können. Für die Mitgliedschaft genügt es,<br />
einen Antrag zu stellen. Nur für Leute von ausserhalb<br />
gibt es höhere Hürden, sie müssen einen<br />
Beitrag bezahlen und eine Art Probezeit<br />
bestehen.<br />
Die Leute in Santa Rita versuchen, ihre Probleme<br />
mittels Dialog zu lösen, zuerst mit den involvierten<br />
Personen, danach wenn nötig in der<br />
Vollversammlung. Darüber hinaus verfügen sie<br />
über ein Sanktionssystem für Personen, die<br />
38<br />
sich nicht an die Regeln halten.<br />
Diese Organisationsform ist historisch bedingt.<br />
Die Leute von Santa Rita (bzw. ein Grossteil<br />
von ihnen) waren schon im Urwald als CPR organisiert.<br />
Sie hatten über zwei Jahre lang mit<br />
der Regierung über die Umsiedlung verhandelt.<br />
Damals lebten sie noch im lakandonischen<br />
Urwald – einem Naturschutzgebiet –, wo<br />
eigentlich keine Menschen wohnen dürfen.<br />
Schlussendlich bekamen sie dieses Land hier<br />
von der Regierung geschenkt, sie haben also<br />
keine Schulden und müssen auch nicht fürchten,<br />
wegen Zahlungsunfähigkeit vertrieben zu<br />
werden.<br />
Ihre gemeinsamen Ziele bei der Gründung dieser<br />
Gemeinde waren der Widerstand gegenüber<br />
der Armee und der Wunsch, eine andere<br />
Form des Zusammenlebens zu finden. Einige<br />
waren zuvor z.B. Mitglieder einer Kooperative<br />
gewesen. Dort ist es so, dass nur jene, die<br />
Mitglieder sind und einen Beitrag bezahlen,<br />
Stimmrecht haben. Solche Defizite sollten mit<br />
der Organisationsform von Santa Rita überwunden<br />
werden. Juan Carlos findet es nach<br />
wie vor wichtig, diese alternative Lebensform<br />
zu thematisieren. Innerhalb der Gemeinde ist<br />
dies allerdings schwierig, da die meisten mit<br />
ihren alltäglichen Problemen beschäftigt sind.<br />
Auch hatten sie, als sie aus dem Urwald hierher<br />
kamen, plötzlich mit neuen Problemen zu<br />
kämpfen. Sie mussten z.B. plötzlich ein Einkommen<br />
erwirtschaften, um am Markt teilnehmen<br />
zu können.<br />
Im Moment werden in der Region jene Projekte<br />
unterstützt, die in die neoliberale Regierungspolitik<br />
passen und die man dann auch<br />
ausbeuten kann (z.B. landwirtschaftliche Produktion<br />
für den Export). Projekte wie das Gesundheitszentrum<br />
von Santa Rita, das die Gemeinde<br />
zur Unterstützung eingereicht hat, haben<br />
es schwer. Die Gemeinde möchte das Zentrum<br />
ausbauen. Denn es fehlt sowohl der Platz<br />
für den grossen Andrang an PatientInnen als<br />
auch für die praktisch komplett vorhandene<br />
technische Ausrüstung für Zahnbehandlungen.<br />
Im Gesundheitszentrum arbeiten keine ÄrztInnen,<br />
sondern GesundheitspromotorInnen. Die<br />
Prävention besteht zu einem Grossteil im<br />
Schaffen hygienischer Verhältnisse hier in der<br />
Gemeinde, in Zahnkontrollen bei den Kindern<br />
und in Malariaprävention.<br />
Es gibt auch zwei tiendas (kleine, kioskähnliche<br />
Läden) in der Gemeinde. Diese werden<br />
nicht, wie gemeinhin üblich, von Privatpersonen<br />
betrieben, sondern eine von der asocia-
ción, die andere vom Frauenkomitee.<br />
Ein weiteres Projekt ist der eigene Radiosender,<br />
über den die Gemeinde verfügt. Dieser<br />
sendet zu Themen rund um Bildung, Gesundheit,<br />
Menschenrechte, Geschichte (z.B. zur<br />
Aufarbeitung der Geschichte des Krieges und<br />
der CPR). Der Sender nennt sich Radio Libertad<br />
und versteht sich als offenes Radio, über<br />
das die Leute wichtige Informationen verbreiten<br />
können. Es ist kein «legales», sondern ein<br />
«Piratenradio». Einmal war auch die Polizei<br />
hier und wollte wissen, ob über das Radio<br />
kommerzielle Werbung gesendet würde – was<br />
nicht der Fall ist. Ursprünglich<br />
erreichte es<br />
eine Sendeweite von<br />
100 km. Nachdem<br />
aber ein Sender verbrannt<br />
ist, können die<br />
RadiomacherInnen nur<br />
noch 10 km weit senden.<br />
Für die BewohnerInnen<br />
von Santa<br />
Rita ist der Radiosender<br />
sehr wichtig, um<br />
eine eigene Kommunikation<br />
zu entwickeln<br />
und zu pflegen und die<br />
Leute auch der Umgebung<br />
gut zu informieren.<br />
Das Radio soll ein<br />
Gegengewicht zu den<br />
öffentlichen Medien bilden,<br />
die falsch informieren<br />
und Propaganda<br />
betreiben. Auch internationale Nachrichten<br />
sollen aus einer anderen Perspektive betrachtet<br />
werden, z.B. zum Irakkrieg oder dem Konflikt<br />
in Palästina und Israel. Radio Libertad versteht<br />
sich als Brücke zwischen anderen alternativen<br />
Medien, z.B. im Internet, und den Leuten<br />
hier.<br />
Die Kinder und Jugendlichen können in Santa<br />
Rita die Primar- und Sekundarschule besuchen<br />
und wandern deshalb nicht ab. Nun sind Gemüseanbau-Projekte<br />
geplant, die Arbeitsplätze<br />
für die Jugendlichen schaffen sollen. Die Gemeinde<br />
möchte mit einer Art Schulgarten beginnen,<br />
wo das angepflanzt wird, was die Leute<br />
wünschen und wo ausprobiert wird, ob es<br />
funktioniert.<br />
Die BewohnerInnen von Santa Rita sind nicht<br />
gezwungen, ausserhalb der Gemeinde zu arbeiten.<br />
Es gibt hier Arbeitsplätze in der Landwirtschaft,<br />
dem Gesundheitszentrum, der Bildung<br />
oder in anderen Projekten. Der Lohn,<br />
den sie dafür erhalten, ist allerdings sehr klein,<br />
das Geld stammt aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen<br />
Erzeugnissen wie Fleisch oder<br />
39<br />
Gemüse. Vor allem jene Leute, die im Bildungs-<br />
oder im Gesundheitsbereich arbeiten,<br />
können ausserhalb Weiterbildungen besuchen.<br />
Ein junger Mann aus Santa Rita studiert zur<br />
Zeit Medizin in Kuba.<br />
Vor zwei Jahren sind zwei Projekte – die Hühnerfarm<br />
der Frauen und die Bäckerei – v.a. an<br />
administrativen Problemen gescheitert, da die<br />
Leute hier kaum administrative Erfahrung haben.<br />
Natürlich gibt es auch immer wieder ideologische<br />
Probleme. Ein Beispiel ist das Land:<br />
In Santa Rita ist das Land nicht in Privatbesitz,<br />
sondern die Leute erhalten ein Stück zur Verfügung<br />
gestellt, damit sie es bebauen können.<br />
Wenn sie älter werden, geschieht es des öftern,<br />
dass sie das Land als Privatbesitz überschrieben<br />
haben wollen, um ihren Kindern etwas<br />
vererben zu können. Es braucht dann jeweils<br />
viel Überzeugungsarbeit im Rahmen der<br />
Vollversammlungen, um den Leuten klar zu<br />
machen, weshalb diese Organisationsform so<br />
wichtig ist.<br />
In der Gemeinde gibt es eine katholische Kirche.<br />
Die evangelikalen Sekten dürfen nicht<br />
physisch mit einem Tempel o.ä. in der Gemeinde<br />
präsent sein. Dadurch soll eine Spaltung<br />
der Gemeinde verhindert werden.<br />
Im Viehprojekt von Santa Rita werden Kälber<br />
und Mastvieh aufgezogen, momentan sind es<br />
91 Mutterkühe und 72 Masttiere. Die nicht<br />
kastrierten männlichen Tiere werden nach Mexiko<br />
verkauft. Die Gemeinde verfügt über ca.<br />
zwei caballerías Weideland, Futter muss sie<br />
keines kaufen.<br />
Zwei der Bauern erzählen uns, dass sie ur-
sprünglich gar nicht aus dem Urwald weg wollten.<br />
Sie hatten 17 Jahre lang dort gelebt, ohne<br />
die Umwelt zu zerstören. Sie schlugen deshalb<br />
der Regierung vor, dass sie dort bleiben und<br />
als WärterInnen des Naturschutzgebietes arbeiten<br />
könnten. Die Regierung ging aber nicht<br />
darauf ein. Später erfuhren sie, dass die Regierung<br />
bereits damals mit einer US-Organisation<br />
(verbandelt mit US-Aid) in Verhandlungen<br />
war. Diese Organisation bekam dann die Aufgabe<br />
der Wartung des Naturschutzgebietes zugeschanzt.<br />
Gründe, warum die Regierung eine<br />
US-Organisation dort und die Bevölkerung weg<br />
haben wollte, sind sicher auch das vorhandene<br />
Holz und das Wasser sowie der Drogenhandel,<br />
der dort durch geht.<br />
Alianza por la Vida y la Paz<br />
Nach dem Mittagessen in Santa Rita wurden<br />
wir in der Kirche der Gemeinde La Libertad<br />
von VertreterInnen der «Alianza por la Vida y<br />
la Paz» empfangen. Die Alianza ist ein Zusammenschluss<br />
von 32 Organisationen und engagiert<br />
sich gegen den «Plan Puebla Panama»<br />
(PPP).<br />
Der Grossteil der Bevölkerung des Petén besteht<br />
aus ArmutsmigrantInnen, die in den letzten<br />
50 Jahren hierher gekommen sind. Die<br />
MitarbeiterInnen der katholischen Kirche hier –<br />
die ein Mitglied der Alianza ist – arbeiten am<br />
REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica<br />
– Wiedererlangen der historischen Erinnerung)<br />
mit und wollen in den Dörfern die Geschichte<br />
aufarbeiten. In der Gemeinde wurden<br />
drei Friedhöfe mit Toten aus der Zeit der violencia<br />
gefunden. In jeder comunidad ist eine<br />
Person zuständig für die Aufarbeitung der Geschichte.<br />
Dadurch soll verhindert werden, dass<br />
die Geschichte sich wiederholt. Nebst dieser<br />
Person, die für das REMHI arbeitet, gibt es<br />
auch in jeder comunidad drei Personen, die je<br />
beauftragt sind mit Menschenrechten, Landund<br />
Agrarfragen. Die Gemeinde (Pfarrei)<br />
möchte sich möglichst gut organisieren und<br />
vernetzen, um den neoliberalem Angriff Widerstand<br />
leisten zu können.<br />
Am Río Usumacinta sind fünf Staudämme geplant,<br />
in ganz Guatemala sind es 60. Falls die<br />
Staudämme hier am Río Usumacinta gebaut<br />
werden, müssen 24 Dörfer umgesiedelt werden,<br />
da sie überschwemmt würden. Und durch<br />
den TLC (Freihandelsvertrag mit den USA)<br />
würde die lokale Landwirtschaftsproduktion<br />
mit subventionierten Exporten aus den Vereinigten<br />
Staaten konkurrenziert.<br />
Der PPP wurde von den Regierungen Mexikos<br />
und Guatemalas ausgearbeitet. Es geht dabei<br />
um Infrastruktur (Strassen, Häfen, Flughäfen,<br />
40<br />
Kanäle), die den Transport von Gütern aus<br />
ganz Zentralamerika ermöglichen soll. Die<br />
guatemaltekische Regierung informiert nicht<br />
über den PPP oder den TLC. Deshalb hat es<br />
sich die «Alianza por la Vida y la Paz» zur Aufgabe<br />
gemacht, die Leute in den Dörfern über<br />
diese Themen zu informieren. Am 9. März<br />
2005 hat die Alianza eine Demonstration gegen<br />
den TLC in der Hauptstadt durchgeführt.<br />
Unterdessen ist der Vertrag unterschrieben, allerdings<br />
noch nicht umgesetzt.<br />
Organisationen innerhalb der Alianza, die die<br />
Leute darin unterstützen, offizielle Landtitel zu<br />
erlangen, leisten gleichzeitig auch Bewusstseinsarbeit<br />
– über die landwirtschaftliche Produktion,<br />
die Präsenz von Militärs und Panzern,<br />
über den Drogenhandel. Sie möchten gerne<br />
auch juristische Arbeit leisten, doch sind die<br />
vorhandenen Studien, auf die sie sich dabei<br />
stützen könnten, veraltet. Heute gibt es viel<br />
mehr Gemeinden, die von den Staudämmen<br />
betroffen wären, als vor dem Krieg. Hinzu<br />
kommen die beschränkten Ressourcen der Organisationen:<br />
die Arbeit wird ehrenamtlich geleistet.<br />
Guatemala produziert genug Energie für den<br />
Eigengebrauch, exportiert sogar einen Teil davon<br />
nach El Salvador und hat Pläne für den Export<br />
nach Belize in der Schublade. Das Interesse<br />
nach mehr Energie ist also kein guatemaltekisches,<br />
sondern ein internationales. Es<br />
geht einmal mehr um fette Geschäfte. Das<br />
grosse Interesse der USA am PPP besteht im<br />
Bestreben, den Atlantik und den Pazifik mit einer<br />
Landbrücke in Zentralamerika zu verbinden<br />
und so den Weg zwischen den beiden<br />
Meeren zu verkürzen. Ein weiteres Interesse<br />
besteht in einem Stromnetz von Panama bis<br />
Mexiko (Mexiko ist über NAFTA mit den USA<br />
verbunden). Es geht also um einen riesigen<br />
Strommarkt, in dem die Stromversorgung vom<br />
Süden in den Norden, Richtung USA geht.<br />
Unterdessen werden Fincas im Petén bereits<br />
wieder verkauft – an Leute, von denen man<br />
nicht genau weiss, was sie mit dem Land vorhaben.<br />
Möglicherweise stehen diese Käufe im<br />
Zusammenhang mit den geplanten Wasserkraftwerken<br />
oder den ebenfalls geplanten Maquilas<br />
(«sweat shops»).<br />
-> Alianza por la Vida y la Paz:<br />
http://www.vidaypaz.org/<br />
-> Indymedia Chiapas: Bericht über das II. Encuentro<br />
Nacional Guatemalteco contra Represas<br />
vom 8. Mai 2006: http://chiapas.indymedia.org/<br />
index.php?category=4<br />
Siehe auch "Razzien bei Kommunalradios"<br />
(Anhang S. 7)
02. 03. 06: Guatemala Stadt: CAFCA und «De Víctimas a Actoras del Cambio»<br />
CAFCA (Zentrum für forensische Analyse<br />
und angewandte Wissenschaften)<br />
Wir werden von Jesús Hernández (Theologe,<br />
Direktor von CAFCA), Sergio Castro (Soziales),<br />
Héctor Soto (Juristisches) und Erwin Melgar<br />
(Technisches betr. Exhumierungen) empfangen.<br />
CAFCA ist als anthropologische und Menschenrechts-Organisation<br />
entstanden. Nach den<br />
Friedensabkommen fehlte jeglicher politische<br />
Wille, die Kriegsgeschehnisse aufzuklären und<br />
aufzuarbeiten. Deshalb braucht es NGOs wie<br />
CAFCA. Die von Repression und Massakern betroffenen<br />
Bevölkerungsgruppen werden weiterhin<br />
marginalisiert, sie haben weiterhin Angst<br />
vor den administrativen und juristischen Apparaten.<br />
Es ist daher wichtig, dass zum rein<br />
Technischen der Exhumationen die juristische<br />
Begleitung dazukommt. CAFCA arbeitet in drei<br />
Aufgabenbereichen:<br />
- sozialer Bereich: Begleitung der Angehörigen,<br />
da es in den Dörfern aufgrund des Zusammenlebens<br />
von Opfern und Tätern viel<br />
Spaltung gibt.<br />
- politischer Bereich: thematisieren und<br />
durchsetzen der Interessen der Opfer in der<br />
Öffentlichkeit<br />
- juristischer Bereich: juristische Begleitung<br />
der Angehörigen<br />
Die Männer erzählen uns, dass die Massaker<br />
während der Zeit der violencia auch einen Genozid-Charakter<br />
hatten, indem sie v.a. gegen<br />
die Mayas gerichtet waren. Diese Bemerkung<br />
löst in der Gruppe eine Diskussion zum Begriff<br />
Genozid und seinem Gebrauch aus. Die<br />
CAFCA-Leute erklären: Der Begriff Genozid<br />
umfasst eine juristische und eine politische Dimension.<br />
Die politische Dimension hat nicht<br />
nur eine innenpolitische, sondern auch eine internationale<br />
Bedeutung. Politisch spricht man<br />
in Guatemala schnell von Völkermord, da der<br />
Begriff nicht klar definiert ist. Während der<br />
schlimmsten Zeit der violencia (1982-84) bestand<br />
klar die Absicht, bestimmte Bevölkerungsgruppen<br />
umzubringen. Juristisch ist es<br />
schwierig, diese Absicht zu beweisen. Die Regierung<br />
wollte mit der Armee die soziale Basis<br />
der Guerilla auslöschen, von der diese sich<br />
auch ein Stück weit ernährte und von der aus<br />
sie ihren Kampf führte. Diese Bevölkerungsgruppen<br />
waren indigen. Gleichzeitig wurden<br />
die Indígenas schon immer marginalisiert. Die<br />
Armeeoperationen erhielten dadurch einen klar<br />
rassistischen Charakter. Die Indígenas hatten<br />
natürlich ein Interesse daran, dass sich etwas<br />
41<br />
verändert. Dies rechtfertigt aber in keiner Weise<br />
die brutale Reaktion der Armee, unzählige<br />
Morde unter der Zivilbevölkerung zu begehen.<br />
In den Wahrheitsberichten wurde nicht von<br />
Genozid gesprochen, sondern von «genozidähnlichen<br />
Handlungen» (offizieller Bericht),<br />
bzw. von «Massakern» und «Ermordungen»<br />
(REMHI). Die Armee hat nicht nur die Leute<br />
umgebracht, sondern auch Gemeinden gespalten<br />
und dadurch deren soziales Zusammenleben<br />
zerstört.<br />
Es ist sehr wichtig, dass der technische Teil einer<br />
Exhumierung nicht isoliert dasteht. Die soziale<br />
Begleitung ist zentral: Was ist geschehen?<br />
Wie haben wir damals gelebt? Warum hat<br />
es gerade uns getroffen? Wie können wir hier<br />
weiterleben und die Gemeinschaft wieder versöhnen?<br />
Auch die juristische Dimension ist wichtig: Die<br />
Leute haben ein Recht darauf, zu wissen, dass<br />
hier Verbrechen vorliegen, wer sie begangen<br />
hat, und dass es Rechtsmittel gibt, mit denen<br />
sie gegen diese Verbrechen vorgehen können.<br />
Dies ist die politische Arbeit, die CAFCA als<br />
eine ihrer Aufgaben betrachtet.<br />
Sich solchen Fragen zu stellen, öffnet immer<br />
auch Wunden bei den Betroffenen. Trotzdem<br />
ist es wichtig für die Arbeit von CAFCA. Es<br />
geht dabei sehr stark um menschliche und soziale<br />
Aspekte. Wer eine Exhumierung beantragt,<br />
muss über die Rechtsfragen informiert<br />
werden. Einerseits ist die Exhumierung an sich<br />
ein juristischer Akt. Es braucht einen Antrag<br />
an die Staatsanwaltschaft, die die Erlaubnis für<br />
eine Exhumierung geben muss. Andererseits<br />
sollen die Leute wissen, dass sie dadurch Beweise<br />
in die Hand kriegen, z.B. Fakten darüber,<br />
wer wo wann umgebracht wurde. Vieles wird<br />
durch die begleitenden Interviews aufgearbeitet,<br />
Fragen über die Identität von Ermordeten,<br />
über die Umstände (z.B., ob eine Ermordete<br />
schwanger war) etc.<br />
Meistens wissen oder vermuten Angehörige<br />
oder Nachbarn, wo Tote verscharrt wurden.<br />
Wenn sie eine Exhumierung durchführen wollen,<br />
können sie sich an lokale Organisationen<br />
wenden, z.B. an die Sozialpastoral oder an Opferorganisationen.<br />
Diese nehmen dann Kontakt<br />
auf mit CAFCA.<br />
Exhumierungen gab es bereits vor dem Abschluss<br />
aller Friedensverträge. Die ersten fanden<br />
1991 statt. 1994 wurde das Abkommen<br />
über die Menschenrechte unterzeichnet. Darin<br />
geht es u.a. um die Aufklärung und Aufarbeitung<br />
der Geschehnisse. Als eines der Mittel<br />
dazu werden Exhumierungen genannt. Doch
die Regierung hat sich in der Folge überhaupt<br />
nicht interessiert gezeigt, Exhumierungen<br />
durchzuführen. Laut den Friedensverträgen<br />
müssen die Organisationen, die Exhumierungen<br />
durchführen, unabhängig sein. Deshalb<br />
gibt es keine entsprechende staatliche Organisation.<br />
Nach Schätzungen sind 75% der Verscharrten<br />
noch nicht exhumiert worden. CAFCA hat bisher<br />
115 Exhumierungen durchgeführt. 60%<br />
davon sind in den Wahrheitsberichten gar nicht<br />
erwähnt, weil die Leute damals z.T. einfach gesagt<br />
haben, es sei etwas passiert – was genau,<br />
haben sie nicht erzählt.<br />
Die Angehörigen haben ein inneres Bedürfnis,<br />
die Überreste ihrer Angehörigen zu finden.<br />
Deshalb gelangen sie an CAFCA. Der Staat<br />
müsste ein Interesse daran haben, dass diese<br />
Arbeit gemacht wird. Hier kommt auch die<br />
Wiedergutmachung ins<br />
Spiel, juristisch wie<br />
ökonomisch. Viele dieser<br />
Fragen sind nach<br />
wie vor offen, doch der<br />
Staat trägt nicht dazu<br />
bei, sie zu klären, gibt<br />
keine moralische Unterstützung<br />
und beteiligt<br />
sich auch nicht an<br />
der Finanzierung von<br />
Exhumierungen. Diese<br />
werden durch ausländische<br />
Organisationen<br />
und Staaten finanziert,<br />
darunter die EU, die<br />
Schweiz, Irland, die<br />
USA.<br />
Anfänglich wurden die<br />
Exhumierungen von<br />
argentinischen Ärzten<br />
begleitet. Heute werden<br />
sie von GuatemaltekInnen durchgeführt,<br />
die unterdessen viele Erfahrungen gesammelt<br />
und Expertise entwickelt haben.<br />
Im Zusammenhang mit Exhumierungen<br />
kommt es immer wieder zu Drohungen. Bedroht<br />
werden nicht primär die Ausgrabungsequipen,<br />
sondern jene Personen, die eine Exhumierung<br />
verlangen und bereit sind zu erzählen,<br />
was geschehen ist. Die für die Morde Verantwortlichen<br />
kümmern sich nicht um die Exhumierungen<br />
und haben auch nichts dagegen,<br />
dass die Leute ihre Angehörigen ausgraben<br />
und ihnen ein würdiges Begräbnis ausrichten.<br />
Sobald jedoch eine Person einen juristischen<br />
Prozess anstrebt und die Verantwortlichen zur<br />
Rechenschaft ziehen will, wird‘s gefährlich.<br />
Seit einigen Jahren werden Leute, die sich für<br />
42<br />
Veränderungen engagieren in die Ecke gedrängt,<br />
als Gueriller@s bezeichnet, stigmatisiert.<br />
Héctor dagegen ist stolz, einer revolutionären<br />
Organisation angehört und für Veränderungen<br />
in diesem Land gekämpft zu haben.<br />
CAFCA ist der Wahrheit verpflichtet, es geht<br />
dem Zentrum nicht darum, die Interessen der<br />
einen oder der anderen Seite zu vertreten. Es<br />
ist einfach so, dass 93% der Menschenrechtsverbrechen<br />
von der Armee und paramilitärischen<br />
Organisationen ausgeübt wurden (gemäss<br />
dem offiziellen Wahrheitsbericht).<br />
Die Soldaten der Armee hatten in der Regel<br />
die Möglichkeit, ihre Toten abzutransportieren.<br />
Sie brachten sie jedoch nicht gerne zu deren<br />
Familien, sondern begruben sie und erzählten,<br />
sie seien verschwunden oder zur Guerilla übergelaufen.<br />
So mussten sie nicht öffentlich dazu<br />
stehen, dass so viele Soldaten umgekommen<br />
waren. Bisher wurden auch diese Fälle nicht<br />
aufgearbeitet. Das hat u.a. damit zu tun, dass<br />
es nach dem Krieg keinen Machtwechsel gegeben<br />
hat. Es sind noch immer die gleichen Leute<br />
an der Macht wie damals (z.B. Ríos Montt).<br />
CAFCA hat keine SpezialistInnen für mentale<br />
Gesundheit und psychosoziale Begleitung. Das<br />
Zentrum leitet die Leute an Organisationen in<br />
ihrem Umfeld weiter, die in diesen Bereichen<br />
arbeiten. Die Angehörigen der exhumierten Ermordeten<br />
werden von diesen Organisationen<br />
psychosozial begleitet. Dies ist nötig, da der<br />
ganze Prozess viele Wunden wieder aufreisst<br />
und auch für die comunidad eine soziale Belastung<br />
darstellt. Es braucht viel Vertrauen, damit<br />
die Leute das jahrelange Schweigen brechen<br />
und von den Ereignissen während des Kriegs
zu sprechen beginnen. Die Erinnerungsarbeit<br />
ist ein langwieriger Prozess und muss bereits<br />
eingeleitet werden, lange bevor die Überreste<br />
der Ermordeten ausgegraben werden.<br />
Oft arbeiten in der katholischen Pastoral SpezialistInnen<br />
für mentale Gesundheit, wie z.B. im<br />
Ixcán. Dort gibt es in jeder comunidad eine<br />
entsprechende Person. Im Ixil, in Nebaj, gibt<br />
es zwei Organisationen für mentale Gesundheit,<br />
die ihre Büros in Santa Cruz del Quiché<br />
und in der Hauptstadt und lokale Mitarbeitende<br />
vor Ort haben. Diese sind die Vertrauenspersonen<br />
der Leute bei der Erinnerungsarbeit.<br />
Die evangelistas sind in der Regel nicht an Exhumierungen<br />
interessiert. Die meisten Anfragen<br />
für Exhumierungen kommen von KatholikInnen.<br />
Vor dem Krieg waren die meisten Leute<br />
katholisch und hatten eine Nähe zur katholischen<br />
Kirche. Während der Präsidentschaft<br />
von Ríos Montt sind viele zu den evangelistas<br />
übergelaufen. Diese wollen jetzt die Geschichte<br />
vergessen und neu anfangen.<br />
-> www.cafcaguatemala.org<br />
CAFCA<br />
2 calle 6-77 zona 1<br />
ciudad de Guatemala<br />
Tel.: 22 53 20 80<br />
E-mail: cafca@hushmail.com<br />
Yolanda Aguilar, Projekt «De Víctimas de<br />
Violencia Sexual a Actoras de Cambio»<br />
Yolanda Aguilar, Mit-Gründerin des Projekts<br />
«De Víctimas de Violencia Sexual a Actoras de<br />
Cambio» (von Opfern sexueller Gewalt zu Akteurinnen<br />
des Wandels) besucht uns in «unserem»<br />
Gästehaus, um uns über das Projekt zu<br />
erzählen. Sie bezeichnet sich als Feministin, ist<br />
Ethnologin und arbeitet mit Frauen, die im<br />
Krieg Opfer von sexueller Gewalt geworden<br />
sind.<br />
Sie hat am Wahrheitsbericht der katholischen<br />
Kirche, «Guatemala: nunca más» (Guatemala:<br />
nie wieder), mitgearbeitet und dabei erfahren,<br />
dass während des Kriegs 25-50‘000 Frauen<br />
vergewaltigt worden waren. Das war 1998. Die<br />
Leute haben damals die ersten Erfahrungen<br />
darin gemacht, über die Geschehnisse während<br />
der Zeit der violencia zu sprechen. Ein<br />
Grossteil der Interviewten waren Frauen. Sie<br />
sprachen v.a. darüber, was den anderen geschehen<br />
war, nicht ihnen selbst. In Guatemala<br />
glaubt eine vergewaltigte Frau – und es wird<br />
ihr von der Gesellschaft auch entsprechend zu<br />
verstehen gegeben –, sie selbst trage die<br />
Schuld, sie sei schuldig. Sie versteht die Vergewaltigung<br />
nicht als Verletzung ihrer Rechte<br />
43<br />
als Frau.<br />
Im Bericht «Nunca más» gibt es ein eigenes<br />
Kapitel über die Erlebnisse von Frauen. Es gab<br />
aber in diesem Kapitel – im Gegensatz zu allen<br />
anderen Kapiteln – keine Empfehlungen an die<br />
Regierung. Die InterviewerInnen, die die testimonios<br />
aufgenommen hatten, waren bei der<br />
Verfassung der Empfehlungen nicht dabei, die<br />
wurden von anderen Leuten geschrieben.<br />
Ohne Empfehlungen gab es auch keine koordinierten<br />
Handlungen bezüglich sexuelle Gewalt,<br />
die Frauen erlitten hatten.<br />
In Guatemala wird viel über die toten Männer<br />
gesprochen, weniger über die toten Frauen<br />
und noch viel weniger über die überlebenden<br />
Frauen. Dies hat damit zu tun, dass Vergewaltigung<br />
als eine Angelegenheit in der Beziehung<br />
zwischen Mann und Frau angesehen wird anstatt<br />
als Verletzung der Menschenrechte von<br />
Frauen. Mädchen werden oft sehr jung verheiratet<br />
oder gar verkauft. Ihr Mann bestimmt die<br />
Beziehung zwischen ihnen und das Leben des<br />
Mädchens. Viele Frauen haben also bereits vor<br />
dem Krieg sexuelle Gewalt erlebt, während des<br />
Kriegs dann durch die Soldaten und auch die<br />
Guerilleros. Und jetzt, zehn Jahre nach dem<br />
Krieg, geht die sexuelle Gewalt gegen Frauen<br />
weiter. Es gab Dörfer, aus denen Frauen ausgestossen<br />
wurden, als nach dem Krieg öffentlich<br />
geworden war, dass sie vergewaltigt worden<br />
waren.<br />
Als erster Schritt muss klar werden dass die<br />
Frauen nicht selber schuld, sondern Opfer<br />
sind. Als zweiter müsste die Anklage folgen,<br />
als dritter die Wiedergutmachung.<br />
Es ist einfacher, Opfer zu sein und in diesem<br />
Status zu verharren, als aus der Opferrolle herauszutreten.<br />
Entscheidend ist deshalb zu sehen,<br />
wie die Frauen aus ihrem Opfer- und Objektstatus<br />
herausgekommen und zu Subjekten<br />
geworden sind.<br />
Yolanda und andere Frauen in Guatemala stellten<br />
plötzlich fest, dass die Vergewaltigungen<br />
im Krieg nicht ihr spezifisches Problem waren,<br />
sondern dass sie es mit Frauen weltweit, die<br />
einen Krieg erlebt haben, teilen. Sie haben<br />
dann in Tokio an einem Tribunal zu diesem<br />
Thema teilgenommen – zusammen mit Frauen<br />
aus verschiedenen Ländern, in denen ein Krieg<br />
geführt und Frauen vergewaltigt worden waren.<br />
Als sie von diesem Tribunal zurückkamen,<br />
hatten Yolanda und eine Freundin von ihr die<br />
Vision, hier in Guatemala ebenfalls etwas zu<br />
unternehmen, um die Würde von im Krieg vergewaltigten<br />
Frauen wieder herzustellen. So<br />
gründeten sie im Jahr 2002 das Projekt «De<br />
Víctimas de Violencia Sexual a Actoras de<br />
Cambio».
95% der im Krieg vergewaltigten Frauen sind<br />
Indígenas. Zu Beginn des Projekts ging es darum,<br />
diese Frauen in den Dörfern und Gemeinden<br />
überhaupt zu finden und zu schauen, ob<br />
sie von ihren Erlebnissen erzählen wollten/<br />
konnten. Dann musste geklärt werden, ob sie<br />
auch zu einem Gruppenprozess bereit waren.<br />
Während der ersten zwei Jahre waren Yolanda<br />
und ihre Mitarbeiterinnen damit beschäftigt,<br />
solche Frauen ausfindig zu machen. Die heute<br />
25 Mitarbeiterinnen arbeiten in drei Departementen<br />
mit 65 Frauen, die grösstenteils zwischen<br />
35 und 60 Jahre alt sind. Die meisten<br />
dieser Frauen sprechen kein Spanisch. Über<br />
die Gewalterlebnisse im Krieg haben sie nie<br />
gesprochen, auch nicht mit ihrem Ehemann<br />
oder ihren Kindern. Viele sind deshalb psychisch<br />
krank. Im Gegensatz zu anderen Gewaltopfern<br />
haben sie auch keinerlei Unterstützung<br />
erhalten.<br />
Das Projekt arbeitet mit zwei anderen Organisationen<br />
zusammen, mit je einer in den Bereichen<br />
psychosoziale Begleitung und Frauenrechte.<br />
Einige der Frauen in den Dörfern wurden<br />
zu Promotorinnen ausgebildet und leiten<br />
nun die sechs Selbsthilfegruppen. Im letzten<br />
Jahr haben sich alle Gruppen an einem Kongress<br />
getroffen und sich gegenseitig ihre Geschichten<br />
erzählt. Ein besonderer Erfolg war,<br />
dass sich die Frauen der Hindernisse in den<br />
comunidades, die sie davon abhielten, von ihren<br />
Geschichten zu sprechen, bewusst geworden<br />
waren. Zu diesen Hindernissen gehören<br />
z.B. die Schuldzuweisungen sowie die Verantwortung<br />
für das Überleben und Wohlergehen<br />
ihrer Kinder. Diese Frauen befinden sich in einer<br />
widersprüchlichen Situation: Einerseits<br />
wissen sie, dass die Familie auf sie angewiesen<br />
ist, und es ist schön, in ihrer Nähe zu sein. Andererseits<br />
erhalten sie aber keine Unterstützung<br />
von ihren Familien zurück.<br />
Unterdessen geht es an den Zusammenkünften<br />
der Gruppen nicht mehr nur um das Erzählen<br />
ihrer eigenen Geschichten, sondern auch<br />
um Frauenrechte im Allgemeinen. Auch sind<br />
die Treffen ein Widerstandsakt der Frauen, indem<br />
sie dort offen über ein gesellschaftliches<br />
Tabu sprechen. Im Moment sind die Mitarbeiterinnen<br />
des Projekts dabei zu erkunden, wie<br />
die Gerechtigkeitsvorstellungen der Frauen,<br />
mit denen sie arbeiten, aussehen und ob es<br />
Frauen gibt, die bereit sind, rechtliche Schritte<br />
in Angriff zu nehmen – entweder hier in Guatemala<br />
oder am interamerikanischen Gerichtshof.<br />
Dies ist ein sehr langwieriger Prozess,<br />
doch es ist äusserst wichtig, dass die Frauen<br />
selbst bestimmen, was sie wollen und wann<br />
sie es wollen. Yolanda und ihre Mitarbeiterin-<br />
44<br />
nen hoffen, dass einige Frauen zum Jahresende<br />
diesen Prozess abgeschlossen und sich entschieden<br />
haben, ob sie rechtliche Schritte unternehmen<br />
wollen oder nicht. Sie wünschen<br />
sich, im nächsten Jahr mit dem ersten juristischen<br />
Prozess beginnen zu können. Bis dann<br />
wollen sie politische Bewusstseinsarbeit leisten,<br />
u.a. in der Frauenbewegung und bei RichterInnen.<br />
Denn sie sind sich bewusst, dass sie<br />
für die Prozesse eine grosse nationale und internationale<br />
Unterstützung benötigen.<br />
Für die Mitarbeiterinnen des Projekts ist ein<br />
Ziel erreicht, wenn Frauen in der Öffentlichkeit<br />
über ihre Erlebnisse im Krieg sprechen können.<br />
Sie verstehen sich als Wegbereiterinnen<br />
für das Bewusstsein, dass solche Dinge hier in<br />
Guatemala geschehen. Diese Arbeit möchten<br />
sie 2008 mit einem Tribunal wie in Tokio abschliessen:<br />
Es soll ein lateinamerikanisches<br />
Tribunal sein, nicht nur eines zu Guatemala.<br />
Das Thema soll dadurch an die Öffentlichkeit<br />
getragen und Frauen sollen befähigt werden,<br />
Akteurinnen zu werden und selbst zu sprechen.<br />
Der internationale Strafgerichtshof kümmert<br />
sich nicht um diese Fälle, weil er nicht<br />
rückwirkend arbeitet. Auch der Gerichtshof für<br />
Menschenrechte kümmert sich nicht darum.<br />
Ziel dieses Projekts ist es, eine öffentliche Diskussion<br />
über sexuelle Gewalt gegen Frauen in<br />
Gang zu bringen. In Guatemala ist bereits das<br />
Sprechen über Sexualität ein Tabu, umso mehr<br />
das Sprechen über sexuelle Gewalt. Mit einem<br />
Buch wollen die Mitarbeiterinnen des Projekts<br />
«De Víctimas de Violencia Sexual a Actoras de<br />
Cambio» aufzeigen, wie im Krieg vergewaltigte<br />
Frauen aus ihrer Opferhaltung herausgetreten<br />
und zu Akteurinnen geworden sind. In diesem<br />
Buch sollen die psychosoziale, die juristische<br />
und die politische Ebene beleuchtet werden.<br />
Yolanda arbeitet seit bald vier Jahren an diesem<br />
Projekt – eine Arbeit, die sehr schmerzhaft<br />
ist. Sie möchte deshalb nun ein Jahr Pause<br />
machen und sich erholen. Es hat sich unterdessen<br />
ein Team gebildet, das ihre Arbeit während<br />
dieser Zeit weiterführen wird.<br />
Den Ausführungen von Yolanda folgt eine angeregte<br />
Diskussion mit der Gruppe:<br />
Arbeitet das Projekt auch mit den Tätern? –<br />
Nein, das ist nicht das primäre Interesse dieses<br />
Projekts. Die Arbeit mit den Frauen<br />
braucht sehr viele Ressourcen. Die Gesellschaft<br />
in Guatemala ist extrem machistisch, es<br />
gibt sowohl staatliche als auch innerfamiliäre<br />
Gewalt. Das Wirkungsvollste ist, wenn die Ehe-
frauen sagen, wann eine Grenze erreicht ist,<br />
dass sie sich nicht alles von ihren Männern gefallen<br />
lassen.<br />
Gibt es auch in der Mayakultur Machismo? –<br />
Die Kolonisierung Lateinamerikas hat mit einer<br />
Vergewaltigung begonnen (Malinche). Die Vermischung<br />
von Mayakultur und spanischer Kultur<br />
ist typisch für Guatemala. Die Mayas sind<br />
bezüglich Frauendiskriminierung auch nicht<br />
besser als andere Völker. Die eigentliche Kosmovision<br />
der Mayas unterscheidet sich von<br />
dem, was die meisten Männer in sie hinein interpretieren.<br />
Bis heute sind zwei ganz unterschiedliche<br />
Vorstellungen über die Rollen von<br />
Frauen und Männern vorhanden. Es gibt eine<br />
Gruppe von feministischen Mayafrauen, die<br />
sich damit auseinandersetzen.<br />
Was geschah mit Kindern, die im Krieg durch<br />
eine Vergewaltigung gezeugt worden waren? –<br />
Viele Frauen brachten solche Kinder zu Nonnen.<br />
Andere behielten sie, haben den Kindern<br />
aber nie etwas von diesen Ereignissen erzählt.<br />
Es gibt auch Fälle, in denen die ehemaligen<br />
Soldaten die Kinder wollten, die Mütter sie<br />
aber nicht hergaben. Die Situation dieser Kinder<br />
ist sehr schwierig. Als bei einer Selbstmordwelle<br />
unter Jugendlichen im Ixcán nach<br />
den Gründen geforscht wurde, fand man heraus,<br />
dass viele dieser Jugendlichen Kinder<br />
von im Krieg vergewaltigten Frauen waren.<br />
Vier Jahre sind eine kurze Zeit für ein Projekt<br />
wie «De Víctimas de Violencia Sexual a Actoras<br />
de Cambio». Es sind nicht nur indigene Frauen,<br />
die sich nicht trauen, über sexuelle Gewalt<br />
zu sprechen. Es gibt auch Ladinofrauen, die<br />
nun zum ersten Mal über die Gewalt reden, die<br />
sie zu Hause von ihren Ehemännern erleben.<br />
Ein Beispiel für die Komplexität dieser Thematik:<br />
In einer der Gruppen des Projekts wurde<br />
die Frage aufgeworfen, weshalb nur Frauen<br />
vergewaltigt worden waren. Die Antwort der<br />
Frauen war: Weil die Soldaten ihre eigenen<br />
Frauen nicht dabei hatten. – Es geht hier u.a.<br />
um die Internalisierung des Täters: Die Frauen<br />
denken sich in die Täter hinein, machen sich<br />
seine Interessen zu eigen und finden es selbstverständlich,<br />
Opfer zu sein. Yolanda und ihre<br />
Mitarbeiterinnen arbeiten nun mit einer Maya-<br />
Frauengruppe daran, diese Denkweise zu dekonstruieren.<br />
Wie ist es möglich, dass Männer Frauen systematisch<br />
vergewaltigen? – Das ganze patriarchale<br />
System basiert auf der Kontrolle der<br />
weiblichen Sexualität. Im Krieg potenziert sich<br />
das, der Höhepunkt dieser potenzierten Männ-<br />
45<br />
lichkeit drückt sich in systematischer Vergewaltigung<br />
aus. In den PAC (Zivilpatrouillen)<br />
gab es z.B. eine Hymne über den patrouillierenden<br />
Macho, welche die Männer sangen,<br />
wenn sie Tiere töteten, lebende Tiere assen<br />
oder compañeros folterten (solche Handlungen<br />
gehörten zur Ausbildung der PAC). Es gibt eine<br />
Analogie zwischen Männlichkeit und Militär, das<br />
eine potenziert sich mit dem anderen.<br />
Es gibt aber auch Frauen im Militär (z.B. in<br />
den deutschen Konzentrationslagern während<br />
des Zweiten Weltkriegs oder momentan im<br />
Irak)… – Weder Frauen noch Männer haben die<br />
Gewalt gepachtet. Um sich im Militär behaupten<br />
zu können, stehen den Frauen zwei Rollen<br />
zur Verfügung: jene des weiblichen Opfers und<br />
jene der «vermännlichten» Frau. Diese Rollen<br />
sind kulturelle und soziale Konstruktionen. In<br />
diesem System ist es genauso schwierig, Mann<br />
zu sein, wie Frau zu sein. Auch den Männern<br />
werden Rollen aufgezwungen (Familienernährer,<br />
starker Mann etc.), die sie erfüllen müssen<br />
– ob sie wollen oder nicht. Beide Geschlechter<br />
müssen in der patriarchalen Gesellschaft gleichermassen<br />
zeigen, dass sie die ihnen zugedachten<br />
Rollen erfüllen. Es gibt nicht nur eine<br />
Frauen-, sondern auch eine Männerbewegung,<br />
die sich für alternative Männlichkeitsbilder einsetzt.<br />
Wir wird Schwangerschaftsabbruch in Guatemala<br />
gehandhabt, wie war es speziell während<br />
des Kriegs? – Wir gehen davon aus, dass die<br />
meisten im Krieg vergewaltigten Frauen ihre<br />
mit Gewalt gezeugten Kinder geboren haben.<br />
Sichere Daten dazu gibt es aber nicht. Abtreibung<br />
ist in Guatemala illegal, obwohl der Staat<br />
behauptet, laizistisch zu sein. Tatsächlich ist<br />
das Verhältnis von Staat und katholischer Kirche<br />
in Fragen der Familie und der Familienplanung<br />
sehr eng. Erst vor ein paar Monaten hat<br />
der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das<br />
den Frauen das Recht zuspricht, Verhütungsmittel<br />
und Kondome zu gebrauchen sowie<br />
selbst über die Anzahl Kinder, die sie gebären<br />
wollen, zu entscheiden. Als dieses Gesetz den<br />
Kongress passiert hatte, feierten viele Frauen<br />
auf der Strasse. In der Folge erklärte die katholische<br />
Kirche, sie sei gegen dieses Gesetz.<br />
Deshalb legte schliesslich Präsident Berger<br />
sein Veto gegen das Gesetz ein, so dass es<br />
dann doch nicht zustande kam.<br />
Die Doppelmoral der katholischen Kirche wird<br />
z.B. darin sichtbar, dass der Zölibat u.a. ein<br />
Mittel ist um zu verhindern, dass der ganze<br />
Reichtum der Kirche in den Unterhalt der Familien<br />
der Priester fliesst.
Welches Gericht könnte am ehesten einen Fall<br />
von sexueller Gewalt im Krieg durchziehen? –<br />
Das Problem besteht darin, dass sich sowohl<br />
die anklagenden Frauen als auch die sie unterstützenden<br />
Organisationen einer Gefahr aussetzen,<br />
wenn sie juristische Schritte unternehmen.<br />
Das Projekt «De Víctimas de Violencia<br />
Sexual a Actoras de Cambio» möchte nächstes<br />
Jahr einen Präzedenzfall schaffen: Eine 83-jährige<br />
Frau, die mittlerweile in Mexiko lebt, ist<br />
ev. bereit, einen Prozess anzustreben. Die<br />
Chance, hier in Guatemala einen solchen Fall<br />
durchziehen zu können, ist minim. Wenn man<br />
hier einen Fall eingibt und sechs Monate lang<br />
nichts geschieht, wird er an den interamerikanischen<br />
Gerichtshof weitergezogen. Guatemala<br />
hat im internationalen Vergleich relativ viele<br />
Konventionen – z.B. auch die Frauenrechtskonvention<br />
CEDAW – unterschrieben und<br />
macht auch Fortschritte in Sachen Frauengesetze.<br />
Doch wenn es zu einem juristischen Fall<br />
kommt, sieht alles wieder anders aus.<br />
46<br />
-> Projektkoordination:<br />
UNAMG (Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas):<br />
unamg@terra.com.gt<br />
http://www.unamg.org/<br />
http://wwwfp.mccneb.edu/mayanliterature/<br />
kaqla.htm<br />
IXQIK (Asociación de Mujeres de Petén Ixqik):<br />
ixqik@itelgua.com<br />
ECAP (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción<br />
Psicosocial): ecap@guate.net<br />
http://www.ecapguatemala.org/<br />
Yolanda Aguilar: yolandaau@intelnet.net.gt<br />
PCS (Consejería en Proyectos – Project Counselling<br />
Service) pcincidencia@terra.com.gt<br />
http://www.pcslatin.org/<br />
Siehe auch "Familienplanung ist Gesetz"<br />
(Anhang S. 9)
02. 03. 06: Archive der Nationalen Polizei gefunden: 100 Jahre Geschichte<br />
Während die Gruppe bei CAFCA zu Besuch war,<br />
hatte ich die Gelegenheit, an der ersten öffentlichen<br />
Präsentation der Arbeit in den im letzten<br />
Jahr zum Vorschein gekommenen Archiven der<br />
Nationalen Polizei dabei zu sein.<br />
Der Fund<br />
Im Juni 2005 stiess das Menschenrechtsprokurat<br />
(PDH) bei der Untersuchung einer Explosion<br />
in einem polizeieigenen Sprengstofflager<br />
mitten in der Hauptstadt «zufälligerweise» auf<br />
ein Archiv der Nationalen Polizei. Inmitten von<br />
polizeilichem Autoschrott und Sprengstoff lag<br />
während Jahren ein wahrer Schatz an Dokumenten<br />
verborgen, aus denen man nun in akribischer<br />
Arbeit Bruchstücke fehlender Geschichte<br />
von Hunderten während dem Krieg<br />
«verschwundener» Personen wiederzufinden<br />
hofft.<br />
Der Fund dieser Archive ist ein Meilenstein in<br />
der Geschichte der Wahrheitssuche in Guatemala,<br />
wurde doch die Existenz solcher Archive<br />
systematisch geleugnet, sowohl gegenüber der<br />
Wahrheitskommission (CEH) wie auch gegenüber<br />
von (Staats-) AnwältInnen, die Beweismaterial<br />
für die Aufklärung von Menschenrechtsverbrechen<br />
suchten.<br />
Zurückhaltende Schätzungen gehen von 50 bis<br />
60 Millionen Dokumenten aus (aneinandergereiht<br />
sind das 24,5 km), welche die Geschichte<br />
der Nationalen Polizei seit Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
bis zur Unterzeichnung der Friedensabkommen<br />
1996 dokumentieren. Die ältesten<br />
Dokumente datieren aus dem Jahr 1902. Kriminalistische<br />
Untersuchungen, offizielle Kommunikation<br />
zwischen den verschiedenen Polizeieinheiten,<br />
administrative Informationen,<br />
Zeitungsausschnitte, interne Memoranden, Fotos<br />
von Kadavern, Gesuche um Fahrausweise<br />
und weitere Informationen im Zusammenhang<br />
polizeilicher Tätigkeiten während quasi 100<br />
Jahren wurden in Stapeln, in Archivschubladen<br />
oder in wirrem Durcheinander auf dem Fussboden<br />
in insgesamt 37 Räumen gefunden. Die<br />
47<br />
meisten dieser Dokumente waren während<br />
Jahren dem Regen, dem Schimmel und den<br />
Fledermäusen ausgesetzt. Das Gebäude, in<br />
dem der grösste Teil der Dokumente gefunden<br />
wurde, hat ein Flachdach, das absolut nicht<br />
wasserdicht ist, da das Gebäude eigentlich als<br />
mehrstöckiges Polizeispital geplant war, aber<br />
nie über das Parterre hinausgebaut wurde.<br />
Entsprechend war das Dach dieses einen<br />
Stockwerks nicht als Dach sondern als Zwischenboden<br />
konzipiert und ist deshalb nur bedingt<br />
wasserdicht. Überhaupt ist es schwierig<br />
zu glauben, dass dieses Gebäude ein Spital<br />
hätte werden sollen – bei einem Rundgang<br />
trifft man auf Dutzende von (ebenfalls unfertigen<br />
und deshalb schwierig zu definierenden)<br />
2,5 m 2 kleinen Räumen ohne Lichtquelle.<br />
Retten, was zu retten ist<br />
Die PDH reagierte schnell. Innerhalb von Stunden<br />
wurden ausländische Botschaften über<br />
den Fund informiert, um zu garantieren, dass<br />
die internationale Gemeinschaft diesem Fund<br />
die notwendige Wichtigkeit zukommen liess.<br />
Guatemaltekische Menschenrechtsorganisationen<br />
stellten sofort Freiwillige zur Verfügung,<br />
die das Gelände und die darin gelagerten Dokumente<br />
schützten und mit ersten Aufräumarbeiten<br />
begannen, sobald die entsprechende<br />
richterliche Verfügung vorlag. Dies ging erstaunlich<br />
rasch und reibungslos: Die PDH bekam<br />
die Erlaubnis, ein Inventar der vorgefundenen<br />
Dokumente zu erstellen und es wurde<br />
richterlich entschieden, dass zum Schutz der<br />
Dokumente das Archiv nicht verlegt werden<br />
darf.<br />
Nachdem die Existenz des Archivs in der<br />
Hauptstadt bekannt wurde, machte sich die<br />
PDH auch in den Departments auf die Suche<br />
und wurde in verschiedenen Polizeistationen<br />
fündig. Aus rund 30 Polizeiarchiven unterschiedlicher<br />
Grösse (hier muss man davon<br />
ausgehen, dass diverses Material zerstört wurde)<br />
aus dem Landesinnern wurden noch einmal<br />
etwa 6 Mio. Dokumente zusammengetragen.<br />
Unterdessen sind diverse Fachleute sowie über<br />
hundert von guatemaltekischen Menschenrechtsorganisationen<br />
bezahlte oder freiwillig<br />
aufgebotene Personen daran, eine erste Systematisierung<br />
der Dokumente durchzuführen.<br />
In erster Linie geht es darum, die Papiere von<br />
Schmutz und Schimmel zu reinigen, Fotos wieder<br />
aufzukleben und die metallenen Büro- und<br />
Heftklammern durch solche aus Plastik zu ersetzen,<br />
um weitere Rostschäden zu verhin-
dern. Alle im Archiv arbeitenden Leute tragen<br />
Handschuhe und Mundschutz, da der Schimmelpilz<br />
giftige Substanzen enthält.<br />
Die Arbeit verläuft in vier Phasen: Sicherstellen,<br />
Bewahren, Analysieren, Erhalten. In den<br />
ersten drei Phasen werden Dokumente aus<br />
dem Zeitraum 1975 bis 1985 prioritär gesichtet,<br />
es handelt sich dabei um die Jahre, in denen<br />
am meisten Personen «verschwunden»<br />
wurden. Dabei geht es darum, sowohl den Ansprüchen<br />
der HistorikerInnen, der ArchivarInnen,<br />
der AnwältInnen wie der Familienangehörigen<br />
gerecht zu werden, Ansprüche, die sich<br />
zum Teil aus beruflichen oder persönlichen Interessen<br />
widersprechen.<br />
Sergio Morales von der PDH erklärt, man habe<br />
noch nicht einmal 1% der Dokumente klassifizieren<br />
können. Entsprechend sei es noch zu<br />
früh, um die Strukturen und das Funktionieren<br />
der Polizei beschreiben zu können. «Unterdessen<br />
haben wir zwar erste Bilder über verschiedene<br />
historische Momente, die nach einem<br />
komplexen und enormen Puzzle ausschauen.<br />
Beim Zusammensetzen dieses Puzzles hat man<br />
manchmal das Gefühl, dass gewisse Teile zusammengehören,<br />
aber dann gibt es wieder<br />
Momente der Unklarheit und der Widersprüche,<br />
die zur Vorsicht mahnen», heisst es in einer<br />
ersten Evaluation der PDH über die ersten<br />
drei Monate Arbeit in den Archiven.<br />
Die PDH rechnet mit mehreren Jahren Arbeit,<br />
bis die Dokumente so geordnet und so aufbereitet<br />
sind, dass sie öffentlich zugänglich gemacht<br />
werden können. Im Moment wird kein<br />
einziges Dokument herausgegeben und keinem<br />
der «Fälle» explizit nachgegangen. Zwar<br />
können Menschenrechtsorganisationen, AnwältInnen<br />
oder Familienangehörige bereits Anträge<br />
für die Herausgabe von eventuell im Archiv<br />
vorhandener Dokumente stellen, doch müssen<br />
alle Dossiers zuerst gesichtet, registriert und<br />
digitalisiert werden, bevor sie freigegeben<br />
werden.<br />
Und dann beginnt die schwierige Arbeit der<br />
Menschenrechtsorganisationen, die darin bes-<br />
48<br />
teht, aus den gefundenen Dokumenten Beweise<br />
dafür zu finden, dass der Befehl, eine Person<br />
zu verfolgen, verschwinden zu lassen, zu<br />
foltern, umzubringen, von einer der Polizeistationen<br />
ausging, deren Archive man jetzt gefunden<br />
hat. Laut Mario Polanco, von der Menschenrechtsorganisation<br />
GAM («Gruppe gegenseitiger<br />
Hilfe») wird dies nicht einfach sein.<br />
Man habe zwar in den Archiven die Beweise,<br />
dass Leute überwacht, verfolgt und möglicherweise<br />
sogar vorübergehend festgenommen<br />
wurden. Viele der Fichen endeten mit dem Befehl<br />
proseguir (weiterverfolgen). Doch wenn<br />
man dann endlich Zugang zu den Dokumenten<br />
habe, müsse erst nachgeprüft und bewiesen<br />
werden, dass alle Dossiers/Personen, die ein<br />
proseguir hätten, identisch sind mit den Dossiers,<br />
welche die Menschenrechtsorganisationen<br />
über die Verschwundenen und Ermordeten<br />
haben, so Polanco.<br />
Eine weitere Frage, die vor der Veröffentlichung<br />
der Dokumente geklärt werden muss,<br />
ist das Problem der individuellen versus der<br />
kollektiven Rechte. Die guatemaltekische Bevölkerung<br />
hat ein Recht auf die Wahrheit (kollektives<br />
Recht), die Familienangehörigen derjenigen<br />
Personen, die in den Archiven fichiert<br />
sind, haben das Recht auf Persönlichkeitsschutz<br />
ihrer Liebsten, auch wenn diese bereits<br />
tot sein sollten (persönliches Recht).<br />
Die guatemaltekische Regierung<br />
Die Reaktion der guatemaltekischen Regierung<br />
auf den historischen Fund ist geprägt<br />
von Zurückhaltung und dem Versuch, das<br />
ganze herunterzuspielen. Was man jetzt<br />
plötzlich für ein Aufheben um diese Archive<br />
machen würde, die seien ja immer da gewesen,<br />
ist der offizielle Kommentar. Entsprechend<br />
stellt die Regierung auch keine<br />
finanziellen Mittel zur Verfügung, um das<br />
Datenmaterial zu sichten und aufzuarbeiten.<br />
Immerhin macht der Sprecher des Vizepräsidenten<br />
das Versprechen, dass in<br />
den selben Räumlichkeiten, in denen das<br />
Archiv gefunden wurde, ein Museo de la Memoria,<br />
ein Museum der Erinnerung eingerichtet<br />
werden soll.<br />
Die Geschichte der Nationalen Polizei<br />
Die im Polizeiarchiv gefundenen Dokumente<br />
umfassen verschiedene historische Perioden in<br />
der Geschichte der Polizei und werden bei der<br />
Aufarbeitung entsprechend gruppiert.<br />
In ihren Anfängen war die guatemaltekische<br />
Polizei eine Art Nachbarschaftshilfe, die autonom<br />
funktionierte und keinen spezifischen Auftrag<br />
des Staates erfüllte. Am 7. Dezember<br />
1872 wurde per Dekret die Guardia Civil ge-
gründet, und am 12. September 1881 wurde<br />
ein Polizeireglement für «Sicherheit und Hygiene»<br />
erlassen.<br />
Eine nächste Phase in der Geschichte der Polizei<br />
umfasst den Zeitraum 1900 bis 1930, in<br />
der eine zahlenmässige Vergrösserung und<br />
territoriale Ausweitung polizeilicher Tätigkeiten<br />
stattfand. Sie bekam den Namen Nationale Polizei<br />
und übernahm immer mehr Überwachungsfunktionen.<br />
Die nächste Periode umfasst die Jahre 1931<br />
bis 1944, die Zeit des Diktators Jorge Ubico, in<br />
der die Polizei mehr und mehr Kontrollfunktionen<br />
übernahm. Es wurde eine nichtuniformierte,<br />
sprich Geheimpolizei ins Leben gerufen, die<br />
einen ausgesprochen militärischen Charakter<br />
hatte und deren Aufgabe die Kontrolle der Zivilbevölkerung<br />
war. Eine Arbeit bei der Polizei<br />
fand nur, wer vorher Militärdienst geleistet hatte.<br />
In dieser Zeit waren die Polizeiaufgaben<br />
unterteilt in «öffentliche Ordnung», «Gesundheit<br />
und Hygiene» und «Soziale Verteidigung».<br />
In der Zeit der Revolution von 1944 bis 1954<br />
änderte man den Namen der Polizei wieder auf<br />
Guardia Civil, um ihren repressiven Ruf und ihren<br />
Imageverlust unter Ubico etwas aufzubessern.<br />
Es wurde auch versucht, die Polizei zu<br />
entmilitarisieren.<br />
Mit der Konterrevolution unter der Regierung<br />
von Carlos Castillo Armas (1954) ergab sich<br />
wieder eine völlige Umstrukturierung der Polizei.<br />
Im Rahmen der «Kommunismusbekämpfung»<br />
wurde das Komitee zur Nationalen Verteidigung<br />
gegründet, dem auch die berühmtberüchtigten<br />
judiciales angehörten, deren Aufgabe<br />
die Jagd auf KommunistInnen war.<br />
Ein weiter historische Zeitspanne, die bei der<br />
Untersuchung der Archive von Bedeutung sein<br />
wird, sind die Jahre zwischen 1963 und 1986.<br />
Nach dem Staatsstreich von 1963 übernahm<br />
das Militär die Vormachtstellung über die anderen<br />
Institutionen, inklusive die Polizei, die<br />
sich in ein Instrument der Aufstandsbekämpfung<br />
wandelt, deren Chefs in enger Beziehung<br />
mit dem Militär standen. Die Unterordnung<br />
und Militarisierung wurde durch die Ernennung<br />
diverser Militärs in hohe Polizeiränge institutionalisiert.<br />
Während der 70er-Jahre wurden landesweit<br />
Polizeiposten und -stationen eingerich-<br />
49<br />
tet. Unter der De-facto-Regierung von Ríos<br />
Montt wurde im Jahr 1982 eine neue Einheit<br />
(DIT) gebildet, deren Aufgabe die Verfolgung<br />
und Untersuchung von «Delinquenten» war,<br />
sowie deren Überstellung an spezielle Gerichte.<br />
Die letzte Zeitspanne umfasst die Jahre von<br />
1986 bis 1997. Sie beginnt mit der Regierung<br />
von Vinico Cerezo, der die DIT abschaffte, die<br />
im Verlauf der Jahre in das umwandelt wird,<br />
was heute die guatemaltekische Kriminalpolizei<br />
(SIC) ist. 1997 wurde im Rahmen der Friedensabkommen<br />
die Zivile Nationalpolizei gegründet,<br />
mit dem Ziel, die Praktiken der menschenrechtsverletzenden<br />
Nationalen Polizei<br />
und der Finanzpolizei ein für alle Mal hinter<br />
sich zu lassen.<br />
Was die Struktur der Polizei betrifft, ist es noch<br />
zu früh, um aus den gesichteten Dokumenten<br />
definitive Schlüsse zu ziehen. Was jedoch klar<br />
hervorkommt, ist eine systematische Unterordnung<br />
der Polizei unter das Militär. Die bisher<br />
gefundenen Organigramme der Nationalen<br />
Polizei lassen noch kein genaues Bild zu über<br />
die interne Hierarchie bzw. über eine Parallele<br />
zwischen den jeweiligen Polizeigesetzen und<br />
der Polizeihierarchie. Gefunden hat man bisher<br />
Organigramme aus den Jahren 1936, 1982<br />
und 1997, die darauf hinweisen, dass über die<br />
Jahre eine Veränderung von hierarchischen zu<br />
horizontaleren Strukturen stattgefunden hat.<br />
Abschliessend kann gesagt werden, dass mit<br />
den bereits gefundenen internen Polizeidokumenten<br />
und mit denen, die die PDH im Verlauf<br />
der Aufarbeitung des Archivs zu finden hofft,<br />
ein ziemlich genaues Abbild der Strukturen<br />
und des Funktionierens der Polizei im letzten<br />
Jahrhundert gemacht werden kann.<br />
-> Artikel «Heiss her geht es um PN- und EMP-Archive»<br />
vom Mai 2006:<br />
http://www.guatemala.de/Fijate/index.html<br />
(¡Fijate! No. 360)<br />
Siehe auch "Heiss her geht es um PN- und EMP-Archive"<br />
(Anhang S. 3)
03. 03. 06: Besuch in der Schweizer Botschaft<br />
Kurz vor Ende der Studienreise erleben wir einen<br />
neuen Höhepunkt: ein Gespräch mit Michael<br />
Moerth, ein Deutscher, der seit 11 Jahren<br />
in Guatemala lebt, im Augenblick in der<br />
Schweizer Botschaft angestellt ist, lange als<br />
Strafverteidiger in Deutschland gearbeitet hat,<br />
mit Bischof Gerardi (am 26.4.1998 ermordet)<br />
bei REMHI (Projekt der katholischen Kirche zur<br />
Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses<br />
und der Erarbeitung des Wahrheitsberichts<br />
Nunca Más) gearbeitet und CAFCA (Zentrum<br />
für forensische Analyse und angewandte Wissenschaften<br />
– s. 02. 03. 06) mit aufgebaut<br />
hat. Dieser überaus kompetente Gesprächspartner<br />
und Informant deutet seine jetzige Arbeit<br />
an:<br />
- Friedensförderungsprogramm der Schweiz in<br />
Guatemala / politische Aktion<br />
- Hilfsprojekte für bis zu 700’000 CHF pro<br />
Jahr<br />
- CAFCA-Unterstützung<br />
- Mitarbeit in nationaler Entschädigungskommission<br />
- Kontakte zu Menschenrechtsbeauftragten<br />
und -Kommissionen<br />
- Kontakte zur Staatsanwaltschaft<br />
- UNO-Programm: Untersuchung der kriminellen<br />
mafiösen Strukturen zur Aufklärung in<br />
der Zivilgesellschaft<br />
- Lobby-Arbeit im Kongress<br />
Welche Botschaften müssen nach 36 Jahren<br />
Bürgerkrieg (1960 – 1996) ausgesandt werden?<br />
- Den Opfern muss ihre Würde wiedergegeben<br />
werden (Exhumierungen…).<br />
- Die Justiz muss in der Aufarbeitung der Unrechtsstrukturen<br />
gestärkt werden (keine<br />
Straffreiheit…).<br />
- Entschädigung für die Opfer muss durchgesetzt<br />
werden (moralisch und finanziell – ein<br />
Programm von 300 Millionen ist aufgelegt<br />
worden).<br />
- Konfliktlösung zwischen organisierter Gesellschaft<br />
und Zivilgesellschaft ist vordringliche<br />
Aufgabe des Staates.<br />
Michael Moerth führt weiter aus.<br />
- Die ehemals dominante Rolle des Militärs ist<br />
deutlich schwächer geworden.<br />
- Der Staat ist «unheimlich» schwach.<br />
- 15 Familien haben «sagenhaft» viel Geld<br />
und Besitz.<br />
Vordringliche Forderungen und Fragen sind:<br />
- Der Staat/ Land muss eine «ökonomische<br />
Nische» finden.<br />
50<br />
- Wie kommt es zu einem Umdenken der Elite/<br />
Unternehmer?<br />
- Wie wächst ein Umdenken der sozialen Organisationen<br />
hin zu klarerer Bestimmung<br />
und Koordination?<br />
- Wie entsteht eine neue Industrie?<br />
- Es muss einen gemeinsamen Willen zur Änderung<br />
der Steuerpolitik und Steuerbereitschaft<br />
geben.<br />
Strukturelle Probleme behindern zusätzlich einen<br />
nachhaltigen Fortschritt:<br />
- Guatemala ist keine Nation – es gibt keine<br />
allgemeine Identität mit dem eigenen Volk.<br />
- Das «Gemeinwohl» ist kein Thema – obwohl<br />
die Parolen aller Parteien propagieren:<br />
«Guatemala für alle».<br />
- Es gibt einen schwachen Staat, eine starke<br />
Oligarchie, eine schwache Zivilgesellschaft<br />
(NGOs …Obwohl es einer unserer/meiner<br />
stärksten Eindrücke durch unsere Begegnungen<br />
in diesem Land war, wie viele aktive<br />
Kommunen, Kooperativen, Vereine, kreative<br />
Gruppen… es gibt.)<br />
Welche Perspektive sieht Michael Moerth?<br />
- Die «Friedensabkommen» von 1996 sind<br />
noch kaum mehr als ein relativer Waffenstillstand.<br />
- Die Gefahr von Gewalt-Konflikten wächst erneut<br />
auf beiden Seiten.<br />
- Auch und gerade angesichts der 2007 anstehenden<br />
Neuwahlen (bisher ist noch nie eine<br />
Regierung wiedergewählt worden, obwohl es<br />
im Grunde keine Opposition gibt) verstärkt<br />
sich die allgemeine Unsicherheit und die offene<br />
Frage nach einer Perspektive.<br />
Beeindruckt verabschieden wir uns von einem<br />
überaus engagierten und kompetenten Gesprächspartner.<br />
Anschliessend erweist sich Antonio auf einer<br />
Stadtrundfahrt mit seinem «Tourismo» als ein<br />
informierter Führer durch seine Hauptstadt mit<br />
ihren Licht- und Schattenseiten.<br />
-> Michael Moehrt: soluna@amigo.net.gt
03. 03. 06: Acoguate<br />
Estéban besucht uns im Gästehaus und erzählt<br />
von der Arbeit von Acoguate:<br />
In den 1980er-Jahren hat PBI (Peace Brigades<br />
International) begonnen, hier in Guatemala zu<br />
arbeiten, d.h. bedrohte MenschenrechtsaktivistInnen<br />
zu begleiten. In den 1990er-Jahren,<br />
als viele Flüchtlinge aus Mexiko zurückkehrten,<br />
kamen weitere Organisationen aus verschiedenen<br />
Ländern hinzu.<br />
Acoguate begleitet Menschen, die der Gefahr<br />
von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt<br />
sind. Nebst dem Schutz versteht es die Organisation<br />
auch als ihre Aufgabe, Menschenrechtsverletzungen<br />
öffentlich zu machen. Diese<br />
Öffentlichkeit, die die internationale Begleitung<br />
schafft, kann z.T. Menschenrechtsverletzungen<br />
verhindern.<br />
Die Demokratisierung in den 1980er-Jahren<br />
war ein Kompromiss mit dem Militär, das die<br />
wirkliche Macht in den eigenen Händen behielt.<br />
Trotzdem wurden damals auch neue Spielräume<br />
geschaffen. Aufgabe der internationalen<br />
Präsenz war es, einen Keil in diese Ritzen zu<br />
treiben. Im Justizwesen z.B. zeigt sich, wie<br />
klein diese Spielräume noch immer sind. Straflosigkeit<br />
ist weit verbreitet, nur 1 Promille der<br />
Mordfälle wird überhaupt aufgeklärt. Dies ist<br />
u.a. eine Nachwirkung der Militärherrschaft. In<br />
den 1980ern war die Gewalt vom Staat ausgegangen,<br />
heute gelingt es dem Staat nicht, gegen<br />
die Gewalt von Drogenkartellen, Oligarchien,<br />
Jugendbanden und klandestinen Mächten<br />
vorzugehen. Insofern hat eine grundlegende<br />
Verschiebung stattgefunden. Die Oligarchie<br />
und die Mafia besitzen sehr viel Macht in Guatemala<br />
und hindern den Rechtsstaat daran, die<br />
Kontrolle auszuüben. Deshalb ist es sehr<br />
schwierig, Militärs vor Gericht zu bringen.<br />
Wenn trotzdem solche Prozesse angerissen<br />
werden, werden die ZeugInnen bedroht oder<br />
umgebracht, Richter und Staatsanwälte werden<br />
ebenfalls bedroht, anderweitig involvierte<br />
Personen verschwinden, es wird in die Büros<br />
von unterstützenden Organisationen eingebrochen,<br />
ihre Computer gestohlen, ihre Mitarbeitenden<br />
werden bedroht oder gar ermordet.<br />
Dies macht solche Prozesse natürlich sehr<br />
schwierig.<br />
Trotzdem haben sich 22 Gemeinden in der<br />
«Vereinigung für Gerechtigkeit und Versöhnung»<br />
zusammengeschlossen und streben einen<br />
Prozess gegen die ehemaligen Generäle<br />
und Präsidenten Fernando Romeo Lucas García<br />
(1978-82) und José Efraín Ríos Montt (1982-<br />
83) an. Dieser Prozess wird primär von der<br />
51<br />
Menschenrechtsorganisation CALDH vorangetrieben.<br />
Internationale Freiwillige begleiten die<br />
130 ZeugInnen aus den Departementen Chimaltenango,<br />
Ixil, Huehuetenango und Ixcán,<br />
die gegen die beiden Generäle ausgesagt haben.<br />
Acoguate koordiniert diese Begleiteinsätze<br />
vor Ort. Verschiedene Menschenrechtsgruppen<br />
und -organisationen oder Solidaritätskomitees<br />
in den USA und Europa suchen in ihren<br />
Ländern die Freiwilligen und bereiten diese auf<br />
ihren Einsatz vor. Die Schweizer Partnerorganisation<br />
von Acoguate ist «Peace Watch<br />
Switzerland». Die Freiwilligen verpflichten sich<br />
für eine Mindestdauer von drei Monaten. Einige<br />
bleiben auch länger, sechs Monate oder ein<br />
Jahr. Je länger die Freiwilligen bleiben, desto<br />
grösser wird die psychische Belastung. Die<br />
meisten erhalten für ihre Arbeit keine finanzielle<br />
Entschädigung, bekommen aber einen<br />
Teil der Spesen bezahlt, bzw. können z.B. gratis<br />
wohnen.<br />
Der Prozess gegen Lucas García und Ríos<br />
Montt wurde in den Jahren 2000 bzw. 2001<br />
eingeleitet. Trotzdem befindet er sich noch immer<br />
im Stadium der Abklärungen, es ist noch<br />
immer nicht zur Anklage gekommen – denn<br />
die Staatsanwaltschaft will diesen Prozess eigentlich<br />
nicht. Die ZeugInnen haben bereits<br />
vor dem Staatsanwalt ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft<br />
hat aber schlechte Frage gestellt,<br />
so dass die ZeugInnen gar nicht dazu kamen,<br />
auf Hintergründe einzugehen. Auch einige<br />
Richter verhalten sich nicht korrekt, bzw. weigern<br />
sich, für den Prozess nötige Exhumierungen<br />
voranzutreiben. Oder sie fällen Urteile, die<br />
den Prozess verhindern. Z.T. mussten Fälle bis<br />
ans Verfassungsgericht weitergezogen werden,<br />
weil die unteren Instanzen uneffizient oder gar<br />
behindernd arbeiteten. In der Regel ist es allerdings<br />
so, dass die verschiedenen Instanzen<br />
sich gegenseitig decken. So schliesst sich der<br />
Kreis: Z.B. hätte Ríos Montt gemäss Verfassung<br />
im Jahr 2003 nicht fürs Präsidentenamt<br />
kandidieren dürfen, doch schlussendlich qualifizierte<br />
das Verfassungsgericht die Kandidatur<br />
als verfassungskonform.<br />
In Guatemala gibt es die Möglichkeit, dass die<br />
Opfer selbst als NebenklägerInnen, als dritte<br />
Partei nebst der Staatsanwaltschaft und den<br />
Angeklagten auftreten und so im Prozess Fragen<br />
stellen können. Den ZeugInnen kommt<br />
deshalb eine sehr wichtige Funktion zu.<br />
Schliesslich kann nicht damit gerechnet werden,<br />
dass sich die Staatsanwaltschaft ernsthaft<br />
für die Opfer ins Zeug legt.
Mitarbeitende von Menschenrechtsorganisationen<br />
wie Acoguate oder CALDH, welche die<br />
ZeugInnen begleiten oder mit ihnen arbeiten,<br />
haben bereits Morddrohungen erhalten oder<br />
sind überfallen worden. Auch wurden ZeugInnen<br />
und internationale BegleiterInnen eingeschüchtert<br />
oder mit dem Tod bedroht. In den<br />
1980er-Jahren wurde gar eine Granate ins<br />
Büro von PBI geworfen.<br />
CALDH arbeitet mit den ZeugInnen, damit sie<br />
sich im Prozess richtig verhalten und über das<br />
nötige Know-how verfügen, um klar machen<br />
zu können, dass es sich bei dieser Sache um<br />
Genozid handelt. Dies ist eine schwierige und<br />
gleichzeitig sehr wichtige Arbeit. Ohne diese<br />
Schulung könnten die Leute vor Gericht nicht<br />
so sprechen, dass ihre Voten die Anklage unterstützen.<br />
Der Prozess wird wohl absichtlich hinausgezögert,<br />
damit er schlussendlich gar nie stattfinden<br />
wird: Lucas García ist bereits krank, hat<br />
den Verstand verloren und weilt im Ausland.<br />
Die übrigen Angeklagten befinden sich hingegen<br />
in gutem Gesundheitszustand. Die ZeugInnen<br />
werden aber auch älter, viele von ihnen<br />
leben in extremer Armut und müssen mit 1<br />
US-Dollar pro Tag auskommen. Trotzdem verlieren<br />
sie den Mut nicht. Sie sind dankbar für<br />
die internationale Begleitung und fühlen sich<br />
durch sie gestärkt. Estéban meint, dass eher<br />
die begleitenden Organisationen mutlos werden<br />
und manchmal resignieren, weil es nicht<br />
vorwärts geht und es gar Stimmen gibt, die<br />
Guatemala eine Zukunft wie die Gegenwart<br />
Kolumbiens voraussagen.<br />
Acoguate arbeitet nun schon seit vier, fünf<br />
Jahren in dieser Sache, ohne dass die Organisation<br />
viel verändern konnte. Andererseits darf<br />
man aber nicht vergessen, dass die ZeugInnen<br />
sich ohne die Begleitung und den Schutz nicht<br />
zusammengeschlossen hätten. Auch anderes<br />
wäre ohne die Arbeit von Acoguate und ähnlichen<br />
Organisationen nicht möglich – sie bewirken<br />
also durchaus etwas.<br />
Die Armee hat nie nur die Guerilla bekämpft,<br />
die war militärisch sowieso schwach. Sondern<br />
sie wollte die Mayagesellschaft zerstören.<br />
Denn sie fürchtete, die Mayas könnten sich organisieren,<br />
von den Bergen runter kommen<br />
und die Macht übernehmen. Deshalb hat die<br />
Armee die Mayas gegeneinander ausgespielt,<br />
gespalten und die einen Mayas andere Mayas<br />
umbringen lassen. Sie hatte Angst vor einer<br />
Bewegung von «Indios» (das ist in Guatemala<br />
ein Schimpfwort) – ein Ausdruck des in Guatemala<br />
herrschenden Rassismus.<br />
Zum Schluss wollen wir noch etwas genauer<br />
wissen, wie die konkrete Arbeit der internatio-<br />
52<br />
nalen BegleiterInnen aussieht. Estéban erzählt:<br />
Bevor die BegleiterInnen nach Guatemala<br />
kommen, werden sie von den Partnerorganisationen<br />
in ihrem Herkunftsland ein Stück<br />
weit vorbereitet. Zudem müssen sie bestimmte<br />
Bedingungen erfüllen: Sie waren bereits<br />
einmal in einem Land des Südens und hatten<br />
dort Basiskontakte, sie sprechen Spanisch etc.<br />
Nach ihrer Ankunft absolvieren sie einen 1-wöchigen<br />
Kurs über Guatemala, die Justiz, den<br />
Prozess, die Mayakultur sowie über die Theorie<br />
und Praxis der Begleitarbeit. Nach dieser Woche<br />
entscheidet Acoguate, wer als BegleiterIn<br />
arbeiten kann und wer wohin kommt.<br />
Für die ZeugInnen ist es auch eine Zumutung,<br />
dass die BegleiterInnen alle drei Monate wechseln<br />
(im Schnitt bleiben sie jedoch länger als<br />
vier Monate). Andererseits darf nicht vergessen<br />
werden, dass die BegleiterInnen für diese<br />
Arbeit von zu Hause weggehen, nichts verdienen<br />
etc. Acoguate überlegt sich deshalb Möglichkeiten,<br />
diese «Ausfälle» der Freiwilligen irgendwie<br />
zu kompensieren.<br />
-> E-mail Acoguate: acoguate@gmx.net<br />
-> Menschenrechtsorganisation CALDH: http://<br />
www.caldh.org/<br />
-> Informationen zu Freiwilligeneinsätzen in Guatemala:<br />
Peace Watch Switzerland: www.peacewatch.ch<br />
Peace Brigades International: www.pbi.ch<br />
Siehe auch "Muere Romeo Lucas" und "Erste Anhörung<br />
wegen Genozids" (Anhang S.1 resp. S. 2)
04. 03. 06: Centro de Estudios de Guatemala (CEG)<br />
Wir werden von Eduardo Márquez und Sandino<br />
Asturias Valenzuela, Enkel des Schriftstellers<br />
Miguel Angel Asturias und Leiter des CEG,<br />
empfangen. Asturias erzählt uns über die Arbeit<br />
des CEG und v.a. über die aktuelle Situation<br />
in Guatemala.<br />
Das CEG arbeitet in zwei Bereichen: Es berät<br />
und unterstützt den Kongress in der Erarbeitung<br />
von Gesetzen zur Umsetzung der Friedensabkommen<br />
und es fertigt Analysen zum<br />
Thema Sicherheit in Guatemala an.<br />
Wenn man in Guatemala heute von Sicherheit<br />
spricht, meint man v.a. «innere Sicherheit».<br />
Früher war das anders, da ging es z.B. um territoriale<br />
Sicherheit. Gemäss Asturias ist die<br />
heutige Unsicherheitssituation in Guatemala<br />
darauf zurückzuführen, dass die Friedensabkommen<br />
nicht umgesetzt werden. Das Ziel<br />
dieser Abkommen war es, das Land in eine<br />
Demokratie überzuführen. Andererseits haben<br />
neoliberale Politiken zum Ziel, den Staat zu<br />
schwächen. Der Staat hätte sich von einem<br />
autoritären zu einem integrativen Staat verändern<br />
müssen. Auf den Sicherheitsbereich bezogen<br />
heisst das, dass zivile Kräfte gestärkt<br />
und die Polizei entmilitarisiert werden müssten.<br />
Den Staat müsste man stärken, in einem<br />
ersten Schritt finanziell: Eine Steuerreform<br />
wäre dringend nötig.<br />
Der Hurrikan «Stan» hat gezeigt, dass der<br />
Staat nicht in der Lage ist, eine solche Situation<br />
zu bewältigen, weder finanziell noch politisch,<br />
noch infrastrukturell. Diese Bedrohung<br />
genügte bereits, ein riesiges Chaos anzurichten,<br />
das den Staat überfordert.<br />
Ein Neudenken der Rolle des Staates wäre nötig<br />
gewesen, um die sozialen und politischen<br />
Probleme nach der Unterzeichnung der Friedensabkommen<br />
in den Griff zu kriegen. Das<br />
Kräfteverhältnis von Militär und Polizei hätte<br />
umgekehrt werden und die Sicherheitskräfte<br />
hätten gestärkt werden müssen. So, wie die<br />
Sicherheitskräfte in Guatemala momentan organisiert<br />
sind, sind sie einem Sicherheitsproblem<br />
wie «Stan» nicht gewachsen.<br />
In der lateinamerikanischen «Rangliste» von<br />
Mord und Totschlag war Guatemala bis anhin<br />
auf Platz 2, seit Januar dieses Jahres hat es<br />
Kolumbien überholt und ist auf Platz 1 vorgerückt.<br />
Dies hängt eng mit der Sozialpolitik des<br />
Staates und den fehlenden Perspektiven für<br />
Jugendliche zusammen. In Guatemala herrscht<br />
eine Kultur der Gewalt, die historisch bedingt<br />
ist und durch das Geschäft mit der Gewalt aufrecht<br />
erhalten wird. Es kann z.B. jedeR ganz<br />
legal eine Waffe erwerben. Pro Jahr werden in<br />
53<br />
Guatemala 43‘000 Stück Munition verkauft. Es<br />
gibt 80‘000 Angestellte von privaten Sicherheitsfirmen,<br />
davon sind 30‘000 legal registriert.<br />
Die Medien haben in diesem Geschäft<br />
eine ganz wichtige Funktion: Die «Prensa Libre»<br />
wird täglich 35‘000mal verkauft. Die beiden<br />
Zeitungen, die sich auf Morde und andere<br />
Verbrechen spezialisiert haben, werden hingegen<br />
800‘000mal verkauft. Auf der einen Seite<br />
gibt es also dieses Geschäft mit der Gewalt,<br />
auf der anderen einen schwachen Staat, der<br />
dieses gewalttätige Denken ebenfalls internalisiert<br />
hat.<br />
In den letzten Jahren ist die Gewalt gegen Jugendliche<br />
stark angestiegen. Es wird mit ständig<br />
grösserer Härte und Gewalt gegen jegliche<br />
Delinquenz vorgegangen – eine Entwicklung,<br />
die in die gleiche Richtung zeigt wie in El Salvador.<br />
Dieses repressive Denken hat hier in<br />
Guatemala zu einer zusätzlichen Welle von Gewalt<br />
und Morden geführt. In El Salvador sind<br />
40‘000 Mitglieder von Jugendbanden eingesperrt,<br />
täglich werden auch welche ermordet.<br />
Guatemala schwenkt nun ebenfalls auf diese<br />
harte Tour gegen Delinquenten ein – eine Entwicklung<br />
mit ganz klar wahltaktischem Hintergrund.<br />
Durch die Militarisierung der Sicherheitspolitik<br />
werden die zivilen Sicherheitskräfte geschwächt,<br />
v.a. auch die Strafjustiz. Zudem<br />
überlässt die Regierung bestimmte Sicherheitsfragen,<br />
z.B. die Drogenbekämpfung, den<br />
USA. Zur Guatemala-internen Militarisierung<br />
kommt also noch das US-Militär hinzu. Ebenfalls<br />
nicht zu unterschätzen sind in diesem Zusammenhang<br />
die Politik der Administration<br />
Bush und die Folgen des 11. Septembers<br />
2001. Die Sicherheitsagenda der USA hat auch<br />
das Sicherheitssystem Guatemalas verschärft.<br />
Die neue Trinität von Oligarchie, USA und Militär<br />
stärkt die Militarisierung der Sicherheitspolitik.<br />
So ist es beispielsweise wieder völlig akzeptabel,<br />
dass das Militär an Demonstrationen<br />
eingesetzt wird.<br />
Die Kaibiles, Spezialeinheiten der Armee, begingen<br />
die grössten Massaker während der<br />
Zeit der violencia. Sie existieren heute noch,<br />
und sie werden noch immer auf die gleiche<br />
Weise ausgebildet wie damals. Jene, die als<br />
UNO-Soldaten im Kongo umgekommen sind,<br />
gehörten dieser Einheit an. Sie hatten dort im<br />
Kongo genau die gleiche Aufgabe, wie anno<br />
dazumal in Guatemala: Aufstandsbekämpfung.<br />
Wäre ihre Aktion – die nicht zu ihrem Mandat<br />
gehörte – nicht gescheitert und wären die beteiligten<br />
Soldaten dabei nicht umgekommen,<br />
wären sie in Guatemala als Helden gefeiert
worden.<br />
Die momentanen Ermordungen und aussergerichtlichen<br />
Hinrichtungen in Guatemala nehmen<br />
z.T. den Charakter «sozialer Säuberungen»<br />
an. Das System spezifischer Ermordungen<br />
wurde wieder belebt und ist nun gegen<br />
Delinquenz im Allgemeinen gerichtet. In einem<br />
Fall in Sololá wurde eine Bürgerwehr gegründet,<br />
die Delinquente mit dem Einverständnis<br />
aller Mitglieder umgebracht hat. In der Folge<br />
wurde der Kreis der «Delinquenten» auf andere<br />
Gruppen, wie z.B. Homosexuelle, ausgeweitet.<br />
Damit erreichen diese aussergerichtlichen<br />
Hinrichtungen definitiv eine Qualität, die es<br />
hier in Guatemala bereits einmal gegeben<br />
hat…<br />
In den letzten zwei Jahren<br />
wurden 10‘000 Menschen<br />
umgebracht, 95%<br />
dieser Morde blieben unaufgeklärt.<br />
Wenn man<br />
z.B. ein Handy klauen<br />
will, ist es einfacher, einen<br />
Raubmord als «nur»<br />
einen Raub zu begehen,<br />
da der Fall dann nicht<br />
aufgeklärt wird.<br />
Mit den Friedensabkommen<br />
waren die Morde<br />
zwischenzeitlich zurückgegangen.<br />
Drei Entwicklungen<br />
haben aber dazu<br />
geführt, dass sie nun<br />
wieder zugenommen haben:<br />
Die Politik der USA,<br />
der Rückzug der UNO<br />
aus dem Land und die<br />
zunehmende Militarisierung<br />
der Sicherheitspolitik<br />
in Guatemala.<br />
Auf der weltweiten «Rangliste» der Unfähigen<br />
ins Sachen Nahrungsmittelsicherheit liegt Guatemala<br />
momentan nach zwei afrikanischen<br />
Staaten auf dem dritten Platz (gemäss Jean<br />
Ziegler). Man spricht in Guatemala bereits von<br />
einem «gescheiterten Staat», der nicht in der<br />
Lage ist, die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung<br />
zu decken. Eine Steuerreform, die auch<br />
die Oligarchie auf ihre Abgaben verpflichtet, ist<br />
etwas vom Wichtigsten, was das Land braucht.<br />
Nur so kann eine andere Sozialpolitik überhaupt<br />
finanziert werden. In Guatemala gibt es<br />
etwa 100 Familien, die – wenn sie ihre Steuern<br />
tatsächlich bezahlen würden – 70% der Steuern<br />
liefern müssten. Doch sind es gerade diese<br />
Leute, die Steuerhinterziehung betreiben. Die<br />
MigrantInnen, die in den USA arbeiten, schicken<br />
jährlich 1.3 Millionen US-Dollars nach<br />
Guatemala. Dieses Geld geht v.a. in drei Sektoren:<br />
Zement, Lebensmittel (u.a. in die Fast-<br />
54<br />
food-Kette «Pollo Campero») und Haushaltgeräte.<br />
Genau diese Sektoren gehören zu den<br />
grossen Steuerhinterziehern. Gleichzeitig sind<br />
die Geldsendungen der MigrantInnen die<br />
grössten Deviseneinnahmen des Landes.<br />
Die Regierung arbeitet mit ihrer Politik auf einen<br />
sozialen Kollaps hin. Der sozialpolitische<br />
Diskurs und die tatsächliche Sozialpolitik passen<br />
überhaupt nicht zusammen. Während z.B.<br />
der Gefängnisdirektor durchaus eine Politik in<br />
Richtung soziale Integration betreiben möchte,<br />
spricht sein Chef, der Innenminister, öffentlich<br />
davon, die Todesstrafe, anonyme Richter und<br />
juristische Schnellverfahren einzuführen. Die<br />
autoritäre, repressive, anti-kommunistische<br />
Mentalität der Regierung ist<br />
an einem Punkt, an dem sie<br />
verändert werden muss – so<br />
kann es jedenfalls nicht mehr<br />
weitergehen. Doch im Hinblick<br />
auf die Wahlen 2007 gibt es<br />
v.a. rechte Projekte mit enorm<br />
viel Geld.<br />
Gleichzeitig besteht v.a. in<br />
Südamerika ein Trend hin zu<br />
linken Regierungen mit einer<br />
integrativen Politik. In Zentralamerika<br />
gibt es ebenfalls<br />
Veränderungen: In Nicaragua<br />
sind 80% der Bürgermeisterämter<br />
von SandinistInnen besetzt,<br />
in El Salvador wird im<br />
Hinblick auf die Wahlen vom<br />
nächsten Sonntag (12. März)<br />
erwartet, dass die Linken 70-<br />
80% der Bürgermeisterämter<br />
und der Sitze des Kongresses<br />
für sich entscheiden. (Nachtrag:<br />
Die politische Wende haben<br />
diese Wahlen nicht gebracht.<br />
Zwar konnte die aus der linken Guerilla<br />
hervorgegangene FMLN bei den Parlamentswahlen<br />
einen Sitz zulegen, doch bleibt sie mit<br />
32 Mandaten weiterhin knapp hinter der rechten<br />
Partei Arena, die 34 Abgeordnete in die<br />
Nationalversammlung (insgesamt 84 Sitze)<br />
entsenden kann. Mit einem denkbar knappen<br />
Vorsprung von gut 100 Stimmen sicherte sich<br />
dafür die FMLN-Kandidatin Violeta Menjívar<br />
für die nächsten drei Jahre das Bürgermeisteramt<br />
der Hauptstadt.) Zwar haben diese Projekte<br />
auch ihre Fehler, trotzdem handelt es<br />
sich hier um einen klaren Richtungswechsel. In<br />
Guatemala gibt es zur Zeit Bestrebungen, die<br />
linken Kräfte zusammenzuführen.<br />
-> CEG – Centro de Estudios de Guatemala<br />
10a. Calle «A» 6-26 zona 2<br />
Ciudad Guatemala<br />
E-mail: ceg@c.net.gt<br />
http://www.c.net.gt/ceg
Anhang<br />
Muere Romeo Lucas<br />
Falleció en Venezuela el sábado por la noche, a<br />
consecuencia de una atrofia cerebral, sin haber<br />
enfrentado a la justicia<br />
Por: Jennyffer Paredes, Lorena Seijo, Ana<br />
Lucía Blas<br />
Grupos sociales lamentan que el ex gobernante Fernando<br />
Romeo Lucas García no haya sido sentenciado.<br />
Tras una larga agonía, el ex presidente Fernando<br />
Romeo Lucas García –1978-1982–, a quien la Audiencia<br />
Nacional Española le seguía un proceso por<br />
genocidio, falleció el sábado en Venezuela a consecuencia<br />
de una atrofia cerebral; grupos de derechos<br />
humanos lamentaron que la muerte le haya ganado<br />
la batalla a la justicia.<br />
“Murió de un paro respiratorio el sábado por la<br />
noche, en la cama de su casa. Estaban con él<br />
familiares y amigos” , dijo vía telefónica Eduardo<br />
Vallejas, amigo de la familia de la esposa<br />
del ex presidente.<br />
Lucas García vivía en la ciudad de Puerto la<br />
Cruz, en el estado Anzoátegui, a 230 kilómetros<br />
al este de Caracas. Estaba casado con la<br />
venezolana Elsa Cirigliano, de una familia de<br />
empresarios de la construcción, de equipos deportivos<br />
y de medios de comunicación.<br />
Vallejas dijo que el funeral se realizó ayer por<br />
la tarde en un pequeño cementerio de la ciudad<br />
en una “ceremonia sencilla”, en la que se<br />
interpretó el Himno de Guatemala y a la que<br />
asistieron familiares y amigos. Fue sepultado<br />
en un pequeño cementerio de la ciudad.<br />
Las numerosas dolencias que padecía desde<br />
1991 (diabetes, infección urinaria, atrofia cerebral<br />
y Alzheimer) provocaron que sus últimos<br />
años permaneciera en cama.<br />
En los últimos días, la salud del ex presidente<br />
había empeorado, por lo que fue trasladado a<br />
un hospital venezolano para recibir atención<br />
médica, donde murió.<br />
Su hermana Delia Lucas García, y su hija, Ana<br />
María de Rivera, viajaron al país sudamericano<br />
para acompañarle. Su hermano, Benedicto<br />
Lucas García, jefe del Estado Mayor Presiden-<br />
1<br />
cial durante su mandato, prefirió permanecer<br />
en Guatemala, según comentó María Elena<br />
Nana Winter, esposa de éste.<br />
Proceso judicial<br />
La muerte causó cierta decepción en los grupos<br />
de derechos humanos que esperaban que<br />
fuera juzgado por genocidio, mientras que antiguos<br />
líderes de extrema derecha –como Leonel<br />
Sisniega Otero– lamentaron su muerte.<br />
“Durante su mandato el país avanzó notablemente.<br />
Se construyó la represa de Chixoy, el<br />
Puerto Quetzal y la carretera a Antigua Guatemala”,<br />
detalló Sisniega.<br />
Lucas García es uno de los seis acusados de<br />
genocidio por la Audiencia Nacional Española,<br />
tras una denuncia interpuesta por la Fundación<br />
Rigoberta Menchú en el 2001.<br />
El 19 de julio una comisión del tribunal<br />
español llegará al país para interrogar al resto<br />
de los acusados, entre los que figuraba Romeo<br />
Lucas.<br />
Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores,<br />
Germán Chupina Barahona, Donaldo Álvarez<br />
Ruiz y Pedro García Arredondo están citados a<br />
declarar.<br />
En el caso de Ríos Montt, sus abogados han interpuesto<br />
varios recursos para evitar que se<br />
siente en el banquillo, lo que perjudicaría su<br />
imagen como precandidato presidencial del<br />
FRG.<br />
Masacres<br />
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico<br />
(CEH), señala que entre 1978 y 1985 “el Estado<br />
guatemalteco cometió numerosas y brutales<br />
violaciones a los derechos humanos”.<br />
También responsabiliza a la Policía Nacional,<br />
del gobierno de Lucas García, de quemar la<br />
Embajada de España en 1980, donde fallecieron<br />
38 personas.<br />
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna<br />
Mack dijo que “debe ser frustrante para los familiares<br />
de las víctimas de un gobierno cuyas<br />
políticas cobraron tantas vidas, no haber podido<br />
ver al responsable en el banquillo de los<br />
acusados”.<br />
De las más de 200 mil personas asesinadas<br />
durante los 36 años de conflicto interno, la<br />
CEH estimó que 132 mil perecieron durante los<br />
gobiernos de Lucas García y Ríos Montt.<br />
Anhang
Biografía<br />
Esta es una síntesis sobre la vida de Fernando<br />
Romeo Lucas García:<br />
Nació en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el<br />
4 de julio de 1924, hijo de Fernando Lucas<br />
Juárez y Concepción García.<br />
En 1978, apoyado por los partidos de extrema<br />
derecha Institucional Democrático y Revolucionario,<br />
ganó la Presidencia. Las elecciones fueron<br />
calificadas de fraudulentas por sus opositores.<br />
Mientras estuvo al frente del Gobierno, el país<br />
conoció un período de violencia y represión tan<br />
alarmante que el vicepresidente, Francisco<br />
Villagrán Kramer, renunció a su cargo en 1981.<br />
En marzo de 1982 fue derrocado por un golpe<br />
de Estado promovido por el general José Efraín<br />
Ríos Montt, lo que motivó su exilio a Venezuela.<br />
En el 2001, la Audiencia Nacional Española inició<br />
un proceso penal en su contra, por los cargos<br />
de genocidio, terrorismo de Estado, torturas,<br />
múltiples secuestros y asesinatos cometidos<br />
en el país durante su mandato.<br />
Postura: Que lo juzgue Dios<br />
“Ojalá que en el más allá la justicia esté a favor<br />
de las víctimas y los huérfanos”, deseó<br />
ayer Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la<br />
Paz 1992, tras conocer el fallecimiento del Romeo<br />
Lucas García.<br />
Menchú recordó que Lucas García gobernaba<br />
el país cuando en 1980 la Policía Nacional provocó<br />
presuntamente el incendio de la Embajada<br />
de España, donde murió su padre, Vicente<br />
Menchú.<br />
“Es lamentable que la ley terrenal no lo haya<br />
alcanzado y sus crímenes queden en total impunidad”,<br />
lamentó.<br />
La Nobel espera que la justicia actúe contra el<br />
resto de implicados, todos mayores de 60<br />
años, antes de que sea tarde.<br />
Sobrevivientes de la represión y testigos del<br />
caso también han fallecido antes de lograr<br />
justicia.<br />
Aus: Prensa Libre, 29. Mai 2006<br />
Erste Anhörung wegen Genozids<br />
Guatemala, 29. März 2006. Der zuständige<br />
guatemaltekische Strafrichter Saúl Álvarez<br />
hat auf Geheiss des Spanischen Gerichtshofes<br />
beschlossen, die Vorladungen der mutmasslichen<br />
Involvierten in das Massaker in der<br />
Spanischen Botschaft 1980 einzuleiten. Die<br />
Anhörungen der elf ZeugInnen und der beschuldigten<br />
Militärs sollen ab kommenden Juni<br />
stattfinden. Für die Ermittlungen wird die Anwesenheit<br />
eines anleitenden Richters und einer<br />
Anwalts-Equipe aus Spanien erwartet.<br />
Im Jahr 2005 hat die Spanische Justiz die<br />
Klage wegen Genozids angenommen, die die<br />
Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú<br />
eingereicht hat. Daraufhin stellte Spanien einen<br />
Antrag an Guatemala, Efraín Ríos Montt,<br />
Romeo Lucas García, Germán Chupina Barahona,<br />
Donaldo Álvarez Ruiz und Pedro García Arredondo<br />
wegen des Mordes an sieben Spaniern<br />
zu vernehmen, von denen drei bei dem Brand<br />
der Botschaft ums Leben kamen.<br />
Ende Februar bestätigte die spanische<br />
Strafinstanz ihre Kompetenz, die Verbrechen<br />
des Genozids, die in Guatemala zwischen 1978<br />
und 1986 begangen wurden, strafrechtlich zu<br />
verfolgen, eine Entscheidung, die von den<br />
guatemaltekischen Opfern begrüsst wurde,<br />
stellt sie doch eine erste Hoffnung auf Gerechtigkeit<br />
dar.<br />
Aus: ¡Fijáte! 257<br />
2 Anhang
CPR: Comunidades de Población en<br />
Resistencia<br />
Die Leute, mit denen wir hier in Nebaj/La Pista<br />
gesprochen haben, lebten aus religiösen und<br />
aus Gründen des praktischen Überlebens in<br />
den CPR. Als die Armee anfangs 1980er-Jahre<br />
begann, Massaker in der Region durchzuführen,<br />
flohen sie in die Berge. Sie wollten mit ihren<br />
Familien in Sicherheit leben, etwas zu essen<br />
und ein Dach über dem Kopf haben. Und<br />
sie wollten nicht zwangsrekrutiert werden für<br />
die PAC (Patrullas de Autodefensa Civil – Patrouillen<br />
für zivile Selbstverteidigung). Doch<br />
wo immer diese Menschen sich niederliessen<br />
und etwas Bescheidenes aufbauten – z.B. einfachste<br />
Behausungen aus Blättern und kleine<br />
Maispflanzungen –, wurde wieder alles von der<br />
Armee zerstört, sie wurden erneut vertrieben.<br />
Der Grund dafür war, dass sie in der katholischen<br />
Kirche organisiert waren. Jegliche Organisation<br />
war der Regierung, der Armee und der<br />
CIA suspekt, organisierte Leute wurden beschuldigt,<br />
der Guerilla anzugehören.<br />
Die Leute, die heute in La Pista wohnen, erzählten,<br />
dass sie während ihrem Leben in den<br />
CPR kaum Zeit und Gelegenheit hatten, um<br />
gemeinsam zu beten, in der Bibel zu lesen<br />
oder Gottesdienst zu feiern, da sie ständig auf<br />
der Flucht waren. Es gab Zeiten, in denen sie<br />
nicht einmal mehr etwas zum Anziehen hatten.<br />
Diese Leute betonten, dass sie in den CPR<br />
Heiss her geht es um PN- und<br />
EMP-Archive<br />
Guatemala, 12. Mai 2006. In der Nacht<br />
zum Donnerstag, 11. Mai, wurde eine Brandbombe<br />
in den mit Fahrzeugwracks zugestellten<br />
Hof des Polizeigebäudes geworfen, in dem die<br />
Archive der Nationalen Polizei (PN) aufbewahrt<br />
werden. Ein Wachmann entdeckte den Qualm<br />
rechtzeitig und konnte das Feuer löschen. Die<br />
im letzten Juli gefundenen Dokumente sind<br />
Beweismaterial für die während des internen<br />
bewaffneten Konflikts verübten Menschenrechtsverletzungen.<br />
(siehe ¡Fijáte! 359) Menschenrechtsombudsmann<br />
Sergio Morales, dessen<br />
Institution für die Archive zuständig ist,<br />
schliesst nicht aus, dass es sich um ein Attentat<br />
handelt, um das Dokumentarsenal zu zerstören.<br />
Während er das Gebäude für den sichersten<br />
Platz zur Aufbewahrung der Aktensammlung<br />
hält und somit eine Verlegung derselben<br />
nicht zur Diskussion stellt, wird vielmehr<br />
ein Rechtsantrag in Erwägung gezogen,<br />
3<br />
nicht subversiv gewesen seien. D.h. dass sie<br />
zwar sehr wohl andere Verhältnisse, jedoch<br />
nicht – wie die Guerilla – die politische Macht<br />
erobern wollten. Andernorts, z.B. im Petén,<br />
gab es CPR, die viel stärker politisch motiviert<br />
waren und teilweise auch der Guerilla als Unterstützungsbasis<br />
dienten. Einige von ihnen leben<br />
nun auch nach dem Krieg weiterhin als<br />
CPR im Kollektiv (s. 28. 02. 06: Santa Rita).<br />
1991 wandten sich die CPR mit einem Communiqué<br />
an die Öffentlichkeit. Sie wiesen auf ihre<br />
Existenz hin und riefen die Leute dazu auf, sie<br />
wahrzunehmen. Von diesem Moment an erhielten<br />
die Menschen in den CPR einen gewissen<br />
internationalen Schutz. Sie konnten sich an einem<br />
Ort niederlassen, ohne ständig wieder<br />
von neuem fliehen zu müssen.<br />
«Wir kämpfen gegen Gefangenschaft, Verfolgung,<br />
Bombardierung, Beschuss im Tiefflug<br />
und die Auferlegung der Militarisierung durch<br />
die Armee. Wir sind hier im Widerstand und<br />
dabei, eine neue Lebensform in Freiheit und<br />
Gleichheit zu schaffen, bis in allen unseren Gemeinden<br />
und dem ganzen Land eine wahre<br />
Demokratie erreicht worden ist.» Koordinierungskommission<br />
der CPR, 1991<br />
aus: Frank Herrmann: Guatemala. Stefan Loose<br />
Travelhandbücher, Berlin 2006: 96<br />
damit der Autoschrott vom Gelände geschafft<br />
wird.<br />
Verdächtig ist die Tatsache, dass zwar am<br />
Tag darauf direkt von dem Vorfall berichtet<br />
und auch darauf hingewiesen wurde, dass gegen<br />
zwei Personen, die für das Menschenrechtsprokurat<br />
(PDH) in den Archiven arbeiten,<br />
sowie gegen die Wachdiensthabenden PolizistInnen<br />
in dem Fall ermittelt wird, doch seit<br />
dem wurde der Vorfall in der Presse nicht wieder<br />
erwähnt.<br />
Einzig wird, ebenfalls am folgenden Tag,<br />
berichtet, dass die Richterin, die die PDH mit<br />
der Untersuchung des PN-Archivs betraut hat<br />
und offenbar immer noch für den Fall zuständig<br />
ist, zahlreiche und vielfältige Drohungen<br />
erhält. Die letzte Einschüchterung fand ebenfalls<br />
zur Abendzeit am selben Mittwoch statt,<br />
als Unbekannte in ihre Kanzlei eindrangen und<br />
in ihren Akten herumwühlten. Ebenso zeigte<br />
die Betroffene, María Ester Roldán, persönliche<br />
Bedrohungen an, zum einen von Seiten eines<br />
vermeintlichen Delegierten der Nationalen Zivilpolizei<br />
(PNC), zum anderen von der Präsidentin<br />
des Höchsten Gerichtshofs (CSJ).<br />
Roldán berichtet, dass der Anwalt Carlos<br />
Anhang
Humberto Rosales Mendizábal, der angeblich<br />
für die PNC arbeitet, in ihrer Kanzlei aufgetaucht<br />
sei und ihr Geld angeboten habe, um<br />
die Resolution der Beschlagnahmung und Verwahrung<br />
der PN-Archive zu ändern. Gemäss<br />
der Bedrohten soll er hinzugefügt haben, dass<br />
es für ihn einfach sei, dafür zu sorgen, dass<br />
eine Richterin getötet würde.<br />
Daneben habe die CSJ-Präsidentin, Beatriz<br />
de León, rechtswidrige Resolutionen erlassen,<br />
ihr die Schlüssel vom Gerichtsgebäude abgenommen<br />
und sie verbal bedroht. De León soll<br />
ausserdem versucht haben, die Richterin<br />
Roldán körperlich anzugreifen, da diese ein Internetprogramm<br />
geschaffen hat, mittels dessen<br />
man die Fälle des Justizapparats konsultieren<br />
kann.<br />
Derweil hat das Verfassungsgericht einem<br />
Einspruch im Zusammenhang mit den Archiven<br />
des aufgelösten Präsidialen Generalstabs<br />
(EMP) stattgegeben, den die Menschenrechtsorganisation<br />
Gruppe gegenseitiger Hilfe (GAM)<br />
im Dezember 2003 eingereicht hatte. Somit<br />
wurde nun eine von Ex-Präsident Alfonso Portillo<br />
getroffene Entscheidung rückgängig gemacht<br />
und entschieden, dass diese Dokumentation<br />
anstatt in die Hände der Streitkräfte,<br />
dem Obersten Gerichtshof übergeben werden<br />
soll. Die Dokumente datieren von 1954 bis zur<br />
EMP-Auflösung im September 2003.<br />
Mario Polanco von der GAM erklärte, dass<br />
die Akten, die seine Organisation interessieren,<br />
diejenigen aus den 80ger Jahren seien,<br />
„der schlimmsten Zeit der Repression“. Bereits<br />
im Januar 2004 verlieh das Verfassungsgericht<br />
eine provisorische Schutzmassnahme, mittels<br />
derer die GAM immerhin den Teil der Akten<br />
durchsehen konnte, der die Ausgaben der ehemaligen<br />
Staatschefs offenbart. Jorge Serrano<br />
Elías hat demnach beispielsweise Mengen an<br />
Bargeld aus den Kassen des EMP genommen.<br />
Doch schon ist der Gerichtsentscheid zur<br />
Polemik zwischen Militär und GAM geworden,<br />
meint doch der Verteidigungsminister Francisco<br />
Bermúdez, dass die Armee das Urteil wohl<br />
befolgen werde, was aber nicht so einfach<br />
wäre, stünden die besagten Archive doch unter<br />
Obhut der PDH und seien versiegelt. Polanco<br />
dagegen wertet Bermúdez Einwand als Täuschungsmanöver,<br />
seien die Akten, auf die sich<br />
das Urteil bezieht, nämlich andere, und zwar<br />
die, in denen Hinweise auf Bewachungen, Bedrohungen,<br />
Einschüchterungen, Geiselnamen,<br />
Morde und andere Verbrechen schriftlich festgehalten<br />
sind, die vom EMP gegen die politische<br />
Opposition und sonstige BürgerInnen begangen<br />
wurden. Die Archive im Gewahrsam<br />
der PDH seien tatsächlich versiegelt, jedoch<br />
bereits digitalisiert. Ausserdem seien dies „die<br />
unrelevantesten Dokumente des EMP“.<br />
Aus: ¡Fijáte! 360<br />
Die katholische Kirche stärkt ihre<br />
soziale Linie<br />
Auch wenn die katholische Kirche in Guatemala<br />
einen Grossteil ihrer Hegemonie eingebüsst<br />
hat, ist sie nach wie vor eine wichtige<br />
soziale und politische Akteurin. Schon immer<br />
haben in Guatemala zwei Kirchen unter einem<br />
Dach gelebt: Die eine konservativ und wenig<br />
konfrontativ, die andere den sozialen Kämpfen<br />
und den Basisgemeinden verpflichtet. Eine interne<br />
Dichotomie, die sich in unterschiedlicher<br />
Intensität über Jahre die Waage hielt und die<br />
sich nun mit der Wahl von Bischof Ramazzini<br />
zum Präsidenten der guatemaltekischen Bischofskonferenz<br />
(CEG) auf die Seite der sozial<br />
engagierten Kirche zu neigen scheint. Vertreter<br />
verschiedener Strömungen innerhalb der<br />
katholischen Kirche erklärten gegenüber Inforpress<br />
(Nr. 1647) die aktuelle Lage des Katholizismus,<br />
seine verschiedenen Visionen und seine<br />
soziale Position und Beteiligung im guatemaltekischen<br />
Gesellschaftsgefüge.<br />
Ramazzini: Garant für das Soziale<br />
In einem Moment zunehmender sozialer<br />
Probleme hat sich die katholische Kirche mit<br />
der Wahl von Alvaro Ramazzini zum Präsidenten<br />
der Bischofskonferenz, konsequent für die<br />
soziale Linie entschieden (siehe ¡Fijáte! 353).<br />
Ramazzini ist Bischof von San Marcos und bekannt<br />
für seine dezidierten Positionen und seinen<br />
Aktivismus in Themen wie dem Minenabbau,<br />
der Migration, der Landverteilung und der<br />
Freihandelsabkommen. Die Wahl Ramazzinis<br />
rief erwartungsgemäss Stimmen auf den Plan,<br />
die eine Radikalisierung und Stärkung des Sozialen<br />
innerhalb der katholischen Kirche vorhersagen<br />
bzw. befürchten.<br />
Sämtliche von Inforpress befragten Quellen<br />
zeigen sich zufrieden mit der Wahl Ramazzinis,<br />
selbst der Opus Dei, der im Prinzip der<br />
Linie der Diözese von San Marcos weit entfernt<br />
steht. Die Meinungen gehen jedoch auseinander<br />
bei der Frage, ob Ramazzini die Geschäfte<br />
der Bischofskonferenz wie bisher weiterführt<br />
oder ob eine Stärkung der sozialen und progressiven<br />
Kräfte innerhalb der Kirche zu erwarten<br />
ist.<br />
Für den Jesuiten Ricardo Falla ist die Wahl<br />
von Ramazzini ein Zeichen des Vertrauens in<br />
eine neue Generation von Bischöfen, denen die<br />
Veteranen langsam das Spielfeld räumen.<br />
Santiago Otero, ehemaliger Hilfssekretär<br />
der Bischofskonferenz sieht in der Wahl von<br />
Ramazzini die Weiterführung der bisherigen Linie<br />
der CEG. Bereits sein Vorgänger Rodolfo<br />
Quezada Toruño habe immer aktiv und realitätsbezogen<br />
Position eingenommen und sich<br />
sehr bestimmt für soziale Belange eingesetzt.<br />
Diese Meinung vertritt auch der Bischof von<br />
Quetzaltenango und ebenfalls Ex-Präsident der<br />
4 Anhang
CEG, Víctor Hugo Martínez: „Es wird keine<br />
Richtungsänderung geben, sondern die bereits<br />
eingeschlagene Richtung wird mit mehr Engagement<br />
weiter verfolgt“.<br />
Nicht alle teilen diese Meinung. Tomás<br />
García, Pfarrer in der Diözese von Martínez, ist<br />
der Meinung, die Kirche sei mit der Wahl Ramazzinis<br />
in Sachen Soziales und Progressivität<br />
zu weit gegangen.<br />
Für Pfarrer Ricardo Bendaña, Jesuit und<br />
Historiker, bedeutet die Wahl Ramazzinis das<br />
Wiederaufnehmen einer Initiative, die mit der<br />
strategischen Ermordung von Bischof Gerardi<br />
verloren ging.<br />
Weiterführung oder Bruch mit der bisherigen<br />
Linie der Bischofskonferenz, Tatsache ist,<br />
dass die Wahl von Ramazzini das Abbild einer<br />
Kurie ist, die laut Bendaña, politisch links oder<br />
mitte-links steht. Einer Kurie, in der es kaum<br />
einen Vertreter der konservativen Linie gäbe,<br />
alle hätten ein soziales Bewusstsein, meint der<br />
Jesuit.<br />
Politisch-Religiöse Debatte<br />
Das aktive Engagement der katholischen<br />
Kirche in konfliktiven Themen wie kürzlich die<br />
Mediation im Streit der LehrerInnen mit der<br />
Erziehungsministerin, oder im Minenabbau, die<br />
klare Positionierung in sozialpolitischen Fragen<br />
wie beispielsweise der Migration oder den Freihandelsabkommen,<br />
hat in gewissen Kreisen<br />
zur Kritik geführt, die Kirche würde ihr Mandat<br />
überschreiten und sich in politische Themen<br />
einmischen. Diese Kritik ist nicht neu, ebenso<br />
wenig die Debatte über die Grenzen des kirchlichen<br />
Engagements. Alle von Inforpress befragten<br />
Personen, unabhängig ihrer religiösen<br />
Tendenz, sind sich jedoch darin einig, dass jeder<br />
Aspekt, der mit der Würde des Menschen<br />
zu tun hat, zum Auftrag der Kirche gehöre.<br />
Fernando Bermúdez, Theologe, Laienmissionar<br />
und Koordinator des Menschenrechtsprogramms<br />
der Diözese San Marcos, erklärt in<br />
diesem Zusammenhang, dass die Einmischung<br />
der Kirche in solche Fragen nicht eine politische<br />
Angelegenheit sei sondern Teil des Evangeliums<br />
und somit Teil der sozialen Doktrin der<br />
Kirche. Die Rechte habe Christus in die Sakristei<br />
sperren, sein soziales Engagement zunichte<br />
machen und sein Wirken allein aufs Spirituelle<br />
reduzieren wollen, kritisiert Bermúdez.<br />
Selbst Sektoren wie der Opus Dei, die traditionellerweise<br />
im sozialen Bereich weniger<br />
aktiv sind, erklären gegenüber Inforpress: Die<br />
Bischöfe haben die Verpflichtung, die Menschen<br />
in zivilen Fragen zu beraten und zu orientieren,<br />
vor allem wenn es um die Gerechtigkeit<br />
und Würde der Gläubigen geht. Pedro Vinicio<br />
Donis, Direktor des Informationsbüros<br />
von Opus Dei in Guatemala, hebt speziell die<br />
Beteiligung von Kardinal Rodolfo Quezada als<br />
Vermittler bei den Friedensverhandlungen zwischen<br />
der Guerilla und der Regierung hervor.<br />
Ebenso die Rolle von Ramazzini bei der Verteidigung<br />
der menschlichen Würde der am meisten<br />
Benachteiligten. „Das Problem ist der Pro-<br />
tagonismus, den viele Menschen den Pfarrern<br />
vorwerfen. Doch was Ramazzini macht ist<br />
nichts anderes, als seine Aufgabe als Pfarrer<br />
zu erfüllen. Wenn ihm jemand vorwirft, er mische<br />
sich in die Politik ein, dann soll diese Person<br />
zuerst die Dokumente der Kirche über die<br />
Aufgaben eines Bischofs lesen und sie wird sehen,<br />
dass Ramazzini das macht, was er machen<br />
muss, nämlich die soziale Doktrin der<br />
Kirche umsetzen“, ergänzt Donis.<br />
In eine ähnliche Richtung spricht auch Víctor<br />
Ruano, ehemaliger Direktor des Priesterseminars:<br />
„Ich finde es hervorragend, mehr<br />
noch, ich finde es richtig und notwendig, dass<br />
sich die Kirche in politische Themen einmischt.<br />
Politische Themen sind immer menschliche<br />
Themen und alles, was den Menschen betrifft,<br />
ist für die Kirche von Interesse. Die Kirche<br />
mischt sich ein, um die Würde des Menschen<br />
zu verteidigen, vor allem dann, wenn es offensichtlich<br />
ist, dass die Regierung sich nicht um<br />
die Würde der Menschen kümmert und nur im<br />
Dienste der Mächtigen steht.“<br />
Konservative Moral<br />
Gegenüber der aktiven und progressiven<br />
Einstellung in sozialen Themen, welche die<br />
guatemaltekische und überhaupt die lateinamerikanische<br />
Kirche auszeichnet, ist die<br />
kirchliche Position in moralischen Fragen nicht<br />
gerade fortschrittlich. Dies geben auch alle von<br />
Inforpress befragten Kirchenmänner zu, vor<br />
allem, wie Tomás García konkretisiert, wenn es<br />
ums Thema Sexualität geht. Dies hat sich in<br />
der jüngsten Debatte um das Familienplanungsgesetz<br />
gezeigt, gegen das sich die Bischofskonferenz<br />
vehement ausgesprochen hat.<br />
„Im Sozialen ist die Kirche offen, engagiert,<br />
aber im moralischen ist sie konservativer.<br />
Ich habe sogar festgestellt, dass die KatholikInnen,<br />
die im sozialen Bereich am engagiertesten<br />
sind, in moralischen Fragen oft am<br />
verschlossensten sind. Für mich ist das fragwürdig.<br />
Wir dürfen nicht dogmatisch sein, wir<br />
dürfen nicht einer Diktatur der Dogmen verfallen“,<br />
erklärt Fernando Bermúdez.<br />
Ricardo Bedaña dazu: „Wir sind TraditionalistInnen.<br />
Es gibt eine Art geistigen Konvervatismus.<br />
Es gibt Dinge, über die nicht verhandelt<br />
werden kann, wie zum Beispiel Abtreibung,<br />
aber auch hier findet eine gewisse Öffnung<br />
statt, z.B. beim Thema Scheidung. Hier<br />
scheinen die Bischöfe fortschrittlicher zu sein<br />
als die Gläubigen. Junge SeminaristInnen haben<br />
heute die Tendenz, konservativer zu sein<br />
als frühere Generationen.“<br />
Und die Befreiungstheologie?<br />
1976 haben die Bischöfe in Guatemala ihr<br />
traditionelles Schweigen gebrochen und mit ihrem<br />
Hirtenbrief „Gemeinsam für Hoffnung“<br />
eine anklägerische Richtung eingeschlagen.<br />
Damit brachen sie die konservative und traditionelle<br />
Allianz mit der Macht, verkörpert bislang<br />
durch Bischof Rossell, der den Sturz von<br />
Jacobo Arbenz befürwortete, und Bischof<br />
5 Anhang
Casariego, der explizit verbot, über irgend etwas<br />
im Zusammenhang mit „sozialer Gerechtigkeit“<br />
zu sprechen.<br />
Seit 1976 und speziell seit dem Tod von<br />
Casariego im Jahr 1983, erhebt die Kirche immer<br />
und immer wieder ihr Wort zur Situation<br />
des Landes. Ein Höhepunkt ist der Hirtenbrief<br />
im Jahr 1988, „Clamor por la Tierra“, wo sie<br />
das Landthema aufnimmt und die ungerechte<br />
Landverteilung anprangert.<br />
Diesen Bewusstseinsprozess musste die<br />
guatemaltekische katholische Kirche in Form<br />
von Verfolgungen und Ermordungen von Pfarrern<br />
und Katecheten teuer bezahlen. Die Anzahl<br />
der wegen ihres christlichen Glaubens Ermordeten<br />
führte dazu, dass die Kirche als eine<br />
Märtyrerkirche bezeichnet wurde. Durch Gewalt<br />
zum Schweigen gebracht und wegen der<br />
Verfolgung, der diese Doktrin durch den Vatikan<br />
ausgesetzt ist, verliert die Befreiungstheologie<br />
an Kraft und wird in den Hintergrund verdrängt.<br />
Als ein „Thema vergangener Jahre“ bezeichnet<br />
der Bischof von Escuintla, Víctor Hugo<br />
Palma, diese Linie. Heute habe sich das Konzept<br />
der Befreiungstheologie weiterentwickelt,<br />
man spreche von einer Theologie der Solidarität.<br />
Viele der Befragten sind der Meinung, die<br />
Befreiungstheologie sei überhaupt nicht verschwunden,<br />
im Gegenteil, sie sei noch sehr<br />
präsent im Gedankengut der lateinamerikanischen<br />
Kirche. Gemäss Santiago Otero gehört<br />
sie zu den wichtigsten Prinzipien vieler Kirchen.<br />
Wenn die Realität sich nicht verändert,<br />
ist die Befreiungstheologie aktueller denn je,<br />
auch wenn man sie nicht so nennt“, erklärt<br />
Otero.<br />
„Der Name ist das Geringste. Wir sprechen<br />
nicht von Befreiungstheologie, wir leben sie“,<br />
bestätigt Ramazzini.<br />
Unterschiede und Gemeinsamkeiten<br />
Während Jahrzehnten, während Jahrhunderten,<br />
gab es innerhalb der katholischen Kirche<br />
verschiedene Tendenzen und Arten, die<br />
Religion zu verstehen. Es sind Strömungen,<br />
die in groben Zügen in „progressiv“ und „konservativ“<br />
unterteilt werden können. Unterschiede<br />
die, wie einige Theologen gegenüber<br />
Inforpress erklären, auch heute nicht ganz<br />
verschwunden sind, die sich aber im Laufe der<br />
Zeit angeglichen und ausgeglichen haben.<br />
Heutzutage würden die Gemeinsamkeiten<br />
mehr gewichtet als die Unterschiede. Uneinigkeit<br />
herrscht darüber, wie viele Vertreter der<br />
Kirchenhierarchie die Linie der Bischofskonferenz<br />
wirklich gutheissen.<br />
Víctor Hugo Palma spricht von Haltungen,<br />
nicht von Tendenzen. Die Unterteilung in progressiv<br />
und konservativ genüge nicht als Erklärung,<br />
einige Kirchenleute seien in gewissen<br />
Fragen offener, in anderen nicht. Man dürfe<br />
das nicht verallgemeinern. Als Beispiel nennt<br />
er Bischof Romero aus El Salvador, der dem<br />
Opus Dei nahe gestanden habe.<br />
Gemäss Víctor Ruano zeichnet sich die aktuelle<br />
Bischofskonferenz durch die Vielfalt der<br />
darin vertretenen Tendenzen aus, auch wenn<br />
sich diese nicht öffentlich ausdrücken. Dasselbe<br />
könne man von der Vereinigung der Religiösen<br />
Guatemalas (COFREGUA) sagen, ebenso<br />
von den laizistischen Vereinigungen. Einige<br />
verfolgen mehr die Doktrin, andere machen<br />
sich für die Benachteiligten stark, wieder andere<br />
konzentrieren sich auf die Inkulturation<br />
oder auf Befreiungsprozesse.<br />
Bendaña ergänzt, dass die guatemaltekische<br />
Kirche stark, aber gleichzeitig sehr zersplittert<br />
sei. Der konservative Sektor sei gewichtig,<br />
aber wenig einflussreich in der Bischofskonferenz.<br />
Als konservativer Sektor werden u.a. Bewegungen<br />
wie der Opus Dei, die Heraldos de<br />
Díos („Herolde Gottes“) und die Neokatechumen<br />
(Kikos, nach ihrem Begründer Kiko Argüello<br />
benannt, die überwiegend die Erwachsenentaufe<br />
vornehmen), ebenso die Charismatische<br />
Erneuerung.<br />
Zu den einigenden Gemeinsamkeiten der<br />
katholischen Kirche gehören laut Bendaña die<br />
gemeinsame 500-jährige Geschichte, die<br />
Papsttreue, die Hierarchie, die Verehrung der<br />
Jungfrau Maria und, zu einem gewissen Grad,<br />
die protestantische Herausforderung. Ein Protestantismus<br />
der sich, in seiner neuapostolischen<br />
Version, in Guatemala stark ausgebreitet<br />
hat mit einer Botschaft, die Erlösung ohne<br />
soziales Engagement verspricht. Diese neuen<br />
Strömungen machen dem Katholizismus ihren<br />
traditionellen Platz streitig und ziehen auch<br />
immer mehr konservative Sektoren an, während<br />
die katholische Kirche mehr die sozial<br />
denkenden Sektoren vereint.<br />
Unabhängig von Tendenzen, Spaltungen<br />
und Widersprüchen kann nicht geleugnet werden,<br />
dass die katholische Kirche in der Lage<br />
gewesen ist, sich den Veränderungen der Zeit<br />
anzupassen und eine enorme Wandlungsfähigkeit<br />
an den Tag zu legen.<br />
Aus: ¡Fijáte! 357, 12. April 2006<br />
6 Anhang
Volksbefragungen: Ein Sieg der<br />
(oder über die) Demokratie?<br />
Guatemala, 20. April 2006. Das guatemaltekische<br />
Verfassungsgericht bestätigte am<br />
4. April die Rechtsgültigkeit der beiden Volksbefragungen<br />
von Río Hondo, Zacapa, und von<br />
Sipakapa, San Marcos, wo sich die Bevölkerung<br />
gegen den Bau eines Wasserkraftwerks<br />
bzw. die Tätigkeit einer Tagebaumine aussprach.<br />
In beiden Fällen berufen sich die InitiantInnen<br />
der Befragungen auf die Umweltschäden,<br />
die von den Unternehmen angerichtet<br />
würden und beschweren sich, dass sie als<br />
betroffene Bevölkerung vor der Lizenzvergabe<br />
an diese Firmen nicht konsultiert wurden, wie<br />
es das Abkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation<br />
(ILO) vorschreibt.<br />
In Sipakapa nahmen rund 600 Personen<br />
aus dreizehn Dörfern an der im letzten Juni<br />
durchgeführten Abstimmung teil, davon sprachen<br />
sich elf Dörfer gegen die Minentätigkeit<br />
aus, eines dafür und eines enthielt sich der<br />
Stimme.<br />
In Río Hondo fand die Befragung ebenfalls<br />
im letzten Juni statt, von den 2’800 teilnehmenden<br />
Personen sprach sich die grosse Mehrheit<br />
gegen den Bau des Wasserkraftwerkes<br />
aus.<br />
An beiden Orten wurde vor den Volksbefragungen<br />
seitens der Unternehmen versucht,<br />
Verwirrung über die Rechtsgültigkeit von solchen,<br />
von den Gemeinden autonom durchgeführten<br />
Abstimmungen zu säen. In Sipakapa<br />
z.B. wurden ein paar Tage vor der Abstimmung<br />
Flugblätter verteilt, die vermeintlicherweise<br />
sagten, die consulta sei abgesagt worden. Und<br />
auch wenn es das Unternehmen abstreitet,<br />
eine Filmequipe, die einen Film über die Volks-<br />
Razzien bei Kommunalradios<br />
Guatemala, 23. März 2006. In Guatemala<br />
spielen Kommunalradios eine Schlüsselrolle<br />
bei der Informationsvermittlung in indigenen<br />
ländlichen Gemeinden. Diese Rolle wird ihnen<br />
bereits in den Friedensabkommen zugestanden,<br />
wo es im Abkommen über die Rechte<br />
und Identität der indigenen Bevölkerung einen<br />
speziellen Paragraphen dazu gibt. Von unschätzbarem<br />
Wert waren die Kommunalradios<br />
z.B. auch während des Hurrican Stan, wo sie<br />
unermüdlich Informationen über die Lage in<br />
den Gemeinden, über eingestürzte Brücken<br />
und verschüttete Strassen übermittelten, Familienangehörige<br />
benachrichtigten, Lebensmittel<br />
und Geld sammelten und auf diese Weise<br />
wichtige Aufgaben übernahmen, die eigentlich<br />
der Staat hätte erfüllen sollen. Auch in den Bereichen<br />
(Bewusstseins-) Bildung und Aufklärung<br />
nehmen viele Kommunalradios im Ver-<br />
7<br />
befragung und überhaupt das Problem der Minenpräsenz<br />
in Sipakapa drehte, sah bei einem<br />
Besuch in der Mine schachtelweise diese Flugblätter<br />
herumstehen.<br />
Der Entscheid des Verfassungsgerichts löste<br />
grosse Freude unter den sozialen Organisationen<br />
aus, die sich zum Thema engagieren.<br />
Als einen historischen Moment bezeichnete die<br />
Nationale BäuerInnenkoordination CNOC dieses<br />
Urteil, mit dem die nationalen und internationalen<br />
Abkommen über die Rechte der indigenen<br />
Bevölkerung über die Partikularinteressen<br />
einiger Weniger gestellt wurden.<br />
Am 18. April übernahmen dann die neugewählten<br />
RichtInnen und ihre respektiven Ersatzrichter<br />
des Verfassungsgerichts ihre Ämter<br />
(siehe ¡Fijáte! 357). Ihre Vorgänger traten jedoch<br />
zurück, nachdem sie zwar die Entscheide<br />
in den Fällen Río Hondo und Sipakapa gefällt<br />
hatten, aber ohne alle notwendigen Dokumente<br />
zu unterzeichnen. Im Fall von Río Hondo soll<br />
es ein unterschriebenes Urteil aber keine<br />
rechtsgültige Verkündung desselben geben. Im<br />
Fall Sipakapa ist es noch schlimmer, da gibt<br />
ein zwar gefälltes, aber nicht von allen Richtern<br />
unterzeichnetes Urteil.<br />
Die (schwindende) Hoffnung der Bevölkerung<br />
der betroffenen Orte besteht nun darin,<br />
dass die NachfolgerInnen der abgetretenen<br />
RichterInnen das Urteil nicht noch einmal revidieren,<br />
sondern so schnell wie möglich ihre<br />
Unterschriften darunter setzen. Ansonsten wären<br />
die nationalen juristischen Möglichkeiten<br />
ausgeschöpft und es bliebe ihnen nur noch die<br />
Variante, ihre Fälle vor den Interamerikanischen<br />
Menschenrechts-Gerichtshof (CIDH) zu<br />
tragen.<br />
Aus: ¡Fijáte! 358<br />
gleich zu ihren kommerziellen Pendants eine<br />
wichtige soziale Rolle wahr.<br />
In einem Land wie Guatemala aber, in dem<br />
Radiofrequenzen zu horrend teuren Preisen<br />
gehandelt werden (bis zu 28’000 US-$), senden<br />
die meisten Kommunalradios ohne eigene<br />
Frequenz, sind also gemäss Gesetz illegal.<br />
Dies führt immer wieder dazu, dass die entsprechenden<br />
Behörden versuchen, solche Radios<br />
zu schliessen oder ihnen die Sendeanlage<br />
zu zerstören.<br />
Laut Informationen des Guatemaltekischen<br />
Rates der Kommunalradios (CGCC) wurden im<br />
Verlauf eines Monats, zwischen Februar und<br />
März 2006, in zwölf kommunalen Radios in<br />
den Departements Jalapa, Jutiapa, Huehuetenango<br />
und Guatemala Razzien durchgeführt und<br />
Personal verhaftet. Dies, obwohl vor einem<br />
Jahr auf Drängen der Weltweiten Vereinigung<br />
der Kommunalradios (AMARC) und Eduardo<br />
Bertoni, Beauftragter für Meinungsfreiheit der<br />
Organisation der Amerikanischen Staaten<br />
Anhang
(OEA), ein sog. Runder Tisch einberufen wurde,<br />
um das Thema zu erläutern. Eingeladen zu<br />
diesem Runden Tisch sind VertreterInnen der<br />
Kommunalradios und der Regierung, namentlich<br />
der Leiter der Präsidialen Menschenrechtskommission<br />
(COPREDEH), Frank LaRue. Bis<br />
dato ist dieser Runde Tisch genau einmal zusammengetroffen.<br />
Eine der Übereinkünfte, die<br />
dabei getroffen wurden, ist die Suspendierung<br />
jeglicher Razzien in den Kommunalradios. Eine<br />
andere, ebenfalls nicht eingehaltene Abmachung<br />
ist, dass die Regierung und die zuständige<br />
Telekommunikationsbehörde (SIT) einen<br />
Gesetzesvorschlag ausarbeiten, um den Kommunalradios<br />
einen legalen Status zu verschaffen.<br />
Ein Gesetzesvorschlag über die Vergabe<br />
von Radiofrequenzen wird seit Jahren zwischen<br />
dem Kongress und der SIT hin und hergeschoben.<br />
Gemäss Marcelino Moscut, Kongressabgeordneter<br />
und Vertreter der Vereinigung der<br />
Der erste Winter nach Hurrikan<br />
Stan<br />
Guatemala, 18. Mai 2006. Die Gelder,<br />
die dafür gedacht waren, denjenigen beizustehen,<br />
die im vergangenen Oktober vom Hurrikan<br />
Stan betroffen wurden, sind in andere,<br />
nicht-priorisierte Munizipien abgezweigt worden,<br />
während die Hilfebedürftigen Familien immer<br />
noch in der Ungewissheit leben, was ihnen<br />
die Regierung zuteil werden lässt, ist doch bislang<br />
nichts bei ihnen angekommen, was ihnen<br />
ihre Situation erleichtern würde. Viele Familien<br />
haben keine feste Arbeit und leben in Herbergen<br />
unter unmenschlichen Bedingungen.<br />
Der Hurrikan hat vor bald acht Monaten<br />
1´500 Opfer gefordert, darunter Tote und Verschwundene,<br />
1´158 Dörfer sind beeinträchtigt,<br />
35´000 Wohnhäuser beschädigt oder zerstört,<br />
hunderte von Kilometern Strasse und zahlreiche<br />
Brücken kollabiert.<br />
Trotz des Notstandsplans haben die Wiederaufbauaktivitäten<br />
in den meisten der Dörfer<br />
immer noch nicht begonnen, und dort, wo die<br />
ersten Arbeiten durchgeführt wurden, haben<br />
sie an vielen Orten bereits dem Regen nachgegeben,<br />
der seit Mitte Mai der Regenzeit entsprechend,<br />
das Land überzieht, sind sie zwar<br />
gebaut, aber nicht unbedingt der bekannt-riskanten<br />
Lage angepasst.<br />
Die Organisation Acción Ciudadana veröffentlichte<br />
dieser Tage die Ergebnisse des Monitorings<br />
des Wiederaufbaus mit alarmierenden<br />
Daten: Geldumleitungen in andere Regionen,<br />
die Langsamkeit der Arbeiten, der Mangel an<br />
Fincas für die Wiederansiedlung der in gefährdeten<br />
Gebieten lebenden Bevölkerung und ein<br />
8<br />
guatemaltekischen Kommunalradios (ARCG),<br />
geht es bei der Debatte über die Kommunalradios<br />
nicht um ein technisches Problem, wie<br />
man immer glaubhaft machen wolle, sondern<br />
um eine politische Angelegenheit. Oftmals sind<br />
es tatsächlich die Kommunalradios, die als einzige<br />
Korruptionsfälle und Menschenrechtsverletzungen<br />
in den Gemeinden zur Sprache bringen.<br />
Interessant ist, dass die Razzien in den<br />
Kommunalradios von einer Sonderabteilung<br />
der Staatsanwaltschaft für „Delikte gegen<br />
JournalistInnen und GewerkschafterInnen“ in<br />
Zusammenarbeit mit der Polizei durchgeführt<br />
wurden. Diese Sonderabteilung wurde geschaffen,<br />
um Vergehen am Menschenrecht auf<br />
Meinungsfreiheit zu verfolgen. Paradoxerweise<br />
werden jetzt diejenigen verfolgt, die das Recht<br />
auf Meinungsfreiheit verteidigen.<br />
Aus: ¡Fijáte! 257<br />
fragwürdiges Vorgehen des zuständigen Sozialen<br />
Investitionsfonds (FIS), dem Korruption<br />
vorgeworfen wird, nutzt er doch nicht die offiziellen<br />
Wege für die Vergabe der Bauvorhaben.<br />
Gemäss Acción Ciudadana ist auch der<br />
Kongress in die Machenschaften verwickelt,<br />
schliesslich hat er 1,5 Mio. Quetzales für den<br />
Wiederaufbau in 150 Munizipien vergeben,<br />
doch die Hälfte davon steht nicht auf der Liste<br />
der vorrangigen Projekte.<br />
Unterdessen wurden in dem Dorf Panabaj,<br />
Sololá, das komplett unter einer Schlammlawine<br />
begraben wurde, im Rahmen eines Pilotprojekts<br />
der Regierung die ersten 89 neuen Häuser<br />
gebaut, auf einem Gelände, das von der<br />
Katholischen Kirche zur Verfügung gestellt<br />
wurde. Doch – oh Schreck – eine nun veröffentlichte<br />
Risikoanalyse stellt fest, dass der Ort<br />
unbewohnbar und dem Risiko neuer Lawinen<br />
ausgesetzt ist.<br />
Aus: ¡Fijáte! 360<br />
Anhang
Familienplanung ist Gesetz<br />
Guatemala, 08. Mai 2006. Heute ist das<br />
heiss diskutierte Gesetz zum Universalen und<br />
gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen<br />
der Familienplanung in Kraft getreten, was der<br />
Exekutive nun ein Ultimatum von 60 Tagen<br />
stellt, um das entsprechende Reglement zu erarbeiten.<br />
Das Gesundheitsministerium ist die<br />
zuständige staatliche Instanz für die Koordinierung<br />
der Arbeitskommission, die die Aufgabe<br />
hat, die normative Theorie in alltägliche und<br />
landesweite Praxis zu verwandeln. Dabei wird<br />
sie vom Bildungsministerium unterstützt, das<br />
sich für Informations-, Bildungs- und Kommunikationstätigkeiten<br />
gegenüber Eltern und<br />
SchülerInnen verantwortlich zeichnet.<br />
Schon im Vorfeld haben sich zahlreiche<br />
Frauenorganisationen in Sachen Informationsverbreitung<br />
stark gemacht. In diesem Rahmen<br />
sind Foren und Workshops in erster Linie mit<br />
Frauenorganisationen geplant sowie die Herausgabe<br />
einer Populärversion des Gesetzes,<br />
um das Verständnis des Inhalts zu vereinfachen.<br />
Besondere Aufmerksamkeit soll der indigenen<br />
Bevölkerung gewidmet werden, ist doch<br />
unter dieser das Wissen um und der Zugang<br />
zu Verhütungsmethoden wesentlich geringer<br />
und die Zahl der Müttersterblichkeit deutlich<br />
höher.<br />
Wichtig ist den organisierten Frauen, die<br />
Verdrehungen richtig zu stellen, die von Sektoren,<br />
die das Gesetz ablehnen, in die Welt gesetzt<br />
wurden. Eine wichtige Rolle spielte dabei<br />
die katholische Kirche, die vor allem durch ihren<br />
Kardinal Quezada Toruño die Familienplanung<br />
diabolisierte, werde diese doch zur Abtreibung<br />
geradezu auffordern und die christlichen<br />
Familienwerte verletzen.<br />
Dass durch den Zugang zu Verhütungsmitteln<br />
gerade ungewollte Schwangerschaften<br />
verhindert werden und somit vielen Frauen in<br />
Guatemala und gerade in den ländlichen Regionen<br />
vor allem vielen jungen Frauen endlich<br />
das Recht zugestanden wird, über ihren eigenen<br />
Körper entscheiden zu können, wollte der<br />
Kirchenoberst bis zuletzt nicht verstehen.<br />
Aus: ¡Fijáte! 359<br />
9 Anhang