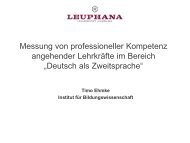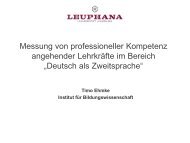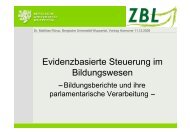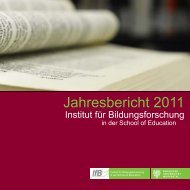Erste Ergebnisse (Stand: Mai 2009) - IfB - Bergische Universität ...
Erste Ergebnisse (Stand: Mai 2009) - IfB - Bergische Universität ...
Erste Ergebnisse (Stand: Mai 2009) - IfB - Bergische Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ergebnisbericht der ersten Befragung des Projekts ‚Beanspruchung und Kooperation an Halb- und<br />
Ganztagsschulen in NRW’<br />
Die dargestellten Mittelwerte sind folgendermaßen zu interpretieren: Die Antwortskala im<br />
Fragebogen war sechsstufig, wobei die einzelnen Alternativen von 1= ‚nie’ bis hin zu 6= ‚sehr<br />
häufig’ reichten. Ein Mittelwert von 4,0 Punkten bedeutet demnach, dass die entsprechende<br />
Kooperationsform ‚eher häufig’ praktiziert wird. Die <strong>Ergebnisse</strong> zeigen insofern ein typisches<br />
Muster, als die beiden Austauschformen am häufigsten vorkommen. Diese beiden<br />
Kooperationsformen sind im Schulalltag relativ einfach zu realisieren und können auch<br />
‚zwischen Tür und Angel’ stattfinden. Die Kokonstruktion hingegen als eine intensive Form<br />
der Zusammenarbeit ist aufwendig und bedarf nicht nur eines größeren Zeitfensters, sondern<br />
stellt auch bezüglicher anderer Merkmale höhere Ansprüche an die beteiligten Lehrerinnen<br />
und Lehrer.<br />
Was die Unterschiede zwischen den Halb- und Ganztagsschulen angeht, so zeigt sich<br />
insgesamt eine höhere Ausprägung der verschiedenen Kooperationsformen an den<br />
Ganztagsschulen. Die <strong>Ergebnisse</strong> sind zwar statistisch signifikant, haben jedoch aufgrund<br />
der relativ hohen Stichprobengröße eine nur geringe praktische Bedeutsamkeit.<br />
Welchen Nutzen ziehen Lehrpersonen aus der Kooperation?<br />
Kooperation entsteht nicht aus heiterem Himmel, sondern bedarf bestimmter Bedingungen.<br />
Die Kooperationsforschung, vor allem aus dem Bereich der Arbeits- und<br />
Organisationspsychologie, hat verschiedene günstige Faktoren identifiziert, die die<br />
Zusammenarbeit von Gruppen fördern. Als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine<br />
produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit kann das Vorhandensein eines gemeinsamen<br />
Ziels gesehen werden. Dies klingt auf den ersten Blick trivial, ist aber im Alltag, insbesondere<br />
im Schulalltag häufig nur schwer umzusetzen. Gute Ziele sind dabei so formuliert, dass sie<br />
klar, handlungsnah und erreichbar sind und sich alle Beteiligten mit ihnen identifizieren<br />
können (West, 1990). Betrachtet man diese Charakteristika von guten Zielen, dann wird<br />
deutlich, dass eine Umsetzung im Schulalltag, die die Zusammenarbeit von Lehrkräften<br />
fördern kann, unter Umständen sehr schwierig ist.<br />
In unserer Erhebung haben wir anhand einer Skala nach gemeinsamen Zielen der<br />
schulischen Arbeit gefragt. Für die Halb- und Ganztagsschulen zeigten sich diesbezüglich<br />
keine signifikanten Unterschiede (HTS: Mittelwert von 4,2; GTS: Mittelwert von 4,2; die<br />
Antwortalternativen waren 1= ‚trifft überhaupt nicht zu’ bis 6= ‚trifft voll und ganz zu’/ ohne<br />
Abbildung).<br />
Kooperation sollte nicht um ihrer selbst stattfinden, sondern ein bestimmtes Ziel verfolgen<br />
und für die Lehrkräfte einen Nutzen haben. Die Frage, warum Lehrpersonen kooperieren<br />
sollten, wird in der Forschung aus unterschiedlichen Blickwinkeln beantwortet und es lassen<br />
sich vielfältige Begründungen anführen. In unserem Fragebogen haben wir nach<br />
verschiedenen Aspekten gefragt, die sich auf den individuellen Nutzen der einzelnen<br />
Lehrkräfte beziehen. Die folgende Grafik stellt die Mittelwerte für die empfundene<br />
‚Arbeitsentlastung’ durch Kooperation (inwieweit also z.B. Zeit bei der<br />
Unterrichtsvorbereitung gespart werden kann), eine ‚emotionale Entlastung’ (z.B. mal ‚Dampf<br />
ablassen können’ nach frustrierenden Unterrichtserlebnissen) und einen ‚fachlichen Nutzen’<br />
(z.B. Lernen von Kolleginnen und Kollegen, Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts) dar.<br />
Die dargestellten Mittelwerte sind ebenfalls vor dem Hintergrund der sechsstufigen<br />
Antwortskala zu interpretieren, bei der 1 für ‚trifft überhaupt nicht zu’ und 6 für ‚trifft voll und<br />
ganz zu’ stehen.<br />
9