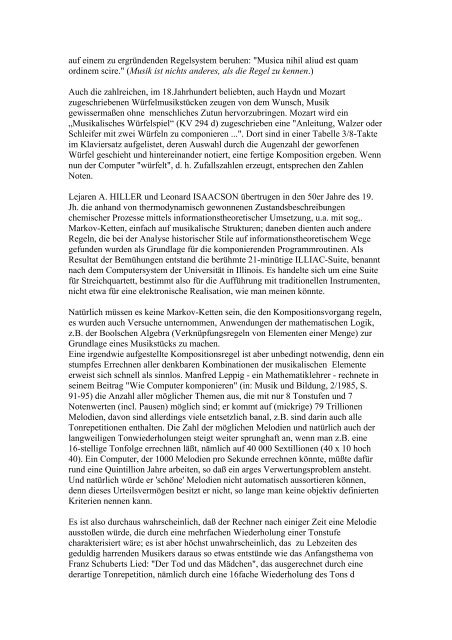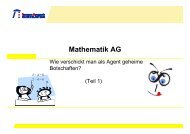Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
auf einem zu ergründenden Regelsystem beruhen: "Musica nihil aliud est quam<br />
ordinem scire." (Musik ist nichts anderes, als die Regel zu kennen.)<br />
Auch die zahlreichen, im 18.Jahrhundert beliebten, auch Haydn und Mozart<br />
zugeschriebenen Würfelmusikstücken zeugen <strong>von</strong> dem Wunsch, Musik<br />
gewissermaßen ohne menschliches Zutun hervorzubringen. Mozart wird ein<br />
„Musikalisches Würfelspiel“ (KV 294 d) zugeschrieben eine "Anleitung, Walzer oder<br />
Schleifer mit zwei Würfeln zu componieren ...". Dort sind in einer Tabelle 3/8-Takte<br />
im Klaviersatz aufgelistet, deren Auswahl durch die Augenzahl der geworfenen<br />
Würfel geschieht und hintereinander notiert, eine fertige Komposition ergeben. Wenn<br />
nun der Computer "würfelt", d. h. Zufallszahlen erzeugt, entsprechen den Zahlen<br />
Noten.<br />
Lejaren A. HILLER und Leonard ISAACSON übertrugen in den 50er Jahre <strong>des</strong> 19.<br />
Jh. die anhand <strong>von</strong> thermodynamisch gewonnenen Zustandsbeschreibungen<br />
chemischer Prozesse mittels informationstheoretischer Umsetzung, u.a. mit sog,.<br />
Markov-Ketten, einfach auf musikalische Strukturen; daneben dienten auch andere<br />
Regeln, die bei der Analyse historischer Stile auf informationstheoretischem Wege<br />
gefunden wurden als Grundlage für die komponierenden Programmroutinen. Als<br />
Resultat der Bemühungen entstand die berühmte 21-minütige ILLIAC-Suite, benannt<br />
nach dem Computersystem der Universität in Illinois. Es handelte sich um eine Suite<br />
für Streichquartett, bestimmt also für die Aufführung mit traditionellen Instrumenten,<br />
nicht etwa für eine elektronische Realisation, wie man meinen könnte.<br />
Natürlich müssen es keine Markov-Ketten sein, die den Kompositionsvorgang regeln,<br />
es wurden auch Versuche unternommen, Anwendungen der mathematischen Logik,<br />
z.B. der Boolschen Algebra (Verknüpfungsregeln <strong>von</strong> Elementen einer Menge) zur<br />
Grundlage eines Musikstücks zu machen.<br />
Eine irgendwie aufgestellte Kompositionsregel ist aber unbedingt notwendig, denn ein<br />
stumpfes Errechnen aller denkbaren Kombinationen der musikalischen Elemente<br />
erweist sich schnell als sinnlos. Manfred Leppig - ein Mathematiklehrer - rechnete in<br />
seinem Beitrag "Wie Computer komponieren" (in: Musik und Bildung, 2/1985, S.<br />
91-95) die Anzahl aller möglicher Themen aus, die mit nur 8 Tonstufen und 7<br />
Notenwerten (incl. Pausen) möglich sind; er kommt auf (mickrige) 79 Trillionen<br />
Melodien, da<strong>von</strong> sind allerdings viele entsetzlich banal, z.B. sind darin auch alle<br />
Tonrepetitionen enthalten. Die Zahl der möglichen Melodien und natürlich auch der<br />
langweiligen Tonwiederholungen steigt weiter sprunghaft an, wenn man z.B. eine<br />
16-stellige Tonfolge errechnen läßt, nämlich auf 40 000 Sextillionen (40 x 10 hoch<br />
40). Ein Computer, der 1000 Melodien pro Sekunde errechnen könnte, müßte dafür<br />
rund eine Quintillion Jahre arbeiten, so daß ein arges Verwertungsproblem ansteht.<br />
Und natürlich würde er 'schöne' Melodien nicht automatisch aussortieren können,<br />
denn dieses Urteilsvermögen besitzt er nicht, so lange man keine objektiv definierten<br />
Kriterien nennen kann.<br />
Es ist also durchaus wahrscheinlich, daß der Rechner nach einiger Zeit eine Melodie<br />
ausstoßen würde, die durch eine mehrfachen Wiederholung einer Tonstufe<br />
charakterisiert wäre; es ist aber höchst unwahrscheinlich, das zu Lebzeiten <strong>des</strong><br />
geduldig harrenden Musikers daraus so etwas entstünde wie das Anfangsthema <strong>von</strong><br />
Franz Schuberts Lied: "Der Tod und das Mädchen", das ausgerechnet durch eine<br />
derartige Tonrepetition, nämlich durch eine 16fache Wiederholung <strong>des</strong> Tons d