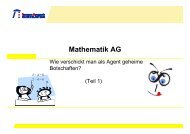Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Warum die Musikwissenschaft, die sich mit vielen physikalischen Objekten und<br />
Funktionalitäten befaßt, z.B. Instrumentenakustik, Raumakustik, mit physiologischen<br />
Vorgängen und psychologischen Phänomenen (z.B. beim Hören und Spielen), mit<br />
informatischen und medientechnologischen Fragestellungen, heute als<br />
Geisteswissenschaft zählt, kann ich mit historischen Gründen erklären, warum<br />
dagegen die Mathematik, die sich ausschließlich mit logischen Symbolen beschäftigt,<br />
die sich durch deduktive Methoden und einem axiomatischen Aufbau abstrakter<br />
Strukturen auszeichnet, heute zu den Naturwissenschaften gehört, weiß ich nicht.<br />
Ursprünglich war der Computer nur eine Art Rechenknecht, z.B. für<br />
Tabellenkalkulationen, später konnte er eben auch Texte verarbeiten, dann Graphiken,<br />
wie z.B. Noten, und Sounds, letzten En<strong>des</strong> alles, was sich irgendwie in Symbolen und<br />
Zahlen ausdrücken bzw. codieren läßt.<br />
Heute kann man ihn als multifunktionale und omnipräsente Denkmaschine betrachten,<br />
wenn man mit Denken nur den softwarebasierten Umgang mit Informationen aller<br />
Art meint. Und mit geeigneter Soundkarte und musikspezifischen Interfaces wird aus<br />
ihm ein omnipotentes Musikinstrument. Und sogar Taschenrechner können Musik<br />
erzeugen, wie die deutsche Elektronikformation Kraftwerk schon in den 80er Jahren<br />
wußte.<br />
Tetraktys der reinen Intervallproportionen<br />
"Alles ist Zahl", sagten die Pythagoräer - eine Gruppe <strong>von</strong> naturwissenschaftlich<br />
geprägten Denkern, gleichermaßen Philosophen, Mathematiker, Musikwissenschaftler<br />
und Politiker. Sie schätzten die Musik als Teil einer auf allgemein gültigen<br />
Zahlengesetzlichkeiten (= logos) beruhenden (organischen wie anorganischen)<br />
Weltordnung, deren harmonikale Struktur sich mit Hilfe eines einfachen Monochords,<br />
also einer über einem Resonanzkasten aufgespannten, klingenden Saite, hörbar,<br />
sinnfällig, also unmittelbar erfahrbar machen läßt. Das Monochord war hier kein<br />
Musik- sondern ein Meßinstrument.<br />
Weil Intervalle identisch mit Zahlenverhältnissen sind, geschieht dabei nichts anderes,<br />
"als daß eine intellektuell erfaßbare Zahlenquantität in eine seelisch erlebbare<br />
Sinnesqualität verwandelt wird", wie es ein zeitgenössischer Vertreter <strong>des</strong><br />
harmonikalen Pythagorismus ausdrückt. Für das pythagoräische Denken ist ein<br />
Zahlenverhältnis und das entsprechende musikalisches Intervall ein und dasselbe. Es<br />
ist nur folgerichtig, wenn die Welt <strong>des</strong> Klangs genau nach den gleichen harmonischen<br />
Prinzipien aufgebaut ist wie die Gesetze der Physik, der Astronomie und der<br />
Mathematik - und umgekehrt. "Alles ist Zahl", so lautet die Quintessenz. Die<br />
Sphärenmusik der pythagoräischen Schule ist real, denn gemeint ist tatsächlich, daß<br />
im Weltall Musik erklingt, hervorgerufen durch die naturgesetzlich geordneten<br />
Bahnen der Himmelskörper. Die Musik dient vorrangig zur wissenschaftlichen