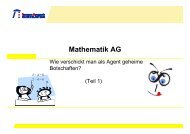Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Ausarbeitung des Vortrages von Prof. Dr. B. Enders
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mathematisch-technisch begründeten System gleichstufig-temperierter Frequenzen,<br />
sozusagen auf den Tasten einer Klaviatur, die funktionale Differenz verschieden<br />
abgeleiteter Ton- und Intervallqualitäten wird ignoriert, vermutlich ein Grund dafür,<br />
daß sie keiner hören will.<br />
Das technisch auf der Tastatur basierende MIDI-System digitalelektronischer<br />
Instrumente verzichtet ebenfalls auf die Erfassung qualitativer Unterschiede, sondern<br />
sendet ausschließlich Noten-Co<strong>des</strong>, die für 12 Tastennummern einer Oktave stehen:<br />
wird die Taste c´ gedrückt, meldet das MIDI-System gemäß der standardisierten<br />
Vereinbarung immer dezimal eine 60, wird das nächste cis (oder <strong>des</strong>) gedrückt, wird<br />
dezimal die Zahl 61 abgeschickt, und so fort.<br />
3. Notation und Notenco<strong>des</strong><br />
Die Geschichte der musiktheoretischen und musikpraktischen Entwicklung läßt sich<br />
als zunehmende Digitalisierung der Repräsentation und Verarbeitung <strong>von</strong><br />
musikalischen Informationen und Prozessen verstehen, der Computer ist lediglich das<br />
letzte und mächtigste Glied in einer langen Kette musiktechnischer,<br />
musikinformatischer und mathematisch-logischer Stationen - vom Trommelstock bis<br />
zum mausgesteuerten virtuellen Musikinstrument <strong>des</strong> Informationszeitalters.<br />
Computerbasierte Musikverarbeitung entspricht der Algorithmisierung aller<br />
musikalischen Prozesse und Phänomene, musikalische Informationen werden<br />
numerisch abgebildet und mit mathematischen Funktionen beschrieben.<br />
<strong>Dr</strong>ei Aspekte lassen sich aus dieser Perspektive heraus unterscheiden:<br />
1. die Entwicklung <strong>von</strong> Notationssystemen im Zusammenspiel mit kompositorischen<br />
Modellen<br />
2. die Entwicklung der Instrumente aufgrund spieltechnischer und klanglicher<br />
Erwartungen<br />
3. die Möglichkeit der Klangspeicherung, der Konservierung <strong>von</strong> Musik<br />
Mit zunehmendem Wissen über die Musik, mit ständig steigender Bedeutung der<br />
Musik für kulturelle Handlungen und der wachsenden Notwendigkeit gemeinsamer<br />
musikalischer Aktionen in einer Gruppe, zum Beispiel beim chorischen<br />
Kirchengesang, verstärkte sich zugleich der Wunsch nach genauerer Festlegung der<br />
musikalischen Aktionen. Töne wurden zum Beispiel bei den Griechen durch<br />
alphabetische Zeichen bestimmt, ein System, das sich über den Generalbass und den<br />
Akkordsymbolen im Jazz (zum Beispiel:. A 7/9 für einen Septnonakkord in A-Dur) bis<br />
heute in verschiedenen Formen bewährt hat, im 9. Jahrhundert wurden<br />
Tonhöhenverläufe durch Neumen (griech. neuma, der Wink) mehr oder weniger<br />
genau angezeigt, das sind Notenzeichen, die aus gestischen, heute noch beim Dirigat<br />
<strong>von</strong> Laienchören gebräuchlichen, Handbewegungen entstanden sind und im<br />
Mittelalter zur groben Fixierung <strong>von</strong> einstimmigen Choralmelodien dienten, ohne<br />
dass Intervallgrößen oder Notenwerte exakt aufgezeichnet werden konnten.<br />
Der Benediktinermönch Guido <strong>von</strong> Arezzo (ca. 991–1033) schuf um 1025 die<br />
Grundlagen für die heutige, weltweit verbreitete Notenschrift mit fünf Linien und<br />
Schlüsseln, so daß eine exakte Fixierung <strong>von</strong> musikalisch relevanten Tonhöhen<br />
möglich wurde. Mit diesem Schritt wird eine Rasterung <strong>des</strong> akustischen Tonraums