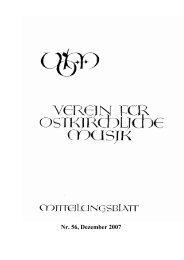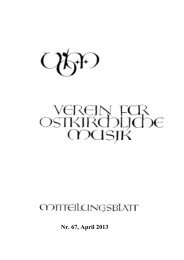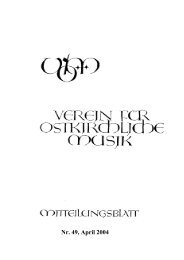Nr. 57, März 2008 - VOM Verein für Ostkirchliche Musik
Nr. 57, März 2008 - VOM Verein für Ostkirchliche Musik
Nr. 57, März 2008 - VOM Verein für Ostkirchliche Musik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anweisungen <strong>für</strong> die Chorleiter<br />
Die in dieser Ausgabe zusammengestellten Gesänge werden in ihrer<br />
Wirkung nur dann vollkommen sein, wenn sie entsprechend ausgeführt<br />
werden. Damit ist nicht nur die rein musikalische Aufführung gemeint,<br />
sondern auch die Aussprache, die sinngemäße Verteilung der<br />
Akzente, also die Art der Gesamtdurchführung. Die nachfolgenden<br />
Anweisungen bleiben nur ein Versuch, die Grundregeln <strong>für</strong> die Leitung<br />
des slawischen Kirchengesanges zu umreißen. Maßgeblich und<br />
unmißverständlich bleibt immer die Praxis. Der mit dem slawischen<br />
Kirchengesang noch nicht vertraute Chorleiter müßte in jedem Falle<br />
zunächst einen guten slawischen Kirchenchor während des Gottesdienstes<br />
hören, um einen umfassenden Eindruck zu gewinnen. Erst<br />
dann wird es gelingen, die Führung in den traditionellen Bahnen zu<br />
übernehmen.<br />
Im slawischen Kirchengesang beherrscht der Text die Melodie und<br />
ordnet sie nach den logischen Akzenten, nur im Text liegt die konstruktive<br />
Kraft. Darum ist vor allem anderen größter Wert auf die richtige<br />
Aussprache, auf die sinngemäße Betonung der Silben zu legen.<br />
Undeutlichkeit, harmlose Fehler in der Akzentuierung können den<br />
Sinn eines Textes mitunter bis zum Grotesken entstellen. Die Konsonanten<br />
müssen unbedingt von allen Sängern deutlich und gleichzeitig<br />
ausgesprochen werden. Die einzelnen Silben dürfen nicht gebunden,<br />
sondern müssen mit einer leichten Neigung zum staccato (aber keineswegs<br />
staccato!) gesungen werden. Die Ausführung erfolgt in<br />
gleichmäßigem, jedoch unsymmetrisch-rhythmischem Gang. Die melodischen<br />
Akzente werden den textlichen untergeordnet. Nasal-Laute<br />
(n und m) dürfen nicht übertrieben gedehnt werden, dagegen muß ein<br />
Doppel-Laut (z. B. ll in dem Wort „Alliluia“) deutlich doppelt klingen.<br />
Die Akzente werden weich, kaum bemerkbar, ohne Stoß, sozusagen<br />
„federnd“, gesungen. Bei richtiger Aussprache geraten die meisten<br />
von selbst an die rechte Stelle. Jede übertriebene pseudodramatische<br />
Dynamik ist zu vermeiden, ebenso ein gefühlloses mechanisches<br />
Gleichmaß. Die Dynamik muß aus dem Inhalt des Textes, aus der<br />
Kraft der Worte, auf eine natürliche Weise herauswachsen. Verständnis<br />
und Gefühl <strong>für</strong> eben diese Kraft der Worte sind <strong>für</strong> den Chorleiter<br />
von großer Bedeutung.<br />
In keinem Fall darf der Chorleiter bei der Interpretation eines<br />
Stückes vom melodischen oder harmonischen Element<br />
ausgehen. Nur der Text, und immer wieder der Text ist <strong>für</strong><br />
die dynamische Interpretation maßgebend.<br />
Das Rezitativ wird mehr rezitiert — skandiert — als gesungen. Das<br />
Tempo des Rezitativs gleicht etwa dem Tempo des Gregorianischen<br />
Chorals. Das Tempo der Hymnen mit einigermaßen entwickelter Melodik<br />
ist bei jedem Stück verschieden und jedesmal angegeben.<br />
Seite 5