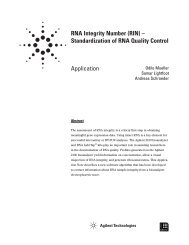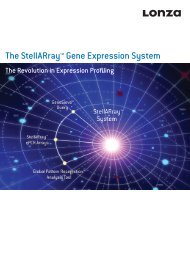PDF Download - Laborwelt
PDF Download - Laborwelt
PDF Download - Laborwelt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
R E P O R T<br />
Zur Induktion der RNAi können siRNAs entweder<br />
als DNA-basierte Expressionssysteme<br />
(shRNAs) oder direkt als RNA-Oligonukleotide<br />
(siRNAs) in die Zelle gebracht werden.<br />
in vivo-siRNA-Drug Delivery<br />
Tab. 1: Applikationsformen von siRNAs zur<br />
Induktion von RNAi in vivo<br />
Applikationsform<br />
Nackte siRNA<br />
Liposomen<br />
Lipoplexe<br />
Kationische Lipide<br />
Virosomen + kationische Lipide<br />
Polyamine<br />
Chemische Modifikationen<br />
Chemische Modifikationen +<br />
Lipid-Einkapselung<br />
Elektropulsation<br />
Histidin-Lysin-Komplexe<br />
Atelocollagen-Komplexierung<br />
Inaktivierte HVJ-Suspension<br />
Kopplung an Protamin-Antikörper-<br />
Fusionsprotein<br />
Kopplung an Cholesterin<br />
Nanoplexe<br />
Polyethylenimin-Komplexe<br />
niger Sekunden in die Schwanzvene injiziert<br />
werden, entsprächen rund drei Litern einer<br />
intravenösen Bolus-Injektion im Menschen.<br />
Alternative Strategien zur Applikation<br />
nackter siRNAs sind häufig auf die lokale<br />
Anwendung oder zumindest eine Applikation<br />
nahe dem Zielgewebe oder Zielorgan begrenzt.<br />
So wurden etwa intravenöse, intraperitoneale,<br />
subretinale, intrathecale, intranasale,<br />
intratracheale, intradermale, intratumorale,<br />
intraoculare oder intraventrikulare Applikationen<br />
beschrieben. Beachtet werden sollte<br />
auch, daß zahlreiche Studien relativ große<br />
Mengen siRNA (im Bereich zehn bis hundert<br />
mg/kg Körpergewicht) verwenden, was die<br />
Gefahr unspezifischer Nebenreaktionen wie<br />
einer intrazellulären Immunantwort erhöhen<br />
kann. Alternative Ansätze für die Applikation<br />
von siRNAs basieren auf ihrer Verpackung<br />
in verschiedenen, teilweise modifizierten<br />
Liposomen oder kationischen Lipiden zur<br />
systemischen oder lokalen Anwendung.<br />
Mit gegen apoB gerichteten siRNAs in sogenannten<br />
SNALPs (stable nucleic acid lipid<br />
particles) wurde kürzlich die erste Studie in<br />
Primaten veröffentlicht. Schließlich sind eine<br />
Reihe anderer Strategien, wie beispielsweise<br />
chemische Modifikationen von siRNA-Molekülen,<br />
Elektropulsation, Virosomen, die Verwendung<br />
von Polyaminen, anderer basischer<br />
Komplexe oder Atelocollagen zur Komplexierung,<br />
sowie die Kopplung an bestimmte<br />
Protein-Präparationen oder niedermolekulare<br />
Verbindungen beschrieben worden (vgl. Tab.<br />
1). Obwohl die Entwicklung von auf siRNAs<br />
basierenden Therapeutika erst vor wenigen<br />
Jahren begonnen wurde, haben erste Phase<br />
I-Studien bereits begonnen oder sind bereits<br />
abgeschlossen. Acuity Pharmaceuticals (Philadelphia,<br />
USA) testeten erfolgreich eine gegen<br />
VEGF gerichtete siRNA bei der feuchten Form<br />
der Altersblindheit (Altersabhängige Maculadegeneration<br />
AMD), von der in Deutschland<br />
etwa 490.000 Personen betroffen sind; auch Alnylam<br />
(Respiratory Syncytial Virus, RSV) und<br />
die von Merck Inc. Ende Oktober akquirierte<br />
Sirna (AMD) haben Phase I-Studien initiiert.<br />
Polyethylenimin-Komplexierung<br />
Polyethylenimine (PEIs) sind synthetische<br />
Polymere, die linear oder verzweigt in einem<br />
breiten Molekulargewichtsbereich von 1000 kDa vorliegen können. Aufgrund<br />
einer protonierbaren Stickstoffgruppe in<br />
jeder dritten Position besitzen sie eine hohe,<br />
vom pH-Wert abhängige, aber bereits unter<br />
physiologischen Bedingungen kationische<br />
Ladungsdichte. Daher sind sie in der Lage,<br />
negativ geladene DNAs nicht-kovalent zu<br />
komplexieren. Da die so gebildeten kompakten<br />
kolloidalen Partikel von Zellen über verschiedene<br />
Endozytosewege aufgenommen werden<br />
können, wurde PEI zunächst als in vitro-DNA-<br />
Transfektionsreagenz eingeführt 3,4 . Dem Mischungsverhältnis<br />
zwischen Stickstoffatomen<br />
Abb. 2: Einschleusen von siRNA-Molekülen<br />
durch Polyethylenimin (PEI)-Komplexierung.<br />
Negativ geladene siRNAs (rot) und positiv geladenes<br />
PEI (blau) bilden einen nicht-kovalenten<br />
Komplex, der über Endozytose in die Zelle<br />
aufgenommen und dort – vermutlich aufgrund<br />
des „Protonenschwamm-Effektes“ – aus dem<br />
Endosom wieder freigesetzt wird. Die siRNA<br />
kann nach Zerfall des Komplexes in RISC eingebaut<br />
werden und RNAi induzieren.<br />
Vorteile der direkten Applikation von siRNAs<br />
bestehen darin, daß sie chemisch relativ<br />
leicht synthetisiert werden können und ein<br />
geringes Gefahrenpotential aufweisen, da<br />
ihre Einschleusung nicht auf virale Systeme<br />
angewiesen ist und sie nicht in das Genom integriert<br />
werden können. Es müssen allerdings<br />
folgende Bedingungen erfüllt sein: Schutz der<br />
sehr instabilen siRNA gegen Abbau durch<br />
(Serum-) Nukleasen, effiziente zelluläre Aufnahme,<br />
keine intrazelluläre Immunstimulation<br />
und effiziente intrazelluläre siRNA-Freisetzung<br />
sowie in vivo geringe Toxizität und<br />
keine schnelle Elimination durch Leber oder<br />
Niere. In der Zellkultur stehen zahlreiche<br />
Transfektionsreagenzien zur Verfügung. Weit<br />
schwieriger ist die Applikation von siRNAs<br />
zu therapeutischen Zwecken in vivo.<br />
Hierzu ist in den vergangenen Jahren eine<br />
größere Zahl an Studien publiziert worden,<br />
die verschiedene Strategien zur systemischen<br />
oder lokalen Applikation beschreiben. Unterscheidungsparameter<br />
sind unter anderem der<br />
Applikationsort beziehungsweise die Applikationsart,<br />
siRNA-Modifikationen und der<br />
Einsatz verschiedener Carriersysteme.<br />
So können zur systemischen Applikation<br />
chemisch unmodifizierte siRNAs verwendet<br />
werden, deren Injektion häufig ohne weiteres<br />
Reagenz durch die sogenannte hydrodynamische<br />
Transfektion erfolgt. Während diese<br />
Methode in einigen Fällen zur effizienten<br />
Induktion von RNAi in Leber, aber auch in<br />
Lunge, Milz, Pankreas und Niere führte, ist sie<br />
für die Therapie am Menschen ungeeignet: die<br />
mehr als 1 ml, die einer Maus innerhalb wedes<br />
PEI und Phosphoratomen der DNA (sog.<br />
N/P-Verhältnis) sowie der Kettenlänge und<br />
dem Verzweigungsgrad des PEI kommen<br />
dabei im Hinblick auf Größe und Ladung des<br />
Komplexes sowie der Transfektionseffizienz<br />
entscheidende Bedeutung zu.<br />
Vermutlich kommt es nach Endozytose<br />
intrazellulär in den Endosomen/Lysosomen<br />
durch die Protonenakzeptorfunktion des PEI<br />
an den noch nicht protonierten Stickstoffatomen<br />
zu einem „Protonenschwammeffekt“,<br />
der zum Abpuffern des sauren pH-Wertes in<br />
diesen Kompartimenten sowie zum osmotisch<br />
bedingten Platzen der Endosomen/Lysosomen<br />
unter intrazellulärer Freisetzung der<br />
Komplexe führt.<br />
In neueren Studien wurden Polyethylenimin-basierte<br />
Systeme für das Einschleusen<br />
kleiner RNA-Moleküle wie siRNAs etabliert 5-7<br />
(Abb. 2). Während chemisch nicht-modifizierte<br />
siNRAs vergleichsweise rasch degradiert<br />
werden und im Serum nur eine Halbwertszeit<br />
von wenigen Minuten besitzen, sind sie nach<br />
PEI-Komplexierung über Stunden hinweg<br />
fast vollständig gegen enzymatischen oder<br />
Kennziffer 14 LW 06 · www.biocom.de<br />
<br />
8 | 7. Jahrgang | Nr. 6/2006 LABORWELT