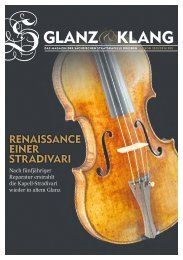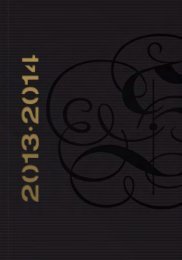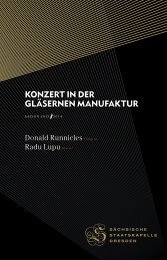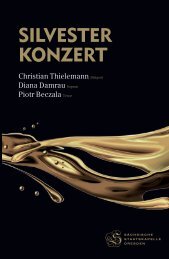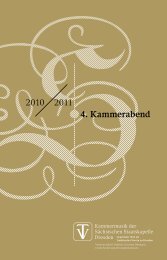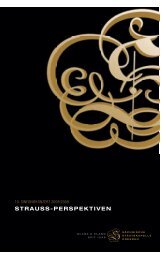Programmheft als PDF - Staatskapelle Dresden
Programmheft als PDF - Staatskapelle Dresden
Programmheft als PDF - Staatskapelle Dresden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
»Landesvater« in Göttingen, 1765<br />
Mehrm<strong>als</strong> besuchte Johannes Brahms in den 1850er Jahren die alte Universitätsstadt,<br />
in der er in privaten und öffentlichen Konzerten mit Joseph Joachim,<br />
Clara Schumann und Julius Otto Grimm auftrat und seine Jugendliebe Agathe<br />
von Siebold kennenlernte. Bei seinem ersten Göttinger Aufenthalt 1853<br />
machte er, begleitet von Joachim, ausgiebig Bekanntschaft mit dem burschenschaftlichen<br />
»Commersch« und wurde umfassend in die studentischen Gebräuche<br />
und Lieder eingeführt. Erfahrungen, die in der Akademischen Festouvertüre<br />
ihren musikalischen Nachhall gefunden haben dürften.<br />
aufrecht. Der zweifachen Abwandlung und Umgestaltung schließt sich das<br />
zweite Zitat an: das Lied »Alles schweige«, genauer gesagt dessen Refrain<br />
»Hört, ich sing das Lied der Lieder«, der anfänglich von den Violinen intoniert<br />
und gleichfalls umgehend weiterverarbeitet wird. Das Lied ist auch<br />
bekannt <strong>als</strong> »Landesvater« bzw. fest mit dem gleichnamigen Brauch verbunden,<br />
bei dem mit kräftigem Gesang und gegenseitigem Durchstechen der<br />
Studenten mützen der Landesvater geehrt und der Burscheneid bekräftigt<br />
wird. Als nächstes in der Brahms’schen Ouvertüre zu hören, zuerst in humorigen<br />
Klängen der Fagotte, ist das »Fuchslied« oder der »Fuchsenritt« (»Was<br />
kommt dort von der Höh’«), mit dem Brahms – wie überhaupt mit dem studentischen<br />
Liedgut – in jungen Jahren in Göttingen in Kontakt gekommen<br />
war, im Zuge eines Besuchs bei Joseph Joachim. Der befreundete Geiger,<br />
<strong>als</strong> »königlicher Hof- und Staats-Concertmeister« in Hannover engagiert<br />
und vom musikliebenden König Georg V. künstlerisch wie persönlich sehr<br />
geschätzt, weilte seinerzeit in der alten niedersächsischen Universitätsstadt<br />
und ging seinem Bildungsdrang nach, was sich im Beisein von Brahms<br />
offenkundig auch auf das Eintauchen in die Welt der Göttinger Burschenschaftler<br />
erstreckte. Brahms fand der Überlieferung zufolge durchaus Gefallen<br />
an dem übermütigen Treiben und ließ sich über Geschichte, Sinn und<br />
Bedeutung der angestimmten Lieder genauestens informieren. Vorgeführt<br />
worden sein dürfte ihm bei dieser Gelegenheit auch das berühmte »Gaudeamus<br />
igitur« (»Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus«, »Laßt uns, weil wir<br />
jung noch sind, uns des Lebens freuen«), das den gesamten Schlussteil der<br />
Ouvertüre ausfüllt und das Werk fulminant und strahlend ausklingen lässt.<br />
Eine ähnlich brillante, unbeschwerte Komposition wird sich unter<br />
den Brahms’schen Orchesterwerken kaum finden lassen. Genau dieser gelöste<br />
Tonfall der Ouvertüre aber und ihre Zweckgebundenheit <strong>als</strong> musikalisches<br />
»Geschenk« haben bis heute in der Musikliteratur dazu geführt, der<br />
Partitur mit einer gewissen Skepsis zu begegnen. Einer Skepsis, zu der auch<br />
und gerade die Studentenlieder und die politischen Anspielungen, die unweigerlich<br />
von ihnen ausgehen, ihren Beitrag geleistet haben. Wenig passte<br />
dies alles zu der Vorstellung vom autonomen, introvertierten, grüblerischen<br />
Künstler Brahms, der sich einzig auf sein kompositorisches »Kerngeschäft«,<br />
die reine Tonkunst, konzentriert. Brahms selbst hingegen haderte lange<br />
vornehmlich mit der Benennung des Werkes, die ihm zu hölzern vorkam:<br />
»Früher gefiel mir bloß meine Musik nicht, jetzt auch die Titel nicht, das ist<br />
am Ende Eitelkeit – ?«<br />
Lyrische Inspiration, symphonische Haltung:<br />
das Brahms’sche Violinkonzert<br />
1880 verbrachte Brahms, seit geraumer Zeit geschmeidiger Bartträger,<br />
erstm<strong>als</strong> die Sommermonate im noblen, exklusiven Bad Ischl: einerseits<br />
zur Erholung, andererseits um die grandiose Natur- und Urlaubsszenerie<br />
des Salzkammerguts schöpferisch umzumünzen und seine Kompositionen<br />
voranzutreiben. Bei ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ließ<br />
er seine Gedanken kreisen und Ideen reifen, <strong>als</strong> Ausgleich pflegte er zum<br />
Tagesausklang die anregende Geselligkeit im Kreise von Freunden, Gönnern<br />
oder Künstlerbekanntschaften, die er in seinem Feriendomizil um sich<br />
scharte. Vor Bad Ischl, in dem sich alljährlich auch der Kaiser zeigte, war<br />
drei Jahre lang das beschauliche Pörtschach am Wörthersee, das »Paradiese<br />
Kärntens«, Brahms’ bevorzugter sommerlicher Rückzugsort. »Hier – ja hier<br />
ist es allerliebst, See, Wald, ›drüber blauer Berge Bogen, schimmernd weiß<br />
in reinem Schnee‹«, schrieb er höchst entzückt an den Freund Theodor Billroth.<br />
»Mir ist es auch für längeren Aufenthalt sehr geeignet … Krebse aber<br />
14 15 10. SYMPHONIEKONZERT