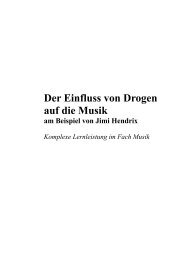Gesellschaftskritik in Anton P. Tschechows Prosawerk - Libertäres ...
Gesellschaftskritik in Anton P. Tschechows Prosawerk - Libertäres ...
Gesellschaftskritik in Anton P. Tschechows Prosawerk - Libertäres ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Erzählungen<br />
2.1 Austern (1884)<br />
2.1.1 Inhalt<br />
Diese Erzählung ist aus der Sicht e<strong>in</strong>es achtjährigen Jungen geschrieben.<br />
Dieser sitzt mit se<strong>in</strong>em Vater auf der Straße und bettelt. Der Vater schämt<br />
sich dafür und schafft es nicht die vorbeikommenden Menschen um etwas Geld<br />
zu bitten. Er kam vor kurzem nach Moskau, um e<strong>in</strong>e Stellung zu suchen, fand<br />
jedoch ke<strong>in</strong>e und versank noch tiefer <strong>in</strong> der Armut. Der Junge hat dabei<br />
schrecklichen Hunger. Da sieht er e<strong>in</strong> Schild an e<strong>in</strong>em gegenüberliegenden<br />
Gasthof, worauf ‚Austern’ geschrieben steht. Er weiß nicht, was das ist und<br />
fragt se<strong>in</strong>en Vater. Nach dessen kurzer Erklärung beg<strong>in</strong>nt er sich<br />
vorzustellen wie Austern wohl aussehen mögen, so dass er plötzlich laut<br />
nach Austern schreit. E<strong>in</strong> paar reiche Passanten nehmen ihn darauf zur<br />
Belustigung <strong>in</strong> den Gasthof mit und spendieren ihm welche. Der Junge ist<br />
angewidert, doch er isst sie trotzdem, sogar mit Schale. Das erheitert die<br />
Anwesenden sehr. Als er und se<strong>in</strong> Vater wieder zu Hause s<strong>in</strong>d, ist ihm<br />
schlecht und se<strong>in</strong> Vater ist erkältet. Der Mann ärgert sich, dass er die<br />
spendablen Leute nicht um Geld gebeten habe, trotz dass sie dem Jungen für<br />
zehn Rubel Austern gekauft hatten.<br />
2.1.2 Deutung<br />
In dieser Erzählung s<strong>in</strong>d zwei Schwerpunkte zu f<strong>in</strong>den. Zum e<strong>in</strong>en werden hier<br />
die psychologischen Auswirkungen des Hungers und des Bettelns auf e<strong>in</strong>en<br />
kle<strong>in</strong>en Jungen geschildert. Zum anderen wird aber auch Kritik an der<br />
Gesellschaft geübt, die e<strong>in</strong>erseits die Not täglich sieht und sie<br />
andererseits jedoch nicht bemerkt und bekämpft.<br />
Trotz Erzählung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er personalen Ich-Perspektive kann man den Jungen<br />
nicht mit dem kle<strong>in</strong>en Tschechow gleichsetzen, da dieser <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Jugend<br />
zwar arm war, aber nicht dermaßen hungern musste. Diese Erzählperspektive<br />
dient nur der höheren Authentizität. Der Hunger wirkt sich besonders auf<br />
den Körper des Jungen aus: „me<strong>in</strong>e Be<strong>in</strong>e knicken e<strong>in</strong>, die Worte bleiben mir<br />
im Halse stecken, me<strong>in</strong> Kopf neigt sich kraftlos zur Seite.“ 4 Er hat das<br />
Gefühl gleich <strong>in</strong> Ohmacht zu fallen. Doch auch se<strong>in</strong>e Fantasie spielt<br />
‚verrückt’, versucht sich die fehlende Nahrung herbeizudenken: „Ich kaue<br />
und mache Schluckbewegungen, als läge <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Mund tatsächlich e<strong>in</strong> Stück<br />
von diesem Meerestier...“ 5 Auch der Wahn des Hungers wird beschrieben: Nach<br />
weiteren Erläuterungen des Vaters stellt der Junge fest, dass Austern<br />
ekelhaft se<strong>in</strong> müssen. Doch trotzdem spürt er e<strong>in</strong> Verlangen nach ihnen: „Das<br />
Tier ist ekelerregend, abscheulich, schrecklich, aber ich esse es, esse<br />
voller Gier und fürchte dabei, se<strong>in</strong>en Geschmack und Geruch wahrzunehmen.“ 6<br />
Diese Schilderung des Hungers ist schon als e<strong>in</strong>e Anklage an die<br />
Gesellschaft zu werten: Wie kann es möglich se<strong>in</strong>, dass Menschen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Gesellschaft so leiden müssen? Und dann auch noch K<strong>in</strong>der!<br />
Doch der sozialkritische Schwerpunkt wird auch noch an anderer Stelle<br />
deutlich. Das Zitat „Sattheit enthält, wie jede andere Kraft, immer auch<br />
e<strong>in</strong> bestimmtes Maß an Frechheit, [...]“ passt hier sehr gut im wörtlichen<br />
(und damit uneigentlichen) S<strong>in</strong>n. Die Menschen, die hier dem kle<strong>in</strong>en,<br />
hungrigen Jungen Austern zu essen geben, me<strong>in</strong>en es ke<strong>in</strong>esfalls gut. Sie tun<br />
dies aus re<strong>in</strong>er Belustigung, zur Ergötzung und zum Zeitvertreib: „Innerhalb<br />
e<strong>in</strong>er M<strong>in</strong>ute sammelt sich e<strong>in</strong>e Menge Menschen um uns und sieht mir<br />
neugierig und unter Gelächter zu.“ 7 Ja, sie machen sich sogar über den<br />
armen Jungen lustig, da er nicht weiß, wie man dieses Nahrungsmittel isst:<br />
„‚Ha ha! Er ißt die Schalen mit!’ lacht die Menge. ‚Du Dummerchen, das kann<br />
man doch nicht essen!’“ 8 Das kann er aber auch gar nicht wissen. Sie<br />
erniedrigen hier e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>d, wegen dessen unverschuldeter Armut und<br />
damit mangelnden Wissens. Außerdem ist es dem Jungen auch egal, ob die<br />
Schalen essbar s<strong>in</strong>d oder nicht. Er leidet schließlich an schrecklichem<br />
Hunger. Die Leute s<strong>in</strong>d gar nicht <strong>in</strong> der Lage die Not des Jungen und se<strong>in</strong>es<br />
Vaters zu bemerken. Sie übersehen sie e<strong>in</strong>fach. Das ist natürlich „e<strong>in</strong><br />
bestimmtes Maß an Frechheit“.<br />
- 5 -