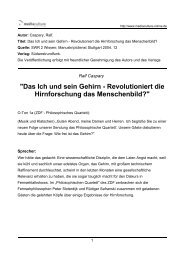Autor: Tilmann P - Mediaculture online
Autor: Tilmann P - Mediaculture online
Autor: Tilmann P - Mediaculture online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
http://www.mediaculture-<strong>online</strong>.de<br />
dahinterstehenden Kulturen“ (Keilhacker 1979, S. 77) und zum anderen der „Verdrängung<br />
der Primärerlebnisse durch Sekundärerlebnisse, d.h. durch Erlebnisse aus zweiter Hand“<br />
(a.a.O., S. 78).<br />
Die wichtigste medienpädagogische Aufgabe ist damit schon angegeben, die Erziehung<br />
von Kindern und Jugendlichen zur Kritikfähigkeit gegenüber den Medien. Hierzu gehört<br />
sowohl die Fähigkeit im medialen Überangebot gezielt auswählen zu können als auch<br />
Wachheit und Wachsamkeit gegenüber der Übermacht der Massenmedien und dem<br />
Mißbrauch solcher Übermacht“ (Keilhacker 1968, S. 141).<br />
5. Von der Medienkritik zur Medienarbeit<br />
Ausgehend von der gesellschaftlichen Bewegung, die - vereinfachend und<br />
medienwirksam - einer Gruppe, nämlich den Studenten zugesprochen wurde, entwickelte<br />
sich in Adaptation der „Kritischen Theorie“ der Frankfurter Schule und der Rezeption der<br />
Werke von Karl Marx Anfang der 70er Jahre die ideologiekritische Richtung der<br />
Medienpädagogik. Über die sprachliche und semiotische Analyse der massenmedialen<br />
Produkte sollte deren Ideologiegehalt entschlüsselt werden. Den Medien wurde dabei<br />
grundsätzlich Manipulation unterstellt, die Rezipienten sah man als manipulierbare Opfer<br />
(vgl. exemplarisch Dahlmüller u.a. 1973).<br />
In besonderer Weise wurde im Umkreis des Institut Jugend Film Fernsehen und seiner<br />
gleichnamigen Zeitschrift der ideologiekritische Ansatz weiterentwickelt: zum einen mit<br />
dem Versuch einer Medientheorie, in der sich marxistische und elitäre Theoreme zu einer<br />
seltsamen Mischung verbanden (Kazda, Müller, Wember 1971) und zum anderen mit der<br />
Entwicklung eines Ansatzes zur Untersuchung der Bildsprache, ihrer Verschleierungen,<br />
ihrer Interdependenzen mit dem Ton und der (vermuteten) ideologischen Positionen der<br />
Filmemacher. Am Beispiel des Dokumentarstreifens „Bergarbeiter im Hochland von<br />
Bolivien“ wendete Wember (1971) seine Analysemethode erstmals an. Er macht deutlich,<br />
daß insbesondere die Kombination von Wort und Bild die Wahrnehmung des Zuschauers<br />
lenkt und es erlaubt, Aussagen zu pointieren und in eine inhaltlich erwünschte Richtung<br />
zu lenken.<br />
16