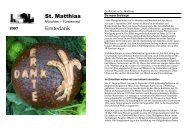Fastenpredigt von Äbtissin M. Petra Articus, OSB - St. Matthias
Fastenpredigt von Äbtissin M. Petra Articus, OSB - St. Matthias
Fastenpredigt von Äbtissin M. Petra Articus, OSB - St. Matthias
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen!<br />
Ökumenische <strong>Fastenpredigt</strong> <strong>von</strong> <strong>Äbtissin</strong> M. <strong>Petra</strong> <strong>Articus</strong><br />
am 26.3.2006 in <strong>St</strong>. <strong>Matthias</strong><br />
Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen,<br />
Mit der Fastenzeit, die Balthasar Fischer „die großen Jahresexerzitien genannt hat“ sind wir wieder<br />
eingetreten in die 40 Tage dauernde Periode der Vorbereitung auf das Osterfest. Nützen wir diese Zeit<br />
„des Frühlings der Kirche“ zur Neuwerdung zur Rückbesinnung auf das Geheimnis <strong>von</strong> Jesu Leiden,<br />
Tod und Auferstehung, seiner Liebe zu uns und auf unsere Intensivierung der Liebe zu ihm.<br />
Die diesjährige Fasten - Predigtreihe steht unter dem großen Thema der Berufung.<br />
Ich verstehe Berufung umfassend, denn das Ziel eines Priesters, oder eines Mönches, einer Nonne,<br />
oder eines Pastoralreferenten und Gemeindereferenten, ist das Ziel jedes bewusst lebenden Christen,<br />
nämlich nach und nach umgestaltet und Christus gleichgestaltet zu werden. „Der Weg des<br />
Ordenschristen steht im Horizont der allgemeinen Berufung zu einem christlichen Leben. Die Frauen<br />
und Männer, die den Orden angehören, sind kein <strong>St</strong>and neben oder über den übrigen Christen, sondern<br />
zunächst einmal Christen, wenn auch mit einem speziellen Charisma“. Heute bahnt sich eine Sicht der<br />
Evangelischen Räte an, die nicht mehr bloß bestimmt ist vom Verzicht auf Besitz, Familie und Freiheit,<br />
sondern das Selbstverständnis der meisten Ordensleute ist bestimmt <strong>von</strong> einer neuen Lebensqualität:<br />
Solidarische Gemeinschaft pflegen, in geschwisterlicher Verbundenheit leben und sich für den Anspruch<br />
anderer frei und verfügbar halten. Es geht heutigen Ordensleuten um die <strong>St</strong>immigkeit des eigenen<br />
Lebensprozesses; sie wollen das Leibliche und Seelische integrieren und aufmerksam werden für den<br />
Zusammenhang der Beziehung zu Gott, zu den Menschen und zu sich selbst. Wir, Zisterzienserinnen<br />
und alle, die nach der Benediktusregel leben werden <strong>von</strong> dieser immer wieder darauf aufmerksam<br />
gemacht, das Leben als Mönches, oder Nonne ist Auftrag zu einem vorbehaltlosen Christsein, und die<br />
evangelischen Räte sind ergänzend zum Sakrament der Ehe und zur Lebensform der Diözesanpriester<br />
– als Verwirklichung der Taufe zu verstehen, nicht als deren Überbietung.<br />
Darf ich jetzt auf einige wenige Gedanken <strong>St</strong>. Benedikts, als Vater des abendländischen Mönchtums<br />
eingehen, dessen Regel das Denken Europas stark mitgeprägt hat eingehen.<br />
In allen großen Religionen gibt es das Leitmotiv der Suche des Menschen nach Gott. Bei uns im<br />
Christentum dagegen, steht die Suche Gottes nach dem Menschen im Vordergrund.<br />
<strong>St</strong>. Benedikt kennt die Hl. Schrift, nimmt die Jesajastellen 43,1 und 45,2ff ernst, in denen es heißt<br />
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist<br />
mein“. Wenn du durch Wasser schreitest, bin ich bei dir, kein <strong>St</strong>rom reißt dich fort.“<br />
Und: „Du sollst erkennen, dass ich der Herr bin / der dich beim Namen ruft, ich Israels Gott. „Ich<br />
habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, / ohne dass du<br />
mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand; / außer mir gibt es keinen Gott.!“<br />
Benedikt will dass wir erkennen wie viel Gott am Volk Israel, an allen Menschen liegt.<br />
Nicht immer ist es uns bewusst, aber vielleicht denken wir in dieser Fastenzeit einmal darüber nach,<br />
dass nicht wir in unserer Gottesbeziehung den Anfang gesetzt haben, sondern, bevor wir nur einen<br />
Gedanken auf Gott gerichtet hatten, hatte er längst schon an uns gedacht.<br />
Die Lesungen des heutigen 4. Fastensonntages, ja die ganze Hl Schrift zeigen uns dies. Auch wenn sich<br />
der Mensch <strong>von</strong> Gott durch Unglaube und Ungehorsam, durch das Anstreben einer vermeintlichen
Freiheit entfernt hatte, ja sich ihm widersetzte, sucht Gott einen Weg uns erneut anzusprechen und nahe<br />
zu kommen. So heißt es im heutigen Evangeliumsabschnitt nach Johannes: Joh 3,16 „Denn Gott hat<br />
die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,<br />
nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“<br />
Ist Ihnen schon bewusst aufgefallen, welches die ersten Fragen Gottes an die Menschen sind? Ja, sie<br />
haben recht, In Buch Genesis Kapitel 3, 9 heißt es: „Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: „Wo<br />
bist du?“ und im folgenden Kapitel 4, 9 sprach der Herr zu Kain: „Wo ist dein Bruder Abel“<br />
Wissend, dass das Wort Adam nicht ein bestimmter Eigenname ist, sonder abgeleitet wurde <strong>von</strong> Adamo<br />
„Erdling“, sind dies die Fragen Gottes an den Menschen überhaupt. Wo bist du, wo stehst du, wie<br />
stehst du zu mir, wo ist dein Bruder, wie stehst du zu ihm? Hier ergreift Gott die Initiative, nimmt<br />
Kontakt mit den beiden in Schuld gefallenen auf, und lässt nicht in ihrer Schuld und Scham verkümmern.<br />
Gott ergreift die Initiative <strong>von</strong> Anfang an und ruft die Menschen zu der befreienden Erfahrung seiner<br />
übergroßen Liebe.<br />
Die Frage Gottes an Adam respektiert die Freiheit des Menschen. Es geht um die Eröffnung eines<br />
Gesprächs, damit der Mensch in Freiheit antworten kann „ad sum“, hier bin ich.<br />
Die Sehnsucht Gottes nach uns durchzieht die ganze Hl. Schrift, das Alte Testament, genauso wie das<br />
Neue Testament. Unter den vielen <strong>St</strong>ellen im At ist eine der schönsten bei Hosea 2,16 zu finden. Es ist<br />
ein Text in dem Gott zu Israel spricht, dem Volk, das sich <strong>von</strong> ihm abgewandt und dem Baalkult<br />
zugewandt hat. „Dann will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie<br />
umwerben.“<br />
Ist das nicht stark ausgedrückt. Israel hat Jahwe vergessen und müsste nun eigentlich eine Bestrafung<br />
erwarten, aber Gott spricht <strong>von</strong> Verlockung, <strong>von</strong> Umwerbung, <strong>von</strong> in die Wüste hinausführen, wobei die<br />
Wüste ein Bild für die Anfangszeit Israels mit Gott ist.<br />
Der Anfang jeglicher Berufung im NT ist die Anrede Christi an seine Jünger, eine ganz persönlich<br />
geprägte Ansprache. Denken wir an Jüngerberufung bei Mk 1,15 ff „Erfüllt ist die Zeit, und genaht hat<br />
sich das Reich Gottes, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium!“ Als er am Ufer des Sees<br />
<strong>von</strong> Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder Simons, wie sie die Netze<br />
auswarfen im See, sie waren nämlich Fischer. Jesus sprach zu ihnen: „Kommt, folget mir nach<br />
und ich werde euch zu Menschenfischern machen!“ Und sie verließen sogleich ihre Netze und<br />
folgten ihm nach.“<br />
Umkehr und Nachfolge gehören zusammen. Wir könnten statt Umkehr auch sagen, Hinwendung zu dem<br />
der uns ruft, Ausrichtung auf ihn hin, der uns anspricht, seinen Willen erkennen, bejahen und erfüllen<br />
heißt Liebe und Nachfolge. Nachfolge ist nicht unbedingt mit einer besonderen Aufopferung oder<br />
vielen asketischen Übungen verbunden. Das innere Verhältnis zu Gott, den Menschen und<br />
Dingen aus der Liebe Christi heraus ist entscheidend. Aber ich muss Brücken hinter mit abbrechen,<br />
muss oft meine vorherige Richtung ändern, wenn ich mich an Christus binde, wenn ich ihn zum<br />
Mittelpunkt meines Lebens mache, mich <strong>von</strong> ihm anziehen lasse?<br />
Dass Jesus <strong>von</strong> uns nicht irgendetwas verlangt, dass er uns nicht alle über einen Kamm schert, wie wir<br />
im Dialekt sagen, sondern jedem <strong>von</strong> uns ganz persönlich begegnet uns auf individuelle Weise anspricht<br />
und zwar immer wieder neu, je nach Lebenssituation, zeigen uns seine Begegnungen mit den<br />
verschiedenen Menschen nach der Auferstehung.<br />
Den Emmaus Jüngern erläutert Jesus die Schrift und offenbart sich beim Brotbrechen, damit Sie<br />
verstehen auch das Leiden gehört zur Nachfolge Christi und die Passion führt nicht zur Resignation,<br />
sondern zur Auferstehung.
Maria Magdalena, die Jesus in Ihrer Trauer mit dem Namen anspricht: muss lernen, dass man Jesus<br />
nicht festhalten kann, ihn nicht ganz für sich haben darf. Jesus lehrt sie Distanz zu halten, wünscht ihre<br />
Selbständigkeit und Reifung und schickt sie zu den Jüngern um ihre Begegnung zu bekunden, denn er<br />
gehört nicht nur ihr, sondern allen Menschen.<br />
Thomas, ein Skeptiker, wird <strong>von</strong> Jesus eingeladen die Distanz zu überwinden, sich vertrauend und<br />
glaubend auf Jesus einzulassen.<br />
Petrus, der aktive Jünger, der mehr verspricht als er halten kann, der nicht zu seinem Wort steht, der<br />
Jesus verleugnet, wird <strong>von</strong> Jesus nach seiner Liebe befragt und erhält dann, obwohl es einen Jünger<br />
gibt, dessen Liebe zum größeren Glauben führt und der so bleiben darf wie er ist, den Auftrag<br />
Menschenfischer zu werden.<br />
Auch Paulus, der eher zwanghaft und fanatisch gesetzestreu ist, wird durch die Begegnung mit Jesus<br />
frei und <strong>von</strong> der <strong>St</strong>unde der Berufung an lebt er nur noch für Christus und die Verkündigung des<br />
Evangeliums.<br />
Sind wir nicht Petrus oder den anderen oft sehr ähnlich? Müssen wir nicht auch lernen der Liebe Jesu zu<br />
uns Menschen zu vertrauen, Gott bestimmen zu lassen, uns, oder unser Denken loszulassen.<br />
• Die Begegnung mit dem Auferstandenen Herrn ist immer eine Art neue Berufung. Das „Folge<br />
mir nach“ ist ein Schöpfungswort Gottes, das mir persönlich zugesprochen wird und mich in eine völlig<br />
neue Situation hinein nimmt. Das Wort umgreift und durchgreift unser ganzes Leben, um es <strong>von</strong> innen<br />
her zu gestalten.<br />
Das Bekenntnis zu Christus, der Glaube an ihn, kostet uns heute nicht mehr das Leben, wie den<br />
frühkirchlichen Martyrern, aber es kostet uns nach wie vor den Einsatz des eigenen Lebens. Dabei spielt<br />
der Verzicht, der sich als Selbstverleugnung konkretisiert, als Ausdruck der Ernsthaftigkeit eine wichtige<br />
Rolle. Verzicht und Absage haben keinen Wert in sich, sondern sind ausgerichtet auf die Liebe zu<br />
Christi. Sie allein ist der Grund der Absage an ein Handeln wie die Welt handelt, ein Konstitutivum des<br />
Mönchtums seit seinen Anfängen. Noch mal - Verzicht verlangt ein Leben als Christ sicher, aber es<br />
bleibt nicht beim Verzicht stehen.<br />
Denn „das Wesen dieses Verzichts besteht nicht in erster Linie darin, etwas aus uns wegzunehmen. Der<br />
Verzicht muss uns klar werden als das, was er ist, als etwas was wir in uns hineinlegen. Wir wissen,<br />
dieses Etwas ist nicht weniger als ein unerhörter Reichtum, eine unerhörte Liebe, nicht weniger<br />
als das Leben, nicht weniger als Christus selbst,“ wie Albert Peyriguere in seinem Buch „<strong>von</strong> Gott<br />
ergriffen“ S. 60 sagt.<br />
Eine wichtige Konsequenz, die sich aus der Nachfolge ergibt, ist die Nächstenliebe. Neben den<br />
Anforderungen des Dekalogs, also den 10 Geboten und der Bergpredigt, orientiert sich die alte Kirche<br />
hier vor allem an der Gerichtsrede bei Matthäus 25 mit den Perikopen, <strong>von</strong> den klugen und törichten<br />
Jungfrauen, den Talenten und vor allem vom Endgericht mit der Feststellung: Mt 25,40 „Was ihr dem<br />
geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan.“ Dies ist das in der alten Kirche am<br />
stärksten vertretene Kapitel. Von Anfang an wusste sich die christliche Gemeinde der Sorge für die<br />
Armen und Hilfsbedürftigen verpflichtet, die eine der größten Ursachen für den missionarischen Erfolg<br />
des Christentums gewesen ist. Die heidnische Äußerung: „Seht, wie sich diese Christen<br />
untereinander lieben“ ist wörtlich gemeint.<br />
Sie merken, bis jetzt habe ich nur <strong>von</strong> unser aller Berufung gesprochen, <strong>von</strong> der Berufung zum Christ<br />
sein, die Eheleute genauso wie Priester, Ordensleute, junge oder alte Menschen betrifft. Leben wir<br />
bewusst aus der Begegnung mit Gott, bereiten wir so den Boden mit für die, die sich für ein<br />
priesterliches oder klösterliches Leben entscheiden. Wenn auch mit gleicher Grundausrichtung, doch
irgendwie, radikaler, und ohne Erfahrung der Belehrung, der Wende, der Einkehr in sich selbst, ist diese<br />
Entscheidung nicht möglich.<br />
Das Matthäuswort 10,37: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und<br />
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, “ fordert die Bereitschaft zur<br />
bedingungslosen Nachfolge mit allen Konsequenzen. Schon früh fordert Cyprian im Umfeld der<br />
Taufunterweisung „Der Liebe unseres Gottes Christus darf man nichts vorziehen.“<br />
Aus der Liebe zu Christus leben, sich dem Geist Gottes zu überlassen, das Leben <strong>von</strong> ihm durchlichten<br />
zu lassen, auf ihn zu hören, ist es was Nachfolge im Ordensleben heißt.<br />
Obwohl <strong>St</strong>. Benedikt den Prolog mit der Aufforderung zum Hören beginnt ist der Ausgangspunkt<br />
für ein Leben in der engeren Nachfolge Christi für ihn das „Gott suchen“.<br />
Die Gottsuche ist Grundvoraussetzung die Benedikt an den Novizen stellt: „Man achte genau darauf,<br />
ob der Novize wirklich Gott sucht“,….Die Gottsuche ist ein Prozess, der nicht dem Anfang des<br />
Ordenslebens vorbehalten ist, sondern dem Mönch, der Nonne, dem Priester, ja allen Menschen immer<br />
aufgegeben ist. Benedikt spricht nie da<strong>von</strong>, dass sie Gott gefunden haben, da er weiß, christliches<br />
Leben bedeutet immer Gott suchen. Wohl dürfen wir voraussetzen, dass die, die sich nach Gott sehnen<br />
<strong>von</strong> Gott gefunden worden sind. Der Bildhauer Barlach sagt: „Ich habe keinen Gott, aber Gott hat<br />
mich“. Das Wort Suchen soll zeigen, dass wir Gott nicht festmachen können. Dieses Suchen heißt nicht<br />
im Unentschiedenen bleiben, es geht nicht um Beliebigkeit oder Unsicherheit. Dieses Suchen ist eine<br />
Fähigkeit des Menschen sich auf etwas ausrichten zu können. Benedikt zeigt mit der Forderung der<br />
Gottsuche auf, dass wir in einen offenen Horizont, in einen Prozess hineingestellt sind, der letztendlich<br />
den Menschen vor das Angesicht Gottes stellen will. Die Aufforderung zur Gottsuche ist der Gegentrend<br />
zu dem, wovor Benedikt in Kapitel 7, 10 in der ersten <strong>St</strong>ufe der Demut warnt: „ Der Mensch achte stets<br />
auf die Gottesfurcht und hüte sich, Gott zu vergessen.“ Das Suchen weist immer wieder zurück auf<br />
die Hl Schrift. Es ist ein Leitwort sowohl im AT wie im NT, es hat immer etwas mit Tasten, eine Ahnung<br />
haben zu tun. Die neutestamentliche Negativfigur zur Thematik der Gottsuche ist der Pharisäer mit<br />
seiner Sicherheit.<br />
Mt 6, 31 - 33 „Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen<br />
wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer<br />
Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine<br />
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben.“<br />
Dieses Wort zeigt, dass das Suchen zielgerichtet ist und sehr viel mit dem Handeln im Alltag zu tun hat.<br />
Das Reich Gottes verwirklicht sich in dem ich seinem Willen entsprechend handle. Das Suchen nach<br />
Gott wird immer wieder in der Hl. Schrift formuliert. So in Joh 1,38 „ Jesus wandte sich um, und als er<br />
sie nachkommen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr?“<br />
Im Buch Amos 5,4 heißt es: „Ja, so spricht der Herr zum Hause Israel: Sucht mich, damit ihr am<br />
Leben bleibt!“ Oder in Dtn 4,29 „ Dort (in der Verbannung) werdet ihr den Herrn, deinen Gott,<br />
wieder suchen. Du wirst ihn auch finden, wenn du dich mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele<br />
um ihn bemühst.“<br />
Das <strong>St</strong>ichwort „Gott suchen“ braucht immer wieder eine neue Klärung, was ist meine Priorität, was ist<br />
meine Motivation. Ich muss immer wieder mein Bündel an Motiven durchleuchten. Wichtig ist auch zu<br />
sehen „Gott suchen“ meint nicht die Vollkommenheit suchen, sondern die Liebe, Christus suchen. Die<br />
Gottsuche ist ganz personal zu sehen. Sie steht im christologischen Zusammenhang. Denken wir an den<br />
Hinweis den Jesus Philippus gegeben hatte, als dieser sagte: „Herr, zeige uns den Vater und es<br />
genügt uns“. Die Antwort Jesu: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“, (Joh 14, 2) zeigt,<br />
wer Christus sieht, sieht den Vater. Die Frage, wie kann man Christus so sehen, dass man dabei<br />
zugleich den Vater sieht, beantwortet das Johannesevangelium im Zusammenhang mit dem Gespräch<br />
am Palmsonntag, in dem Philippus Jesus den Wunsch der Griechen kund tut ihn zu sehen. Die Antwort<br />
Jesu führt uns in den Horizont der Passion: „“Die <strong>St</strong>unde ist gekommen, dass der Menschensohn
verherrlicht wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und<br />
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt,<br />
verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige<br />
Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener<br />
sein. Wenn einer mir dient wird der Vater ihn ehren.“ (Joh 12,23 ff)<br />
Die Verherrlichung Jesu geschieht in der Passion. Aus ihr kommt die vielfältige Frucht. Das Sehen<br />
geschieht im Nachfolgen. Das Nachfolgen ist ein Leben mit Christus, in der Weise wie er gelebt hat. Von<br />
daher gewinnt auch das Wort am Ende der Passion seine große Bedeutung: „Sie werden schauen auf<br />
den, den sie durchbohrt haben“. Joh 19,37)<br />
Gregor <strong>von</strong> Nyssa interpretiert die <strong>St</strong>elle im Buch Exodus, in der Mose verlangte Gott zu sehen und<br />
erfährt, dass man Gott nur <strong>von</strong> hinten sehen kann, mit folgenden Gedanken. „ Wir können Gott nur<br />
begegnen, in dem wir hinter Jesus hergehen; wir sehen ihn nur in der Weise der Nachfolge Jesu,<br />
die ein Gehen hinter seinem Rücken und so hinter dem Rücken Gottes ist. Sehen ist Gehen, ist<br />
Unterwegssein unserer ganzen Existenz auf den lebendigen Gott zu, wofür uns Jesus mit seinem<br />
ganzen Weg, vor allem mit dem österlichen Geheimnis <strong>von</strong> Leiden, <strong>St</strong>erben, Auferstehung,<br />
Auffahrt die Richtung schenkt.“ Kardinal Ratzinger („Unterwegs zu Jesus Christus S. 25)<br />
So geht es auch <strong>St</strong>. Benedikt um die Offenheit und Bereitschaft, Christus zum Mittelpunkt des Lebens<br />
werden zu lassen. Die Gottsuche kann das Grundgelübde des benediktinischen Lebens genannt<br />
werden. Daher steht diese Weisung als parallele Wendung zu der zentralen Formulierung bei Benedikt<br />
„der Liebe zu Christus nichts vorziehen“. Gefordert ist die absolute Entscheidung des Menschen für<br />
Christus, der mit seiner Liebe im Leben des einzelnen gegenwärtig ist.<br />
Benedikt meint nicht zuerst die Liebe des Mönchs zu Christus, sondern wie die biblische Botschaft zeigt,<br />
die Liebe, mit der Christus ihn zuerst geliebt hat. In der Situation der Bewährung ist sie das einzig<br />
Wichtige. Jede Liebe zu Christus ist daher Antwort und Ausdruck der Entscheidung für ihn. Erst die<br />
Liebe des Herrn befähigt den Menschen zu einem Leben aus dem Glauben. Der Blick des Mönches ist<br />
auf den gegenwärtigen, österlichen Christus und auf den wiederkommenden Herrn gerichtet.<br />
Das <strong>St</strong>ichwort Gott suchen können wir auch als Lebenswidmung bezeichnen. Die Hinzufügung<br />
Benedikts des Wortes „wahrhaftig suchen“ heißt um Gott selbst willen ihn suchen. Augustinus hat das zu<br />
seinem Lebensmotto am Anfang der „Confessiones“ gemacht. „Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in<br />
dir.“<br />
Die wahrhafte Ausrichtung auf Gott, das nur Gott im Blick haben enthält immer auch die Forderung die<br />
Welt zu verlassen wie es auch im Evangelium formuliert wird. Zum Beispiel Mk 10, 28 „Du weißt, wir<br />
haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage euch: Jeder,<br />
der um meinetwillen und um das Evangeliums willen Haus oder Brüder…verlassen hat, wird das<br />
Hundertfache dafür empfangen.“ Die Wichtigkeit dieser <strong>St</strong>elle ersehen wir auch darin, dass sie auch<br />
bei Mt 19,27.29 und Lk 18, 28. 29 zu finden ist.<br />
Die Werkzeuge in Kapitel 4, 20 und 21 der Regel ergänzen sich: 20 „Sich dem Treiben der Welt<br />
entziehen.“ 21 „Der Liebe Christi (oder: zu Christus) nichts vorziehen.“<br />
Die beiden Verse gehören zusammen und sind die geistliche Achse des Kapitels 4 und beides geschieht<br />
in einem Prozess, der ein Leben lang vor sich geht. (Ich muss mich nicht nur dem Treiben der Welt<br />
außen, sondern auch in mir entziehen.) Dies erfordert immer wieder die Umkehr und gehört in die<br />
Taufspiritualität. Die Taufe ist zugleich durch die Abkehr <strong>von</strong> der Welt, Hinwendung zu Christus. Wir<br />
haben also in den beiden Versen die christliche Taufgrundlage. Die zeigte sich auch leiblich sichtbar,<br />
wenn der Täufling nach Westen zugewandt gefragt wurde: „Widersagst du dem Teufel“ und in<br />
Blickrichtung nach Osten, wandte der Täufling sich dann der Liebe Christi zu.
Benedikt ist bewusst, die kirchliche Gemeinschaft als Basis und die Taufe als Wurzel des Ordenslebens<br />
würden leer und haltlos, wären sie nicht Ausdruck und Folge einer personalen Christusbeziehung, die<br />
sich als innerste Quelle eines Lebens in Gelübden erweist. Die Beziehung zu Christus: „das Bei – ihm –<br />
sein, das ihm gleichen wollen, die Schicksalsgemeinschaft mit ihm, das Hören – auf – sein – Wort<br />
begründet das Ordensleben.<br />
Christus ist nicht nur das Ziel des suchenden Menschen, sondern Christus selbst sucht den Menschen,<br />
wie Ambrosius formuliert: „Suche mich, weil ich dich suche, suche mich, finde mich, nimm mich<br />
auf, trage mich. Du kannst den finden, den du suchst.“<br />
In so enger Beziehung mit Christus zu leben ist nicht selbstverständlich Benedikts Begriffe der „enge<br />
Weg des Anfangs“ und das „weite Herz“ machen den Anspruch dieses Prozesses deutlich wie die<br />
Verse 48 und 49 des Prologs zeigen: 48….“dann lass dich nicht sofort <strong>von</strong> Angst verwirren und<br />
fliehe nicht vom Weg des Heils; er kann am Anfang nicht anders sein als eng. 49 Wer aber im<br />
klösterlichen Leben (und wir könnten sagen in der Christusliebe) und Glauben fortschreitet, dem<br />
wird das Herz weit, und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes.“<br />
Die neutestamentliche <strong>St</strong>elle hierzu finden wir bei Mt 7, 13. 14: 13 „Geht hinein durch das enge Tor!<br />
Denn weit ist das Tor, und breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die<br />
hineingehen auf ihm. 14 Doch wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt,<br />
und wenige sind es, die ihn finden.“<br />
Origines bringt die Anforderungen der ernst genommenen Nachfolge und Umkehr auf den Punkt: Du<br />
glaubst vielleicht der Weg sei sanft, aber du täuscht dich. Er ist am Aufstieg eng und<br />
beschwerlich. Aber es ist ein Aufstieg auf das Leben hin.“<br />
Den engen Weg zu gehen entspricht der Forderung Jesu, „er nehme sein Kreuz auf sich und folge<br />
mir nach“. Durch den Prozess der Umkehr und des Glaubens gelangt der Mensch, nach Sicht der<br />
Väter, in die Weite des Herzens, wird frei <strong>von</strong> seinen Egoismen.<br />
„Es kostet entschiedene Mühe, sich <strong>von</strong> Gott in Frage stellen zu lassen, sich fordern und formen zu<br />
lassen durch den Tageslauf, die Arbeit, die Begegnung mit den Brüdern oder Schwestern, durch die<br />
spürbare Askese ernsthafter geistiger oder körperlicher Arbeit, durch die Feier der Liturgie, sowie die<br />
normalen Spannungen des gemeinsamen Lebens.“<br />
Die Formulierung in K. 58, 8 „Offen rede man über alles Harte und Schwere auf dem Weg zu Gott.“<br />
zeugt <strong>von</strong> dem Wissen Benedikts und auch der Väter, das Anstrengung zum Leben des Getauften<br />
gehört: Cyprian schreibt: „ Du hast vielleicht geglaubt, der <strong>von</strong> Gott angegebene Weg werde eben<br />
und leicht sein und weder Anstrengung noch Mühe fordern. Doch in Wirklichkeit ist es ein<br />
Anstieg, ein Anstieg voller Windungen, schmal und beschwerlich.“<br />
Von „ire ad deum“ ist der Weg zurückzuschlagen zum Prolog Vers 2 wo das Grundmotto anklingt, zu ihm<br />
zurückkehren: „So kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die<br />
Trägheit des Ungehorsams verlassen hast.“ Die Grundbewegung des Mönches und Christen ist – zu<br />
ihm zurückkehren, zu Christus umkehren.<br />
So hat die Regel Benedikts den gesamten Lebensprozess im Blick, beachtet das was der Christ<br />
eigentlich im Leben verwirklichen möchte.<br />
Sie merken hier geht es nicht um etwas, was ich mir heute vornehme und morgen umsetze. Die<br />
Beziehung zu Christus, jede Berufung zu einem christlichem Leben und vor allem zu einem Ordensleben<br />
muss aus der Kontemplation entstehen, aus Augenblicken intensiv empfundener Gemeinschaft mit Gott,<br />
aus einer tiefen Gemeinschaft mit Christus im Gebet, aus der Suche nach seinem Antlitz beim der Lesen<br />
der Hl. Schrift, in der Begegnung mit Christus in der Eucharistie oder auch im anderen Menschen.<br />
Da Benedikt weiß, dass das Leben als Mönch, und ich würde sagen als Christ, in den verschiedenen<br />
Ebenen unseres Alltags immer auf zwei Brennpunkte ausgerichtet sein muss:
• auf die persönliche Entscheidung zur Christusnachfolge, denn „Christsein und christliche<br />
Lebensbindungen leben <strong>von</strong> der inneren Bindung an die Person Jesu Christi“<br />
• und auf die aufmerksame Wahrnehmung der Zeichen der Zeit, also der gesellschaftlichen und<br />
kulturellen Entwicklung und der je eigenen Lebenssituation,<br />
entwickelt er im Prolog eine Spiritualität des Hörens.<br />
BR Obsculta – Höre, mein Sohn….<br />
Prolog<br />
1 – „Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den<br />
Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch Tat!<br />
2 – So kehrst du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurück, den du durch die Trägheit des<br />
Ungehorsams verlassen hast.<br />
Wenn die Benediktusregel mit diesem Wort beginnt, ist damit die Wichtigkeit des Hörens betont Das<br />
erste, was der Mensch verwirklichen soll, ist das Hören. „Hören als Grundprinzip und<br />
Grundvoraussetzung sinnerfüllten Lebens: „Hören auf das, „was der Geist zu den Gemeinden<br />
redet“; dies ist unsere Berufung.<br />
Hören beinhaltet offen sein, wachsam sein. Der Hörende muss einen Schritt aus sich herausgehen,<br />
aufmerksam sein, auf jemanden hören und damit auch abhängig sein, ein <strong>St</strong>ück sich<br />
zurücknehmen und Empfangender sein.<br />
Dieses Hören ist das Erste, das Grundlegende für die monastischen Väter. Hieronymus beginnt den<br />
Brief an Eustachia auch mit dem Schriftzitat „höre o Tochter und neige dein Ohr“.<br />
Bereits die Entscheidung des Antonius zum monastischen Leben wird unter dem <strong>St</strong>ichwort des Hörens<br />
vorgestellt, und er selbst mahnt seine Schüler: „Hört die Hl. Schrift, die ist gut für euch“.<br />
Programmatisch klingt Benedikts grundlegende <strong>St</strong>elle in Dtn 6,4 „Höre, Israel!“ in Verbindung mit Spr<br />
1,8 „Mein Sohn, o höre auf die Mahnung deines Vaters und lehne nicht die Unterweisung deiner<br />
Mutter ab.“ Oder Ps 45,11 Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr! Vergiss dein Volk und dein<br />
Vaterhaus, “ oder Ps 119,36 „Mach mein Herz deinen Weisungen geneigt und nicht der<br />
Gewinnsucht.“<br />
Hören ist wie in der Hl Schrift, so auch für Benedikt immer ein Vorgang der Beziehung und<br />
entscheidet letztendlich über Glauben und Unglauben, kennzeichnet die Beziehung zwischen Gott<br />
und Israel. Hören ist dann Gehorchen im Glauben, ist jemandem Angehören. Das Hören ist aber in<br />
der Hl. Schrift nicht einseitig als Einbahnstraße zu sehen, denn sie stellt Gott auch als Hörenden dar.<br />
Die Aufforderung zum Hören ist immer identisch mit der Aufforderung zu glauben, zum umkehren<br />
und nachfolgen. Es geht also um eine ganz weite Dimension wie es auch Ps 81 zeigt: 81,9 – 12 „Höre,<br />
mein Volk, ich klage wieder dich! Israel, möchtest du doch auf mich hören! Keinen anderen Gott<br />
soll es bei dir geben, keinen fremden Gott darfst du verehren! Ich, der Herr, bin dein Gott, der<br />
dich aus dem Lande Ägypten geführt. Öffne deinen Mund so will ich ihn füllen! Doch mein Volk<br />
hörte nicht auf meine <strong>St</strong>imme, Israel gehorchte mir nicht.“<br />
Auch die Heilung des Taubstummen, der <strong>von</strong> Jesus aufgefordert wurde „Ephphatha“, das heißt „öffne<br />
dich“ zeugt <strong>von</strong> dieser Dimension. Das sich Öffnen, das Hören auf den Einen, dem der Mönch gehören<br />
will, bewirkt die Verwandlung, ersetzt eigene und Fremdworte, durch den Anspruch des Herrn, durch das<br />
Wort des Lebens.<br />
Das Hören in der Hl Schrift ist nicht nur ein Beziehungswort, sondern auch ein Begriff der zur<br />
Entscheidung drängt. Also höre und tue, höre und vollende. Hören und nicht weghören, hören und
unterscheiden was wesentlich ist, wird gefordert. Lukas zeigt uns Maria nicht nur in der<br />
Kindheitsgeschichte als die Hörende („Sie bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem<br />
Herzen“), sondern auch in der Verwandtenperikope als die schlechthin vorbildliche, maßstäbliche<br />
Christin. („Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach<br />
handeln.“) Lk 8, 21<br />
Gerade an Maria sehen wir, der hörende Mensch ist jemand, der nicht der Selbsttäuschung erliegt, er<br />
sei sich selbst genug und das Maß aller Dinge; sondern er ist ein Mensch, der fähig ist zu demütiger<br />
Öffnung und Aufmerksamkeit. Er lebt wesentlich aus einer personalen und dialogischen Beziehung.<br />
Wie lernt man das Hören? Es sind uns zwei Möglichkeiten gegeben: Gnadenhaft angesprochen werden,<br />
wie es zum Beispiel Paul Claudel geschenkt wurde, oder sich vertraut machen, sensibel sein für das<br />
Wort Gottes, still werden vor Gott.<br />
Benedikt verbindet diese beiden Grunderfahrungen gelebter Existenz mit dem Wort obsculta und vertieft<br />
das durch das „Neige das Ohr deines Herzens“. Das heißt im Grunde: zeige Zuneigung. Das Ohr<br />
unseres Herzens neigend wünschen wir den zu lieben und durch ihn zu wachsen, der zu uns spricht:<br />
„ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch alles gegeben habe, was<br />
ich vom Vater gehört habe.“ Joh 15, 15<br />
Dieses Hören führt in das Wesentliche und Dialogische unserer Existenz; es gibt unserem Leben erst<br />
Sinntiefe und Inhalt.“ „Rede, Herr, Dein Diener hört“ „Mir geschehe, wie du gesagt!“<br />
Durch mehrere Verse drückt Benedikt das Bleibende des Hören Sollens aus. Es geht ihm um eine<br />
Dauersituation, nicht um ein Hören in der Überlegungsphase, sondern es meint hören, überlegen,<br />
entscheiden. Es geht also um eine grundsätzliche Aussage über den Menschen.<br />
33 – „Schließlich sagt der Herr im Evangelium: „Wer diese meine Worte hört und danach handelt,<br />
ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat.“<br />
Die <strong>St</strong>elle ist deshalb so wichtig, da sie innerhalb des Evangeliums eine Basisstelle ist, die Abschluss-<br />
<strong>St</strong>elle nach der Bergpredigt. Das Wort vermittelt die Verpflichtung zu befolgen was die Bergpredigt sagt.<br />
Benedikt entwickelt im Prolog nicht nur eine Spiritualität des Hörens, er zeigt auch wie wichtig die freie<br />
Entscheidung dazu für den Fortgang eines monastischen Lebens ist.<br />
15 – „Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht?“<br />
16 – Wenn du das hörst und antwortest: „Ich“, dann sagt Gott zu dir:<br />
17 – „Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine<br />
Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tue das Gute; suche Frieden und jage ihm nach!<br />
Es geht hier um einen Berufungsprolog zwischen Christus und dem Menschen, der schon eine<br />
Wirklichkeit der Beziehung zwischen Christus und dem Einzelnen voraus setzt. Es geht um eine<br />
Botschaft, die bleibend ist, die das Wichtigste und Bedeutsamste in unserem Leben sein muss, die sich<br />
weiterentwickelt in dem das Hören zum Gehorchen wird, in dem im Umgang mit der Schöpfung und den<br />
Dingen Achtung und Sorgfalt geübt wird, im Umgang untereinander Ehrfurcht und Liebe und im Umgang<br />
mit sich selbst die Bereitschaft zum Kämpfen und sich beschneiden lassen. Aber alles was im Kloster<br />
geschieht soll im rechten Maß geschehen.