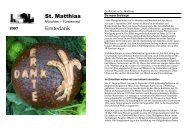Fastenpredigt von Erzabt Jeremias Schröder OSB ... - St. Matthias
Fastenpredigt von Erzabt Jeremias Schröder OSB ... - St. Matthias
Fastenpredigt von Erzabt Jeremias Schröder OSB ... - St. Matthias
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kirche, eine Gemeinschaft, die glücklich macht?<br />
Ökumenische <strong>Fastenpredigt</strong> <strong>von</strong> <strong>Erzabt</strong> <strong>Jeremias</strong> Schröder <strong>OSB</strong> <strong>von</strong> <strong>St</strong>. Ottilien,<br />
am 13.2.2005 in <strong>St</strong>. <strong>Matthias</strong><br />
Als mich Pfarrer Czarnocki einlud, diese heutige <strong>Fastenpredigt</strong> über „Kirche – eine Gemeinschaft, die<br />
glücklich macht – Fragezeichen“ zu halten, da habe ich sofort zugestimmt. Als Benediktinermönch gehöre ich<br />
zu einem Orden, der geradezu beispielhaft für Gemeinschaftsleben steht und freute mich auf die Gelegenheit,<br />
darüber zu sprechen.<br />
Erst beim näheren Vorbereiten dieser Predigt wurde ich mir dann aber des Kieselsteins bewußt, der in den<br />
weichen Brezelteig dieses Predigtthemas eingeschmuggelt wurde: die Frage nach dem Glück, oder eben<br />
nach der Gemeinschaft, die möglicherweise glücklich macht.<br />
In meiner Jerusalemer Bibel steht im Index unter dem <strong>St</strong>ichwort Glück nur ein Verweis auf Hiob, den<br />
spichwörtlichen Erdulder des Unglücks. Die <strong>St</strong>elle, die genannt wird, ist eine Schilderung seiner einstigen<br />
Zufriedenheit, seines früheren Glücks, um das er ja mindestens durch die Zulassung Gottes gekommen war.<br />
Ich habe als zweites einen Blick in den Denzinger geworfen, ein wertvolles Kompendium der katholischen<br />
Dogmatik. Als Ziel der Kirche tauchte da nur das Heil der Seelen auf, vom Glück ist nicht die Rede. Ein dritter<br />
Blick führte mich zu Google, der Internetsuchmaschine. Da gab es einen Hinweis auf einen interessanten<br />
Artikel in der Tageszeitung Die Welt, dann ein Link auf einen Hans-im-Glück-Verlag und schließlich einige<br />
philosophische Seiten.<br />
Und so versuchte ich schließlich unwissenschaftlich in mein eigenes Herz hineinzuhören. Wie ist das mit dem<br />
Glück? Natürlich bin ich – im landläufigen Sinn – lieber glücklich als unglücklich. Aber habe ich das Glück<br />
gesucht? Wollte ich unbedingt glücklich werden, als ich vor 20 Jahren ins Kloster gegangen bin, oder als ich<br />
einige Jahre später die Entscheidung getroffen habe, für mein ganzes Leben dort zu bleiben? Oder als ich vor<br />
ein paar Jahren die Wahl meiner Mitbrüder zum Abt annahm? Ich hätte diese Entscheidungen sicher nicht<br />
getroffen, wenn ich unglücklich gewesen wäre, aber dieses schwer zu fassende Glück war nie das Ziel, eher<br />
ein Geschenk, das sich immer wieder erhaschen läßt, in Momenten, die mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllen.<br />
Aber könnte ich Rezepte geben, wie man dieses Glück findet? Und soll ich – sollen wir – überhaupt Menschen<br />
auf einen Pfad lenken, der sich vornehmlich auf die Suche dieses Glücks richtet?<br />
Vielleicht darf ich das noch etwas zuspitzen. Glauben Sie, das Jesus glücklich war?<br />
Mit dieser Frage wird uns deutlich, glaube ich, daß wir anders fragen müssen. Was erwarten wir eigentlich <strong>von</strong><br />
unserem Leben, das ja für uns, <strong>Fastenpredigt</strong>besucher, <strong>von</strong> vornherein christlich verstanden und gelebt wird?<br />
Der heilige Benedikt, der vor rund 1500 Jahren seine Mönchsregel geschrieben hat, beschreibt das Ziel des<br />
klösterlichen Lebens – und das ist ja nichts anderes als ein christliches Gemeinschaftsleben – an einer <strong>St</strong>elle<br />
ganz lapidar: Da wo es um die Zulassung eines jungen Mannes zum Noviziat geht, da sagt er, man solle<br />
prüfen, „ob er wirklich Gott sucht“. Das ist in der großen Unbedingtheit auch noch nicht leicht<br />
nachzuvollziehen, aber es befreit uns doch zunächst einmal <strong>von</strong> der Glücksfrage, die uns ständig in Gefahr<br />
bringt, recht seicht auf dem Niveau <strong>von</strong> Bahnhofsromanen über das Leben zu sprechen.<br />
Glücklicherweise läßt uns der Heilige Benedikt aber nicht nur mit dieser knappen und monumentalen Antwort<br />
stehen. Da, wo er sein ganzes Programm zusammenfaßt, da schreibt er: „Und wenn wir im Klosterleben und<br />
im Glauben fortschreiten, dann laufen wir mit geweitetem Herzen den Weg der Gebote Gottes in der
unaussprechlichen Süßigkeit der Liebe.“ Wenn unser Sprachgefühl die Hürde der „Süßigkeit“ einmal hinter<br />
sich gelassen hat, dann strahlt da plötzlich dieser Ausdruck vom geweiteten Herzen auf: dilatato corde.<br />
Illustriert wird das durch Gregor den Großen, der eine Lebensbeschreibung des heiligen Benedikt verfaßt hat.<br />
Er beschreibt wie der greise Mönchsvater kurz vor seinem Tod nächtens auf den Turm stieg und dort in einer<br />
Vision die ganze Welt sah, „<strong>von</strong> einem Sonnenstrahl umfaßt“. Und Gregor deutet das: die Seele, die den<br />
Schöpfer erfaßt hat, der wird die ganze Schöpfung eng. Da taucht dieses Motiv der Weite noch einmal auf: gut<br />
und heilig hat gelebt, dessen Herz weit geworden ist.<br />
Das soll erst einmal genügen zur Frage des Glücks, und ich kehre schnell zurück zum Untertitel der heutigen<br />
<strong>Fastenpredigt</strong>: Kirche – eine Gemeinschaft, die glücklich macht?<br />
Was ist die Rolle der Kirche beim Glücklichsein, oder bei der Weitung des Herzens?<br />
Ich muß auch da <strong>von</strong> meiner benediktinischen Erfahrung zehren; traue mich freilich auch das zu tun, weil in<br />
unserem Verständnis die Klostergemeinschaft eine Kirche im Kleinen ist, eine ecclesiola, wie das bei den<br />
Vätern genannt wird.<br />
Es ist eine Platitüde, aber trotzdem wahr: Der Mensch ist auf Gemeinschaft hin geschaffen.<br />
Und unser Glaube inkarniert sich eben auch in einer Kirchengemeinschaft, die Christus begründet hat, und die<br />
das Evangelium durch die Zeiten trägt. In der Geschichte der christlichen Spiritualität gab es einen wichtigen<br />
Moment, den Aufbruch der ersten Einsiedler in die Wüste, in dem dieses Prinzip unserer<br />
Gemeinschaftsbezogenheit in Frage gestellt wurde. Sehr bald kam die Korrektur: die Einsiedler konnten und<br />
wollten nicht in völliger Isolation existieren, auch wenn das anfangs dem einen oder anderen als Ideal<br />
vorgeschwebt hatte. Aus der Erfahrung der Wüste wuchs der Drang, Klöster zu schaffen, damit die Mönche<br />
nicht allein, verloren und gefährdet ihr aszetisches Leben pflegen, sondern das gemeinsam tun. Und Basilius<br />
der Große hat diese Erfahrung schließlich theologisch untermauert: nur mit anderen zusammen kann das<br />
gelebt werden, was Christus uns mitgegeben hat: seine Liebe.<br />
Diese Liebe ist wohl die wichtigste Zutat für das so schwer greifbare Glück, dem wir heute nachspüren. Und<br />
selbst wenn sich das Glück – diese vage Verheißung - nicht erhaschen läßt, so bleibt doch der Auftrag der<br />
Liebe, die ja nicht nur schöne Empfindung ist, sondern göttliches Gebot. Die Gemeinschaft der Kirche soll so<br />
sein, daß sie uns zur Liebe befähigt, und vielleicht – en passant sozusagen – auch zum Glück.<br />
Vielleicht sollte unsere Erwartung an die Kirche denn auch etwas heruntergeschraubt werden. Die Frage ist<br />
nicht unbedingt, ob sie uns zum Glück führt, sondern eher, daß sie es wenigstens nicht verhindert. Denn oft<br />
genug kann diese Gemeinschaft ja auch bedrücken. Ich kenne eine ganze Reihe <strong>von</strong> Menschen, gerade auch<br />
in meinem kirchlichen und klösterlichen Umfeld, die an einer Gemeinschaft oder Kirche fast zerbrochen sind.<br />
Ich meine, daß es da fast immer auch an der Weite des Herzens gefehlt hat, und daß unsere Kirchen einen<br />
milden Blick verdienen, so wie wir ja auch unseren Eltern – neben allen Vorwürfen, die sie sich vielleicht zu<br />
Recht zuziehen, immer auch Dankbarkeit schulden.<br />
Aber natürlich gibt es auch Arten und Weisen, wie sich eine Gemeinschaft verhält und wie sie organisiert ist,<br />
die dem Glück des Einzelnen Raum gewähren, und solche, die das eher verunmöglichen. Wenn Sie es<br />
gestatten, werde ich noch einmal auf unsere benediktinische Erfahrung zurückkommen, die immerhin 1 ½<br />
Jahttausende überbrückt.<br />
In unseren Kirchen und eben auch in unseren Klöstern befinden wir uns ja in einem ideologisch recht<br />
aufgeheizten Raum. Es geht um die großen Themen der Welt und des Lebens, um Liebe und Tod, Wahrheit<br />
und Gerechtigkeit, Schuld und Sühne, Verdammnis und Erlösung. Allesamt Themen, die unseren<br />
ernsthaftesten Einsatz beanspruchen. Im Eifer dieses Einsatzes passiert dann aber recht leicht, daß die<br />
Grenzen des anderen, sein persönlicher Gestaltungraum, seine Überzeugungen verletzt werden. Die
abendländische Kirchengeschichte und wahrscheinlich auch die Protokolle der meisten<br />
Pfarrgemeineratssitzungen sind voll da<strong>von</strong>.<br />
Um dem zu begegnen, um zu verhindern, daß aus wohlmeinendem Eifer die anderen unter die Räder<br />
kommen, gebietet der heilige Benedikt seinen Mönch Respekt voreinander. Er tut das nicht nur mit einem<br />
allgemeinen Appell, sondern mit ganz konkreten Anordnungen:<br />
Die Mönche sollen einander dienen, und zwar beim Essen. Abwechselnd ist jeder einmal Tischdiener für alle<br />
anderen. Sie sollen auch einander gehorchen, nicht nur dem Abt. Um die falsche Vertraulichkeit der<br />
Kumpanei zu verhindern, die allzuleicht in Ablehnung umschlägt, ordnet er an, daß die Mönche einander nie<br />
nur mit dem bloßen Namen anreden sollen, sondern immer mit der Anrede „Bruder“ oder „Ehrwürdiger Vater“.<br />
Das sind kleine Dinge, aber sie schaffen einen Raum der Hochachtung voreinander, der jeden einzelnen<br />
schützt und die anderen nie vergessen läßt, daß einem in jedem Bruder Christus begegnet.<br />
Ein weiteres Prinzip ist die Ordnung. Benedikt weiß, daß kleine Geister, die es im Kloster und vielleicht auch<br />
in der Kirche ja doch auch gibt, sich über Rangfragen unendlich zerstreiten können. Und so schafft er ein<br />
klares Ordnungsprinzip: alles richtet sich nach dem Zeitpunkt des Eintritts. „Wer zum Beispiel zur zweiten<br />
<strong>St</strong>unde des Tages gekommen ist, muss wissen, dass er jünger ist als jener, der zur ersten <strong>St</strong>unde des Tages<br />
gekommen ist, welches Alter oder welche <strong>St</strong>ellung er auch haben mag.“<br />
Das wird bis heute so gehandhabt. Der Vorteil ist, daß klare Verhältnisse herrschen, und daß andererseits das<br />
Ordnungsprinzip so elementar ist, daß man gut verschmerzen kann, wenn einem in diesem System einer der<br />
hinteren Plätze zukommt. Ordnung als Prinzip der Konfliktvermeidung stiftet Frieden, und das hat dazu<br />
geführt, daß viele unserer Klöster das Wort Pax im Wappen tragen, was freilich gelegentlich eher<br />
hoffnungsvolle Verheißung als tatsächliche Zustandsbeschreibung ist.<br />
Nun könnte der Eindruck entstehen, diese klösterliche Ordnung habe etwas <strong>von</strong> der Kaserne. Das ist aber<br />
ganz sicher nicht der Fall, denn zur Regel Benedikts gehört ausdrücklich die Rücksichtnahme auf die<br />
Schwächen des Einzelnen. Es heißt also gerade nicht: Gleiches Recht für alle, sondern, nach dem Motto des<br />
Osservatore Romano „Suum Cuique“, Jedem das Seine. Gemeint ist, daß jeder nach seinen Bedürfnissen<br />
bekommen soll, was er braucht. Das ist ein vernünftiges Prinzip, das allerdings in sich noch das Problem der<br />
subjektiven und objektiven Bewertung hat: wer legt denn nun fest, was wirklich die Bedürfnisse sind? Die<br />
Antwort Benedikts ist klar; im Zweifelsfall ist der Klosterverwalter oder der Abt maßgeblich.<br />
Weil Benedikt ein kluger Menschenkenner ist, sagt er: diejenigen, die mehr erhalten, sollen sich deshalb also<br />
nicht erheben, denn man kommt ja nur ihrer Schwäche entgegen. Und diejenigen, die weniger brauchen,<br />
sollen froh sein, daß es so ist. Damit verhindert er, daß der ansonsten übliche Wettkampf der <strong>St</strong>atussymbole –<br />
der bessere Habitstoff, der schneller Computer, die schönere Zimmeraussicht – alles Dinge, die im Alltag ja<br />
auch eine Rolle spielen könnten, im Kloster ausbricht.<br />
Dem Verwalter legt er übrigens einmal nahe, daß alles so geschehen soll, daß niemand im Kloster betrübt<br />
werde. Da ist wieder diese realistische Blickweise, die nicht erwartet, daß in einer Klostergemeinschaft alle<br />
gleichzeitig zum Glück geführt werden können, aber daß doch wenigstens das Unglücklichwerden das<br />
Einzelnen verhindert werden kann.<br />
Das, was die Klostergemeinschaft in ihrem Alltag am <strong>St</strong>ärksten zusammenhält, ist schließlich der<br />
gemeinsame Lobpreis. Benedikt schreibt: dem gemeinsamen Gottesdienst soll nichts vorgezogen werde. Und<br />
das wird wohl auch für Kirche gelten, meine ich. Gemeinsames Beten, Bekennen des Glaubens, Hören auf<br />
die Heilige Schrift, Feier der Sakramente, das sind die Dinge, die uns als Gemeinschaft im tiefsten<br />
bekräftigen. Sie betreffen jeden Einzelnen <strong>von</strong> uns tief in der Seele, und bereiten den Boden für unser<br />
geistliches Wachstum, für die Weitung unseres Herzens, für das Erfahren und Schenken <strong>von</strong> Liebe, vielleicht<br />
sogar für das gelegentliche Geschenk des Glücks.