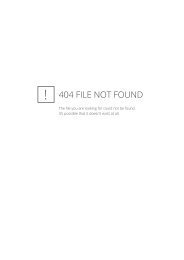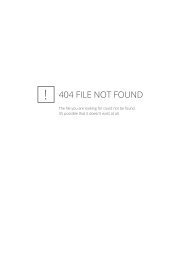Visualisierung biochemischer Netzwerke - Arbeitsbereich für ...
Visualisierung biochemischer Netzwerke - Arbeitsbereich für ...
Visualisierung biochemischer Netzwerke - Arbeitsbereich für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Visualisierung</strong> abstrakter Daten SS 2004<br />
Felix Schernhammer TU Wien<br />
Zellorganellen befindet) stattfindet. Wie bereits erwähnt existiert bei diesem Vorgang <strong>für</strong> jede<br />
der 20 Aminosäuren ein eigenes Enzym, das diesen Vorgang katalysiert.<br />
Im Bild oben kann man die Struktur eines t-RNA Moleküls erkennen. Man sieht unten in<br />
gestricheltem Rahmen das Codon mit dazugehörigem Anticodon der m-RNA. Am 3’ Ende<br />
des Moleküls, oben im Bild, verbindet sich die RNA mit der entsprechenden Aminosäure. Die<br />
beiden Arme links und rechts spielen bei der Proteinsynthese keine Rolle. Auffällig im Bild<br />
ist noch, dass das Basentripel des Anticodons eine Säure mit dem Buchstaben I enthält. Diese<br />
Base heißt Inosin. Inosin kann sich mit drei verschiedenen Basen binden, und zwar Adenin,<br />
Cytosin und Uracil. (Uracil kommt ausschließlich in RNA vor, und ersetzt bei der<br />
Transkription die Base Thymin der DNA, die in RNAs nicht mehr vorkommt). Der Vorteil<br />
der sich ergibt wenn Inosin im Anticodon verwendet wird ist nun der Folgende:<br />
Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren aber 64 mögliche Basentripel um diese zu codieren.<br />
Deshalb gibt es <strong>für</strong> eine Aminsäure mehrere gültige Basentripel. Und es ist dabei eine<br />
Rangordnung von der „most significant“ zur „least significant“ Base zu erkennen. Einige<br />
Aminosäuren sind nun allein durch die ersten beiden Basen bestimmt. An die dritte Stelle<br />
kommt sozusagen eine Wildcard, das Inosin. Der Vorteil in dieser Vorgangsweise ist der, dass<br />
die Verbindung von Inosin zu einer Base viel schwächer ist als die herkömmlichen<br />
Verbindungen und somit schneller wieder gelöst werden kann. (denn natürlich müssen t-RNA<br />
und m-RNA nach der Translation wieder getrennt werden). „Die biochemische Evolution hat<br />
demnach <strong>für</strong> die meisten Codon-Anticodon-Wechselwirkungen das Optimum an Genauigkeit<br />
und Geschwindigkeit gefunden“ ([Lehn] S. 985).<br />
ad 2: Zunächst wird in dieser Phase die<br />
m-RNA an das Ribosom gebunden.<br />
Dann wird die erste (initiierende)<br />
Aminosäure, die an der t-RNA „hängt“<br />
dazugefügt. Es gibt zu diesem Zweck ein<br />
Basentripel („Startcodon“), das den<br />
Anfang einer Polypeptidkette<br />
signalisiert.<br />
ad3: Nun wird jede weitere Aminosäure<br />
durch ihre t-RNA, die an das jeweilige<br />
Codon der m-RNA andockt, in<br />
räumliche Nähe zur vorangehenden<br />
Aminosäure gebracht, worauf diese beiden dann eine Peptidbindung eingehen. Dieser<br />
Vorgang wiederholt sich beliebig oft.<br />
ad 4: Die Termination der Elongation wird durch so genannte Nonsense Tripletts<br />
herbeigeführt. Der Name stammt aus den Anfängen der Erforschung der Proteinsynthese.<br />
Man erkannte nämlich nicht gleich die Bedeutung als Terminationscodons, sondern wunderte<br />
sich zunächst darüber, dass diese Sequenzen <strong>für</strong> keine Aminosäure kodieren. Es gibt drei<br />
verschiedene Nonsense Tripletts (UAA, UAG, UGA). Wird ein nun ein solches Triplett<br />
erreicht, löst sich die Polypeptidkette von der t-RNA und diese löst ihre Bindungen mit der m-<br />
RNA.<br />
ad 5: Nicht nur die Aminosäurensequenz ist <strong>für</strong> die Eigenschaften eines Proteins<br />
entscheidend, sondern auch die räumliche Struktur (Tertiärstruktur). In der letzten Phase wird<br />
durch Enzyme gewährleistet, dass das Protein die richtige räumliche Struktur erhält.<br />
(Primärstruktur: Aminosäurensequenz, Sekundärstruktur: räumliche Anordnung, die allein<br />
durch physikalische und chemische Eigenschaften der beteiligten Molekühle (z.B. Ladung)<br />
zustande kommt.)<br />
<strong>Visualisierung</strong> <strong>biochemischer</strong> <strong>Netzwerke</strong> Seite 7/26