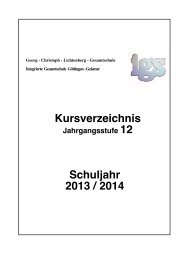WiB Gö-Geismar - IGS Göttingen
WiB Gö-Geismar - IGS Göttingen
WiB Gö-Geismar - IGS Göttingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6<br />
dass so genannte „vorstrukturiert reversiblen Gespräche“ geführt wurden, in denen die Gesprächspartner<br />
zu drei ausgewählten „Interaktionsbereichen“ – nämlichen „Schule-<br />
Öffentlichkeit“, „Lehrer-Lehrer“ und „Lehrer-Schüler“ – durch Impulse angeregt ihre eigene,<br />
auf die jeweilige Schule bezogene Sicht der Dinge artikulieren sollten.<br />
Das auf diese Weise gesammelte umfangreiche Material wurde einer differenzierten Analyse<br />
unterzogen, bei der es sich als schwierig erwies, die unterschiedlichen Bedingungen, die vielfältigen<br />
Erfahrungen und die differenten Deutungen der Praxis systematisch auf den Begriff<br />
zu bringen und daraus dann auch noch eindeutige und überzeugende Folgerungen abzuleiten<br />
(vgl. die ausführliche Dokumentation in PROJEKTGRUPPE S<strong>IGS</strong> 1975). Als Ausweg bot sich<br />
letztlich an, dass aus der Vielfalt der durchaus nicht einheitlichen Befunde jene Folgerungen<br />
favorisiert wurden, die das Konzept der <strong>IGS</strong> Göttingen-<strong>Geismar</strong> im Sinne der „sozialen Interaktion“<br />
schärfen und profilieren sollten. Damit wurde beansprucht, die zuvor an technologischer<br />
Effizienz orientierte Ausrichtung des Unterrichtens, Lernens und Prüfens durch ein<br />
Konzept zu ersetzen, bei dem pädagogisch reflektierte und immer erneut zu reflektierende<br />
Beziehungen zwischen allen Beteiligten an erster Stelle stehen. Ein eher ‚administratives’<br />
Konzept von Schule sollte durch ein ‚kommunikatives’ ersetzt werden. Ziele der gemeinsamen<br />
Arbeit sollten nicht institutionell verordnet werden, sondern sich – zumindest in der situativen<br />
Konkretisierung – aus gemeinsamer Planung ergeben. Gleichwohl musste – sozusagen<br />
paradoxerweise – für eben diese gemeinsame kommunikative Arbeit ein institutioneller Rahmen<br />
geschaffen werden, der dies nicht nur möglich, sondern geradezu erforderlich und unvermeidlich<br />
machen würde.<br />
Ein möglicher Rahmen wurde Ende 1973 mit noch vorsichtigen „Fragen, Thesen und praktischen<br />
Überlegungen zur ‚Differenzierung’ an der <strong>IGS</strong> Göttingen-<strong>Geismar</strong>“ (PROJEKTGRUPPE<br />
S<strong>IGS</strong> 1975, S. 196-201) entworfen. Um diese Vorschläge wurde in den nachfolgenden Wochen<br />
heftig diskutiert. Einwände bezogen sich teilweise auf grundsätzliche konzeptionelle<br />
Fragen, aber auch auf praktische Probleme der Konkretisierung. Es konnte aber schon im April<br />
1974 in den von der Projektgruppe erarbeiteten „Vorschlägen zur sozialen Organisation<br />
des Lernens an der <strong>IGS</strong> Göttingen-<strong>Geismar</strong>“ (ebd., S. 201-214) unterstellt werden, dass „der<br />
Schwerpunkt des Schulversuchs im Bereich des sozialen und politischen Lernens liegen soll“.<br />
Deshalb müssten entsprechende Formen des Lehrens und Lernens [...] erprobt werden.<br />
Zur Begründung der alternativen Vorschläge zur Praxis der Lernorganisation wurde auf die<br />
Erfahrungen an bestehenden Gesamtschulen verwiesen:<br />
„Bei allen Fortschritten, die die laufenden Gesamtschulen gegenüber dem herkömmlichen Schulsystem<br />
gebracht haben, sind doch bestimmte Schwierigkeiten nicht zu übersehen. Insbesondere konnten<br />
Zielsetzungen im Bereich des sozialen Lernens noch nicht in befriedigender Weise erreicht werden.<br />
Einige Probleme sollen im Folgenden erläutert werden.