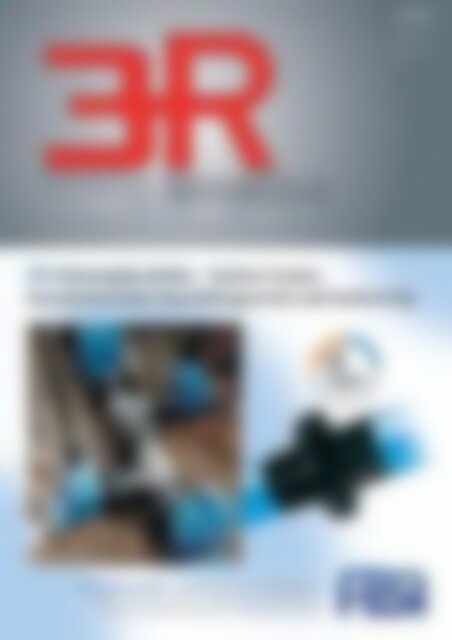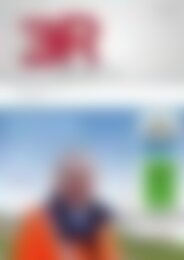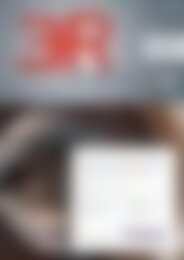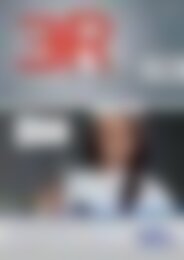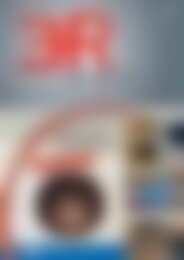3R Entwicklungen im Leistungsnetz (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11/2011<br />
ISSN 2191-9798<br />
K 1252 E<br />
Vulkan-Verlag,<br />
Essen<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Titel_<strong>3R</strong>_9-11 10.10.11<br />
PSI Schrumpfprodukte - System Canusa<br />
Korrosionsschutz baustellengerecht und hochwertig<br />
PSI Products GmbH · Ulrichstraße 25 · D-72116 Mössingen<br />
Telefon +49 (0) 7473/37 81-0 · Fax +49 (0) 7473/37 81-35<br />
E-Mail vertrieb@psi-products.de · www.psi-products.de
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
<strong>3R</strong> + gwf Wasser Abwasser<br />
<strong>im</strong> Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
<strong>3R</strong> International erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser Abwasser erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenhe<strong>im</strong>erstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder <strong>im</strong> Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (12 Ausgaben) und<br />
gwf Wasser Abwasser (12 Ausgaben) <strong>im</strong> attraktiven Kombi-Bezug.<br />
□ Als Heft für 528,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 528,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ Als Heft für 264,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 264,- pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr. Die sichere und pünktliche Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,–<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN0411<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Editorial<br />
<strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Leitungsnetz<br />
und deren Auswirkungen auf die<br />
Leitungsbauunternehmen<br />
„Die Zukunft wird uns <strong>im</strong>mer überraschen, sie sollte<br />
uns aber nicht überrumpeln.“ Dieses Zitat von Richard<br />
Buckminster Fuller (1895–1983) ist für Leitungsbauunternehmen<br />
gerade in unserer heutigen<br />
Zeit von größter Aktualität. Je schneller ein Zukunftstrend<br />
erkannt wird, desto schneller kann dieser aufgegriffen<br />
werden. Das Leitungsbauunternehmen<br />
kann entsprechend investieren und Wettbewerbsvorteile<br />
erlangen.<br />
Die Haushalte in Deutschland verbrauchen <strong>im</strong>mer<br />
weniger Energie. Der gesamte Heizenergieverbrauch<br />
sank seit 2005 um 10 %, verglichen mit<br />
2000 sogar um 20 %. Dabei ist festzustellen, dass<br />
private Haushalte 70 % ihres Energieverbrauchs für<br />
die Raumwärme nutzen.<br />
Der Trend zur Energieeinsparung wird sich in Zukunft<br />
sogar noch verstärken. Die EU-Richtlinie zur<br />
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sieht vor, dass<br />
öffentliche Neubauten ab 2019, neue Privatbauten<br />
ab 2021 nahezu ein Null-Energie-Niveau erreichen.<br />
Das Energiekonzept der Bundesregierung zielt in die<br />
gleiche Richtung. Bis 2020 soll der Wärmebedarf des<br />
Gebäudebestandes um 20 % niedriger liegen als heute.<br />
Ab 2050 könnte in der Energiesparverordnung der<br />
Standard „Null-Emission“ zur Regel werden.<br />
Dezentrale Energiegewinnung wird <strong>im</strong>mer wichtiger.<br />
Dabei besteht die Möglichkeit, viele dezentrale<br />
Stromerzeuger in einem virtuellen Kraftwerk<br />
informationstechnisch zu verschalten. Dadurch wird<br />
es möglich, die lokal verteilten Erzeuger in einer zentralen<br />
Leitwarte zu steuern, als ob sie ein einziges<br />
großes Kraftwerk wären. Das Prinzip der dezentralen<br />
Energieerzeugung wird sich sowohl bei Anlagen<br />
der KWK, als auch der Wind- und Wasserkraft sowie<br />
bei der Nutzung von Bioenergie durchsetzen.<br />
Die Bioenergie ist die bedeutendste regenerative<br />
Energieform in Deutschland. Energie aus Biomasse<br />
macht derzeit 70 % der Endenergiebereitstellung<br />
aus erneuerbaren Energieträgern aus.<br />
Die regenerativen Energien kommen bei den Investitionskosten<br />
an die Werte der herkömmlichen<br />
Stromerzeugung heran. Die Biomasse ist dabei Spitzenreiter<br />
mit Kosten ab 1500 $/kW. Der Erfolg der<br />
regenerativen Energien als leitungsgebundener<br />
Energieträger zur Stromerzeugung in Deutschland<br />
wächst stetig. Hierbei muss ein Fortschreiten der<br />
Anbindung dieser dezentralen Erzeuger an das Gesamtnetz<br />
erfolgen.<br />
Der Anteil der erneuerbaren elektrischen Energie<br />
soll bis 2030 in Deutschland mindestens 50 %<br />
erreichen. Doch Wind und Sonne sind nicht kontinuierlich<br />
vorhanden. Der Umbau geht also nicht ohne<br />
massive Speicherkapazitäten.<br />
Die Windenergieanlagen-Betreiber in Norddeutschland<br />
bekamen dies als erste zu spüren. Allein<br />
in Schleswig-Holstein passten 2009 etwa<br />
50 Mio. kWh Windstrom nicht mehr in die Hochspannungsebene<br />
des Verteilernetzes.<br />
Ein besonderes Problem ist der Stromaustausch<br />
über die mit wenigen Ausnahmen überlasteten<br />
Grenzkuppelstellen. Derzeit können über Dänemark<br />
ca. 1,5 GW ausgetauscht werden. Durch die geplanten<br />
Seekabel vergrößert sich die Kapazität bis 2018<br />
auf etwa 4,3 GW. Nach der SRU-Studie sind 2017<br />
bereits ca. 8 GW notwendig. 2020 wird eine Übertragungskapazität<br />
von 16 GW und 2050 bis zu<br />
62 GW nötig.<br />
Das wäre jedoch nur die Hälfte der Kapazität, die<br />
durch das Desertec-Projekt für den Solarstrom aus<br />
Nordafrika erforderlich ist.<br />
Die Speicherkapazität <strong>im</strong> deutschen Stromnetz<br />
besteht heute zu 95 % aus Pumpspeicherwerken mit<br />
6,6 GW Kapazität.<br />
Darüber hinaus wachst die Gesamtleistung von<br />
Kraftwerken in Deutschland, die aus erneuerbaren<br />
Energiequellen Strom erzeugen dynamisch. Bis 2022<br />
könnte sich die Kapazität auf ca. 150 GW erhöhen.<br />
Demgegenüber dürfte in der nächsten Dekade<br />
nach Einschätzung der Bundesnetzagentur die Speicherleistung<br />
nur um ca. 2,4 GW anwachsen. Alternative<br />
Speichermöglichkeiten, wie adiabate Druckluftspeicherkraftwerke<br />
oder Windstrom zu Erdgas,<br />
sind daher dringend zur Marktreife zu entwickeln.<br />
Die Gaswirtschaft zeigt großes Interesse an der<br />
Einspeisung des Gases aus erneuerbaren Energieträgern<br />
in ihre Netze. Zusammen mit den Erdgasspeichern<br />
beträgt die Speicherkapazität ca. 1 Mrd. MWh.<br />
Die Dezentralisierung der Energieerzeugung und<br />
die Notwendigkeit der Erweiterung der Speicherkapazitäten<br />
bilden die Grundlage für die weitere positive<br />
Entwicklung aller mit diesen Prozessen verbundenen<br />
Unternehmen und Einrichtungen.<br />
Dr. Wolfgang Berger<br />
Geschäftsführer der FITR-Forschungsinstitut für<br />
Tief- und Rohrleitungsbau gemeinnützige GmbH<br />
11 / 2011 785
11/2011<br />
Inhalt<br />
S. 790 S. 806<br />
Editorial<br />
785 <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong><br />
Leitungsnetz und deren<br />
Auswirkungen auf die<br />
Leitungsbauunternehmen<br />
Dr. Wolfgang Berger<br />
Nachrichten<br />
Industrie und Wirtschaft<br />
790 Feierliche Inbetriebnahme der Nord Stream-Pipeline<br />
790 Onlineangebote für die Hausanschlusssanierung<br />
791 TÜV SÜD zertifiziert Netzverträglichkeit von Stromerzeugern<br />
792 Esders GmbH erhält Innovation/Kreativität-Preis<br />
792 Privatleute treiben die Energiewende voran<br />
793 REHAU erweitert Serviceangebot<br />
Verbände und Organisationen<br />
794 KRV-Jahresbericht 2011<br />
794 Kraftwerksförderprogramm muss Wettbewerb erzeugen<br />
796 Güteschutz Kanalbau überarbeitet Leitfäden für die Eigenüberwachung<br />
800 Wirtschaftsverband für Industrieservice legt Branchenmonitor 2011 vor<br />
800 DVGW entwickelt sicherheitsrelevantes Berichtswesen für Gasversorgung<br />
weiter<br />
801 Goldmedaille für das FITR<br />
Faszination Technik<br />
818 Im Würgegriff<br />
Michael Honds<br />
Veranstaltungen<br />
801 Gebäude- und Grundstücksentwässerung<br />
802 Sicherheit von Pipelinesystemen<br />
802 10. Tiefbau-Forum in Neu-Ulm<br />
803 Duktile Gussrohre grabenlos verlegen<br />
804 Betriebssicherheit von Anlagen in der Chemischen Industrie<br />
804 9. DWA-Kanalbautage 2012<br />
805 FBS-Mitgliederversammlung in Frankfurt<br />
786 11 / 2011
S. 812<br />
Normen & Regelwerk<br />
Fachbericht<br />
806 NETZAUSBAU RELOADED: SCHNELLER,<br />
TEURER, WEITER<br />
Von RA Christian Fürst<br />
809 DVGW-Regelwerk:<br />
GW 335-B3 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der<br />
Gas- und Wasserverteilung – Teil B3: Mechanische<br />
Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) für die<br />
Wasserverteilung“<br />
G 5305-2 Entwurf „Gasströmungswächter für<br />
Gasversorgungsleitungen““<br />
G 5614 Entwurf „Unlösbare Rohrverbindungen für<br />
metallene Gasleitungen; Pressverbinder“<br />
Produkte & Verfahren<br />
812 Stumpfschweißmaschinen für PE-Rohre bis<br />
da 2.400 mm<br />
814 Rinnenabdeckung mit Wabenstruktur bis Belastungsklasse<br />
F 900<br />
815 Software-Paket zur Bemessung von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen<br />
815 Umfangreiches Servicepack 3 für BaSYS 8.2<br />
816 Rohrleitung sicher befestigen mittels Rohrbügel<br />
mit PE-Unterlage<br />
816 WELTEC-Rechner opt<strong>im</strong>iert Biogasanlagen online<br />
817 Fernwärme opt<strong>im</strong>al abgedichtet<br />
Treffpunkt der Wirtschaft und Wissenschaft, Marktplatz<br />
umfangreichen Know-hows und Neuestem aus<br />
der Fachwelt.<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
09. bis 10. Februar 2012<br />
mehr als 3.000 Besucher aus Praxis und<br />
Hochschule, der freien Wirtschaft und aus<br />
der Wissenschaft<br />
mehr als 100 Fachvorträge aus allen<br />
Facetten der Branche, schaffen Wissen<br />
für die Praxis und sorgen für Impulse für die<br />
Forschung<br />
mehr als 350 internationale Aussteller zeigen<br />
nicht nur Neuestes aus Wissenschaft und Praxis,<br />
sondern fördern den Austausch unter- und<br />
miteinander.<br />
Anmeldungen und weitere Informationen:<br />
Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18 / 26121 Oldenburg<br />
Frau Ina Kleist<br />
Tel. 0441 361039-0 / Fax 0441 361039-10<br />
E-mail ina.kleist@iro-online.de / www.iro-online.de<br />
11 / 2011 787
11/2011<br />
Inhalt<br />
S. 818 S. 845 S. S. 859 350<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Fachbericht<br />
818 Gesellschaftliche Verantwortung <strong>im</strong> Leitungsbau<br />
Von Ach<strong>im</strong> Hilgenstock, Kirsten Willings<br />
Fachbericht<br />
825 Baumwurzeln und erdverlegte Leitungsanlagen<br />
Von Michael Honds<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
830 Zellstoffproduktionsbetrieb erzeugt Biogas<br />
Wasserversorgung<br />
Fachbericht<br />
832 Wasserverlustmanagement – Grundlagen und aktuelle <strong>Entwicklungen</strong><br />
Von Dr. Jörg Kölbl<br />
Fachbericht<br />
838 Wechsel wirkungen zwischen Trink wasser qualität, Rohrwerk stoffen<br />
sowie Sanierungs- und Netzpflegemaßnahmen<br />
Von Dr. Gabriele Weirauch<br />
Services<br />
849 Marktübersicht<br />
887 Praxis-Tipps<br />
888 Buchbesprechung<br />
889 Terminkalender<br />
3.US Impressum<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
845 Trinkwasser in geregelten Bahnen – Landkreis Greiz setzt<br />
auf PE-Xa-Rohrsystem<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
846 Norwegen setzt auf Berstlining – PE-HD-Rohr ersetzt 900 m duktiles<br />
Gussrohr<br />
Abwasserentsorgung<br />
Fachbericht<br />
859 165 m Schmutzwasser-Kanal mit Pilotrohrverfahren erneuert<br />
Von Alfons Goral<br />
788 11 / 2011
Abwasserentsorgung<br />
Fachbericht<br />
864 Sanierung von öffentlichem Kanal und privaten<br />
Hausanschlusskanälen nach „Berliner Bauweise“<br />
Von Alexander Krüger und Horst Görg<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
871 Vorhandene Rohranschlüsse präzise überbohren<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
872 Sanierung eines Eiprofil 1390/1800 in Bremen<br />
mit KM-Liner<br />
Fernwärme & Energie<br />
Fachbericht<br />
875 Generische Zustandsanalyse von Fernwärmenetzen<br />
Von Volker Herbst<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
884 1.200 m Fernwärmeleitung dank HDD in<br />
Rekordgeschwindigkeit verlegt<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
886 Neue Rohre für ein historisches Kraftwerk<br />
S. 884<br />
… verbindet die Märkte<br />
789 10 / 2010 10 / 2010 789<br />
11 / 2011 789
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Feierliche Inbetriebnahme der<br />
Nord Stream-Pipeline<br />
Sie lassen das Gas fließen: Vorne von links nach rechts: François Fillon, französischer Premierminister;<br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel; Mark Rutte, niederländischer Premierminister;<br />
Dmitrij Medwedew, Präsident der Russischen Föderation; und EU-Energiekommissar Günther<br />
Oettinger. Hinten von links nach rechts: Dr. Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender<br />
der E.ON AG; Alexei Miller, Vorstandsvorsitzender von OAO Gazprom; Dr. Kurt Bock, Vorstandsvorsitzender<br />
der BASF SE; Erwin Sellering, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern;<br />
Paul van Gelder, Vorsitzender und CEO der N.V. Nederlandse Gasunie<br />
Der erste Strang der Nord Stream-Pipeline<br />
wurde am 8. November in Gegenwart von<br />
hochrangigen Gästen feierlich in Betrieb<br />
genommen. Vertreter aus Politik und Wirtschaft,<br />
darunter Bundeskanzlerin Angela<br />
Merkel, der russische Präsident Dmitrij<br />
Medwedew, der französische Premierminister<br />
François Fillon, der niederländische<br />
Premierminister Mark Rutte sowie der EU-<br />
Kommissar für Energie, Günther Oettinger,<br />
nahmen an der feierlichen Eröffnung teil.<br />
Sie würdigten das Nord Stream-Projekt als<br />
wichtigen Beitrag für die langfristige Energiesicherheit<br />
in Europa. Mit der Fertigstellung<br />
des zweiten Leitungsstrangs <strong>im</strong> Jahr<br />
2012 wird die 1.224 km lange Pipeline eine<br />
jährliche Transportkapazität von bis zu 55<br />
Milliarden Kubikmetern haben und die Europäische<br />
Union für mindestens 50 Jahre<br />
mit russischem Erdgas versorgen können.<br />
500 Gäste aus Politik und Wirtschaft<br />
nahmen neben den Staats- und Regierungschefs<br />
an den Feierlichkeiten zum<br />
Beginn der Erdgas-Lieferungen durch die<br />
Nord Stream-Pipeline teil. Die Pipeline<br />
wurde von den Staats- und Regierungschefs<br />
der Länder, aus denen die Anteilseigner<br />
des Projekts stammen, EU-Kommissar<br />
Oettinger und Spitzenvertretern<br />
der Anteilseigner in Betrieb genommen.<br />
Der Festakt fand an der deutschen Anlandestation<br />
der Leitung in Lubmin statt.<br />
Dort wird das Erdgas aus der Nord Stream-<br />
Pipeline über die weiterführenden Leitungen<br />
OPAL und NEL in das europäische<br />
Fernleitungsnetz eingespeist.<br />
Vertreter der Anteilseigner der Nord<br />
Stream AG – OAO Gazprom, BASF SE/Wintershall<br />
Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG,<br />
N.V. Nederlandse Gasunie und GDF SUEZ<br />
S.A. – bezeichneten die Pipeline als Schlüsselprojekt<br />
für Europas Energieinfrastruktur,<br />
das hinsichtlich Zeitplan und Kosten wie geplant<br />
umgesetzt worden ist. Dem europäischen<br />
Steuerzahler entstehen dabei keinerlei<br />
Kosten: Die fünf Unternehmen finanzieren<br />
30 % des Investitionsvolumens von 7,4<br />
Milliarden Euro durch Eigenkapital. Weitere<br />
70 % des Projektbudgets werden durch<br />
Kredite abgedeckt. An der Finanzierung sind<br />
insgesamt etwa 30 Banken beteiligt.<br />
Die Europäische Kommission, das Europäische<br />
Parlament und der Rat der Europäischen<br />
Union haben die Nord Stream-<br />
Pipeline bereits <strong>im</strong> Jahr 2006 in die Leitlinien<br />
für die Transeuropäischen Energienetze<br />
(TEN-E) der Europäischen Union<br />
aufgenommen und dem Projekt den Status<br />
eines „Vorhabens von europäischem<br />
Interesse“ eingeräumt. Die Internationale<br />
Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass<br />
Erdgas bis zum Jahr 2030 der wichtigste<br />
Energieträger in der Europäischen Union<br />
werden wird. Diesem zunehmenden Bedarf<br />
steht jedoch ein Rückgang der he<strong>im</strong>ischen<br />
Produktion gegenüber.<br />
Onlineangebote für die Hausanschlusssanierung<br />
Die neue Homepage www.kanalcheck7.de<br />
vernetzt Hauseigentümer und Verwalter<br />
mit Kommunen, Unternehmen und Beratern.<br />
Hier können Unternehmen ihre<br />
Dienstleistung kostenfrei eintragen und<br />
somit direkt von Hauseigentümern gefunden<br />
und kontaktiert werden.<br />
Alle Hauseigentümer müssen über kurz<br />
oder lang ihren Kanal auf Dichtheit prüfen<br />
lassen. So sieht es nicht nur § 61a des Landeswasser-Gesetz<br />
NRW vor, auch in anderen<br />
Bundesländer wurden und werden ähnliche<br />
Gesetze auf den Weg gebracht. Für<br />
Kanalsanierungs- und Tiefbaufachfirmen<br />
kann diese Gesetztesneuerung auch neue<br />
Aufräge bedeuten. Allerdings stehen die<br />
Hauseigenümer selbst erst einmal vor vielen<br />
Fragen: Wer bietet die Dichtheitsprüfung<br />
an? Was kostet es? Wie sind überhaupt<br />
die Anforderungen in meiner Gemeinde?<br />
Was mache ich, wenn der Kanal undicht ist?<br />
790 11 / 2011
Seit Sommer 2011 gibt es dieses neue<br />
Portal, auf dem Hauseigentümer Antworten<br />
und Anbieter finden. So können dort<br />
Berater, Kommunen und Unternehmen<br />
Informationen und Angebote kostenlos<br />
einstellen und so von Eigentümern und<br />
Verwaltern gefunden werden. Bei Anfrage<br />
eines Interessenten haben die Unternehmen<br />
die Möglichkeit, diese anzunehmen<br />
oder abzulehnen. Nur wenn die<br />
Anfrage angenommen wird, ist eine Bearbeitungsgebühr<br />
von 3,50 Euro für das<br />
Unternehmen fällig. Nach der Abwicklung<br />
eines Auftrages kann der Auftraggeber<br />
eine Bewertung abgeben. Diese Transparenz<br />
macht es zukünftigen Interessenten<br />
leichter, sich für einen Anbieter zu entscheiden.<br />
TÜV SÜD zertifiziert Netzverträglichkeit von<br />
Stromerzeugern<br />
Mit der Energiewende und dem Ausbau der<br />
Erneuerbaren Energien werden <strong>im</strong>mer mehr<br />
dezentrale Energieerzeuger an das Stromnetz<br />
angeschlossen. Voraussetzung für den<br />
Anschluss ist der Nachweis zur Netzverträglichkeit.<br />
Betroffen sind vor allem Windparks<br />
und Solaranlagen mit ihren witterungsbedingt<br />
fluktuierenden Einspeisemengen –<br />
künftig auch Biogasanlagen oder Blockheizkraftwerke<br />
(BHKW). TÜV SÜD Industrie<br />
Service hat die Akkreditierung zur Zertifizierung<br />
dieser Anlagen erhalten. Die Deutsche<br />
Akkreditierungsstelle (DAkkS) hat die TÜV<br />
SÜD-Zertifizierungsstelle für Netzverträglichkeit<br />
zur Prüfung von Energieerzeugungsanlagen<br />
und -einheiten zugelassen. Zudem<br />
ist TÜV SÜD bei der Fördergemeinschaft<br />
Wind und andere Erneuerbare Energien e.V.<br />
(FGW) als Zertifizierstelle empfohlen worden.<br />
In Zukunft wird das Spektrum auch die<br />
Zertifizierung von Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken<br />
umfassen.<br />
Die Voraussetzung für den Anschluss<br />
von Erneuerbare-Energien-Anlagen an<br />
das deutsche Stromnetz sind anlagenund<br />
typenspezifische Zertifikate, welche<br />
die elektrischen Eigenschaften der Erzeugungseinheit<br />
und der Erzeugungsanlage<br />
ausweisen. Geprüft werden Grundanforderungen<br />
wie Kurzschlussfestigkeit, Dauerstrombelastbarkeit<br />
und die Regelung der<br />
Wirk- und Blindleistung. Außerdem muss<br />
das angemessene Verhalten des Stromerzeugers<br />
<strong>im</strong> Netzfehlerfall – beispielsweise<br />
einem Spannungseinbruch – sichergestellt<br />
sein.<br />
Verantwortung für<br />
unsere Umwelt.<br />
• ökologisch<br />
• langlebig<br />
• sicher<br />
Kompetent in der<br />
kommunalen<br />
Abwasserentsorgung.<br />
• wartungsarm<br />
• biegesteif<br />
• belastbar<br />
Qualität, die überzeugt:<br />
Steinzeug<br />
11 / 2011 791<br />
www.steinzeug-keramo.com
Industrie & Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Esders GmbH erhält Innovation/Kreativität-Preis<br />
Der Wirtschaftsverband Emsland besteht<br />
aus über 360 Unternehmen, der unterschiedlichsten<br />
Wirtschaftsbereiche, deren<br />
Interessen durch den Verband gebündelt<br />
vertreten werden. Zum dritten Mal<br />
BILD 1: Prof. Dr. Frank Blümel zeichnete Bernd Esders aus<br />
vergab der Wirtschaftsverband Emsland<br />
den Emsländischen Unternehmenspreis,<br />
mit diesem wurden in diesem Jahr erneut<br />
emsländische Unternehmen für ihre unternehmerischen<br />
Leistungen in verschiedenen<br />
Kategorien gewürdigt.<br />
Der Weg des<br />
Erfolges war steinig,<br />
er hat sich schließlich<br />
doch eingestellt. In<br />
der Kategorie Kreativität<br />
und Innovation<br />
erhielt das Unternehmen<br />
Esders aus Haselünne<br />
die begehrte<br />
Auszeichnung.<br />
Der 1989 gegründete<br />
Betrieb<br />
beschäftigt heute<br />
50 Mitarbeiter und<br />
hat sich auf die Entwicklung<br />
von Messgeräten<br />
für die Gasund<br />
Wasserlecksuche,<br />
Messtechnik für<br />
Gasinneninstallation,<br />
Gaswarngeräten und<br />
Druckmesstechnik spezialisiert. Gerade<br />
Kreativität wird bei der Entwicklung von<br />
neuen Geräten großgeschrieben. So konnte<br />
sich die 2005 entwickelte GasCam zur<br />
Visualisierung von Erd- und Biogas bei der<br />
Dichtigkeitsprüfung von Biogasanlagen<br />
standardmäßig durchsetzen.<br />
Die Esders GmbH befasst sich seit<br />
1989 mit der Entwicklung von Messgeräten<br />
und Software. Die Jury des Unternehmenspreises<br />
des Wirtschaftsverbandes<br />
Emsland sah gerade in der Entwicklung<br />
dieser innovativen Geräte die Basis für<br />
die Nominierung. Das emsländische Unternehmen<br />
gehört zu einer der wenigen führenden<br />
Firmen in dieser Branche, die sich<br />
auch <strong>im</strong> Ausland etablieren konnte. Esders<br />
erweiterte den Standort in Haselünne in<br />
den Jahren 2002, 2007 und 2011. Dazu<br />
gehört auch der Bau einer neuen Produktionshalle<br />
in diesem Jahr. Mit der zusätzlichen<br />
rund 1.000 Quadratmeter großen<br />
Produktions- und Lagerfläche stellt das<br />
Unternehmen die Weichen für eine weitere<br />
Expansion. Firmenchef Bernd Esders<br />
sieht gute Zukunftsaussichten für sein Unternehmen.<br />
Privatleute treiben die Energiewende voran<br />
In den Sparten Photovoltaik und Windenergie<br />
an Land sind Privatpersonen traditionell<br />
die wichtigste Gruppe unter den Investoren.<br />
Zu diesem Ergebnis kommen das Marktforschungsinstitut<br />
trend:research und das<br />
Klaus Novy-Institut (KNi) in einer aktuellen,<br />
vom Bundesumweltministerium geförderten<br />
Studie. Daraus geht hervor, dass <strong>im</strong><br />
Bereich Windenergie onshore mehr als jedes<br />
dritte installierte Megawatt (36,2 %) <strong>im</strong><br />
Jahr 2010 von Privatleuten investiert wurde.<br />
Ihr Anteil an der insgesamt installierten<br />
Leistung lag sogar bei mehr als 51 %. Bei der<br />
Photovoltaik schnitt diese Investorengruppe<br />
ähnlich stark ab: Hier brachten es die Privatpersonen<br />
2010 auf einen Anteil von mehr<br />
als 40 % am Zubau. Die Landwirte steuerten<br />
darüber hinaus 21,8 % bei. Fonds und Banken<br />
folgten weit abgeschlagen mit einem<br />
Anteil von rund 9 %. Eine insgesamt untergeordnete<br />
Rolle für den Ausbau der Erneuerbaren<br />
Energien spielten bislang die großen<br />
Energieversorger.<br />
Dass Erneuerbare-Energien-Anlagen<br />
gerade bei Privatleuten so gut ankommen,<br />
liegt nicht nur an der staatlich garantierten<br />
Einspeisevergütung <strong>im</strong> Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
(EEG). Wie die Autoren der<br />
Studie betonen, ist die Eigentümerstruktur<br />
etwa <strong>im</strong> Bereich Photovoltaik auch wegen<br />
weiterer Vorteile dezentral geprägt.<br />
Die Studie nennt in diesem Zusammenhang<br />
die gute Verfügbarkeit und Handhabbarkeit<br />
dieser Technologie für Privatleute sowie für<br />
kleinere Gewerbe- und Industriebetriebe.<br />
Den starken Auftritt der Privatpersonen<br />
bei der Onshore-Windkraft erklären die<br />
Wissenschaftler mit vergleichsweise überschaubaren<br />
Investitionssummen bei der Kooperation<br />
in Bürgerwindparks. Auch mit relativ<br />
geringem finanziellen Einsatz ist hier eine<br />
Beteiligung möglich. Das gilt ebenso für<br />
die Gesellschaftsform der Genossenschaft,<br />
die für den Bau von Erneuerbare-Energien-<br />
Anlagen an Attraktivität gewonnen hat. Allerdings<br />
ist der Anteil der Kooperativen laut<br />
der Studie bislang überschaubar und noch<br />
deutlich ausbaufähig.<br />
Für den Geschäftsführer der Agentur für<br />
Erneuerbare Energien, Philipp Vohrer, zeigen<br />
die Ergebnisse der Studie die wachsende<br />
Bedeutung dezentraler Versorgungsstrukturen<br />
in Deutschland. „Mit der Energiewende<br />
bieten sich Chancen, Beteiligungsmodelle<br />
und in anderen Bereichen bewährte, genossenschaftliche<br />
Strukturen verstärkt auch in<br />
der Energiewirtschaft zu etablieren. Das gilt<br />
für Windkraftanlagen ebenso wie für Solarstrom<br />
und die Energiegewinnung aus Biogas“,<br />
unterstreicht Vohrer.<br />
Die vollständige Studie „Marktakteure<br />
– Erneuerbare-Energien-Anlagen“ ist zu<br />
finden unter www.kni.de.<br />
792 11 / 2011
REHAU erweitert Serviceangebot<br />
Mit der Veröffentlichung seiner Ausschreibungstexte<br />
in der Online-Datenbank<br />
www.ausschreiben.de unterstützt<br />
Rehau seine Partner nun auch bei der<br />
Erstellung von Leistungsverzeichnissen<br />
und Angeboten. Die Positionsbeschreibungen<br />
werden nur noch in einer Plattform<br />
erstellt und gepflegt. Hierdurch<br />
können sie stets aktuell gehalten werden.<br />
Der Download ist in allen am Bau relevanten<br />
Datenformaten möglich, wie<br />
beispielsweise GAEB 90, HTML, PDF<br />
oder XML. In zahlreiche AVA-Anwendungen<br />
und Handwerkerprogramme ist<br />
die Datenübernahme schnell und fehlerfrei<br />
direkt per Drag & Drop möglich.<br />
Die meisten Artikel sind mit Bildern veranschaulicht,<br />
die optional in<br />
den entsprechenden<br />
Datenformaten<br />
mit in das<br />
Leistungsverzeichnis<br />
oder Angebot übernommen<br />
werden<br />
können. Detaillierte<br />
Informationen zu<br />
Normen, Zulassungen<br />
oder anwendungsspezifische<br />
Details komplettieren<br />
die Ausschreibungstexte. Darüber hinausgehende<br />
Informationen oder individuelle<br />
Hilfe können per E-Mail von der<br />
Infoseite des Katalogs aus angefordert<br />
werden.<br />
7 th Pipeline Technology<br />
Conference<br />
Pipeline Technology<br />
Conference 2010<br />
28.-30. März 2012, Hannover Congress Centrum<br />
HANNOVER MESSE, 4.-8. April 2011<br />
das wichtigste Technologieereignis <strong>im</strong> Jahr<br />
www.hannovermesse.de<br />
Call for Papers<br />
veröffentlicht!<br />
6 th Pipeline Technology Conference, 4.-5. April 2011<br />
mit begleitender Fachausstellung <strong>im</strong> Konferenzbereich<br />
www.pipeline-conference.com<br />
Mehr Informationen und Newsletter mit aktuellen Nachrichten unter www.pipeline-conference.com<br />
Euro Institute for Information<br />
and Technology Transfer<br />
German Society for<br />
Infrastructure Solutions Transfer<br />
S I S T<br />
11 / 2011 793
Verbände & Organisationen<br />
Nachrichten<br />
KRV-Jahresbericht 2011<br />
Auf seiner Mitgliederversammlung am<br />
05. Oktober 2011 in Hamburg stellte der<br />
Kunststoffrohrverband e.V., Fachverband<br />
der Kunststoffrohr-Industrie, seinen aktuellen<br />
Jahresbericht vor und berichtete über<br />
die Situation der Kunststoffrohrbranche.<br />
Demnach wuchs in der vergangenen Dekade<br />
die deutsche Kunststoffrohrproduktion<br />
stetig, <strong>im</strong> Jahresdurchschnitt um 2,2 %.<br />
Die deutsche Kunststoffrohrproduktion<br />
stieg <strong>im</strong> Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr<br />
um 4,9 % auf 637.000 t. Dabei profitierten<br />
alle drei Werkstoffarten PP, PE sowie<br />
PVC-U vom Aufwärtstrend. Während<br />
die Verarbeitung von PE-Rohrsystemen<br />
rund 319.000 t ausmachte und um 4,0 %<br />
anstieg, gefolgt von PVC-/U-Anwendungen<br />
mit 3,5 % auf 233.518 t, legten insbesondere<br />
Rohranwendungen für PP überproportional<br />
zu. Die Produktion stieg um<br />
12,7 % auf 84.193 t.<br />
Damit erreichte der deutsche Inlandsmarkt<br />
für Kunststoffrohrsysteme<br />
nach nur einem Jahr das Vorkrisenniveau<br />
des Jahres 2008. Insgesamt 534.000 t<br />
wurden zu Kunststoffrohrsystemen<br />
verarbeitet und <strong>im</strong> deutschen Markt<br />
abgesetzt. Dabei lässt sich ein deutlicher<br />
Rückgang des Exports von Kunststoffrohrsystemen<br />
feststellen. Während<br />
die Exportquote in 2007 und 2008<br />
noch rund 27,8 % ausmachte, fiel sie auf<br />
23,7 % bzw. 151.000 t <strong>im</strong> vergangenen<br />
Jahr. Damit kompensiert der deutsche Inlandsmarkt<br />
die konjunkturellen Einbrüche<br />
bei unseren von der Eurokrise belasteten<br />
Nachbarn.<br />
Die Konjunkturpakete der Bundesregierung<br />
dürften hierbei eine ebenso nicht<br />
zu unterschätzende Rolle gespielt haben,<br />
wie Substitutionseffekte. Vor allem <strong>im</strong><br />
schwächelnden Tiefbau dürften Kunststoffrohrsysteme<br />
zunehmend Rohrsysteme<br />
aus anderen Werkstoffen verdrängen.<br />
Aber auch <strong>im</strong> Hochbau und damit in<br />
der Haus- und Gebäudetechnik wurden<br />
traditionelle Rohrsysteme zunehmend<br />
durch Kunststoffe ersetzt.<br />
Trotz der sehr erfreulichen Produktions-<br />
bzw. Absatzmengenentwicklung<br />
von Kunststoffrohrsystemen in 2010<br />
kämpften die Hersteller mit steigenden<br />
Rohstoffpreisen, die Anfang des Jahres<br />
2011 von steigenden Energiepreisen,<br />
Transportkosten und höheren Tariflöhnen<br />
flankiert wurden. Überkapazitäten,<br />
hohe Wettbewerbsintensität und Kostensteigerungen<br />
drückten nachweislich<br />
auf die Margen der Kunststoffrohrhersteller.<br />
Der vollständige Jahresbericht ist<br />
unter www.krv.de/home/Downloads zu<br />
finden.<br />
Kraftwerksförderprogramm muss Wettbewerb<br />
erzeugen<br />
Die deutschen Stadtwerke unterstützen<br />
weiterhin die <strong>im</strong> Sommer getroffene<br />
Entscheidung der Bundesregierung,<br />
das geplante Kraftwerksinvestitionsprogramm<br />
auf kleinere und<br />
mittlere Unternehmen zu beschränken.<br />
„Die deutschen Stadtwerke und<br />
der VKU vertreten hier dezidiert eine<br />
andere Meinung als der Rest der<br />
Branche“, sagt Dr. Hermann Janning,<br />
Vorstandvorsitzender der Stadtwerke<br />
Duisburg und Vizepräsident des Verbandes<br />
kommunaler Unternehmen<br />
(VKU). „Wer mehr Wettbewerb will,<br />
muss kleineren Marktteilnehmern den<br />
Zugang zum Energieerzeugungsmarkt<br />
erleichtern.“ Eine Mittelstandsförderung<br />
sei auch in vielen anderen Bereichen<br />
geübte Praxis und nichts Neues.<br />
„Wenn das nicht passiert, dann können<br />
die großen Player ihre heute dominante<br />
Position noch durch staatliche Hilfe<br />
weiter zementieren oder gar ausbauen.<br />
Dies entspricht nicht der Zielsetzung<br />
der Bundesregierung, dass die<br />
Energielandschaft der Zukunft deutlich<br />
dezentraler aussehen wird.“<br />
Nach Ansicht Jannings sei ein Investitionsprogramm<br />
bitter nötig. „Wir<br />
brauchen den Einsatz hoch effizienter<br />
Kraftwerke auf Basis von KWK und<br />
Gaskraftwerken für den Übergang in<br />
das Zeitalter der erneuerbaren Energien.“<br />
Mit der beschlossenen Wende<br />
hin zu mehr dezentralen Technologien<br />
haben die Stadtwerke die Chance, den<br />
Anteil an der Stromerzeugung deutlich<br />
zu steigern. „Das geht aber nur, wenn<br />
entsprechende Anreize gesetzt werden“,<br />
so der VKU-Vizepräsident. Aktuell<br />
haben die kommunalen Versorger<br />
einen Anteil von 9,8 % an der Energieerzeugung,<br />
was „für einen funktionierenden<br />
Wettbewerb, eine nachhaltig<br />
preiswerte und zukunftsfähige Energieversorgung<br />
deutlich zu wenig ist“,<br />
meint Janning. „Eine Begrenzung auf<br />
kleinere Marktteilnehmer ist unseres<br />
Erachtens sinnvoll und hilft, ihre Position<br />
<strong>im</strong> Wettbewerb zu stärken. Zum<br />
Vorteil für den Kunden.“<br />
Mit dem Kraftwerksinvestitionsprogramm<br />
will die Bundesregierung<br />
den Bau hocheffizienter Kraftwerke<br />
mit bis zu 15 % der Investitionssumme<br />
bezuschussen. Nach den bisherigen<br />
Plänen soll das Programm nur solchen<br />
Unternehmen zugute kommen, die<br />
über weniger als 5 % Marktanteil an<br />
der Energieerzeugung verfügen. Aktuell<br />
steht das Programm noch unter<br />
dem Vorbehalt einer beihilferechtlichen<br />
Prüfung durch die EU-Kommission.<br />
794 11 / 2011
Heute schon Know-how geshoppt?
Verbände & Organisationen<br />
Nachrichten<br />
Güteschutz Kanalbau überarbeitet Leitfäden<br />
für die Eigenüberwachung<br />
Antragsteller und Gütezeichenbenutzer<br />
weisen dem Güteausschuss der Gütegemeinschaft<br />
Güteschutz Kanalbau die Erfüllung<br />
der Güteanforderungen der jeweils<br />
angestrebten bzw. beurkundeten Beurteilungsgruppe<br />
nach. Detaillierte Anforderungen<br />
hierzu finden sich in den Güte- und<br />
Prüfbest<strong>im</strong>mungen. Sie betreffen die Fachkunde,<br />
technische Leistungsfähigkeit und<br />
technische Zuverlässigkeit der Bieter sowie<br />
die Dokumentation der Eigenüberwachung.<br />
Eigenübewachung<br />
Bei der Eigenüberwachung handelt es sich<br />
um eine interne Dokumentation durch<br />
Mitarbeiter des Unternehmens. Diese Dokumentation<br />
vereinfacht die Übermittlung<br />
von Sollwerten auf die Baustelle sowie die<br />
Dokumentation der Istwerte. Abnahmebescheinigungen<br />
sowie sämtliche Nachweise<br />
der Eigenüberwachung sind mindestens<br />
fünf Jahre aufzubewahren.<br />
Eine Hilfe zur Dokumentation der Eigenüberwachung<br />
bietet die Gütegemeinschaft<br />
in Form von Leitfäden, diese existieren<br />
für die Ausführungsbereiche Offener<br />
Kanalbau (AK), Vortrieb (VP, VM/VMD,<br />
VO/VOD), Inspektion (I), Reinigung (R) und<br />
Dichtheitsprüfung (D). Hinzu kommen die<br />
Leitfäden für die Beurteilungsgruppen<br />
Ausschreibung und Bauüberwachung <strong>im</strong><br />
Bereich Offener Kanalbau (ABAK), Vortrieb<br />
(ABV) und Sanierung (ABS). Diese Leitfäden<br />
werden in diesem Jahr in einer vollständig<br />
überarbeiteten Version erscheinen.<br />
Die Leitfäden stellen ein Muster für die<br />
Dokumentation der Eigenüberwachung<br />
dar. Ihre Verwendung ist ein Angebot der<br />
Gütegemeinschaft Kanalbau. Alternativ<br />
kann die Eigenüberwachung in anderer<br />
Form dokumentiert werden. Insbesondere<br />
der individuellen innerbetrieblichen Dokumentation<br />
angepasste Varianten werden<br />
verwendet, die <strong>im</strong> Rahmen von Qualitätssicherungssystemen<br />
erstellt wurden.<br />
Beurteilungsgruppen S<br />
Gütezeicheninhaber der Beurteilungsgruppe<br />
Sanierung (S) verfügen über ein für das<br />
jeweilige Verfahren individuelles Handbuch,<br />
in dem die zum Einsatz kommenden Materialien<br />
genannt sind. Zu diesen Materialien<br />
existiert eine nach den aktuellen Regelwerken<br />
vollständige Materialprüfung. Weiterhin<br />
sind <strong>im</strong> Handbuch Anforderungen an<br />
Verfahren, Ausführung und auch an die Eigenüberwachung<br />
definiert. Die Muster zur<br />
Dokumentation werden mit dem Güteaus-<br />
schuss der Gütegemeinschaft individuell<br />
abgest<strong>im</strong>mt. Damit ist gewährleistet, dass<br />
die Dokumentation der Eigenüberwachung<br />
exakt auf die Verfahrensvariante und die<br />
entsprechenden Anforderungen in den Regelwerken<br />
abgest<strong>im</strong>mt ist.<br />
Den betreffenden Mitgliedern der Gütegemeinschaft<br />
von Auftraggeber-Seite<br />
steht ein Muster der individuellen Eigenüberwachungsunterlagen<br />
für die Dauer<br />
der Sanierungsmaßnahme über den Passwort-geschützten<br />
Bereich unter www.kanalbau.com<br />
zur Verfügung.<br />
Checklisten und Protokolle<br />
Ein Leitfaden gibt den Umfang der Eigenüberwachung<br />
vor. In diesem Rahmen werden<br />
für alle Beurteilungsgruppen die maßgeblichen<br />
Parameter überprüft und deren<br />
Einhaltung dokumentiert. Dementsprechend<br />
sind die Leitfäden für die Eigenüberwachung<br />
aufgebaut. Neben Hinweisen<br />
und Erläuterungen enthalten diese<br />
neugestaltete und aktualisierte Checklisten<br />
und Protokolle als Muster zur Dokumentation.<br />
Zusätzlich enthalten die Leitfäden<br />
Auszüge aus DIN-EN Normen und<br />
DWA-Regelwerk mit den entsprechenden<br />
Vorgaben in Bezug auf die Eigenüberwachung.<br />
Der Leitfaden für die Beurteilungsgruppe<br />
Offener Kanalbau beispielsweise<br />
enthält unter anderem Muster zur Dokumentation<br />
der Projektdaten, Angaben zur<br />
Bauausführung, Nachunternehmer, Lastannahmen,<br />
Höhen, Längen, Gefälle sowie<br />
zum Thema Verdichtungsnachweis.<br />
BILD: Innen und außen neu gestaltet: Eine Hilfe zur Dokumentation der Eigenüberwachung<br />
bietet die Gütegemeinschaft in Form der Leitfäden an<br />
Foto: Güteschutz Kanalba<br />
Überprüfung Qualifikation und<br />
Eigenüberwachung<br />
In unregelmäßigen Abständen erfolgen<br />
unangemeldete Überprüfungen des Fortbestehens<br />
der Qualifikation, der Dokumentation<br />
der Eigenüberwachung und der<br />
Erfüllung der sonstigen Anforderungen der<br />
beurkundeten Beurteilungsgruppe.<br />
Be<strong>im</strong> Firmenbesuch prüft und bewertet<br />
ein vom Güteausschuss beauftragter Prüfingenieur<br />
oder eine vom Güteausschuss<br />
beauftragte Prüfstelle stichprobenweise<br />
die Einhaltung und Dokumentation der<br />
796 11 / 2011
der jeweiligen Beurteilungsgruppe zugehörigen Anforderungen,<br />
einschließlich der Dokumentation der Eigenüberwachung<br />
und der Meldungen der Baustellen. Die Unterlagen werden auf<br />
Vollständigkeit geprüft und bewertet.<br />
Auch be<strong>im</strong> Baustellenbesuch prüft und bewertet ein vom<br />
Güteausschuss beauftragter Prüfingenieur oder eine beauftragte<br />
Prüfstelle stichprobenweise die Einhaltung und Dokumentation<br />
der zugehörigen Anforderungen, einschließlich der<br />
Dokumentation der Eigenüberwachung. Die Unterlagen werden<br />
auf Vollständigkeit geprüft und bewertet.<br />
Werden Mängel festgestellt, können durch den Güteausschuss<br />
Ahndungen gemäß Durchführungsbest<strong>im</strong>mungen vorgeschlagen<br />
werden.<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und<br />
Verfahren <strong>im</strong> Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der<br />
Abwasserentsorgung, der Nah- und Fernwärmeversorgung,<br />
des Anlagenbaus und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Prüfungen<br />
Die Prüfung der vom Gütezeicheninhaber durchgeführten Eigenüberwachung<br />
stellt höchste Anforderungen an die Organisation<br />
und die Personen, die mit dieser Aufgabe betraut sind.<br />
Deshalb werden die Prüfungen ausschließlich durch vom Güteausschuss<br />
beauftragte Prüfingenieure durchgeführt. Sie verfügen<br />
über jahrelange Praxis und hohes Fachwissen sowie über<br />
die notwendige Neutralität und Unabhängigkeit.<br />
Kommunikation statt Formalismus<br />
Das Fachgremium Güteausschuss und die Tätigkeit der Prüfingenieure<br />
stellen sicher, dass nicht Formalismus, sondern Fachkompetenz<br />
und intensive Kommunikation Grundlage der Gütesicherung<br />
sind. Das findet Zust<strong>im</strong>mung bei Auftraggebern<br />
und Auftragnehmern. Die Vorteile der Zugehörigkeit zur Gütegemeinschaft<br />
sind keineswegs nur graue Theorie. Das mit<br />
dem Gütezeichen transportierte Selbstverständnis der Mitglieder<br />
findet in einer Reihe von Folgemaßnahmen seinen Ausdruck.<br />
Nach Beantragung eines Gütezeichens intensivieren die<br />
Unternehmen die Eigenüberwachung; viele haben zusätzlich<br />
ein betriebliches Qualitätsmanagementsystem eingerichtet.<br />
Kein zusätzlicher Aufwand<br />
Die Handhabung der Leitfäden stellt keinen zusätzlichen<br />
Aufwand für die Gütezeicheninhaber dar, sondern soll vielmehr<br />
die Umsetzung der Forderungen in den Regelwerken<br />
systematisieren und vereinfachen. Die in den Leitfäden enthaltenen<br />
Checklisten und Protokolle entsprechen den Mindestanforderungen,<br />
die durch die Regelwerke in Bezug auf<br />
die Eigenüberwachung vorgegeben sind. Ihre Form wurde so<br />
opt<strong>im</strong>iert, dass das Ausfüllen einfach und schnell zu erledigen<br />
ist. Eine systematische Dokumentation kann insbesondere<br />
bei Mängelanzeigen sehr hilfreich sein. Mit vollständigen<br />
Angaben kann ein Unternehmen nachvollziehbar dokumentieren,<br />
dass die erforderlichen Arbeitsschritte auf der Baustelle<br />
durchgeführt wurden bzw. die maßgeblichen Parameter<br />
eingehalten wurden.<br />
Die überarbeiteten Leitfäden stehen ab Dezember 2011<br />
unter www.kanalbau.com zur Verfügung. Eine digital nutzbare<br />
Version ist in Vorbereitung.<br />
Kontakt: RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau,<br />
Bad Honnef, Tel. +49 2224 9384-0,<br />
E-Mail: info@kanalbau.com, www.kanalbau.com<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie <strong>im</strong> Online-Shop unter<br />
www.3r-international.de<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-international.de<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
11 / 2011 797
Verbände & Organisationen / Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
Wirtschaftsverband für Industrieservice legt<br />
Branchenmonitor 2011 vor<br />
In der Wirtschaft ist Outsourcing „in“. Immer<br />
mehr Unternehmen suchen sich qualifizierte<br />
Partner für eine effiziente Arbeitsteilung.<br />
Die <strong>im</strong> Industrieservice tätigen Unternehmen<br />
rechnen auf Jahre hinaus mit<br />
wachsenden Auftragsvolumina von 7 bis<br />
8 % allein in Deutschland. Auf internationaler<br />
Ebene winken sogar zweistellige Zuwachsraten,<br />
berichtet der Wirtschaftsverband<br />
für Industrieservice (WVIS) in seinem<br />
aktuellen „Branchenmonitor“ für 2011.<br />
Der WVIS repräsentiert 18 industrielle<br />
Dienstleister mit 8,2 Mrd. Euro Umsatz<br />
und über 90.000 Beschäftigten und damit<br />
etwa ein Drittel des deutschen Marktes.<br />
Europaweit bewerten die Experten für den<br />
Industrieservice das Marktvolumen von<br />
rund 100 Mrd. Euro.<br />
Das Aufgaben-Spektrum <strong>im</strong> Industrieservice<br />
ist dabei breit gefächert. In der<br />
chemischen und in der Mineralölindustrie<br />
ist dem Branchenmonitor zufolge bereits<br />
jeder fünfte Arbeitsplatz an einen Dienstleister<br />
ausgegliedert. Zu den stark auf die<br />
Arbeitsteilung setzenden Unternehmen<br />
zählen auch Konzerne der Kraftwerks-,<br />
Energie- und Umwelttechnik sowie die<br />
Automobilindustrie.<br />
Zum großen Teil verdienen die Industriedienstleister<br />
ihr Geld in der Wartung<br />
und Instandhaltung von Großanlagen.<br />
Die WVIS-Mitgliedsunternehmen erzielen<br />
laut Branchenmonitor fast 45 % ihres<br />
Umsatzes in diesem Bereich. Nächstfolgender<br />
Schwerpunkt sind Aufgaben in<br />
der Technischen Reinigung, gefolgt von<br />
Montage und Installation. Industrieservice<br />
wird aber auch in völlig anderen Bereichen<br />
geleistet – etwa bei der Beratung<br />
und Planung, <strong>im</strong> Engineering, der Qualitätssicherung<br />
oder mit Personaldienstleistungen.<br />
DVGW entwickelt sicherheitsrelevantes<br />
Berichtswesen für Gasversorgung weiter<br />
Der DVGW Deutscher Verein des Gasund<br />
Wasserfaches strukturiert sein seit<br />
30 Jahren bewährtes Instrument der<br />
Bestands- und Ereignisdatenerfassung<br />
Gas neu. Ziel des neutralen und unabhängigen<br />
Monitorings ist es, Systematiken<br />
und Trends bei der Schaden- und<br />
Unfallentwicklung zukünftig noch umfassender<br />
erkennen und bewerten zu<br />
können. Der DVGW stellte das weiterentwickelte<br />
Datenmeldesystem auf der<br />
gat 2011 in Hamburg erstmals der breiten<br />
Fachöffentlichkeit vor.<br />
Als Folge der neuen energierechtlichen<br />
Rahmenbedingungen erweitern<br />
Versorgungsunternehmen ihren Anlagenbestand<br />
fortlaufend um neue Anlagentypen<br />
wie z.B. Biogaseinspeiseanlagen<br />
oder Erdgastankstellen.<br />
Vor diesem Hintergrund sind belastbare<br />
und repräsentative Bestands- und<br />
Ereignisdaten der Gas- und Wasserinfrastrukturen<br />
eine unerlässliche Voraussetzung,<br />
um technische Regeln nachhaltig<br />
zu setzen. Speziell für die Gasversorgung<br />
muss der DVGW über Schaden-<br />
und Unfallereignisse <strong>im</strong> Dialog mit den<br />
Behörden auskunftsfähig sein.<br />
Der DVGW hat hierzu die Technische<br />
Regel G 410 „Bestands- und Ereignisdatenerfassung<br />
Gas“ heraus gegeben.<br />
Sie liegt seit Juli 2011 <strong>im</strong> Entwurf<br />
vor und umfasst folgende Datenerfassungskriterien:<br />
Bestandsdaten für Gasleitungen,<br />
Hausanschlüsse und gastechnische<br />
Anlagen<br />
Ereignisdaten für Gasleitungen,<br />
Hausanschlüsse, gastechnische<br />
Anlagen und Kundenanlagen der<br />
häuslichen und gewerblichen Gasanwendung<br />
Gasgeruchsmeldungen<br />
Meldungen zu Versorgungsunterbrechungen<br />
nach EnWG<br />
Ein gemeinsamer und einheitlicher Datenpool<br />
bildet die Grundlage für den<br />
zyklischen DVGW-Ereignisbericht, der<br />
über sicherheitsrelevante Trends in der<br />
Gasbranche informiert. Alle Betreiber<br />
von gastechnischen Energieanlagen <strong>im</strong><br />
Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes<br />
(EnWG) müssen ihre Bestandsdaten<br />
<strong>im</strong> jährlichen Turnus an den DVGW<br />
melden.<br />
Der DVGW behandelt diese Daten<br />
vertraulich. Aus den gemeldeten Daten<br />
erstellt und veröffentlicht der Verein<br />
einen standardisierten Bericht. Dieser<br />
enthält Aussagen über die Entwicklung<br />
zum Leitungs- und Anlagenbestand und<br />
zu Trends sicherheitstechnischer Kennzahlen.<br />
Der DVGW stellt seinen Mitgliedern<br />
ein Werkzeug bzw. eine Schnittstelle<br />
zur Datenerfassung, -übermittlung<br />
und -speicherung zur Verfügung und<br />
erleichtert damit nachhaltig den Übermittlungsprozess.<br />
Die Dateneingabe erfolgt<br />
über eine Web-Applikation. Eine<br />
weitere Möglichkeit besteht darin, die<br />
Daten aus bestehenden Datenbanksystemen<br />
direkt an eine vom DVGW definierte<br />
SOAP-Schnittstelle per Webservice<br />
zu übertragen.<br />
Kontakt: DVGW, Bonn, Daniel<br />
Wosnitzka, Tel. +49 30 794736-64,<br />
www.wvgw.de<br />
800 11 / 2011
Goldmedaille für das FITR<br />
Am 29.10.2011 wurde die FITR – Forschungsinstitut<br />
für Tief- und Rohrleitungsbau<br />
gemeinnützige GmbH mit<br />
einer Goldmedaille für das Exponat<br />
„Thermpipe“ ausgezeichnet. Das prämierte<br />
Exponat hat in einem Schutzrecht<br />
aus dem Jahr 2007 des Forschungsinstitutes<br />
durch die Erfinder Dr.-Ing. Wolfgang<br />
Berger, M. Eng. Matthias C. Dworrak<br />
und Dipl.-Ing. (FH) Hartmut Solas<br />
seinen Ursprung. Die Idee wurde gemeinsam<br />
u. a. mit der Frank & Krah Wickelrohr<br />
GmbH in einem vom Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Technologie<br />
geförderten Projekt zur Anwendungsreife<br />
entwickelt.<br />
Mit dem entwickelten Rohrsystem<br />
„Thermpipe“ kann Wärme aus dem System<br />
Boden – Kanal, d. h. zum einen aus<br />
dem <strong>im</strong> Inneren des Rohres fließenden<br />
Abwassers und der dort befindlichen<br />
Luft und zum anderen<br />
aus dem das als Abwasserrohr<br />
verlegte Rohr umgebenden<br />
Boden, zurückgewonnen werden.<br />
Im Rahmen dieses Projektes wurde<br />
in Zusammenarbeit mit der Stadt We<strong>im</strong>ar<br />
und seinen Stadtwerken ein Pilotprojekt<br />
durchgeführt, welches zum Ziel hat, die<br />
Warmwasserbereitung und die Heizung<br />
für das dortige W<strong>im</strong>aria Stadion durch die<br />
Abwasserwärme eines in der Nähe befindlichen<br />
Abwasserkanals DN 500 aus<br />
dem Neubaugebiet We<strong>im</strong>ar West zu unterstützen.<br />
Das Abwasseraufkommen<br />
beträgt bei einer Temperatur von 14 –<br />
19 °C ca. 10 l/s. Es können 0,5 kW/m<br />
Wärmeenergie entnommen werden. Zur<br />
Nutzung der Energie wurde eine Wärmepumpe<br />
Typ alpainnoTec SWP 270 H<br />
(Sole/Wasser)<br />
mit einer<br />
Heizleistung<br />
von bis<br />
zu 27 kW, zwei<br />
Multifunktionsspeicher<br />
und ein Trennpufferspeicher<br />
sowie diverse Messtechnik eingebaut.<br />
Mit der Durchführung dieses Pilotprojekts<br />
waren die Beteiligten Vorreiter<br />
für die Anwendung dieses neuen Systems<br />
der Abwasserwärmenutzung. Gleichzeitig<br />
stellt dieses Projekt eine gelungene<br />
Symbiose zwischen Kommune und der<br />
ansässigen FITR – Forschungsinstitut für<br />
Tief- und Rohrleitungsbau gemeinnützige<br />
GmbH für eine nachhaltige Forschung<br />
dar. Die Anlage wurde am 11.05.2011 an<br />
die Stadt We<strong>im</strong>ar übergeben.<br />
Gesicherte Qualität durch RAL-Gütezeichen<br />
Gebäude- und Grundstücksentwässerung<br />
Die Anforderungen an die Qualifikation von Fachbetrieben und<br />
die Best<strong>im</strong>mungen zur Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen<br />
und -kanäle bilden den Schwerpunkt der Tagung „Gebäude-<br />
und Grundstücksentwässerung“, zu der die Deutsche<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.<br />
(DWA) gemeinsam mit dem Zentralverband Sanitär, Heizung,<br />
Kl<strong>im</strong>a (ZVSHK) Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft und<br />
Kommunen einlädt.<br />
Die Veranstaltung am 16. und 17. Januar 2012 <strong>im</strong> Kongressund<br />
Kulturzentrum Fulda stellt die neue RAL-Gütegemeinschaft<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung e. V. vor und erläutert<br />
die Vorteile der Gütesicherung für Fachbetriebe. Außerdem bietet<br />
sie ein Forum für den fachlichen Austausch.<br />
Unter dem Dach des Güteschutzes Grundstücksentwässerung<br />
entstehen Gütezeichen, mit denen – bei entsprechendem<br />
Nachweis – die Qualität der Arbeit von Firmen in verschiedenen<br />
Ausführungsbereichen bescheinigt werden kann.<br />
Parallel zur Veranstaltung können Tagungsbesucher eine<br />
begleitende Fachausstellung besuchen, auf der sich Unternehmen<br />
mit ihren Produkten, Dienstleistungen und neuen Verfahren<br />
präsentieren.<br />
6. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 13. Juni 2012<br />
in Gelsenkirchen<br />
Veranstaltet von:<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Kontakt: DWA, Hennef, Sarah He<strong>im</strong>ann,<br />
Tel. +49 2242 872-192, E-Mail: he<strong>im</strong>ann@dwa.de<br />
11 / 2011 801
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
7. Pipeline Conference<br />
Sicherheit von Pipelinesystemen<br />
Europas führende Pipeline Technologie<br />
Konferenz jährt sich 2012 zum 7. Mal.<br />
Ein Schwerpunkt der vom EITEP – Euro<br />
Institute for Information and Technology<br />
Transfer in Environmental Protection<br />
ausgerichteten Konferenz mit begleitender<br />
Ausstellung wird die technologische<br />
Sicherheit von Pipelinesystemen sein.<br />
Europäische Ingenieure und Entwickler<br />
haben langjährige Erfahrung mit<br />
Rohrleitungen – so sind viele Rohrsysteme<br />
bereits seit über 50 Jahren in Betrieb<br />
und transportieren zuverlässig Gas,<br />
Öl, Wasser oder andere Stoffe. In dieser<br />
Zeit sind die Netze europaweit stetig<br />
angewachsen und damit auch die Erfahrung<br />
<strong>im</strong> Umgang mit Rohrleitungen.<br />
Deutsche Unternehmen sind führend in<br />
Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung<br />
und -setzung von Pipelines. Das hat<br />
dazu geführt, dass trotz Vervielfachung<br />
der Netzlänge die Zahl der Zwischenfälle<br />
an Rohrleitungen zurückgegangen ist. Die<br />
Basissicherheit von Pipelinesystemen hat<br />
hier einen wichtigen Beitrag dazu geleistet.<br />
Dennoch treten allein am europaweiten<br />
Pipelinenetz jährlich noch über 2.000<br />
Schäden auf – es ist also noch einiges zu<br />
tun, um die Verfügbarkeit und Sicherheit<br />
weiter zu steigern. Neben dem so genannten<br />
3 rd -Party-Impact, also Schäden,<br />
die auf Dritte zurückzuführen sind, wie<br />
Bauarbeiten oder Arbeiten in der Landwirtschaft,<br />
sind es auch Konstruktionsfehler<br />
und Korrosion, die zu Rohrleitungsschäden<br />
führen.<br />
Die internationale Konferenz mit über<br />
50 % Teilnehmern aus dem Ausland bietet<br />
auch 2012 wieder hochkarätige Experten<br />
aus der Öl-, Gas- und Wasserwirtschaft,<br />
die über aktuelle Schlüsselprojekte und<br />
<strong>Entwicklungen</strong> auf dem Markt berichten<br />
sowie neue Technologien vorstellen.<br />
Betreiber, Planer, Bauunternehmer, Produzenten,<br />
Dienstleister, Behörden und<br />
Ministerien können sich hier offen über<br />
zukunftsweisende Sicherheits-, Modernisierungs-<br />
und Erweiterungsstrategien<br />
informieren. Auf der Konferenz und der<br />
begleitenden Ausstellung haben die Teilnehmer<br />
die Möglichkeit, sich mit Kollegen<br />
über ihre Arbeitsweisen und Erfahrungen<br />
auszutauschen.<br />
Weitere Schwerpunkte der 7. Pipeline<br />
Technology Conference werden die<br />
Sicherstellung der Versorgung und Energieeffizienz<br />
sein, der Umweltschutz bei<br />
Bau und Betrieb sowie die so genannte<br />
„Cyber Security“, also die Gefährdung von<br />
Steuerungssystemen durch gezielte Angriffe<br />
in Computernetzwerken.<br />
Die 7. Pipeline Technology Conference<br />
findet vom 28. bis zum 30. März<br />
2012 <strong>im</strong> Hannover Congress Centrum<br />
statt. Das detaillierte Programm für die<br />
7. Pipeline Technology Conference wird<br />
<strong>im</strong> Januar 2012 vorliegen.<br />
Kontakt: EITEP – Euro Institute for<br />
Information and Technology Transfer in<br />
Environmental Protection GmbH,<br />
Hannover, Dennis Fandrich, Tel. +49 511<br />
90992-22, E-Mail: fandrich@eitep.de<br />
10. Tiefbau-Forum in Neu-Ulm<br />
Am 26. Januar 2012 laden die Unternehmen<br />
IBA, Muffenrohr, Raab<br />
Karcher und Schulte Tiefbauhandel<br />
die Branche zum 10. Tiefbau-Forum<br />
nach Neu-Ulm in das Edwin-Scharff-<br />
Haus ein. Durch die gelungene Kombination<br />
aus 33 Expertenvorträgen<br />
mit Praxisbezug und einer begleitenden<br />
Fachmesse mit rund 60 Ausstellern<br />
ist das Tiefbau-Forum traditioneller<br />
Branchentreff zum Jahresbeginn.<br />
Die Veranstalter erwarten über<br />
1.500 Teilnehmer aus allen Bereichen<br />
– Wasserversorgungsunternehmen<br />
und -verbände, Stadtwerke,<br />
Rohrleitungsbauer, Planer, Ingenieurbüros,<br />
Kommunen sowie kommunale<br />
Unternehmen.<br />
2012 stehen folgende Themen<br />
besonders <strong>im</strong> Fokus:<br />
Öffentliche Ausschreibungen von<br />
Rahmenverträgen <strong>im</strong> Tiefbau einschließlich<br />
Praxisbeispielen<br />
Zentrale Enthärtung von Trinkwasser:<br />
Grundlagen, Nutzen, Kosten,<br />
Beispiele<br />
Geothermienutzung mit der<br />
HELIX-Sonde – wirtschaftlich und<br />
umweltverträglich<br />
Kontakt: Saint-Gobain Building<br />
Distribution Deutschland GmbH,<br />
Frankfurt am Main, Kathrin Will,<br />
Tel. +49 69 40505-324, E-Mail:<br />
kathrin.will@saint-gobain.com<br />
Das 10.Tiefbau-Forum <strong>im</strong> Neu-Ulmer Edwin-<br />
Scharff-Haus ist der traditionelle Branchentreff<br />
zum Jahresbeginn 2012<br />
Foto: Saint-Gobain Building Distribution<br />
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main<br />
802 11 / 2011
Duktile Gussrohre grabenlos verlegen<br />
Zum Thema „Das duktile Gussrohr – grabenlos<br />
verlegt“ hatte die Firma Duktus Ende<br />
September diesen Jahres interessierte<br />
Kunden zu einer zweitägigen Info-Veranstaltung<br />
eingeladen. Ziel war es, die grabenlosen<br />
Einbautechniken für Gussrohre<br />
<strong>im</strong> HDD-, Berstlining-, Relining- und<br />
Pflugverfahren den 80 Vertretern aus<br />
Kommunen, Planungs- und Bauunternehmen<br />
näher zu bringen.<br />
An den praktischen Vorführungen <strong>im</strong><br />
Testgelände der Tracto-Technik konnten<br />
die Teilnehmer sehen, wie ein Stahlrohr<br />
mit einem Rollenmesser aufgeschnitten<br />
und das duktile Gussrohr mit der Berstlininganlage<br />
GRUNDOBURST eingezogen<br />
wurde. Die Gäste zeigten sich auch von<br />
der Vorführung des HDD-Spülbohrverfahrens<br />
beeindruckt. In beiden Fällen kamen<br />
ZMU-Rohre und BLS/VRS-T-Verbindungen<br />
zum Einsatz. Eine Vorführung der GRUN-<br />
Die Demonstrationsstrecke<br />
<strong>im</strong> Testgelände<br />
zeigt, wie das<br />
Altrohr aus<br />
Stahl mit dem<br />
Rollenmesser<br />
aufgeschnitten,<br />
aufgeweitet und<br />
gleichzeitig das<br />
neue duktile<br />
Gussrohr mit der<br />
GRUNDOBURST-<br />
Lafette eingezogen<br />
wird<br />
DOMAT-Erdrakete und der gesteuerten<br />
GRUNDOPIT-Keyholetechnik rundeten das<br />
Programm ab. Am nächsten Tag stand unter<br />
anderem eine Werkbesichtigung bei Duktus<br />
an. Insgesamt zogen die Gäste wie auch die<br />
beteiligten Unternehmen ein positives Resümee<br />
dieser Veranstaltungsreihe, die <strong>im</strong><br />
nächsten Jahr fortgesetzt werden soll.<br />
WISSEN für die ZUKUNFT<br />
ROHRLEITUNGSERNEUERUNG<br />
MIT BERSTVERFAHREN<br />
Die grabenlose Erneuerung von Rohrleitungen hat in den letzten zwanzig Jahren enorme Fortschritte gemacht.<br />
Besondere Aufmerksamkeit hat das Berstverfahren aufgrund seiner wirtschaftlichen und technischen Effi zienz erfahren.<br />
Die zweite, überarbeitete Aufl age führt in die Technik der Erneuerung von Rohrleitungen der Ver- und Entsorgung durch<br />
Bersten ein, stellt die relevanten Regelwerke dar und gibt umfangreiche Praxisbeispiele und Hilfestellungen<br />
für Ausschreibende, Planer und Ausführende.<br />
Mit Musterausschreibungstexten, Musterformularen, technischen Regeln, Literaturhinweisen.<br />
Hrsg.: M. Rameil<br />
2. Aufl age 2010, 376 Seiten inkl. DVD, Broschur<br />
Gleich anfordern – per Post oder per Fax: +49 / 201 / 820 02-34<br />
inkl. DVD mit<br />
ergänzenden Inhalten<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung<br />
3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex. Rohrleitungserneuerung mit Berstverfahren + DVD<br />
2. Aufl age 2010 – ISBN: 978-3-8027-2765-8<br />
für € 68,- (zzgl. Versand)<br />
Die bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird<br />
mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
E-Mail<br />
Branche/Tätigkeitsbereich<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder<br />
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die<br />
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Kontonummer<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten<br />
erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder<br />
11 / 2011<br />
✘<br />
vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben<br />
803<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
Datum, Unterschrift<br />
Bank, Ort<br />
PAREB22010
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
Betriebssicherheit von Anlagen in der<br />
Chemischen Industrie<br />
Das Spannunungsfeld zwischen Technik, Recht und<br />
Gesellschaft und in diesem Zusammenhang die Bedeutung<br />
des Wortes „Restrisiko“ verdeutlichte Prof.<br />
Dr. Markus Braunewell in seinem Vortrag<br />
Über 120 Gäste versammelten sich am 21.<br />
September be<strong>im</strong> Expertentreff der Kunststoff-Rohrleitungsbranche<br />
in der Stadthalle<br />
Neuss. Gastgeber und Ausrichter<br />
ThyssenKrupp Plastics bot auf der zweiten<br />
Veranstaltung dieser Art ein Forum für<br />
Diskussionen rund um sicherheitsrelevante<br />
Aspekte der Planung, Montage und Betriebssicherheit<br />
von Industrieanlagen mit<br />
dem Schwerpunkt Prozesstechnik.<br />
Das breit gefächerte Referentenprogramm<br />
reichte von Risiken <strong>im</strong> internationalen<br />
Großanlagenbau über Schweiß- und<br />
Anwendungsverfahren bis zur Kalkulierbarkeit<br />
von Begleit- und Folgeschäden bei Betriebsunfällen.<br />
Einen aktuellen Bezug setzte<br />
dabei Thomas Schuer, Marketing-<br />
Referent der Röchling Engineering<br />
Plastics, mit seinem Vortrag über<br />
Chemiebehälter in tektonisch unsicheren<br />
Regionen. So sei ein Erdbebennachweis<br />
auch in Deutschland<br />
entgegen anderslautenden Branchenmeinungen<br />
ein nicht zu vernachlässigendes<br />
Thema. Dipl.-Ing.<br />
Harald Huberth, Geschäftsführer<br />
des Kunststoff-Zentrums SKZ,<br />
zeigte auf, dass vermeidbare Fehler<br />
oft schon vor der Auftragsvergabe<br />
gemacht würden und betonte die<br />
Wichtigkeit der Mitarbeiterqualifizierung.<br />
Die Branche sei <strong>im</strong> Allgemeinen<br />
für neue Herausforderungen<br />
gut gerüstet, gab Klaus Gottwald<br />
von der VDMA Arbeitsgemeinschaft<br />
Großanlagenbau einen<br />
opt<strong>im</strong>istischen Ausblick, betonte<br />
aber die Wichtigkeit des Risikomanagements.<br />
Daran knüpften auch<br />
die Überlegungen zum Spannungsfeld<br />
zwischen Technik, Recht und<br />
Gesellschaft von Prof. Dr. Markus<br />
Braunewell, dessen Vortrag ebenfalls<br />
auf großes Echo bei den Gästen<br />
stieß.<br />
„Wir möchten hier ein Podium bieten,<br />
Marktentwicklungen aufzuzeigen und mit<br />
unseren Gästen zu diskutieren“, erklärte<br />
ThyssenKrupp Plastics Geschäftsführer<br />
Falk Majert das Konzept der Veranstaltung.<br />
„Wir möchten Wissen vermitteln, Trends<br />
aufzeigen und Interessen verbinden.“<br />
Begleitend zur Veranstaltung präsentierte<br />
ThyssenKrupp Plastics zusammen<br />
mit den genannten Partnern FRANK, Georg<br />
Fischer, Röchling Engineering, dem VDMA<br />
und SKZ Anwendungskonzepte für Produkte<br />
und Systeme, wie Klebetechnik und<br />
Kunststoffschweißmaschinen. Auch diese<br />
Zubehörsysteme gehören zum Lieferportfolio<br />
von ThyssenKrupp Plastics.<br />
Die ThyssenKrupp Plastics GmbH mit<br />
Sitz in Essen ist ein deutschlandweit flächendeckender<br />
Dienstleister für Produktund<br />
Anwendungsberatung, Anarbeitung,<br />
Beschaffung und Lieferung. Das Portfolio<br />
von über 40.000 Kunststoff-Produkten<br />
und Marken stammt ausschließlich von<br />
namhaften, international tätigen Produzenten,<br />
die in den jeweiligen Produktbereichen<br />
zu den Technologie- und Marktführern<br />
zählen. Das Verkaufsprogramm orientiert<br />
sich an den spezifischen Anforderungen<br />
der Kunden in den Bereichen Baumarkt<br />
und Baufachhandel, Hochbau, Kunststoff-<br />
Rohrleitungssysteme, Technische Kunststoffe<br />
und Visuelle Kommunikation.<br />
Kontakt: ThyssenKrupp Business<br />
Services GmbH, Essen, Peter Diekmann,<br />
Tel. +49 201 844-539451, E-Mail:<br />
peter.diekmann@thyssenkrupp.com,<br />
www.thyssenkrupp-plastics.de<br />
9. DWA-Kanalbautage 2012<br />
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)<br />
ruft Wissenschaftler und Ingenieure auf,<br />
innovative Projekte und gelungene Beispiele<br />
aus der Praxis des Kanalbaus am 6.<br />
November 2012 auf den 9. Kanalbautagen<br />
in Neuss vorzustellen. Willkommen<br />
sind nicht kommerzielle Vorträge zu folgenden<br />
Themen:<br />
Neuentwicklungen und Erfahrungen <strong>im</strong><br />
Kanal- und Leitungsbau<br />
Betriebsopt<strong>im</strong>ierte Planung und ressourcenschonende<br />
Ausführung von<br />
Bauprojekten<br />
Umbaumaßnahmen zur Entkoppelung<br />
von Regen- und Schmutzwasser<br />
Die Beiträge sollten nicht mehr als 25<br />
Minuten umfassen. Für die anschließende<br />
Diskussion sind 5 Minuten eingeplant.<br />
Vortragssprache ist deutsch. Aussagekräftige<br />
Kurzfassungen der geplanten<br />
Beiträge von max<strong>im</strong>al einer Seite können<br />
bis zum 31. Dezember 2011 eingereicht<br />
werden.<br />
Kontakt: DWA, Hennef, Renate<br />
Teichmann, Tel. +49 2242 872118,<br />
E-Mail: teichmann@dwa.de<br />
804 11 / 2011
FBS-Mitgliederversammlung in Frankfurt<br />
Am 19. Oktober fand in Frankfurt am<br />
Main die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung<br />
der FBS – Fachvereinigung<br />
Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.<br />
statt. Neben den Berichten von Vorstand<br />
und Geschäftsführung sowie den Berichten<br />
über die Arbeit <strong>im</strong> Technischen Ausschuss<br />
und <strong>im</strong> Marketing Ausschuss stand<br />
die Entlastung des Vorstandes auf der Tagesordnung<br />
der Veranstaltung. Der Vorstand<br />
unter Vorsitz von Tanja Pöthmann,<br />
Geschäftsführerin der Harzer Betonwarenwerke<br />
Rolf Pöthmann Handels Ges.<br />
mbH, wurde dabei ebenso bestätigt, wie<br />
die Geschäftsführung und die Mitglieder<br />
der Ausschüsse.<br />
Eigenschaften überzeugen<br />
Auch bei der Diskussion über die aktuelle<br />
wirtschaftliche Situation herrschte Konsenz<br />
unter allen Beteiligten. Der Markt für<br />
Rohre und Schächte aus Beton und Stahlbeton<br />
ist trotz der schwierigen finanziellen<br />
Lage der Kommunen <strong>im</strong> Großen und<br />
Ganzen stabil geblieben. Die Betonrohrindustrie<br />
ist darüber hinaus zuversichtlich,<br />
dass sich ihre nachhaltigen und ökologischen<br />
Produkte <strong>im</strong> Vergleich zu den Substituten<br />
<strong>im</strong> Kanalbau langfristig durchsetzen<br />
werden. Auch in anderen zukunftsträchtigen<br />
Marktsegmenten besitzt der<br />
Werkstoff Beton gute Karten – vor allem<br />
aufgrund seiner ökologischen Vorteile,<br />
zu denen neben einer hervorragenden<br />
Ökobilanz eine ressourcenschonende<br />
und nur mit geringen CO 2<br />
-Emissionen<br />
verbundene Herstellung mit niedrigem<br />
Energieeinsatz zählen. Stellvertretend für<br />
verstärkte zukünftige Aktivitäten führt<br />
FBS-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Wilhelm<br />
Niederehe den Bereich der Regenwasserbewirtschaftung<br />
an, der <strong>im</strong> Rahmen des<br />
Kl<strong>im</strong>awandels und aufgrund von zunehmenden<br />
Starkregenereignissen neue und<br />
vielfältige Anforderungen an Auftraggeber<br />
und Planer stellen wird. „Diese könnten<br />
zum Beispiel mit Stauraumkanälen<br />
aus Beton und Stahlbeton bestens erfüllt<br />
werden“, ist Niederehe überzeugt.<br />
Gemeinsam stark<br />
Mit einem deutlichen Appell an die kommunalen<br />
Auftraggeber untermauert die<br />
FBS die Lobbyarbeit „pro Kanalbau“: So<br />
sollte – <strong>im</strong> Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung<br />
von Leitungsnetzen – eine<br />
Kanalerneuerung Vorrang vor einer Reparatur<br />
haben. Ein Thema, für das sich die<br />
FBS und ihre Mitglieder bereits seit 25<br />
Jahren stark machen, zum Beispiel mit der<br />
gemeinsamen Entwicklung neuer Produkte.<br />
Mit Maßnahmen wie dieser will<br />
man die Marktposition der Betonrohrhersteller<br />
stärken. Im FBS-Vorstand ist man<br />
sich einig: Entscheidend für die weitere<br />
positive Entwicklung wird sein, dass sich<br />
die in der Regel mittelständischen und familiengeführten<br />
Mitgliedsunternehmen<br />
der FBS trotz der Wettbewerbssituation<br />
solidarisch für den Werkstoff Beton einsetzen,<br />
auch auf internationaler Ebene.<br />
Als wichtige Bausteine sind hier die Aktivitäten<br />
von Marketing Ausschuss und<br />
Technischem Ausschuss sowie die Arbeit<br />
der FBS-Fachberater zu nennen. Hinzu<br />
kommen neue Konzepte wie die Messeauftritte<br />
in den<br />
letzten beiden Jahren.<br />
Auf der Wasser<br />
Berlin und der IFAT<br />
in München präsentierte<br />
sich die FBS<br />
zusammen mit Mitgliedsunternehmen<br />
auf einem gemeinsamen<br />
Messestand.<br />
Die Kompetenzund<br />
Ressourcenbündelung<br />
unter<br />
dem übergeordneten<br />
Motto „Alles<br />
fließt natürlich<br />
durch Beton“ ist bei<br />
den Besuchern und<br />
bei den Beteiligten<br />
des Messestandes<br />
gleichermaßen<br />
gut angekommen.<br />
Dementsprechend<br />
ist die FBS auch auf<br />
der IFAT ENTSORGA<br />
2012 zusammen<br />
mit Mitgliedsfirmen<br />
auf einem repräsentativen<br />
Gemeinschaftsstand<br />
(Halle B5 7.-11.5.<br />
337/428) zu finden.<br />
WILHELM EWE GmbH & CO. KG<br />
FBS-Geschäftsführer Wilhelm Niederehe ist<br />
zuversichtlich, dass sich die nachhaltigen<br />
und ökologischen Produkte der Betonrohrindustrie<br />
<strong>im</strong> Vergleich zu den Substituten <strong>im</strong><br />
Kanalbau langfristig durchsetzen werden<br />
Foto: FBS<br />
EWE-Multi-Druck-<br />
Anbohrventil<br />
Telefon: 05 31 – 37 00 50<br />
www.ewe-armaturen.de<br />
für alle gängigen<br />
Schweißsysteme<br />
Neu überarbeitete<br />
Konstruktion,<br />
opt<strong>im</strong>ierter Durchfluss,<br />
korrosionssichere<br />
Werkstoffe,<br />
mit Bohrschneider aus<br />
A4-Duplex-Edelstahl,<br />
für Wasser und<br />
Gas geeignet<br />
11 / 2011 805
Fachbericht<br />
Normen & regelwerk<br />
NETZAUSBAU RELOADED:<br />
SCHNELLER, TEURER, WEITER<br />
Von RA Christian Fürst<br />
Bei der Betrachtung des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in der letzten Ausgabe der <strong>3R</strong> wurde der Themenbereich<br />
des Netzausbaus ausgeklammert, weil er inhaltlich enger zu einem weiteren Baustein der Energiewende<br />
passt, dem am 5. August 2011 in Kraft getretenen Artikelgesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus.<br />
Es enthält hauptsächlich das „Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz“ (NABEG), dessen Ziel es ist, die Voraussetzungen<br />
für einen schnelleren Ausbau der Stromübertragungsnetze zu schaffen, um so unter anderem die Versorgungssicherheit<br />
trotz des Atomausstiegs zu gewährleisten und eine schnellere Integration der regenerativen Energieerzeugung<br />
in die bestehende Stromlandschaft zu erzielen. Hierzu sollen die Planungs- und Genehmigungsverfahren für einzelne<br />
vordringliche länderübergreifende oder grenzüberschreitende Leitungsvorhaben beschleunigt werden.<br />
Es wäre allerdings zu kurz gesprungen, die Auswirkungen des NABEG ausschließlich <strong>im</strong> Elektrizitätsbereich zu suchen.<br />
Durch vielschichtige und aufeinander aufbauende Planungs- und Genehmigungsstufen <strong>im</strong> Zusammenspiel zwischen<br />
NABEG und EnWG bestehen auch Handlungsnotwendigkeiten für Fernleitungsnetzbetreiber <strong>im</strong> Gasbereich.<br />
Netzentwicklungsplanung (§§ 12a bis<br />
12d sowie § 15a EnWG)<br />
Zunächst wird außerhalb des NABEG in den §§ 12a bis 12d<br />
und 15a EnWG eine jährlich zu aktualisierende Netzentwicklungsplanung<br />
aller Netzbetreiber eingeführt, die den Zielen<br />
der Investitions- und Versorgungssicherheit Rechnung tragen<br />
soll. Sämtliche Übertragungsnetzbetreiber sind erstmalig<br />
zum 3. Juni 2012 und sämtliche Fernleitungsnetzbetreiber<br />
erstmalig zum 1. April 2012 verpflichtet, einen gemeinsamen<br />
nationalen Netzentwicklungsplan zu erarbeiten (§§ 12b und<br />
15a EnWG). Dieser muss alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten<br />
Opt<strong>im</strong>ierung, Verstärkung und zum bedarfsgerechten<br />
Ausbau der Netze enthalten, die in den nächsten<br />
zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb<br />
erforderlich sein werden.<br />
Grundlage des Netzentwicklungsplans sollen verschiedene<br />
Szenarien für die mittel- und langfristige Entwicklung der<br />
Netze sein. Im Gasbereich gehören hierzu Annahmen über die<br />
Entwicklung der Gewinnung, der Versorgung, des Verbrauchs,<br />
des grenzüberschreitenden Transports von Gas wie auch Aspekte<br />
der Versorgungssicherheit und die Entwicklung geplanter<br />
Investitionen in Netzinfrastrukturen (§ 15a Abs. 1 Satz 4<br />
EnWG). Im Elektrizitätsbereich umfasst der Szenariorahmen<br />
mindestens drei Szenarien, die für die nächsten zehn Jahre die<br />
Bandbreite wahrscheinlicher <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Rahmen der<br />
energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdecken; eines<br />
der Szenarien soll sogar die wahrscheinliche Entwicklung für<br />
die nächsten zwanzig (!) Jahre darstellen (§ 12 a Abs. 1 EnWG).<br />
Sowohl der Szenariorahmen als auch der Netzentwicklungsplan<br />
wird von den Netzbetreibern entworfen und durch<br />
806 11 / 2011
die Bundesnetzagentur (BNetzA) nach Konsultierung der Öffentlichkeit<br />
genehmigt bzw. bestätigt. Durch diese frühzeitige<br />
und umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit, einschließlich<br />
tatsächlicher oder potentieller Netznutzer, den nachgelagerten<br />
Netzbetreibern sowie den Trägern öffentlicher Belange<br />
und den Energieaufsichtsbehörden der Länder, wird ein<br />
bundeseinheitlich koordinierter Netzausbau ermöglicht und<br />
soll eine möglichst weitgehende Transparenz der Planung geschaffen<br />
sowie damit insgesamt die Akzeptanz planerischer<br />
Maßnahmen erreicht werden.<br />
Die BNetzA überwacht den Stand der Umsetzung des<br />
Netzentwicklungsplans und ergreift erforderlichenfalls Maßnahmen<br />
zu seiner Durchsetzung. Der jeweilige Betreiber von<br />
Transportnetzen muss die <strong>im</strong> Netzentwicklungsplan vorgesehenen<br />
Investitionen durchführen, es sei denn, zwingende von<br />
ihm nicht zu beeinflussende Gründe stehen entgegen. Wird eine<br />
Investition, die innerhalb von drei Jahren nach Eintritt der<br />
Verbindlichkeit des Plans durchgeführt werden musste, nicht<br />
durchgeführt, fordert die BNetzA den Netzbetreiber mit Fristsetzung<br />
dazu auf, sofern die Investition unter Zugrundelegung<br />
des jüngsten Netzentwicklungsplans noch relevant ist. Nach<br />
fruchtlosem Ablauf der Frist kann sie die Investition zur Vergabe<br />
an Dritte ausschreiben (§ 65 Abs. 2a EnWG).<br />
Bundesbedarfsplanung (§ 12e EnWG)<br />
Der Netzentwicklungsplan stellt <strong>im</strong> Elektrizitätsbereich die<br />
Grundlage für die Bundesbedarfsplanung nach § 12e En-<br />
WG dar. Deren Grundidee ist, dass durch ein förmliches Parlamentsgesetz<br />
der tatsächliche Bedarf für den Netzausbau<br />
verbindlich festgestellt wird. Die BNetzA übermittelt hierzu<br />
mindestens alle drei Jahre der Bundesregierung den Netzentwicklungsplan<br />
als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan;<br />
die Bundesregierung legt diesen dem Parlament vor, das ihn<br />
als Bedarfsplangesetz verabschiedet.<br />
Im Bundesbedarfsplan werden die bundesländerübergreifenden<br />
und grenzüberschreitenden Höchstspannungsleitungen<br />
sowie Anbindungsleitungen von Offshore-Windparks zu<br />
den Netzverknüpfungspunkten an Land gekennzeichnet. In<br />
ihm kann zudem vorgesehen werden, dass Pilotprojekte für<br />
eine verlustarme Übertragung hoher Leistungen über große<br />
Entfernungen auf Teilabschnitten als Erdkabel errichtet und<br />
betrieben werden können, wenn dies neben anderen Voraussetzungen<br />
technisch und wirtschaftlich effizient ist (§ 12e<br />
Abs. 3 i.V.m. § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3a EnWG). Der Vollständigkeit<br />
halber sei zusätzlich darauf verwiesen, dass durch den<br />
neu eingefügten § 43h EnWG auf der 110-kV-Ebene ohnehin<br />
die Erdverkabelung für neu zu errichtende Leitungen der<br />
Regelfall werden soll, wenn dies <strong>im</strong> Verhältnis zu alternativen<br />
Freileitungen kostentechnisch verhältnismäßig ist.<br />
Mit Erlass des Bundesbedarfsplans durch den Bundesgesetzgeber<br />
werden für die darin enthaltenen Leitungsvorhaben<br />
die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche<br />
Bedarf verbindlich festgestellt. Das „Ob“ eines <strong>im</strong> Bundesbedarfsplangesetz<br />
genannten Vorhabens kann damit <strong>im</strong> Rahmen<br />
des nachfolgenden Zulassungsverfahrens nicht mehr in<br />
Frage gestellt werden (§ 12e Abs. 4 EnWG).<br />
Bundesfachplanung (§§ 4 ff. NABEG)<br />
Während <strong>im</strong> Bundesbedarfsplangesetz die Notwendigkeit für<br />
den Bau best<strong>im</strong>mter Leitungen verbindlich festgestellt wird,<br />
soll das NABEG eine Vorhabenbeschleunigung bewirken. Dies<br />
wird erreicht durch Verlagerung der Planung und Genehmigung<br />
von Höchstspannungsleitungen mit europäischer oder überregionaler<br />
Bedeutung auf die Bundesebene: die nach geltendem<br />
Recht von den Ländern durchzuführenden Raumordnungs- und<br />
Planfeststellungsverfahren werden mit dem NABEG auf die<br />
Bundesebene verlagert und in einer Behörde konzentriert. Die<br />
Zuständigkeitsbündelung bei der BNetzA, die in diesen Bereichen<br />
bislang noch gar nicht tätig war, soll der gesamtstaatlichen<br />
Koordination der Vorhaben und der Effizienzsteigerung<br />
durch Vermeidung behördlicher Doppelprüfungen dienen. Die<br />
BNetzA soll für ihre neuen Aufgaben bis zu 240 neue Stellen<br />
bewilligt bekommen.<br />
Die BNetzA best<strong>im</strong>mt in der Bundesfachplanung Trassenkorridore<br />
(Gebietsstreifen, innerhalb derer die Trasse einer<br />
Stromleitung verläuft) von <strong>im</strong> Bundesbedarfsplan aufgeführten<br />
Höchstspannungsleitungen und prüft deren Übereinst<strong>im</strong>mung<br />
mit den Erfordernissen der Raumordnung und der strategischen<br />
Umweltprüfung unter Einschluss etwaiger ernsthaft<br />
in Betracht kommender Trassenalternativen (§ 5 NABEG). Für<br />
den Rahmen ihrer Untersuchungen hat sie eine so genannte<br />
Antragskonferenz mit Vorhabenträgern, betroffenen Trägern<br />
öffentlicher Belange und Vereinigungen durchzuführen (§ 7<br />
NABEG) sowie die Öffentlichkeit und andere Behörden frühzeitig<br />
zu beteiligen (§ 9 NABEG). In besonderen Ausnahmefällen,<br />
insbesondere bei Ausbaumaßnahmen in Trassen bereits bestehender<br />
Hoch- oder Höchstspannungsleitungen, kann ein vereinfachtes<br />
Verfahren ausreichend sein (§ 11 NABEG).<br />
Die Bundesfachplanung ist binnen sechs Monaten, <strong>im</strong> vereinfachten<br />
Verfahren innerhalb von drei bzw. vier Monaten,<br />
abzuschließen (§ 12 Abs. 1 NABEG). Die Entscheidung der<br />
BNetzA ist für das nachfolgende Planfeststellungsverfahren<br />
verbindlich, hat aber keine unmittelbare Außenwirkung (§ 15<br />
NABEG). Sie kann daher nicht von Projektgegnern behördlich<br />
oder gerichtlich angegriffen werden; lediglich jedes von der<br />
Entscheidung betroffene Bundesland ist berechtigt, innerhalb<br />
eines Monats Einwendungen zu erheben (§ 14 NABEG).<br />
Planfeststellungsverfahren (§§ 18 ff.<br />
NABEG)<br />
Aufbauend auf der Bundesfachplanung kann nunmehr auf der<br />
letzten Stufe ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt<br />
werden (§§ 18 ff. NABEG). Auf Kritik des Bundesrates an der<br />
zunächst vorgesehenen alleinigen Zuständigkeit der BNetzA<br />
auch für diese Stufe und der bestehenden Kompetenzen der<br />
Landesbehörden in diesem Bereich kann ein Planfeststellungsverfahren<br />
durch die BNetzA nur dann durchgeführt werden,<br />
wenn die entsprechende Trasse in einer Rechtsverordnung,<br />
welche der Zust<strong>im</strong>mung des Bundesrates bedarf, der Zuständigkeit<br />
der BNetzA explizit zugewiesen wird. Im Übrigen bleiben<br />
die Länder für die Durchführung des gesamten Planungsund<br />
Genehmigungsverfahrens zuständig (§ 31 Abs. 2 NABEG).<br />
Der Ablauf des bundeseinheitlichen Planfeststellungsverfahrens<br />
nach dem NABEG folgt den aus Planfeststellungsver-<br />
11 / 2011 807
Fachbericht<br />
Normen & regelwerk<br />
fahren allgemein bekannten Anforderungen: Antrag des Vorhabenträgers<br />
auf Planfeststellungsbeschluss, Durchführung<br />
einer Antragskonferenz durch die BNetzA zur Festlegung des<br />
Untersuchungsrahmens, Anhörung der Träger öffentlicher Belange<br />
und der Vereinigungen, ggf. vereinfachte Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
und abschließend Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses.<br />
Weitere Änderungen<br />
Weitere Änderungen durch das Gesetz über Maßnahmen zur<br />
Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze betreffen<br />
in seinen Artikeln 2 bis 6 das EnWG, das Bundesnaturschutzgesetz,<br />
die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)<br />
und die Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Nach diesen<br />
Änderungen besteht z.B. die Möglichkeit der Übertragungsnetzbetreiber,<br />
freiwillige Kompensationszahlungen an Städte<br />
oder Gemeinden, auf deren Gebiet eine Freileitung auf neuer<br />
Trasse errichtet wird, zu zahlen, um so die Akzeptanz von<br />
Vorhaben zu erhöhen. Anders als bei anderen Infrastrukturvorhaben<br />
wie Straßen oder Schienen hätten die Gebietskörperschaften<br />
entlang einer Stromtrasse keinen eigenen Nutzen<br />
von dem Infrastrukturprojekt, z.B. durch Verbesserung der<br />
örtlichen Infrastruktur durch Ausfahrten oder Haltepunkte.<br />
§ 5 Abs. 4 StromNEV und § 11 Abs. 2 lit. 8b ARegV gestatten<br />
in diesem Fall die einmalige Berücksichtigung dieser Zahlungen<br />
als Kosten bei der Best<strong>im</strong>mung der Netzkosten in Höhe<br />
von max. 40.000 Euro pro Kilometer Höchstspannungsfreileitung<br />
ab 380 kV. Diese Kosten gelten als dauerhaft nicht<br />
beeinflussbare Kostenanteile.<br />
Zwar ist grundsätzlich zu begrüßen, dass Vorhabenträgern<br />
eine Möglichkeit gegeben wird, mit Hilfe von Ausgleichszahlungen<br />
die Widerstände vor Ort gegen den Neubau von Freileitungen<br />
auf der Höchstspannungsebene zu verringern. Gleichzeitig<br />
liegt hierin eine strukturelle Änderung der Grundprinzipien<br />
des Entschädigungsrechts, die sich auch auf andere Vorhaben<br />
auf anderen Spannungsebenen der Stromnetze und sogar<br />
auf Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgungsnetze auswirken<br />
könnte. Dies ist faktisch und rechtlich bedenklich. Zum einen<br />
sind Entschädigungszahlungspflichten ohne Gegenleistung<br />
der Kommune finanzverfassungsrechtlich und unter Compliance-Kriterien<br />
kritisch zu betrachten. Zum anderen garantieren<br />
sie nicht, dass bei den betroffenen Bürgern und Bürgerinitiativen<br />
tatsächlich die erforderliche Akzeptanz geschaffen<br />
und die Verfahren damit erheblich beschleunigt werden können.<br />
Im Gegenteil ist zu befürchten, dass sogar ungewünschte<br />
Mitnahmeeffekte entstehen, die die Behandlung berechtigter<br />
Forderungen betroffener Grundstückseigentümer erschweren.<br />
Die Forderung nach Zahlungen, die über das geltende Entschädigungsrecht<br />
hinausgehen, wurde bereits vereinzelt erhoben.<br />
gen zum Netzausbau zu. Die EU-Richtlinie verlangt die Erstellung<br />
von Netzentwicklungsplänen nur für nach dem ITO-Modell<br />
entflochtene Unternehmen. Durch diese Verschärfung wird<br />
der Druck auf einen transparenteren und schnelleren Bau von<br />
dringend notwendigen Leitungen in Deutschland in besonderem<br />
Maße erhöht. Gerade <strong>im</strong> Elektrizitätsbereich ist mit der Konzentration<br />
einiger Verfahrensbestandteile bei einer Bundesbehörde<br />
und mit der Privilegierung best<strong>im</strong>mter Vorhaben eine<br />
durchaus beschleunigte Verbindung der <strong>im</strong> Norden Deutschlands<br />
gelegenen regenerativen Produktionsstandorte (Windkraftanlagen<br />
an und vor den Küsten von Nord- und Ostsee)<br />
mit den Verbrauchszentren <strong>im</strong> Westen und Süden des Landes<br />
durchaus zu bewerkstelligen.<br />
Es dürfte teurer werden<br />
Die Netze spielen insgesamt eine <strong>im</strong>mer wichtigere Rolle be<strong>im</strong><br />
Umbau des Energieversorgungssystems, wofür viele Milliarden<br />
Euro an Investitionen erforderlich sind. Dies hat auch die<br />
BNetzA letztlich anerkannt und am 27.10.2011 bestätigt, dass<br />
die Eigenkapitalzinsen <strong>im</strong> Rahmen der Anreizregulierung nicht<br />
wie ursprünglich geplant drastisch, sondern nur moderat auf<br />
9,05 % gesenkt werden sollen. Damit können die Renditechancen<br />
der Netzbetreiber weiter Anreize für eine notwendige Investitionsbereitschaft<br />
setzen.<br />
Letztlich werden die Netzentgelte eher steigen als sinken.<br />
Aber auch wenn die „Ablasszahlungen“ an betroffene Städte<br />
oder Gemeinden (s. oben zu 5) durchaus einen gewissen Bruch<br />
<strong>im</strong> System darstellen, wird man in den Kostensteigerungen einen<br />
notwendigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende<br />
sehen müssen.<br />
Es sollte weiter gehen<br />
Dabei stellt sich allerdings die Frage, warum ein durchaus vergleichbarer<br />
Ausbau der Gasinfrastruktur auf der Fernleitungsebene<br />
nicht eine ähnliche Privilegierung erfährt. Im Zusammenhang<br />
mit dem erwarteten verstärkten Ausbau von Kraftwerken<br />
auf Basis von Erdgas in Ergänzung zu erneuerbaren<br />
Energien sowie der Entwicklung der Power-to-Gas-Technologie<br />
als mögliche Speicheroption für überschüssigen Strom<br />
aus erneuerbaren Energien („Windgas“) könnte ein verstärkter<br />
Aus- und Umbau des Gasfernleitungsnetzes erforderlich werden.<br />
Eine auf den Netzentwicklungsplänen aufbauende Bundesbedarfs-<br />
und -fachplanung <strong>im</strong> Gasbereich wäre eine sinnvolle<br />
Ergänzung <strong>im</strong> Sinne eines gesamtsystemischen Ansatzes.<br />
Autor<br />
Fazit: Schneller, teurer, weiter…<br />
Es wird schneller gehen<br />
Wie die Bestandsaufnahme zum novellierten EnWG in der letzten<br />
Ausgabe der <strong>3R</strong> gezeigt hat, gehen die Vorgaben zum Teil<br />
über die EU-Vorlage hinaus; dies trifft auch auf die Planun-<br />
RA Christian Fürst<br />
Erdgas Münster GmbH, Münster<br />
Tel. +49 251/2800-107<br />
E-Mail: Christian.Fuerst@erdgas.de<br />
808 11 / 2011
DVGW-Regelwerk<br />
GW 335-B3 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung – Teil<br />
B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) für die Wasserverteilung“<br />
Ausgabe 9/11, EUR 20,59 für DVGW-Mitglieder, EUR 27,45 für Nicht-Mitglieder<br />
Die Entwurfsfassung vom September<br />
2010 basiert auf den Werkstoffen POM<br />
(Polyoxymethylen) und PP (Polypropylen).<br />
Einige Einsprüche zielten auf die<br />
Berücksichtigung weiterer Werkstoffe<br />
wie PE (Polyethylen) und PA GF (glasfaserverstärktes<br />
Polyamid), die weder<br />
in DVGW VP 609 (Vorgänger von GW<br />
335-B3) noch in ISO 14236 (Grundlage<br />
von GW 335-B3) enthalten sind.<br />
So konnte die Frage, inwieweit das Anforderungsprofil<br />
von GW 335-B3 für<br />
andere Werkstoffe passt, ob also die<br />
schlichte Ergänzung der werkstoffspezifischen<br />
Tabellen reicht, <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Einspruchsberatung nicht geklärt werden.<br />
Das zuständige technische Komitee<br />
des DVGW hat auch eine Öffnungsklausel<br />
für zusätzliche Werkstoffe abgelehnt,<br />
da sie den <strong>im</strong> Wettbewerb stehenden<br />
Prüf-/Zertifizierungsstellen de<br />
facto Regelsetzungskompetenz einräumen<br />
würde und die Art und Weise<br />
der Anwendung einer Öffnungsklausel<br />
letztlich schwer absehbar wäre.<br />
Im Ergebnis wurde die Entwurfsfassung<br />
der GW 335-B3 vom September<br />
2010 bis auf kleinere Korrekturen<br />
bestätigt, die nicht berücksichtigten<br />
Werkstoffe müssen <strong>im</strong> Rahmen<br />
ergänzender Regelsetzung behandelt<br />
werden.<br />
G 5305-2 Entwurf „Gasströmungswächter für Gasversorgungsleitungen“<br />
Ausgabe 9/11, EUR 27,61 für DVGW-Mitglieder, EUR 36,82 für Nicht-Mitglieder<br />
Das Technische Komitee „Bauteile und<br />
Hilfsstoffe – Gas“ hat beschlossen, die<br />
VP 305-2 gemäß der Geschäftsordnung<br />
GW 100 in eine Technische Prüfgrundlage<br />
G 5305-2 zu überführen. Im Rahmen<br />
der Überführung wurde eine Anpassung<br />
an die aktuelle Regelwerksstruktur und<br />
eine redaktionelle Anpassung der zertifizierungsrelevanten<br />
Textpassagen vorgenommen,<br />
zusätzlich wurden die Regelwerksbezüge<br />
aktualisiert.<br />
Die Gasströmungswächter nach<br />
G 5305-2 sperren die Gaszufuhr für<br />
das nachgeschaltete Leitungssystem<br />
ab, wenn der vorgegebene Schließdurchfluss<br />
überschritten wird, z. B.<br />
durch eine mechanisch bedingte Leckage<br />
(Baggerangriff) mit ausreichend<br />
hohem Öffnungsquerschnitt.<br />
Diese technische Prüfgrundlage gilt<br />
für Anforderungen und Prüfungen von<br />
Gasströmungswächtern bis zu einer<br />
Nennweite von DN 50 mit definierter<br />
Durchflussrichtung. Sie werden mit Gasen<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 (jedoch<br />
nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase)<br />
betrieben. Sie werden entsprechend dem<br />
Betriebsdruckbereich unterteilt in die Typen<br />
A (15 mbar bis 100 mbar), B (0,1 bar<br />
bis 5 bar), C (25 mbar bis 5 bar) und D<br />
(25 mbar bis 1 bar).<br />
Einspruchsfrist: 30. Dezember 2011.<br />
G 5614 Entwurf „Unlösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen;<br />
Pressverbinder“<br />
Ausgabe 9/11, EUR 20,59 für DVGW-Mitglieder, EUR 27,45 für Nicht-Mitglieder<br />
Das Technische Komitee „Bauteile und<br />
Hilfsstoffe – Gas“ hat beschlossen, die<br />
VP 614 gemäß der Geschäftsordnung<br />
GW 100 in eine Technische Prüfgrundlage<br />
G 5614 zu überführen. Im Rahmen<br />
der Überführung wurde eine Anpassung<br />
an die aktuelle Regelwerksstruktur und<br />
eine redaktionelle Anpassung der zertifizierungsrelevanten<br />
Textpassagen vorgenommen;<br />
zusätzlich wurden die Regelwerksbezüge<br />
aktualisiert.<br />
Diese technische Prüfgrundlage gilt<br />
für Anforderungen und Prüfungen von<br />
Pressverbindern aus Metall zum Verbinden<br />
von Rohren und Rohrleitungsteilen<br />
aus metallenen Werkstoffen, die gegen<br />
glatte Wandungen metallisch oder nicht<br />
metallisch dichten. Die Prüfgrundlage gilt<br />
nicht für Pressverbinder, die für erdverlegte<br />
Leitungen eingesetzt werden. Die<br />
Pressverbinder müssen für Leitungen geeignet<br />
sein, die mit Gasen nach DVGW-<br />
Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.<br />
Diese technische Prüfgrundlage gilt<br />
für Pressverbinder, die in Gas-Rohrleitungen<br />
der Rohraußendurchmesser<br />
d 108 mm und bis zu Nenndrücken von<br />
5 bar (PN 1 oder PN 5) eingesetzt werden.<br />
Für den Anwendungsbereich der<br />
Gas-Innenleitungen nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 600 (TRGI) und TRF müssen<br />
sie thermisch erhöht belastbar sein.<br />
Einspruchsfrist: 30.12.2011<br />
Kontakt: DVGW, Bonn,<br />
Tel. +49 228 91 88-5,<br />
E-Mail: info@dvgw.de,<br />
www.dvgw.de<br />
11 / 2011 809
Faszination Technik<br />
Im Würgegriff<br />
Wurzel einer 40 Jahre alten Linde schlingt<br />
sich um eine Rohrleitung DN 200<br />
Fotograf: Michael Honds (siehe Beitrag auf S. 825)
Produkte & Verfahren<br />
Stumpfschweißmaschinen für PE-Rohre bis<br />
da 2.400 mm<br />
Durch die Weiterentwicklung von Rohrextrusionsanlagen und PE-Rohstoffe mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften (low-sagging)<br />
ist es möglich glattwandige Großrohre axial extrudiert bis Außendurchmesser 2.400 mm und Wanddicken bis 140 mm herzustellen.<br />
Aufgrund der positiven Erfahrungen der Kunden mit Stumpfschweißmaschinen von Widos für PE-Rohre bis 2 m Durchmesser wurde<br />
eine neue Maschine bis 2,4 m beauftragt. Die neue Maschine, Modellbezeichnung WIDOS 24000, zeichnet sich, wie die meisten anderen<br />
Baustellen-Stumpfschweißmaschinen des Unternehmens, durch eine Vielzahl von Besonderheiten aus, die <strong>im</strong> Folgenden erläutert<br />
werden.<br />
Hydraulikzylinder<br />
Die Hydraulikzylinder sind so am Maschinengrundgestell<br />
angebracht, dass die<br />
Rohrachse und die gegenüberliegenden<br />
Zylinder in einer Linie sind. Jeweils innen<br />
neben den Hydraulikzylinder, befinden sich<br />
Hochlastführungen, die die Konstruktion<br />
zusätzlich verstärken und stabil machen.<br />
Vorteile dieser Anordnung sind:<br />
Die Schweißkraft wird gleichmäßig auf<br />
das Rohrende übertragen<br />
Hydraulikzylinder unterschiedlicher<br />
Größen können eingesetzt und der<br />
Kraftbereich an die jeweiligen Anforderungen<br />
angepasst werden<br />
Weniger Verschleiß und längere<br />
Lebensdauer der Hydraulikzylinder,<br />
da die Quer- und Torsionskräfte be<strong>im</strong><br />
Schweißen durch die Hochlastführungen<br />
aufgenommen werden<br />
Es ist mit sehr einfachen Mitteln möglich,<br />
die Zylinder z.B. für Servicezwecke<br />
zu entnehmen, ohne dass hierfür die<br />
Grundmaschine demontiert werden<br />
muss<br />
Die Widos-Hydraulik arbeitet mit der sog.<br />
Nachdrücktechnik, d.h. geringe Druckabfälle<br />
werden durch ein Speicherreservoir ausgeglichen,<br />
ohne dass die Ölpumpe anläuft.<br />
Da die Ölpumpe nicht <strong>im</strong> Dauerlauf arbeitet,<br />
ist das Hydrauliksystem besonders langlebig.<br />
Bei permanent laufenden Pumpen besteht<br />
die Gefahr der Selbstüberhitzung.<br />
Da die Hydraulik mittels hochqualitativer<br />
Proportionalventile gesteuert wird,<br />
ist die Bewegung der eingespannten Rohre<br />
sehr präzise möglich.<br />
Die Hydraulikleitungen sind <strong>im</strong> Spannring<br />
versenkt und flachdichtend, sowie alle<br />
Kupplungen einfach zu reinigen. Spezialdichtungen<br />
ermöglichen zusätzlich extrem<br />
leichtgängigen Lauf der gehärteten und<br />
hartverchromten Kolbenstangen. Stumpfschweißmaschinen<br />
von Widos zeichnen<br />
sich deshalb durch besondere Leichtgängigkeit<br />
aus. Für die Bewegung der Maschine<br />
selbst wird nur wenig Druck benötigt,<br />
so dass Kraftreserven für das Schweißen<br />
von langen Rohrsträngen verbleiben.<br />
Spanneinsätze<br />
In der Praxis müssen oft kurzschenklige<br />
Formstücke oder wenige cm lange<br />
Rohrenden, wie z.B. Behälterstutzen, geschweißt<br />
werden. Mit Widos-Schweißmaschinen<br />
stellt das in den meisten Fällen<br />
kein Problem dar, da der vierte Ring der<br />
Schweißmaschine abgeschraubt werden<br />
kann und das Rohrstück mit nur einem Ring<br />
festgehalten und geschweißt wird.<br />
Da auch die Reduzierspanneinsätze<br />
werkseigener Herstellung „Made in Germany“<br />
sind, können Sonderdurchmesser,<br />
z. B. für Relining-Rohre, schnell dem Kunden<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Bild 1: WIDOS 24000 Stumpfschweißmaschine für die<br />
Baustelle (WIDOS GmbH)<br />
Bild 2: Stumpfschweißen von sehr dünnwandigen Großrohren; hier<br />
ca. SDR 61 (WIDOS GmbH)<br />
812 11 / 2011
Bild 3: WIDOS 24000 Werkstattschweißmaschine<br />
(WIDOS GmbH)<br />
Bild 4: Leichtes Handling von großen Sägestücken<br />
(WIDOS GmbH)<br />
Bei der gesamten Ausführung der<br />
Schweißmaschine wird auf höchste Qualität<br />
geachtet. So sind auch die Spindeln und<br />
Trapezgewinde aus sehr verschleißresistentem<br />
Material und besonders langlebig.<br />
Fast alle Maschinenteile sind galvanisch<br />
vergütet oder kunststoffbeschichtet.<br />
SchweiSSen von dickwandigen<br />
und dünnwandigen<br />
Rohren<br />
Da es in der „PE-Schweißer-Richtlinie“ DVS<br />
2207 Teil 1 [1] nur Schweißparameter für<br />
Rohre mit Wanddicke bis 70 mm gibt, werden<br />
die neuen Großrohre sinngemäß, in<br />
Anlehnung an die Richtlinie, geschweißt.<br />
Auf alle Fälle müssen noch die Empfehlungen<br />
der Rohr- bzw. Rohstoffhersteller beachtet<br />
werden.<br />
An dieser Stelle sei auf einen wesentlichen,<br />
allgemeinen Verfahrensvorteil des<br />
Heizelementstumpfschweißens von Großrohren<br />
hingewiesen: Auch „sehr dünnwandige“<br />
Großrohre können zuverlässig geschweißt<br />
werden. WIDOS-Maschinen mit<br />
ihren geringen Verarbeitungstoleranzen<br />
erleichtern den Versatzausgleich der Rohre<br />
zusätzlich. Folgendes Projekt dient der<br />
Veranschaulichung und als Referenz für die<br />
Frage „bis zu welcher SDR-Stufe kann man<br />
PE-Rohre schweißen?“: Eine alte Trinkwasserleitung<br />
des Zweckverbandes Landeswasserversorgung<br />
(Stuttgart), bestehend<br />
aus Spannbeton in DN 1500, wurde<br />
mittels Sublining mit PE-Rohr saniert. Die<br />
einzelnen PE-Rohre (Außendurchmesser<br />
1.480 mm, Wanddicke lediglich 24,3 mm)<br />
wurden vor dem Einzug zu einem Rohrstrang<br />
stumpfgeschweißt [2]. Dieses PE-<br />
Rohr entspricht ca. SDR 61 und konnte<br />
problemlos stumpfgeschweißt werden.<br />
Weiterhin werden auch oft sehr lange<br />
Rohrabschnitte mit Widos-Stumpfschweißmaschinen<br />
geschweißt, da die<br />
Hydraulikzylinder über große Kraftreserven<br />
verfügen. Zusätzlich durch den Einsatz<br />
von Rollenböcken, und ggf. der Nutzung<br />
von Landschaftsgefällen, können Rohrabschnitte<br />
von mehreren hundert Metern<br />
Länge geschweißt werden. Das macht das<br />
Stumpfschweißen auf der Baustelle zur<br />
universellen Verbindungstechnik für PE-<br />
Rohre.<br />
WerkstattschweiSSungen<br />
bis da 2.400 mm<br />
Da man mit der Baustellenschweißmaschine<br />
jetzt in der Lage war lange, gerade<br />
Rohrleitungen herzustellen, wurden für<br />
das Rohrleitungssystem geschweißte Bögen<br />
und T-Stücke nachgefragt. Als Vorreiter<br />
auf diesem Gebiet und wegen seines<br />
einzigartigen Erfahrungsschatzes wurde<br />
Widos mit der Konstruktion einer Werkstattschweißmaschine<br />
für Rohrleitungsbauteile<br />
bis da 2.400 mm beauftragt.<br />
In der neuen Produktionshalle in He<strong>im</strong>erdingen<br />
mit 6 m Kranhöhe wurde Anfang<br />
2011 mit dem Bau der ersten WIDOS<br />
24000 WM begonnen.<br />
Mit den dazugehörigen Spannwerkzeugen<br />
können Rohrsegmente <strong>im</strong> Winkel 7,5°<br />
und 11,25° verschweißt werden. Manuelles<br />
Festziehen der Spannwerkzeuge entfällt,<br />
ein neues hydraulisches Kniehebelsystem<br />
zur Aufbringung der enormen Spannkräfte<br />
lässt sich per Knopfdruck bedienen.<br />
Mit den massiven Spannwerkzeugen können<br />
Schweißkräfte über 75 kN übertragen<br />
werden. Reduzierspannschalen für kleinere<br />
Durchmesser stehen bis da 1.200 mm<br />
zur Verfügung.<br />
Bei besonders dickwandigen Bauteilen<br />
kann ein optionaler, oberer Zusatzzylinder<br />
eingesetzt werden, der zusätzlich<br />
eine Schweißkraft von 125 kN bringt.<br />
Dieser lässt sich hydraulisch aus dem Arbeitsbereich<br />
herausschwenken, so dass ein<br />
Entnehmen zum Öffnen der Werkzeuge<br />
nicht mehr notwendig ist.<br />
Großrohrtechnik unterscheidet sich in<br />
mancherlei Hinsicht von den mittleren PE-<br />
Rohr-D<strong>im</strong>ensionen. Hat man das Handling<br />
der großen Rohre und Rohrstücke erst einmal<br />
„<strong>im</strong> Griff“, dann gehen die Schweißarbeiten<br />
auch schnell voran. In punkto Handling<br />
haben sich die Konstrukteure von Widos<br />
deshalb einiges einfallen lassen. So<br />
z.B. eine hydraulische Rohranhebung in<br />
den Spannschalen. Ovale oder eingefallene<br />
Rohrstücke klemmen sich in den annähernd<br />
perfekt runden Spannschalen fest.<br />
Will man das Rohrstück zum Versatzausgleich<br />
etwas drehen, kann es um wenige<br />
cm angehoben werden, so dass eine Manipulation<br />
erst möglich wird. Auch zur Entnahme<br />
werden die Bauteile leicht angehoben<br />
und können bequem aus der Maschine<br />
gehoben werden.<br />
Ein weiteres Hilfsmittel ist ein manuell<br />
frei setzbarer hydraulischer Spannzylinder,<br />
der <strong>im</strong> Bedarfsfall für den schnellen Versatzausgleich<br />
das Rohrstück oder Bauteil<br />
mm-weise weitet.<br />
Normalerweise gibt es zu den Spannschalen<br />
passende Reduziereinsätze für<br />
die kleineren Durchmesser. Widos geht<br />
hier neue Wege: Die Reduziereinsätze der<br />
oberen Spannschalen entfallen und es gibt<br />
für jeden Durchmesser eigene Spannschalen.<br />
Dadurch wird das Gewicht der oberen<br />
Spannelemente reduziert. Die Vorteile:<br />
Rohrstücke, insbesondere mit geringen<br />
Wanddicken, werden kaum noch oval<br />
11 / 2011 813
Produkte & Verfahren<br />
gedrückt. Der Bereich der Schweißnaht<br />
kann leicht eingesehen werden, Versatzausgleich<br />
und Wulstbildung sind für den<br />
Schweißer sehr gut sichtbar.<br />
Heizelemente und<br />
Planhobel<br />
Die Heizelemente sind für eine gleichmäßige<br />
Temperaturverteilung ausgelegt. Generell<br />
werden die Anforderungen der DVS<br />
2208-1, an die max<strong>im</strong>al zulässige technisch<br />
bedingte Temperaturabweichung,<br />
(über-) erfüllt. Erreicht wird dies mit bis zu<br />
acht einzelnen Temperaturregelzonen. Die<br />
verschleißfeste Mehrfachbeschichtung ist<br />
eine Besonderheit, die den Widos-Heizelementen<br />
eine hohe Funktionalität und besonders<br />
lange Lebensdauer verleiht. Für<br />
schnellen Service können die Heizpatronen<br />
einzeln von der Außenkante des Heizelementes<br />
ausgetauscht werden.<br />
Der Planhobel zeichnet sich durch<br />
opt<strong>im</strong>ales Schnittverhalten aus. Seine<br />
Oberflächen sind zur Verringerung der<br />
Oberflächenreibung gehärtet und poliert.<br />
Die durchzugstarken Motoren ermöglichen,<br />
dass die gehärteten Messer<br />
(HSS-Stahl) durch das PE „gleiten“.<br />
Durch die besondere Geometrie der<br />
Hobelplatten werden die PE-Späne fast<br />
vollständig nach außen abgeführt. Be<strong>im</strong><br />
Versatzausgleich ist an höchsten Bedienerkomfort<br />
gedacht: Die beiden Hobelseiten<br />
werden getrennt angetrieben und<br />
so kann mit jeder Seite separat gehobelt<br />
werden. Der Versatzausgleich z.B.<br />
bei großen T-Stücken wird dadurch noch<br />
schneller.<br />
An dem übersichtlichen Bedienpult<br />
werden die Schweißdaten ausgewählt<br />
und der Schweißprozess läuft automatisch<br />
ab. Alle Schweißparameter werden<br />
aufgezeichnet und können <strong>im</strong> Sinne<br />
von Traceability mit der universellen<br />
WICON-Software weiterverarbeitet<br />
werden.<br />
Literatur<br />
[1] DVS-Taschenbuch „Fachbuchreihe<br />
Schweißtechnik, Band 68/IV, 13.<br />
Auflage, 2009, Verlag für Schweißen<br />
und verwandte Verfahren DVS-Verlag<br />
GmbH, Düsseldorf<br />
[2] Schönteich, M.; Ernst, B.: Bauüberwachung<br />
bei der Sanierung einer<br />
Trinkwasserleitung DN 1500 mit einem<br />
PE 100-Linerrohr durch Sublining,<br />
Wiesbadener Kunststoffrohrtage,<br />
April 2011<br />
AUTOR: WIDOS Wilhelm Dommer Soehne<br />
GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Bernd Klemm,<br />
He<strong>im</strong>erdingen, Tel. +49 7152 9939-59<br />
E-Mail: Bernd.Klemm@widos.de,<br />
www.widos.de<br />
Rinnenabdeckung mit Wabenstruktur<br />
bis Belastungsklasse F 900<br />
Mit einer Rinnenabdeckung <strong>im</strong> Wabendesign<br />
bietet Birco jetzt eine Abdeckung<br />
mit außergewöhnlich hoher Abflussleistung<br />
in neuartigem Design auch für den<br />
Schwerlastbereich. Die Abdeckungsvariante<br />
ist ab sofort auch in der Nennweite<br />
200 erhältlich und für Gewichte von<br />
bis zu 90 t (Belastungsklasse F 900) ausgelegt.<br />
„Wir haben bei der Produktentwicklung<br />
großen Wert auf ein besonderes<br />
Design bei gleichzeitig hoher Funktionalität<br />
gelegt: Dank der Wabenform können<br />
große Wassermassen schnell und effizient<br />
abgeleitet werden. Der Werkstoff<br />
Sphäroguss ermöglicht den Einsatz sowohl<br />
in umweltsensiblen Bereichen als auch <strong>im</strong><br />
Schwerlastbereich“, erklärt Geschäftsführer<br />
Christian Merkel.<br />
Die besondere Bienenwabenform ermöglicht<br />
eine opt<strong>im</strong>ierte hydraulische<br />
Leistung – große Einlaufwaben und seitliche<br />
Reinigungsöffnungen sorgen für eine<br />
schnelle und effiziente Entwässerung ohne<br />
Rückstau; daher eignet sich die Wabenabdeckung<br />
besonders gut für den Einsatz in<br />
abfallendem Gelände. Ein weiterer Vorteil<br />
der Wabenabdeckung: Durch die besondere<br />
Form werden einwirkende<br />
Lasten gut verteilt, damit<br />
bleibt die Wabenabdeckung<br />
selbst bei extrem hoher Belastung<br />
formstabil.<br />
Die Wabenabdeckung ist<br />
aus dem besonders zugfesten<br />
Sphäroguss gefertigt und<br />
wahlweise schwarz-tauchlackiert<br />
oder verzinkt erhältlich.<br />
Vor allem in stark frequentierten<br />
Bereichen, in denen höchste Funktionalität<br />
und mechanische Beständigkeit gegenüber<br />
hohen Lasten gefragt sind, eignen sich<br />
Sphärogussabdeckungen gut. Außerdem ist<br />
der Werkstoff besonders widerstandsfähig<br />
gegen umweltbelastende Medien. Deshalb<br />
kann die Wabenabdeckung auch in so genannten<br />
WHG-Flächen eingesetzt werden,<br />
also in Bereichen, in denen das Wasserhaushaltsgesetz<br />
angewendet werden muss. Für<br />
den WHG-Bereich außerdem von Vorteil:<br />
Die Dichtungsfuge ist dank der großen Wabenöffnungen<br />
gut einsehbar. Das erleichtert<br />
die Überprüfung der Rinne.<br />
Die Rinnensysteme von Birco sind mit<br />
einer Combi-Verschluss-Massivstahlzarge<br />
ausgestattet. Mit Hilfe dieser Zarge kann<br />
die Wabenabdeckung bis zu acht Mal pro<br />
Meter stabil mit dem Rinnenelement verschraubt<br />
oder alternativ mit BIRCO-Easylock<br />
mit nur einer Umdrehung in der Zarge<br />
befestigt werden. Das spart Zeit und Kosten<br />
bei Wartung und Einbau. Die Zargen<br />
werden über massive Anker mit den Betonrinnen<br />
belastungsstabil verbunden; spezielle<br />
Zargentaschen sorgen darüber hinaus<br />
für die problemlose Reinigung des Gewindegangs.<br />
Kontakt: BIRCO Baustoffwerk GmbH,<br />
Baden-Baden, Michael Neukirchen, Tel.<br />
+49 7221 5003-24, E-Mail: info@birco.<br />
de, www.birco.de<br />
814 11 / 2011
Software-Paket zur Bemessung von<br />
Regenwasserbewirtschaftungsanlagen<br />
Die Bemessung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung<br />
setzt eine sorgfältige<br />
Planung voraus. FRÄNKISCHE bietet dafür<br />
eine professionelle und einfache Komplettlösung:<br />
Mit RigoPLAN 5.0 kann der Planer<br />
neben den örtlichen Gegebenheiten auch<br />
die erforderliche Reinigungsleistung einkalkulieren.<br />
Der Anwender ergänzt die, auf<br />
Grundlage des DWA-Merkblattes M 153,<br />
nötigen Parameter und ermittelt so die<br />
richtige D<strong>im</strong>ensionierung der Anlage. Per<br />
Knopfdruck lassen sich die dadurch berechneten<br />
Daten in verschiedene weitere Bemessungsmodule<br />
– für Rohrrigolen-, Muldenrigolen-<br />
oder Muldenversickerungs-<br />
Anlagen – übernehmen. Basis hierfür sind<br />
die einschlägigen Normen und Richtlinien<br />
der DWA-A 138 und DWA-A 117.<br />
Neben der einfachen Bedienbarkeit<br />
bietet das Programm den Vorteil, einzelne<br />
Projekte komfortabel auf Excel-Basis verwalten<br />
und speichern zu können. Erhältlich<br />
ist RigoPLAN als kostenloser Download<br />
auf www.fraenkische-drain.de <strong>im</strong> Bereich<br />
„Service & Download“.<br />
Umfangreiches Servicepack 3 für BaSYS 8.2<br />
Anfang November 2011 wurde das Servicepack<br />
3 für die BaSYS Version 8.2 freigegeben.<br />
Mit der Auslieferung erweitert<br />
Barthauer nicht nur die Vorgängerversion,<br />
sondern veröffentlicht parallel auch zusätzliche<br />
innovative Module. Damit liefert<br />
Barthauer Software nicht nur eine Stabilisierung,<br />
Opt<strong>im</strong>ierung und Performance-<br />
Steigerung, sondern führt zu einer wesentlichen<br />
Vereinfachung und Beschleunigung<br />
einer Reihe von Arbeitsschritten.<br />
Bei der Realisierung der neuen Module<br />
wurden zahlreiche Anregungen und Wünsche<br />
der Anwender aus der Praxis berücksichtigt<br />
und umgesetzt.<br />
Der neue Netznavigator ermöglicht<br />
schnell und bequem die grafische Visualisierung<br />
und bidirektionale Kommunikation<br />
mit den Sachdaten der Netzelemente,<br />
auch ohne zusätzliche CAD/GIS-Lizenzen.<br />
Die Grafikerweiterung steht derzeit in den<br />
Anwendungen BaSYS KanDATA (Abwassermanagement)<br />
und PISA (Sanierungsplanung)<br />
zur Verfügung.<br />
Über die statistische Auswertung<br />
(OLAP) werden direkt in BaSYS beliebige<br />
Datenbankfelder übersichtlich zu einer Pivot-Ansicht<br />
arrangiert, die als Bericht oder<br />
Office-Dokument exportiert werden kann.<br />
Das Abwassermanagementmodul Kan-<br />
DATA ist um die Stutzen- und Abzweiggrafik<br />
erweitert worden. Das grafische Werkzeug<br />
liefert eine schematische Darstellung<br />
aller Anschlüsse der Haltungen und<br />
Anschlussleitungen, unterschieden nach<br />
Status und Punktfixierung.<br />
Mit dem Anschlussleitungs-Opt<strong>im</strong>izer<br />
kann innerhalb der Stutzen-/Abzweiggrafik<br />
ein Vergleich zwischen Bestandsund<br />
Inspektionsdaten und eine halb automatisierte<br />
Zuordnung der Inspektionsdaten<br />
von Anschlussleitungen zu bereits <strong>im</strong><br />
Projekt vorhandenen Bestandsanschlussleitungen<br />
durchgeführt werden.<br />
Zur schnellen Überprüfung ist die Erzeugung<br />
von Längsschnitten jetzt direkt<br />
aus KanDATA heraus möglich. Neben der<br />
Selektion über die Tabellenansicht ist <strong>im</strong><br />
Zusammenspiel mit dem optionalen neuen<br />
Netznavigator die Auswahl der darzustellenden<br />
Haltungen sogar direkt über<br />
die grafische Selektion möglich.<br />
Kontakt: Barthauer Software GmbH,<br />
Potsdam, Jenny Krüger, Tel. +49 331 550<br />
499 12, E-Mail: krueger@barthauer.de,<br />
www.barthauer.de<br />
Bild 1: Der neue Netznavigator ermöglicht schnell und bequem die<br />
grafische Visualisierung und bidirektionale Kommunikation mit den<br />
Sachdaten der Netzelemente<br />
Bild 2: Das Abwassermanagementmodul KanDATA ist um die<br />
Stutzen-/Abzweiggrafik erweitert worden<br />
11 / 2011 815
Produkte & Verfahren<br />
Rohrleitung sicher befestigen mittels Rohrbügel<br />
mit PE-Unterlage<br />
Hängende Rohrleitungen, wie sie in Chemieanlagen,<br />
auf Rohrbrücken, in Tanklagern<br />
usw. verwendet werden, werden oft<br />
mit Rundstahlrohrbügeln befestigt. Da alle<br />
Rohrleitungen eine gewisse Eigenbewegung<br />
durch Temperaturschwankungen<br />
oder Vibration erleiden, kann bei den<br />
Bild 1: Beschädigung der Rohrleitungsumhüllung durch<br />
laterale Bewegungen bei einer herkömmlichen Aufhängung<br />
mittels Rundstahlrohrbügel<br />
Rohrleitungen an den punktuellen<br />
Auflagestellen der<br />
Korrosionsschutz und auch<br />
das Rohrmaterial beschädigt<br />
werden, so dass teilweise<br />
schon nach kurzer Zeit Reparaturmaßnahmen<br />
erforderlich<br />
sind.<br />
Um einen<br />
direkten Kontakt<br />
zwischen<br />
Rohrleitung und<br />
Rohrbügel zu<br />
vermeiden, bietet<br />
der neue<br />
Rohrbügel von<br />
MSI Technik eine Unterlage<br />
zwischen Rohrleitung und<br />
Rohrbügel aus PE. Die Rohrbügelunterlage<br />
weist eine<br />
Nut auf, in der der Rohrbügel<br />
formschlüssig angeordnet ist.<br />
Der Rohrbügel ist in den<br />
Größen DN 15 bis DN 250 in<br />
langer und kurzer Ausführungen<br />
verfügbar. Er eignet sich<br />
Bild 2: Rohrbügel mit PE-Unterlage fixieren bzw. tragen<br />
Rohrleitungen sicher; Beschädigung der Umhüllung bzw. der<br />
Rohrleitungen werden vermieden<br />
auch für GFK-Leitungen und elektropolierte<br />
Leitungen sowie für geschäumte Rohre<br />
mit Wickelfalz. Der Bügel ist feuerverzinkt<br />
mit 35 μm (inkl. Gewinde), wodurch eine<br />
lange Lebensdauer gewährleistet wird. Die<br />
PE-Einlage ist fest fixiert, so dass ein Verrutschen<br />
der Einlage unmöglich ist.<br />
Kontakt: MSI Technik, Chieming,<br />
Tel. +49 8664 92882-00, E-Mail: Martin.<br />
Starzengruber@MSI-Technik.de<br />
WELTEC-Rechner opt<strong>im</strong>iert Biogasanlagen online<br />
WELTEC BIOPOWER ermöglicht Biogasanlagen-Betreibern<br />
und Investoren mit<br />
einem neuen Online-Rechner die Wirtschaftlichkeit<br />
ihrer Anlagen zu überprüfen.<br />
Der Kalkulator verarbeitet die eingegebenen<br />
Daten vollkommen herstellerunabhängig.<br />
Unter www.weltec-biopower.de erfahren<br />
die Nutzer durch die Eingabe weniger<br />
Kennzahlen in eine Maske umgehend,<br />
wie effizient ihre Anlage arbeitet<br />
und wie sich der Energieertrag steigern<br />
lässt. Die Eingabe der Daten in den Feldern<br />
ist standardisiert; die grafische Auswertung<br />
erfolgt schnell, neutral und kostenfrei.<br />
Bei falschen Angaben wird der<br />
Nutzer umgehend zur Korrektur aufgefordert.<br />
Auf Basis der Ergebnisse kann ein<br />
kostenloses Beratungsgespräch angefordert<br />
werden.<br />
Nach der Eingabe der Daten<br />
zeigt eine graphische Auswertung,<br />
wie die Anlage opt<strong>im</strong>iert<br />
werden kann. Auf<br />
Wunsch ist es möglich, die<br />
Zahlen anonym zu archivieren,<br />
um einen Datenabgleich<br />
zu einem späteren Zeitpunkt<br />
zu erleichtern. Über ein Betriebstagebuch<br />
können die<br />
Anwender täglich Daten zur<br />
Biologie oder zu Laufzeiten<br />
der Anlage eingeben.<br />
Das Instrument stellt zudem<br />
die Verbindung mit dem<br />
WELTEC Service her, so dass<br />
die Mitarbeiter ständig ein aktuelles<br />
Bild von der Anlage und<br />
möglichen Problemen in der<br />
Anlagenführung haben.<br />
Unter www.weltec-biopower.de können Nutzer mit einem<br />
neuen Online-Rechner die Wirtschaftlichkeit ihrer<br />
Biogasanlagen überprüfen<br />
816 11 / 2011
Fernwärme opt<strong>im</strong>al abgedichtet<br />
Canusa Superseal-Produkte sind besonders leistungsstarke, wärmeschrumpffähige Produkte für die Muffenabdichtung bei vorgedämmten<br />
Rohrsystemen. Sie sind speziell entwickelt für Mantelrohre und Muffen aus HDPE und für Anwendungen in Rohr- und<br />
Betriebssystemen (z. B. Fernwärme), bei denen starke Sandreibungskräfte und große Rohrbewegungen <strong>im</strong> Boden zu erwarten sind.<br />
Für eine möglichst flexible Anwendbarkeit<br />
sind Canusa Superseal TM -Produkte in drei<br />
Konfigurationen verfügbar:<br />
Die Wrapid Sleeve TM KTD/KLD sind<br />
montagefertige Schrumpfmanschetten<br />
mit einem bereits werkseitig integrierten<br />
Verschlussband. Es gewährleistet<br />
eine schnelle und verlässliche Verarbeitung.<br />
Die Canusa Wrap TM WTD/WLD sind<br />
Schrumpfmanschetten als Rollenware<br />
mit separatem Verschlussband. Für<br />
jeden beliebigen Rohrdurchmesser<br />
kann die erforderliche Schrumpfmanschettenlänge<br />
direkt auf der Baustelle<br />
zugeschnitten werden. Diese Flexibilität<br />
bietet die Vorteile einer wirtschaftlich<br />
opt<strong>im</strong>alen Lagerhaltung und einer<br />
bemerkenswerten Kostenmin<strong>im</strong>ierung<br />
auf der Baustelle.<br />
Der Canusa Tube TM PTD ist ein werksmäßig<br />
hergestellter geschlossener<br />
Schrumpfschlauch, der auf der Baustelle<br />
schnell und funktionssicher installierbar<br />
ist. Er wird zum Schutz des<br />
Schmelzklebers während der Bauphase<br />
in einem schmutz- und wasserdichten<br />
Plastikbeutel geliefert. Die Systeme<br />
sind durchweg mit dem besonders<br />
montagetoleranten und hoch scherfesten<br />
„D-Kleber“ ausgestattet. Dieser<br />
zeichnet sich auch durch eine kaum<br />
messbare Wasseraufnahme aus.<br />
Neben diesen drei Hauptprodukten bietet<br />
PSI weitere Lösungen für Fernwärmerohrleitungen<br />
an: Die CSS-Schrumpfabschottung<br />
dient zur Kunststoffmantelrohrabschottung<br />
(lieferbar für KMR 90 – 630).<br />
Mauerdurchführungen sind erhältlich als<br />
Compakt FW Gummipressdichtungen oder<br />
zum einfach Überschieben auf das Rohr in<br />
Form von Labyrinth-Mauerdichtringen.<br />
Die PSI-Abdichtmanschette Typ FW erlaubt<br />
radiale und axiale Bewegungen und<br />
ist druckdicht bis max. 0,5 bar.<br />
Komplettiert wird die Produktpalette<br />
<strong>im</strong> Bereich Fernwärme durch die PSI Canusa<br />
Fernwärme Endkappen CSS sowie<br />
durch das PSI-Dichtband aus einer speziellen<br />
Butylkautschukmischung. Es ist selbstverschweißend,<br />
gut wärmestandfest und<br />
sehr alterungsbeständig. Anwendung findet<br />
es speziell für KMR-Muffensysteme,<br />
Schrumpfendkappen und Abschlussmanschetten.<br />
Die Schrumpftechnik nach dem System<br />
Canusa funktioniert nach folgendem<br />
Prinzip: Das wärmeschrumpfende Trägermaterial<br />
einer Schrumpffolie besteht aus<br />
molekularvernetztem Polyethylen (PE). Es<br />
ist mechanisch stark belastbar und resistent<br />
gegen aggressive Elemente. Durch<br />
eine energiereiche Elektronenbestrahlung<br />
verbinden sich die ursprünglich schwach<br />
zusammenhaltenden Kohlenwasserstoffketten<br />
zu einem stabilen Netz. Dieses Netz<br />
wird be<strong>im</strong> Einsatz an der Baustelle durch Erwärmung<br />
– mittels eines Propangasbrenners<br />
– elastisch und verformbar, schmilzt<br />
aber nicht. Das mechanisch aufgeweitete<br />
Material wird um den abzudichtenden<br />
Rohrbereich geschrumpft und kann durch<br />
anschließendes Abkühlen in dem verformten<br />
Zustand fixiert werden. Auf diese Weise<br />
lässt es sich perfekt an unterschiedliche<br />
Konturen anpassen, überbrückt Verbindungen<br />
bzw. verfüllt Unebenheiten oder<br />
dient zur Reparatur beschädigter Werksumhüllungen.<br />
Unterstützt wird der Abdichtungsprozess<br />
durch die während der Verarbeitung<br />
entstehende Schrumpfspannung<br />
des Trägermaterials.<br />
Je höherschrumpfend das Trägermaterial<br />
ist, umso größere Differenzen <strong>im</strong><br />
Querschnitt können überbrückt werden.<br />
Das wärmeschrumpfende Trägermaterial<br />
ist mit einem dauerelastischen Schmelzkleber<br />
beschichtet. Dieser Dichtungskleber<br />
ist das eigentliche dauerelastische<br />
Abdichtungsmedium für die Muffe. Der<br />
Schmelzkleber wird miterwärmt, verflüssigt<br />
sich und benetzt die zu umhüllende<br />
Oberfläche opt<strong>im</strong>al, verkrallt sich dabei in<br />
alle Unebenheiten und füllt Absätze und<br />
Übergänge aus und gibt nach Abkühlung<br />
dem System die erforderliche Schäl- und<br />
Scherfestigkeit.<br />
Canusa Superseal TM -Produkte haben<br />
die Prüfungen bei unabhängigen Fernwärmeinstituten<br />
gemäß der EN 489 bestanden.<br />
Die bei diesen Prüfungen festgestellten<br />
Leistungsdaten liegen über den Anforderungen<br />
und Vorgaben der Norm.<br />
Kontakt: PSI Products GmbH, Mössingen,<br />
Tel. +49 7473 37 81-0,<br />
E-Mail: vertrieb@psi-products.de,<br />
www.psi-products.de<br />
11 / 2011 817
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Gesellschaftliche Verantwortung<br />
<strong>im</strong> Leitungsbau<br />
Von Ach<strong>im</strong> Hilgenstock, Kirsten Willings<br />
Projektleiter und Projektmitarbeiter/innen müssen oft bei ihren Projektentscheidungen gesellschaftliche und unternehmerische<br />
Verantwortung übernehmen und dennoch ihr Projekt erfolgreich <strong>im</strong> Termin- und Kostenrahmen halten.<br />
Der nachfolgende Artikel zeigt einerseits Beispiele auf, wie dies in der Praxis gelebt wird, verdeutlicht aber auch<br />
das Spannungsfeld in dem sich die handelnden Personen oft befinden. Es werden exemplarisch auch Maßnahmen beschrieben,<br />
die zu einer Verbesserung in der Projektabwicklung führen.<br />
Einleitung<br />
Nachhaltigkeit, unternehmerische Verantwortung und ethische<br />
Grundsätze – heute kommt man an diesen Schlagwörtern<br />
nicht mehr vorbei. Sie sind in vielen unternehmerischen<br />
Prozessen Fakt, aber wie passen sie in das Thema Leitungsbau?<br />
Den konkreten Zusammenhang erkennt man hier nicht<br />
auf den ersten Blick.<br />
Andere Branchen haben es leichter, diese Botschaften<br />
nach Außen zu tragen. Der nachhaltige Anbau von Kakaobohnen<br />
oder Kaffee ist in der Öffentlichkeit bekannt, die Notwendigkeit<br />
steht außer Frage. Doch wie sieht es <strong>im</strong> Leitungsbau<br />
aus? Kann es tatsächlich ein von ethischen Grundsätzen geprägtes<br />
Projektmanagement geben und wie wird eine nachhaltige<br />
Strategie erfolgreich <strong>im</strong> Projekt umgesetzt?<br />
Heute kommen keine großen Investitionsprojekte ohne die<br />
genaue Identifikation der möglichen „weichen Risikofaktoren“<br />
aus. Der Begriff „Corporate Responsibility“ (abgekürzt CR)<br />
umfasst hierbei alle mit Nachhaltigkeit und unternehmerischer<br />
Verantwortung zusammenhängenden Themen (eine ausführliche<br />
Erläuterung finden Sie in der separaten Informationsbox).<br />
Nicht nur die öffentliche Akzeptanz eines Projektes bezüglich<br />
der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt spielt eine große<br />
Rolle. Schon bei der Finanzierung solcher Projekte werden<br />
heute von den Banken ausführliche und unabhängige Gutachten<br />
gefordert. St<strong>im</strong>men die Ergebnisse nicht mit den jeweiligen<br />
Vorgaben der Bank überein, wird das Projekt nicht finanziert.<br />
Große Leitungsprojekte beziehen daher CR-Standards<br />
in ihre Projekt- und Budgetplanung mit ein. Die Prüfungen der<br />
Banken und die umfangreichen Genehmigungsprozesse erfordern<br />
jedoch nicht nur die Analyse der Auswirkungen eines<br />
solchen Großprojekts auf Mensch und Umwelt, sondern verlangen<br />
auch klare Aktionen, um möglichen negativen Auswirkungen<br />
entgegenzuwirken oder einen Ausgleich zu schaffen.<br />
Diese Prozesse sind in den letzten Jahren in vielen Großunternehmen<br />
umgesetzt worden. Doch manche Teilprozesse<br />
sind nicht absolut neu und erst durch CR <strong>im</strong>plementiert worden.<br />
Viele Vorgaben, die heute Teil der CR-Strategie sind, werden<br />
seit Jahren <strong>im</strong> Rohrleitungsbau praktiziert. So ist die Berücksichtigung<br />
nachhaltiger Grundsätze <strong>im</strong> Leitungsbau gelebte<br />
Realität: Die Einbindung der Öffentlichkeit in ein geplantes<br />
Rohrleitungsprojekt, die transparente Beschreibung des<br />
Projektes für die Energieaufsicht, der Umweltschutz, die Arbeitssicherheit,<br />
der Einbezug von Archäologen und zahlreiche<br />
andere Aspekte – das alles ist integrierter Teil eines Projektplans<br />
be<strong>im</strong> Bau einer Pipeline. Lesen Sie auf den folgenden<br />
Seiten mehr über die Detailplanung des Leitungsbaus in<br />
Bezug auf Corporate Responsibility und welche umfangreichen<br />
Maßnahmen ergriffen werden, um den Bau einer Leitung<br />
nachhaltig und verantwortungsvoll durchzuführen.<br />
Entscheidungsspielräume bei Planung,<br />
Bau und Inbetriebnahme<br />
Große Gastransportleitungen sind die Autobahnen der Energieversorgung.<br />
Über sie werden jährlich riesige Energiemengen<br />
über große Entfernungen transportiert und sie tragen so<br />
zum Wohlstand und Wachstum <strong>im</strong> Lande bei. Leitungen für<br />
den Gastransport dienen damit dem öffentlichen Interesse,<br />
was <strong>im</strong> Energiewirtschaftsgesetz entsprechend gewürdigt<br />
wird. Leitungen werden nach der Inbetriebnahme über Jahrzehnte<br />
hinweg sicher betrieben und stellen somit einen wesentlichen<br />
Bestandteil zur Versorgungssicherheit mit wettbewerbsfähiger<br />
Energie dar. Dennoch müssen bei der Planung<br />
und dem Bau die unterschiedlichen Interessen der Betroffenen,<br />
der Umwelt, der Arbeitssicherheit und zahlreiche andere<br />
Parameter berücksichtigt werden. Genau dazu dienen die bei<br />
großen Vorhaben notwendigen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren<br />
mit den notwendigen Umweltverträglichkeitsstudien<br />
und den entsprechenden Abwägungen der unterschiedlichen<br />
Interessen. Insbesondere werden auch die Belange<br />
der Öffentlichkeit ausdrücklich berücksichtigt und mit<br />
einbezogen. Die öffentliche Erörterung der Vorhaben ist dabei<br />
ein wesentliches Element in den Genehmigungsprozessen.<br />
In der aktuellen Diskussion um Stuttgart 21 wurde <strong>im</strong>mer<br />
wieder die Frage nach der öffentlichen Beteiligung und<br />
der Abwägung der Individualinteressen gestellt. Gerade <strong>im</strong><br />
Leitungsbau werden Öffentlichkeit und Träger öffentlicher<br />
Belange (TöB’s) sehr frühzeitig informiert und eingebunden.<br />
Über die öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen wird<br />
zudem die Möglichkeit geschaffen, Einwände zu erheben. In<br />
818 11 / 2011
Bild 1: Projektablaufplan (schematisch) [5]<br />
der Regel wird davon auch intensiv Gebrauch gemacht – so<br />
sind heutzutage mehr als 1000 Einwendungen pro 100 km<br />
Leitungslänge keine Seltenheit mehr. In den öffentlichen Erörterungen<br />
werden dann die Einwendungen diskutiert, so dass<br />
der Verfahrensführer anschließend nach Abwägung der Argumente<br />
den Planfeststellungsbeschluss verfassen kann. Häufig<br />
führen die Einwendungen zu Auflagen <strong>im</strong> Planfeststellungsbeschluss,<br />
die vom Vorhabensträger erfüllt werden müssen.<br />
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt aber, dass es in den Diskussionen<br />
mit den Betroffenen zu einer „Ich bin gegen Alles-<br />
Haltung“ oder auf Neudeutsch: Build absolutely nothing anywhere<br />
near anything (BANANA-Effekt) kommt. Das komplexe<br />
Zusammenwirken der unterschiedlichen Interessen bei der<br />
Projektabwicklung soll <strong>im</strong> Folgenden an Hand einiger ausgewählter<br />
Beispiele beschrieben werden, um zu verdeutlichen,<br />
dass die Projektmitglieder unter Berücksichtigung nachhaltigen<br />
Handelns agieren und dabei die öffentlichen Interessen<br />
beachten, ohne dabei die unternehmensinternen Interessen<br />
zu vernachlässigen.<br />
Der nachfolgende Projektzeitplan (Bild 1) verdeutlicht,<br />
dass zahlreiche Aktivitäten <strong>im</strong> Projekt parallel oder auf einander<br />
aufbauend abgearbeitet werden müssen, um den Inbetriebnahmetermin<br />
der Leitung sicher zu gewährleisten. Dabei<br />
ist der angegebene Projektzeitraum mit drei bis vier Jahren<br />
als ambitioniert zu betrachten, müssen doch in dieser Zeit der<br />
Raumordnungsbeschluss, die Planfeststellung und somit die<br />
Baugenehmigung erlangt werden, die Wegerechte erworben<br />
und die Kreuzungsgenehmigungen eingeholt, Materialien beschafft<br />
und die Rohr- und Tiefbauleistungen ausgeschrieben,<br />
beauftragt und geleistet werden. Die Wahrung aller Interessen<br />
der Projektbeteiligten kann dabei den einen oder anderen<br />
Zielkonflikt auslösen, wie <strong>im</strong> Folgenden erläutert werden soll.<br />
Die Planungs- und Genehmigungsphase<br />
Das Raumordnungsverfahren (ROV) prüft die Verträglichkeit<br />
der Leitungsplanung mit geplanten oder bereits vorhandenen<br />
raumbedeutsamen Einzelvorhaben. Es klärt dabei, ob eine<br />
Maßnahme mit den Zielen und Grundsätzen des Raumordnungsgesetzes<br />
vereinbar ist und wie raumbedeutsame Maßnahmen<br />
aufeinander abgest<strong>im</strong>mt werden können [1].<br />
Be<strong>im</strong> ROV wird ein Korridor – üblicherweise mit 150 bis<br />
200 m Breite – identifiziert, in dem später <strong>im</strong> Rahmen des<br />
Planfeststellungsverfahrens die genaue Planung der Trasse<br />
parzellenscharf abgebildet werden muss. Nachdem der<br />
Raumordnungsbeschluss erlangt wurde, kann das Planfeststellungsverfahren<br />
(PFV) eröffnet werden. In diesem Verfahren<br />
werden neben den privaten Einwendungen insbesondere<br />
auch die Themen Arbeitsschutz, kommunale Belange, Naturund<br />
Landschaftsschutz, Wald- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft,<br />
Bodenschutz, Landwirtschaft, Immissionsschutz,<br />
Sicherheit, Schutz der Kulturgüter und Denkmalschutz, Verkehr<br />
und Straßen, Interessen von Leitungsträgern und anderen<br />
Trägern öffentlicher Belange berücksichtigt. Die <strong>im</strong> Rahmen<br />
des PFV durchzuführende Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
muss den Zeitraum einer vollständigen Vegetationsperiode<br />
umfassen und ist somit Zeit best<strong>im</strong>mend für die<br />
Dauer des Verfahrens. Im Rahmen der Planung werden dann<br />
Kompensationsmaßnahmen erarbeitet, die den Eingriff in die<br />
Natur durch den späteren Leitungsbau ausgleichen werden.<br />
Im Rahmen der beiden Genehmigungsverfahren sind für<br />
den Projektleiter und sein Team zahlreiche Herausforderungen<br />
zu meistern: Er muss in geeigneter und glaubhafter Weise<br />
die Öffentlichkeit einbinden und um Akzeptanz für sein Vorhaben<br />
und die entwickelte Leitungstrasse werben. Gelingt<br />
ihm dies, werden z.B. die Wegerechtsverhandlungen problemloser<br />
verlaufen. Ziel sollte es sein, mit dem Vorliegen des<br />
Planfeststellungsbeschlusses auch die Baufreiheit durch die<br />
Einwilligung der vom Bau Betroffenen vorliegen zu haben, da<br />
es ansonsten zu Verzögerungen <strong>im</strong> Bauablauf kommen kann.<br />
Letzteres ist auch <strong>im</strong>mer mit einer zusätzlichen Gefährdung<br />
von Mitarbeitern verbunden, da schwere Maschinen und das<br />
Material um die nicht baufreien Grundstücke herum trans-<br />
11 / 2011 819
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
portiert werden müssen. Nebenbei kostet jeder einzelne Umsetzvorgang<br />
bei großen Transportleitungen schnell mehr als<br />
100.000 €.<br />
Im Zuge des Wegerechtserwerbs geleistete Entschädigungszahlungen<br />
müssen für alle fair und in gleicher Höhe bezogen<br />
auf die Größe des betroffenen Grundstücks sein. Hohen<br />
Forderungen Einzelner kann daher nicht nachgekommen<br />
werden. Entschädigungsleistungen werden in der Regel mit<br />
Bild 2: Steinkauz, zu dessen Schutz die Leitungsachse verschoben<br />
wurde (TLN, Open-Grid-Europe)<br />
Bild 3: Archäologischer Fund <strong>im</strong> Arbeitsstreifen (man beachte das<br />
Schwert <strong>im</strong> Gürtel!) (Werner Waltz, externer Bauleiter <strong>im</strong> Projekt Forchhe<strong>im</strong>-Irsching<br />
der E.ON Ruhrgas AG)<br />
den zuständigen Bauernverbänden einvernehmlich geregelt.<br />
Im nichtlandwirtschaftlichen Bereich gibt es dafür gesetzliche<br />
Regelungen, die zugrunde gelegt werden. In der Vergangenheit<br />
wurde oft die Erfahrung gemacht, dass die Akzeptanz<br />
für ein neues Leitungsprojekt in der Bevölkerung groß<br />
ist, wenn bereits schon einmal eine Leitung verlegt wurde.<br />
Dann wissen die Betroffenen, dass mit ihnen fair und offen<br />
umgegangen wird.<br />
In den letzten Jahren traten der Umweltschutz und das<br />
Thema Arbeitssicherheit <strong>im</strong> Leitungsbau <strong>im</strong>mer stärker in den<br />
Fokus. Eine Konsequenz daraus war, dass E.ON Ruhrgas die<br />
sich über lange Jahre bewährten Arbeitstreifenbreiten überprüft<br />
und vergrößert hat [2]. Was zunächst <strong>im</strong> Widerspruch<br />
zum Umweltschutz zu stehen scheint – es wird ja mehr Land<br />
in Anspruch genommen – führt letzten Endes zu einer Verbesserung<br />
des Umweltschutzes durch die Möglichkeit der<br />
getrennten Lagerung von unterschiedlichen Bodenhorizonten<br />
und zu einer Erhöhung der Arbeitssicherheit. Die breiteren<br />
Arbeitsstreifen stießen sowohl bei den Behörden, als<br />
auch bei den betroffenen Landwirten auf viel Zust<strong>im</strong>mung, da<br />
die Vorteile für alle ersichtlich waren. Die Mehrkosten für die<br />
Entschädigungen der betroffenen Grundeigentümer wurden<br />
durch E.ON Ruhrgas getragen, da die gewonnenen Vorteile für<br />
alle überwogen. Der vergrößerte Arbeitsraum wurde von den<br />
Baufirmen begrüßt, da die Logistik deutlich vereinfacht und<br />
so ein wichtiger Beitrag zur Arbeitssicherheit geleistet wurde.<br />
Die Realisierung der breiteren Arbeitsstreifen erforderte<br />
komplexe Abst<strong>im</strong>mungen <strong>im</strong> eigenen Hause, mit den Genehmigungsbehörden<br />
und den betroffenen Grundeigentümern.<br />
Letzten Endes war es für alle ein Erfolg.<br />
Ein weiteres Beispiel ist die Einführung digitaler Planfeststellungsverfahren<br />
[3]: Seit 2006 konnten dadurch riesige<br />
Mengen an Papier für die Antragsunterlagen eingespart werden<br />
(ca. 350 m Akten je 100 km Leitung), die Logistik wurde<br />
vereinfacht und die Handhabung der ursprünglichen Aktenberge<br />
durch entsprechend intelligente Benutzeroberflächen<br />
für den Anwender einfacher. Die Einführung setzte aber auch<br />
eine Änderung der internen und externen Abläufe voraus, die<br />
sich über Jahre bewährt hatten. Letztlich wurden nicht nur<br />
Ressourcen geschont und die Öffentlichkeit besser informiert<br />
sondern auch noch Geld gespart.<br />
Bei der <strong>im</strong> Rahmen der Planfeststellung erarbeiteten Leitungstrasse<br />
müssen zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden:<br />
Schutz der Umwelt und der Natur. Häufig wurden schon<br />
Leitungstrassen in der Planungsphase so verlegt, dass<br />
schützenswerte Pflanzen oder Tiere berücksichtigt wurden.<br />
Beispiele sind das Brutgebiet des Steinkauzes was zu<br />
einer Umtrassierung und Mehrlänge der Leitung führte.<br />
Die damit verbundenen Mehrkosten lagen in der Größenordnung<br />
von einer Million Euro (Bild 2).<br />
Oft werden durch Behörden Bauzeitenbeschränkungen<br />
auferlegt, um Brut und Aufzucht von Jungtieren zu ermöglichen.<br />
Diese Auflagen haben signifikante Auswirkungen<br />
auf den Bauablauf und auf die damit verbundene Belastung<br />
der bauausführenden Mitarbeiter. Hierauf wird<br />
später noch eingegangen.<br />
820 11 / 2011
Denkmalschutz und Archäologie spielen ebenfalls eine<br />
wichtige Rolle. Durch archäologische Untersuchungen vor<br />
dem eigentlichen Leitungsbau können Funde <strong>im</strong> Arbeitsstreifen<br />
gesichert werden. Bild 3 zeigt das so gefundene<br />
Skelett eines vor jahrhunderten Verstorbenen, dem als<br />
Grabbeilage ein Schwert in den Gürtel gesteckt wurde.<br />
Damit war die Datierung des Fundes schnell möglich.<br />
Ortsfeste Tierpopulationen werden temporär für die<br />
Bauphase umgesiedelt. Die Fledermauspopulation in<br />
Bild 4 wurde dazu vorübergehend in eine Behausung außerhalb<br />
des Baustellenbereichs umgesiedelt.<br />
Im Rahmen der Planung werden auch viele technische Fragestellungen<br />
angegangen: Dabei spiel der Stresstest – ein<br />
Begriff, der aktuell in der öffentlichen Diskussion häufig vorkommt<br />
– <strong>im</strong> Leitungsbau schon lange eine bedeutende Rolle,<br />
um die Integrität der verlegten Leitung nachzuweisen.<br />
Die Leitung wird dazu mit Wasser befüllt und der Druck so<br />
lange erhöht, bis die Streckgrenze des Rohrmaterials nahezu<br />
erreicht ist. Dieser Druck liegt deutlich über dem späteren<br />
Betriebsdruck. Das Befüllen der Leitung und die spätere<br />
Entleerung erfolgt in der Regel über <strong>im</strong> Trassenverlauf befindliche<br />
Gewässer, die zuvor durch die Behörde freigegeben<br />
werden müssen. Die Opt<strong>im</strong>ierung des Stresstests hat in<br />
den letzten Jahren dazu geführt, dass längere Druckprobenabschnitte<br />
untersucht werden können, als bisher üblich, wodurch<br />
sich der Eingriff in die Natur reduziert. Die hier geleisteten<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten haben sich somit<br />
bewährt.<br />
Neben den Genehmigungen müssen alle für den Bau der<br />
Leitung erforderlichen Materialien bestellt und geliefert werden<br />
und die Bauleistungen an leistungsstarke Unternehmen<br />
vergeben sein. Alle Lieferanten werden zuvor einer Präqualifikation<br />
unterzogen, um sicherzustellen, dass das Material von<br />
höchster Qualität ist und die Baufirmen über die notwendigen<br />
Fähigkeiten und Mitarbeiter verfügen. In der Vergangenheit<br />
wurde die Ausschreibung für Rohr- und Tiefbauarbeiten<br />
oft so gestaltet, dass alle wesentlichen Positionen der Ausschreibung<br />
<strong>im</strong> Einheitsverlegepreis enthalten sein mussten.<br />
Dieser beinhaltete dann auch sicherheitsrelevante Positionen,<br />
die ggf. durch die Baufirma nicht umgesetzt wurden, um<br />
günstiger bauen zu können. Zur Vermeidung derartiger Effekte<br />
werden sicherheitsrelevante Positionen aus dem Einheitsverlegepreis<br />
herausgenommen und entsprechend mit separaten<br />
Positionen belegt. Dadurch werden den Baufirmen entsprechende<br />
sicherheitsrelevante Arbeiten auch bezahlt und<br />
nicht <strong>im</strong> Einheitsverlegepreis vermischt. In den letzten Jahren<br />
konnte so auch ein fairer Umgang zwischen Bauunternehmer<br />
und Bauherr erreicht werden.<br />
Bauphase<br />
An die ca. zwei- bis dreijährige Planungs- und Genehmigungsphase<br />
schließt sich die Bauphase an. Zu Beginn eines Projektes<br />
steht der Termin für die Inbetriebnahme der Leitung (in<br />
der Regel der 1. Oktober als Beginn des Gaswirtschaftsjahres)<br />
fest. Der Bau in den Wintermonaten wurde bei E.ON Ruhrgas<br />
in den letzten Jahren vermieden, da aufgrund der niedrigen<br />
Temperaturen, der kürzeren hellen Tageslichtphasen und der<br />
Bild 4: Fledermauspopulation, die <strong>im</strong> Zuge einer Baumaßnahme<br />
temporär umgesiedelt wurde (Fa. Bohn Engineering, Bayreuth)<br />
Bild 5: Ameisenbläuling,<br />
der wegen niedriger Temperaturen<br />
nicht schlüpfen<br />
wollte [6]<br />
oft nassen Witterung die Gefährdung der Mitarbeiter sowie<br />
der Umwelt deutlich höher ist, als in den Sommermonaten.<br />
Daher wurde die Bauzeit oft für die Monate April bis Oktober<br />
geplant. In dieser Zeit 100 km Hochdruckleitung zu verlegen<br />
erfordert mehr als eine Baufirma, weshalb die gesamte<br />
Baustelle in der Regel in mehrere Baulose unterteilt wird.<br />
Dennoch ist zur rechtzeitigen Inbetriebnahme einer Leitung<br />
ein reibungsloser Ablauf aller Gewerke auf der Baustelle erforderlich.<br />
Unvorhergesehene Ereignisse, wie der Ausfall von<br />
Maschinen, Schlechtwetterperioden oder Probleme bei der<br />
Verlegung der Leitung können zwar bedingt eingeplant werden,<br />
lassen Terminpläne aber dennoch schnell aus dem Ruder<br />
laufen. Daher wurde in den letzten Jahren Maßnahmen entwickelt,<br />
um zeitliche Puffer <strong>im</strong> Projekt zu haben.<br />
Leitungsbaustellen sind sogenannte Linienbauwerke bei<br />
denen ein Gewerk dem nächsten folgt. Angefangen be<strong>im</strong><br />
Mutterbodenabtrag erfolgt anschließend die Rohrausfuhr,<br />
dann das Verbinden der Rohre, die Herstellung des Rohrgrabens,<br />
das Absenken der Rohre, die Wiederverfüllung des<br />
Rohrgrabens und die Wiederherstellung der Oberfläche. Wird<br />
dieser Bauablauf gestört, z.B. durch nicht baufreie Grundstücke<br />
oder Bauzeitenbeschränkungen, werden Maßnahmen erforderlich,<br />
die zu einer zeitlichen Verzögerung der Baumaß-<br />
11 / 2011 821
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
diesem Hintergrund wurden mit Baufirmen Seminare durchgeführt,<br />
um die Sicherheit auf den Baustellen weiter zu erhöhen.<br />
Die gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen finden eine<br />
hohe Akzeptanz be<strong>im</strong> Bauherrn und dem bauausführenden<br />
Unternehmen. Es muss allerdings sichergestellt werden,<br />
dass jeder einzelne Mitarbeiter die Maßnahmen auch einhält.<br />
Treten Unfälle dennoch auf, so werden diese analysiert<br />
und Maßnahmen zur Vermeidung abgeleitet. Diese Maßnahmen<br />
werden auf der Baustelle und <strong>im</strong> Hause erläutert. Ein wesentlicher<br />
Aspekt ist aber auch, über diese Unfälle in einem<br />
größeren Kreis extern zu berichten, um auch bei anderen Unternehmen<br />
der gleichen Branche derartige Unfälle künftig zu<br />
vermeiden. Hier ist die E.ON Ruhrgas <strong>im</strong> letzten Jahr zusammen<br />
mit der EWE aus Oldenburg mit gutem Beispiel vorangeschritten<br />
und hat <strong>im</strong> Rahmen einer Fachkonferenz Unfälle<br />
und die erforderlichen Maßnahmen zu deren Vermeidung<br />
dargestellt und diskutiert. Auch das ist gesellschaftliche Verantwortung.<br />
Im Falle eines Unfalls mit Personenschaden sind es in der<br />
Regel die Bauleiter vor Ort, die als erste an einer Unfallstelle<br />
ankommen und den Verletzten betreuen bzw. bergen müssen.<br />
Bauleiter sind Experten in Sachen Leitungsbau, aber<br />
keine Sanitäter oder Rettungsfachleute und daher oft auch<br />
psychisch stark belastet. Darüber hinaus ist kurz nach dem<br />
Unfall die Frage der Verantwortung noch offen: Waren alle<br />
Sicherheitsunterweisungen erteilt? Sind die Arbeitszeitvorschriften<br />
eingehalten worden? Viele andere offene Fragen<br />
belasten die verantwortlichen Personen vor Ort. Daher<br />
ist die sachgerechte Aufklärung der Vorgänge für alle Projektbeteiligten<br />
von höchster Priorität. Bei besonders schwenahme<br />
und zu hohen Kosten führen können. Folgendes Beispiel<br />
verdeutlicht das:<br />
Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens war eine Bauzeitenbeschränkung<br />
für einen begrenzten Bauabschnitt<br />
auferlegt worden, um dem Ameisenbläuling (Bild 5) das<br />
Schlüpfen aus den Larven zu ermöglichen. Diese Bauzeitenbeschränkung<br />
war dem Unternehmen bekannt und es<br />
konnte seine Bauzeitenplanung entsprechend ausführen.<br />
Aufgrund der nassen und kalten Witterung <strong>im</strong> Sommer<br />
verzögerte sich allerdings der Schlupf des Ameisenbläulings<br />
und die baubegleitende ökologische Bauleitung gab<br />
die Baustelle <strong>im</strong> betroffenen Abschnitt nicht frei. Hierdurch<br />
entstanden nicht nur erhebliche Kosten für die Umsetzung<br />
der Baumaschinen, auch die Mitarbeiter wurden<br />
durch diese zusätzlichen Arbeiten belastet.<br />
Durch die nasse Witterung mussten darüber hinaus die<br />
Arbeiten teilweise zum Schutz des Bodens eingestellt<br />
werden.<br />
Dies sind nur einige Beispiele, die verdeutlichen, dass trotz guter<br />
Planung und kompetenter Baufirmen der einzelne Mitarbeiter<br />
stark beansprucht wird, um das Projekt erfolgreich zu<br />
beenden. Um die Arbeitssicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten,<br />
wird über alle Hierarchieebenen klargestellt, dass<br />
die Sicherheit auf der Baustelle Priorität vor der Inbetriebnahme<br />
der Leitung hat. Dennoch versuchen alle, den Inbetriebnahmetermin<br />
einzuhalten, wobei die Arbeitsschutzbest<strong>im</strong>mungen<br />
<strong>im</strong>mer <strong>im</strong> Vordergrund stehen müssen.<br />
Trotzt wiederholter Sicherheitsunterweisungen kann es<br />
auf Großbaustellen mit mehreren 100 Mitarbeitern zu Unfällen<br />
kommen, teilweise leider auch mit Personenschäden. Vor<br />
Bild 6: Seitenbaum mit<br />
Überrollbügel (Heike Baumewerd-Schmidt<br />
m.a.,<br />
beratende Archäologin,<br />
St. Augustin)<br />
822 11 / 2011
Corporate Responsibility (CR)<br />
Heute werden die Themen Nachhaltigkeit und unternehmerische<br />
Verantwortung unter dem Begriff „Corporate Responsibility“<br />
(abgekürzt CR) zusammengefasst. CR steht<br />
sowohl bei großen Konzernen als auch <strong>im</strong> Mittelstand <strong>im</strong><br />
Fokus von Unternehmensleitungen und Fachabteilungen.<br />
Allerdings herrscht oft noch Verwirrung, wenn über CR,<br />
Nachhaltigkeit oder Unternehmensethik diskutiert wird. Wie<br />
definiert man CR? Eine Definition bietet der WBCSD (World<br />
Business Council for Sustainable Development):<br />
“Explicitly, the WBCSD defines CR as a concept that embraces<br />
the integration of social and environmental values<br />
within a company’s core business operations and […] engagement<br />
with stakeholders to <strong>im</strong>prove the wellbeing of<br />
society.” (WBSCD, 2002)<br />
Der WBCSD definiert CR als ein Konzept, das die Integration<br />
von sozialen und ökologischen Werten innerhalb des<br />
Kerngeschäfts eines Unternehmens und den Austausch mit<br />
Interessengruppen umfasst, um das Wohlergehen der Gesellschaft<br />
zu verbessern.<br />
Doch die Wahrnehmung der sogenannten „CR-Themen“<br />
ist – sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei Mitarbeitern<br />
– <strong>im</strong>mer noch hauptsächlich von sozialen Schwerpunkten<br />
geprägt. Oft wird CR mit dem Engagement eines<br />
Unternehmens für soziale Projekte, der Förderung des<br />
Ehrenamtes oder der Spenden für gemeinnützige Organisationen<br />
in Verbindung gebracht. „Tue Gutes und rede<br />
darüber“ ist nicht selten der Fokus, der CR in der Vergangenheit<br />
geprägt hat. Doch CR wird heute anders definiert,<br />
dies wird auch in der Beschreibung des WBCSD<br />
deutlich: CR bedeutet professionelles CR-Management,<br />
das zahlreiche Themen und vor allem schon bestehende<br />
Strukturen, Richtlinien und Prozesse zusammenfasst und<br />
so die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie<br />
gewährleistet. CR ist kein Marketing- oder PR-Instrument,<br />
um die Reputation zu unterstützen, sondern muss<br />
<strong>im</strong> Kerngeschäft verankert sein. Die Bandbreite der CR-<br />
Themen ist groß: positive Kundenorientierung, ein ausgewogener<br />
Energiemix, nachhaltige CO 2<br />
-Reduktion und die<br />
damit verbundene Technologieentwicklung, eine verantwortungsvolle<br />
Beschaffung, Umweltschutz und Arbeitssicherheit<br />
für eigene Mitarbeiter und die Mitarbeiter beauftragter<br />
Unternehmen sind Beispiele der unternehmerischen<br />
Verantwortung. Das professionelle CR-Management<br />
konzentriert sich auf die Einbindung von CR in alle<br />
Geschäftsprozesse. So ist fast jeder Bereich eines Unternehmens<br />
betroffen und aufgefordert, CR entlang der<br />
Wertschöpfungskette zu <strong>im</strong>plementieren.<br />
Fakt ist, auf politischer, gesellschaftlicher und unternehmerischer<br />
Ebene besteht ein breiter Konsens, dass Unternehmen<br />
und deren Mitarbeiter gesellschaftliche Verantwortung<br />
übernehmen müssen: Sie sollen ihre Verantwortung<br />
als gesellschaftliche Akteure wahrnehmen und auf<br />
freiwilliger Basis zur Lösung ökologischer und sozialer Probleme<br />
beitragen. Genau das tun sie, wenn sie die Verantwortung<br />
von Projekten übernehmen und sich für eine nachhaltige<br />
und ethisch vertretbare Umsetzung einsetzen. Zudem<br />
lässt sich für das Unternehmen ohne eine grundlegende gesellschaftliche<br />
Akzeptanz kein Geschäft auf Dauer nachhaltig<br />
oder erfolgreich betreiben.<br />
Aber nicht nur die Erwartungen der Öffentlichkeit müssen<br />
heute in die Unternehmensstrategie und in die Projektplanung<br />
einfließen. Ratingagenturen und Finanzinvestoren<br />
beziehen CR-Aspekte in zunehmender Weise – als „extrafinancials“<br />
– in ihre Analyseurteile und Investmententscheidungen<br />
ein, da eine ausschließlich auf finanziellen Kennzahlen<br />
basierende Analyse – sei sie auch noch so detailliert und<br />
streng – den Unternehmenswert und die Risikoexposition<br />
nicht adäquat erfassen kann. Die Entwicklung ist ebenfalls<br />
bei der Projektfinanzierung zu beobachten. Werden vorgegebene<br />
CR-Standards nicht erreicht, ist eine Finanzierung<br />
ausgeschlossen oder die Kapitalkosten erhöhen sich<br />
aufgrund der höheren Risikoexposition des Unternehmens.<br />
Insbesondere bei Investitionen <strong>im</strong> Ausland müssen heutzutage<br />
internationale Standards eingehalten werden. So werden<br />
z. B. die IfC-Standards (International Finance Corporation/World<br />
Bank Group), die Equator Principles oder die<br />
OECD-Richtlinien als zusätzliche Anforderungen an ein Projekt<br />
mit einbezogen. Wo früher der Fokus generell mehr auf<br />
den Umweltaspekt ausgerichtet war, stehen heute gerade<br />
bei Projekten in Schwellen- und Entwicklungsländern zusätzliche<br />
Themen wie die Einhaltung der Menschenrechte,<br />
Vermeidung von Kinderarbeit oder die Nutzung von lokalen<br />
Zulieferern an.<br />
… verbindet die Märkte<br />
823 10 / 2010 10 / 2010 823<br />
11 / 2011 823
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
ren Unfällen kann auch eine Traumatisierung der Mitarbeiter<br />
nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn schwere Unfälle<br />
nur extrem selten vorkommen, wurden in den letzten Jahren<br />
regelmäßig für Projekt- und Bauleiter Traumapräventionsseminare<br />
als vorbeugende Maßnahme durchgeführt, um<br />
die mit einer möglichen Traumatisierung verbundenen Symptome<br />
rechtzeitig erkennen und geeignete Hilfsmaßnahmen<br />
einleiten zu können. Der Schutz der Mitarbeiter steht <strong>im</strong>mer<br />
<strong>im</strong> Vordergrund.<br />
Die Erhöhung der Sicherheit auf der Baustelle kostet den<br />
Bauherrn Geld und verteuert die Investition. Beispiele sind<br />
die Forderung nach Überrollbügeln an schweren Baumaschinen<br />
(Bild 6) sowie mehr Sicherheitspersonal zur Überwachung<br />
der Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen. Es besteht<br />
<strong>im</strong> Unternehmen Einigkeit darüber, dass diese Mehrkosten<br />
gut investiert sind.<br />
Nach dem Bau<br />
Seit mehreren Jahren werden nach jedem erfolgreichen Abschluss<br />
eines Leitungsbauprojektes sogenannte „Lessons<br />
Learned Seminare“ durchgeführt [4]. Dabei wird das Projekt<br />
von Beginn an anhand klar definierter Kriterien reflektiert. Alle<br />
am Projekt beteiligten Bauleiter, Teilprojektleiter sowie die<br />
wesentlichen Projektmitglieder nehmen an der in der Regel<br />
zwei Tage dauernden Veranstaltung teil und berichten über<br />
positive und negative Erfahrungen die <strong>im</strong> Laufe des Projektes<br />
aufgetreten sind. Aus diesem konstruktiven Rückblick leiten<br />
sich eine Reihe von Maßnahmen ab, die in laufende oder<br />
geplante Projekte einfließen. Die Benennung einzelner persönlich<br />
verantwortlicher Mitarbeiter für besonders relevante<br />
Themen sichert die Umsetzung der Lessons Learned – besonders,<br />
wenn derartige Umsetzungen noch in der Zielvereinbarung<br />
des Mitarbeiters verankert werden.<br />
Fazit<br />
Gesellschaftlich verantwortungsvolles und ethisch korrektes<br />
Verhalten in großen Investitionsprojekten ist wichtig für den<br />
Projekterfolg. Die Akzeptanz für Infrastrukturprojekte in der<br />
Öffentlichkeit und bei Genehmigungsbehörden wird nur dann<br />
erreicht, wenn alle das verantwortungsbewusste Handeln erkennen<br />
und umsetzen. Einige ausgewählte Beispiele wurden<br />
oben beschrieben. CR sorgt dafür, dass wichtige Projekte auch<br />
künftig ethisch vertretbar und von der Bevölkerung akzeptiert<br />
realisiert werden können. Die Erfahrungen <strong>im</strong> Leitungsbau sollten<br />
als Beispiel für „gelebte CR“ auch in andere Projekte und<br />
Prozesse einfließen. Letztlich muss CR sowohl in der Unternehmensstrategie<br />
verankert sein als auch durch das verantwortungsvolle<br />
Handeln eines jeden Mitarbeiters gelebt werden<br />
– nur so profitieren Mensch, Umwelt und Unternehmen.<br />
Literatur<br />
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Raumordnungsverfahren<br />
[2] Breilmann, S.: Mehr Sicherheit und Umweltschutz durch<br />
opt<strong>im</strong>ierte Arbeitsstreifen. <strong>3R</strong> International, (2009) Nr. 8,<br />
S. 459-462<br />
[3] Hilgenstock, A.; Terzic, M.: Einführung digitaler Planfeststellungsunterlagen<br />
<strong>im</strong> Leitungsbau. <strong>3R</strong> International,<br />
(2007) Nr. 4, S. 210-212<br />
[4] Hüwener, T.; Hilgenstock, A: Effizienzsteigerungen bei<br />
Planung, Bau und Betrieb von Gashochdruckleitungen.<br />
<strong>3R</strong> International, (2009) Nr. 8, S. 454-458<br />
[5] Piechowiak, L.: Berechnung der Dauer von Leitungsbauprojekten<br />
in Abhängigkeit vom Starttermin. Bachelorarbeit<br />
TFH Georg Agricola, Bochum, in Zusammenarbeit mit E.ON<br />
Ruhrgas AG, Essen, 2010<br />
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkler_Wiesenknopf-<br />
Ameisenbl%C3%A4uling<br />
Autoren<br />
Dr. Ach<strong>im</strong> Hilgenstock<br />
Leiter Technische Kooperationsprojekte<br />
E.ON Ruhrgas AG, Essen<br />
Tel. +49 201 184 8387<br />
E-Mail: ach<strong>im</strong>.hilgenstock@eon-ruhrgas.com<br />
Kirsten Willings<br />
Leiterin Corporate Responsibility<br />
E.ON Ruhrgas AG, Essen<br />
Tel. +49 201 184 3994<br />
E-Mail: kirsten.willings@eon-ruhrgas.com<br />
824 11 / 2011
Baumwurzeln und erdverlegte<br />
Leitungsanlagen<br />
Ursachen und Folgen einer komplexen Koexistenz<br />
Von Michael Honds<br />
Rohrleitungsbeschädigungen an Gas- und Wasserversorgungsleitungen und Wurzeleinwuchs in Abwassersysteme<br />
verursachen jährlich mehrere Millionen Euro Schaden. Berechnungen zufolge muss von einem Gesamtsanierungsvolumen<br />
von rund 50 Milliarden Euro deutschlandweit ausgegangen werden. Aber was nutzen Sanierungen und Erneuerungen<br />
ohne effektiven Präventivschutz und ohne das Erkennen der eigentlichen Problematik? Das Sachverständigenbüro<br />
Michael Honds beschäftigt sich seit 1993 Jahren eingehend mit der Problematik der Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen.<br />
Hierbei stehen zwei Betrachtungs- und Ansatzpunkte <strong>im</strong> Vordergrund:<br />
die dynamische und statische Kraftübertragung des Wurzelwerks eines Stadtbaums auf erdverlegte Ver- und Entsorgungsanlagen<br />
mit zum Teil sehr hohem Gefährdungspotenzial (Gasversorgungsleitungen, Transportleitungen der<br />
petrochemischen Industrien, Pipelineanlagen der Mineralölfirmen)<br />
der Wurzeleinwuchs in das private und kommunale Kanalsystem mit Folgebeschädigungen (Wurzeleinwuchs in die<br />
Kanalsysteme und Verstopfungen dieser)<br />
Wurzelwuchs <strong>im</strong> Bereich erdverlegter<br />
Versorgungsanlagen<br />
Im Laufe der Jahre haben wir aufgrund unserer eingehenden<br />
Untersuchungen eine ganze Reihe von <strong>im</strong>mer wiederkehrenden<br />
Phänomenen beobachtet, die sich durch hohe Wiederholungen<br />
als natürliche Erscheinungen mit botanischem Hintergrund<br />
entpuppt haben.<br />
So haben wir aufgrund umfangreicher Aufgrabungen an<br />
vermuteten Gefahrenstandorten herausgefunden, dass insbesondere<br />
die Baumarten Platane, Ahorn, Kastanie, Linde<br />
und Zeder zu Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen neigen.<br />
Diese Baumarten wachsen nicht nur „zielgerichtet“ in<br />
Richtung des Rohrgrabens, sondern nehmen die Leitungsanlagen<br />
als zusätzliche Haltepunkte förmlich an, indem sie diese<br />
komplett umschlingen. Durch diese Umschlingung werden<br />
die dynamischen und statischen Kräfte, die aus Windkrafteintrag<br />
in das Kronenwerk des Baumes resultieren, auf die Rohrleitungen<br />
übertragen. Die oben genannten Baumarten stammen<br />
vom Ursprung her zumeist aus bergischen Gebieten und<br />
sind somit klüftige und felsige Untergründe gewohnt. In ihrem<br />
natürlichen Umfeld nehmen diese Baumarten die Klüfte<br />
an und verankern sich fangarmartig in ihnen.<br />
In unseren Breitengraden verhalten sich diese Baumarten<br />
scheinbar ähnlich. Sie erkennen in den Rohrleitungsanlagen<br />
einen klüfteähnlichen, toten Körper <strong>im</strong> Boden, umschlingen<br />
diesen und verankern sich somit zur Stabilitätsopt<strong>im</strong>ierung<br />
an ihm. Bei der Platane waren in 95 % aller Aufgrabungen<br />
Zugschlingen und Druckstempelbildung an Leitungsanlagen<br />
zu beobachten.<br />
Zudem ist der Rohrleitungsgraben aufgrund seines leichten<br />
Aufbaus, der aus einem sandigen und offenen Gefüge besteht,<br />
ein „gefundenes“ und bevorzugtes Wuchsumfeld für<br />
die Baumwurzel. Die Bäume erkennen in der Rohrleitungszone<br />
eine bevorzugte Durchwurzelungszone, da dieser Bereich<br />
mit geringstem Widerstand erschlossen und durchzogen<br />
werden kann. Somit hat der Baum auf direkte Weise die<br />
zukünftige Wurzelwuchszone <strong>im</strong> ungünstigsten, da rohrleitungsnahen<br />
Umfeld erschlossen.<br />
Ein Beispiel für die Wurzeldynamik wird in Bild 1 deutlich.<br />
Die Wurzel entlang der Hausanschlussleitung aus Stahl<br />
ist beidseitig auf ca. 5 cm aufgeplattet, was bedeutet, dass<br />
dieser Weg bei starken Winden von der Wurzel <strong>im</strong> Boden zurückgelegt<br />
wird. Das hinter der Leitung ersichtliche Kabel ist<br />
wesentlich flexibler und kann durch seine günstigeren Materialeigenschaften<br />
(Flexibilität des Materials) diese Belastung<br />
noch ausgleichen.<br />
Bild 1: Zugschlinge unter HAS-Leitung<br />
11 / 2011 825
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Bild 2: Zugschlingen und Druckstempel<br />
an Leitung und Schadstelle nach Druckstempelentnahme<br />
Bild 3: Platanenstandort und Zugschlinge<br />
unter der Leitung<br />
Bild 4: Druckstempel<br />
an Leitung<br />
und Schadstelle nach<br />
Druckstempelentnahme<br />
Die Schadensmeldungen, die eine eindeutige Zuweisung<br />
in Richtung „Rohrleitungsschaden durch Wurzelwuchs“<br />
zulassen, sind zugegebener Maßen eher gering,<br />
was aus unserer Sicht jedoch daran liegt, dass ein<br />
Rohrleitungsschaden nicht eindeutig auf diese Interaktion<br />
hin untersucht wird. Somit erachten wir die Dunkelziffer<br />
in diesem Bereich als enorm hoch.<br />
Jedes Versorgungsunternehmen kann mindestens<br />
ein Fallbeispiel nennen, was glücklicherweise nicht mit<br />
solch enormen Ausmaßen und Opfern verbunden ist,<br />
wie das Beispiel aus einer niederrheinischen Stadt vor<br />
15 Jahren. Hier kam es aufgrund von Wechselwirkungen<br />
einer Platanenwurzel mit einer Erdgasleitung zu<br />
einem Schaden an der Gasleitung und einem Leck. Das<br />
austretende Gas diffundierte durch ein Fundament eines<br />
nahestehenden Hauses und führte zu einer folgenschweren<br />
Explosion, bei der ein Mensch starb, weitere<br />
verletzt wurden und ein enormer Sachschaden<br />
entstand.<br />
Bezogen auf die tragischen Auswirkungen ein bisher<br />
einzigartiger Fall, aber aufgrund umfangreicher Recherchen<br />
sind weitere zum Teil folgenschwere Gasschäden<br />
aufgrund dieser mechanischen Wechselwirkung<br />
deutschlandweit bekannt.<br />
Ein folgenschwerer Irrglaube ist es, dass ein Baum<br />
erst einmal einen stattlichen Umfang erreichen muss,<br />
um einen Schaden durch sein Wurzelwerk verursachen<br />
zu können. Im Fall des oben geschilderten Gasunglücks<br />
aus der niederrheinischen Stadt hatte die Platane einen<br />
Stammdurchmesser von 40 cm und das Alter des<br />
Baumes betrug rund 35 Jahre.<br />
Anhand dieses Umstands wird deutlich, dass es zum<br />
Teil sehr schwer ist, eindeutig zuzuordnen, ob und inwieweit<br />
ein Baum <strong>im</strong> Nahbereich von erdverlegten Versorgungsanlagen<br />
eine Gefahr darstellt oder nicht.<br />
Die wenigen technischen Regeln, die sich mit der<br />
Problematik der Baumstandorte <strong>im</strong> Nahbereich von<br />
Ver- und Entsorgungsanlagen, Pipelines und Transportanlagen<br />
beschäftigen, sind aus unserer Sicht unzureichend<br />
und risikobehaftet. So wird z. B. <strong>im</strong> GW 125 des<br />
DVGW bei einem eingehaltenen Sicherheitsabstand<br />
von über 2,50 m zwischen Baumachse und Rohrleitungsachse<br />
davon ausgegangen, dass außerhalb dieses<br />
Bereichs mit keinen weiteren Gefahren bezüglich<br />
Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen gerechnet<br />
werden muss. Eine unter Umständen folgenschwere<br />
Empfehlung, wenn man bedenkt, dass die hohen dynamischen<br />
Kräfte z. B. einer Platanenwurzel erst bei<br />
einem Abstand über 2,50 m komplett wirken. Untersuchungen<br />
der RWTH Aachen haben an einer 35 cm<br />
starken Platanenwurzel eine Bruchlast von 40 Tonnen<br />
ermittelt.<br />
Insgesamt halten wir den Ansatz einer botanischen<br />
Betrachtung der Begleitbegrünung von Versorgungstrassen<br />
für effektiver und sinnvoller. Denn Untersuchungen<br />
haben ergeben, dass eine ganze Reihe „anerkannter“<br />
(Galkliste) Baumarten kein Phänomen der<br />
826 11 / 2011
„Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen-Neigung“<br />
aufweisen.<br />
Das bedeutet, dass diese Baumarten wesentlich<br />
bedenkenloser und in Verbindung mit empfehlenswerten<br />
Schutzmaßnahmen versehen, sicher <strong>im</strong> Nahbereich<br />
von Ver- und Entsorgungsanlagen gepflanzt<br />
werden können.<br />
Dieser Ansatz der botanischen Betrachtung der sicheren<br />
Begleitgrünmaßnahme <strong>im</strong> Nahbereich von Verund<br />
Entsorgungsanlagen erscheint uns erheblich sicherer<br />
und sollte unbedingt weiter verfolgt werden.<br />
Weiterhin sollten von Seiten der Planungsabteilungen<br />
Baumstandorte <strong>im</strong> Vorfeld der Baumaßnahmen mit<br />
allen beteiligten Fachleuten der Ver- und Entsorger sowie<br />
den Grünflächenplanern abgesprochen werden. So<br />
können bereits <strong>im</strong> Vorfeld Gefahrenstandorte vermieden<br />
werden.<br />
Im Folgenden sollen einige Praxisbeispiele von Aufgrabungen<br />
an vermuteten Gefahrenstandorten die<br />
Wirkung der Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktion<br />
verdeutlichen:<br />
Beispiel 1: Platane, 35 Jahre an Gasleitung DN 200<br />
mit Schadstelle (Bild 2)<br />
Beispiel 2: Platane, 60Jahre an Gasleitung DN 150<br />
(Bild 3)<br />
Beispiel 3: Kastanie, 55 Jahre, Gasleitung DN 200<br />
mit Schadstelle (Bild 4)<br />
Beispiel 4: Kastanien, 50 Jahre Hausanschlussleitung<br />
Gas DN 50 (Bild 5)<br />
Beispiel 5: Platane, 30 Jahre, Hausanschlussleitung<br />
Gas DN 50, entnommener Wurzelstrang der sich<br />
spiralförmig um die HAS-Leitung gewunden hat<br />
(Bild 6)<br />
Die Darstellungen verdeutlichen die Vermutung, dass<br />
ein Baum nicht erst 80 Jahre alt und einen Stammdurchmesser<br />
von einem Meter erreicht haben muss,<br />
um eine Schaden durch sein Wurzelwerk zu verursachen.<br />
Bild 5: Kastanienstandort und Zugschlinge<br />
unter Leitung<br />
Bild 6: Spiralwurzel nach Entnahme<br />
von HAS-Leitung<br />
Schutz- und PräventivmaSSnahmen<br />
<strong>im</strong> Versorgungsbereich<br />
Zunächst möchten wir den Versorgungsbereich mitsamt<br />
der Problematik der dynamischen und statischen<br />
Belastungen erläutern.<br />
In diesem Bereich verfolgen wir seit vielen Jahren<br />
den Weg des kombinierten Schutzes. Zum einen die<br />
Altstandorterkennung und Einschätzung der jeweiligen<br />
Gefahren an diesem Standort und zum anderen<br />
den gezielten Präventivschutz mit Baumartwahl und<br />
sinnvollen technischen Schutzmaßnahmen.<br />
Bei der Altstandorterkennung und Einschätzung<br />
handelt es sich um ein speziell entwickeltes Gefahrenbaumkataster,<br />
das satellitengesteuerte Koordinaten<br />
der Baumstandorte <strong>im</strong> Versorgungsgebiet wiedergibt<br />
und alle erforderlichen Parameter zur Beurteilung des<br />
Gefährdungspotenzials beinhaltet.<br />
Bild 7: Beurteilung des Gefährdungspotenzials<br />
11 / 2011 827
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Bild 7 zeigt die erforderlichen Parameter zur Einschätzung<br />
und Beurteilung des Gefährdungspotentials auf.<br />
Mit Hilfe dieses Gefahrenbaumkatasters ist man nun in<br />
der Lage, Baumstandorte aus einem Versorgungsgebiet gefahrenorientiert<br />
zu bearbeiten. Handlungsbedarf und Handlungsart<br />
werden definiert und in Absprache aller beteiligten<br />
Fachabteilungen vorgenommen.<br />
Hier können z. B. auch schon Eingriffe in das Kronenwerk<br />
eines Baumes den erforderlichen Sicherheitsaspekt<br />
bedienen. Bei einer Platane z. B. ist es besonders wichtig,<br />
die dynamischen Kräfte einzudämmen. Dies kann durch die<br />
stufenweise Reduktion der Segelfläche eines Baumes erfolgen.<br />
Aber auch ein gezielter Wurzelschnitt (in Kombination<br />
mit einem Kronenschnitt) kann die gewünschte Sicherheit<br />
darstellen.<br />
In Einzelfällen kann es sicherlich auch sinnvoll sein eine<br />
Rohrleitungstrasse zu verlegen, soweit dies <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Flächennutzung möglich ist.<br />
Es gibt eine Fülle von Sicherungsmaßnahmen, die nicht<br />
zwangsläufig zur Fällung eines Baumes führen müssen. Da<br />
Bild 8: Wurzelschutzplatte glatt und Wurzelführungsplatte mit<br />
Längsrippen<br />
Bild 9: Leitungs zone als Wurzelzone<br />
jeder Baum <strong>im</strong> innerstädtischen Bereich eine Reihe wichtiger<br />
Aufgaben erfüllt, die neben der Gas- und Wasserversorgung<br />
und der Abwasserentsorgung existenziell für unser<br />
Leben <strong>im</strong> urbanen Raum sind, ist der Erhalt möglichst vieler<br />
Standorte von hoher Bedeutung.<br />
In dem Gefahrenbaumkataster werden alle Baumstandorte<br />
<strong>im</strong> Nahbereich der erdverlegten Versorgungsanlagen<br />
erfasst und in Gefahrenklassen eingestuft. Die Gefahrenklassen<br />
spiegeln dann auch die Priorität der Bearbeitung wider.<br />
Die Gefahrenklassen sind in A1, A2, B1, B2 und C unterteilt,<br />
wobei A1 die höchste und C die niedrigste Gefahrenklasse<br />
darstellt.<br />
Bisherige Baumkatastererstellungen haben ergeben,<br />
dass ca. vier relevante Bäume an jedem Kilometer Rohrnetz<br />
stehen, oder anders ausgedrückt, alle 250 m steht<br />
ein Baum mit geringem bis hohem Gefährdungspotenzial<br />
bezüglich Rohrleitungsbeschädigungen an einem Rohrnetz.<br />
Gemessen an den bisher ermittelten Ergebnissen muss<br />
bei sich ergebenden Gesamtzahl (bemessen auf die Gesamtlänge<br />
des Versorgungsnetzes) von ca. 25 % Baumstandorten<br />
mit hohem bis sehr hohem Gefährdungspotenzial<br />
ausgegangen werden.<br />
Aus der Beurteilung der Standortbedingungen, dem<br />
Wuchsverhalten des Baumes und der Rohrleitungsparameter<br />
ergeben sich die möglichen Schutzmöglichkeiten für<br />
bestehende Baumstandorte bzw. bestehende Rohrleitungsanlagen.<br />
Einen größeren Einfluss auf die Sicherstellung geplanter<br />
Baumstandorte und/oder Rohrleitungsanlagen gibt es<br />
in der Planungsphase. In dieser Phase können die geplanten<br />
Neuanlagen oder Baumstandorte in Bezug auf Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen<br />
sicher gestaltet werden.<br />
Das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 beschreibt zum Beispiel<br />
den Einbau von Schutzplatten. Der Einbau dieser<br />
Schutzplatten ist bei Abständen ab ca. 1,50 m (je nach<br />
Baum art) eine sichere Schutzmaßnahme.<br />
Diese Schutzplatten, bzw. möglichst lange Bahnenware<br />
ohne Verbindungsstellen, werden senkrecht vor die Leitungsanlage<br />
eingebaut und schützen somit die Leitungen<br />
vor direktem Zuwachs der Baumwurzeln (Bild 8).<br />
Der Einbau dieser Schutzbahnen bei einem geringeren<br />
Abstand als 1,50 m von Baumstandort zu Leitungskörper<br />
birgt jedoch große Gefahren für die Standsicherheit der<br />
Bäume. Besser ist hier der Einbau von Wurzelführungsplatten,<br />
die ein systematisches Ableiten der Wurzeln in den Untergrund<br />
bewirken und nebenbei auch die Oberflächen des<br />
Straßen- und Gehwegausbaus vor Beschädigungen durch<br />
Presswurzelbildung schützen.<br />
Ein weiterer Ansatz zum Schutz der Versorgungsleitungen<br />
vor Wurzelzuwachs ist das höhere Verdichten des Rohrleitungsgrabens.<br />
Das eingebrachte Rohrbettungsmaterial<br />
bzw. der Rohrgrabensand muss deutlich höher verdichtet<br />
werden, um die Drainagewirkung der Leitungsbettungszone<br />
zu verhindern. Diese Bereiche werden sehr schnell von den<br />
zielstrebigen Wurzeln erkannt und komplett angenommen.<br />
Ist die Wurzel erst einmal <strong>im</strong> Rohrgrabenbereich angelangt,<br />
so ist es, je nach Baumart, nur eine Frage der Zeit<br />
828 11 / 2011
is diese die Rohrleitung als zusätzlichen Verankerungspunkt<br />
ann<strong>im</strong>mt.<br />
Sollten die räumlichen Gegebenheiten es ermöglichen,<br />
so kann auch über die Anlage eines „Opfergrabens“ nachgedacht<br />
werden, der den ankommenden Wurzeln einen wesentlich<br />
geringer verdichteten Raum zur Verfügung stellt als<br />
in der angrenzenden Rohrgrabenzone.<br />
Die „Weiterentwicklung“ dieses Prinzips des hohen Verdichtungsgrads<br />
der Leitungsbettungszone kann mit dem Verfüllen<br />
von Flüssigboden erreicht werden. Dieser flüssige und<br />
selbstnivellierende Bodenersatz wird nach der Leitungsverlegung<br />
in den Rohrgraben eingebracht und garantiert ein sauerstoff-<br />
und feuchtearmes Substrat. Zudem stellt dieses Material<br />
durch seine hohe Dichte und Festigkeit eine nicht durchwurzelbare<br />
Zone dar. Dieses Material wird als Leitungsbettung<br />
um den Leitungskörper eingebracht und verhindert durch seine<br />
spezifischen Eigenschaften einen Wurzelzuwachs in Richtung<br />
der eingebetteten Leitungskörper.<br />
Ohne eine Verdichtung <strong>im</strong> Sinne der oben aufgeführten<br />
Methoden ist die Drainagewirkung eines Rohrgrabens ein Indikator<br />
für verstärkten Wurzelwuchs innerhalb dieser Zone.<br />
Bild 9 verdeutlicht dieses natürliche Wuchsverhalten <strong>im</strong> Bereich<br />
einer Erdgasleitung <strong>im</strong> Nahbereich eines Lindenstandorts.<br />
Alle Abbildungen verdeutlichen, dass die Koexistenz von<br />
erdverlegten Versorgungsanlagen und Bäumen <strong>im</strong> innerstädtischen<br />
Raum Gefahren und Risiken birgt und Neuanpflanzungen<br />
<strong>im</strong> Nahbereich von Versorgungsanlagen sowie Neuverlegungen<br />
<strong>im</strong> Nahbereich bestehender Baumstandorte grundlegend<br />
überdacht werden müssen. Auch die bestehenden Regelwerke<br />
sollten aus Sicht des Autors dem neuen Kenntnisstand<br />
angepasst werden.<br />
Ziel und Aufgabe unserer eingehenden Untersuchungen<br />
ist es, Empfehlungen für leitungsnahe Begrünungen zu definieren.<br />
Unser Hauptaugenmerk liegt in der Beurteilung und<br />
Definition der botanischen und leitungsspezifischen Zusammenhänge.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Problematik der Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen<br />
ist einem Großteil der kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmen<br />
bekannt. Jährlich müssen deutschlandweit<br />
mehrere Millionen Euro bereitgestellt werden, um<br />
Schäden aufgrund dieser Koexistenz von urbanem Baum und<br />
kommunaler Ver- und Entsorgung zu beseitigen. Es macht jedoch<br />
nicht den Anschein als solle sich hier etwas ändern, denn<br />
konsequente Veränderungen sind weder in botanischer noch<br />
in versorgungstechnischer Sicht erkennbar.<br />
Betrachtet man die botanische Seite der Zusammenhänge,<br />
so muss den Ver- und Entsorgern ein hohes „Eigenverschulden“<br />
attestiert werden. Rohrleitungsgräben stellen in ihren<br />
heutigen Aufbauformen und Verdichtungsgraden ein Paradies<br />
für Wurzeln dar. Gefolgt dem Leitsatz des „Weg des geringsten<br />
Widerstands“ stellt diese Zone zunächst den bevorzugten<br />
Wuchsraum für die Wurzeln der Straßenbäume dar.<br />
Erst durch diesen Umstand kommt es zu den nachfolgenden<br />
Umschlingungen und “Angriffen“ der Baumwurzeln auf die<br />
Rohrleitungsanlagen. Hierbei unterscheiden sich die Baumarten<br />
herkunftsspezifisch deutlich voneinander. He<strong>im</strong>ische Baumarten,<br />
wie Buche, Weide oder Birke nehmen zwar die Rohrleitungsgräben<br />
auch an, „benutzen“ gegenüber den Baumarten<br />
Platane, Ahorn, Linde, Kastanie und Zeder die Rohrleitung jedoch<br />
nicht als zusätzliche Verankerungspunkte. Es ist somit eine<br />
Kombination aus „falschem Verdichtungsgrad“ der Rohrleitungszone<br />
und „falscher Baumartwahl“ die zumeist zu Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen<br />
führt. Das Erkennen dieses<br />
Umstands sollte ein erster Einstieg für weitere Baumpflanzungs-<br />
bzw. Neuverlegungsmaßnahmen in der Zukunft sein.<br />
Unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Bedeutung<br />
von Baumbewuchs <strong>im</strong> urbanen Umfeld und der existenziellen<br />
Notwendigkeit von Ver- und Entsorgungsanlagen wird es<br />
Aufgabe der Fachleute aus Industrie, Technik und Ministerien<br />
sein, die Techniken und Methoden für ein gefahrenfreies und<br />
kostenschonendes Miteinander zu erarbeiten. Getreu unseres<br />
Leitsatzes: Heute der richtige Baum, an der richtigen Stelle,<br />
mit den richtigen Leitungssicherungseinbauten versehen gepflanzt,<br />
stellt morgen keine Gefahr dar.<br />
Autor<br />
Michael Honds<br />
Sachverständiger für Baumwurzel-<br />
Rohrleitungs-Interaktionen,<br />
Mönchengladbach<br />
Tel. +49 2166 552390<br />
E-Mail: info@baumwurzeln.de<br />
6. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 13. Juni 2012<br />
in Gelsenkirchen<br />
Veranstaltet von:<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
11 / 2011 829
Projekt kurz beleuchtet<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Zellstoffproduktionsbetrieb<br />
erzeugt Biogas<br />
Betriebskosten reduziert und Carbon Footprint gesenkt<br />
Die Schweighofer Gruppe, ein österreichisches Familienunternehmen<br />
mit dem Kernbereich Holzindustrie, beauftragte<br />
Aquantis mit dem Bau einer Abwasserbehandlung mit Biogaserzeugung<br />
in Hallein. Die neue Anlage wird künftig täglich<br />
rund 5.700 m³ Wasser mit einer organischen Fracht von 62 t<br />
CSB reinigen und dabei auf umweltverträgliche Weise Biogas<br />
mit einer Feuerungsleistung von ca. 4 MWh produzieren.<br />
Das in der Produktion entstehende Abwasser wird zurzeit<br />
in einer werkseigenen anaeroben/aeroben Behandlungsanlage<br />
gereinigt und anschließend in die Salzach als Vorfluter eingeleitet.<br />
Durch die Umstellung der Produktion wird zukünftig<br />
zusätzlich ein Bleichereikonzentrat entstehen, das einen Zuwachs<br />
an organischen Inhaltsstoffen bewirkt. Für eine energetische<br />
Nutzung zur Herstellung von Biogas und zur Entlastung<br />
der bisherigen Anaerob-Anlage wird die Erweiterung der<br />
vorhandenen Abwasserbehandlungsanlage notwendig. Die<br />
Kernkomponenten der neuen Anlage sind leistungsfähige<br />
BIOBED ® EGSB-Reaktoren. Im Interesse einer hohen Betriebssicherheit<br />
wurden die Reaktoren mit einer moderaten Raumbelastung<br />
ausgelegt. Darüber hinaus weisen sie keine Einbauten<br />
innerhalb des aktiven Reaktionsvolumens auf, so dass die<br />
Menge an anaerober Biomasse max<strong>im</strong>iert und damit die<br />
Schlammbelastung min<strong>im</strong>iert werden kann. Das entstehende<br />
Biogas wird dem vorhandenen Biomassenheizkraftwerk zugeführt<br />
und trägt mit seiner Leistung wesentlich zur Reduzierung<br />
der Betriebskosten und zur Verminderung des Carbon<br />
Footprints bei.<br />
Der Neubau ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms<br />
zur strategischen Neuausrichtung dieses Standorts,<br />
der sich auf die Herstellung von hochwertigem Zellstoff und<br />
Bioenergie konzentriert. Die Schweighofer Fiber GmbH erzeugt<br />
derzeit mit rund 200 Beschäftigten jährlich etwa<br />
160.000 Tonnen Zellstoff, überwiegend für die europäische<br />
Papierindustrie. Gleichzeitig ist das Unternehmen einer der<br />
bedeutendsten Lieferanten von erneuerbarer Energie <strong>im</strong> Bundesland<br />
Salzburg und einer der wichtigsten Holzabnehmer in<br />
Österreich.<br />
Kontakt<br />
Veolia Water Solutions & Technologies, Celle, Stefan Jakubik,<br />
Tel. +49 5141 803-174,<br />
E-Mail: stefan.jakubik@veoliawater.com<br />
Bild 1: Luftbild des<br />
Standortes Hall<br />
830 11 / 2011
<strong>3R</strong><br />
als Heft<br />
oder<br />
als ePaper<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift für die<br />
Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und Verfahren <strong>im</strong><br />
Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
Gratis für Sie: Das Tabellenbuch für den Rohrleitungsbau<br />
Kompakt aufbereitete Daten und Kennwerte für Planer, Konstrukteure und Betreiber von Rohrleitungsanlagen.<br />
Dieses nützliche Nachschlagewerk beantwortet alle Fragen <strong>im</strong> Rohrleitungsbau. Es<br />
ist die ideale, praxisbezogene Ergänzung für Fach- und Lehrbücher der Rohrleitungstechnik.<br />
Hrsg.: MCE Energietechnik GmbH<br />
15. Aufl age 2006, 520 Seiten, Broschur<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder <strong>im</strong> Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen. Bitte schicken Sie mir die Fachpublikation<br />
□ als gedrucktes Heft für € 263,- zzgl. Versand (Deutschland: € 27,- / Ausland: € 31,50) pro Jahr<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) für € 263,- pro Jahr<br />
Als Dankeschön erhalte ich das „Tabellenbuch für den Rohrleitungsbau“ gratis.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr.<br />
Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von<br />
€ 20,- auf die erste Jahresrechung belohnt..<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN0311<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Wasserverlustmanagement<br />
– Grundlagen und aktuelle<br />
<strong>Entwicklungen</strong><br />
Von Dr. Jörg Kölbl<br />
Wasserverluste und Schadensraten von Wasserversorgungssystemen sind wichtige Indikatoren für den Zustand der<br />
Rohrnetze. Aus dem Wasserverlustmanagement gezogene Erkenntnisse stellen eine wichtige Basis für die Betriebsund<br />
Instandhaltungsplanung, insbesondere für die Rehabilitationsplanung, dar. Dieser Beitrag beschreibt grundlegende<br />
Methoden des Wasserverlustmanagements, gibt einen kurzen Überblick über mögliche Strategien zur Netzüberwachung<br />
und zur Reduzierung von Wasserverlusten und geht auf aktuelle <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Richtlinienwesen<br />
(DVGW, ÖVGW) ein.<br />
1 Einleitung<br />
Verglichen mit einer typischen Situation in Deutschland oder<br />
Österreich sind die Verluste aus Wasserversorgungssystemen<br />
global gesehen oft dramatisch höher und stellen große Probleme<br />
für die Versorgungssicherheit dar. Vor dem Hintergrund<br />
eines ständig steigenden globalen Wasserbedarfs aufgrund<br />
wachsender Weltbevölkerung, zunehmende Verstädterung<br />
und Industrialisierung, Zunahme der künstlichen Bewässerung<br />
sowie Auswirkungen des Kl<strong>im</strong>awandels kommt dem effektiven<br />
Management von Wasserverlusten <strong>im</strong>mer größere<br />
Bedeutung zu.<br />
Kingdom et al. (2006) schätzen die jährlichen realen Wasserverluste<br />
in entwickelten Staaten auf 9,8 Mrd. m³, in Eurasien<br />
(GUS) auf 6,8 Mrd. m³ und in Entwicklungsländern auf<br />
16,1 Mrd. m³, also insgesamt auf 32,7 Mrd. m³, was ca. dem<br />
45-fachen des jährlichen Trinkwasserbedarfs von Österreich<br />
entspricht.<br />
Zur Lösung des Problems werden oftmals ressourcenseitige<br />
Erweiterungen durch den Bau von energieintensiven<br />
Meerwasserentsalzungsanlagen oder die Ausbeutung<br />
von nicht erneuerbaren Tiefengrundwasserkörpern angestrebt.<br />
In vielen Fällen stellt das Erweitern der Ressourcen<br />
aber nur eine Bekämpfung der Symptome dar, da oftmals<br />
die vorhandene Infrastruktur in einem schlechten Zustand<br />
ist und ohne eine Bekämpfung der Ursachen weiterhin<br />
große Anteile der in die Wasserversorgungssysteme<br />
eingespeisten Wassermengen über Leckagen in den Untergrund<br />
versickern.<br />
Dem Management von Wasserverlusten kommt aber<br />
nicht nur aus Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit<br />
eine wichtige Rolle zu, sondern können aus der Höhe von<br />
Wasserverlusten und der Dynamik von auftretenden Schäden<br />
wichtige Informationen über den Zustand der Rohrnetze<br />
abgeleitet werden. Aus Gesichtspunkten der Instandhaltungsplanung<br />
ist ein funktionierendes Wasserverlustmanagement<br />
auch für Versorgungssysteme in gutem Zustand<br />
essentiell. Dieser Thematik wird auch in Mitteleuropa gerade<br />
<strong>im</strong> Hinblick auf ein effizientes Erhalten der Wasserversorgungsnetze<br />
in gutem Zustand <strong>im</strong>mer mehr Aufmerksamkeit<br />
geschenkt.<br />
2 Richtlinien zu Wasserverlusten<br />
Das DVGW-Arbeitsblatt W 392 (2003) ist eine der ersten<br />
Richtlinien <strong>im</strong> deutschen Sprachraum, welche die Methoden<br />
der Netzüberwachung und Leckortung umfassend beschreibt.<br />
Auch beinhaltet die DVGW W 392 (2003) bereits<br />
die von der IWA (International Water Association) empfohlene<br />
standardisierte Wasserbilanz.<br />
Aufgrund neuer Erkenntnisse <strong>im</strong> Bereich der Bewertung<br />
und Reduzierung von Wasserverlusten überarbeitete die<br />
Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach<br />
(ÖVGW) die Wasserverlustrichtlinie ÖVGW W 63 Ausgabe<br />
4/1993. Unter Berücksichtigung internationaler <strong>Entwicklungen</strong><br />
und Standards zur Wasserverlustbewertung und<br />
-reduzierung sowie der technischen <strong>Entwicklungen</strong> <strong>im</strong> Bereich<br />
der Rohrnetzüberwachung und Leckortung beinhaltet<br />
die überarbeitete ÖVGW W 63 (2009) praktikable Kennwerte<br />
mit Interpretations- und Handlungsempfehlungen.<br />
Erstmalig werden in dieser Richtlinie technische Überwachungsmöglichkeiten<br />
für hydraulisch nicht getrennte Netzbereiche<br />
beschrieben. Des Weiteren versucht die Richtlinie<br />
die praktische Anwendbarkeit für verschiedenste Versorgungsstrukturen<br />
und -größen zu gewährleisten.<br />
Das grundsätzliche Erfordernis des Niedrighaltens von<br />
Wasserverlusten in Trinkwasserversorgungssystemen ist<br />
als ein wesentliches Instandhaltungsziel in den einschlägigen<br />
Richtlinien ÖVGW W 100 (2007), DVGW W 400-<br />
3 (2006) und DVGW W 392 (2003) beschrieben. Diese<br />
Richtlinien geben auch einen Überblick über verschiedene<br />
Instandhaltungsstrategien, bei denen die Kenntnisse über<br />
Höhe, Verteilung und Entwicklung der Wasserverluste wesentliche<br />
Kriterien sind.<br />
832 11 / 2011
Tabelle 1: Wasserbilanz nach ÖVGW W 63 (2009)<br />
3 Berechnung und Beurteilung von<br />
Wasserverlusten<br />
3.1 Wasserbilanz<br />
Voraussetzung für das Berechnen von Wasserverlusten in<br />
Wasserversorgungsnetzen ist ein zuverlässiges Messen aller<br />
wichtigen Volumenströme des Versorgungssystems. Der<br />
wichtigste Punkt dabei ist zweifellos das Messen der in das<br />
System eingespeisten Mengen. Das ist die Basis für die Abschätzung<br />
der Höhe der Verluste. Aber auch das Messen von<br />
Wasserbezug und Wasserabgabe von bzw. an andere Wasserversorger,<br />
das Messen der Wasserabgabe an Direktversorgte<br />
sowie das Erfassen der unentgeltlichen Wasserabgabe<br />
(z. B. Feuerwehr, öffentliche Trinkbrunnen) sind essentiell<br />
für das Berechnen der Wasserbilanz.<br />
Die IWA hat in den IWA Blue Pages (Lambert & Hirner<br />
2000) eine Wasserbilanz entwickelt, die mittlerweile in<br />
vielen Staaten Verwendung findet (vgl. Liemberger, 2005).<br />
Unter anderem wurde diese Art von Wasserbilanz auch in<br />
die DVGW W 392 (2003) sowie die ÖVGW W 63 (2009)<br />
übernommen (Tabelle 1). Für die Berechnung von Wasserverlustkennzahlen<br />
werden die „Realen Wasserverluste“ herangezogen.<br />
3.2 Wasserverlustkennzahlen<br />
Zur Quantifizierung und Beurteilung der Höhe an Wasserverlusten<br />
sowie für die Beobachtung der Entwicklung der Wasserverluste<br />
bzw. den Vergleich mit anderen Wasserversorgungsunternehmen<br />
bedarf es definierter Kennzahlen.<br />
Bei der Verwendung von Kennzahlen ist es wichtig, die jeweiligen<br />
Rahmenbedingungen eines Versorgungssystems zu<br />
kennen und zu berücksichtigen. Die wichtigsten Einflussfaktoren<br />
auf die Höhe der Wasserverluste sind (vgl. ÖVGW W 63,<br />
2009 und DVGW W 392, 2003):<br />
die Struktur des Versorgungssystems (ländlich, städtisch,<br />
großstädtisch),<br />
der Betriebsdruck, Druckänderungen, Druckstöße,<br />
die Bodenart und Bodenbewegungen,<br />
die Verkehrbelastung sowie<br />
der Zustand des Rohrnetzes (Anzahl, Größe und Laufzeit<br />
der Leckstellen).<br />
3.2.1 Wasserverlustrate (%)<br />
Die Wasserverlustrate, also der prozentuelle Anteil der realen<br />
Verluste an der Systemeinspeisung findet <strong>im</strong>mer noch<br />
häufig Verwendung, obwohl diese Kennzahl für eine Beurteilung<br />
der Verluste aus technischen Gesichtspunkten völlig<br />
ungeeignet ist.<br />
Einerseits wird die Versorgungsstruktur (Länge des Rohrnetzes,<br />
Anzahl der Hausanschlüsse usw.) nicht berücksichtigt<br />
und andererseits erfolgt eine Division durch die Systemeinspeisung<br />
und dieser Wert ändert sich jährlich in Abhängigkeit<br />
von der Wasserabgabe. Dadurch kann es sein, dass die tatsächlichen<br />
Verluste eines Jahres <strong>im</strong> Vergleich zu einem anderen<br />
Jahr höher sind, während die Kennzahl eine niedrigere Rate<br />
ausweist, weil auch die Systemeinspeisung und die Wasserabgabe<br />
gestiegen sind.<br />
3.2.2 Infrastruktur Leckverlust Index (ILI)<br />
Der ILI wurde von der IWA Water Loss Task Force (Lambert<br />
et al., 1999) entwickelt und berücksichtigt mehrere wichtige<br />
Parameter, wie die Hausanschlussdichte, die durchschnittliche<br />
Hausanschlussleitungslänge oder die durchschnittliche<br />
Versorgungsdruckhöhe. Dadurch ermöglicht der ILI auch einen<br />
Vergleich der Wasserverluste unterschiedlicher Versorgungssysteme.<br />
Die Berechnung des ILI erfolgt durch die Gegenüberstellung<br />
der realen jährlichen Verluste (CARL, engl. Current Annual<br />
Real Losses) mit einem Referenzwert, den so genannten<br />
unvermeidbaren jährlichen Verlusten (UARL, engl. Unavoidable<br />
Annual Real Losses).<br />
ILI = CARL<br />
UARL<br />
CARL = reale jährliche Verluste (l/(AL · d)),<br />
AL = Anschlussleitung<br />
UARL = unvermeidbare jährliche Verluste (l/(AL · d))<br />
Der ILI gibt somit an, um das Wievielfache die jährlichen Verluste<br />
über dem Referenzwert der unvermeidbaren jährlichen<br />
Verluste UARL liegen.<br />
⎛<br />
UARL = 18⋅ l ⎞<br />
m<br />
⎜ + 0,8 + 0,025⋅l p ⎟<br />
⎝ n AL ⎠<br />
⋅p<br />
l m<br />
n AL<br />
l p<br />
p<br />
Systemeinspeisung<br />
Wasserabgabe<br />
Entgeltliche<br />
Abgabe<br />
Unentgeldliche<br />
Abgabe<br />
Wasserverluste<br />
Scheinbare<br />
Verluste<br />
Reale<br />
Wasserverluste<br />
Gemessener entgeltlicher Verbrauch<br />
Nicht gemessener entgeltlicher<br />
Verbrauch<br />
Gemessener unentgeldlicher<br />
Verbrauch<br />
Nicht gemessener unentgeldicher<br />
Verbrauch<br />
Zählerabweichungen und Fehler bei<br />
der Rechnungslegung<br />
Schleichverluste<br />
Unzulässige Wasserentnahme<br />
Zubringerleitungen<br />
Behälter<br />
Versorgungsleitungen<br />
Anschlussleitungen bis zum<br />
Wasserzähler<br />
= Gesamtlänge der Haupt- und Versorgungsleitungen<br />
(km)<br />
= Anzahl der Anschlussleitungen (Stk.)<br />
= durchschnittliche Länge der Anschlussleitungen<br />
von der Grundstücksgrenze bis zur Übergabestelle<br />
(Wasserzähler) (m)<br />
= durchschnittliche Versorgungsdruckhöhe (m)<br />
Der ILI konnte bereits in vielen Ländern in die Wasserverlustberechnung<br />
<strong>im</strong>plementiert werden. Internationale Erfahrungen<br />
zeigen, dass die Berechnung der Kennzahl gut funktioniert<br />
und dass es damit gelingt auch länderübergreifende<br />
Vergleiche durchzuführen, ohne weitere Gruppierungen, z. B.<br />
nach der Urbanität, vornehmen zu müssen.<br />
In Rechnung<br />
gestellte<br />
Wassermenge<br />
Nicht in<br />
Rechnung<br />
gestellte<br />
Wassermenge<br />
11 / 2011 833
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
In der ÖVGW W 63 (2009) ist der ILI die maßgebliche<br />
Kennzahl für die Bewertung der Höhe der Wasserverluste.<br />
Die UARL-Formel ist auch die Basis für die Klassifikation nach<br />
der Kennzahl Verluste bezogen auf Anschlussleitung und Tag,<br />
q AL<br />
(Tabelle 2).<br />
Da in die ILI Berechnung auch die Versorgungsdruckhöhe<br />
eingeht, ist zu berücksichtigen, dass mit dem Druck auch die<br />
realen Verluste ansteigen. Der ILI erlaubt somit eine Aussage<br />
zum Zustand des Versorgungssystems. Für Systeme mit<br />
hohen Versorgungsdruckhöhen werden somit höhere Verluste<br />
als Referenz „geduldet“. Daher sollte bei hohen Versorgungsdruckhöhen<br />
auch eine Druckreduktion als geeignete<br />
Maßnahme zur Wasserverlustreduzierung in Betracht gezogen<br />
werden.<br />
3.2.3 Reale Verluste bezogen auf Anschlussleitung<br />
und Tag, q AL<br />
(l/(AL · d))<br />
Diese Kennzahl berücksichtigt mit der Anzahl der Anschlussleitungen<br />
einen wesentlichen Einflussfaktor auf die realen<br />
Wasserverluste (ÖVGW W 63, 2009).<br />
q AL<br />
= Q VR ⋅1000<br />
n AL<br />
⋅365<br />
q AL<br />
= reale Verluste bezogen auf Anschlussleitung und Tag<br />
(l/(AL · d))<br />
Q VR<br />
= jährliche reale Verluste (m³/a)<br />
n AL<br />
= Anzahl Anschlussleitungen<br />
Unter Berücksichtigung der Anschlussdichte und Versorgungsdruckhöhe<br />
kann eine schnelle und einfache Bewertung<br />
für diese Kennzahl anhand von Tabelle 3 durchgeführt werden.<br />
Die Zahlenwerte basieren auf der UARL-Formel und sind für alle<br />
Versorgungsstrukturen anwendbar. In der Regel ist die Genauigkeit<br />
der Klassifikation ausreichend. Im Grenzfall zwischen<br />
zwei Klassen empfiehlt sich die direkte Berechnung des ILI.<br />
3.2.4 Reale Verluste bezogen auf Kilometer<br />
Leitungslänge (m³/(km · h))<br />
q L<br />
=<br />
Q VR<br />
l⋅8760<br />
Tabelle 2: Bewertungsschema für ILI und q AL<br />
(Verluste bezogen auf Anschlussleitungen) nach ÖVGW W 63<br />
(2009)<br />
ILI Klasse q AL<br />
Bewertung<br />
bis 2 A sehr geringe bis geringe Wasserverluste, weitere Reduktion könnte unökonomisch<br />
sein, genaue Analyse vor dem Setzen weiterer Maßnahmen empfohlen<br />
2 bis 4 B mittlere Wasserverluste, Poteltial für merkliche Verlustreduktionen vorhanden,<br />
Verbesserungen in der Leckkontrolle und <strong>im</strong> Infrastruktur-Management<br />
4 bis 8 C hohe Wasserverluste, Höhe und Gründe der Verluste analysieren und Anstrengungen<br />
zur Reduktion der Verluste intensivieren<br />
größer 8 D sehr hohe Wasserverluste, Höhe und Gründe der Verluste analysieren, ausgeprägte<br />
Leckkontrolle und Leckverlustreduktion umgehend durchführen<br />
Tabelle 3: Ausschnitt aus der Klassifizierungstabelle für reale Verluste je Anschlussleitung<br />
und Tag (Kölbl 2009)<br />
834 11 / 2011
Tabelle 4: Richtwerte für Reale Verluste bezogen auf Kilometer<br />
Leitungslänge nach DVGW W 392 (2003) in (m³/(km · h))<br />
q L<br />
Q VR<br />
l<br />
= reale Verluste bezogen auf Kilometer Leitungslänge<br />
(m³/(km · h))<br />
= jährliche reale Verluste (m³/a)<br />
= Länge Zubringer-, Haupt- und Versorgungsleitungen<br />
(km)<br />
Durch den Bezug der realen Verluste auf die Leitungslänge<br />
(Zubringer-, Haupt- und Versorgungsleitungen exkl. Anschlussleitungen)<br />
wird die Versorgungsstruktur teilweise berücksichtigt.<br />
Die Leitungslänge ist eine Größe, die sich <strong>im</strong> Allgemeinen<br />
nur langsam verändert.<br />
Der längenbezogene Wasserverlust wird in der DVGW<br />
W 392 (2003) als maßgebliche Kennzahl verwendet und es<br />
werden auch Richtwerte in Abhängigkeit von der Versorgungsstruktur<br />
(ländlich, städtisch, großstädtisch; Einstufung<br />
auf Basis der spezifischen Netzeinspeisung) angegeben (siehe<br />
Tabelle 4).<br />
Allerdings ist diese Klassifizierung durchaus als problematisch<br />
anzusehen, da es eine Korrelation zwischen Wasserverlusten<br />
und Anschlussdichte sowie spezifischer Netzabgabe<br />
gibt. Daher kann es v.a. an den Klassengrenzen zu Fehleinstufungen<br />
kommen.<br />
4.1 Druckmanagement<br />
Ein wichtiger Einflussfaktor für die Höhe der Wasserverluste<br />
ist der Versorgungsdruck. Höhere Drücke führen zu höheren<br />
Wasserverlusten und wirken sich insbesondere bei Rohrnetzen<br />
in schlechtem Zustand negativ auf Schadensraten aus.<br />
Für übliche Situationen in Österreich und Deutschland kann<br />
festgestellt werden, dass Druckmanagement (bewusstes<br />
Absenken des Versorgungsdruckes um Wasserverluste und<br />
Schadensraten zu reduzieren) für die meisten Wasserversorger<br />
kein Thema ist, da die Netze generell nach geltenden<br />
Richtlinien und Normen geplant sind und daher die Versor-<br />
Wasserverlustbereich<br />
Geringe<br />
Wasserverluste<br />
Mittlere<br />
Wasserverluste<br />
Hohe<br />
Wasserverluste<br />
Bereich 1<br />
(großstädtisch)<br />
spez. Rohrnetzeinspeisung<br />
> 15.000 m 3 /(km · a)<br />
Versorgungsstruktur<br />
Bereich 2<br />
(städtisch)<br />
spez. Rohrnetzeinspeisung<br />
5.000–<br />
15.000 m 3 /(km · a)<br />
Bereich 3<br />
(ländlich)<br />
spez. Rohrnetzeinspeisung<br />
< 5.000 m 3 /(km · a)<br />
< 0,10 < 0,07 < 0,05<br />
0,10–0,20 0,07–0,15 0,05–0,10<br />
> 0,20 > 0,15 > 0,10<br />
4 Methoden des<br />
Wasserverlustmanagements<br />
Bild 1 gibt einen Überblick über die grundlegenden Methoden<br />
<strong>im</strong> Wasserverlustmanagement. Das weiße Quadrat<br />
repräsentiert jene Verluste, die auch bei einem opt<strong>im</strong>alen<br />
Wasserverlustmanagement in der Regel nicht unterschritten<br />
werden können und das umliegende größere Quadrat stellt<br />
die potentiell einzusparenden Verluste dar, die sich je nach<br />
„Stärke“ der darauf einwirkenden Pfeile verändern.<br />
Bild 1: Grundlegende Methoden des Wasserverlust managements<br />
gungsdrücke zumeist zwischen 3 und 5 bar liegen. Allerdings<br />
sind unnötig hohe Drücke zu vermeiden. Es ist zu beachten,<br />
dass die in der ÖNORM B 2538 (2002) und ÖVGW-Richtlinie<br />
W 77 (2000) geforderten Netzdrücke auch bei außergewöhnlichen<br />
Betriebszuständen (z. B. Brandfall) eingehalten<br />
werden (vgl. ÖVGW W 63, 2009).<br />
In wie weit Maßnahmen zur Druckkontrolle, z. B. Absenken<br />
des Versorgungsdruckes in den Nachtstunden <strong>im</strong> Hinblick<br />
auf die Mindestanforderungen in den einschlägigen Normen<br />
und Richtlinien, aus ökonomischen Gesichtspunkten und Aspekten<br />
des Kundenservice und der Versorgungssicherheit<br />
11 / 2011 835
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
sinnvoll umsetzbar sind, muss für jedes (Teil-) System individuell<br />
beurteilt werden.<br />
4.2 Geschwindigkeit und Qualität der<br />
Reparatur<br />
Die Laufzeit einer Leckage beeinflusst die Gesamtaustrittsmenge<br />
maßgeblich. Daher, und um Folgeschäden zu vermeiden,<br />
sollen bei Erkennen einer Leckage Reparaturmaßnahmen<br />
rasch ergriffen werden.<br />
Zum Zeitpunkt der Reparatur bietet sich die Möglichkeit<br />
zur Dokumentation des Schadens. Qualität und Umfang der<br />
Schadensdokumentation sind eine essentielle Basis für Aufgaben<br />
der Instandhaltungsplanung insbesondere der Rehabilitationsplanung.<br />
Neben Fotos und Skizzen der Schadenssituation<br />
sind sämtliche wichtigen Anlagedaten (Material,<br />
Durchmesser, Alter, usw.) und Schadensdaten (Schadensart,<br />
Ursache, Zeitpunkt, Ort) zu dokumentieren und in eine<br />
Datenbank zu übertragen. Detaillierte Informationen zur<br />
Schadensstatistik sind in den Richtlinien DVGW W 400-3<br />
(2006), DVGW W 402 (2010) sowie ÖVGW W 100 (2007)<br />
und ÖVGW W 105 (2011) zu finden.<br />
4.3 Wasserverlustüberwachung und<br />
Leckortung<br />
Die Effektivität in der Kontrolle der Wasserverluste hängt<br />
maßgeblich von Art und Umfang der Netzüberwachungssysteme<br />
sowie der Leckortungsmaßnahmen ab. Je stichhaltiger<br />
die Informationen aus der Überwachung sind, desto<br />
schneller wird man auf Leckagen aufmerksam und desto<br />
zielgerichteter kann die Eingrenzung des betroffenen Bereiches<br />
erfolgen.<br />
Die Beschreibung aller gängigen Überwachungs- und<br />
Leckortungsmethoden würde den Rahmen dieses Beitrages<br />
sprengen. Detaillierte Informationen dazu finden sich unter<br />
anderem in der DVGW W 392 (2003), ÖVGW W 63 (2009)<br />
und in Heydenreich & Hoch (2008). Im Folgenden wird nur<br />
auf ausgewählte Methoden eingegangen.<br />
Bild 2: Prinzip der Überwachung physischer und virtueller Messzonen<br />
(Kölbl 2009)<br />
4.3.1 Netzüberwachung<br />
Bei der Auswahl der Überwachungsstrategie sind wirtschaftliche<br />
Aspekte zu beachten (z. B. Gestehungs- und Verteilungskosten)<br />
aber auch Aspekte der Versorgungssicherheit<br />
und des Risikomanagements zu berücksichtigen. Die Art der<br />
Überwachungsmaßnahmen wird wesentlich von der Struktur<br />
des Wasserversorgungssystems beeinflusst.<br />
Für die laufende Überwachung von Rohrnetzbezirken sind<br />
die relevanten Messdaten kontinuierlich zu erfassen und an<br />
eine zentrale Überwachungseinheit (z. B. Leitwarte) zu übertragen.<br />
Dazu zählen z. B. Einspeisemengen, Druck, Durchfluss<br />
und Behälterstände (vgl. ÖVGW W 63, 2009). Grundsätzlich<br />
können zwei verschiedene Methoden der Überwachung unterschieden<br />
werden:<br />
Überwachung von hydraulisch abgegrenzten Zonen<br />
Überwachung von hydraulisch nicht abgegrenzten Zonen<br />
Erstere Methode bietet sich v.a. bei Versorgungsstrukturen<br />
an, die aufgrund der geografischen Verhältnisse eine Zonierung<br />
bereits vorgegeben haben (z. B. Druckzonen, durch Flüsse<br />
oder Verkehrswege getrennte Zonen, ländliche Strukturen).<br />
Um eine effiziente Überwachung zu erreichen, sollte eine<br />
Zone max<strong>im</strong>al 3000 Hausanschlüsse umfassen, idealerweise<br />
aber deutlich weniger.<br />
Die Zonierung größerer Netzbereiche ist meist mit einem<br />
hohen Aufwand zur Erreichung und laufenden Instandhaltung<br />
der Zonendichtheit verbunden und bringt einige Nachteile <strong>im</strong><br />
Netzbetrieb mit sich, da die hydraulischen Vorteile eines nicht<br />
unterteilten Netzes el<strong>im</strong>iniert werden. Weitere Aspekte sind<br />
mögliche Qualitätsprobleme durch Stagnation oder das Risiko<br />
<strong>im</strong> Brandfall nur unzureichend Löschwasser zur Verfügung<br />
zu haben. Daher kommt eine kleinräumige Zonierung für viele<br />
Versorgungsunternehmen nicht in Frage und wird oftmals<br />
auf eine effektive laufende Überwachung großer Zonen (z. B.<br />
Kernzonen vieler Städte) verzichtet. Dies führt in der Regel zu<br />
höheren Wasserverlusten aufgrund langer Lecklaufzeiten, da<br />
jährlich oder in größeren Abständen durchgeführte Leckortungskampagnen<br />
die einzige Möglichkeit sind, kleinere, nicht<br />
an die Oberfläche kommende Leckagen zu finden.<br />
Seit einigen Jahren sind auch geeignete Methoden für<br />
die Überwachung hydraulisch nicht abgegrenzten Zonen, also<br />
großen Zonen mit (deutlich) mehr als 3000 Hausanschlüssen,<br />
verfügbar. Es erfolgt keine weitere hydraulische Unterteilung<br />
des Rohrnetzes. Die einzelnen Messbereiche („virtuelle Zonen“)<br />
ergeben sich durch die Positionierung der Messgeräte,<br />
wobei die Messstellenpositionen grundsätzlich nach hydraulischen<br />
Gesichtspunkten zu wählen sind (ÖVGW W 63, 2009).<br />
Als aussagekräftigster Parameter kann der Durchfluss<br />
entweder einzeln oder in Kombination mit Druck und/oder<br />
Geräusch gemessen werden. Durch die zeitgleiche Messung<br />
mehrerer Parameter an verschiedenen Messstellen können die<br />
Aussagen zu möglichen Leckagen noch verbessert werden.<br />
Neben vergleichenden Messungen z. B. in Niedrigverbrauchszeiten<br />
können solche messtechnischen Systeme auch<br />
unterstützend zur aktiven Eingrenzung von Leckagen genutzt<br />
werden. Zusätzlich bieten sich abseits des Wasserverlustmanagements<br />
zahlreiche Vorteile z. B. bei hydraulischen Kalibrierungen<br />
des Rohrnetzes.<br />
836 11 / 2011
4.4 Infrastrukturmanagement<br />
Das Infrastrukturmanagement umfasst zahlreiche vor allem<br />
längerfristig beeinflussbarer Maßnahmen wie die Instandhaltung<br />
aller Arten von Anlagenteilen (Leitungen, Armaturen,<br />
Pumpen, Durchflussmessgeräten, Ventilen etc.). Die Rehabilitationsplanung<br />
(inkl. Auswertung von leitungsgruppenbezogenen<br />
Schadensraten) stellt eine Kernaufgabe für eine nachhaltige<br />
und wirtschaftliche Instandhaltung dar.<br />
Zum Infrastrukturmanagement zählt auch das Kundenzählermanagement<br />
(Art und Alter der Kundenzähler, Art der<br />
Ablesung, Stichtagsproblem bei längeren Ablesezeiträumen)<br />
sowie die generelle Planung und Opt<strong>im</strong>ierung des Wasserversorgungssystems.<br />
Gemäß DVGW W 400-3 (2006) und ÖVGW W 100<br />
(2007) werden drei verschiedene Instandhaltungsstrategien<br />
unterschieden:<br />
Ereignisorientierte Instandhaltung oder Ausfallstrategie<br />
Vorbeugende und intervallorientierte Instandhaltung oder<br />
Präventivstrategie<br />
Vorbeugende und zustandsorientierte Instandhaltung<br />
oder Inspektionsstrategie<br />
Durch die Berücksichtigung der Entwicklung des Zustandes<br />
der Wasserverteilungsanlagen ermöglicht die Inspektionsstrategie<br />
einen effektiven und wirtschaftlichen Einsatz der<br />
Instandhaltungsmittel und stellt damit eine dem Stand der<br />
Technik entsprechende Instandhaltungsstrategie dar.<br />
Dem Wasserverlustmanagement kommt für die erfolgreiche<br />
Umsetzung einer solchen Inspektionsstrategie eine maßgebliche<br />
Bedeutung in der Bereitstellung von Daten über die<br />
Höhe, Verteilung und die Entwicklung der Wasserverluste zu.<br />
Eine ordnungsgemäß geführte Rohrnetzdokumentation und<br />
Schadensstatistik sind ebenso essentiell, wie auch die Dokumentation<br />
der Kosten für Reparatur, Erneuerung und Sanierung.<br />
Autor<br />
DI Dr. techn. Jörg Kölbl<br />
Gleinstätten (A)<br />
Tel. +43 680 20 13 785<br />
E-Mail: joergkoelbl@hotmail.com<br />
Literatur<br />
[1] DVGW-Arbeitsblatt W 392 „Rohrnetzinspektion und Wasserverluste<br />
– Maßnahmen, Verfahren und Bewertungen“<br />
(2003)<br />
[2] DVGW-Arbeitsblatt W 400-3 „Technische Regeln<br />
Wasserverteilungs¬anlagen (TRWV); Teil 3: Betrieb und<br />
Instandhaltung“ (2006)<br />
[3] DVGW-Arbeitsblatt W 402 „Netz- und Schadenstatistik -<br />
Erfassung und Auswertung von Daten zur Instandhaltung<br />
von Wasserrohrnetzen“ (2010)<br />
[4] Heydenreich, M., Hoch, W.: Praxis der Wasserverlustreduzierung.<br />
– DVGW, wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und Wasser mbH, Bonn, 2008, ISBN 978-3-<br />
89554-171-1<br />
[5] Kingdom, B.; Liemberger, R.; Marin, P.: The Challange of<br />
Reducing Non-Revenue Water (NRW) in Developing Countries<br />
– How the Private Sector Can Help: A Look at Performance-Based<br />
Service Contracting. – Water Supply and<br />
Sanitiation Sector Board Discussion Paper Series No. 8,<br />
The World Bank, Washington, DC, USA, 2006<br />
[6] Kölbl, J.: Process Benchmarking in Water Supply Sector:<br />
Management of Physical Water Losses. Dissertation,<br />
Schriftenreihe zur Wasserwirtschaft, 56, Technische<br />
Universität Graz, Österreich, 2009, ISBN 978-3-85125-<br />
055-8<br />
[7] Lambert, A.; Brown, T.G.; Takizawa, M.; We<strong>im</strong>er, D.: A Review<br />
of Performance Indicators for Real Losses from Water<br />
Supply Systems. AQUA, Vol. 48 No. 6, 1999, ISSN<br />
0003-7214<br />
[8] Lambert, A.; Hirner, W.: Losses from water supply systems:<br />
Standard terminology and recommended performance<br />
measures. - IWA Blue Pages, London, UK, 2000<br />
[9] Liemberger, R.: Wasserbilanz und Wasserverlust-Indikatoren.<br />
– aqua press International, 2/2005, Wien<br />
[10] ÖNorm B 2538 „Transport-, Versorgungs- und Anschlussleitungen<br />
von Wasserversorgungsanlagen – Ergänzende<br />
Best<strong>im</strong>mungen zu ÖNORM EN 805“ (2002)<br />
[11] ÖVGW-Richtlinie W 63 „Wasserverluste in Versorgungsnetzen,<br />
Anschlussleitungen und Verbrauchsleitungen –<br />
Feststellungen, Beurteilungen und Maßnahmen zur Verminderung“<br />
(1993)<br />
[12] ÖVGW-Richtlinie W 63 „Wasserverluste in<br />
Trinkwasserversorgungs¬systemen – Ermittlung, Bewertung<br />
und Maßnahmen zur Verminderung“ (2009)<br />
[13] ÖVGW-Richtlinie W 77 „Bereitstellung von Löschwasser<br />
durch die Wasserversorgungsunternehmen“ (2000)<br />
[14] ÖVGW-Richtlinie W 100 „Wasserverteilleitungen - Betrieb<br />
und Instandhaltung“ (2007)<br />
[15] ÖVGW-Richtlinie W 105 „Schadensstatistik“ (2011)<br />
11 / 2011 837
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Wechsel wirkungen zwischen Trinkwasser<br />
qualität, Rohrwerk stoffen sowie<br />
Sanierungs- und Netzpflegemaßnahmen 1)<br />
Von Dr. Gabriele Weirauch<br />
In Deutschland unterliegt die Gewinnung und Aufbereitung von Roh- zu Trinkwasser hohen Qualitätsstandards, so dass<br />
ein Trinkwasser entsprechend den gesetzlichen Anforderungen [1] ästhetisch und hygienisch einwandfrei in das Verteilungsnetz<br />
eingespeist wird. Zwischen der Aufbereitungsanlage und dem Verbraucher liegt jedoch unter Umständen ein<br />
kilometerlanges Leitungssystem, das die Wasserqualität infolge von chemischen, physikalischen, aber auch biologischen<br />
Prozessen beeinflussen kann. Im Gegenzug kann aber auch die eingespeiste Wasserqualität trotz hochwertiger Aufbereitung<br />
den Rohrwerkstoff angreifen und langfristig zerstören, wenn Wasserbeschaffenheit und Rohrwerkstoff nicht<br />
aufeinander abgest<strong>im</strong>mt sind. Normalerweise besteht aber ein existierendes Versorgungsnetz nicht nur aus einem einzelnen<br />
Rohrwerkstoff, sondern aus einer Vielzahl verschiedener Rohrwerkstoffe, deren Alter und Zustand zusätzlich<br />
stark variiert, wodurch eine gezielte Aufbereitung erschwert wird und andere Maßnahmen erforderlich sind. Die häufigsten<br />
Probleme, die sich aus der Wechselwirkung zwischen Trinkwasser und Rohrwerkstoff ergeben, sind erhöhte<br />
Rohrrauheit, verfärbtes Wasser und Ke<strong>im</strong>e <strong>im</strong> Wasser. Anhand einer Literaturstudie wurde der aktuelle Wissensstand<br />
über die häufigsten Ursachen für diese Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität in Deutschland – Biofilm, Korrosion<br />
und sed<strong>im</strong>entierte oder <strong>im</strong> Wasser suspendierte Partikel – sowie mögliche Maßnahmen dagegen zusammengefasst.<br />
Biofilm<br />
Biofilme kommen unabhängig vom Rohrwerkstoff in so gut<br />
wie jedem Verteilungssystem vor [4]. Der Nachweis von<br />
Biofilmen durch Wasserproben wird allerdings dadurch erschwert,<br />
dass sich die Biomasse zum großen Teil (~95 %) auf<br />
der Rohroberfläche und nur ein geringer Teil <strong>im</strong> Wasserkörper<br />
befindet [5]. So geben Wasserproben keine Auskunft darüber,<br />
wo genau sich Biofilme abgelagert haben, welches Ausmaß<br />
sie haben und welche Organismen darin leben. Jedoch<br />
können Wasserproben einen groben Anhaltspunkt geben, an<br />
welcher Stelle sich „Brennpunkte“ finden [6].<br />
Wachstum<br />
Nährstoffe:<br />
• AOC/BDOC<br />
• Phosphor/Sulfat<br />
• Stickstoffverbindungen<br />
pH-Wert<br />
Temperatur<br />
Biofilmstruktur<br />
Sauerstoff<br />
Kationen (Ca 2+ , Fe 2+ etc.)<br />
Fließbedingungen<br />
Schutz & Nährstoffe<br />
Korrosion & Ablagerungen<br />
Erhöhte Koloniezahlen<br />
Biokorrosion<br />
Braunwasser<br />
Veränderte Rohrrauheit<br />
Die Folgen von Biofilmen reichen von veränderter Rohrrauheit<br />
über ein mikrobielles Mitwirken bei Braunwasser und<br />
Biokorrosion bis hin zu erhöhten Ke<strong>im</strong>zahlen <strong>im</strong> Trinkwasser<br />
[7], wobei obligat pathogene Mikroorganismen normalerweise<br />
gar nicht und fakultativ pathogene Ke<strong>im</strong>e nur sehr<br />
selten auftreten [5].<br />
Bedeutend für die Ansiedlung und Vermehrung von Mikroorganismen<br />
ist, wie in Bild 1 dargestellt, eine ausreichende<br />
Versorgung mit Nährstoffe. Unter Nährstoffe [4, 8] fallen<br />
Phosphor, Stickstoffverbindungen, Eisen und Mangan, die<br />
wichtigsten Nahrungsquellen sind aber meist Kohlenstoffverbindungen,<br />
die von den Mikroorganismen verwertet werden<br />
können: AOC (Ass<strong>im</strong>ilierbarer organischer Kohlenstoff) und<br />
BDOC (Biologisch abbaubarer gelöster organischer Kohlenstoff).<br />
Unter den physikalischen Einflussfaktoren begünstigen<br />
hohe Temperaturen und ein pH-Wert unter 9 eine Vermehrung<br />
[4, 9]. Ablagerungen, insbesondere auch durch korrodierte<br />
Oberflächen, bieten den sich ansiedelnden Ke<strong>im</strong>en<br />
Schutz vor hohen Strömungsgeschwindigkeiten und Desinfektionsmittel<br />
sowie ein erhöhtes Nahrungsangebot [10, 11].<br />
Die Rauheit neuer Rohre ist hingegen nur kurzfristig bedeutend,<br />
so begünstigt eine erhöhte Rauheit die Erstbesiedlung,<br />
aber nach Ausbildung eines Biofilms verliert die ursprüngliche<br />
Oberflächenbeschaffenheit genauso wie das Alter der Rohre<br />
Bild 1: Einflussfaktoren auf die Bildung von Biofilm sowie Folgen von<br />
mikrobiellen Aktivitäten [2, 3]<br />
1) Zusammenfassung der gleichnamigen Masterarbeit an der<br />
Bauhaus-Universität We<strong>im</strong>ar unter Betreuung von Dr.-Ing.<br />
Hans-Christian Sorge (IWW Rheinisch-Westfaelisches Institut<br />
für Wasser Regionalstandort Rhein-Main)<br />
838 11 / 2011
und der Rohrwerkstoff, sofern dieser keine Nährstoffe abgibt,<br />
ihre Bedeutung [5, 12, 13].<br />
Die Struktur des Biofilms wird, vor allem in der Anfangsphase,<br />
durch den Sauerstoffgehalt <strong>im</strong> Wasser und die Fließgeschwindigkeit<br />
beeinflusst. So führen hohe Fließgeschwindigkeiten<br />
zu kompakteren und dünneren Biofilmen, die resistenter<br />
gegenüber mechanischen Stress sind [12, 14]. Ein geringer<br />
Sauerstoffgehalt <strong>im</strong> Wasser führt bei der Erstbesiedlung<br />
zunächst zu streifigen oder flockigen Biofilmen [12], aber<br />
<strong>im</strong> weiteren Verlauf verliert die Sauerstoffkonzentration aufgrund<br />
des unterschiedlichen Sauerstoffbedarfs der verschiedenen<br />
Bakterienstämme an Bedeutung [15]. Ein weiterer Faktor,<br />
der sich auf die Struktur des Biofilms auswirken kann, ist<br />
die Kationen-Konzentration. Durch die Einlagerung von positiv<br />
geladenen Ionen in den extrazellulären, polymeren Substanzen<br />
(EPS) des Biofilms kann sich die Elasitizität des Films<br />
erhöhen [16, 17, 18].<br />
Die einzige Möglichkeit, Biofilme langfristig zu vermeiden,<br />
wäre eine Wasserverteilung von Beginn an mit einem relativ<br />
hohen Desinfektionsmittelrestgehalt, der auch bis in den Endsträngen<br />
aufrecht erhalten werden muss [13]. Eine Dauerdosierung<br />
(z. B. Dauerchlorung) kann aber z. B. zu einer vorzeitigen<br />
Alterung und Versprödung von PE-Rohren führen [19].<br />
Gleichfalls können Chlor und andere oxidierende Zusatzmittel<br />
Stahl- und Gussrohre angreifen [20]. In Deutschland, wie<br />
auch in einigen anderen europäischen Ländern, ist eine Trinkwasserverteilung<br />
mit Desinfektionsmittelrestgehalt nur noch<br />
selten, denn zum einen widerspricht dies dem Min<strong>im</strong>ierungsgebot<br />
an Zusätzen in der Trinkwasserversorgung, zum anderen<br />
ist meist eine Dauerdosierung mit einem Desinfektionsmittel<br />
auch nicht notwendig, um ein Wasser frei von bedenklichen<br />
oder gar gesundheitsgefährdenden Mikroorganismen<br />
bereitzustellen [21]. Denn nach der Anfangsphase, in<br />
der vermehrt Ke<strong>im</strong>e <strong>im</strong> Wasser nachgewiesen werden können,<br />
bildet sich meist ein stabiler Biofilm mit äußerst geringem<br />
Aufke<strong>im</strong>ungsrisiko aus. Dies setzt jedoch voraus, dass die <strong>im</strong><br />
Versorgungsnetz verwendeten Werkstoffe (Rohre, Einbauten<br />
oder Dichtungen) keine Nährstoffe abgeben [22, 23] und die<br />
chemischen sowie physikalischen Eigenschaften des Wassers<br />
sich nicht drastisch ändern [24, 25]. Bei jeder Änderung –<br />
insbesondere bei sehr plötzlichen und schnellen Wechsel der<br />
Wasserbeschaffenheit oder der Betriebsbedingungen – reagiert<br />
der Biofilm mit einer Anpassung an die neuen Umgebungsbedingungen<br />
[7]. Diese Umbildungsprozesse bedeuten<br />
aber auch ein erhöhtes Risiko der Ke<strong>im</strong>abgabe an das Wasser,<br />
die erst wieder zurückgehen, wenn sich der Biofilm den neuen<br />
Bedingungen angepasst hat. Von besonderer Bedeutung<br />
sind Schwankungen des Desinfektionsmittelrestgehalts bzw.<br />
kurzzeitige Dosierung eines Desinfektionsmittels. Veränderungen<br />
der Nährstoffkonzentration oder der Temperatur können<br />
nur dann zu einer verstärkten Vermehrung führen, wenn<br />
sie extrem und schnell erfolgen [24]. Langsame Temperaturanstiege<br />
und Nährstoffzunahme führen hingegen zu keinen<br />
nennenswerten Aufke<strong>im</strong>ungserscheinungen [21].<br />
Eine plötzliche, starke Erhöhung der Fließgeschwindigkeit,<br />
wie sie z. B. bei Spülungen und Reinigungen auftritt, kann den<br />
Biofilm beschädigen, dies führt dann bis zu dessen Stabilisierung<br />
wieder zu einer verstärkten Vermehrung und Ke<strong>im</strong>abgabe<br />
an das Wasser [4, 26]. Regelmäßiges Spülen der Leitung<br />
ist dann notwendig, wenn Sed<strong>im</strong>ente und abgelagerte Korrosionsprodukte<br />
Schutz vor Desinfektionsmitteln und Scherkräften<br />
sowie zusätzliche Nährstoffe für eine mikrobielle Vermehrung<br />
bedeuten [11].<br />
Um eine vollständige Beseitigung eines bestehenden Biofilms<br />
mittels einer Rohrdesinfektion zu erreichen, wäre in der<br />
Regel eine Desinfektionsmittelkonzentration nötig, die die<br />
Grenzwerte der gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien<br />
überschreitet [27, 28]. Eine zu geringe Dosierung bewirkt<br />
aber nur eine Inaktivierung oder teilweise Abtötung der oberen<br />
Schichten, die später dann wieder als Nährstoffe dienen<br />
und zu einer verstärkten Vermehrung und Aufke<strong>im</strong>ung führen<br />
[29]. Zusammengefasst stellt<br />
ein stabiler Aufbereitungsprozess und damit eine stabile<br />
Wasserqualität,<br />
gleichmäßige Fließbedingungen,<br />
niedrige Temperaturen,<br />
die Verwendung nährstoffarmer Werkstoffe und<br />
die Vermeidung von Ablagerungen, rauen Oberflächen<br />
sowie Verunreinigungseintrag von außen<br />
die beste Methode dar, um eine Aufke<strong>im</strong>ung des Wassers zu<br />
unterbinden.<br />
Korrosion<br />
In Deutschland werden heutzutage keine Stahl- oder Gussrohre<br />
mehr ohne eine Innenauskleidung verlegt. Es befindet<br />
sich aber <strong>im</strong>mer noch eine große Zahl an alten ungeschützten<br />
Leitungen <strong>im</strong> Einsatz (ca. 50 – 65 % des gesamten TW-Rohrnetzbestandes<br />
[30]). Unter gleichbleibenden Bedingungen<br />
bereiten diese aber häufig keine oder nur geringe Probleme,<br />
da sich auf ihnen eine schützende Deckschicht aus Korrosionsprodukten<br />
und Wasserinhaltsstoffen gebildet hat, die das<br />
Fortschreiten der Korrosion deutlich verlangsamt [31]. Problematisch<br />
wird es, wenn sich aufgrund rückläufiger Bevölkerungs-<br />
und Verbrauchszahlen die Trinkwasser-Abgabemengen<br />
reduzieren und dadurch längere Verweilzeiten des Wassers<br />
<strong>im</strong> Leitungssystem auftreten [32]. Durch den abnehmenden<br />
Sauerstoffgehalt <strong>im</strong> Trinkwasser während der Stagnation<br />
werden dreiwertige Eisenverbindungen aus der schützenden<br />
Deckschicht metallener Rohrleitungen reduziert und diese<br />
Schicht u.U. beschädigt [33]. Als Folge der Reduktion werden<br />
zweiwertige Eisenionen an den Wasserkörper abgegeben,<br />
die bei Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und erhöhter<br />
Sauerstoffzufuhr wieder oxidieren und so zu Rostwasserproblemen<br />
führen (siehe Bild 2). Besonders deutlich tritt<br />
dieses Phänomen auf, wenn nach einem geringen Verbrauch<br />
des Nachts die Fließgeschwindigkeiten und damit der Sauerstoffgehalt<br />
morgens schnell ansteigen.<br />
Wie be<strong>im</strong> Biofilm kann auch eine Umstellung der Wasserqualität<br />
zu vermehrtem Auftreten von Rostwasser durch<br />
die Umbildung der Deckschichten führen [34]. Die häufigste<br />
Form der Wasserumstellung in Deutschland, welche die Deckschichten<br />
beeinflusst, ist die Umstellung von hartem, gut gepuffertem<br />
Grundwasser auf weichere, weniger gepufferte<br />
11 / 2011 839
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Rohwasser<br />
Organische und<br />
anorganische<br />
Verbindungen<br />
Aufbereitungsprozess<br />
•Flockungsmittel<br />
•Filterpartikel<br />
Verunreinigung<br />
•Bauarbeiten<br />
•Sickerwasser<br />
Talsperrenwässer (meist verbunden mit der Einspeisung sog.<br />
Mischwassers in das Netz – bestehend aus Grund- und Oberflächenwasser)<br />
[35]. Negativ auf bestehende Deckschichten<br />
wirkt sich auch eine Erhöhung des Neutralsalzgehalts z. B.<br />
durch eine Chlorung aus [36].<br />
Hydraulische Beeinträchtigungen infolge von Korrosion in<br />
ungeschützten Stahl- und Gussrohren entstehen durch Inkrustationen,<br />
die wie in Bild 2 gezeigt den Rohrquerschnitt<br />
verengen, und Ablagerungen der Korrosionsprodukte, die die<br />
Rohrrauheit erhöhen [37, 31].<br />
Besteht nicht die Möglichkeit, Rohre, die vermehrt zu<br />
Problemen führen, zu sanieren oder auszutauschen, können<br />
phosphathaltige Inhibitoren dosiert werden. Dadurch werden<br />
die Oberflächen geglättet und ein weiterer Korrosionsangriff<br />
verringert. Jedoch können Inhibitionszusätze in der Regel<br />
nicht einfach wieder abgesetzt werden, da die Probleme<br />
dann zeitversetzt wieder auftreten [38, 39]. Nach entsprechenden<br />
Untersuchungen kann aber häufig die Dosierung reduziert<br />
oder die Zusammensetzung auf phosphatärmere Mittel<br />
umgestellt werden, die die Umwelt in geringerem Ausmaß<br />
Einflussfaktoren<br />
• Wasserinhaltsstoffe<br />
• Chem. Parameter (pH, AQ, …)<br />
• Phys. Parameter (m/s, °C, …)<br />
• Biol. Parameter (Bakterien)<br />
Günstige Wasserparameter<br />
→ Bildung schützender<br />
Deckschichten<br />
Unterschiedlicher<br />
Einflussfaktoren bei:<br />
• Pr<strong>im</strong>äre Reaktion<br />
• Deckschichtenbildung<br />
• Bestehende Deckschichten auf<br />
→ Korrosionsrate<br />
→ Eisenabgaberate<br />
Neubildung<br />
Post-Flockung<br />
Calcit-Lösung & Korrosion<br />
Sed<strong>im</strong>entation<br />
Ca 2+ Ca 2+<br />
Ca 2+<br />
Fe 2+ Fe 2+<br />
Fe 2+<br />
Rostwasser<br />
Veränderte Rohrrauheit<br />
Rohrquerschnittverengung<br />
O 2 -, Cl 2 - Zehrung<br />
Mikrobiologische Wachstum<br />
Zerstörung des Rohrmaterials<br />
Adsorption giftiger Substanzen<br />
Bild 2: Einflüsse auf und Folgen von Korrosion in ungeschützten Stahl<br />
und Gussrohren<br />
Fe 2+<br />
Schutz & Nährstoffe für<br />
Mikroorganismen<br />
Fe 2+<br />
Fe 2+<br />
Mobilisierung<br />
Fließgeschwindigkeit + Schleppspannung<br />
Bild 3: Einflussfaktoren und Folgen von Partikeleintrag von außen<br />
und Partikelentstehung <strong>im</strong> Rohr<br />
belasten [40, 41]. Ein erhöhtes mikrobiologisches Wachstum<br />
ist durch die phosphathaltigen Mittel nicht zu erwarten, da<br />
die geglättete Oberfläche gegenüber der rauen, korrodierten<br />
Oberfläche einen für Mikroorganismen ungünstigeren Lebensraum<br />
ohne Schutz darstellt [42]. Ausnahmen stellen nur<br />
die sehr seltenen Fälle dar, bei denen das Biofilmwachstum<br />
durch Phosphat und nicht, wie meist der Fall, durch die Kohlenstoffverbindungen<br />
l<strong>im</strong>itiert ist [43].<br />
Die wichtigsten Faktoren, um die Korrosions- und Eisenabgaberate<br />
bei alten, ungeschützten Stahl- und Gussrohren<br />
so gering wie möglich zu halten sind:<br />
kontinuierliche Fließbedingungen und Vermeidung von<br />
Stagnation<br />
niedriger Neutralsalzgehalt<br />
gleichbleibende Wasserbeschaffenheit<br />
gegebenenfalls Dosierung von Korrosionsinhibitoren<br />
Sed<strong>im</strong>ente und Trübung<br />
Eine Verfärbung oder Trübung des Wassers hat seine Ursache<br />
nicht nur in der Korrosion ungeschützter Stahl- und<br />
Gussrohre, auch wenn dies die bekannteste Ursache ist. Viele<br />
suspendierte und sed<strong>im</strong>entierte Partikel in einem Versorgungsnetz<br />
werden durch das aufbereitete Wasser eingetragen<br />
[44]. Meist sind dies gelöste Metall- oder organische<br />
Kohlenstoff-Verbindungen <strong>im</strong> Rohwasser, die in der Aufbereitung<br />
schwer zu entfernen und nachzuweisen sind [45, 46].<br />
Eine weitere Variante des Eintrags von Partikel von außen ist<br />
durch Verunreinigungen infolge von Bauarbeiten oder einsickerndes<br />
Wasser [47]. Ob sich eingetragene Partikel auf der<br />
Rohroberfläche ablagern, hängt wesentlich von der Fließgeschwindigkeit<br />
ab. Je größer die Fließgeschwindigkeit, desto<br />
geringer ist das Risiko einer Sed<strong>im</strong>entation [48]. Im Rohr<br />
können weitere Prozesse die Vergrößerung der eingetragenen<br />
Partikel zur Folge haben (Postflockung) [49], es können<br />
sich aber auch Partikel durch Korrosion in Stahl- und Gussrohren<br />
oder durch Calcitlösung von Zementmörtelauskleidung<br />
neu bilden. Die genannten Ursachen und Prozesse <strong>im</strong><br />
Leitungssystem sind schematisch in Bild 3 dargestellt. Neben<br />
der Beeinträchtigung der Hydraulik durch Ablagerungen<br />
kann die Vermehrung von Mikroorganismen begünstigt werden,<br />
einerseits durch Nährstoffe aus den Sed<strong>im</strong>enten und andererseits<br />
durch den Schutz vor Scherkräften durch die Ablagerungen<br />
[50].<br />
MaSSnahmen<br />
Spülung und Reinigung<br />
Eine Möglichkeit Korrosionsprodukte und andere Sed<strong>im</strong>ente,<br />
die zur Trübung oder Braunwasser führen, zu beseitigen, ist<br />
die Spülung oder Reinigung der Leitung. Die verschiedenen<br />
Spülverfahren beruhen darauf, mit hohen Fließgeschwindigkeiten<br />
und Schleppspannungen die Ablagerungen zu mobilisieren<br />
und auszutragen. Die Nachhaltigkeit und Effizienz der<br />
Spülungen hängt davon ab, ob die Höhe der Fließgeschwindigkeit<br />
und der Schleppspannung auf die Größe, Dichte und<br />
Anhaftung der sed<strong>im</strong>entierten Partikel abgest<strong>im</strong>mt und so-<br />
840 11 / 2011
Tabelle 1: Maßnahmen zur Reduzierung unerwünschter Wechselwirkungen<br />
zwischen Rohrwerkstoff und Trinkwassergüte: „+“: Nachhaltig;<br />
„(+)“: Nachhaltigkeit abhängig von der Ursache<br />
mit ausreichend ist, diese auch wirklich auszutragen [48,<br />
51]. Die benötigte Fließgeschwindigkeit kann empirisch<br />
durch schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit best<strong>im</strong>mt<br />
werden [52]. Anhand einer Analyse der Ablagerungszusammensetzung<br />
und der abgelagerten Mengen<br />
in einer best<strong>im</strong>mten Zeitspanne in eingegrenzten Netzabschnitten<br />
können<br />
Ursachen (Eintrag von außen, Entstehung <strong>im</strong> Netz)<br />
best<strong>im</strong>mt,<br />
besonders betroffene Abschnitte <strong>im</strong> Leitungsnetz erkannt<br />
und<br />
die Spülintervalle abschnittsspezifisch angepasst werden.<br />
Mit einer derartigen Erstellung opt<strong>im</strong>ierter Spülpläne können<br />
die Effizienz gesteigert und Kosten gespart werden<br />
[52]. Bei sehr hartnäckigen Ablagerungen und Inkrustationen<br />
reichen die mit herkömmlichen Wasserspülungen<br />
erzielten Fließgeschwindigkeiten jedoch oftmals nicht<br />
aus. Durch eine Weiterentwicklung der Wasserspülung<br />
sind Verfahren wie z. B. die Wasser-Luft-Impulsspülung<br />
entstanden. Diese Verfahren benötigen weit geringere<br />
Wassermengen und erreichen deutlich höhere Fließgeschwindigkeiten<br />
[48]. Die Gefahr bei diesen Methoden<br />
wie auch bei der mechanischen Reinigung besteht aber<br />
in der Beschädigung von schützenden Deckschichten in<br />
Stahl- oder Gussrohren und von Biofilmen [26, 51]. Bis<br />
sich wieder eine Schutzschicht oder stabiler Biofilm ausgebildet<br />
hat, ist vermehrt mit Braunwasser und Aufke<strong>im</strong>ung<br />
zu rechnen. Daher sind diese Verfahren nur dann<br />
einzusetzen, wenn hartnäckige Ablagerungen und Inkrustationen<br />
die Hydraulik stark beeinträchtigen und/oder eine<br />
Sanierung mit Relining-Verfahren oder Zementmörtelauskleidung<br />
behindern würden.<br />
Zementmörtelauskleidung<br />
Eine Zementmörtelauskleidung kann die Nutzungsdauer<br />
einer Stahl- oder Gussleitung um Jahrzehnte verlängern<br />
[53]. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass die<br />
statische Resttragfähigkeit des Rohres noch ausreichend<br />
ist und schädigende Korrosionsangriffe hauptsächlich <strong>im</strong><br />
Leitungsinneren stattgefunden haben. Die Zementmörtelschicht<br />
auf der Rohrinnenseite bewirkt aufgrund der<br />
physischen Trennung des Wassers vom Metall einen passiven<br />
Korrosionsschutz und zusätzlich infolge der hohen<br />
Alkalität des Zementmörtels auch einen aktiven Schutz<br />
[54, 55]. Die ZM-Auskleidung kann aber auch, vor allem<br />
in der Anfangszeit, die Wasserqualität beeinflussen, wobei<br />
die Wasserbeschaffenheit wiederum einen entscheidenden<br />
Einfluss auf die Dauer und die Höhe der Wasserqualitätsänderung<br />
hat. So muss bei einer frischen ZMA<br />
mit einem Anstieg des pH-Wertes infolge der Alkalität<br />
des Mörtels gerechnet werden [56]. Die Dauer und Höhe<br />
des pH-Anstiegs wird wesentlich von der Höhe der<br />
Säurekapazität K S4,3<br />
(Hydrogencarbonat-Konzentration)<br />
best<strong>im</strong>mt [57]. Je höher diese ist, desto schneller bildet<br />
sich eine schützende Calciumcarbonat-Schicht und<br />
der pH-Wert sinkt wieder ab. Bei niedriger Säurekapazi-<br />
Maßnahmen<br />
Maßnahmen<br />
Innenkorrosion<br />
Deckschichten I<br />
Ablagerungen<br />
Inkrustationen<br />
Braunfärbungen<br />
Trübungen<br />
Biofilm<br />
Aufke<strong>im</strong>ung<br />
Ausreichender Sauerstoffgehalt + (+) 1 (+) 1 (+) 2<br />
Reduzierung AOC, BOC (-) 3 + + +<br />
Reduzierung Ammonium, Nitrat, Nitrit (+) 2 + + +<br />
Reduzierung Phosphor, Phosphat (-) 3 + + +<br />
Reduzierung Eisen, Mangan + + +<br />
Reduzierung Neutralsalze (Chlor, Sulfat) + (+) 1 (+) 1 (+) 4 (+) 4<br />
Anpassung an Calcitsättigung + + + +<br />
Anpassung des pH-Werts II + (+) 1 (+) 1 + +<br />
Anpassung der Säurekapazität K S4,3<br />
III<br />
+ (+) 1 (+) 1 +<br />
Vermeidung Desinfektionsmittelrestgehalt<br />
ZMA-Auslaugung<br />
PE-Versprödung<br />
+ (+) 1 (+) 1 (±) 5 +<br />
Niedrige Temperatur + (+) 1 (+) 1 + +<br />
Gleichbleibende Wasserparameter + (+) 1 (+) 1 +<br />
I<br />
ausgebildete, schützende Deckschichten<br />
in ungeschützten Stahl- und Gussrohren:<br />
Korrosions- und Eisenabgaberate<br />
II<br />
Korrosionsdeckschichten: pH > 7,5<br />
Biofilm: pH > 8 (verlangsamte Vermehrung)<br />
ZMA: pH > 7,8 (geringeres Risiko<br />
Säureangriff)<br />
III<br />
Innenkorrosion<br />
Deckschichten I<br />
bei Eisenabgaberate abhängig vom<br />
Neutralsalzgehalt: niedrige Säurekapazität<br />
bei hohem Neutralsalzgehalt bzw. hohe<br />
Säurekapazität bei niedrigem Neutralsalzgehalt<br />
bei Korrosionsrate: möglichst hohe<br />
Säurekapazität<br />
Ablagerungen<br />
Inkrustationen<br />
Braunfärbungen<br />
Trübungen<br />
Biofilm<br />
Aufke<strong>im</strong>ung<br />
Spülung + + (+) 1<br />
Reinigung II (+) 1 (+) 1 (+) 1<br />
Sanierung III + (+) 2 (+) 2 (+) 2<br />
Erneuerung/Austausch IV + (+) 2 (+) 2 (+) 2 + +<br />
Inhibitor-Dosierung + (+) 2 (+) 2 (+) 2<br />
Leitungsdesinfektion (+) 3<br />
Opt<strong>im</strong>ierte Aufbereitung + + + + + (+) 4<br />
Umbau Netzstruktur V + + + (+) 5<br />
I<br />
I<br />
III<br />
IV<br />
V<br />
ausgebildete, schützende Deckschichten<br />
in ungeschützten Stahl- und Gussrohren:<br />
Korrosions- und Eisenabgaberate<br />
meist in Verbindung mit Spülungen<br />
z. B. mit Zementmörtelauskleidung oder<br />
Linern<br />
gegen (korrosions-)unempfindlicher<br />
Material<br />
zur Änderung der Hydraulik (ausreichend<br />
hohe Fließgeschwindigkeit, Vermeidung<br />
von Stagnation)<br />
ZMA-Auslaugung<br />
PE-Versprödung<br />
1<br />
Beschädigung der Deckschicht oder<br />
Biofilm möglich<br />
2<br />
vor allem bei Korrosion als Ursache<br />
3<br />
bei bestehendem Biofilm nur bei hohen<br />
Konzentrationen, nachträgliche<br />
Spülung/Reinigung erforderlich<br />
4<br />
Verteilung ohne Desinfektionsmittelrestgehalt<br />
5<br />
Stagnationseinfluss nur bei schlecht<br />
ausgebildeten Biofilmen<br />
Tabelle 2: Opt<strong>im</strong>ierung der Wasseraufbereitung zur Reduzierung unerwünschter<br />
Wechselwirkungen zwischen Rohrwerkstoff und Trinkwassergüte:<br />
„+“: wirksam; „(+)“: Wirksamkeit abhängig von der Ursache; „(-)“:<br />
nachteilig; „(±)“: bedingt wirksam<br />
1<br />
vor allem bei Korrosion als Ursache<br />
2<br />
MIC, sonst eingeschränkter Einfluss<br />
3<br />
Huminstoffe, Phosphate: inhibitierende<br />
Wirkung<br />
4<br />
vor allem Sulfat<br />
5<br />
stabile, gleichbleibende Wasserparameter<br />
und Vermeidung des Ke<strong>im</strong>eintrags<br />
von außen sind besser geeignet<br />
11 / 2011 841
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
tät eines Wassers kann die Bildung einer Calciumcarbonat-<br />
Schicht durch<br />
Einfahren mit harten Wässern [57],<br />
Zugabe von Natriumhydrogencarbonat [57],<br />
Füllung des Rohres mit Kohlenstoffdioxidgas [57] oder<br />
Auftragen einer Phosphatlösung mit anschließender<br />
Ca(OH) 2<br />
-Lösung (keine praktische Erfahrung) [54]<br />
unterstützt werden. Hohe Fließgeschwindigkeiten und niedrige<br />
Temperaturen beschleunigen ebenfalls die Deckschichtenbildung,<br />
die entgegengesetzten Parameter führen dagegen zu<br />
einer tiefergehenden Carbonatisierung, welche langfristig die<br />
Auslaugung von z. B. Kalium verringert [56]. Werden Rohre<br />
mit fabrikseitig aufgebrachter ZMA verlegt, können durch die<br />
Herstellungsbedingungen und längere Lagerung der Rohre die<br />
Dauer und Höhe des pH-Anstiegs verringert werden [54, 56].<br />
Vor der Desinfektion sollte in jedem Fall aber eine Messung<br />
des pH-Wertes erfolgen, damit das eingesetzte Desinfektionsmittel<br />
auch wirksam ist. Dank seiner Wirksamkeit auch<br />
bei relativ hohen pH-Werten empfiehlt sich die Verwendung<br />
von Chlordioxid [25]. Calcitlösende, weiche Wässer, wie sie in<br />
Deutschland bei Talsperren teilweise vorliegen, können eine<br />
ZMA langfristig aufweichen und schädigen [54].<br />
Andere Rohrwerkstoffe<br />
Neben ungeschützten und ZM-ausgekleideten Stahl- und<br />
Gussrohren kommen auch andere Rohrwerkstoffe in deutschen<br />
Versorgungsnetzen vor. Der Anteil an PE-Rohren n<strong>im</strong>mt<br />
dabei <strong>im</strong>mer weiter zu. Die Eigenschaften von PE-Rohren<br />
wurden in den letzten Jahren <strong>im</strong>mer weiter entwickelt, so<br />
dass die heute eingesetzten Materialien in der Regel keine<br />
Beeinträchtigungen be<strong>im</strong> Betrieb mit Trinkwasser erleiden.<br />
Bei früheren PE-Generationen bis zur Einführung von HD-<br />
PE tritt infolge der geringeren PE-Dichte durch eine Dauerchlorung<br />
eine vorzeitige Alterung und Versprödung auf [19].<br />
Auf dem Rückzug befinden sich Asbestzementrohre, die<br />
seit 1995 nicht mehr hergestellt bzw. verlegt werden dürfen.<br />
Asbestzementrohre unterliegen den gleichen Einsatzgrenzen<br />
wie ZMA-Rohre. Wird der Zementmörtel, der die Asbestfasern<br />
umhüllt, durch ungünstige Wasserqualitäten aufgeweicht<br />
und abgetragen, können die Fasern in das Wasser<br />
gelangen. Aufgrund der krebserregenden Fasern sollten diese<br />
Rohre ab einer Konzentration von mehreren 10.000 Fasern je<br />
Liter Trinkwasser langfristig ausgetauscht werden (DVGW-<br />
Mitteilung Anfang der 1990er Jahre). Eine Möglichkeit, die<br />
Faserabgabe zu beseitigen ohne die Rohre sofort auszutauschen,<br />
ist die Aufbringung einer ZMA oder Einbringen eines<br />
sog. U-Liners, Schlauchreling kann eventuell problematisch<br />
bei der Verklebung sein [58].<br />
Auswahl von Maßnahmen<br />
Bei der Auswahl der Maßnahmen ist neben der technischen<br />
Realisierbarkeit und der Effizienz auch die wirtschaftliche<br />
Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Zu unterscheiden sind Methoden,<br />
die die Ursache von Qualitätsproblemen beseitigen<br />
oder nur deren Auswirkungen bekämpfen. Zu der ersten Gruppe<br />
zählen die Umstellung der Wasseraufbereitung und – insbesondere<br />
bei Korrosion – der Austausch von Rohren bzw. und<br />
unter gewissen Voraussetzungen (z. B. ausreichende Resttragfähigkeit)<br />
die Auskleidung mit Zementmörtel. In der Regel<br />
sind dazu höhere Investitionskosten notwendig, langfristig<br />
werden aber die laufenden Betriebskosten dadurch gesenkt.<br />
Zur zweiten Gruppe gehören die Inhibitordosierung, Spülungen<br />
oder Reinigung. Diese belasten zwar die Betriebskosten,<br />
können aber, wenn sie angepasst und opt<strong>im</strong>iert sind, sehr wirkungsvoll<br />
sein. Die Auskleidung mit ZM oder Schlauchreling<br />
können die Betriebszeit deutlich verlängern (in Abhängigkeit<br />
des Leitungszustands und der Korrosionsangriffe), sind aber<br />
aufwändiger und meist kostenintensiver als z. B. Spülungen,<br />
allerdings günstiger als Neuverlegungen.<br />
Im Allgemeinen müssen die Kosten für die Verfahren aber<br />
fallabhängig geprüft und kalkulatorisch mit alternativen Maßnahmen<br />
verglichen werden, idealer Weise unter Verwendung<br />
sog. Barwertmethoden. Die Eignung der genannten Maßnahmen<br />
gibt Tabelle 1 wieder. In Tabelle 2 sind die Prozesse in<br />
der Wasseraufbereitung aufgelistet, durch deren Opt<strong>im</strong>ierung<br />
eine Verke<strong>im</strong>ung des Wassers, Ablagerungen und Braunwasser<br />
sowie eine Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs beeinflusst<br />
und verringert werden können.<br />
Literatur<br />
[1] Trinkwasserverordnung. 2001<br />
[2] Bressel, Arnd. Mikrobielle Biofilme in oligotrophen Systemen: Untersuchungen zu Werkstoffeinfluss und elektrochemischem Verhalten.<br />
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2003. S. 103, Dissertation<br />
[3] Saftic. Biofilmuntersuchungen <strong>im</strong> Düsseldorfer Trinkwassersystem. 1997. Tagungsband Berlin<br />
[4] Berger, Paul S., LeChevallier, Mark W. und Reasoner, Donald J. et al. Control of biofilm growth in drinking water distribution systems.<br />
Washington, DC 20460 : United States Environmental Protection Agency, Juni 1992. Seminar Publication<br />
[5] Flemming, Hans-Curt. Biofilme – eine Gefahr für das Trinkwasser? GWA. 6 2006, S. 481 – 486<br />
[6] Flemming, Hans-Curt, Schulte, S<strong>im</strong>one und Wingender, Jost. Biofilme: Nachweis, Desinfektion, Resistenz. Präsentation. IWW Zentrum<br />
Wasser, Biofilm Centre, Universität Duisburg-Essen : s.n., 2005<br />
[7] Erhöhte Koloniezahlen <strong>im</strong> Trinkwasserverteilungssystem – Ursachen und Gegenmaßnahmen. Korth, Andreas, Henning, Lars und<br />
Wricke, Burkhard. 12 2007, bbr, S. 78 – 83<br />
[8] Chandy, Joseph P. und Angles, Mark L. Factors influencing the development of biofilms under controlled conditions. The Cooperative<br />
Research Centre for Water Quality and Treatment. s.l. : The Cooperative Research Centre for Water Quality and Treatment,<br />
2004. Research Report 20<br />
842 11 / 2011
[9] Flemming, Hans-Curt und Wingender, Jost. Biofilme – Eine<br />
Gefahr für das Trinkwasser? [Online] [Zitat vom: 4. 3<br />
2011.] http://www.uni-due.de/<strong>im</strong>peria/md/content/biofilm-centre/drinking_water.pdf<br />
[10] Advantage Provided by Iron for Escherichia coli Growth<br />
and Cultivability in Drinking Water. Appenzeller, Brice M.<br />
R., et al. 9 2005, Applied Environmental Microbiology, Bd.<br />
71, S. 5621 – 5623<br />
[11] Removal of soft deposits from the distribution systems<br />
<strong>im</strong>proves the drinking water quality. Lehtola, M. J., et al.<br />
Nr. 3, s.l. : Water Research, 2004, Bd. 38, S. 601-610<br />
[12] Rauheitsänderung durch Biofilmbewuchs in Druckrohrleitungen.<br />
Kraus, Thomas, Dallwig, Hans-Jürgen und Zanke,<br />
Ulrich. 6 2006, WasserWirtschaft WaWi, S. 36<br />
[13] Erfassung des Kontaminationspotentials von Biofilmen in<br />
der Trinkwasserverteilung. Flemming, Hans-Curt und Wingender,<br />
Jost. 8 2002, bbr, Bd. 53<br />
[14] Percival, S: L., et al. The effect of turbulent flow and surface<br />
roughness on biof<strong>im</strong> formation in drinking water.<br />
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology.<br />
1999, Bd. 22, S. 152 – 159<br />
[15] Flemming, H.-C. Biofilme und Wassertechnologie: Teil 1 –<br />
Entstehung, Aufbau, Zusammensetzung und Eigenschaften<br />
von Biofilmen. GWF Wasser-Abwasser. 4 1991, Bd. 132, S.<br />
197 – 207<br />
[16] Best<strong>im</strong>mung der mechanischen Stabilität von Biofilmen.<br />
Körstgens, Volker, et al. 4 2001, BIOspektrum, Bd. 7, S.<br />
333 – 335. http://biospektrum.de/blatt/d_bs_pdf&_<br />
id=933066<br />
[17] Lappin-Scott, Hilary M. und Costerton, J. William. Microbial<br />
Biofilms. s.l. : Cambridge University Press, September<br />
2003. S. 324. ISBN-13: 9780521542128<br />
[18] Vogt, Michael. Wasserdiffusion in Biofilmen von Pseudomonas<br />
aeruginosa und Polysaccharid/Wasser-Systemen.<br />
Fachbereich 6 (Chemie/Geographie), Gerhard-Mercator-<br />
Universität Duisburg. 2001. Dissertation<br />
[19] Dietrich, Andrea M., Whelton, Andrew J. und Gallagher,<br />
Daniel L. Chemical Permeation/Desorption in New and<br />
Chlorine Aged. 2010. http://waterrf.org/ProjectsReports/<br />
ExecutiveSummaryLibrary/4138_ProjectSummary.pdf<br />
[20] Der Einfluss von Neutralsalzen auf das Korrosionsverhalten<br />
unlegierter Eisenwerkstoffe in gut gepufferten Trinkwässern.<br />
Wagner, Ivo, Gerber, S. und Kuch, A. 1985, Werkstoffe<br />
und Korrosion, Bd. 36, S. 64 – 69<br />
[21] Außerbetriebnahme der Chlorung in Wasserwerken des<br />
Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal. Korth,<br />
Andreas, Hennekes, Georg und Klinkhammer, Frank. 7/8,<br />
s.l. : Energie|Wasser-Praxis, 2011<br />
[22] Trinkwasserkontamination durch Biofilme auf weich dichtenden<br />
Absperrschiebern. Kilb, Beate und Lange, Bernd. 7<br />
2001, bbr Fachmagazin für Wasser und Leistungstiefbau,<br />
Bd. 52, S. 55 – 56<br />
[23] Wachstumsbedingungen von Pseudomonas aeruginosa unter<br />
besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Trinkwasserversorgungssystemen.<br />
Schoenen, Dirk. 12 2009,<br />
GWF-Wasser| Abwasser, S. 1012 – 1015<br />
[24] NOM increase in drinking water reservoirs – Relevance for<br />
drinking water production. Korth, A., et al. 4 2004, Bd. 4,<br />
S. 55 – 60<br />
[25] Einsatz von Chlordioxid-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion.<br />
Schrott, J. 11 1999, Energie| Wasser-Praxis, S. 428<br />
– 433<br />
[26] Veränderung der bakteriologischen Güte von Trinkwasser<br />
während Stagnation. Korth, A. und Wricke, B. 12 2003,<br />
Energie| Wasser-Praxis, S. 91<br />
[27] Biofilm composition, formation, and control in the Los Angeles<br />
aqueduct system. Nagy, L. A., et al. Nashville, TN :<br />
s.n., 1982, Proceedings Water Quality Tech. Conference<br />
[28] Iron Bacteria in Drinking-Water Distribution Systems: Elemental<br />
Analysis of Gallionella Stalks, using X-ray energydispersive<br />
microanalysis. Ridgeway, H. F., Means, E. G. und<br />
Olson, B. H. 1 1981, Applied and Environmental Microbiology,<br />
Bd. 41, S. 288 – 297<br />
[29] Trinkwasserdesinfektion und Biofilme. Wingender, Jost,<br />
Flemming, Hans-Curt und Schulte, S<strong>im</strong>one, Schaule, Gabriela.<br />
12 2004, Energie | Wasser-Praxis , S. 102<br />
[30] DVGW-Schadensstatistik Wasser Auswertungen für die<br />
Erhebungsjahre 1997 – 1999. 12, s.l. : Wirtschafts- und<br />
Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH , 2002, Bde.<br />
Wasser-Information Nr. 67<br />
[31] Iron corrosion scales: Model for scale growth, iron release,<br />
and colored water formation. Sarin, P., et al. 4 2004, Journal<br />
of Environmental Engineering, S. 364 – 373<br />
[32] Auswirkungen demografischer <strong>Entwicklungen</strong> auf die<br />
Wasserversorgung. Wricke, B. und Korth, A. 10 2007,<br />
Energie|Wasser-Praxis , S. 30-37<br />
[33] Instationäre Korrosion – Eine Ursache der Rostwasserbildung<br />
in Wasserverteilungsnetzen. Kuch, Alfre und Sonthe<strong>im</strong>er,<br />
Heinrich. 12 1986, gwf – wasser/abwasser, Bd.<br />
127, S. 621 – 629<br />
[34] Einfluss der Rohrleitungswerkstoffe auf die Qualität des<br />
Trinkwassers. Wagner, I. 2/3 1993, <strong>3R</strong> international, Bd.<br />
32, S. 88 – 93<br />
[35] Ergebnisse von Untersuchungen zur Vorbereitung der Umstellung<br />
der Wasserversorgung von hartem auf weiches<br />
Wasser. Böhler, E., et al. 12 2005, GWF-Wasser/Abwasser,<br />
Bd. 146, S. 938 – 944<br />
[36] The effect of chloride and orthophosphate on the release<br />
of iron from a cast iron pipe section. Lytle, D. A., et al. 5<br />
2005, Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA,<br />
Bd. 54, S. 267 – 281<br />
[37] Rostwasserprobleme – Ursachen und Gegenmaßnahmen.<br />
Böhler, Ernst. 1997, Veröffentlichungen aus dem TZW<br />
Karlsruhe, Bd. 2, S. 16 -39<br />
[38] Zentrale Dosierung von Korrosionsinhibitoren Teil 1: Phosphate.<br />
W215-1. s.l. : DVGW, Juli 2005<br />
[39] Zentrale Dosierung von Korrosionsinhibitoren – Teil 2: Silikat-Mischungen.<br />
W215-2. s.l. : DVGW, April 2010<br />
[40] Zentrale Dosierung von Inhibitoren zum Trinkwasser unter<br />
ökologischen und technischen Aspekten am Beispiel der<br />
Stadtwerke Göttingen AG. Schumacher, Paul G., Wagner,<br />
Ivo und Wehle, Volker. 10 1993, GWF Wasser – Abwasser,<br />
Bd. 134, S. 628 – 635<br />
[41] Zentraler Einsatz von Silikat-Mischungen als Korrosionsinhibitoren<br />
– das neue DVGW-Arbeitsblatt W 215-2. Hater,<br />
Wolfgang. 4 2010, bbr, S. 60- 65<br />
[42] The effect of phosphorus based corrosion inhibitors and<br />
low desinfection residuals on distribution biofilms. Abernathy,<br />
C. G. und Camper, A. 1998. Bde. AWWA Water Quality<br />
Technology Conference, Proceedings<br />
[43] Biofilm formation in drinking water affected by low concentrations<br />
of phosphorus. Lehtola, Markku J., Miettinen,<br />
Ilkka T. und Martikainen, Pertti J. 6 2002, Canadian Journal<br />
of Microbiology, Bd. 48, S. 494 – 499<br />
[44] Vreeburg und J.H.G. Discolouration in drinking water system:<br />
a particular approach. Technische Universität Delft.<br />
Niederlande : s.n., 2007. S. 198, Dissertation<br />
[45] Deposition of Manganese in Drinking Water Distribution<br />
System. Sly, L.I., Hodgkinson, M.C. und Arunpairojana, V. 3<br />
11 / 2011 843
Literatur<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und<br />
Verfahren <strong>im</strong> Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der<br />
Abwasserentsorgung, der Nah- und Fernwärmeversorgung,<br />
des Anlagenbaus und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
1990, Applied and Environmental Microbiology, Bd. 56,<br />
S. 628 – 639<br />
[46] Impact of enhanced and opt<strong>im</strong>ized coagulation on removal<br />
of organic matter and its biodegradable fraction in<br />
drinking water. Volk, Christian, et al. 8 2000, Water Research,<br />
Bde. Volume 34, Issue 12, S. 3247 – 3257<br />
[47] Teasdale, Peter, et al. Literature review on discoloured<br />
water formation and desktop study of industry practices.<br />
Cooperative Research Centre for Water Quality and<br />
Treatment. Salisbury, Australia : s.n., 2007. Research Report<br />
51. ISBN 18766 16776<br />
[48] Spülverfahren und Spülstrategien für Trinkwasserverteilungssysteme<br />
– Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen.<br />
Korth, Andreas und Donath, Olaf. 6 2011,<br />
Energie|Wasser-Praxis<br />
[49] Clark, , R. M., et al. Water quality changes in a s<strong>im</strong>ulated<br />
distribution system. Journal of Water Science Research<br />
Technology ?- Aqua. 1994, Bd. 43, S. 263 – 277<br />
[50] Biological stability: a multid<strong>im</strong>ensional quality aspect of<br />
treated water. van der Kooij, D. 2000, Water, Air and Soil<br />
Pollution, Bd. 123, S. 25 – 34<br />
[51] Böhler, Ernst und Träncker, Jens. Entwicklung von Methoden<br />
zur Selektion effizienter Spülreg<strong>im</strong>e für unterbelaste<br />
Sektoren in bestehenden Wasserversorgungsnetzen<br />
zur Vermeidung der Rostwasserbildung. Forschungsvorhaben<br />
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung<br />
(BMBF). s.l. : DVGW – Technologiezentrum Wasser Karlsruhe<br />
– Außenstelle Dresden, 2004. Abschlussbericht<br />
[52] Opt<strong>im</strong>ierung der Rohrnetzspülung. Korth, Andreas,<br />
Richardt, Sebastian und Wricke, Burkhard. 10 2007, GWF<br />
Wasser- Abwasser, Bd. 148, S. 704 – 709<br />
[53] Allgemeines zur Zementmörtelauskleidung. Zech, Horst.<br />
2006, RSV – Sonderdruck 50 Jahre Zementmörtelauskleidung<br />
in Deutschland, S. 26-30<br />
[54] Lohmann, Dirk. Untersuchungen zur Vermeidung zu hoher<br />
pH-Werte in weichen Trinkwässern bei der Inbetriebnahme<br />
von Rohrleitungen mit einer Zementmörtelauskleidung.<br />
Fakultät für Chemie, Universität Duisburg .<br />
1999. Dissertation<br />
[55] Zementmörtel-Auskleidung von duktilen Gussrohren für<br />
den Einsatz in Trinkwasser- und Abwasserleitungen. Rammelsberg,<br />
Jürgen. 4 2000, Beton-Informationen, S. 52 –<br />
59<br />
[56] Völkel, Monika. Untersuchung zur Beeinflussung der<br />
Trinkwasserqualität bei Verwendung zementmörtelausgekleideter<br />
Versorgungsrohre. Institut für Siedlungswasserwirtschaft,<br />
Rheinisch-Westfälische TEchnische Hochschule<br />
Aachen. s.l. : Dohmann, M., 1995. Dissertation<br />
[57] W 346. Guss- und Stahlrohrleitungsteile mit ZM-Auskleidung<br />
– Handhabung. s.l. : DVGW, August 2000<br />
[58] Roscher, H.: Rehabilitation von Wasserversorgungsnetzen:<br />
Strategien, Verfahren, Fallbeispiele. Essen: Vulkan-Verlag,<br />
2. Auflage, 2009. – ISBN: 978-3802728501<br />
Autor<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie <strong>im</strong> Online-Shop unter<br />
www.3r-international.de<br />
Dr. Gabriele Weirauch<br />
E-Mail: gabriele_weirauch@hotmail.com<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-international.de<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
844 11 / 2011
Projekt kurz beleuchtet<br />
Wasserversorgung<br />
Trinkwasser in geregelten Bahnen<br />
Landkreis Greiz setzt auf PE-Xa-Rohrsystem<br />
Damit sauberes Trinkwasser dorthin gelangt, wo es<br />
benötigt wird, muss es teilweise lange Wege zurücklegen.<br />
Deshalb ist bereits be<strong>im</strong> Transport auf<br />
eine hohe Qualität der Leitungen zu achten, um<br />
Verschmutzungen oder Leckagen auszuschließen.<br />
So wie <strong>im</strong> Fall einer Trinkwasserleitung <strong>im</strong> südöstlichen<br />
Teil des Landkreises Greiz <strong>im</strong> Freistaat Thüringen.<br />
Nachdem dort eine alte Trinkwasserleitung aus<br />
Asbestzementrohren auf dem Straßenabschnitt<br />
zwischen Herrenreuth und Waldhaus <strong>im</strong> Werdauer-Greizer<br />
Wald defekt war, musste eine neue<br />
Trinkwassertrasse verlegt werden. Der Zweckverband<br />
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung<br />
in Greiz entschied sich dabei für das polymere<br />
Trinkwasserrohrsystem RAU-PE-Xa von<br />
REHAU.<br />
Rohrsystem mit besonderes Eigenschaften<br />
RAU-PE-Xa hat einen wesentlich größeren Widerstand<br />
gegen die Kerbbildung und das Risswachstum<br />
als Rohre aus konventionellem unvernetztem Polyethylen.<br />
Über Zeitstandinnendruckprüfungen wurde<br />
nachgewiesen, dass selbst bei Kerbtiefen von bis zu<br />
20 % der Rohrwanddicke die in DIN 16892 geforderten<br />
Mindeststandzeiten <strong>im</strong>mer deutlich übertroffen<br />
werden. Darüber hinaus zeigen die Rohre<br />
selbst bei Temperaturen von bis zu -50 °C und Drücken<br />
von bis zu 16 bar keine schnelle Rissfortpflanzung.<br />
Ein weiterer Vorteil ist das ausgezeichnete<br />
Rückstellvermögen der Rohre, auch Memory-Effekt<br />
genannt, was die Herstellung mechanischer Verbindungen<br />
erleichtert.<br />
Schnelle und sichere Verlegung<br />
Die neue Trinkwassertrasse verläuft über die<br />
Scheitalle bis in die Ortschaft Mohlsdorf entlang<br />
eines Trinkwasserschutzgebietes. Deshalb waren<br />
eine besonders achtsame Planung sowie die Verwendung<br />
einer durchdachten Systemlösung notwendig.<br />
Zusätzlich stellte die Bodenart der Klassen<br />
5 und 6 eine weitere Herausforderung dar, da<br />
Schluff mit Lehm und Tonanteilen das Verlegen erschweren.<br />
Um möglichst zeitsparend zu arbeiten, wurden<br />
die hoch abriebfesten Rohre, die als Ringbundware<br />
geliefert wurden, <strong>im</strong> Spülbohrverfahren eingebaut.<br />
Mittels Heizwendelschweißmuffen wurde dann die<br />
dauerhaft sichere Verbindung der eingezogenen<br />
Rohre in Zwischenbaugruben realisiert.<br />
BILD 1: Die Verlegung der neuen Trinkwasserrohre <strong>im</strong> Spülbohrverfahren<br />
war unter anderem durch Schluff mit Lehm und Tonanteilen<br />
erschwert. Insgesamt sorgen nun 500 m 63 x 5,8 mm und 2.950 m<br />
90 x 8,2 mm des polymeren Trinkwasserrohrsystems RAU-PE-Xa<br />
dafür, dass das kostbare Trinkwasser in geregelten Bahnen verläuft<br />
Kontakt<br />
REHAU AG + Co, Erlangen, Tanja Nürnberger, Tel. +49 9131 92-5496,<br />
E-Mail: tanja.nuernberger@rehau.com<br />
11 / 2011 845
Projekt kurz beleuchtet<br />
Wasserversorgung<br />
Norwegen setzt auf Berstlining<br />
PE-HD-Rohr ersetzt 900 m duktiles Gussrohr<br />
In der drittgrößten norwegischen Stadt Trondhe<strong>im</strong>, genauer gesagt in Gamle Jonsvannsheien, war eine Trinkwassertransportleitung<br />
DN 600 aus duktilem Guss auf insgesamt 900 m Länge zu erneuern. Die 1968 verlegte Leitung ist in die Jahre<br />
gekommen. Korrosion machte dem Rohr zu schaffen und es kam <strong>im</strong>mer wieder zu Lecks, die aufwändig repariert werden<br />
mussten. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, war es nach über 40 Jahren an der Zeit, die Leitung zu erneuern.<br />
Dabei sollte der Rohrquerschnitt in jedem Fall erhalten bleiben. Aufgrund der korrosiven Bodenverhältnisse wurde ein<br />
PE-HD-Rohr DA 710 x 52,2 mm (mit Schutzmantel) gewählt.<br />
Geschlossene Bauweise spart Kosten<br />
Um ein Verkehrschaos der vielbefahrenen Straße vor einer<br />
Schule und einem Kindergarten zu vermeiden und um Kosten<br />
einzusparen sowie die Bauzeit zu verkürzen, sollte das in 3 m<br />
Tiefe liegende Rohr nicht <strong>im</strong> offenen Graben sondern in geschlossener<br />
Bauweise erneuert werden. Die Kommune Trondhe<strong>im</strong><br />
ist aktives Mitglied der Scandinavian Society for Trenchless<br />
Technology und als solches natürlich bestens mit grabenlosen<br />
Einbautechnologien vertraut und will durch dieses Projekt<br />
zur Verbreitung der NODIG-Verfahren in Norwegen beitragen.<br />
Für das Projekt kam nur das Berstliningverfahren in Frage.<br />
Das war für die Firma SANDUM AS aus Geithus bei Oslo<br />
genau die richtige Aufgabe. Das Unternehmen konnte durch<br />
seine langjährige Einsatzerfahrung, sein Know-How und die<br />
technischen Voraussetzungen überzeugen. Die Kalkulation<br />
ergab statt der 12.000 Kronen / Meter für die offene Bauweise<br />
nur 8.000 Kronen / Meter für die geschlossene, grabenlose<br />
Bauweise. Das entspricht einer Kostenreduktion von<br />
über 30 %. Damit war der Deal perfekt.<br />
Die Rohrd<strong>im</strong>ension war eine neue Herausforderung, die<br />
einer sorgfältigen Planung und einer engen Abst<strong>im</strong>mung mit<br />
dem Ingenieurbüro Asplan Viak AS und mit dem Maschinenhersteller<br />
TRACTO-TECHNIK bedurfte; denn noch nie zuvor<br />
wurde in Norwegen ein 600er duktiles Gussrohr <strong>im</strong> Berstliningverfahren<br />
erneuert. Die Frage war, mit welcher Baulänge<br />
ein PE-HD-Rohr möglichst schonend eingezogen werden<br />
kann, um die Zugbelastungen auf das Rohr zu min<strong>im</strong>ieren.<br />
Deshalb wurde beschlossen, umweltverträgliches Bentonit<br />
zur Schmierung des Rohrstrangs einzusetzen. Dies wirkt sich<br />
spürbar auf die Mantelreibung aus und erleichtert den<br />
Rohreinzug.<br />
Der Projektablauf<br />
Begonnen wurde mit einer Teststrecke mit der Option für<br />
die Fortsetzung des Projekts. Für diese Mammutaufgabe<br />
musste schweres „Geschütz“ aufgefahren werden. Zum Einsatz<br />
kam der GRUNDOBURST mit 250 t Zugkraft und ein<br />
BILD 1: Vorbereiteter Rohrstrang vor dem Einzug ins Altrohr<br />
846 11 / 2011
spezielles Rollenmesser, mit dem das duktile Gussrohr aufgeschnitten<br />
werden konnte. Die nachfolgende 830er Aufweitung<br />
hat die Aufgabe, das geteilte Altrohr in das Erdreich<br />
zu verdrängen und den Hohlraum für die Aufnahme des Neurohres<br />
zu vergrößern. Der Test verlief erfolgreich und es gab<br />
keine besonderen Auffälligkeiten, so dass die weiteren Teilstrecken<br />
in Angriff genommen werden konnten.<br />
Die 900 m Trasse wurde in sieben Abschnitte unterteilt,<br />
die kürzeste Strecke mit 120 m, die längste mit 170 m Länge.<br />
Das PE-Rohr DA 710, PE 100, SDR 13,6 in Einzellängen<br />
von 18 m wurde zu einem Rohrstrang, der jeweiligen Haltungslänge<br />
entsprechend verschweißt, einer Druckprüfung<br />
unterzogen und mit einem Zugkopf kraftschlüssig verschlossen.<br />
An das vom GRUNDOBURST in das Altrohr eingeschobene<br />
Gestänge wurden Rollenmesser und Aufweitung angekoppelt.<br />
Be<strong>im</strong> Rückzug wurde das Altrohr geschnitten und<br />
das Neurohr unter Einsatz von Bentonit zwecks Reduzierung<br />
der Mantelreibung in den zuvor aufgeweiteten Hohlraum<br />
eingezogen. Die Zugbelastung am Rohr wurde mit dem Zugkraftmessgerät<br />
permanent überwacht und protokolliert. Sie<br />
lag durchschnittlich bei ca. 500 kN und damit weit unter dem<br />
zulässigen Wert. Die gesamte Maßnahme lief über vier Monate<br />
und war <strong>im</strong> August zur Zufriedenheit des Auftraggebers<br />
vollständig abgewickelt.<br />
BILD 2: Das<br />
Rollenmesser zum<br />
Aufschneiden der<br />
Gussleitung kurz vor<br />
dem Start<br />
Kontakt<br />
Tracto Technik, Björn Fre<strong>im</strong>uth,<br />
E-Mail: björn.fre<strong>im</strong>uth@tracto-technik.de<br />
BILD 3: Positionieren<br />
des Neurohrs – die<br />
Schmierung des<br />
Neurohrs bei Einzug<br />
min<strong>im</strong>ierte die<br />
Zugbelastung am Rohr<br />
… verbindet die Märkte<br />
847 10 / 2010 10 / 2010 847<br />
11 / 2011 847
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
<strong>3R</strong> + gwf Wasser Abwasser<br />
<strong>im</strong> Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
<strong>3R</strong> International erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser Abwasser erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenhe<strong>im</strong>erstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder <strong>im</strong> Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (12 Ausgaben) und<br />
gwf Wasser Abwasser (12 Ausgaben) <strong>im</strong> attraktiven Kombi-Bezug.<br />
□ Als Heft für 528,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 528,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ Als Heft für 264,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 264,- pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr. Die sichere und pünktliche Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,–<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN0411<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Marktübersicht<br />
2011<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de
2011<br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Absperrklappen<br />
Anbohrarmaturen<br />
Schaugläser für Rohrleitungen<br />
Rohre<br />
Fernwärmerohre PE 100-RC Rohre Schutzmantelrohre<br />
762 10 / 2011
RohRe + Komponenten<br />
2011<br />
Kunststoff<br />
Formstücke<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
10 / 2011 763
2011<br />
mAschInen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Berstlining<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
764 10 / 2011
mAschInen + GeRäte<br />
2011<br />
Leckageortung<br />
Inspektion, Reparatur und Reinigung<br />
Marktübersicht<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
10 / 2011 765
2011<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
766 10 / 2011
KoRRosIonsschutZ<br />
2011<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
10 / 2011 767
2011<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
Dienstleistungen<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Ingenieurdienstleistungen<br />
768 10 / 2011
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
2011<br />
sanierung<br />
Sanierung Gewebeschlauchsanierung Schächte<br />
Marktübersicht<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Institute<br />
10 / 2011 769
2011<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
770 10 / 2011
165 m Schmutzwasser-Kanal mit<br />
Pilotrohrverfahren erneuert<br />
Von Alfons Goral 1<br />
Der aus dem Jahr 1937 stammende Schmutzwasserkanal DN 200 in der Fischstraße in Delmenhorst war aufgrund<br />
des Alters zu erneuern. Aufgrund der besonderen örtlichen Umstände und trotz der langen Pressstrecken über max<strong>im</strong>al<br />
85 m wurde das Pilotrohrverfahren gewählt.<br />
Örtliche Verhältnisse, vorhandene<br />
Fremdleitungen<br />
Die Fischstraße in Delmenhorst ist ein alter Straßenzug, der<br />
früher aus dem Bereich des Bahnhofs nach Überquerung des<br />
örtlichen Vorfluters Delme in die östlichen Stadtteile führte.<br />
Die Stadtwerke Delmenhorst erzeugten bis in die siebziger<br />
Jahre des vorigen Jahrhunderts an der Fischstraße unweit<br />
der Delme Stadtgas. Infolge der damaligen Gaserzeugung<br />
finden sich <strong>im</strong> Boden erhebliche Teerrückstände. Die<br />
am stärksten belasteten Flächen wurden bereits vor mehreren<br />
Jahren aufwändig abgekapselt. Im weiteren Straßenverlauf<br />
liegen die Gebäude des örtlichen Energieversorgers.<br />
Hier verzweigt eine 110-kV-Leitung in mehrere 20-kV-Leitungen<br />
ins übrige Stadtgebiet. Die Kabel liegen dabei beiderseits<br />
<strong>im</strong> Gehwegbereich und kreuzen zudem mehrfach die<br />
Straße. Hinzu kommen je eine Hoch- und Mitteldruckgasleitung<br />
sowie eine Hauptwasserleitung mit jeweils zugehörigen<br />
kreuzenden Hausanschlussleitungen. Da bereits in beiden<br />
Gehwegen Kabelstränge der Telecom und ihrer Nachfolgeunternehmen<br />
liegen, wurden vom örtlichen Versorger<br />
für noch zu verlegende Lichtwellenleiter Leerrohre an beiden<br />
Fahrbahnrändern seitlich der Rinnen verlegt. Unter dem<br />
Fahrbahn- und Gehwegbelag ist der Untergrund somit opt<strong>im</strong>al<br />
ausgenutzt.<br />
Der Schmutzwasserkanal aus Steinzeugrohren DN 200<br />
wurde <strong>im</strong> Jahre 1937 fertiggestellt. Der Anfangsschacht<br />
liegt hinter der Delmebrücke. Im weiteren Verlauf kreuzt der<br />
Kanal die auf einer ehemaligen Bahntrasse gelegene stark<br />
befahrene Wittekindstraße, führt entlang der Gebäude des<br />
örtlichen Energieversorgers und dann durch Wohngebiet bis<br />
er sich unterhalb einer Privatbahntrasse mit einem weiteren<br />
Sammler vereinigt. Aus der Kamerabefahrung war bekannt,<br />
dass einzelne Haltungen sanierungsbedürftig sind und zudem<br />
in den oberen drei Haltungen Unterbögen vorhanden<br />
sind. So war <strong>im</strong> Vorfeld bereits der Abschnitt <strong>im</strong> Wohngebiet<br />
und unter der Privatbahn mittels Inliner saniert worden, so<br />
dass nur die oberen drei Haltungen noch zu erneuern waren.<br />
1<br />
Der Autor betraute die Baumaßnahme von der Planungsphase<br />
bis zur Schlussabnahme auf Seiten des Auftraggebers Stadtwerke<br />
Delmenhorst.<br />
Im oberen Abschnitt zwischen Delme und Wittekindstraße<br />
besteht der Fahrbahnbelag aus gut erhaltener Asphaltdecke<br />
und <strong>im</strong> unteren Abschnitt von der Wittekindstrasse<br />
bis zur Bahnlinie aus Kopfsteinpflaster, sogenannten<br />
Bumsköpfen. Auflage der Stadt Delmenhorst als Straßenbaulastträger<br />
war, dass die gut erhaltene Asphaltdecke <strong>im</strong><br />
oberen Abschnitt erhalten bleiben muss.<br />
Im Untergrund wurden <strong>im</strong> Bereich der Baustrecke, wie<br />
<strong>im</strong> übrigen Stadtgebiet auch, überwiegend Feinsande mit<br />
unterschiedlichen Be<strong>im</strong>engungen von gröberen Sanden erwartet.<br />
Aber auch Schluff, Klei und Torf waren nicht auszuschließen.<br />
Über die Kiesfraktion hinausgehende Korngrößen<br />
konnten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Der Grundwasserspiegel liegt <strong>im</strong> Mittel bei knapp über<br />
6,00 m+NN und damit ca. 1,40 m unter Gelände und ca.<br />
1,40 m über Rohrscheitel. Aufgrund des mit Teeranteilen<br />
kontaminierten Untergrundes war eine erhöhte Belastung<br />
des Grundwassers zu erwarten. Durch ein stärkeres Abpumpen<br />
des Grundwassers für eine Grundwasserabsenkung<br />
musste mit einem Auswaschen der angelagerten Schadstoffe<br />
aus dem Boden gerechnet werden. Das so geförderte<br />
Grundwasser wäre noch stärker kontaminiert und könnte<br />
auch nicht in den nächstgelegenen Vorfluter abgeleitet werden.<br />
Bei Ableitung über den Schmutzwasserkanal sind dann<br />
zusätzliche Kosten aus Abwassergebühren einzukalkulieren.<br />
Voruntersuchungen<br />
Nach dem alle Fremdleitungspläne vorlagen, wurden <strong>im</strong> geplanten<br />
Vortriebsbereich <strong>im</strong> Abstand von ca. 50 m insgesamt<br />
vier Bohrungen bis in eine Tiefe von knapp 6 m unter Gelände<br />
und damit ca. 2 bis 3 m unter geplanter Kanalsohle abgeteuft.<br />
Erbohrt wurden wie erwartet Feinsande mit Be<strong>im</strong>engungen<br />
gröberer Fraktionen, die den Bodenklassen 3 und 4<br />
zuzuordnen sind. Daneben fanden sich auch einzelne dünne<br />
Torfschichten und Bereiche mit deutlich humosen Anteilen.<br />
Das angetroffene Grundwasser wurde gleichfalls beprobt.<br />
Aufgrund der Inhaltsstoffe sollte auf eine Einleitung in offene<br />
Vorfluter oder in den Regenwasserkanal verzichtet werden<br />
und das geförderte Wasser über den Schmutzwasserkanal<br />
abgeleitet werden.<br />
11 / 2011 859
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Gründe für die Wahl des Rohrvortriebs<br />
als Bauverfahren<br />
Schon <strong>im</strong> frühen Planungsstadium wurde klar, dass eine Erneuerung<br />
des Schmutzwasserkanals in offener Bauweise<br />
nicht in Frage kam, da<br />
auf ca. 70 m die intakte Asphaltdecke nicht aufgeschnitten<br />
werden durfte,<br />
in diesem Abschnitt der Fischstraße aufgrund des hohen<br />
Verkehrsaufkommens eine Straßensperrung problematisch<br />
ist,<br />
eine Querung der verkehrlich stark frequentierten Wittekindstraße<br />
in offener Bauweise ebenfalls problematisch ist,<br />
Bild 1: Startgrube – Vorbereitung der Vortriebspilotrohre,<br />
rechts unten der Theodolit<br />
<strong>im</strong> Verlauf der Wittekindstraße ein Regenwasserkanal<br />
und ein hierzu parallellaufender Stauraumkanal größeren<br />
Durchmessers zu unterqueren sind,<br />
eine erhöhte Bodenkontamination infolge der Teerrückstände<br />
zu erwarten ist. Der belastete Bodenaushub würde<br />
nicht wieder eingebaut werden können und müsste<br />
teuer gesondert entsorgt werden,<br />
als Ersatz für den abgefahrenen belasteten Boden muss<br />
Füllboden zugekauft werden,<br />
aus dem genannten Grund ist auch mit einer Belastung<br />
des Grundwassers zu rechnen und auch das bei offener<br />
Baugrube aus der Grundwasserabsenkung geförderte<br />
Grundwasser muss gesondert entsorgt werden,<br />
<strong>im</strong> Verlauf der Kanaltrasse ein Baum am Straßenrand bei<br />
der offenen Bauweise möglicherweise gefährdet ist.<br />
Als Alternativen zur offenen Bauweise kamen noch Inlinersanierung<br />
(Schlauchliner, TIP-Verfahren usw.), Pipe-eating,<br />
Berstlining und Vortriebsverfahren in Frage. Da die vorhandenen<br />
Unterbögen mit der Inlinersanierung nicht beseitigt<br />
werden können, schied dies Sanierungsverfahren aus. Berstlining<br />
kam zum einen wegen der Unterbögen nicht in Frage und<br />
zum anderen war aus historischen Bauunterlagen bekannt,<br />
dass der alte Steinzeugrohrkanal unter der Wittekindstraße<br />
<strong>im</strong> Bereich einer ehemaligen Bahnstrecke be<strong>im</strong> Bau auf ca.<br />
20 m Länge mit einem über 30 cm dicken Betonmantel versehen<br />
worden war. Hier wäre Berstlining auch nur mit erhöhtem<br />
Aufwand und entsprechenden Kosten ausführbar gewesen.<br />
Da be<strong>im</strong> Pipe-eating-Verfahren in der Regel ein größerer<br />
Durchmesser als der Bestand eingebaut wird, schied<br />
dies auch aus. Nachteilig sowohl bei Pipe-eating als auch bei<br />
Berstlining ist zudem, dass der bestehende Kanal vor Baubeginn<br />
außer Betrieb genommen werden muss. Da in der<br />
Fischstraße auf der ca. 90 m langen Vortriebsstrecke nur drei<br />
Hausanschlüsse zu berücksichtigen waren, kristallisierte sich<br />
so schnell das Pilotrohrverfahren in einer Trasse neben dem<br />
Altkanal als mögliches Vortriebsverfahren heraus. Als steuerbares<br />
Verfahren war mit diesem Verfahren auch die Möglichkeit<br />
gegeben, das erforderliche geringe Gefälle einhalten<br />
zu können. Kritisch war noch die vorgesehene Länge, da aus<br />
der Literatur bisher nur Längen an die 30 m für das Rohrkaliber<br />
DN 200 bekannt waren. Nach Rücksprache mit verschiedenen<br />
Bohrfirmen und den Herstellern von Vortriebsmaschinen<br />
bestanden keine Bedenken mehr, dass diese Länge ausführbar<br />
ist. So sollte dann von jenseits der Wittekindstraße<br />
entgegen dem Gefälle in Richtung Delme zum oberen Endschacht<br />
vorgepresst werden.<br />
Bild 2: Pilotrohre mit innerem Rohr auf Lagerplatz<br />
Pilotrohrverfahren<br />
Ein Pilotrohr mit einem Außendurchmesser von 114 mm wird<br />
von einem Startschacht aus zum Ziel gesteuert vorgepresst.<br />
Das Pilotrohr ist dabei hohl und durch diese Sichtachse wird<br />
mittels eines Theodoliten mit angeschlossener Kamera der<br />
Vortrieb laufend überwacht. An der Rückseite des unter 45°<br />
abgeschrägten Presskopfes ist eine Diodenzieltafel angebracht,<br />
deren Bild über die Kamera auf einen Monitor über-<br />
860 11 / 2011
Bild 3: Zielgrubenbereich – <strong>im</strong> Vordergrund Mitte<br />
Aufweitkopf, dahinter ausgebaute Aufweitrohre<br />
Bild 5: Angekommen – rechts das noch in Betrieb<br />
befindliche Altrohr, provisorisch für den Ausbau der<br />
Aufweitrohre umgeleitet<br />
Bild 4: Zielgrube – Ankunft der Aufweitrohre, der Aufweitkopf<br />
ist schon ausgebaut<br />
tragen wird. Der Bediener an der Presse kann dann entsprechend<br />
dem Bild auf dem Monitor durch Drehen des abgeschrägten<br />
Kopfes die Ablenkung des Kopfes und damit<br />
die Richtung be<strong>im</strong> Vortrieb steuern. Für Arbeiten unter dem<br />
Grundwasserspiegel und bei bindigen Böden wird ein Doppelrohr<br />
eingesetzt. Hierbei erfolgt die Drehung des Kopfes<br />
dann über das innere Rohr. Bedingt durch das Doppelrohr<br />
verringert sich der Durchmesser der optischen Gasse,<br />
dies erfordert eine höhere Genauigkeit bei der Steuerung.<br />
Nachdem der Steuerkopf das Ziel erreicht hat, wird <strong>im</strong> Startschacht<br />
ein stählernes Aufweitrohr an das Ende des Pilotrohres<br />
montiert und das Stahlrohr an der Führung des Pilotrohres<br />
ebenfalls vorgepresst. Durch den offenen Kopf des Auf-<br />
weitrohres eintretender Boden wird über eine Schnecke zum<br />
Startschacht zurückgefördert. Sind die Aufweitrohre am Ziel<br />
eingetroffen, werden am anderen Ende <strong>im</strong> Startschacht die<br />
Mediumrohre (in diesem Fall Steinzeug DN 200) anmontiert<br />
und zum Zielschacht vorgeschoben, wo dann – wie vorher<br />
die Pilotrohre – die Aufweitrohre geborgen werden.<br />
Planung<br />
Um das Pilotrohrverfahren möglichst wirtschaftlich einzusetzen,<br />
wurde die Länge der Vortriebsstrecke dahingehend<br />
erweitert, dass vom Vortriebsschacht nicht nur in die eine<br />
Richtung zur Delme, sondern auch in die entgegengesetzte<br />
11 / 2011 861
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Richtung gepresst werden sollte. Denn auch in diesem zweiten<br />
Abschnitt war mit zahlreichen Hindernissen, hauptsächlich<br />
querende und parallel verlaufende Leitungen zu rechnen.<br />
Es wurde dann die Lage des Startschachtes so festgelegt,<br />
dass eine Strecke von insgesamt ca. 165 m mit zwei Vortrieben<br />
erneuert werden konnte. Die neue Trasse verläuft ca. 3 m<br />
parallel zum alten Kanal, wobei sie in Fließrichtung unterhalb<br />
des Startschachtes <strong>im</strong> spitzen Winkel auf die alte Trasse zuläuft,<br />
damit die neue Leitung am obersten bestehen bleibenden<br />
Schacht des Bestandes angeschlossen werden kann. Hier<br />
mussten die letzten 10 – 12 m der Neubaustrecke doch in<br />
offener Bauweise erstellt waren, da andernfalls der Vortrieb<br />
die alten Rohre zerstört hätte. Da auf diesen letzten Metern<br />
sowieso noch drei Hausanschlüsse in offener Baugrube anzuschließen<br />
waren, fiel dies aber nicht weiter ins Gewicht. Der<br />
obere Endschacht wurde als Zielschacht in einem Parkstreifen<br />
seitlich versetzt zur vorhandenen Trasse geplant. So konnte<br />
der Verkehr einspurig an der Baugrube des Zielschachtes<br />
vorbeigeführt werden.<br />
Begünstigt durch die parallele Lage von Bestand und neu<br />
wurde für den Großteil der Hausanschlüsse keine Wasserhaltung<br />
eingerichtet, da aufgrund der Kamerabefahrung des<br />
Hauptkanals davon ausgegangen werden konnte, dass die Anschlussleitungen<br />
von oben beziehungsweise unter einem vertikalen<br />
Winkel von 45° einmünden. Der Vortrieb konnte die<br />
noch in Betrieb befindlichen Anschlussleitungen also unterfahren.<br />
Die insgesamt anzuschließenden 13 Hausanschlüsse<br />
sollten nach Abschluss der Vortriebsarbeiten dann über Kopflöcher<br />
und Anbohren der Vortriebsrohre entsprechend der<br />
Lage des Bestandes über Flexoset-Elemente angeschlossen<br />
und erneuert werden.<br />
Da alle Leitungen an den alten Kanal über Revisionsschächte<br />
angeschlossen waren, konnte die endgültig erforderliche<br />
Höhenlage <strong>im</strong> Verlauf der Planung überprüft werden.<br />
Es stellte sich heraus, dass das neue Haltungsgefälle durch<br />
die am oberen Endschacht angeschlossene Leitung best<strong>im</strong>mt<br />
wurde, die die tiefste Lage hatte. So ergab sich zwischen den<br />
beiden Zwangspunkten Revisionsschacht am oberen End-<br />
Tabelle 1: Zeitdauer be<strong>im</strong> Pilotrohrvortrieb<br />
Einrichten<br />
Pilotrohre<br />
Aufweitungsrohre<br />
Vortrieb 1 (86 m) Vortrieb 2 (79 m)<br />
1–2 Tage<br />
1–2 Tage<br />
2 Tage<br />
Mediumrohre 8 h, 45 Min für 86 m*<br />
Drehen Presse, Kran zur 2. Zielgrube<br />
Pilotrohre<br />
Aufweitungsrohre<br />
Mediumrohre<br />
Abbau<br />
Insgesamt für 165 m:<br />
* gem. Vortriebsprotokoll<br />
1 Tag<br />
ca. 14 Werktage<br />
1–2 Tage<br />
2 Tage<br />
8 h, 8 Min*<br />
ca. 1 Tag<br />
schacht und unterem Schacht des Bestandes ein Höhenunterschied<br />
von nur 36 cm. Auf der gesamten Neubaustrecke<br />
von ca. 177 m beträgt das Gefälle damit gerade 2 %o. Ausgeschrieben<br />
wurde dann eine Vorpressstrecke von 165 m mit<br />
einem Startschacht DN 2000 und einem oberen Zielschacht<br />
mit DN nach Wahl des AN. Der Startschacht sollte dabei als<br />
Absenkschacht niedergebracht werden und später zum Revisionsschacht<br />
umgebaut werden. Am unteren Ende der Vorpressstrecke,<br />
wo diese in offener Bauweise an den Bestand<br />
angeschlossen wird, war auf ca. 12 m offene Bauweise mit<br />
Grundwasserabsenkung vorgesehen.<br />
Als Rohrmaterial waren – wie bei Schmutzwasserkanälen<br />
in Delmenhorst üblich – innen glasierte Steinzeugrohre vorgesehen.<br />
Da über die vorhandenen Anschlüsse hinaus weitere<br />
Anschlüsse an die zu erneuernden Haltungen nicht vorgesehen<br />
waren, sollte der bisherige Durchmesser DN 200 beibehalten<br />
werden.<br />
Ausführung<br />
Aufgrund der besonderen Anforderungen und einer gewissen<br />
Eilbedürftigkeit wurden die Ausschreibungsunterlagen<br />
<strong>im</strong> Rahmen einer beschränkten Ausschreibung auf Grundlage<br />
des Konjunkturpaketes II fünf qualifizierten Firmen der<br />
Region übergeben.<br />
Vorarbeiten Absenkschacht<br />
Am Montag begann die beauftragte Baufirma mit der Einrichtung<br />
der Baustelle und am Dienstag wurde mit der Aufnahme<br />
des Pflasters und den Aushubarbeiten für den Startschacht<br />
begonnen, da bereits am Mittwoch das komplette ca. 2,50 m<br />
hohe Schachtbauteil angeliefert und eingesetzt werden sollte.<br />
Das Absenken auf die erforderliche Sohltiefe gelang dann<br />
am Donnerstag relativ problemlos und am Freitag wurde die<br />
Betonplombe an der Schachtsohle gegossen. Anfang der folgenden<br />
Woche erfolgte die Sohlprofilierung und die Baustelle<br />
konnte für die Vortriebsmannschaft des Subunternehmers<br />
freigegeben werden.<br />
Aufbau<br />
Innerhalb von zwei Tagen wurde die gesamte Maschinentechnik<br />
für den Vortrieb bestehend aus dem <strong>im</strong> Schacht aufzubauenden<br />
Pressbohrgerät, einem Kran zur Bedienung des Vortriebsschachtes<br />
in einem Container und einem zweiten Kran<br />
für die Zielbaugrube nebst Kleingerät angeliefert und für die<br />
erste Pressung eingerichtet.<br />
Durchführung und Dauer<br />
Am neunten Arbeitstag starteten die Arbeiten mit dem Vortrieb<br />
der Pilotrohre in Fließrichtung. Während die Vortriebsmaschinerie<br />
aufgebaut und eingerichtet wurde, hatte das<br />
Bauunternehmen bereits die offene Baugrube vor dem bestehenbleibenden<br />
Bestandsschacht ausgehoben und verbaut.<br />
Die hier erforderliche Grundwasserabsenkung konnte ohne<br />
besonderen Aufwand betrieben werden, da das Grundwasser<br />
sich hier als unbelastet erwies und in den Regenwasserkanal<br />
abgeleitet werden konnte. Nach zwei Tagen waren die<br />
862 11 / 2011
ersten 86 m vorgepresst und der Steuerkopf erreichte in der<br />
offenen Baugrube neben dem alten Kanal wieder das Tageslicht.<br />
Am nächsten Tag konnten dann die Stahlaufweitrohre<br />
vorgepresst werden. Dabei wird der durch den Aufweitkopf<br />
gelöste Boden über eine Schnecke <strong>im</strong> Aufweitrohr bis<br />
zum Startschacht transportiert und dort in einen Sammelkübel<br />
aufgefangen. Teerhaltigen Bodenteile wurden dabei<br />
nicht gefunden und auch <strong>im</strong> Startschacht konnten <strong>im</strong> einsickernden<br />
Grundwasser auffällige Stoffe nicht festgestellt<br />
werden. Die endgültig einzubauenden Steinzeugrohre mussten<br />
dann in einem Zug ohne größere Unterbrechungen vorgepresst<br />
werden, um zu vermeiden, dass sich die Rohre mit<br />
ihrer glasierten Außenwandung bei einem längeren Stillstand<br />
<strong>im</strong> Untergrund festsaugen und dann be<strong>im</strong> Wiederanfahren<br />
ein für die Steinzeugrohre zu hoher Pressdruck erforderlich<br />
wird. Für die insgesamt einzubauenden 86 Steinzeugrohre<br />
in Längen von 1 m rechnete die Bohrfirma mit knapp einem<br />
Arbeitstag. Diese Kalkulation konnte problemlos <strong>im</strong> Vortrieb<br />
1 eingehalten werden und nach gut acht Stunden waren die<br />
86 m eingebaut. Am nächsten Tag erfolgte das Drehen der<br />
Presse, das Umsetzen des Ausbaukranes vom Zielschacht 1<br />
zum Zielschacht 2 und die Vorbereitung der zweiten Pressung<br />
in die Gegenrichtung.<br />
Der angefallene Zeitaufwand ist in Tabelle 1 dokumentiert.<br />
Abbau<br />
Nachdem auch in der zweiten Pressstrecke die Steinzeugrohre<br />
innerhalb von gut 8 Stunden (ca. 10 Rohre/h) vorgeschoben<br />
waren, wurde am Folgetag die Baustrecke von der Einrichtung<br />
der Bohrfirma abgeräumt. Umgehend begann Fa. Stefen<br />
dann auch in diesem Abschnitt mit der geplanten Übernahme<br />
und Erneuerung der Hausanschlüsse. Infolge des unerwartet<br />
frühen Wintereinbruchs mit längeren Frostperioden<br />
kam es bei diesen Arbeiten dann allerdings zu größeren<br />
Zeitverzögerungen.<br />
Unvorhergesehenes vermeiden<br />
Obwohl die Lage der Hausanschlüsse durch eine vorhergehende<br />
Kamerabefahrung ziemlich genau feststand, ist es dann<br />
doch geschehen, dass ein bestehender Hausanschluss durch<br />
das Pilotrohr überfahren bzw. angefahren wurde. Dies wurde<br />
erst nach Abzug der Vortriebsmannschaft bemerkt, als<br />
an diesem Hausanschluss der Abfluss stockte und <strong>im</strong> oberhalb<br />
liegenden Revisionsschacht Abwasser einstaute. Außerplanmäßig<br />
musste daher das Erneuern dieses Anschlusses<br />
vorgezogen werden. Be<strong>im</strong> Freilegen des Hausanschlusses<br />
zeigte sich dann, dass be<strong>im</strong> Einpressen der Aufweitrohre die<br />
entgegen den Annahmen flachliegende alte Leitung DN 150<br />
aus Steinzeugrohren „geknackt“ worden war. Will man solche<br />
Überraschungen vermeiden, sollte gleich nach Abschluss der<br />
Vortriebsarbeiten eine Überprüfung der noch in Betrieb befindlichen<br />
Anschlussleitungen mit einer Satellitenkamera aus<br />
dem Altkanal heraus vorgesehen werden.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Erneuerung des aus dem Jahre 1937 stammenden<br />
Schmutzwasserkanals DN 200 in der Fischstraße wurde aufgrund<br />
der problematischen Boden- und Grundwasserverhältnisse<br />
<strong>im</strong> Zusammenhang mit vielen Fremdleitungen mittels einer<br />
parallel zum Altbestand vorgetriebenen Pilotrohrbohrung<br />
durchgeführt. Aus einer Startgrube wurden zwei Vortriebe<br />
über 79 und 86 m erstellt und der neue Kanal so in knapp<br />
drei Wochen hergestellt. Die Längen lagen dabei <strong>im</strong> oberen<br />
Bereich der bisher durchgeführten Pilotrohrvortriebe für DN<br />
200-Rohre. Die Verlegung der Rohre hätte in offener Bauweise<br />
mit einer entsprechend aufwändigen Grundwasserabsenkung<br />
und der Vielzahl von parallelen und kreuzenden Leitungen<br />
sicher erheblich mehr Zeit erfordert. Die bestehenden<br />
Hausanschlüsse wurden anschließend in offener Bauweise<br />
erneuert und an den Kanal angeschlossen.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Alfons Goral<br />
Osterholz-Scharmbeck<br />
Tel. +49 4791 82460<br />
E-Mail: goralaa@aol.com<br />
11 / 2011 863
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Sanierung von öffentlichem Kanal<br />
und privaten Hausanschlusskanälen<br />
nach „Berliner Bauweise“<br />
Von Alexander Krüger und Horst Görg<br />
Der Einsatz von Formteilen, Sattelstücken und Abzweigen hat <strong>im</strong> Kanalneubau dazu geführt, dass seitliche Zuläufe wie<br />
Hausanschüsse oder Straßenabläufe in den meisten Fällen entlang der Rohrleitung direkt am Rohr angeschlossen wurden.<br />
Die sogenannte Berliner Bauweise, die ab den 1980er Jahren mit der Entwicklung von geschlossenen Bauverfahren von<br />
den Berliner Wasserbetrieben angewendet wurde, verfolgt ein anderes Konzept. Bei ihr schließen alle Kanäle, öffentliche<br />
Hauptsammler sowie die privaten Grundstücksentwässerungen zentral, sternförmig an den Schachtbauwerken an.<br />
Mittlerweile hat die Sanierung der bestehenden Abwasserkanäle den Neubau vielerorts abgelöst. Die Diskrepanz zwischen<br />
dem was <strong>im</strong> Neubau best<strong>im</strong>mt gut ist und dem was bei der Sanierung dann später vielleicht hinderlich ist, durchzieht<br />
viele Bereiche des Bauwesens. Aktuelle Bedeutung erlangt die Thematik vor dem Hintergrund der zu erwartenden<br />
Sanierungen von maroden Hausanschlusskanälen, die eine Folge der demnächst anstehenden Dichtheitsprüfungen<br />
sein dürften. Die Problematik seitlicher Anschlüsse als ein Ausschlusskriterium für die grabenlose Sanierung bei herkömmlichen<br />
Bauweisen ist unbestritten. Bei vielen Sanierungsmaßnahmen kann aus Sicht der Verfasser ein Zusammenfassen<br />
der Anschlüsse an Schächten analog zur „Berliner Bauweise“ Vorteile bringen, wenn man ganzheitliche Betrachtungsweisen<br />
anführt, eine gemeinschaftliche Sanierungsstrategie verfolgt und die grabenlosen Techniken bestmöglich<br />
anwenden möchte. Aus den Schachtbauwerken arbeitende Verfahren können ohne Aufgrabungsarbeiten in Straße und<br />
Grundstück die Kanäle in vorhandener bzw. in neuer Trasse grabenlos erneuern.<br />
Einführung<br />
Die Fachgruppe um Professor Görg <strong>im</strong> Lehrstuhl Abwasserund<br />
Abfalltechnik der Universität Siegen hat sich der Forderung<br />
der grabenlosen Leitungserneuerung nicht nur durch die<br />
erfolgreiche Implementierung des deutschen Symposiums für<br />
die grabenlose Leitungserneuerung (SgL, 2011 zum 6. Mal)<br />
verschrieben. Die vielen Facetten mit dem hohen Innovationspotenzial<br />
grabenlosen Bauens sind Gegenstand verschiedener<br />
kürzlich am Lehrstuhl entstandener Publikationen [1 – 4].<br />
Vor dem Hintergrund der Fragestellung, wie die Verfahren<br />
der grabenlosen Leitungserneuerung effektiver angewendet<br />
werden können, steht neben Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit,<br />
Dichtheit und Betriebssicherheit die Nachhaltigkeit <strong>im</strong><br />
Focus der Betrachtung. Vor diesen Kriterien muss der Umgang<br />
mit seitlichen Anschlüssen <strong>im</strong> Kanalbestand <strong>im</strong> Zusammenhang<br />
mit der grabenlosen Erneuerung kritisch hinterfragt<br />
werden. Nach [5] werden 17 % der öffentlichen Kanäle<br />
mittelfristig als sanierungsbedürftig eingestuft. Ein weitaus<br />
höheres Schadenspotenzial wird in den Kanälen der Grundstücksentwässerung<br />
gesehen, die zwei bis dre<strong>im</strong>al so lang sind<br />
wie öffentliche Kanäle. Hier gehen Schätzungen [6] davon<br />
aus, dass <strong>im</strong> schl<strong>im</strong>msten Fall bis zu 70 % der Kanäle undicht<br />
sind. Die Notwendigkeit der Dichtheit aller „Abwasser ableitenden“<br />
Leitungen zum Schutz der Umwelt vor den gefährlichen<br />
Abwasserinhaltstoffen unterstreicht die Diskussion um<br />
die Dichtheit der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen,<br />
wie sie aktuell in Nordrhein-Westfalen der §61a Landeswassergesetz<br />
fordert [7]. Mit der Fortsetzung von flächendeckenden<br />
Dichtheitsprüfungen dürfte die Nachfrage nach kostengünstigen<br />
Verfahren und klugen Strategien einhergehen.<br />
In der Fachwelt ist unbestritten, dass Schäden vermehrt<br />
dort auftreten, wo Leitungen aneinander anschließen oder<br />
miteinander verbunden werden. Vom Umfang her dürfte ihr<br />
Ausmaß bundesweit <strong>im</strong> zweistelligen Millionenbereich liegen.<br />
Diese neuralgischen Punkte sind aufgrund ihrer Lage entlang<br />
der Rohrleitung für die grabenlose Sanierung schlecht zugänglich.<br />
Bild 1 verdeutlicht die Problematik des seitlichen<br />
Anschlusspunktes bei grabenlosen Sanierungsverfahren.<br />
Während bei den Renovationsverfahren wie dem Kurz-<br />
Rohrrelining („Tight-in-Pipe“), dem Schlauchlinerverfahren<br />
oder den Strangverfahren („Close-Fit“, „Flexoren“) noch die<br />
Möglichkeit besteht, den Anschluss grabenlos mittels Reparaturverfahren<br />
(„Stutzensanierung“, Verpressen, Verkleben<br />
usw.) wieder herzustellen, ist dies be<strong>im</strong> Berstlining nicht<br />
möglich. Wie Untersuchungen des IKT-Institutes [8] belegen,<br />
weisen die Reparaturverfahren unterschiedliche Qualitäten<br />
auf; ihre Leistung bzw. Nutzungsdauer liegt deutlich unter<br />
der von Renovation und Erneuerung, halt Reparatur. Be<strong>im</strong><br />
Berstvorgang werden alle seitlichen Anschlüsse zerstört, so<br />
dass dieses Verfahren in der innerörtlichen Kanalsanierung<br />
häufig a priori ausgeschlossen wird. Eine Möglichkeit alle o.g.<br />
Verfahren effektiver anzuwenden, besteht in der Umstellung<br />
auf Berliner Bauweise, indem die bisherigen Anschlusspunkte<br />
aufgeben werden und neue Anschlusspunkte an den vorhandenen<br />
Schachtbauwerken sternförmig angeordnet werden<br />
(Bild 2). Die Versperrung bzw. Zerstörung der ehemali-<br />
864 11 / 2011
Bild 1: Problematik<br />
„Anschlusserhaltung“<br />
bei grabenlosen Sanierungsverfahren<br />
Bild 2: „Klassische<br />
Bauweise“ und „Berliner<br />
Bauweise“ [9, verändert:<br />
Öffentliche Hauptsammler<br />
„blau“, Zuführende<br />
Kanäle „gelb“]<br />
gen Anschlussöffnung kann aufgrund der nicht mehr erforderlichen<br />
Nutzung problemlos in Kauf genommen werden.<br />
Die Umstellung auf Berliner Bauweise <strong>im</strong> Bestand ist insbesondere<br />
dann besonders wirtschaftlich, wenn<br />
der Hauptsammler in bisheriger Linienführung saniert<br />
oder erneuert werden kann,<br />
viele der anschließenden Grundstückentwässerungskanäle<br />
ein Erneuerungserfordernis aufweisen und<br />
man einen Dialog mit den Grundstückeigentümern anstrebt,<br />
durch eine gemeinschaftliche Baumaßnahme die<br />
Gesamtkosten zu reduzieren.<br />
Gerade bei Einzelfällen (Straßenzug) ist eine Betrachtung von<br />
Vor- und Nachteilen angeraten. Hier ist o.g. Dialog einfacher zu<br />
führen, da sich die Zahl der Beteiligten auf die Anliegergrundstücke<br />
beschränkt. Das Argument, dass durch Verfahren die aus<br />
dem Schacht arbeiten, überbaute Flächen geschützt werden,<br />
gilt sowohl für den öffentlichen wie auch privaten Bereich. Im<br />
Idealfall ist so ein absolutes „NO-DIG“ ohne Start- und Zielgruben<br />
oder Kopflöcher für Anschlüsse und den damit verbundenen<br />
Straßen- und Erdbauarbeiten realisierbar.<br />
Neben den Vorteilen (Zugänglichkeit, Dichtheit, saubere<br />
Trennung zwischen Grundstückskanälen) können auch einige<br />
Nachteile gegen die Anwendung sprechen. Eigentumsverhältnisse<br />
oder die Frage wie an den Schacht z. B. bei gegenläufiger<br />
Fließrichtung oder unterschiedlicher Höhenlage angeschlossen<br />
werden soll, beeinflussen ebenso Entscheidungen wie die etwaige<br />
Kostenzunahme infolge einer Leitungsmehrlänge und vorhandene<br />
Straßenabläufe.<br />
Der besondere Bezug zur grabenlosen Leitungserneuerung<br />
ist Gegenstand einer Diplomarbeit [10], die <strong>im</strong> Fachgebiet Abwasser-<br />
und Abfalltechnik der Universität Siegen entstanden ist.<br />
Ziel war es u.a., die vermeintlichen K.O.-Kriterien der „Berliner<br />
Bauweise <strong>im</strong> Bestand“ anhand eines Beispiels zu prüfen und Fälle<br />
aufzuzeigen, wo die Umstellung besonders Sinn machen würde.<br />
Anschluss am Rohr oder am Schacht?<br />
Für den Umgang mit Anschlüssen <strong>im</strong> Kanalbau sind folgende<br />
Regelwerke relevant:<br />
DIN EN 1610: „Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen“<br />
DWA A 139: „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen“<br />
DIN EN 752: „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“<br />
ATV- M 143: „Sanierung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden“<br />
Sonstige: z. B. Din-Normen für Rohre; Herstellerinformationen<br />
(Verlegeanleitungen)<br />
Anschlussarten gemäß DIN EN 1610 [11] sind:<br />
Anschluss durch Abzweig („am Rohr“)<br />
Anschluss durch Anschlussformstücke („am Rohr“)<br />
Anschluss durch Sattelstücke („am Rohr“)<br />
Anschluss durch Schweißen („am Rohr“)<br />
Anschluss an Schächte & Inspektionsöffnungen („am<br />
Schacht“)<br />
Für Anschlüsse gelten die gleichen Anforderungen wie für die<br />
übrigen Bestandteile des Kanalnetzes (vgl. DIN EN 752). Sie<br />
müssen dicht, dauerhaft und betriebssicher sein, ferner Wirtschaftlichkeitsaspekten<br />
genügen. Dies gilt vom Grundsatz<br />
her sowohl für den Neubau als auch den Bestand, wenngleich<br />
der Fokus von DIN EN 1610 eher auf der Neuverlegung liegt.<br />
Die Wahl des Verfahrens hängt gemäß DIN EN 1610 „von<br />
den Anforderungen des Betreibers, dem Rohrdurchmesser und<br />
dem Rohrwerkstoff ab. Weitere Verfahren zur Herstellung von<br />
Anschlüssen können verwendet werden, vorausgesetzt, sie<br />
stellen einen qualitativ gleichwertigen Anschluss sicher.” [11].<br />
Gemäß DWA-Merkblatt M 139 „gibt die Art und die konstruktive<br />
Ausbildung der Anschlüsse der Planer vor.“ [12]. Schwierig ist,<br />
dass sich die Art der Ausführung (Material, Qualitätssicherung,<br />
11 / 2011 865
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Verlegetechnik) vom Zeitpunkt der Neuverlegung bis hin zur Sanierung<br />
mit dem jeweiligen Stand der Technik ändert. Die grabenlosen<br />
Verfahren sind relativ neu. Innovationen und Spezifikationen<br />
(beispielsweise verschweißbare innenliegende Abstürze<br />
aus PE) werden in der Praxis häufig noch wenig verwendet.<br />
In die Rohrleitung eingebrachte Abzweige (gesteckt/geschweißt)<br />
oder angebrachte Formteile und Stutzen stellen be<strong>im</strong><br />
Neubau der Hauptkanäle in offener Bauweise sehr elegante<br />
Lösungen dar, um Leitungen unproblematisch seitlich an den<br />
Tabelle 1: Arbeitsgänge bei seitlichem / zentralen Anschließen<br />
von Grundstücksentwässerungen <strong>im</strong> Kanalbestand<br />
Arbeitsgänge (Seitliches Anschließen)<br />
Durchführen von Vorarbeiten:<br />
(inspizieren / spülen / fräsen)<br />
Einmessen aller seitlichen Anschlusspunkte<br />
Renovieren des Hauptkanals<br />
(mit „T.I.P“, „Close Fit“, „Flexoren“)<br />
Öffnen der seitlichen, durch das Neurohr<br />
(Liner) verdeckten Anschlüsse<br />
(mit Fräsroboter)<br />
Arbeitsgänge (Zentrales Anschließen)<br />
Durchführen von Vorarbeiten:<br />
(inspizieren / spülen / fräsen)<br />
Renovieren des Hauptkanals<br />
(mit „T.I.P“, „Closefit“, „Flexoren“)<br />
oder Erneuern des Hauptkanals<br />
(mit Berstlining vom Schacht aus) *)<br />
Neuverlegung der Hausanschlüsse<br />
(grabenlos mit un- / gesteuerten<br />
Bohrverfahren vom Schacht oder<br />
alternativ Arbeitsrichtung zum Schacht)<br />
**)<br />
Dichtes Einbinden der Hausanschlusskanäle<br />
(am Schacht unter Beachtung der<br />
Fließrichtung und der Tiefenlage aller<br />
Kanäle)<br />
Dichtes Einbinden der seitlichen<br />
Anschlusskanäle mit Reparaturverfahren<br />
(mit Hutprofil, Injektion, Verpressung)<br />
*) z. B. mit Grundoburst 400S (Schachtburster), Fa. Tracto-Technik<br />
**) z. B. mit Grundobore 200S, Fa. Tracto-Technik<br />
Tabelle 2: Einsatzbereiche und Verfahrensgrenzen „aus dem<br />
Schacht arbeitender“ Sanierungsverfahren gem. Herstellerangaben<br />
Ausführung Rohrart Nennweite Länge<br />
Berstlining<br />
Schacht / Schacht<br />
Kurzrohr ≤ DN 300 ≤ 70m Statisch<br />
Kurzrohr ≤ DN 200 ≤ 50m Dynamisch<br />
Grube / Schacht ../.. ≤ DN 600 ≤ 70m<br />
Grube / Grube ../.. ≤ DN 1000 ≤ 200m<br />
Tight-in Pipe (T.I.P)<br />
Schacht / Schacht Kurzrohr ≤ DN 300 ≤ 50/60m<br />
Grube / Schacht Kurzrohr ≤ DN 600 ≤ 100m<br />
Close Fit (Compact Pipe)<br />
Schacht / Schacht Rohrstrang ≤ DN 400<br />
Entfernung des Konus Rohrstrang DN 450 / 500<br />
Flexoren<br />
Schacht / Schacht Rohrstrang ≤ DN 300 ≤ 150m<br />
Schlauchlining mit UV-aushärtenden GFK-Liner<br />
Schacht / Schacht Schlauch ≤ DN 1000 ≤ 200m<br />
verlegten Hauptkanal anzuschließen. Hierbei wird der kürzeste,<br />
direkteste Leitungsverlauf vom Entwässerungsobjekt zum<br />
Hauptkanal gewählt. Dies und die Tatsache, dass zum Zeitpunkt<br />
des Neubaus vor häufig über 30 Jahren grabenlose Verfahren<br />
noch nicht existierten, begründet auch den Umstand, dass die<br />
meisten Entwässerungsplanungen diese Art als vorteilhafter<br />
gegenüber der „Berliner Bauweise“ angesehen haben. Weitere<br />
Unabwägbarkeiten gilt es bei „Berliner Bauweise“ zu prüfen:<br />
Größe, Art und Anzahl von Schächten werden durch die Zahl<br />
der Anschlüsse und die Lage der Grundstücke beeinflusst. Eigentumsverhältnisse<br />
können die Ursache sein, dass Kanallängen<br />
sich vergrößern oder die Zahl der Schachtbauwerke zun<strong>im</strong>mt<br />
und es so zur Verteuerung der Baumaßnahme kommt.<br />
Entsprechend dem Zusammenfluss von Haupt- und Nebensammler<br />
an Schachtbauwerken bei Straßenkreuzungen ist dies<br />
auch mit Straßenabläufen und Grundstückskanälen möglich.<br />
Vielfach wird dies bereits bei den sogenannten Endschächten<br />
praktiziert. Aus betrieblicher Sicht sollten Anschlussleitungen<br />
nie gegen die Fließrichtung der Hauptkanäle anschließen. Wichtig<br />
sind die Höhen der Anschlusspunkte, die durch die Tiefenlage<br />
der Kanäle vorgegeben wird und die Gefälleverhältnisse <strong>im</strong><br />
Hinblick auf die Freispiegelabflüsse. Kanäle können an Schachtbauwerke<br />
sohl- oder scheitelgleich anschließen, Höhendifferenzen<br />
mit Abstürzen realisiert werden. Hier bietet zum Beispiel<br />
die Firma Predl einen innenliegenden Absturz aus Kunststoff<br />
an, der die Höhendifferenz zwischen Grundstücks- und<br />
Hauptkanal überwindet. Die Leitungsführung <strong>im</strong> Schacht muss<br />
eine ausreichende Vorflut für die Haushaltsabwässer sicherstellen<br />
und gewährleisten, dass es nicht zu Ablagerungen (Toilettenpapier)<br />
kommt. Als Schachtbauwerke sind in den letzten<br />
Jahren Stahlbeton-Fertigteile in Standardbauweise DN 1000<br />
verwendet worden. Die Alternative, auch für größere Durchmesser,<br />
sind Kunststoffschächte (PE, PP), die komplett verschweißte<br />
Kanalsysteme möglich machen. Tabelle 1 zeigt die<br />
Arbeitsgänge einer ganzheitlichen Sanierung.<br />
Für die Sanierung der Hauptleitung sind neben den Verfahren<br />
entsprechende Rohrmaterialien entwickelt worden, die als Kurzrohrmodule<br />
(z. B. aus PP der Fa. Schöngen) oder als kurvengängige<br />
Strangware (PE-Flexoren der Fa. Maincor) über die Schächte<br />
in das Rohrnetz eingezogen oder eingeschoben werden.<br />
Die Verfügbarkeit von Verfahren, die aus Schächten (Standardmaß<br />
DN 1000, z. B. „Schacht-burster: Grundoburst 400<br />
S“) arbeiten und die das bestehende Schachtbauwerk auch erhalten,<br />
schränkt die Anwendung der grabenlosen Techniken <strong>im</strong><br />
Hinblick auf „absolutes NO-DIG“ i.d.R. auf Hauptkanäle kleiner<br />
DN 400 ein. Allerdings sind ca. 80 % der öffentlichen Kanäle<br />
kleiner als DN 400 [13], Schmutzwasserkanäle <strong>im</strong> ländlichen<br />
Raum häufig <strong>im</strong> Mindestprofil DN 250 (200) gemäß [14] verlegt.<br />
Tabelle 2 zeigt Erneuerungs- und Renovationsverfahren<br />
mit örtlich- und werkseitig gefertigten Rohren sowie die entsprechenden<br />
Verfahrensgrenzen.<br />
Sanierungsverfahren gemäSS<br />
Herstellerangaben<br />
Die Leitungsführung und der Anschluss der Grundstücksentwässerung<br />
müssen <strong>im</strong> Hinblick auf den weiteren Kanalbetrieb<br />
866 11 / 2011
Bild 3: Schematische<br />
Darstellung der grabenlosen<br />
Erneuerung von<br />
Hauptkanälen und Herstellung<br />
der Hausanschlusskanäle<br />
[15, 16]<br />
technisch sauber erfolgen. Obgleich einige Bedingungen die<br />
Anwendung einschränken (u. a. die anstehende Bodenart),<br />
kann eine grabenlose Erneuerung der Hausanschlüsse vom<br />
Schacht aus Kosteneinsparungen bringen. Mit Grundobore<br />
200S hat die Fa. Tracto-Technik ein Bohrgerät entwickelt,<br />
das sich in Schächte DN 1000 einbringen lässt und das von<br />
dort aus ungesteuerte oder gesteuerte Bohrungen für Hausanschlüsse<br />
bis 20 m durchführen kann [15] (Bild 3). Diese<br />
Reichweite ist für die meisten Fälle ausreichend, um den<br />
befestigten, öffentlichen Straßenbereich und die überbaute<br />
private Grundstücksumfriedung (Böschungen, Mauern, Hecken,<br />
Zufahrten usw.) zu unterqueren oder den Revisionsschacht<br />
zu erreichen.<br />
Durch die Lage und Positionierung von Revisionsschächten<br />
auf den Grundstücken kann planerisch auf den Leitungsverlauf<br />
der Grundstücksentwässerung Einfluss genommen<br />
werden.<br />
Wenn die Kreuzung fremder Grundstücke unvermeidbar<br />
ist, muss ein Gespräch mit den beteiligten Parteien eine<br />
Lösung finden. Ein Dialog mit den Grundstückseigentümern<br />
<strong>im</strong>pliziert die Darlegung der technischen Notwendigkeit (Argumente:<br />
„Kosteneinsparung“, “Gemeinwohl“). Eine sachliche<br />
Argumentation ist z. B. auch die, dass eine Kreuzung von<br />
„Fremdgrundstücken“ bei der „Berliner Bauweise“ in der Regel<br />
in nicht bebauungsfähigen Grundstücksbereichen stattfindet.<br />
Inwieweit das Schachtbauwerk auch den Zielschacht einer<br />
vom Grundstück aus gestarteten Bohrung z. B. mit Erdrakete<br />
sein kann, muss eine detaillierte Planung ergeben. Die<br />
Forderung der DIN 1986-30 [17], Grundleitungen an der<br />
Kellerdecke abzuhängen, wird <strong>im</strong> Hinblick auf die Kanalrückstauebene<br />
den Einsatz von Abwasserhebesystemen zur Folge<br />
haben. Vor diesem Hintergrund könnten Freigefälleabflüsse<br />
der Grundstücksentwässerung zum Hauptkanal entbehrlich<br />
werden und auch Verlegesysteme, die mit geringerer<br />
Gefällegenauigkeit arbeiten, wie Horizontalspülbohrsysteme<br />
(HDD), in der Grundstücksentwässerung breitere<br />
Anwendung finden.<br />
Analyse von Vor- und Nachteilen<br />
In Anlehnung an DIN EN 752 [18] sind für Planungen Aspekte<br />
wie Kosten, Bau, Betrieb, Umwelt und Recht heranzuziehen.<br />
Um eine Erörterung sachgerecht, themenbezogen und mit<br />
der nötigen Aspektrelevanz durchzuführen, macht es Sinn,<br />
eine vergleichende Erörterung auf einzelne Sachkriterien herunter<br />
zu brechen.<br />
Die Formulierung von Kriterien, die Vor- und Nachteile<br />
von Varianten beinhalten, ist Gegenstand der Tabelle 3. Die<br />
nachfolgend genannten Kriterien dienen der Erörterung des<br />
Vergleiches zwischen dem seitlichen Anschließen am Rohr<br />
und dem zentralen Anschließen am Schacht. Im speziellen<br />
Anwendungsbereich können die aufgezählten Kriterien mehr<br />
oder weniger relevant sein. Zusätzliche Kriterien durch ortsbezogene<br />
Spezifikationen müssen <strong>im</strong> Einzelfall in die Diskussion<br />
einbezogen werden.<br />
Wenngleich die Beweggründe für den Einsatz grabenloser<br />
Verfahren unterschiedlich sind, müssen sie doch die gleichen<br />
Qualitätsansprüche wie eine offene Bauweise erfüllen.<br />
Für den Erfolg einer Baumaßnahme hat neben der Planung<br />
die Umsetzung auf der Baustelle entscheidende Bedeutung.<br />
Gerade unsachgemäß ausgeführte Sanierungen der seitlichen<br />
Anschlussstellen (u.a. durch “Fehlbohrungen”) haben maßgeblich<br />
zu aktuellen Qualitätsdiskussionen in die Kanalsanierung<br />
beigetragen.<br />
Anwendungsbeispiel<br />
Anhand von Planunterlagen sollte für eine ca. 2.000-Einwohner-große<br />
Ortsgruppe <strong>im</strong> Kreis Siegen-Wittgenstein (NRW)<br />
die Eignung einer großflächigen Umstellung auf “Berliner Bauweise”<br />
als Maßnahme <strong>im</strong> Bestand geprüft werden (Machbarkeit).<br />
Die Prüfung sah eine Verlagerung der Anschlusspunkte<br />
an die vorhandenen Schachtbauwerke vor und die anschließende<br />
Bewertung hinsichtlich der gravierendsten k.o.-Kriterien<br />
„Eigentumsverhältnisse“, „Kanallänge“ und „Anschlussrichtung“.<br />
Die Besonderheit der Ortsteile lag in der ländlichen Struktur<br />
mit dörflich geprägten Charakter, „weitläufiger Bebauung“<br />
und großzügig angelegten Grundstücken. Die demographische<br />
Entwicklung <strong>im</strong> Planungsbereich gibt der Forderung nach<br />
flexiblen Lösungen besonderen Nachdruck.<br />
Den konkreten Anlass bildeten Überlegungen,<br />
den abgängigen Kanal in drei Straßen zu erneuern (kurzfristig),<br />
das gesamte Kanalsystem flächendeckend von Mischsystem<br />
auf Trennsystem umzustellen (mittelfristig),<br />
die aktuellen <strong>Entwicklungen</strong> zur Dichtheit von privaten<br />
Grundstückskanälen in NRW in einer ganzheitlichen Maßnahme<br />
zu berücksichtigen.<br />
Die Untersuchung umfasste 426 bebaute Grundstücke, 327<br />
Haltungen (keine Verbindungssammler!) und wurde mit<br />
ArcGis auf Basis von Katasterdaten und Kanalbestandsplänen<br />
durchgeführt.<br />
Gemäß den Vorgaben können ca. 90 % der betrachteten<br />
Grundstücke und Haltungen aufgrund ihrer Lage als für eine<br />
Umstellung auf „Berliner Bauweise“ gut, befriedigend oder<br />
ausreichend geeignet angesehen werden. Sieht man sich die<br />
Verteilung über das gesamte Gemeindegebiet an, so erkennt<br />
man, dass sich Bereiche zeigen, bei denen eine Umstellung<br />
durchaus Sinn macht.<br />
11 / 2011 867
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Bei einem Straßenzug, der als besonders geeignet für<br />
die Umstellung auf „Berliner Bauweise“ eingestuft wird, ist<br />
eine Kostenvergleichsrechnung angefertigt worden. Gemäß<br />
Tabelle 2 würde es sich bereits lohnen, auf „Berliner Bauweise“<br />
umzustellen, wenn neben dem Hauptkanal bereits<br />
zwei der sechs Hausanschlüsse grabenlos erneuert würden.<br />
Wenn alle sechs Hausanschlusskanäle marode wären<br />
und grabenlos erneuert würden, sind deutlichere Kosteneinsparungen<br />
möglich, als wenn dies (sukzessiv) in offener<br />
Bauweise geschieht.<br />
Als wichtiges Ergebnis darf festgehalten werden, dass<br />
die nachteiligen Argumente der „Berliner Bauweise“, die in<br />
der Kreuzung “fremder“ Grundstücke, in der Leitungsmehrlänge<br />
und der gegensätzlichen Anschlussrichtung gesehen<br />
Tabelle 3: Kriterien für eine Umstellung auf Berliner Bauweise<br />
Kriterium: Pro „Berliner Bauweise“ Kontra „Berliner Bauweise“<br />
„Schachtnotwendigkeit“<br />
(Gründe, Aufgaben)<br />
„Grundstücksentwässerung“<br />
(Betrieb, Überwachung)<br />
„Zuständigkeit“<br />
(Planerische Hoheit)<br />
Fazit: Viele Gründe sprechen gegen gleichzeitige und gemeinschaftliche Erneuerung von Hauptkanal und Grundstückskanälen.<br />
Ggfs. Querung fremder Grundstücke (Dienstbarkeiten)<br />
Fazit: Eigentumsverhältnisse sprechen gegen zentrales Anschließen am Schacht, insbesondere wenn Grundstücke<br />
gekreuzt werden.<br />
„Eigentumsverhältnisse“<br />
(rechtliche Belange)<br />
„Planerische<br />
Flexibilität“<br />
(zukünftige<br />
<strong>Entwicklungen</strong>)<br />
„Grabenlose<br />
Erneuerung“<br />
(Möglichkeiten /<br />
Grenzen)<br />
„Hydraulik“<br />
(Individual-/<br />
Pauschalkonzept)<br />
„Mehrfachnutzung“<br />
(Kanal, Grundstückskanal)<br />
An neuralgischen Punkten<br />
(Profilwechsel, Materialwechsel, Gefällewechsel, Seitlichen<br />
Zuläufen, Richtungsänderungen, Anfangshaltungen als Endschacht,<br />
zu großen Haltungslängen)<br />
Kurze Haltungslängen bzw. Anzahl der Schachtbauwerke,<br />
Grundstücksgrößen<br />
Fazit: Berliner Bauweise entspricht Maßstäben (Planungsgrundsätzen), die in der Kanalplanung zum Einsatz von<br />
Schächten führen.<br />
Inspektion, Dichtheitsprüfung, Spülung der Hausanschlusskanäle<br />
vom Schacht aus möglich,<br />
Indirekteinleiterüberwachung (Probenahme) und Fremdwasserlokalisation,<br />
Zunahme der Hausanschlusskanallänge<br />
Grabenloses Einmessen der Hausanschlüsse entfällt, da die<br />
Schachtkoordinaten vorliegen<br />
Fazit: Bessere Betriebsüberwachung der Grundstückentwässerung vom Schacht aus. Zusätzliche Revisionsschächte u.U.<br />
entbehrlich.<br />
Chance auf gemeinschaftlichen Dialog <strong>im</strong> Hinblick die Dichtheitsprüfung.<br />
Zuständigkeiten und Eigentümer unterschiedlich<br />
Zeitschienen, Finanzierung und Bedarf unterschiedlich<br />
Umstellung von Entwässerungssystemen (Mischsystem in<br />
Trennsystem, Modifizierung: Abkopplung von Regenwasser)<br />
Materialien zielgerichteter einsetzbar<br />
Einstellen auf Veränderungen<br />
(Demographie, Kl<strong>im</strong>a).<br />
Vorhandene, angeschlossene Straßenentwässerung<br />
schafft ggfs. Vorgaben<br />
Fazit: Die Verschiebung der Zwangspunkte von dem Rohr an den Schacht erlaubt flexiblere Optionen für zukünftige<br />
Entwässerungsplanungen.<br />
Absolutes NO-DIG möglich,<br />
(kein Straßenaufbruch, weniger Beeinträchtigung durch Verkehr,<br />
Lärm, Emissionen etc.)<br />
Verzicht auf kurzlebigere Reparaturverfahren<br />
Weniger Risiken / Einmessen / Fehlbohrung. (vgl. mäßige<br />
Ergebnisse IKT-Warentests „Stutzensanierung“)<br />
Opt<strong>im</strong>aler Einsatz der Werkstoffe, Kombination mit Schachtsanierung<br />
möglich. Voll-Verschweißtes Kanalnetz möglich.<br />
Einschränkungen bei der aus dem Schacht arbeitenden<br />
Verfahrenstechnik. (z. B. Bersten von Schacht auf<br />
Schacht nur bei < DN 400 und < 70m)<br />
Fazit: Die grabenlose Leitungserneuerung profitiert in vielerlei Hinsicht vom Konzept der Berliner Bauweise<br />
Verringerung von seitlichen Einzelverlusten (Individualkonzept),<br />
somit größere hydraulische Leitungsfähigkeit<br />
Effektive Nutzung der glatten Neurohrwerkstoffe insbesondere<br />
Kunststoff<br />
Haltungsweise Berechnungslogik<br />
Bei Einsatz von Abstürzen seltenerer Einstau der Hausanschlüsse<br />
bei Starkregen<br />
Anschlussrichtung verursacht ggfs. Ablagerungsprobleme<br />
/ Geruch. Technische Herausforderung<br />
„Anschlusspunkt“.<br />
Gefälleverhältnisse können u.U. lange Schleppleitungen<br />
erforderlich machen<br />
Fazit: Für die Kanalhydraulik ergeben sich mit der „Berliner Bauweise“ bei richtiger Herstellung des Schachtanschlusses<br />
bzw. opt<strong>im</strong>alen Bedingungen Vorteile<br />
Bei FAST-OPTICOM-System (Verlegung von Glasfaserkabeln FTTH<br />
in vorhandenen Kanälen) ist Anbindung „FAST-TO-BUILDING“ vom<br />
Schacht über Hausanschlusskanal zum Gebäude möglich, eine<br />
zusätzliche Kabelverlegung mit Erdrakete u.U. entbehrlich<br />
Fazit: Fibre-to-the-Home (FTTH) über Abwasserkanal und Hausanschluss bei Berliner Bau weise eher möglich als bei<br />
seitlichen Anschlüssen<br />
J<br />
J<br />
L<br />
L<br />
J<br />
J<br />
K<br />
J<br />
868 11 / 2011
Bild 4: Prüfung, Bewertung und Ergebnisse der Analyse: „Umstellung auf „Berliner Bauweise“ <strong>im</strong> Bestand“<br />
Bild 5: Betrachtung eines Straßenzuges mit Kostenaufstellung<br />
werden, <strong>im</strong> vorliegenden Beispiel zumindest nur bedingt<br />
relevant sind. Allerdings betrug bei untersuchtem Beispiel<br />
die Anzahl der Anschlüsse pro Schacht max<strong>im</strong>al ein bis zwei<br />
Stück. Die mittlere Haltungslänge mit etwa 30 m lag in Bezug<br />
zu den Grundstücksgrößen <strong>im</strong> günstigen Bereich.<br />
Zusammenfassung<br />
Integrale Betrachtungsweisen gewinnen <strong>im</strong> Zusammenhang mit<br />
Wasserwirtschaft und Umwelt <strong>im</strong>mer stärker an Bedeutung.<br />
Der Bereich Kanalisation kann sich bei ganzheitlicher Betrachtung<br />
aus den Bausteinen<br />
Öffentlicher Kanal – Grundstücksentwässerung – Straßenbau<br />
…<br />
Rohrstrang – Schacht – Anschluss – Anschlusskanal …<br />
zusammensetzen. Eine Systematik, die <strong>im</strong> Zusammenhang mit<br />
den anstehenden Dichtheitsprüfungen zur Gewährleistung<br />
der Arbeitsabläufe (Terminierung, Überprüfung, Nachhaltung,<br />
Dokumentation) notwendig sein wird, bietet die Möglichkeit<br />
ein integrales Sanierungskonzept an die Dichtheitsprüfung<br />
anzuschließen. Die Handlungsoptionen und die Nachfrage<br />
nach Strategien sind höher, wenn viele Hausanschlüsse<br />
ein Sanierungserfordernis aufweisen. Neben Systematik sind<br />
Flexibilität und Zukunftsfähigkeit wichtige Punkte: Sowohl Ka-<br />
11 / 2011 869
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
nalnetzbetreiber als auch Bürger entledigen sich mit der<br />
Dichtheitsprüfung 2015 keinesfalls sämtlicher Sorgen auf<br />
alle Zeit. Gemäß §61a des LWG NRW sind Dichtheitsprüfungen<br />
alle 20 Jahre zu wiederholen.<br />
Aus „rein technischer“ Sicht stellt die „Berliner Bauweise“<br />
eine Alternative dar. Dies betrifft vor allem den<br />
Bestand, wobei der Zusammenhang zum Anwendungserfolg<br />
grabenloser Techniken als sehr hoch einzustufen ist.<br />
Zumindest sollte eine Anwendung der „Berliner Bauweise“<br />
geprüft werden und keine pauschale Ablehnung erfolgen.<br />
Im Einzelfall (je nach Entwässerungsverfahren, je nach<br />
Grundstückslagen und Haltungslängen) kann die Anwendung<br />
wirtschaftlich sein. Dennoch existieren verständliche<br />
Vorbehalte (Eigentümer, Kosten, Zeitplan), wobei nicht<br />
technische Fertigkeiten, sondern die kommunikative Fähigkeiten,<br />
Besonnenheit und Weitblick des Planers Vorbehalte<br />
ausräumen müssen. Hier gilt es, die Sachlage darzulegen<br />
und die Problematik kompetent gegenüber Politik und Bürger<br />
zu artikulieren. Traditionelle Denkweisen, wie „das haben<br />
wir schon <strong>im</strong>mer so gemacht“ oder der Irrglaube, dass<br />
der „kürzeste Weg <strong>im</strong>mer der günstigste sei“, sind weitverbreitet.<br />
Diesen Denkweisen stehen mit den grabenlosen<br />
Techniken relativ junge Bauverfahren gegenüber, die in den<br />
letzten Jahren verfahrens- und materialtechnisch deutliche<br />
Verbesserungen (T.I.P.-Verfahren, Mehrschichtrohre<br />
mit Schutzeigenschaften) erfahren haben.<br />
Die Thematik „Anschließen und Verbinden“ von Rohren<br />
steht und fällt mit der Qualität der Anbindung. Die Frage,<br />
wie lange die Verfahren der Stutzensanierung halten bzw.<br />
dicht halten, kann nicht sicher beantwortet werden, zumal<br />
Anschlüsse und Rohrverbindungsstellen <strong>im</strong>mer besonderen<br />
Belastungen ausgesetzt sind und deshalb a priori in ihnen<br />
potenzielle Schadensstellen gesehen werden müssen.<br />
Die Diskussion über den richtigen „Weg“, Rohre zu verbinden<br />
ist sowohl material- als auch verfahrensübergreifend<br />
längst nicht abgeschlossen. Be<strong>im</strong> Relining bedarf es weiterhin<br />
der Entwicklung und Innovationen der geschlossenen<br />
Sanierungsverfahren, insbesondere <strong>im</strong> Anschlussbereich<br />
der Stutzensanierung.<br />
Die Philosophie der „Berliner Bauweise“ stellt aus Sicht<br />
der Verfasser eine geeignete Lösung dar, grabenlose Lösungen<br />
in Form eines absoluten NO-DIGs (ohne offene<br />
Start- und Zielgruben, Kopflöcher) zu realisieren und<br />
Schwachpunkte wie die Stutzenreparatur zu umgehen.<br />
Berst- und Bohrverfahren lassen sich so noch gezielter<br />
für die Stadtentwässerung einsetzen.<br />
Literatur<br />
[1] Krüger, A.; Görg, H.: Rechtwinklig oder sternförmig – am Rohr oder<br />
am Schacht ? Umgang mit seitlichen Anschlüssen <strong>im</strong> Kanalbestand;<br />
5. deutsches Symposium für grabenlose Leitungserneuerung SgL, am<br />
07.10.2010 in der Universität Siegen<br />
[2] Görg, H.; Krüger, A.: Flickenteppich Kanalisation: Zustand, Notwendigkeit<br />
und Rahmenbedingungen der Sanierung / Erneuerung; 5. deutsches Symposium<br />
für grabenlose Leitungserneuerung SgL, am 07.10.2010 in der<br />
Universität Siegen<br />
[3] Görg, H.; Krüger, A.: Perspektiven des Leitungsbaus in Straße und Grundstück<br />
– grabenlos in die Zukunft?; 6. deutsches Symposium für grabenlose<br />
Leitungserneuerung SgL, am 06.10.2011 in der Universität Siegen<br />
[4] Krüger, A.; Birbaum, J.; Görg, H.; Zander, U.: Zusammenhang von Straßenzustand<br />
und grabenlose Leitungserneuerung <strong>im</strong> Hinblick auf lange Nutzungsdauern<br />
und opt<strong>im</strong>ale Wertschöpfung; 6. deutsches Symposium für<br />
grabenlose Leitungserneuerung SgL, am 06.10.2011 in der Universität<br />
Siegen<br />
[5] Berger, C.; Falk, C.: Zustand der Kanalisation; Ergebnisse der DWA-Umfrage<br />
2009, veröffentlicht in Korrespondenz Abwasser KA, Hennef, 1/2011<br />
[6] Diederich, F.; Rehling R.: Status Quo der privaten Grundstücksentwässerung,<br />
veröffentlicht in TIS 12/2005<br />
[7] Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG), § 61a Private<br />
Abwasseranlagen, Fassung vom 25. Juni 1995<br />
[8] IKT-Warentest: Reparaturverfahren für Anschlussstutzen, veröffentlich<br />
durch IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH, Gelsenkirchen,<br />
2006<br />
[9] GSTT „Hausanschlussverlegung mittels Microtunneling“; Film veröffentlicht<br />
unter NO-DIGbau-TV, Nov. 2007<br />
[10] Stoye, N.: „Berliner Bauweise“ versus klassischer Kanalbau als Maßnahmen<br />
<strong>im</strong> Rahmen der grabenlosen Leitungserneuerung, Diplomarbeit Universität<br />
Siegen, Aug. 2010 (unveröffentlicht)<br />
[11] DIN EN 1610 „Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen”<br />
(1997-10)<br />
[12] DWA A 139 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“<br />
(2001-06)<br />
[13] AWT/WWT 1993; unterlegt durch eigene Untersuchungen am Kanalbestand<br />
mehrerer Kommunen in Südwestfalen 2005-2010<br />
[14] DWA A 110 „Hydraulische D<strong>im</strong>ensionierung und Leistungsnachweis von<br />
Abwasserleitungen und -kanälen“ (2006-08)<br />
[15] Pachutzki, M.: Ungesteuertes und gesteuertes Press-Bohr-Verfahren für<br />
die Neuverlegung von Abwasser-Hausanschlüssen mit neu entwickelter<br />
Kleinbohranlage Grundobore 200 S, veröffentlicht <strong>im</strong> Tagungsband 3. dt.<br />
Symposium für grabenlose Leitungserneuerung SgL, Siegen, Sept. 2008<br />
[16] Sommer, J.: Verfahrensvarianten der Berliner Bauweise <strong>im</strong> Rahmen der<br />
Sanierung und Erneuerung öffentlicher Kanalisationen und Anschlussleitungen,<br />
veröffentlicht <strong>im</strong> Tagungsband 5.dt. Symposium für grabenlose<br />
Leitungserneuerung SgL, Siegen, Okt. 2011<br />
[17] DIN 1986 Teil 30 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke<br />
– Teil 30: Instandhaltung“ (2010-10)<br />
[18] DIN EN 752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ (2008-04)<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Alexander Krüger<br />
Universität Siegen, Fachgebiet Abwasserund<br />
Abfalltechnik<br />
Tel. +49 271 740-2186<br />
E-Mail: krueger@bauwesen.uni-siegen.de<br />
Prof. Dr.-Ing. Horst Görg<br />
Universität Siegen, Fachgebiet Abwasserund<br />
Abfalltechnik<br />
Tel. +49 271 740-2323<br />
E-Mail: goerg@bauwesen.uni-siegen.de<br />
870 11 / 2011
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Vorhandene Rohranschlüsse<br />
präzise überbohren<br />
Im Rahmen der Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungssystems<br />
in Hatzfeld (Hessen) wurde die Ortsdurchfahrt ab<br />
März 2011 gesperrt, um die komplette Sanierung der Fahrbahn,<br />
des Gehwegs und die aufwändigen Arbeiten <strong>im</strong> Leitungssystem<br />
vornehmen zu können. Sowohl Stahlbetonrohre<br />
in D<strong>im</strong>ensionen DN 300 – DN 700 wurden neu verlegt als<br />
auch schon bestehende Rohre mit neuen Anschlüssen versehen.<br />
Die Sanierung der Altbestände, mit der Notwendigkeit,<br />
bereits vorhandene Anschlüsse absolut präzise zu überbohren,<br />
stellte besondere Ansprüche an den Anwender und das<br />
Gerät. Obgleich man seit vielen Jahren mit eigenem Gerät<br />
Kernbohrungen in Stahlbetonrohren durchführt, wurde <strong>im</strong><br />
Rahmen dieses Bauvorhabens in eine neue Technik investiert.<br />
Der verantwortliche Bauleiter, Dirk Wind, hatte Informationen<br />
über ein innovatives Kanalbohrgerät, die KRABBE, erhalten,<br />
das ohne weitere Hilfsmittel von einer Person befestigt,<br />
eingerichtet und bedient werden kann. Be<strong>im</strong> Überbohren der<br />
vorhandenen Löcher spielte das Gerät in Hatzfeld dann seine<br />
Vorteile aus:<br />
Befestigung über das Zangenprinzip ohne Zurrgurte oder<br />
Erdnägel<br />
Einrichten der Gerätes mit min<strong>im</strong>alem Zeitaufwand<br />
Präzise Bohrung (auch be<strong>im</strong> Überbohren).<br />
BILD 1: Befestigung durch Zangenprinzip: das Kanalbohrgerät<br />
„KRABBE“ <strong>im</strong> Einsatz <strong>im</strong> Herzfeld<br />
Kontakt<br />
ADIA-Bautechnik, Max Paul Bunke, Herdecke,<br />
Tel. +49 2330 6577442, E-Mail: bunke@adia-bautechnik.de,<br />
www.adia-bautechnik.de<br />
… verbindet die Märkte<br />
871 10 / 2010 10 / 2010 871<br />
11 / 2011 871
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Sanierung eines Eiprofil 1390/1800<br />
in Bremen mit KM-Liner<br />
Schlauchlining auch in großen Profilen: Das Bauunternehmen KMG Pipe Technologies sanierte in Bremen einen Mischwasserkanal<br />
mit einem Querschnitt von 1390/1800. Dafür wurde der größte Liner geliefert, den das Unternehmen je eingebaut hat.<br />
Für den Netzbetreiber HanseWasser saniert KMG von März bis<br />
Ende September 2011 in der Bremer Bayernstraße einen 880<br />
m langen Sammler für Mischwasser aus dem Jahr 1914. Er dient<br />
dem Kanalnetz der Stadt gleichzeitig auch als Stauraumkanal<br />
und wies Schlammablagerungen, Fugenauswaschungen und<br />
Risse <strong>im</strong> Mauerwerk auf, die bereits zum Eintritt von Grundwasser<br />
führten. Die große Herausforderung bei der Sanierung<br />
des gemauerten Eiprofils mit Schlauchlining war für das Bauunternehmen<br />
KMG seine große Nennweite von 1390/1800.<br />
Zudem musste das Abwasser zur Vorflutsicherung aufwändig<br />
umgepumpt werden. Den Erfolg der Sanierungsmaßnahme<br />
stellte KMG Ende Juni geladenen Gästen von Netzbetreibern<br />
und Ingenieurbüros <strong>im</strong> Rahmen eines Baustellentags in Bremen<br />
vor. In seinem Vortrag anlässlich dieses Baustellentags zeigte<br />
sich Arne Schmüser von HanseWasser zufrieden mit der Ausführung<br />
des Projektes: „Es freut mich, mit KMG einen zuverlässigen<br />
und professionellen Partner für dieses herausfordernde<br />
Projekt in der Bayernstraße gefunden zu haben“.<br />
Auf der Rekordbaustelle kam der KM-Liner mit Längen<br />
von 100 m bis 150 m und einem Gesamtgewicht von 150<br />
Tonnen zum Einsatz, der mit einem Sondertransport vom<br />
Produktionswerk der Firma SEKISUI NordiTube, wie KMG<br />
Bild 1: Schlauchlining in Rekordgröße: KMG Pipe Technologies saniert in Mischsammler in Bremen (Quelle: KMG Pipe<br />
Technologies GmbH)<br />
872 11 / 2011
gwfWasser<br />
Abwasser<br />
2Hefte<br />
Das führende<br />
Fachorgan für<br />
Wasser und Abwasser<br />
gratis<br />
zum<br />
Kennenlernen!<br />
Bild 2: Einzug Liner - Der Schlauchliner wird über eine<br />
Gleitfolie in das Altrohr eingebracht und dort mit einem<br />
zweiten Kalibrierschlauch aufgestellt (Quelle: KMG Pipe<br />
Technologies GmbH)<br />
Jedes zweite Heft mit<br />
Sonderteil R+S<br />
Recht und Steuern <strong>im</strong><br />
Gas- und Wasserfach<br />
ein Unternehmen der SEKISUI SPR Europe Gruppe, aus<br />
Schieder-Schwalenberg angeliefert wurde. Er wurde nach<br />
dem Pull Inliner-Verfahren eingebaut, das sich besonders<br />
zur Sanierung von großen Durchmessern und dicken Wandstärken<br />
eignet.<br />
Das Besondere ist die Einzieh-/Einstülp-Kombination<br />
von zwei Linern, das die Imprägnierung mit unterschiedlichen<br />
Harzen ermöglicht sowie ein formschlüssiges Anliegen<br />
am Altrohr sicherstellt. Der Liner wurde über eine Winde in<br />
den Altkanal eingezogen, eine Folie mit Gleitmittel stellte<br />
dabei den reibungslosen Ablauf sicher. Dann stellten ihn die<br />
Sanierungsexperten von KMG über einen eingestülpten Kalibrierschlauch<br />
mit Wasserdruck auf. Zwei Heizanlagen erwärmten<br />
anschließend das Prozesswasser, um die beiden<br />
Schläuche auszuhärten. Auf diese Weise wurden sieben Abschnitte<br />
von bis zu 150 m Länge unter der Einhaltung vom<br />
HSE-Management (Health-Safety-Environment) der Hanse<br />
Wasser saniert.<br />
Das Eiprofil des zu sanierenden Mischsammlers verlangte<br />
aufgrund der großen Nennweite auch eine exakte statische<br />
Berechnung, die Fred Hüpers, ein Experte der ILL Ingenieursgesellschaft<br />
für Leitungsbau und Leitungsinstandhaltung<br />
mbH aus Detmold, <strong>im</strong> Vorfeld durchführte. Darüber<br />
hinaus hat das Ingenieurbüro Siebert & Knippschild für HanseWasser<br />
in jedem Abschnitt der Baumaßnahme Linerproben<br />
entnommen. „Sämtliche gemessenen Parameter liegen<br />
deutlich über dem Sollwert“, beurteilte Mirjam Lechner aus<br />
dem Ingenieurbüro die positiven Ergebnisse, die sie auch<br />
den Teilnehmern des Baustellentags vorstellte.<br />
Kontakt<br />
KMG Pipe Technologies GmbH, Schieder-Schwalenberg,<br />
Tel. +49 5284 705-0, E-Mail: mail@kmg.de, www.kmg.de<br />
Von Experten<br />
für Experten<br />
Informieren Sie sich regelmäßig über alle technischen<br />
und wirtschaftlichen Belange der Wasserbewirtschaftung<br />
und Abwasser behandlung.<br />
✁<br />
gwf Wasser/Abwasser erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenhe<strong>im</strong>er Str. 145, 81671 München<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0)931 / 4170-492<br />
oder per Post: Leserservice gwf • Postfach 91 61 • 97091 Würzburg<br />
Ja, senden Sie mir die nächsten beiden Ausgaben des Fachmagazins gwf Wasser/<br />
Abwasser gratis zu. Nur wenn ich überzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen<br />
nach Erhalt des zweiten Hefts schriftlich absage, bekomme ich gwf Wasser/<br />
Abwasser für zunächst ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von € 170,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 15,- / Ausland: € 17,50) pro Halbjahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) € 85,- zzgl. Versand<br />
pro Halbjahr.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
✘<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.gwf-wasser-abwasser.de<br />
Telefax<br />
Datum, Unterschrift PA<strong>3R</strong>IN0911<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice gwf, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene<br />
Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag<br />
11 / 2011 oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote 873 informiert und beworben<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Wissen für die praxis<br />
RSV-Regelwerk<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2006, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Rohren aus<br />
thermoplastischen Kunststoffen durch Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung mit dem TIP-Verfahren ohne Ringraum (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner<br />
(partielle Inliner)<br />
2009, 25 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbauwerken<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Schachtsanierung (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen / Anschlußleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 24 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlußleitungen – Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Erneuerung von Entwässerungskanälen und Anschlussleitungen mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Faxbestellschein an: 0201/82002-34<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Garantie: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen bei der Vulkan-Verlag GmbH, Postfach 10 39 62, 45039 Essen schriftlich widerrufen<br />
werden. Die rechtzeitige Absendung der Mitteilung genügt. Für die Auftragsabwicklung und die Pflege der Kommunikation werden Ihre<br />
persönlichen Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich per Post, Telefon, Telefax<br />
oder E-Mail über interessante Verlagsangebote informiert werde. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer
Generische Zustandsanalyse von<br />
Fernwärmenetzen<br />
Von Volker Herbst<br />
Die luftgestützte Thermografie soll zukünftig als Verfahren zur Zustandsbewertung von Fernwärmenetzen eingesetzt<br />
werden. Die Thermalaufnahmen werden jedoch von einer Vielzahl an Parametern beeinflusst. Hierdurch ist eine zuverlässige<br />
Bewertung hinsichtlich des Zustandes von Fernwärmenetzen derzeit nur begrenzt möglich. In diesem Forschungsvorhaben<br />
der industriellen Gemeinschaftsforschung IGF wurden durch praktische Untersuchungen <strong>im</strong> Feldversuch<br />
und durch theoretische Berechnungen die Einflussparameter untersucht.<br />
Das IGF-Vorhaben 15802 N der Forschungsvereinigung FFI Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover e.V. wurde<br />
über die AiF <strong>im</strong> Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung<br />
(IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages<br />
gefördert.<br />
Bisheriger Stand und Zielsetzung<br />
Der Betrieb von Fernwärmenetzen erfordert eine ständige<br />
Kontrolle des Leitungszustandes zur Erhaltung der Leitungsnetze.<br />
Die Leitungsnetze bestehen größtenteils aus erdverlegten<br />
Rohrsystemen und sind damit einer regelmäßigen visuellen<br />
Kontrolle entzogen. Bisher konnten nur punktuelle und<br />
systembezogene Aussagen zum Zustand der Rohrleitungssysteme<br />
gemacht werden.<br />
Eine Möglichkeit zur flächendeckenden Analyse von erdverlegten<br />
Fernwärmenetzen stellt die luftgestützte Thermal-<br />
Infrarot-Technologie (TIR) dar. Diese Technologie ermöglicht<br />
es, Strahlungsdichteunterschiede der Oberfläche zu visualisieren.<br />
Die Thermoanomalien geben Hinweise auf Schwachstellen<br />
<strong>im</strong> Isolationsvermögen des Fernwärmerohrsystems<br />
und besonders auf austretendes Fernheizwasser. Im zunehmenden<br />
Maße streben die Fernwärmeversorgungsunternehmen<br />
eine Zustandsbewertung ihrer Netze an. Dabei steht die<br />
Erfassung von zeitlichen Veränderungen der Wärmedämmung<br />
als Indikator für eine Zustandsänderung der verlegten warmgehenden<br />
Rohre <strong>im</strong> Vordergrund, sowohl <strong>im</strong> Vorlauf- als auch<br />
<strong>im</strong> Rücklaufsystem. Es ergäbe sich eine verbesserte vorteilhafte<br />
Wirtschaftlichkeit, wenn die Thermal-Infrarot-Technologie<br />
(TIR) diesbezüglich herangezogen werden könnte. Hinsichtlich<br />
der Erfüllung dieser Forderung stößt die luftgestützte<br />
Thermografie derzeit an Grenzen.<br />
In dem AIF-Vorläufer-Forschungsvorhaben 14014N<br />
„Generische Zustandsanalyse von Fernwärmenetzen“ wurden<br />
praktische Untersuchungen durchgeführt und ein vereinfachtes<br />
Berechnungsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe<br />
die Auswertung von TIR-Bilddaten unterstützt werden kann.<br />
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Umgebungsbedingungen<br />
an der Erdoberfläche den deutlich größten Einfluss<br />
auf die Erdoberflächentemperatur aufweisen und eine exakte<br />
Bewertung und Gewichtung anderer Einflussgrößen (Überdeckungshöhe,<br />
Eigenschaften des Überdeckungsmaterials, Mediumtemperatur)<br />
und damit das El<strong>im</strong>inieren von Störgrößen<br />
nur durch eine weiterführende praxisnahe Parameterstudie<br />
mit Präzisierung des Berechnungsmodells möglich wird. Auf<br />
Basis dieser Erkenntnisse wurde <strong>im</strong> aktuellen Forschungsvorhaben<br />
ein zweigeteilter Ansatz verfolgt. Ein Teil umfasste die<br />
Durchführung eines Feldversuchs. Der andere Teil umfasste<br />
die Durchführung von Modellberechnungen. Die Ergebnisse<br />
der Modellberechnungen und des Feldversuchs wurden miteinander<br />
verglichen und bewertet.<br />
Aufbau und Durchführung des<br />
Feldversuchs<br />
Die Datenbestände aus den messtechnischen Untersuchungen<br />
<strong>im</strong> Feldversuch bildeten die Basis für die Entwicklung eines<br />
Berechnungsmodells und lieferten wichtige Erkenntnisse<br />
über die Randbedingungen.<br />
Die Messungen wurden auf einem Betriebsgelände in Hannover<br />
durchgeführt. Bei dem untersuchten System handelte es<br />
sich um ein erdverlegtes Kunststoffmantelrohrsystem der D<strong>im</strong>ension<br />
DN 300/450. Vor- und Rücklaufleitung sind nebeneinander<br />
in einer Tiefe von 0,7 m verlegt. Der Abstand zwischen<br />
der Vor- und Rücklaufleitung beträgt 0,84 m. Die Leitung verläuft<br />
horizontal ohne Steigung bzw. Gefälle. Die Oberfläche ist<br />
mit Gras bewachsen. Im Bereich der Messstelle erfolgt keine<br />
Verschattung durch Gebäude oder Bewuchs. Im Feldversuch<br />
wurden sensorische Langzeitmessungen durchgeführt<br />
sowie luft- und bodengestützte Thermalaufnahmen realisiert.<br />
Die Außenlufttemperatur sowie die Erdreichtemperaturen<br />
wurden mit PT 100-Widerstandsthermometern erfasst.<br />
Die Widerstandsthermometer zur Messung der Erdreichtemperaturen<br />
wurden in definierten Abständen angebracht. Die<br />
Messungen erfolgten nahe der Erdoberfläche, direkt unter<br />
der Grassohle sowie in 0,35 m und 0,7 m Tiefe. Die Messanordnung<br />
der Widerstandsthermometer <strong>im</strong> Erdreich sowie die<br />
Kennzeichnung der Messstellen ist in Bild 1 dargestellt.<br />
Zusätzlich wurde der Wärmestromfluss durch Wärmestromsensoren<br />
auf dem Rohrmantel der Vor- und Rücklaufleitung<br />
erfasst. Die Windgeschwindigkeit wurde mit einem<br />
11 / 2011 875
Fachbericht<br />
Fernwärme & Energie<br />
Bild 1: Messanordnung<br />
der Pt-100-Widerstandsthermometer<br />
<strong>im</strong><br />
Erdreich mit Kennzeichnung<br />
der Messpunkte<br />
Tabelle 1: Durchführung der Messungen <strong>im</strong> Feldversuch<br />
Durchführung<br />
Langzeitmessung<br />
Luftgestützte Thermalaufnahmen<br />
Bodengestützt Thermalaufnahmen<br />
Vergleich und Bewertung der Messergebnisse<br />
Temperaturgradienten über der Fern wärmeleitung<br />
mit unterschiedlichen Kamerasystemen<br />
Meßstellenbezeichnung<br />
gemäß<br />
Bild 28<br />
Parameter<br />
Erdreichtemperaturen, Lufttemperatur,<br />
Windgeschwindigkeit<br />
Wärmestrom Vor- und Rücklauf<br />
Temperaturgradienten über der Fernwärmeleitung<br />
Tabelle 2: Mittlere Temperaturen des Erddreichs und der Außenluft<br />
für den Februar<br />
Erdoberflächenberich<br />
000<br />
Mittlere absolute Temperaturen <strong>im</strong> Monat Februar [°C]<br />
Erd<br />
(ungestörtes<br />
Erdreich)<br />
VLS<br />
(neben<br />
Vorlauf)<br />
VLM<br />
(über<br />
Vorlauf)<br />
RLM<br />
(über<br />
Rücklauf)<br />
RLS<br />
(neben<br />
Rücklauf)<br />
2,6 5,0 5,3 5,0 4,1<br />
350 mm 5,0 9,2 12,0 10,5 7,2<br />
700 mm 7,4 11,1 15,5 13,1 9,4<br />
925 mm 8,6 -<br />
Außenlufttemperatur<br />
T Luft<br />
1,8<br />
Windgeschwindigkeitsgeber in Erdbodennähe erfasst. Alle<br />
Messwerte wurden in einem zeitlichen Abstand von 0,5 h<br />
erfasst und gespeichert.<br />
Zur Bewertung der sensorischen Messergebnisse wurden<br />
die Messwerte des Monats Februar 2011 analysiert, da in diesem<br />
Zeitraum die kl<strong>im</strong>atischen Bedingungen (keine Überdeckung<br />
mit Schnee) den Anforderungen entsprechen, wie sie<br />
zur Durchführung einer luftgestützten Thermalaufnahme erforderlich<br />
sind. Der Mittelwert der Vorlaufmediumtemperatur<br />
betrug für diesen Zeitraum 85,5 °C, die Rücklaufleitung wies<br />
eine mittlere Mediumtemperatur von 55,8 °C auf. Die durchschnittliche<br />
Temperatur der Luft betrug 1,8 °C, die mittlere<br />
Windgeschwindigkeit betrug 1,03 m/s.<br />
Die Mittelwerte der Temperaturen des Monats Februar<br />
für das Messfeld sind in Tabelle 2 dargestellt.<br />
Die erdoberflächennahen Temperaturen werden <strong>im</strong> Wesentlichen<br />
von der Außenlufttemperatur beeinflusst (Bild 2).<br />
Dieser Einfluss ist auch direkt über der Vor- und Rücklaufleitung<br />
deutlich zu erkennen. Allerdings werden extreme Temperaturschwankungen<br />
der Außenluft über der Fernwärmeleitung<br />
etwas stärker gedämpft als an der Oberfläche des ungestörten<br />
Erdreichs. Zwischen der Erdoberfläche des ungestörten<br />
Erdreichs und der der Erdoberfläche über der Fernwärmeleitung<br />
stellt sich eine deutliche Temperaturdifferenz ein.<br />
Diese Temperaturdifferenz ist über den dargestellten Zeitraum<br />
relativ konstant (Bild 3).<br />
Der Mittelwert für die Temperaturdifferenz zwischen<br />
der ungestörten Erdoberfläche und der Erdoberfläche über<br />
der Vorlaufleitung bezogen auf den Monat Februar beträgt<br />
2,7 K. Der Mittelwert für die Temperaturdifferenz zwischen<br />
der ungestörten Erdoberfläche und der Erdoberfläche über<br />
der Rücklaufleitung beträgt 2,4 K.<br />
876 11 / 2011
Bild 2: Erdoberflächennahe<br />
Temperaturverläufe<br />
mit Verlauf der<br />
Außenlufttemperatur <strong>im</strong><br />
Monat Februar<br />
Bild 3: Temperaturdifferenzen<br />
an der Erdoberfläche<br />
zwischen dem<br />
ungestörten Erdreich und<br />
der Vorlauf- und Rücklaufleitung<br />
Bild 4: Temperaturprofil<br />
an der Erdoberfläche<br />
am Tag und in der<br />
Nacht<br />
11 / 2011 877
Fachbericht<br />
Fernwärme & Energie<br />
An der Erdoberfläche bildet sich ein Temperaturprofil zwischen<br />
dem ungestörten Erdreich und dem Einflussbereich der<br />
Fernwärmeleitung aus, bei dem das Max<strong>im</strong>um über der Vorlaufleitung<br />
auftritt (Bild 4). In Richtung der Rücklaufleitung<br />
sinkt die Erdoberflächentemperatur. Das Temperaturprofil nahe<br />
der Erdoberfläche verändert sich <strong>im</strong> tageszeitlichen Verlauf<br />
nur geringfügig.<br />
Zwischen der Außenluft und der Erdoberfläche über der<br />
Vorlaufleitung ist eine Temperaturdifferenz vorhanden, die<br />
für den Monat Februar durchschnittlich 3,5 K beträgt. Der<br />
Einfluss der Außenlufttemperatur wird bereits bei geringer<br />
Verlegetiefe gedämpft (Bild 5). Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen,<br />
dass ein Einfluss des konvektiven Wärmeüber-<br />
gangs an der Erdoberfläche bereits in geringen Tiefen nicht<br />
mehr vorhanden ist.<br />
Die Temperaturen <strong>im</strong> ungestörten Erdreich (Erd) und neben<br />
der Rücklaufleitung (RLS) steigen mit zunehmender Tiefe<br />
linear an. Im Bereich der Fernwärmeleitung sind die Temperaturverläufe<br />
leicht „gekrümmt“. Die Temperaturdifferenzen<br />
bezogen auf das ungestörte Erdreich zwischen den Messstellen<br />
sind in 70 cm Tiefe am Größten und werden in Richtung<br />
der Erdoberfläche geringer (Bild 6).<br />
Die Temperatur der Erdoberfläche und <strong>im</strong> Erdreich über<br />
der Fernwärmeleitung wird durch den Wärmeverlust der Vorund<br />
Rücklaufleitung best<strong>im</strong>mt. Der Wärmefluss der Vorlaufund<br />
Rücklaufleitung ist relativ konstant und beeinflusst die<br />
Bild 5: Temperaturverläufe<br />
über der Vorlaufleitung<br />
für den Monat<br />
Februar<br />
Bild 6: Temperaturverläufe<br />
in Abhängigkeit<br />
der Erdreichtiefe<br />
878 11 / 2011
Bild 7: Wärmefluss<br />
der Vorlauf- und Rücklaufleitung<br />
<strong>im</strong> Monat Februar<br />
Tabelle 3: Messzeitraum und Messbedingungen während der<br />
luftgestützten Thermalaufnahmen<br />
Weitere Flugparameter:<br />
Datum/ Uhrzeit 28.2.2011/ 23.24 MEZ 9.3.2011/ 03.48 MEZ<br />
Flughöhe 766,6 m ü.G. 750,9 m ü.G.<br />
Lufttemperatur min. 2°C, max. 7°C min. 4°C, max. 11°C<br />
Luftfeuchte Rel. 85% Rel. 72%<br />
Sonnenscheindauer Unter 1 h Unter 1 h<br />
Wind 4 – 11 Km/h 7 – 32 Km/h<br />
Temperaturbildung <strong>im</strong> Erdreich (Bild 7). Der durchschnittliche<br />
Wärmefluss der Vorlaufleitung beträgt für den dargestellten<br />
Zeitraum 32,2 W/m. Für die Rücklaufleitung beträgt<br />
der durchschnittliche Wärmefluss 16,4 W/m. Damit ergibt<br />
sich zwischen der Vor- und Rücklaufleitung eine Differenz<br />
von 15,8 W/m bezogen auf den Wärmefluss bei einer durchschnittlichen<br />
Temperaturdifferenz von 2,4 K der Manteltemperaturen.<br />
An der Erdoberfläche erfolgt der Wärmeaustausch sehr<br />
schnell. Die Änderung der Erdoberflächentemperatur <strong>im</strong> Bereich<br />
der Fernwärmeleitung wird <strong>im</strong> Wesentlichen durch die<br />
kl<strong>im</strong>atischen Bedingungen beeinflusst.<br />
Im Versuchszeitraum wurden jeweils zwei luftgestützte<br />
Thermalaufnahmen des Areals realisiert. Zum Einsatz kam ein<br />
Thermal<strong>im</strong>ager vom Typ IR 18 MK III <strong>im</strong> Wellenlängenbereich<br />
von 8 bis 14 μm. Der Messzeitraum und die Messbedingungen<br />
während der luftgestützten Thermalaufnahmen sind in<br />
(Tabelle 3) dargestellt. Im Bereich des Messfeldes der sensorischen<br />
Messungen wurden für den gekennzeichneten Bereich<br />
auf den Thermalaufnahmen (Bild 8) 3D-Farboberflächendiagramme<br />
erstellt, die Temperaturgradienten ermittelt<br />
und graphisch dargestellt (Bild 9). Hieraus lässt sich die Temperaturverteilung<br />
an der Erdoberfläche darstellen.<br />
Bild 8: Luftgestützte Thermalaufnahme<br />
am 28.02.2011, Zeit: 23:24 mit Kennzeichnung<br />
des Bereichs zur Darstellung der Temperaturgradienten<br />
Die Thermalinfrarotaufnahmen zeigen das erwartete signifikante<br />
Erscheinungsbild der erdverlegten Kunststoffmantelrohrleitung<br />
(KMR). Die relativ geringe Mediumtemperatur<br />
(ca. 80 °C Vorlauftemperatur) sowie die Isolation der Heizleitungen<br />
erzeugt ein entsprechendes Isotherm <strong>im</strong> Bereich der<br />
Leitung, welches als Ergebnis eine sehr geringe Wärmeabstrahlung<br />
an der Erdoberfläche hervorruft. Das bedeutet, dass<br />
der ungestörte Leitungsverlauf thermisch äußerst schwer erkennbar<br />
ist. Die zusätzliche Signaldämpfung durch die atmosphärischen<br />
Einflüsse, führen zu einer weiteren Reduzierung<br />
der messbaren Strahlungstemperatur. Aus den numerischen<br />
Werten ergibt sich ein durchschnittliches ΔT von 1 – 2 K zwischen<br />
der Überdeckung der Fernwärmeleitung und den an-<br />
11 / 2011 879
Fachbericht<br />
Fernwärme & Energie<br />
grenzenden Bodenarealen. Auf den kleinen IR-Abbildungen<br />
sind die verwendeten Temperaturgradienten verortet.<br />
Die thermografischen Messungen am Boden konzentrierten<br />
sich auf die Fläche auf der die Messfühler in den Bo-<br />
den eingebracht wurden. So wurde die Gegenüberstellung<br />
sowie die Vergleichsmöglichkeit der Messergebnisse gewährleistet.<br />
Bild 10 veranschaulicht die Abfolge der <strong>im</strong> weiteren<br />
Verlauf dargestellten Messreihen. Die Messfläche ist<br />
durch ein Markierungsband abgegrenzt, das auf den überlagerten<br />
2-d<strong>im</strong>ensionalen Rasterbilddaten identifizierbar ist.<br />
Auf dem Originalbild (1) ist das jeweilige Thermogramm (2)<br />
platziert und wird durch das thermische Profildiagramm (3)<br />
komplettiert. Die bereits nach den luftgestützten TIR-Aufnahmen<br />
festgestellten thermischen Strahlungsverhältnisse<br />
wurden durch die bodengestützten Messungen bestätigt.<br />
Sämtliche Messungen nach Sonnenuntergang bis in die<br />
Nachtstunden weisen ein ΔT von ca. 1,5 bis 2 K des Leitungsbereiches<br />
zur Umgebung auf. Hierbei sind die Differenzen<br />
der Lufttemperatur kaum ausschlaggebend auf das<br />
Messergebnis. Die parallel gemessene Luftfeuchtigkeit hat<br />
hingegen die erwarteten Veränderungen des Signal/Rauschverhaltens<br />
zur Folge. Entsprechende Korrekturen el<strong>im</strong>inieren<br />
die Störungen. Bemerkenswert ist, dass bei genauer Betrachtung<br />
des Anstieges bzw. des Abfalls der Profilkurven<br />
die Lage des Vor-und Rücklaufes der Fernwärmeleitung erkennbar<br />
wird (Bild 11).<br />
Bild 9: Temperaturgradienten <strong>im</strong> gekennzeichneten Bereich der<br />
luftgestützten Thermalaufnahme, siehe Bild 8<br />
Berechnungen<br />
Im ersten Vorhaben wurde ein vereinfachtes analytisches Berechnungsmodell<br />
entwickelt. Zusätzlich erfolgte nun eine numerische<br />
S<strong>im</strong>ulation mit einem FEM-Modell. Die Berechnungen<br />
erfolgten auf Basis der <strong>im</strong> Feldversuch ermittlelten Messwerte<br />
und Geometriedaten. Die Berechnungsmodelle wurden<br />
auf Basis der Messdaten des 28. Februars 2011 überprüft, da<br />
an diesem Tag auch eine Überfliegung durchgeführt wurde.<br />
Zur Durchführung der Berechnungen wurden die Mittelwerte<br />
aus den Messwerten der Umgebungstemperatur (Lufttemperatur)<br />
und der Mediumrohrtemperatur des Feldversuchs<br />
eingesetzt. Weiterhin wurden für die Berechnung folgende<br />
Werte eingesetzt:<br />
Rohrd<strong>im</strong>ension: DN 300/450<br />
Verlegetiefe: 0,7 m<br />
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung: 0,033 [W•m- 1 K -1 ]<br />
Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs: 1,4 [W•m -1 K -1 ]<br />
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: 1,03 m/s<br />
Wärmeübergangskoeffizient an der Erdoberfläche:<br />
6 W · m -2 K -1<br />
Bild 10: Darstellung der Überlagerung der Rasterbilddaten<br />
Das analytische Modell<br />
Für das vereinfachte analytische Berechnungsmodell wurden<br />
die Gleichungen für die Wärmeleitung und den Wärmedurchgang<br />
für eine mehrschichtige Zylinderwand angesetzt<br />
und miteinander verknüpft. Es wurden die folgenden Randbedingungen<br />
festgelegt:<br />
Das Berechnungsmodell ist für ein einzelnes <strong>im</strong> Erdreich<br />
verlegtes Kunststoffmantelrohr aufgestellt. Es wird davon<br />
ausgegangen, dass die Erdoberflächentemperatur aufgrund<br />
der höheren Mediumtemperatur, allein durch die<br />
Vorlaufleitung dominiert wird.<br />
880 11 / 2011
Bild 11: Ermittelte Temperaturgradienten<br />
an der Erdoberfläche<br />
durch thermografische<br />
Messung am Boden<br />
<strong>im</strong> Bereich der sensorischen<br />
Meßstellen<br />
Bild 12: Sensorisch<br />
erfasste erdoberflächennahe<br />
Temperaturverläufe<br />
über der Vorlaufleitung<br />
und dem ungestörtem<br />
Erdreich sowie<br />
der Lufttemperatur<br />
mit Darstellung der<br />
berechneten Erdoberflächentemperatur<br />
über<br />
der Vorlaufleitung<br />
Es wird der stationäre Zustand zugrunde gelegt, d. h., das<br />
System Rohr/Erdreich befindet sich <strong>im</strong> thermodynamischem<br />
Gleichgewicht.<br />
Der Wärmestrom vom Mediumrohr durch die Dämmschicht<br />
und das Erdreich bis an die Erdoberfläche ist konstant.<br />
Der konvektive Wärmeübergang zwischen dem Wärmeträger<br />
Wasser und der Rohrinnenwand wird vernachlässigt.<br />
Die Wärmeleitung durch das Mediumrohr sowie durch<br />
den PE-Mantel wird nicht berücksichtigt.<br />
Die Wärmestrahlung an der Erdoberfläche wird vernachlässigt.<br />
In (Bild 12) sind die erdoberflächennahen gemessenen und<br />
die berechneten Temperaturen über der Vorlaufleitung, die<br />
gemessenen Temperaturen an der Erdoberfläche des ungestörten<br />
Erdreichs sowie die Messwerte der Lufttemperatur<br />
als Funktion der Tageszeit des 28. Februars 2011 dargestellt.<br />
Der berechnete Temperaturverlauf über der Vorlaufleitung<br />
ist <strong>im</strong> Wesentlichen eine Funktion der Luft- bzw. Umgebungstemperatur.<br />
Im Zeitfenster von 00:00 bis 07:12 ist die<br />
Lufttemperatur relativ konstant. In diesem Zeitraum liegen<br />
die erdoberflächennahen Messwerte über der Vorlaufleitung<br />
deutlich über den berechneten Werten. Die durchschnittliche<br />
Temeperaturdifferenz zwischen der berechneten Erdoberflächentemperatur<br />
und der sensorisch erfassten Temperatur<br />
über der Vorlauleitung beträgt in diesem Zeitraum 2,97 K. Die<br />
durchschnittliche Temperaturdifferenz zwischen der gemessenen<br />
Lufttemperatur und der berechneten Erdoberflächentemperatur<br />
beträgt in diesem Zeitraum 1,2 K. Aus den numerischen<br />
Werten der luftgestützen Thermalaufnahmen ergibt<br />
sich ein durchschnittliches ΔT von 1 bis 2 K zwischen der<br />
Überdeckung der Fernwärmeleitung und den angrenzenden<br />
Bodenarealen. Die Messung der Erdoberflächentemperaturen<br />
erfolgte nicht dierekt an der Erdoberfläche, sondern unterhalb<br />
der Grassohle, so dass der Einfluss durch die konvektive Abkühlung<br />
nicht erfasst wurde und auch der Einfluss von Temperaturschwankungen<br />
der Luft abgeschwächt wird. Es ist daher<br />
realistisch, dass die Erdoberflächentemperatur über der Vorlaufleitung<br />
unterhalb der dargestellten Messwerte liegt. Die<br />
berechneten Temperaturen weisen bei stabilen Temperaturverhältnissen<br />
der Umgebung eine gute Übereinst<strong>im</strong>mung mit<br />
den messtechnisch erfassten Temperaturen auf.<br />
Das FEM-Modell<br />
Im Rahmen des Projektes wurde das FE-Programm ABAQUS<br />
verwendet, um parametrisierte Temperaturfeldberechnungen<br />
durchzuführen. Auch die FEM-Berechnung erfolgte für<br />
den stationären Zustand. Für die S<strong>im</strong>ulation des stationä-<br />
11 / 2011 881
Fachbericht<br />
Fernwärme & Energie<br />
Bild 13: Temperaturfeld<br />
<strong>im</strong> umgebenden Erdreich der<br />
Fernwärmeleitung<br />
ren Zustands ist die Geometrie des Berechnungsgebiets des<br />
KMR-Boden-Systems durch Elemente endlicher Größe (finite<br />
Elemente) festzulegen. Die Geometrie der Elemente wird<br />
durch die Lage von Knotenpunkten definiert. Für die erstellten<br />
2D-Modelle der Versuchsquerschnitte wurden 4-Knoten-Elemente<br />
verwendet. Nebeneinander liegende Elemente<br />
sind durch gemeinsame Knoten verbunden. Den Elementen<br />
wird die jeweilige Wärmeleitfähigkeit als Materialeigenschaft<br />
zugewiesen. Modelliert wurden der Boden und das<br />
KMR-System bestehend aus Stahlrohr, Dämmung und Mantelrohr.<br />
Die Geometriedaten der Rohrd<strong>im</strong>ension und Verlegtiefe<br />
werden auch hier entsprechend den Angaben des Feldversuchs<br />
entnommen. In Bild 13 ist das berechnete Temperaturfeld<br />
dargestellt.<br />
In Tabelle 4 ist die Differenz der berechneten Temperaturen<br />
<strong>im</strong> FE-Modell zu den gemessenen Temperaturen <strong>im</strong><br />
Tabelle 4: Differenz der Temperaturen vom FE-Modell zum Feldversuch<br />
Erd VLS VLM RLM RLS<br />
0 -0.1 K 1.0 K 0.6 K 0.6 K 0.4 K<br />
350 1.1 K 2.2 K 2.9 K 2.2 K 0.9 K<br />
700 2.4 K 1.5 K 1.3 K 0.9 K 1.0 K<br />
Tabelle 5: Prozentuale Abweichung der Temperatur <strong>im</strong> FE-Modell<br />
bezogen auf den Feldversuch<br />
Erd VLS VLM RLM RLS<br />
0 4 % 21 % 11 % 11 % 11 %<br />
350 21 % 23 % 24 % 21 % 13 %<br />
700 33 % 13 % 8 % 7 % 10 %<br />
Prozentuale Abweichung der Temperatur <strong>im</strong> FE-Modell bezogen<br />
Feldversuch für die betrachteten Messstellen dargestellt. Die<br />
Differenz beträgt <strong>im</strong> Erdreich max<strong>im</strong>al rund 2,4 K. Im Bereich<br />
der Erdoberfläche beträgt die max<strong>im</strong>ale Differenz lediglich<br />
ca. 1 K.<br />
In Tabelle 5 ist die prozentuale Abweichung der Temperaturen<br />
<strong>im</strong> FE-Modell bezogen auf die Temperaturen <strong>im</strong> Feldversuch<br />
für die betrachteten Messstellen dargestellt. Die Abweichung<br />
beträgt max<strong>im</strong>al 33 % und <strong>im</strong> Mittel 15 %.<br />
Abschließend kann festgestellt werden, dass sich eine relativ<br />
gute Übereinst<strong>im</strong>mung der berechneten und der gemessenen<br />
Temperaturen ergeben hat.<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Auf Basis der Daten von luftgestützten Thermalaufnahmen soll<br />
zukünftig eine Zustandsbewertung erfolgen sowie Zustandsänderungen<br />
durch Messungen in zeitlich definierten Abständen<br />
erfasst werden. Die Aufnahme der TIR-Bilddaten wird jedoch<br />
von einer Vielzahl an Parametern beeinflusst, so dass Abweichungen<br />
bei den Messungen nach einem best<strong>im</strong>mten Zeitraum<br />
nicht grundsätzlich auf eine Zustandsänderung des Fernwärmenetzes<br />
zurückzuführen sind. Über ein Berechnungsmodell,<br />
das die Einflussgrößen in bestmöglicher Annäherung an die Realität<br />
berücksichtigt und darstellt, sollen zukünftig differenziertere<br />
Aussagen zur Bewertung und Zustandsänderungen der<br />
Fernwärmenetze getroffen werden können. Im AIF-Vorläufer-<br />
Forschungsvorhaben „Generische Zustandsanalyse von Fernwärmenetzen“<br />
vom 01.05.2004 bis zum 31.01.2006 wurde<br />
ein vereinfachtes analytisches Berechnungsmodell entwickelt.<br />
Im aktuellen Forschungsvorhaben sollte durch eine weiterführende<br />
praxisnahe Parameterstudie in einem Feldversuch das<br />
Berechnungsmodell präzisiert werden.<br />
In einem Feldversuch auf einem Betriebsgelände in Hannover<br />
wurden sensorische Langzeitmessungen sowie luftgestützte<br />
und bodengestützte thermografische Messungen<br />
durchgeführt. Durch die sensorische Langzeitmessung wurden<br />
die Erdreichtemperaturen, die Mediumrohrtemperaturen<br />
der Vor- und Rücklaufleitung, der Wärmestromfluss der<br />
882 11 / 2011
Vor- und Rücklaufleitung sowie die Lufttemperatur erfasst.<br />
Die sensorischen Messungen haben bestätigt, dass die Umgebungstemperatur<br />
einen erheblichen Einfluss auf die Temperaturbildung<br />
der Erdoberfläche besitzt.<br />
Die luftgestützten Thermalaufnahmen haben gezeigt,<br />
dass durch die relativ geringe Medientemperatur (ca. 80 °C<br />
Vorlauftemperatur) sowie durch die Isolation der Fernwärmeleitung<br />
eine sehr geringe Wärmeabstrahlung an der Erdoberfläche<br />
erzeugt wird. Der ungestörte Leitungsverlauf ist<br />
thermisch äußerst schwer erkennbar. Aus den numerischen<br />
Werten ergibt sich ein durchschnittliches ΔT von 1 bis 2 K<br />
zwischen der Überdeckung der Fernwärmeleitung und den<br />
angrenzenden Bodenarealen. Die bereits nach den luftgestützten<br />
TIR-Aufnahmen festgestellten thermischen Strahlungsverhältnisse<br />
wurden durch die bodengestützten Messungen<br />
systemunabhängig bestätigt. Sämtliche Messungen<br />
nach Sonnenuntergang bis in die Nachtstunden weisen ein ΔT<br />
von ca. 1,5 bis 2 K des Leitungsbereiches zur Umgebung auf.<br />
Die Überprüfung des vereinfachten analytischen und des<br />
FEM-Berechnungsmodells erfolgte auf Basis der Messdaten<br />
des 28. Februars 2011. Die berechneten Temperaturen beider<br />
Modelle weisen bei stabilen Temperaturverhältnissen der<br />
Umgebung eine gute Übereinst<strong>im</strong>ung mit den messtechnisch<br />
erfassten Temperaturen auf, so dass eine Anpassung der Modelle<br />
für diesen Fall vorerst nicht erforderlich ist.<br />
Zurzeit ist eine Bewertung der Zustandsänderung in Bezug<br />
auf eine zeitliche Veränderungen der Wärmedämmung eines<br />
Fernwärmenetzes durch luftgestützte Thermografie nicht<br />
möglich. Die zeitliche Veränderung der Wärmeleitfähigkeit<br />
der Wärmedämmung führt zu einer Veränderung der Temperatur<br />
an der Erdoberfläche. Diese Änderung wird jedoch von<br />
den Störgrößen an der Erdoberfläche sowie den atmosphärischen<br />
Einflüssen überlagert. Nur durch die exakte Bewertung<br />
der kl<strong>im</strong>atischen und atmosphärischen Einflüsse auf die Darstellung<br />
der Thermalbilder kann ein zuverlässiges Verfahren<br />
zur Zustandsbewertung entwickelt werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing.(FH) Volker Herbst<br />
Fernwärme-Forschungsinstitut in<br />
Hannover e.V.<br />
Tel. +49 511 94370-0<br />
E-Mail: Herbst@fernwaerme.de<br />
WISSEN für die ZUKUNFT<br />
Taschenbuch Dichtungstechnik<br />
Dieses Taschenbuch erläutert kurz und prägnant die wichtigsten Begriffe der Dichtungstechnik.<br />
Es enthält in kompr<strong>im</strong>ierter Form grundlegende Informationen zu statischen Dichtungen,<br />
Packungen, Gleitringdichtungen, Radialwellendichtringen, Hydraulik- und Pneumatikdichtungen,<br />
berührungsfreien Dichtungen sowie Sonderdichtungen und Zubehör.<br />
Hrsg.: W. Tietze / A. Riedl<br />
3. Aufl age 2011,<br />
400 Seiten mit zahlreichen<br />
Abbildungen und Tabellen, Hardcover<br />
3. aktualisierte<br />
und ergänzte<br />
Auflage<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 201 / 82002-34 oder <strong>im</strong> Fensterumschlag einsenden<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex. Taschenbuch Dichtungstechnik<br />
(ISBN: 978-3-8027-2767-2)<br />
zum Preis von € 45,- zzgl. Versand<br />
Die bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird<br />
mit einer Gutschrift von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Tätigkeitsbereich<br />
Telefax<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder<br />
durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die<br />
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Kontonummer<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten<br />
erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder<br />
11 / 2011<br />
✘<br />
vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben<br />
883<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
Datum, Unterschrift<br />
PATDT32011
Projekt kurz beleuchtet<br />
Fernwärme & Energie<br />
1.200 m Fernwärmeleitung dank HDD<br />
in Rekordgeschwindigkeit verlegt<br />
In der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm gelang der Fernwärmeanschluss fast unbemerkt: Bei der Unterquerung des<br />
Datteln-Hamm-Kanals und der Lippe kam die HDD-Bohrtechnik zum Einsatz. Um mehrere hundert Haushalte mit Fernwärme<br />
zu versorgen, wurden drei jeweils 420 m Bohrungen erstellt.<br />
GroSSe Herausforderungen für den<br />
Einsatz<br />
Die Stadt Hamm beauftragte die Köster GmbH mit den<br />
auszuführenden Arbeiten. Als Subunternehmen war die<br />
Firma Visser&Smit Hanab für die Bohrungen zuständig,<br />
zum Einsatz kam dabei eine HDD-Anlage von Pr<strong>im</strong>e Drilling.<br />
„Die größte Herausforderung des Projekts waren die<br />
geographischen und geologischen Parameter“, erklärt<br />
Werner Wurm, Geschäftsführer des Herstellers von Bohrgeräten.<br />
Denn in der bevölkerungsreichen Gegend an der<br />
Speicherstraße des Ruhrgebiets verlaufen der Datteln-<br />
Hamm-Kanal und der Fluss Lippe parallel zueinander. Um<br />
hier eine Fernwärmeleitung zu verlegen, musste das Gewässer<br />
dre<strong>im</strong>al auf einer Länge von jeweils 420 m unterquert<br />
werden.<br />
Mehrere Argumente sprachen für das grabenlose Bauverfahren.<br />
In dem harten Tonmergelstein hätte das Verlegen<br />
der Leitungen in offener Bauweise mehrere Monate in Anspruch<br />
genommen und die Infrastruktur behindert. Ferner<br />
hätte man den Kanal unter Umständen anstauen müssen –<br />
mit erheblichen Folgen für die Binnenschifffahrt und die<br />
Wasserwirtschaft der Region.<br />
Aus diesen Gründen entschied sich der Auftraggeber für<br />
das HDD-Verfahren. Zum Einsatz kam eine Pr<strong>im</strong>e Drilling<br />
BILD 1: Die in Hamm eingesetzte Bohranlage PD100/50RP mit einer Zugkraft von 1.000 kN<br />
Foto: Pr<strong>im</strong>e Drilling<br />
884 11 / 2011
BILD 2: Bei der Unterführung des Datteln-Hamm-Kanals wurden drei Bohrungen von jeweils 420 m Länge vorgenommen<br />
Foto: Visser&Smit Hanab GmbH<br />
Bohranlage PD100/50RP mit einer Zugkraft von 1.000 kN.<br />
„Der Bau eines Mikrotunnels hätte zwei bis drei Monate gedauert.<br />
Dank der HDD-Bohrung war das Projekt nach drei<br />
Wochen abgeschlossen“, erklärt Peter Dennig, Projektleiter<br />
bei Visser&Smit, die Vorteile der Technik in diesem Fall.<br />
Die erste Bohrung diente dem Einziehen von Kabelschutzrohren<br />
und wurde zunächst als Spülungsrücklauf für die übrigen<br />
Bohrungen genutzt. In die zweite und dritte Bohrung<br />
wurden nach einer Aufweitung auf jeweils 26 Zoll Vor- beziehungsweise<br />
Rücklauf der Fernwärmeleitung eingezogen.<br />
Weltweit <strong>im</strong> Einsatz<br />
Die HDD-Bohranlagen der Pr<strong>im</strong>e Drilling GmbH haben sich in<br />
den vergangenen Jahren bereits in zahlreichen, teils spekta-<br />
kulären Bauprojekten bewährt. So wurde für die Olympischen<br />
Winterspiele 2014 in Russland eine Gas-Pipeline eingerichtet,<br />
die zum Teil die Küste des Schwarzen Meeres unterqueren<br />
musste. Projekte in den Alpen oder die Erdverlegung einer<br />
Hochspannungsleitung <strong>im</strong> Magdeburger Hafen mit einem<br />
besonders steilen Eintrittswinkel von 38° stellt <strong>im</strong>mer wieder<br />
die Leistungsfähigkeit der Technologie unter Beweis. „Die<br />
HDD-Technik gibt es zwar schon seit einigen Jahren, jedoch<br />
stieß man <strong>im</strong>mer wieder an Grenzen. Erst mit den aktuellen<br />
technischen Weiterentwicklungen können nahezu alle Hindernisse<br />
bewältigt werden“, sagt Werner Wurm.<br />
Kontakt<br />
www.pr<strong>im</strong>e-drilling.de oder www.vshanab.nl<br />
Made<br />
in<br />
Germany<br />
Die ganze Welt der<br />
Horizontalbohrtechnik<br />
Pr<strong>im</strong>e Drilling Horizontalbohranlagen<br />
mit Zugkräften von 32 bis 600 t.<br />
PRIME DRILLING GmbH<br />
Tel.: +49 (0) 2762 930 96-0<br />
E-Mail: info@ pr<strong>im</strong>e-drilling.de · www.pr<strong>im</strong>e-drilling.de<br />
11 / 2011 885
Projekt kurz beleuchtet<br />
Fernwärme & Energie<br />
Neue Rohre für ein historisches<br />
Kraftwerk<br />
Elektrizitätsgewinnung durch Wasserkraft liegt zwar derzeit „voll <strong>im</strong> Trend“, ist jedoch nichts wirklich Neues. Und so stehen den<br />
derzeit allerorten neu gebauten WKA durchaus auch ein paar historische Anlagen gegenüber. Diese technisch auf den neuesten<br />
Stand zu bringen, lohnt sich heute natürlich mehr denn je. Aktuelles Beispiel dafür ist die Modernisierung der WKA Fischweier in<br />
Baden-Württemberg.<br />
Seit 1934 wird <strong>im</strong> Laufkraftwerk Fischweier an der Alb regenerativer<br />
Strom erzeugt. Nach jahrzehntelangem Dauerbetrieb<br />
ist das bei Rheinstetten gelegene Kraftwerk, das sich<br />
heute in Privatbesitz von Manfred Lüttke befindet, rundum<br />
modernisierungs- und sanierungsbedürftig. Die Neubauplanungen<br />
des Ingenieurbüros Eppler, Dornstetten sahen eine<br />
Anlage mit 500.000 kWh Jahreserzeugung vor, mit denen bis<br />
zu 200 Haushalte ganzjährig versorgt werden können. Eine<br />
kontinuierliche Wassermenge von 1000 Litern pro Sekunde<br />
gewährleistet bei 8 bis 9 m Gefälle des Laufkraftwerks eine<br />
Leistung von 65 bis 70 kW.<br />
Ein spezieller Aspekt der Modernisierung waren die Oberwasser-<br />
und Unterwasserrohrleitungen. Gerade an den ursprünglichen<br />
Pressbetonrohren DN 1000 waren 75 Jahre fließendes<br />
Wasser nicht spurlos vorüber gegangen. Das Sanierungskonzept<br />
sah deshalb auch hier einen zumindest partiellen<br />
Neubau vor. Da großer Wert auf reibungs-, verschleißund<br />
wartungsarmes Rohrmaterial gelegt wurde, fiel die Wahl<br />
folgerichtig auf glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). Zum<br />
Zuge kamen schließlich GFK-Wickelrohre des Systems FLOW-<br />
TITE von AMITECH Germany. Zwischen 2009 und der Inbetriebnahme<br />
des Kraftwerks <strong>im</strong> August 2011 wurden 800 m<br />
des Oberwasserkanals und 150 m des Unterwasserkanals<br />
durch GFK-Rohre DN 1400 ersetzt. Momentan noch in Beton<br />
belassene Teilstrecken sollen künftig Zug um Zug gleichfalls<br />
durch GFK ersetzt werden.<br />
Dabei spielt, wie schon bei der aktuellen Erneuerung, eine<br />
große Rolle, dass sich GFK aufgrund seines geringen Metergewichtes<br />
<strong>im</strong> Bauvorgang sehr leicht und schnell handhaben<br />
lässt. Damit können Auszeiten für das Kraftwerk auf ein<br />
absolutes Min<strong>im</strong>um reduziert werden: Ein sehr wichtiger Pluspunkt<br />
unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit,<br />
der sich nicht nur in Fischweier, sondern in<br />
etlichen Projekten <strong>im</strong> ganzen deutschsprachigen Raum für<br />
WKA-Betreiber ausgezahlt hat.<br />
Kontakt<br />
AMITECH Germany GmbH, Jochen Auer, Mochau,<br />
Tel. +49 1749077771,<br />
E-Mail: Jochen.Auer@amitech-germany.de<br />
BILD 1: Einbindung<br />
des GFK-Wickelrohrs<br />
DN 1400 in das neue<br />
Kraftwerksbauwerk<br />
886 11 / 2011
Praxis-tipps<br />
Services<br />
Digitaler LCD-Notizblock mit<br />
Speicherfunktion<br />
Das Boogie Board Rip ist ein digitaler LCD-Notizblock mit 9,5 Zoll,<br />
auf dem es sich fast wie auf echtem Papier schreiben lässt. Zudem<br />
können die aufgezeichneten Notizen und Bilder nun auch als Dateien<br />
gespeichert werden. Die Dateien können zur Bearbeitung, Organisierung,<br />
Archivierung und/oder Weitergabe auf einen Computer<br />
übertragen werden. Ob die Mitschriften aus Sitzungen, entworfene<br />
Skizzen oder der Spielplan des Sportteams – alle auf dem neuen<br />
Board festgehaltenen Notizen können mit nur einer Taste gespeichert<br />
werden und mit dem USB-Kabel auf einem Computer archiviert<br />
oder beabeitet werden. Bis zu 200 Bilder <strong>im</strong> PDF-Format fasst<br />
der interne Speicher des kleinen Boards. Der integrierte Akku hält<br />
laut Hersteller eine Woche und 60 Tage <strong>im</strong> Standby.<br />
Der Hersteller gibt weiterhin an, dass das Display des elektronischen<br />
Notizblocks kratzfest sei. Das Vorgängermodell das Boogieboard<br />
LCD writing Tablet ist <strong>im</strong> deutschen Handel erhältlich. Das<br />
neue Modell des Boogie Board RIP kann über die <strong>im</strong>provelectronics<br />
Webseite für 114,99 Euro bestellt werden.<br />
Kontakt:<br />
www.<strong>im</strong>provelectronics.com/de/<br />
BILD 1: Der LCD-<br />
Notizblock speichert<br />
alle handskizzierten<br />
Notizen und ermöglicht<br />
somit die Weiterverarbeitung<br />
auf<br />
dem Computer<br />
Mini-PC fürs Büro und Dahe<strong>im</strong><br />
Ob fürs Büro oder die Freizeit: Die neue<br />
MSI Wind Box DC100 spielt in beiden<br />
Bereichen ihre Stärken aus. Der besonders<br />
kompakte Mini-PC mit einem<br />
Volumen von nur einem Liter und einer<br />
Dicke von gerade einmal 3,5 cm findet<br />
leicht Platz auf dem Schreibtisch oder<br />
neben der Stereo-Anlage – bietet aber<br />
trotzdem volle PC-Leistung auch für<br />
anspruchsvollste Aufgaben.<br />
Der neueste AMD Brazos Dual Core<br />
Prozessor E-450 ist das Herz der energiesparenden<br />
und leisen Wind Box und<br />
bietet hohe Leistung, mit der sich nicht<br />
nur die üblichen Office-Aufgaben, wie<br />
E-Mail schreiben, Textverarbeitung<br />
und Internetrecherche leicht bewältigen<br />
lassen. Dank der integrierten AMD<br />
Radeon HD 6320-Discrete-Class-<br />
Grafik sind auch Mult<strong>im</strong>edia-Anwendungen<br />
problemlos möglich: Full-HD-<br />
Filme gibt er flüssig in bester Qualität<br />
wieder, beeindruckt mit DirectX®<br />
11-Unterstützung bei 3D-Spielen und<br />
streamt die Lieblingsmusik ohne Ruckler<br />
oder Unterbrechungen. Die mitgelieferte<br />
Smart Sync und Media Link-<br />
Software sorgt für einfache Vernetzung<br />
mit anderen PCs und Entertainment-Devices<br />
mit Hilfe neuester Cloud-<br />
Technik.<br />
Die MSI Wind Box DC100 ist als<br />
Windows 7 Professional- oder als<br />
Home-Premium-Variante ab ca. 300<br />
Euro erhältlich.<br />
Kontakt:<br />
www.msi-computer.de<br />
11 / 2011 887
Buchbesprechung<br />
services<br />
Moderation<br />
Effiziente Besprechungen<br />
und Projektmeetings<br />
Zusammenfassung: Der Praxisratgeber „Moderation“ hilft sowohl Meetings<br />
konstruktiv und systematisch aufzubauen, Moderationen bestmöglich vorzubereiten<br />
als auch Kommunikationsprozesse zu fördern und damit schneller und<br />
effektiver zum Ziel zu führen.<br />
Infos<br />
Dr. Jan Bodo Sperling, Jacqueline<br />
Wasseveld-Reinhold<br />
1. Auflage 2011, 277 Seiten<br />
Broschur + CD-ROM, 24,80 Euro<br />
ISBN 978-3-648-01280-2<br />
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg<br />
www.haufe-lexware.com<br />
Die Aufgabe von Führungskräften ist,<br />
Dinge zu bewegen, Lösungen zu liefern<br />
und Ergebnisse zu schaffen, indem sie<br />
Menschen zur erfolgreichen Zusammenarbeit<br />
motivieren und anleiten. Dies gelingt<br />
am besten durch eine professionelle<br />
Moderation. Das Buch zeigt sowohl Anfängern<br />
als auch bereits erfahrenen Moderatoren,<br />
wie sie <strong>im</strong> Rahmen ihrer täglichen<br />
Arbeit Sitzungen, Projekte und Arbeitsgruppen<br />
moderieren können und dabei<br />
ihre Ziele erreichen. Konkrete Hilfestellungen<br />
erhält der Leser durch<br />
Moderationstechniken und -methoden.<br />
Zudem liefert es Praxisbeispiele, Arbeitshilfen<br />
und Lösungen für den Umgang mit<br />
aufkommenden Konflikten.<br />
Nach der Klärung der Rolle des Moderators<br />
und dem Basiswissen zum Thema zeigt das<br />
Buch konkrete Techniken und gibt Tipps,<br />
wie man gekonnt Themen visualisiert und<br />
mit Fragen führen kann. Auf der dem Buch<br />
beiliegenden CD-ROM befinden sich Moderationstools,<br />
Prozesspläne, Checklisten<br />
zur Auftragsklärung und Ergebnissicherung<br />
sowie Zeitpläne.<br />
Qualitätsmanagement für<br />
Ingenieure<br />
Zusammenfassung: Das Lehrbuch vermittelt das Grundwissen des Qualitätsmanagements<br />
für die Ingenieurausbildung und stellt die Zusammenhänge zu<br />
anderen Wissensgebieten her. Es zeigt einen umfassenden Überblick über<br />
geeignete Methoden und Werkzeuge zur systematischen Umsetzung von<br />
standardisierten Qualitätsforderungen der ISO 9000:2000 ff.<br />
Infos<br />
G. Linß<br />
3. Auflage, 700 Seiten<br />
Hardcover + CD-ROM, 34,90 Euro<br />
ISBN: 978-3-446-41784-7<br />
www.hanser.de<br />
Qualitätsmanagement hat in der modernen<br />
arbeitsteiligen und spezialisierten<br />
Produktion und <strong>im</strong> Dienstleistungsbereich<br />
<strong>im</strong>mer mehr an Bedeutung gewonnen und<br />
wurde zum wichtigen Wettbewerbsfaktor.<br />
Knapp und übersichtlich wird das<br />
Grundwissen vermittelt und Zusammenhänge<br />
zu anderen Wissensgebieten, insbesondere<br />
zur Messtechnik, hergestellt.<br />
Dabei wird die Normenfamilie für das<br />
Qualitätsmanagement ISO 9000 ff. behandelt.<br />
Die umfangreichen Methoden<br />
und Werkzeuge sind nach den inhaltlichen<br />
Kriterien Qualitätsplanung, Produktrealisierung,<br />
Qualitätsauswertung und -ver-<br />
besserung systematisch beschrieben. Kapitel<br />
zu Prozessmanagement, Total Quality<br />
Management (TQM), rechnergestütztem<br />
Qualitätsmanagement (CAQ),<br />
qualitätsbezogenen Kosten, Produkthaftung,<br />
Umweltmanagement und Produktkonformität<br />
runden die Darstellungen ab.<br />
Das Buch ist sowohl für Studierende als<br />
auch für Praktiker, Manager und Geschäftsführer<br />
in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen,<br />
öffentlichen Verwaltungen<br />
und Kommunen gedacht.<br />
Die beiliegende CD-ROM enthält ein vollständiges<br />
browsergestütztes Qualitätsmanagement-Handbuch.<br />
888 11 / 2011
Aktuelle<br />
Neuerscheinung<br />
Dieses Buch<br />
richtet sich an alle<br />
Rohrleitungspraktiker!<br />
Zahlreiche Beispiele aus der täglichen Arbeitspraxis helfen Ingenieuren<br />
und Technikern bei der Lösung ihrer betrieblichen Aufgabenstellungen.<br />
Alltägliche Rohrleitungsprobleme vom Druckverlust bis zur<br />
Kavitation in Pumpen, Blenden oder Regelventilen werden detailliert<br />
beschrieben. Dabei wird auf ausschweifende, akademische Ausführungen<br />
verzichtet. Vielmehr werden konkrete Lösungsansätze aufgezeigt<br />
und insbesondere auf relevante Einfl ussgrößen hingewiesen.<br />
Der praxisorientierte Charakter des Buchs veranschaulicht, dass die<br />
pragmatische Wissensvermittlung anhand konkreter Problematiken<br />
aus der Arbeitspraxis effektiver ist, als viele Seiten rein theoretischer<br />
Ausführungen.<br />
Die Rohrleitungsfi bel basiert <strong>im</strong> Wesentlichen auf den Berufserfahrungen<br />
sowie den Erkenntnissen aus Diskussionen aus den Seminaren<br />
über die Rohrleitungsplanung, die der Autor <strong>im</strong> Haus der Technik in<br />
Essen gehalten hat.<br />
M. Nitsche<br />
1. Aufl age 2011, 265 Seiten, Broschur<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 201 / 820 02 - 34 oder <strong>im</strong> Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex.<br />
Rohrleitungs-Fibel für die tägliche Praxis<br />
1. Aufl age 2011 – ISBN: 978-3-8027-2762-7<br />
zum Preis von € 79,- (zzgl. Versand)<br />
Die bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift<br />
von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen.<br />
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
PARLFI2011
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – brbv<br />
Spartenübergreifend<br />
Grundlagenschulungen<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Grundkurs<br />
17./18.11.2011 Gera<br />
08./09.12.2011 Gera<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Nachschulung<br />
02.12.2011 Gera<br />
Baustellenabsicherung und Verkehrssicherung<br />
RSA/ZTV-SA – 1 Tag<br />
08.11.2011 Ettersburg<br />
13.12.2011 Frankfurt/Main<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Spartenübergreifende Hausanschlusstechnik<br />
17.11.2011 Kassel<br />
Arbeitsvorbereitung und Kostenkontrolle<br />
<strong>im</strong> Rohrleitungsbau – Arbeitskalkulation<br />
16.11.2011 Hannover<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren<br />
– Fortbildungsveranstaltung nach GW 329<br />
07.12.2011 Kassel<br />
Arbeitssicherheit <strong>im</strong> Tief- und Rohrleitungsbau<br />
23.11.2011 Magdeburg<br />
15.12.2011 Kerpen<br />
Baurecht 2011<br />
16.11.2011 Magdeburg<br />
Kalkulationsgrundlagen<br />
06.12.2011 Berlin<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und Sanierung<br />
29.11.2011 Bad Vilbel<br />
Gas/Wasser<br />
GW 128 Grundkurs „Vermessung“<br />
9 Termine ab 07.11.2011 bundesweit<br />
GW 128 Nachschulung „Vermessung“<br />
11 Termine ab 02.11.2011 bundesweit<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
21.-25.11.2011 Würzburg<br />
21.-25.11.2011 Leipzig<br />
28.11.-02.12.2011 Hannover<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
23 Termine ab 07.11.2011 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerung<br />
64 Termine ab 01.11.2011 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Grundkurs<br />
21 Termine ab 02.11.2011 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Nachschulung<br />
23 Termine ab 04.11.2011 bundesweit<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
07.-09.11.2011 Rostock<br />
14.-16.11.2011 Gera<br />
Kunststoffrohrleger<br />
4 Termine ab 07.11.2011 bundesweit<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500<br />
Kap. 2.31<br />
24.11.2011 Magdeburg<br />
08.12.2011 Gütersloh<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und Wasserversorgung<br />
– Verlängerung zur GW 331<br />
17.11.2011 Kassel<br />
06.12.2011 Berlin<br />
Bau von Gas- und Wasserrohrleitungen<br />
22./23.11.2011 Potsdam<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
14./15.12.2011 Bad Vilbel<br />
Sachkundiger Gas bis 4 bar<br />
30.11.2011 Erfurt<br />
Sachkundiger Wasser – Wasserverteilung<br />
01.12.2011 Erfurt<br />
Fernwasserleitungen – Bau, Betrieb und<br />
Dienstleistungen<br />
13.12.2011 Karlsruhe<br />
Fachaufsicht für die Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 316-2<br />
30.11./01.12.2011 Koblenz<br />
Instandsetzung von Trinkwasserbehältern<br />
– Verlängerung zur W 316-2<br />
01.12.2011 Koblenz<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 – Qualitätsanforderungen<br />
für Rohrleitungsbauunternehmen<br />
03.11.2011 Augsburg<br />
Praxisseminare<br />
Druckprüfung von Gasrohrleitungen<br />
22.11.2011 Nürnberg<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
23.11.2011 Nürnberg<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500,<br />
Kap. 2.31 – Fachaufsicht<br />
07.-11.11.2011 Gera<br />
12.-16.12.2011 Gera<br />
Einführung in die Gasdruckregel- und<br />
Messtechnik<br />
07.-09.11.2011 Erfurt<br />
DVS 2202-1 – Beurteilung von Kunststoffschweißverbindungen<br />
15.11.2011 Kerpen<br />
01.12.2011 Mellendorf<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß<br />
DVGW-Merkblatt GW 15<br />
10.11.2011 Kerpen<br />
07.12.2011 Hamburg<br />
Fernwärme<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Bau und Sanierung von Nah- und Fernwärmeleitungen<br />
16./17.11.2011 Bremen<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
09.11.2011 Frankfurt/Main<br />
Kanalbau<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Aufbaulehrgang Kanalbau<br />
24.11.2011 Berlin<br />
Sanierung privater Abwasserkanäle<br />
16.11.2011 Wedemark<br />
Brunnenbau<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Qualitätssicherung und Risikomin<strong>im</strong>ierung<br />
bei Geothermiebohrungen und –anlagen<br />
04.11.2011 Kassel<br />
Betriebliche Management-Systeme (BMS)<br />
in Brunnenbau und Geothermieunternehmen<br />
17.11.2011 Stuttgart<br />
Kontaktadresse<br />
brbv<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
GmbH, Köln,<br />
Tel. 0221/37 658-20,<br />
E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
890 11 / 2011
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Lehrgänge – RSV<br />
Seminare<br />
Grundlagen Kanalbau<br />
21.11.2011 Lünen<br />
Sicherheitsunterweisung gemäß UVV und<br />
Ersthelferlehrgang<br />
17./18.11.2011 Lünen<br />
Abschlusslehrgang Fachkunde<br />
Kanalsanierung (RSV/SAG)<br />
14.-16.12.2011 Darmstadt<br />
Kontaktadresse<br />
RSV<br />
RSV – Rohrleitungssanierungsverband e. V.,<br />
49811 Lingen (Ems), Tel. 05963/9 81 08 77,<br />
Fax 05963/9 81 08 78, E-Mail: rsv-ev@<br />
t-online.de, www.rsv-ev.de<br />
Seminare – Verschiedene<br />
DVGW<br />
Intensivschulungen<br />
Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitung<br />
30.11.-02.12.2011 Ulm<br />
EW Medien und<br />
Kongresse<br />
Seminar<br />
Gütesicherung <strong>im</strong> Kabelleitungstiefbau und<br />
Querverbund<br />
14.-18.11.2011 Erfurt<br />
HDT<br />
Seminare<br />
ASME-Kenntnisse für die Anfrage zu<br />
Druckgeräten, Rohrleitungen mit Zubehör<br />
und Schweißkonstruktionen <strong>im</strong> Maschinenbau<br />
21.11.2011 Essen<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen und<br />
Rohrleitungen nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
29.11.2011 Essen<br />
Dichtungen – Schrauben – Flansche<br />
10.11.2011 Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
06./07.12.2011 Leibstadt, Schweiz<br />
07./08.02.2012 Essen<br />
20./21.03.2012 München<br />
Theorie und Praxis der Stopfbuchsen an<br />
Armaturen und Apparaten<br />
06.10.2011 Essen<br />
Projektmanagement <strong>im</strong> Anlagenbau: Teil 2<br />
– Qualität, Vertrag/Änderungen, Dokumentation,<br />
Recht, EDV und Beispiele<br />
10./11.10.2011 Essen<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
27.10.2011 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen <strong>im</strong> Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
23./24.11.2011 Essen<br />
Rohrleitungsplanung für Industrie- und<br />
Chemieanlagen<br />
24./25.11.2011 München<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen und<br />
Rohrleitungen nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
29.11.2011 Essen<br />
Forum Molchtechnik<br />
01./02.12.2011 Berlin<br />
Dichtungstechnik <strong>im</strong> Rohrleitungs- und<br />
Apparatebau<br />
08.12.2011 Essen<br />
TAE<br />
Seminare<br />
Kanalinstandhaltung<br />
09./10.11.2011 Ostfildern<br />
Spezialtiefbau<br />
14./15.11.2011 Ostfildern<br />
Hochspannungsbeeinflussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
02.12.2011 Ostfildern<br />
Mikrotunnelbau<br />
09.12.2011 Ostfildern<br />
TAH<br />
Seminare<br />
Lehrgang zum Zertifizierten Kanalsanierungs-Berater<br />
2011<br />
ab 10.10.2011 We<strong>im</strong>ar<br />
Instandhaltung von Abwasserkanalsystemen<br />
– Kanalsanierung von A bis Z<br />
28./29.09.2011 Hannover<br />
Auf den Punkt gebracht 2011<br />
08.11.2011 Münster<br />
09.11.2011 Rendsburg<br />
10.11.2011 Lüneburg<br />
23.11.2011 Mülhe<strong>im</strong>/Ruhr<br />
24.11.2011 L<strong>im</strong>burg/Lahn<br />
TAW<br />
Seminare<br />
KKS-Seminar für Fortgeschrittene (Teil 1)<br />
21.-23.11.2011 Wuppertal<br />
KKS-Seminar für Fortgeschrittene (Teil 2)<br />
23.-25.11.2011 Wuppertal<br />
Schweißtechnik an Rohren in der chemischen<br />
Industrie und <strong>im</strong> Anlagenbau<br />
01./02.02.2012 Wuppertal<br />
Rohrleitungen in verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
14./15.03.2012 Wuppertal<br />
Kathodischer Korrosionsschutz unterirdischer<br />
Anlagen (Grundlagenseminar)<br />
14.-16.03.2012 Wuppertal<br />
Kontaktadresse<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V., Bonn; Tel. 0228/9188-607,<br />
Fax 0228/9188-997, E-Mail: splittgerber@<br />
dvgw.de, www.dvgw.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik, Essen; Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
TAE<br />
Technische Akademie Esslingen e.V., Heike Baier,<br />
Tel. 0711/3 40 08-0, Fax 0711/3 40 08-27,<br />
E-Mail: heike.baier@taw.de, www.tae.de<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.;<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
TAW<br />
Technische Akademie Wuppertal;<br />
Dr.-Ing. Ulrich Reith,<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
11 / 2011 891
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Messen und Tagungen<br />
1. Praxistag Wasserversorgungsnetze – Leckortung und<br />
Netzopt<strong>im</strong>ierung<br />
08.11.2011 in Essen; Vulkan-Verlag, Barbara. Pflamm, Tel. 0201/<br />
82002-28, Fax 0201/82002-40, E-Mail: b.pflamm@<br />
vulkan-verlag.de<br />
Pipeline Symposium 2011 – Pipelines – weit mehr als<br />
Transportleitungen<br />
14./15.11.2011 in Hamburg; TÜV NORD Akademie, Clarissa Jakubzig,<br />
Tel. 040/8557-2920, E-Mail: cjakubzig@tuev-nord.<br />
de oder Meike Langmann, Tel. 040/8557-2046, E-<br />
Mail: mlangmann@tuev-nord.de, Fax 040/8557-2958,<br />
www.tuevnordakademie.de<br />
ROHRBAU We<strong>im</strong>ar<br />
21./22.11.2011 Kongress mit Fachausstellung; figawa Service GmbH, Gabriele<br />
Borkes, Tel. 0221/37658-46, Fax 0221/37658-<br />
63, E-Mail: borkesborkes@figawaservice.de, www.brbv.de<br />
Forum Wasseraufbereitung 2011<br />
24.11.2011 in Mülhe<strong>im</strong>/Ruhr; IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für Wasserforschung, Fax: 0208/40303-82, Frau Servatius,<br />
E-Mail: h.servatius@iww-online.de, oder Frau Bonorden,<br />
E-Mail: s.bonorden@iww-online.de<br />
Forum Molchtechnik<br />
01./02.12.2011 in Berlin; Haus der Technik Essen, Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
Tagung Rohrleitungsbau<br />
24./25.01.2012 in Berlin; figawa Service GmbH, Gabriele Borkes, Tel.<br />
0221/37658-46, Fax 0221/37658-63, E-Mail:<br />
borkes@figawaservice.de, www.brbv.de<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012<br />
09./10.02.2012 IRO GmbH Oldenburg, Tel. 0441/36 10 39-0, Fax<br />
0441/36 10 39–10, E-Mail: info@iro-online.de, www.<br />
iro-online.de<br />
IFAT 2012<br />
07.-11.05.2012 in München; Messe München GmbH, Tel. 089/9 49-113<br />
58, Fax 089/9 49-113 59, E-Mail: info@ifat.de, www.<br />
ifat.de<br />
ACHEMA 2012<br />
18.-22.06.2012 in Frankfurt/Main; DECHEMA, Dr. Kathrin Rübberdt, Tel.<br />
069/7564-277/-296, Fax: 069/7564-272, E-Mail:<br />
presse@dechema.de, www.achema.de<br />
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 835<br />
7th Pipeline Technology Conference 2012, Hannover 793<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012, Oldenburg 787<br />
WILHELM EWE GmbH & Co. KG, Braunschweig 805<br />
PRIME DRILLING GmbH, Wenden 885<br />
PSI Products GmbH, Mössingen<br />
REW Istanbul 2012, Istanbul, Türkei<br />
Titelseite<br />
4. Umschlagseite<br />
Steinzeug Abwassersysteme GmbH, Frechen 791<br />
Marktübersicht 849–858<br />
892 11 / 2011
Impressum<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49(0)201-82002-0, Telefax +49(0)201-82002-40.<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke,<br />
Hans-Joach<strong>im</strong> Jauch<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56,<br />
45128 Essen, Telefon +49(0)201-82002-33,<br />
Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Telefon +49(0)201-82002-<br />
35, Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer, Vulkan-Verlag/Oldenbourg Industrieverlag<br />
GmbH, Telefon +49(0)89-45051-471, Telefax +49(0)89-<br />
45051-300, E-Mail: mittermayer@oiv.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL, Postfach 91 61, 97091<br />
Würzburg, Telefon +49(0)931-4170-1616, Telefax +49(0)931-<br />
4170-492, E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Gestaltung, Satz und Druck<br />
Gestaltung: deivis aronaitis design I dad I,<br />
Leonrodstraße 68, 80636 München<br />
Satz: e-Mediateam Michael Franke, Breslauer Str. 11,<br />
46238 Bottrop<br />
Druck: Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben <strong>im</strong> Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 263,- + € 27,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 263,- + € 31,50 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 34,- +<br />
€ 3,- Versand; Einzelheft (Ausland): € 34,- + € 3,50 Versand;<br />
Einzelheft als ePaper (PDF): € 34,-; Studenten: 50 % Ermäßigung<br />
auf den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten<br />
bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede Buchhandlung<br />
möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der<br />
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zust<strong>im</strong>mung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Auch die<br />
Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung,<br />
<strong>im</strong> Magnettonverfahren oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede <strong>im</strong> Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung<br />
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der<br />
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen <strong>im</strong> Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V., Köln · Rohrleitungsbauverband<br />
e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband e.V., Essen ·<br />
Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten, Gasmeßund<br />
Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Europipe<br />
GmbH, Mülhe<strong>im</strong> · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld, Vorsitzender des<br />
Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik<br />
und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) · Dipl.-Ing. K. Küsel, Heinrich<br />
Scheven Anlagen-und Leitungsbau GmbH, Erkrath · Dipl.-Volksw. H. Zech,<br />
Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln · Rechtsanwalt<br />
C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing. Th. Grage,<br />
Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen · Dr.-Ing.<br />
A. Hilgenstock, E.ON Ruhrgas AG, Technische Kooperationsprojekte, Kompetenzcenter<br />
Gastechnik und Energiesysteme /(Netztechnik), Essen · Dipl.-<br />
Ing. D. Homann, IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, RWE –<br />
Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH, Dortmund · Dipl.-Ing.<br />
J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe<br />
GmbH, Mülhe<strong>im</strong> · Dr. H.-C. Sorge, IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für Wasser, Biebeshe<strong>im</strong> · Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und Rohrleitungsbau<br />
e.V., We<strong>im</strong>ar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter<br />
des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen · Dipl.-Ing.<br />
D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG · W. Burchard, Geschäftsführer<br />
des Fachverbands Armaturen <strong>im</strong> VDMA, Frankfurt · Bauassessor<br />
Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Köln ·<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren ·<br />
Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes<br />
e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn, BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing.<br />
B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure GmbH, München · Dr.-Ing. W. Lindner,<br />
Vorstand des Erftverbandes, Berghe<strong>im</strong> · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer<br />
des Kunststoffrohrverbands e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß,<br />
Mitglied des Vorstandes, FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD<br />
Systems GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der<br />
Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V., Grieshe<strong>im</strong> · Dipl.‐Berging.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Prokurist der AR-<br />
KIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener, Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg · Prof. Dr.-Ing. B. Wielage,<br />
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische Universität Chemnitz-Zwickau<br />
· Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer Geschäftsführer der Salzgitter<br />
Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen