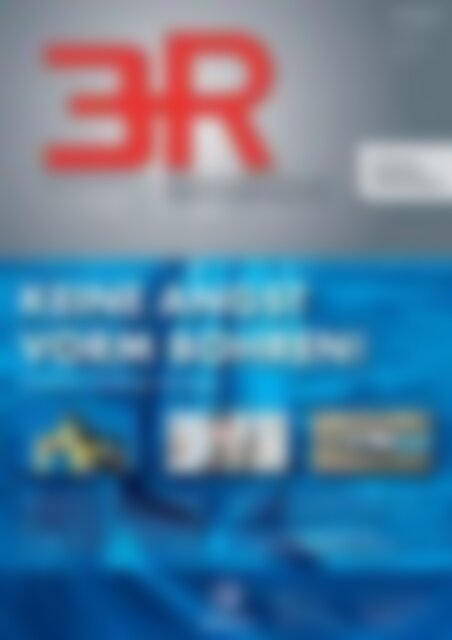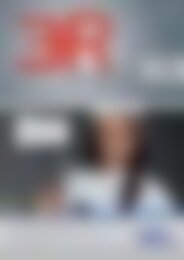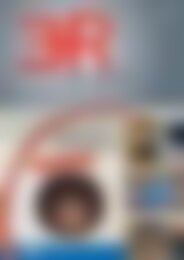3R Neue Herausforderungen erfordern neue Wege (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8-9/2011<br />
ISSN 2191-9798<br />
K 1252 E<br />
Vulkan-Verlag,<br />
Essen<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Schwerpunkt:<br />
Grabenloser<br />
Rohrleitungsbau<br />
KEINE ANGST<br />
VORM BOHREN!<br />
Produkte, Beratung, Lösungen.<br />
Als Marktführer für Rohre mit Schutzeigenschaften<br />
beraten wir Sie bei der Planung<br />
und Durchführung von Rohrleitungsprojekten.<br />
Wir zeigen Ihnen die Potentiale für kostengünstiges<br />
Bauen: Verzicht auf Einsandung,<br />
Rohrbündel, Nutzung bestehender Trassen,<br />
Pflügen, Fräsen, Bersten und Bohren...<br />
Mehr auf www.egeplast.de<br />
und www.webkalkulator24.de<br />
egeplast<br />
Werner Strumann<br />
GmbH & Co. KG<br />
Robert-Bosch-Straße 7<br />
48268 Greven, Germany<br />
Tel.: +49.2575.9710-0<br />
Fax: +49.2575.9710-110<br />
info@egeplast.de<br />
www.egeplast.de
1. Praxistag Wasserversorgungsnetze<br />
Leckortung und<br />
Netzoptimierung<br />
am 8. November 2011 in Essen<br />
Programm<br />
Moderation:<br />
Prof. Th. <strong>Wege</strong>ner, iro<br />
Wann und Wo?<br />
Themenblock 1: Wasserverlustmanagement<br />
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen<br />
im Wasserverlustmanagement<br />
Dr. J. Kölbl, Salzburg (A)<br />
Erfahrung der Rohrnetzhydraulik –<br />
Nutzen für das Asset Management<br />
Dr. Osmancevic, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Asset Management – Rehabilitationsplanung<br />
Dr. G. Gangl, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Themenblock 2: Leckortung – Messtechnik<br />
„Wasser“ – vom Bewusstsein zur Verlustanalyse<br />
J. Kurz, SebaKMT, Baunach<br />
Permanente Leckortung –<br />
Verfahren zur Reduzierung von Wasserverlusten<br />
D. Becker, Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh<br />
Themenblock 3: Erfahrungen von Netzbetreibern<br />
Leckortung in Wasserverteilnetzen<br />
Ulrich Zigan, Stadtwerke Essen AG, Essen<br />
Leckageortung an Wassertransportleitungen am Beispiel<br />
der Hauptleitung 3 der Landeswasserversorgung<br />
Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh,<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, ZfW, iro<br />
Termin: Mittwoch, 08.11.2011,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Essen, Welcome Hotel Essen<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken und<br />
Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich Netzinspektion<br />
und -wartung<br />
Teilnahmegebühr:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 350,- €<br />
Nichtabonnenten: 390,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
Themenblock 4: Entstördienst, Wiederinbetriebnahme<br />
Optimierung des Entstördienstes<br />
J. Treiber, Friatec AG, Mannheim<br />
Reinigung, Desinfektion und Armatureninspektion<br />
Dr. N. Klein, Hammann GmbH, Annweiler am Trifels<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-55 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
Editorial<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Herausforderungen</strong><br />
<strong>erfordern</strong> <strong>neue</strong> <strong>Wege</strong><br />
Seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts<br />
haben innovative Firmen zum Teil unter Mitwirkung<br />
von Auftraggebern versucht, marode<br />
Rohrleitungssysteme der Gas- und Trinkwasserversorgung<br />
mittels grabenloser Technologien<br />
wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand<br />
zu versetzen. Besonders intensiv ist die Entwicklung<br />
ab den 80er Jahren vorangeschritten,<br />
wobei später zunehmend auch die Sanierung<br />
der Kanalisation in den Fokus der Entwickler<br />
geriet.<br />
Sehr bald wurde erkennbar, dass für diese<br />
Verfahren – vergleichbar zum Neubau – allgemeine<br />
Standards zur Qualitätssicherung erforderlich<br />
waren, um für alle Bieter und Auftraggeber<br />
vergleichbare Bedingungen am Markt zu<br />
schaffen.<br />
Im Jahr 1992 haben sich deshalb die führenden<br />
Sanierungsfirmen in Deutschland zum<br />
„Rohrleitungssanierungsverband“ (RSV) zusammengeschlossen.<br />
Wichtigste Ziele des RSV waren (und sind)<br />
die Qualitätssicherung, die Definition von Regeln<br />
und Standards, die Förderung moderner<br />
Verfahren und technischer Innovationen. Dazu<br />
wurden in den Gründerjahren vor allem die<br />
Firmen aufgerufen, die bereits entsprechende<br />
Erfahrungen mitbrachten und die wirtschaftliche<br />
Kraft hatten, einen Beitrag zur Umsetzung<br />
der genannten Ziele zu leisten. Zum damaligen<br />
Zeitpunkt sicherlich der richtige Ansatz.<br />
Führte das doch zu einer ausgewogenen<br />
Zusammenarbeit bei der Erstellung erster eigener<br />
Qualitätsrichtlinien und bei der Mitwirkung<br />
an der Schaffung von Standards anderer<br />
Verbände.<br />
Knapp 20 Jahre später haben sich die Rahmenbedingungen<br />
geändert. Die Sanierungsverfahren<br />
sind fester Bestandteil der Er<strong>neue</strong>rungsstrategien<br />
rohrleitungsgebundener Verund<br />
Entsorgungssysteme und die Qualitätsstandards<br />
haben ein hohes Niveau erreicht. Der<br />
RSV und vor allem aber seine Mitglieder haben<br />
daran einen entscheidenden Anteil.<br />
In unserem Verband sind Hersteller, Planungsbüros<br />
und ausführende Firmen vertreten.<br />
Viele von ihnen verfügen über jahrzehntelange<br />
Erfahrungen in der Vorbereitung und Umsetzung<br />
von Sanierungsprojekten. Das heißt, im<br />
RSV konzentriert sich ein großer Teil des praktisch<br />
fundierten Fachwissens in Deutschland.<br />
Natürlich sind wir uns der Tatsache bewusst,<br />
dass das Potenzial der Sanierungsverfahren<br />
noch lange nicht voll ausgeschöpft wird.<br />
Dazu bedarf es ganz offensichtlich weiterer<br />
Anstrengungen, die wir zukünftig gern auf<br />
noch mehr Schultern verteilen würden. Das<br />
heißt nichts anderes, als dass der RSV aktiv<br />
<strong>neue</strong> Mitglieder werben möchte. Jede Firma,<br />
die sich mit der Rohrsanierung beschäftigt, ist<br />
im Rohrleitungssanierungsverband als Mitglied<br />
herzlich willkommen und kann die Kraft der<br />
Gemeinschaft nutzen um aktiv an der Erhöhung<br />
der Marktakzeptanz und damit auch der<br />
Nachfrage grabenloser Sanierungsverfahren<br />
mitzuwirken.<br />
Das Bemühen vieler Gremien, die Qualität<br />
der Sanierung zu regeln, hat aber auch dazu<br />
geführt, dass inzwischen zahlreiche Merk- und<br />
Arbeitsblätter im Umlauf sind, die sich bei näherer<br />
Betrachtung nicht wirklich voneinander<br />
unterscheiden. Wie sollten sie auch?<br />
Wir suchen deshalb die Zusammenarbeit<br />
mit anderen Verbänden, um das Fachwissen<br />
weiter zu bündeln, die Aktualisierung bestehender<br />
und die Erarbeitung <strong>neue</strong>r Standards zu<br />
vereinfachen und zu vereinheitlichen sowie den<br />
zeitlichen und monetären Aufwand der Firmen<br />
für Zertifizierungen, Gütezeichen und ähnlicher<br />
Nachweise zu optimieren, ohne dass die Qualität<br />
darunter leidet.<br />
Keine leichte Aufgabe, wie sich bisher gezeigt<br />
hat, geht es doch auch darum, Verbandsinteressen<br />
einer gemeinsamen Zielstellung zumindest<br />
teilweise unterzuordnen. Abgrenzung<br />
hingegen führt zu Wettbewerb, der an dieser<br />
Stelle dem Grundanliegen eher nicht dienlich<br />
ist.<br />
Dass es funktionieren kann, zeigt unsere<br />
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem VDRK<br />
und DIN certco bei der Zertifizierung von Unternehmen<br />
im Bereich der Grundstücksentwässerung.<br />
Dipl.-Ing. Lutz Kretschmann<br />
Vorstandsvorsitzender des RSV<br />
8-9 / 2011 585
8-9/2011<br />
Inhalt<br />
S. 590 S. 596<br />
S. 608<br />
Editorial<br />
585 <strong>Neue</strong> <strong>Herausforderungen</strong><br />
<strong>erfordern</strong> <strong>neue</strong> <strong>Wege</strong><br />
Lutz Kretschmann<br />
Nachrichten<br />
Industrie und Wirtschaft<br />
590 HDD-Bohrzubehör online<br />
590 Steinzeug-Übernahme von EuroCeramic perfekt<br />
591 KESSEL erweitert Entwicklungskapazitäten<br />
592 Nord Stream-Pipeline mit OPAL verbunden<br />
592 GECO-Bildwettbewerb – „Bizzarres Zerstörungswunder“<br />
593 SIMONA mit deutlicher Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2011<br />
593 DIBt er<strong>neue</strong>rt Zulassung für BIRCO-Rinnensysteme<br />
594 Swietelsky-Faber eröffnet <strong>neue</strong> Niederlassung in Leipzig<br />
594 <strong>Neue</strong> Unternehmensstrategie bei der Reinigung von TW-Verteilungsleitungen<br />
Verbände und Organisationen<br />
595 geofora 2012 erwartet rund 600 Teilnehmer<br />
596 German Water Partnership unterwegs mit Bundesentwicklungsminister<br />
Dirk Niebel<br />
597 Gütesicherung Grundstücksentwässerung<br />
600 RSV-News – Anforderungsprofil für GFK-Rohre überarbeitet<br />
Personalien<br />
601 Prof. Dr.-Ing. Klaus Homann mit Bunsen-Pettenkofer-Ehrentafel ausgezeichnet<br />
Faszination Technik<br />
626 „Ein heißes Eisen“<br />
Über die Geschichte des<br />
Gussrohrs<br />
Veranstaltungen<br />
602 Abwassersysteme im Fokus der Nachhaltigkeit<br />
602 Deutschland mit zwei Gruppenständen auf der ECWATECH 2012<br />
604 15. Workshop Kolbenverdichter 2011<br />
605 IKV-Erfahrungsaustausch bei PLASSON in Wesel<br />
605 Industrietage Wassertechnik<br />
586 8-9 / 2011
BUILT TO<br />
RESIST<br />
S. 629<br />
Normen & Regelwerk<br />
Fachbericht<br />
608 <strong>Neue</strong> Gesetze verändern die Energiebranche<br />
Von Christian Fürst<br />
Fachbericht<br />
610 Rohrleitungssysteme aus GfK<br />
Von Achim Dörfler und Marcus Demetz<br />
Fachbericht<br />
618 Die bruchmechanischen Eigen schaften der<br />
Polyolefine - Sind die in den Normen vorgesehenen<br />
Anwendungsbereiche realistisch?<br />
Von H.-J. Kocks, C. Bosch, M. Betz<br />
Produkte & Verfahren<br />
PAS<br />
1075<br />
629 Max Wild entwickelt umweltfreundliche<br />
250-Tonnen-Horizontalbohranlage<br />
630 Gegen Geruch und biogene Schwefelwasserstoffkorrosion<br />
630 <strong>Neue</strong> Rohrgeneration mit erhöhter Abriebfestigkeit<br />
631 RAUDRIL Rail erhält Eisenbahn-Bundesamt-<br />
Zulassung<br />
632 <strong>Neue</strong>ste Techniken für die grabenlose Verlegung<br />
und Er<strong>neue</strong>rung von Rohrleitungen<br />
632 <strong>Neue</strong>s Wasserlecksuchgerät von SEWERIN<br />
Absolut rissbeständig:<br />
SIMONA®PE 100-RC Rohre<br />
Speziell für alternative Verlege- und Sanierungsverfahren<br />
entwickelt, leisten Rohrsysteme von<br />
SIMONA hohen Widerstand gegen langsames und<br />
schnelles Risswachstum. Die nach PAS 1075<br />
Typ 3 zertifizierten Schutzmantelrohr systeme bieten<br />
zusätzlich höchste Sicherheit bei Punktlasten.<br />
Mehr dazu unter: www.simona.de/simona-rc<br />
8-9 / 2011 587
8-9/2011<br />
Inhalt<br />
S. 638 S. 662 S. S. 672 350<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Fachbericht<br />
634 Erdgas aus Deutschland – sicher, sinnvoll und umweltverträglich<br />
Josef Schmid<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
638 <strong>Neue</strong> Gas-Hochdruckleitung verbindet Spenge und Bünde<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
640 Erdverkabelung im Fels unter ICE Strecke, Autobahn und Landstraße<br />
Wasserversorgung<br />
Fachbericht<br />
642 Optimierung der Wasserversorgungsanlagen unter Anwendung des<br />
TASI-Moduls<br />
Von Esad Osmancevic und Marius Greza<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
648 Spezialanwendung demineralisiertes Prozesswasser<br />
Services<br />
651 Marktübersicht<br />
685 Praxis-Tipps<br />
686 Terminkalender<br />
3.US Impressum<br />
Abwasserentsorgung<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
662 Sanierung eines Mischwasserkanals DN 300 mit<br />
Burstform-Umformtechnik<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
664 Gut gewickelt unter dem Leuzetunnel<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
668 <strong>Neue</strong> Abwasserleitungen für die Düsseldorfer Altstadt<br />
588 8-9 / 2011
Abwasserentsorgung<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
670 Schlauchliner-Sanierung am Heidelberger<br />
Schloss<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
672 AXEO Brumath realisiert bislang größtes<br />
Schlauchlining-Projekt in Frankreich<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
675 Dauerbeständige Schachteinbindung – Kaiserslauterns<br />
Schlauchliner sehen „rot“<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
678 Sanierung eines Haubenkanals 2525/2290 mm<br />
mit Spritzbeton<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
680 Staukanal und Pumpwerk aus GFK<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
682 Er<strong>neue</strong>rung der Schmutz- und Regenwasserkanäle<br />
entlang der Bundesstraße B 417<br />
S. 680<br />
Part of<br />
The world’s leading trade event<br />
for process, drinking and waste water<br />
More than 800 exhibitors from 40 countries<br />
Outstanding water projects in the spotlight<br />
Network with thousands of colleagues<br />
Special attention for industrial use of water<br />
Register for free entrance<br />
www.amsterdam.aquatechtrade.com<br />
Organised by:<br />
Co-located with:<br />
Supported by:<br />
8-9 / 2011 589
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
HDD-Bohrzubehör online<br />
Am 18.08.2011 hat die TRACTO-TECHNIK ihre <strong>neue</strong><br />
Webseite für HDD-Bohrzubehör unter der Adresse<br />
www.hdd-bohrzubehoer.de gestartet. Der Hersteller<br />
von grabenlosen Rohrverlegesystemen gibt in seinem<br />
Online-Katalog einen umfassenden und systematischen<br />
Überblick über sein Zubehör für die HDD-Spülbohrsysteme.<br />
Die von der TRACTO-TECHNIK-Homepage getrennte<br />
Webseite ist erstellt worden, um direkt ohne Umwege<br />
auf das Zubehör zugreifen zu können. Des Weiteren<br />
lässt sich die <strong>neue</strong> Homepage im Bedarfsfall schneller auf<br />
den aktuellsten Stand bringen als der bisherige Printkatalog.<br />
Auf der <strong>neue</strong>n Webseite sind nunmehr über 300<br />
Zubehörartikel (Bohrköpfe, Backreamer, Ortungstechnik<br />
usw.) erfasst und können online ausgewählt und preislich<br />
angefragt werden. Wichtige Zubehörartikel sind dreidimensional<br />
dargestellt, so dass sie von allen Seiten angesehen<br />
und durch den Zoom im Detail betrachtet werden<br />
können. Ergänzt wird der Online-Katalog ab Ende August<br />
2011 um eine Druckfunktion, mit der sich das HDD-Zubehör<br />
als kompletter Katalog ausdrucken lässt.<br />
Zeitgleich startet TRACTO-TECHNIK die Seite auch<br />
in Englisch unter www.directional-drilling-accessories.<br />
com.<br />
Schnell und umfassend informieren mit der <strong>neue</strong>n<br />
Tracto-Technik-Webeite www.hdd-bohrzubehoer.de<br />
Steinzeug-Übernahme von EuroCeramic perfekt<br />
Mit Wirkung vom 31. Juli dieses Jahres ist<br />
die Akquisition der EuroCeramic durch die<br />
STEINZEUG Abwassersysteme GmbH nach<br />
der kartellrechtlichen Genehmigung durch<br />
die zuständigen Behörden nun unter Dach<br />
und Fach. Damit übernimmt die Wienerberger-Tochter<br />
sämtliche Steinzeug-Aktivitäten<br />
von Wavin auf dem kontinental-europäischen<br />
Markt.<br />
Gernot Schöbitz, Geschäftsführer der<br />
STEINZEUG Abwassersysteme GmbH, sieht<br />
die Transaktion in vielerlei Hinsicht sehr positiv<br />
und optimistisch: „Unser vorrangiges<br />
Ziel ist eine rasche Integration von Euro-<br />
Ceramic in das Unternehmen STEINZEUG,<br />
wobei wir Integration nicht als Unterordnung<br />
verstehen, sondern als Zusammenführung,<br />
als Ergänzung, als Bündelung der<br />
Stärken zweier Unternehmen. Die Produktionsstätte<br />
von EuroCeramic in Belfeld<br />
wird weiter betrieben, die Marke EuroCeramic<br />
beibehalten, das Rohrsystem-Sortiment<br />
sinnvoll erweitert und hinsichtlich<br />
des Schachtangebotes können wir unsere<br />
Kompetenz noch deutlich ausbauen. Wir<br />
arbeiten derzeit an einem entsprechenden<br />
Vertriebs- und Markenkonzept, um das erweiterte<br />
Produktsortiment erfolgreich im<br />
Markt umsetzen zu können.“<br />
Weiterhin gilt die Konzentration auf<br />
die Vorzüge und Vorteile der Produkte aus<br />
Steinzeug, ihre Entwicklung und die notwendigen<br />
Innovationen zum weiteren Ausbau<br />
des Marktes. Das umfangreiche Sortiment<br />
hochwertiger und nachhaltiger Abwasser-Rohrsysteme<br />
des Unternehmens<br />
STEINZEUG vergrößert sich um eine weitere<br />
Produktlinie: „Cradle to Cradle“-zertifizierte<br />
Steinzeugrohre von EuroCeramic<br />
(Cradle to Cradle ist ein internationaler<br />
Nachhaltigkeitsstandard, der von der EPEA<br />
internationale Umweltforschung vergeben<br />
wird.)<br />
Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger<br />
AG, kommentiert den Kauf der EuroCeramic<br />
durch das Tochterunternehmen STEIN-<br />
ZEUG entsprechend positiv. Für Wienerberger<br />
sind zum einen die strategischen Hintergründe<br />
sehr wichtig, zum anderen die<br />
Sortimentserweiterung eines nachhaltigen<br />
Produkts: „Mit dieser Transaktion ist uns<br />
ein wichtiger Schritt zum Ausbau unserer<br />
Marktposition gelungen. Wir haben damit<br />
eine starke Basis für weiteres Wachstum<br />
im Bereich keramischer Rohrsysteme geschaffen,<br />
die ein qualitativ hochwertiges<br />
Nischenprodukt mit herausragenden Materialeigenschaften<br />
wie Druckfestigkeit und<br />
Dichtheit, verbunden mit hoher Verschleißund<br />
Korrosionsfestigkeit, sowie einer außerordentlich<br />
langen Lebensdauer sind.<br />
Mit der Zusammenführung der STEIN-<br />
ZEUG Abwassersysteme GmbH und der EuroCeramic<br />
etabliert sich für den kontinental-europäischen<br />
und den internationalen<br />
Markt ein sehr schlagkräftiges Unternehmen,<br />
mit dem das vorhandene Marktpotenzial<br />
in bestmöglicher Weise genutzt und die<br />
Kunden optimal bedient werden können.“<br />
590 8-9 / 2011
KESSEL erweitert Entwicklungskapazitäten<br />
Der Entwässerungsspezialist KESSEL hat<br />
sein Entwicklungszentrum, in dem rund<br />
50 Mitarbeiter tätig sind, für 1,5 Mio. Euro<br />
erweitert. „Unser Unternehmen steht<br />
für Innovation und Entwicklung. Um unsere<br />
hohen Standards zu halten und zur stetigen<br />
Verbesserung unserer Produkte, haben<br />
wir in ein hochmodernes Entwicklungszentrum<br />
investiert“, sagt Edgar Thiemt, Vorstand<br />
Technik und Finanzen.<br />
Das Entwicklungszentrum wurde um<br />
350 m 2 erweitert, neben Büroräumen für<br />
die Entwicklung und das Produktmanagement<br />
wurde vor allem in einen hochmodernen<br />
Versuchsbereich investiert. In diesem<br />
werden beispielsweise Rückstau-Dauerversuche,<br />
Volumenmessungen bei Pumpen<br />
und Dichtheitsprüfungen durchgeführt. Im<br />
Freien hat das Unternehmen ein Prüffeld<br />
gebaut. Unter realistischen Bedingungen<br />
können dort in verschiedenen Versuchsgruppen<br />
Produkte für den Erdeinbau wie<br />
Abscheider- und Kleinkläranlagen getestet<br />
werden. Unter anderem wird geprüft,<br />
Im Stresstest:<br />
Ein eigens entwickelter<br />
Prüfstand<br />
sorgt für<br />
höchste Qualitätsstandards<br />
bei den Ecolift-<br />
Rückstauhebeanlagen<br />
wie leistungsfähig die Behälter sind, also<br />
beispielsweise wie grundwasserbeständig.<br />
Auch lässt sich die Abflussleistung bei Abläufen<br />
testen, Prüfungen bis zu einer Leistung<br />
von 50 l/s sind nun möglich.<br />
Trotz steigender Exportzahlen und eines<br />
weltweiten Vertriebsnetzes in mehr<br />
als 30 Ländern bleibt das Unternehmen<br />
Deutschland als Produktionsstandort<br />
treu. Auch zukünftig möchte der Entwässerungsspezialist<br />
weiter in den Stammsitz<br />
investieren und so die rund 400 Arbeitsplätze<br />
in Lenting sichern.<br />
Verantwortung für<br />
unsere Umwelt.<br />
• ökologisch<br />
• langlebig<br />
• sicher<br />
Kompetent in der<br />
kommunalen<br />
Abwasserentsorgung.<br />
• wartungsarm<br />
• biegesteif<br />
• belastbar<br />
Qualität, die überzeugt:<br />
Steinzeug<br />
8-9 / 2011 591<br />
www.steinzeug-keramo.com
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Nord Stream-Pipeline mit OPAL verbunden<br />
Die Direktverbindung zwischen den großen<br />
russischen Lagerstätten in Sibirien und dem<br />
europäischen Erdgasmarkt steht: Der erste<br />
Rohrstrang der Nord Stream-Pipeline ist<br />
jetzt mit der Erdgasleitung OPAL (Ostsee-<br />
Pipeline-Anbindungs-Leitung) verbunden<br />
worden. „Das Pipelinesystem ist nun für<br />
die nächsten komplexen Schritte der Inbetriebnahme<br />
bereit, so dass wir im vierten<br />
Quartal 2011 den ersten Strang der Nord<br />
Stream wie geplant in Betrieb nehmen können“,<br />
so Dr. Georg Nowack, Projektleiter der<br />
Nord Stream AG für Deutschland. „Die Anschlussleitung<br />
OPAL, die das Erdgas aus der<br />
Nord Stream-Pipeline zum Weitertransport<br />
übernimmt, ist bereits fertig gestellt“, erklärte<br />
Bernd Vogel, Geschäftsführer der<br />
Fakten zum Schweißen<br />
Der Rohrabschnitt in Lubmin hat<br />
einen Durchmesser von 900 Millimeter<br />
(36 Zoll)<br />
Schweißverfahren: Metallaktivgasschweißen<br />
(MAG) unter Schutzgas<br />
(Argon), halbautomatisch<br />
Anzahl der geschweißten Lagen: acht<br />
(Wurzel, Hotpass, fünf Füllnähte und<br />
eine Decknaht)<br />
Die Verbindungsschweißnaht hat<br />
insgesamt eine Länge von 2,8 m<br />
Der gesamte Schweißvorgang dauert<br />
rund drei Stunden<br />
Nach dem Schweißen wird die Naht<br />
per Ultraschall auf mögliche Fehler<br />
geprüft<br />
Der gesamte Schweißvorgang einer Naht dauerte rund drei<br />
Stunden, anschließend wird die Naht per Ultraschall auf mögliche<br />
Fehler untersucht<br />
OPAL NEL TRANSPORT<br />
GmbH, einem Unternehmen<br />
der WINGAS-Gruppe,<br />
das die Anschlussleitung<br />
betreiben wird. „Somit stehen<br />
wir bereit. Das russische<br />
Erdgas kann kommen.“<br />
Die letzte Verbindungsschweißnaht<br />
zwischen dem<br />
ersten Strang der Nord<br />
Stream und der OPAL-Leitung<br />
wurde auf dem Gelände<br />
der Erdgasübernahmestation<br />
in Lubmin bei<br />
Greifswald, wo die Pipeline<br />
die deutsche Küste erreicht,<br />
vorgenommen. Über 200<br />
Mitarbeiter regionaler und<br />
überregionaler Unternehmen<br />
sind derzeit auf dem rund 12 Hektar<br />
großen Gelände im Bereich des Lubminer<br />
Hafens tätig, um die Übernahmestation für<br />
den späteren Betrieb vorzubereiten. Insgesamt<br />
investieren die beteiligten Unternehmen<br />
allein in Lubmin rund 100 Millionen Euro.<br />
An der Nord Stream-Pipeline sind neben<br />
der OAO Gazprom die BASF-Tochter Wintershall<br />
Holding GmbH und die E.ON Ruhrgas<br />
AG, die niederländische N.V. Nederlandse<br />
Gasunie und GDF SUEZ aus Frankreich<br />
beteiligt. An der Anschlussleitung OPAL hält<br />
die WINGAS-Gruppe 80 % und die E.ON<br />
Ruhrgas AG 20 %.<br />
Die Erdgasleitung OPAL wurde bereits<br />
vor gut einem Monat fertig gestellt. Inzwischen<br />
ist die Pipeline mit Gas befüllt worden<br />
und steht bereit, das Nord Stream-Gas<br />
in die Tschechische Republik weiterzuleiten.<br />
Vor wenigen Tagen wurde der erste<br />
Strang der 1.224 km langen Nord Stream-<br />
Pipeline sowohl in Russland als auch in Lubmin<br />
an den jeweiligen Anlandebereich angebunden.<br />
„Die Rohrleitung durch die Ostsee<br />
ist bereits druckgeprüft, entwässert<br />
und getrocknet und wird seit dem 22. August<br />
komplett mit Stickstoff gefüllt, der als<br />
Sicherheitspuffer zwischen Luft und Gas<br />
dient“, erläutert Nord Stream-Projektleiter<br />
Nowack. Dem schließe sich dann die<br />
schrittweise Befüllung der Pipeline mit<br />
Erdgas von Russland aus an, so dass der<br />
erste Strang der Nord Stream pünktlich<br />
betriebsbereit sein werde.<br />
GECO-Bildwettbewerb – „Bizzarres Zerstörungswunder“<br />
Sie schützt, aber überwiegend vernichtet<br />
sie: Korrosion. Sie ist hässlich, doch sie<br />
bringt beeindruckende Formen und Farben<br />
hervor. Ihre bizzarre Schönheit erkennt<br />
man oft erst bei genauer Betrachtung und<br />
bei besonderem Licht. Abwasseranlagen<br />
sind mikrobakteriell, und Biogasanlagen<br />
verfahrenstechnisch verursachter Schwefelsäurekorrosion<br />
ausgesetzt. Ein großes<br />
Problem für Umwelt & Ressourcen … und<br />
dennoch mit bizarrer Schönheit im Detail.<br />
Unter dem Thema: „BIZZARRES ZER-<br />
STÖRUNGSWUNDER“ startete der GECO<br />
e.V., Gera einen ungewöhnlichen, wie spannenden<br />
Wettbewerb mit künstlerischem<br />
Anspruch, bei dem man nicht Künstler<br />
sein muss. Einen Blick für das Besondere<br />
ist dennoch angebracht, um Spannung bei<br />
Betrachter zu erzeugen.<br />
Das Ziel: „Zeigen Sie die Widersprüche<br />
des bizarren Zerstörungswunders in<br />
beeindruckenden, einmaligen Bildern, mit<br />
künstlerischen Anspruch. Teilnehmen darf<br />
jeder. Wir freuen uns auf <strong>neue</strong> Sichtweisen,<br />
auf spannende, nachhaltig wirkende<br />
Bilder.“ so stellv. Vorsitzender und Geschäftsführer<br />
des GECO e.V. Dieter Weismann,<br />
der den Wettbewerb mit der GO-<br />
LIAT-Werbeagentur, Chemnitz ins Leben<br />
gerufen hat. Der Wettbewerb läuft bereits<br />
seit 01. August 2011 und endet am 31.<br />
Oktober des Jahres. Nähere Informationen<br />
unter www.geco-dialog.de.<br />
592 8-9 / 2011
SIMONA mit deutlicher<br />
Umsatzsteigerung im ersten<br />
Halbjahr 2011<br />
Der SIMONA-Konzern hat auch im zweiten<br />
Quartal 2011 die positive Entwicklung bei<br />
Absatz und Umsatz fortgesetzt. Es wurden<br />
Umsatzerlöse von 85,4 Mio. EUR erzielt.<br />
Das entspricht einer Steigerung von<br />
15,4 Mio. EUR bzw. 22 % gegenüber dem<br />
Vorjahr. Insgesamt betrugen die Umsatzerlöse<br />
im ersten Halbjahr 2011 162,3 Mio.<br />
EUR und damit 32,6 Mio. EUR bzw. 25,1 %<br />
mehr als im ersten Halbjahr 2010. Auch<br />
der Absatz ist im ersten Halbjahr 2011 im<br />
zweistelligen Prozentbereich gestiegen,<br />
aufgrund von Preiseffekten durch weiter<br />
hohe Rohstoffkosten jedoch nicht so stark<br />
wie der Umsatz. Der Konzern hat vor allem<br />
von der weiter hohen Investitionsneigung<br />
wichtiger Abnehmerbranchen in der Chemie,<br />
dem Maschinenbau und der Photovoltaikindustrie<br />
profitiert.<br />
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber<br />
dem 31.12.2010 um 17,2 Mio. EUR auf<br />
262,2 Mio. EUR erhöht. Mit 7,1 Mio. EUR<br />
(Vorjahr 2,9 Mio. EUR) hat SIMONA die<br />
Investitionen im ersten Halbjahr deutlich<br />
ausgeweitet. Für das zweite Halbjahr<br />
erwartet das Kunststoff verarbeitende<br />
Unternehmen deutlich schwierigere<br />
Rahmenbedingungen. Die Staatsschuldenkrise<br />
wichtiger Industrienationen<br />
hat zu erheblichen Marktunsicherheiten<br />
geführt. „Aufgrund der positiven<br />
Entwicklung im ersten Halbjahr gehen<br />
wir zurzeit aber davon aus, unser Umsatzziel<br />
von 290 Mio. EUR und ein Ergebnis<br />
vor Ertragsteuern von 15 Mio.<br />
EUR erreichen zu können“, so Wolfgang<br />
Moyses, Vorsitzender des Vorstandes<br />
der SIMONA AG.<br />
DIBt er<strong>neue</strong>rt Zulassung für<br />
BIRCO-Rinnensysteme<br />
Gütesicherung<br />
Kanalbau ...<br />
... wir sind dabei!<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung der<br />
■ Fachkunde<br />
■ technischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
■ technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen<br />
Für den Einbau in extrem belastete WHG-<br />
Flächen geeignet: DIBt-geprüfte Schlitzrinne<br />
BIRCOsolid<br />
Das Deutsche Institut für Bautechnik<br />
(DIBt) hat für das Schlitzrinnensystem<br />
BIRCOsolid die allgemeine bauaufsichtliche<br />
Zulassung er<strong>neue</strong>rt. Diese bestätigt,<br />
dass BIRCOsolid die Normen und Auflagen<br />
erfüllt, um in Bereichen mit wassergefährdenden<br />
Stoffen (WHG-Flächen)<br />
eingesetzt werden zu können. „Aus der<br />
praktischen Anwendung heraus wissen<br />
wir, dass über die DIBt-Zulassung hinaus<br />
wichtige Kriterien entscheidend sind,<br />
um WHG-Flächen zuverlässig zu entwässern“,<br />
sagt Christian Merkel, BIRCO Geschäftsführer.<br />
Um das Erdreich und Grundwasser<br />
vor wassergefährdenden Flüssigkeiten zu<br />
schützen, fertigt BIRCO die Schlitzrinne<br />
BIRCOsolid aus einem monolithischen Rinnenkörper<br />
– so ist sie frei von verschleißanfälligen<br />
Nähten und Fugen. Auch dynamischen<br />
Horizontalkräften hält die Rinne<br />
dadurch problemlos stand und ist für den<br />
Einbau bis zur Belastungsklasse F 900 ausgelegt.<br />
neutral – fair –<br />
zuverlässig<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
steht für eine objektive<br />
Bewertung nach einheitlichem<br />
Maßstab<br />
Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961<br />
8-9 / 2011 593
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Swietelsky-Faber eröffnet <strong>neue</strong> Niederlassung in<br />
Leipzig<br />
Die Swietelsky-Faber GmbH Kanalsanierung<br />
bleibt auf Expansionskurs. Pünktlich<br />
zum 10-jährigen Gründungsjubiläum des<br />
Unternehmens etabliert sich der renommierte<br />
Kanalsanierer mit einer Niederlassung<br />
in Schkeuditz bei Leipzig auch in den<br />
„<strong>neue</strong>n“ Bundesländern.<br />
Die Baukonzerne Swietelsky (Linz/<br />
Österreich) und Faber Bau, die 2001 das<br />
Sanierungsunternehmen Swietelsky-Faber<br />
GmbH Kanalsanierung mit Hauptsitz<br />
in Schlierschied gründeten, sind auch<br />
im deutschen Osten keine unbekannten<br />
Größen. Wie die Swietelsky GmbH,<br />
die in Meißen einen Standort mit über<br />
100 Mitarbeitern unterhält, ist auch Faber/Eiffage<br />
mit den Niederlassungen in<br />
Wilsdruff und Drebach mit 180 Mitarbeitern<br />
seit fast 20 Jahren aktiv. Bislang<br />
standen in dieser Konstellation Leistungen<br />
in Hoch-, Tief-, Straßen- und Deponiebau<br />
im Fokus.<br />
Haben den deutschen<br />
Osten<br />
im Visier: Die<br />
Swietelsky-Faber-<br />
Geschäftsführer<br />
Dipl.-Ing. Martin<br />
Wagner und Winfried<br />
Schelzer mit<br />
Alexander Heil, dem<br />
<strong>neue</strong>n Leipziger<br />
Niederlassugsleiter,<br />
und Wolfram Kopp,<br />
Niederlassungsleiter<br />
Blomberg<br />
Jetzt zieht die gemeinsame, auf grabenlose<br />
Kanalsanierung spezialisierte<br />
Tochter nach: Am 1. September wurde die<br />
Niederlassung Leipzig in Schkeuditz-Glesien<br />
in Sichtweite des Flughafens Leipzig und<br />
unweit des Autobahnkreuzes Schkeuditz<br />
eröffnet. Für Swietelsky-Faber Kanalsanierung<br />
mit bundesweit insgesamt 120 Mitarbeitern<br />
ist das die insgesamt achte Niederlassung<br />
in Deutschland und Österreich.<br />
Unter Führung von Niederlassungsleiter<br />
Alexander Heil bietet man künftig<br />
das volle Spektrum grabenloser Sanierungsverfahren<br />
für Kanäle aller Nennweiten<br />
sowie für Hausanschlussleitungen an.<br />
Partielle Sanierungsverfahren wie Kurzliner<br />
und die Reparatur mit Robotertechnik<br />
stehen ebenso auf dem Programm wie<br />
die bewährten „Klassiker“ der Kanal-Renovation:<br />
Schlauchlining, Berstlining sowie<br />
Lang- und Kurzrohr-Lining. Angesichts der<br />
wachsenden Bedeutung des Marktes der<br />
Hausanschlussleitungen gehört auch deren<br />
Sanierung durch Schlauchlining mit<br />
zum Produktprogramm von Swietelsky-<br />
Faber in Leipzig.<br />
<strong>Neue</strong> Unternehmensstrategie bei der Reinigung<br />
von TW-Verteilungsleitungen<br />
Vor rund sieben Jahren hat die WtL mit<br />
ihren Saugspülanlagen ein <strong>neue</strong>s System<br />
zur Reinigung von Trinkwassernetzen in<br />
den Markt gebracht. Seit dem wurden<br />
viele tausend Kilometer Leitungstrasse<br />
zuverlässig und erfolgreich gereinigt.<br />
In dieser Zeit gab es viele Anfragen, angefangen<br />
von Sicherheitsbedenken beim<br />
Spülbetrieb, über Änderungswünsche und<br />
Zusatzfunktionen, bis hin zu Kaufinteresse<br />
und Franchise-Wünschen.<br />
Das große Interesse nahm WtL zum<br />
Anlass, die bisher praktizierte Dienstleistungs-Philosophie<br />
zu hinterfragen und ihr<br />
Geschäftsmodell zu erweitern.<br />
Auf der Grundlage der „Einteilung von<br />
Spülklassen“, aus der Schriftenreihe des<br />
TZW- Band 27, hat WtL den deutschen<br />
und europäischen Gesamtbedarf hochgerechnet.<br />
Geht man davon aus, dass ca.<br />
80 % aller TW-Leitungen der Spülklasse<br />
2 und 3 zuzuordnen sind, und die restlichen<br />
20 % den Klassen 1 und 4 zu gleichen<br />
Teilen angelastet werden müssen,<br />
schlussfolgert sich daraus, dass für den<br />
Hauptanteil der Leitungen Spülintervalle<br />
zwischen zwei und vier Monaten erforderlich<br />
sind. Hinzu kommen die Leitungsendstränge,<br />
die in der Regel der<br />
Klasse 4 entsprechen und wenigstens alle<br />
vier Wochen gereinigt werden sollten. Für<br />
ein WVU mit etwa 1.000 km Leitungstrasse<br />
ergäbe sich so ein Spülungsbedarf,<br />
der mit einer Spülanlage abgedeckt werden<br />
könnte.<br />
Für viele Wasserversorgungsunternehmen<br />
kann sich dann der Unterhalt eines eigenen<br />
Spülwagens gegenüber der Beauftragung<br />
eines Dienstleisters wirtschaftlich<br />
darstellen. Vor diesem Hintergrund hat sich<br />
WtL entschlossen neben dem Angebot<br />
als Dienstleister auch kundenspezifische<br />
Spülanlagen herzustellen und zu vertreiben.<br />
Interessenten können sich wenden an<br />
wtl.klose@t-online.de.<br />
594 8-9 / 2011
geofora 2012 erwartet rund<br />
600 Teilnehmer<br />
Am 5. Juli unterzeichneten in Bonn<br />
der Präsident der Bundesvereinigung<br />
der Firmen im Gas- und Wasserfach<br />
e.V. (figawa), Prof. Schwank und der<br />
Oberbürgermeister der Stadt Hof,<br />
Dr. Harald Fichtner den Projektvertrag<br />
für die geofora 2102 in Hof gemeinsam<br />
mit Dieter Hesselmann dem<br />
Geschäftsführer des wirtschaftlichen<br />
Trägers, der figawa Service GmbH. Sie<br />
bekräftigen damit die gute Zusammenarbeit<br />
für die innovative Kongress-<br />
und Messeveranstaltung im<br />
kommenden Jahr.<br />
Die Partner sehen die geofora als<br />
Kongress und Fachmesse für Bohrtechnik,<br />
Wassergewinnung und Geothermie<br />
unter der Überschrift „Wissen,<br />
Technik, Lösungen“ sehr gut positioniert<br />
und erfahren großen Zuspruch<br />
der Branche so Schwank. Dr.<br />
Fichtner hebt hervor, dass sich Hof<br />
seit der ersten geofora erfolgreich<br />
zum Bayerischen Kompetenzstandort<br />
Wasser weiterentwickelt hat. Dies<br />
beinhaltet unter anderem das Firmen-<br />
Kompetenznetznetzwerk Wasser und<br />
einen <strong>neue</strong>n Studiengang der Hochschule<br />
Hof für Umweltingenieurwesen<br />
mit Schwerpunkt Wasser.<br />
Auf der geofora 2012 werden<br />
neben der Diskussion branchenspezifischer<br />
und technischer Fragen auch<br />
<strong>neue</strong> Entwicklungen präsentiert und<br />
interessante Parallelveranstaltungen<br />
sowie Workshops angeboten. Einen<br />
thematischen Schwerpunkt wird der<br />
Brunnen als zentrales Bauwerk der<br />
Wasserversorgung und dessen Bedeutung<br />
in der Daseinsfürsorge, national<br />
wie international, bilden. Zu<br />
den Kernthemen zählen weiterhin die<br />
oberflächennahe und tiefe Geothermie.<br />
Bereits heute haben mehrere internationale<br />
Delegationen angekündigt,<br />
dass sie die geofora in Hof als<br />
Informations- und Kommunikationsplattform<br />
nutzen werden.<br />
Rohrsysteme<br />
aus GFK<br />
von Amitech<br />
Flowtite-Rohre bestehen aus glasfaserverstärktem<br />
Polyesterharz,<br />
kurz GFK.<br />
GFK ist extrem leicht, enorm fest<br />
und erstaunlich flexibel. Aus GFK<br />
bauen Ingenieure rund um den<br />
Globus Flugzeuge, Schiffe, hoch<br />
beanspruchte Teile im Fahrzeugbau,<br />
und wir bauen daraus Rohre<br />
für Ihre Ansprüche.<br />
Flowtite-Rohre eignen sich für alle<br />
Druck- und drucklosen Anwendungen,<br />
in denen traditionell<br />
Guss-, Stahl-, Stahlbeton oder<br />
Steinzeugrohre eingesetzt werden.<br />
Amitech Germany GmbH · Am Fuchsloch 19 ·<br />
04720 Mochau · Tel.: + 49 34 31 71 82 - 0 ·<br />
Fax: + 49 34 31 70 23 24 · info@amitech-germany.de ·<br />
www.amitech-germany.de<br />
figawa-Präsident, Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank, OB Stadt Hof, Dr. Harald Fichtner und<br />
Geschäftsführer der figawa Service GmbH Dieter Hesselmann am 05.07.2012 in Bonn<br />
A Member of the<br />
Group<br />
Weitere Informationen unter www.amiantit.com<br />
8-9 / 2011 595
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
German Water Partnership unterwegs mit<br />
Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel<br />
Im Rahmen der Reise des Bundesentwicklungsministers<br />
vom 4. bis 8. August nach<br />
Albanien und Bosnien & Herzegowina begleitete<br />
Stefan Girod, Geschäftsführer<br />
von German Water Partnership (GWP), als<br />
Vertreter der Wirtschaft die Delegation. In<br />
Albanien stand der Besuch konkreter Projekte<br />
aus dem Bereich des Wassersektors<br />
mit Beteiligung deutscher Unternehmen<br />
auf dem Programm. So wurde am Shkroda-See<br />
im Rahmen des Projektes „Umweltschutzprogramm<br />
Shkroda See“ der<br />
Grundstein für eine zukünftige Kläranlage<br />
gelegt. In Berat (Mittelalbanien) wurde,<br />
ebenfalls im Rahmen eines Projektes der<br />
finanziellen Zusammenarbeit, die Verbindungsleitung<br />
zur Wasserversorgung zwischen<br />
Berat und Kuçova eingeweiht und<br />
eröffnet. In beiden Projekten engagieren<br />
sich GWP-Mitgliedsunternehmen. In Bosnien<br />
& Herzegowina besichtigte die Delegation<br />
das Mahnmal von Srebrenica.<br />
Know-how der deutschen<br />
Wasserwirtschaft ist international<br />
anerkannt<br />
„Die Entwicklung Albaniens verläuft unter<br />
den stabilen innenpolitischen Entwicklungen<br />
rasant, gleichwohl gibt es einen hohen<br />
Bedarf bezüglich der Verbesserung<br />
von Infrastruktur in der Region. German<br />
Water Partnership unterstützt mit seinen<br />
Mitgliedsunternehmen den Ausbau einer<br />
nachhaltigen Wasserwirtschaft. Der Erfolg<br />
der Kooperationsprojekte in Shkroda und<br />
Berat unterstreicht, dass auch international<br />
das Know-how und die qualitativ hochwertigen<br />
Leistungen der deutschen Wasserwirtschaft<br />
anerkannt und gefragt sind“,<br />
so Stefan Girod.<br />
Trotz reichhaltiger Wasserressourcen<br />
verfügt Albanien noch nicht über kontinuierliche<br />
Trinkwasserversorgung und umweltgerechte<br />
Abwasserreinigung. Rund<br />
25 % der Bevölkerung haben weniger als<br />
acht Stunden täglich Zugang zu sauberem<br />
Trinkwasser. Grund dafür sind eine vielerorts<br />
veraltete Infrastruktur der Wasserbetriebe,<br />
hohe Wasserverluste, finanzielle<br />
Defizite sowie schwache Kapazitäten und<br />
geringe Einnahmen. Ein stabiler und zukunftsfähiger<br />
Aufschwung muss mit ei-<br />
Gemeinsam am<br />
„Rad drehen“:<br />
Öffnung des<br />
Schiebers der<br />
Verbindungsleitung<br />
zwischen<br />
Berat und Kuçova:<br />
v.l. Bundesentwicklungsminister<br />
Dirk<br />
Niebel, Stefan<br />
Girod (GWP),<br />
Fatmir Shehu<br />
(Direktor des<br />
Wasserwerks),<br />
Jürgen Wummel<br />
(Sachsen Wasser<br />
GmbH)<br />
ner nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung<br />
einhergehen. Daher ist insbesondere ein<br />
nachhaltiges und effizientes Wassermanagement<br />
Grundlage weiterer Entwicklungen<br />
dieser Länder. Vor diesem Hintergrund<br />
dienten die Treffen mit dem Ministerpräsidenten<br />
und weiteren Entscheidungsträgern<br />
sowohl dem Austausch über die politische<br />
Situation als auch der Verständigung<br />
über weitere entwicklungspolitische<br />
Kooperationen.<br />
Nachhaltiges Wassermanagement<br />
mit deutscher Expertise<br />
Im Zuge der Annäherung Albaniens an die<br />
Europäische Union waren auch die Möglichkeiten<br />
der Zusammenarbeit mit der<br />
deutschen Wasserwirtschaft hinsichtlich<br />
der erforderlichen Maßnahmen im Bereich<br />
der Wasserinfrastruktur ein wichtiges<br />
Thema. In Bosnien & Herzegowina<br />
sind deutsche Consultingunternehmen<br />
in allen laufenden Infrastrukturvorhaben<br />
der Bereiche Wasser und Energie, die durch<br />
die finanzielle Zusammenarbeit getragen<br />
werden, als Durchführungsconsultants<br />
aktiv. Die KfW-Entwicklungsbank unterstützt<br />
mit verschiedenen Partnern Albanien<br />
und Bosnien & Herzegowina auf dem<br />
Weg nach Europa. Dabei konzentriert sie<br />
sich vornehmlich auf die Bereitstellung von<br />
verlässlichen und qualitativ hochwertigen<br />
Gemeindedienstleistungen für Wasser und<br />
Abwasser. Weitere Kooperationsprojekte<br />
zur Umsetzung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft<br />
unter Beteiligung deutscher<br />
Unternehmen sind zu erwarten.<br />
German Water Partnership stellt sich<br />
hier als Ansprechpartner zu Verfügung.<br />
Das Bundesministerium für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)<br />
ist eines der fünf Partnerministerien von<br />
GWP. Im Laufe der vergangenen Jahre hat<br />
sich eine intensive Zusammenarbeit entwickelt.<br />
Bereits zahlreiche gemeinsame<br />
Aktivitäten und internationale Kooperationsprojekte<br />
wurden initiiert. Die Erfahrungen<br />
daraus und die enge Verknüpfung der<br />
Ziele und Kompetenzen bilden die Grundlage,<br />
auch in Zukunft in der Entwicklungszusammenarbeit<br />
international erfolgreich<br />
zu agieren. Das Netzwerk bündelt als Gemeinschaftsinitiative<br />
von derzeit 320 Mitgliedern<br />
aus der deutschen Wasserwirtschaft<br />
und -forschung umfassende Kompetenzen<br />
im Wassersektor.<br />
Ziel ist es, die deutsche Expertise und<br />
Qualität “Made in Germany” weltweit zu<br />
etablieren und infolgedessen zielgerichtet<br />
die Positionierung der deutschen Wasserwirtschaft<br />
in den internationalen Märkten<br />
zu stärken sowie die Erreichung der Millenniumsziele<br />
zu unterstützen. Mit vielfältigen<br />
Aktivitäten in 17 Fokusländern und<br />
-regionen hat GWP bereits fundierte Erfahrungen<br />
und leistet einen entscheidenden<br />
Beitrag zur Förderung von grenzüberschreitenden<br />
Kooperationen.<br />
596 8-9 / 2011
Gütesicherung Grundstücksentwässerung<br />
Am 19.07.2010 wurde unter der Antragsnummer<br />
412 beim RAL Deutsches Institut<br />
für Gütesicherung und Kennzeichnung<br />
e.V. ein Gütezeichen-Antrag auf Einleitung<br />
eines RAL-Anerkennungsverfahrens<br />
für eine Gütegemeinschaft Güteschutz<br />
„Grundstücksentwässerung“ gestellt. Das<br />
Anerkennungsverfahren und damit die Abstimmung<br />
der Satzung mit den Fach- und<br />
Verkehrskreisen sind abgeschlossen. Die<br />
formale Anerkennung durch den RAL steht<br />
unmittelbar bevor.<br />
Zu den Gründungsmitgliedern der <strong>neue</strong>n<br />
Gütegemeinschaft gehören die Deutsche<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V. (DWA), der Zentralverband<br />
Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK),<br />
die Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau,<br />
die Gesellschaft zur Förderung der<br />
Abwassertechnik e.V. (GFA), die Überwachungsgemeinschaft<br />
technische Anlagen<br />
der SHK-Handwerke e.V. (ÜWG-SHK),<br />
die Gütesicherung Entwässerungstechnik<br />
(GET), die PKT- Pader Kanal Technik Rohr<br />
Frei GmbH & Co. KG und die Bochtler GmbH<br />
Haustechnik. Weitere Organisationen sind<br />
eingeladen, der Gütegemeinschaft Grundstücksentwässerung<br />
beizutreten und das<br />
gemeinsame Ziel zu unterstützen.<br />
Die <strong>neue</strong> Gütegemeinschaft hat die<br />
Aufgabe, die Herstellung, den baulichen<br />
Unterhalt und die Prüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
gütezusichern.<br />
Dabei werden Leistungen mit dem<br />
Gütezeichen Grundstücksentwässerung<br />
gekennzeichnet. Grundlage hierfür sind<br />
Umweltschonend!<br />
duktile Gussrohrsysteme für die grabenlose Verlegung.<br />
• höchste Zugkräfte<br />
• schnelle und einfache montage<br />
• Radien ab 70 m<br />
Informieren sie sich im Internet unter www.duktus.com<br />
8-9 / 2011 597
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
Güte- und Prüfbestimmungen, eine Gütezeichensatzung<br />
und Durchführungsbestimmungen.<br />
Gleichzeitig wird überprüft,<br />
ob Gütezeichenbenutzer die Gütezeichensatzung<br />
einhalten. „Mitglieder der Gütegemeinschaft<br />
können bundesweit tätige Organisationen,<br />
deren Mitgliedsunternehmen<br />
im Bereich der Grundstücksentwässerung<br />
tätig sind, aber auch einzelne Betriebe und<br />
natürliche und juristische Personen sein“,<br />
erläutert Dipl.-Ing. Dirk Bellinghausen,<br />
Geschäftsführer der <strong>neue</strong>n Gütegemeinschaft.<br />
Die eigentliche Gütesicherung obliegt<br />
dem eigens eingerichteten Güteausschuss.<br />
Zu den weiteren Organen zählen<br />
der Vorstand und ein Fachbeirat.<br />
BILD 1: Die Gründungsmitglieder<br />
der<br />
<strong>neue</strong>n Gütegemeinschaft<br />
BILD 2: Beurteilungsgruppen<br />
Gütesicherung<br />
Kanalbau und<br />
Gütesicherung<br />
Grundstücksentwässerung<br />
Handlungsbedarf<br />
Nach DIN 1986 „Entwässerungsanlagen<br />
für Gebäude und Grundstücke“, Teil 30<br />
„Instandhaltung“, ist in definierten Zeiträumen<br />
eine Dichtheitskontrolle sämtlicher<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
durchzuführen. Hierzu gehören unter anderem<br />
die Abwasserleitungen innerhalb<br />
von Gebäuden, Leitungen unter Gebäuden<br />
(Grundleitungen), alle weiteren erdverlegten<br />
Abwasserleitungen im Grundstück und<br />
die Anschlussleitung zum öffentlichen Kanal,<br />
einschließlich der Einbindung.<br />
In Bezug auf die Herstellung und Instandhaltung<br />
von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
besteht daher Handlungsbedarf.<br />
Tausende Kilometer privater Leitungsnetze<br />
müssen überprüft und gegebenenfalls<br />
saniert oder er<strong>neue</strong>rt werden.<br />
Ein Unterfangen, bei dem der Laie auf fachkundigen<br />
Rat und zuverlässige Baupartner<br />
angewiesen ist. „Da im Bereich privater<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen aber<br />
auch Unternehmen tätig werden, die nicht<br />
im öffentlichen Bereich arbeiten, können<br />
diese die Anforderungen der Gütesicherung<br />
Kanalbau nicht erfüllen“, verdeutlicht<br />
Künster. „Das Angebot der Gütesicherung<br />
Kanalbau war deshalb entsprechend durch<br />
eine separate Gütesicherung für den Bereich<br />
der Grundstücksentwässerung zu ergänzen.“<br />
Zu den vorrangigen Zielen bei der Umsetzung<br />
dieser Aufgabe gehört es, ein bundesweit<br />
einheitliches Angebot zu etablieren.<br />
Unterschiedliche Angebote zur Kontrolle<br />
der Qualifikation bergen die „Gefahr“,<br />
dass Auftraggeber bzw. Genehmigungsstellen<br />
ihre Anforderungen an die Bietereignung<br />
über voneinander abweichende<br />
Systeme definieren. Unternehmen, die für<br />
mehrere Auftraggeber tätig sind, wären in<br />
diesen Fällen gehalten, den Qualifikationsnachweis<br />
in mehreren Systemen zu führen.<br />
„Dies ist unwirtschaftlich und nach Möglichkeit<br />
zu vermeiden“, so Künster weiter.<br />
Definiertes Zusammenwirken<br />
Über den jeweiligen Geltungsbereich der<br />
Güte- und Prüfbestimmungen wird das<br />
Zusammenwirken von Gütesicherung Kanalbau<br />
RAL-GZ 961 „für die Herstellung<br />
und Instandhaltung von öffentlichen und<br />
privaten Abwasserleitungen und -kanälen“<br />
und Gütesicherung Grundstücksentwässerung<br />
RAL-GZ 968 „für die Herstellung<br />
und Instandhaltung von privaten Abwasserleitungen<br />
und -kanälen nach DIN 1986<br />
≤ DN 250 auf Grundstücken“ definiert.<br />
Beurteilungsgruppen für offene Bauweise,<br />
Inspektion, Reinigung und Dichtheitsprüfung<br />
werden künftig in beiden<br />
Gütesicherungen existieren. Inhaber des<br />
Gütezeichens Grundstücksentwässerung<br />
weisen Referenzen im Bereich privater<br />
Grundstücksentwässerungen nach. Gütezeicheninhaber<br />
Kanalbau belegen ihre<br />
Erfahrung zusätzlich über Referenzen im<br />
öffentlichen Bereich.<br />
Die bislang in der Gütesicherung Kanalbau<br />
eingerichtete Beurteilungsgruppe<br />
G beinhaltet die Inspektion, Reinigung<br />
und Dichtheitsprüfung ausschließlich auf<br />
598 8-9 / 2011
Grundstücken und wird daher bis zum<br />
31.12.2011 in die Gütesicherung Grundstücksentwässerung<br />
überführt. Darüber<br />
hinaus werden in der Gütesicherung<br />
Grundstücksentwässerung Gruppen für<br />
Arbeiten an Fett- und Leichtflüssigkeitsabscheider,<br />
Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben<br />
existieren. Die Gruppen<br />
zu Vortriebs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
sind weiterhin Bestandteil der<br />
Gütesicherung RAL-GZ 961; genauso<br />
wie die Gruppen für die Ausschreibung<br />
und Bauüberwachung von Maßnahmen<br />
im offenen Kanalbau (ABAK), im Vortrieb<br />
(ABV) und in der Sanierung (ABS).<br />
Gütesicherung<br />
Grundstücksentwässerung<br />
Die Gütesicherung Grundstücksentwässerung<br />
besteht zum einen aus Gütebestimmungen<br />
mit Anforderungen an die<br />
Gütezeicheninhaber und zum anderen<br />
aus Prüfbestimmungen mit Anforderungen<br />
an die Prüfung.<br />
Wichtige Kriterien zur Beurteilung<br />
der Qualifikation sind Erfahrung und Zuverlässigkeit<br />
des Unternehmens und des<br />
eingesetzten Personals in Bezug auf die<br />
Ausführung der beschriebenen Arbeiten.<br />
Den Nachweis zu diesen Anforderungen<br />
erbringen Gütezeichen-Inhaber in Form<br />
von detaillierten Referenzen, Abnahmeprotokollen<br />
und einer Organisationsübersicht.<br />
Weitere Anforderungen an die Gütezeicheninhaber<br />
betreffen die Ausstattung<br />
der Unternehmen. Im Detail werden<br />
Anforderungen an das Personal, an<br />
die fachliche Qualifikation des Personals,<br />
an Betriebseinrichtungen und Geräte und<br />
an die Beauftragung von Nachunternehmern<br />
definiert.<br />
Zu den Aufgaben des Güteausschusses<br />
der Gütegemeinschaft Grundstücksentwässerung<br />
gehören die Weiterentwicklung<br />
der Güte- und Prüfbestimmungen<br />
und deren Auslegung für die Einzelfälle<br />
der Praxis. Weiterhin beauftragt der<br />
Güteausschuss die Prüfstellen, welche<br />
dem Güteausschuss wiederum ihre Berichte<br />
zur Prüfung vorlegen. Diese werden<br />
dann im Einzelfall geprüft und bestätigt.<br />
Der Güteausschuss ist damit das<br />
Gremium, welches das Anforderungsniveau<br />
definiert. Eine ausgeglichene Interessensvertretung<br />
im Güteausschuss ist<br />
daher durch die in der Satzung geregelte<br />
Zusammensetzung gewährleistet.<br />
Die Prüfbestimmungen enthalten Regelungen<br />
zur Prüfung der in den Gütebestimmungen<br />
definierten Anforderungen.<br />
In der Erstprüfung wird festgestellt,<br />
ob alle Anforderungen der entsprechenden<br />
Beurteilungsgruppe erfüllt sind. In der<br />
Folge wird regelmäßig stichprobenartig<br />
geprüft. Die regelmäßige Bestätigung der<br />
Qualifikation nach Gütezeichenverleihung<br />
erfolgt situationsabhängig, mindestens<br />
aber eine Firmenprüfung alle zwei Jahre<br />
pro Beurteilungsgruppe. Baustellenbesuche<br />
erfolgen nach Gütezeichenverleihung<br />
in Abhängigkeit der Anzahl der Baustellen,<br />
mindestens aber ein Baustellenbesuch pro<br />
Jahr pro Beurteilungsgruppe.<br />
Vom Güteausschuss beauftragte Prüfer<br />
prüfen stichprobenweise die Einhaltung<br />
und Dokumentation der zur jeweiligen<br />
Beurteilungsgruppe gehörenden Anforderungen<br />
einschließlich der Dokumentation<br />
der Eigenüberwachung.<br />
In den regelmäßigen Firmenbesuchen<br />
wird unter anderem geprüft, ob die Dokumentation<br />
der Eigenüberwachung für<br />
die abgewickelten Maßnahmen geführt<br />
wurde, die Qualifikation des eingesetzten<br />
Personals vorhanden und deren überbetriebliche<br />
Schulungen durchgeführt wurde.<br />
Bei den jährlichen Baustellenbesuchen<br />
wird festgestellt, ob die Qualifikation und<br />
die Zuverlässigkeit anhand der Bauausführung<br />
weiterhin bestätigt werden kann.<br />
Aufeinander abgestimmt<br />
Der wachsende Markt der Prüfung, Instandhaltung<br />
und Herstellung von Entwässerungsanlagen<br />
auf Grundstücken fordert<br />
eine tragfähige und nachvollziehbare Lösung<br />
zur Gütesicherung der ausführenden<br />
Unternehmen. Um allen beteiligten Unternehmen<br />
ein Angebot zur Gütesicherung<br />
machen zu können, wurde eine <strong>neue</strong> RAL-<br />
Gütesicherung Grundstücksentwässerung<br />
installiert. RAL-Gütesicherungen zeichnen<br />
sich durch ein hohes Qualitätsniveau aus<br />
und werden in einem Anerkennungsverfahren<br />
mit den interessierten Fach- und<br />
Verkehrskreisen abgestimmt. Unter dem<br />
gemeinsamen Dach des RAL werden beide<br />
Gütesicherungen für die Herstellung<br />
und Instandhaltung von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen aufeinander abgestimmt.<br />
Damit verfügen Inhaber des Gütezeichens<br />
Kanalbau weiterhin auch über<br />
einen Qualifikationsnachweis für Arbeiten<br />
auf privaten Grundstücken.<br />
www.funkegruppe.de<br />
Funke Kunststoffe GmbH<br />
8-9 / 2011 599
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
Anforderungsprofil für GFK-Rohre<br />
überarbeitet<br />
BILD 1: Neben anderen Bauverfahren<br />
stellt die Sanierung eines Kanals mit<br />
werksgefertigten GFK-Rohren ein technisch<br />
ausgereiftes Verfahren dar<br />
Foto: Tiefbauamt Karlsruhe<br />
BILD 2: Das Anforderungsprofil für<br />
GFK-Rohre stellt eine verlässliche Grundlage<br />
für Ausschreibung, Planung und Bau<br />
dar, die dem heutigen Stand der Technik<br />
angepasst ist<br />
Foto: Tiefbauamt Karlsruhe<br />
Gemeinsam mit dem RSV – Rohrleitungssanierungsverband<br />
e. V. hat die Arbeitsgruppe<br />
süddeutscher Kommunen das „Anforderungsprofil<br />
für die Renovierung von Abwasserleitungen<br />
mit werkseitig hergestellten<br />
GFK-Rohren“ aktualisiert. Das Anforderungsprofil<br />
stellt eine verlässliche Grundlage<br />
für Ausschreibung, Planung und Bau dar,<br />
die dem heutigen Stand der Technik angepasst<br />
ist. Es soll eine Hilfestellung für Planer<br />
und Auftraggeber sein. Zugleich soll es<br />
Bietern ermöglichen, sich im Vorfeld einer<br />
Ausschreibung mit den Anforderungen und<br />
Bedingungen für eine Auftragserteilung und<br />
-abwicklung vertraut zu machen.<br />
„In vielen Kommunen sind die großen<br />
Abwassertransportleitungen häufig schon<br />
mehrere Jahrzehnte, an manchen Stellen<br />
bereits über hundert Jahre alt“, erläutert<br />
Dipl.-Ing. Volker Zinn vom Tiefbauamt der<br />
Stadt Karlsruhe. „Viele dieser Kanäle weisen<br />
teilweise starke Schäden auf und eine Sanierung<br />
ist dringend erforderlich“, so der Sprecher<br />
der Arbeitsgruppe weiter. Neben anderen<br />
auf dem Markt befindlichen Bauverfahren<br />
stellt die Sanierung eines Rohrstranges<br />
mit werkgefertigten GFK-Rohren ein technisch<br />
ausgereiftes und langlebiges Verfahren<br />
dar. Dabei ist es grundsätzlich wichtig,<br />
dass ein Auftraggeber genau das Rohr bekommt,<br />
das auf die Anforderungen seiner<br />
Tiefbaumaßnahme zugeschnitten ist. Grund<br />
genug, das bestehende Anforderungsprofil<br />
zu überarbeiten und dem allgemeinen<br />
Stand der Technik anzupassen. „Anforderungsprofile<br />
werden von den ausschreibenden<br />
Stellen zunehmend genutzt“, stellt<br />
RSV-Geschäftsführer Dipl.-Volkswirt Horst<br />
Zech fest. So sind hier unter anderem allgemeine<br />
Anforderungen an das bauausführende<br />
Unternehmen, aber auch allgemeine<br />
Anforderungen an die GFK-Rohrwerkstoffe<br />
und Verfahren sowie an das Produkt und die<br />
Herstellung definiert. „Das trägt entscheidend<br />
dazu bei, dass der Auftraggeber das<br />
gewünschte Produkt erhält“, so Zech weiter.<br />
„Zudem stellt es für den Hersteller eine<br />
ausgezeichnete Orientierungshilfe dar.“<br />
Renovierungsziele definiert<br />
Im Anforderungsprofil für die Renovierung<br />
von Abwasserleitungen mit werkseitig<br />
hergestellten GFK-Rohren werden Renovierungsziele<br />
für Kanalsanierungsmaßnahmen,<br />
die auf Basis dieses Anforderungsprofiles<br />
ausgeschrieben werden, festgelegt.<br />
So muss die Funktionsfähigkeit des<br />
Kanals dauerhaft wieder hergestellt werden,<br />
ebenso wie die Dichtheit. Dabei sind<br />
die statischen Vorgaben des DWA-Merkblattes<br />
M127 Teil 2 einzuhalten. Darüber<br />
hinaus sind die Anforderungen des Gewässerschutzes<br />
und einer optimalen Abwasserableitung<br />
und Abwasserreinigung einzuhalten.<br />
Ebenso sollen die Vorteile der<br />
Renovierung von Abwasserleitungen mit<br />
vorgefertigten GFK-Rohren genutzt werden.<br />
Hierzu zählen die Wirtschaftlichkeit<br />
im Verhältnis zum Neubau, die geringe<br />
öffentliche Belastung, geringer Eingriff<br />
in den Verkehrsraum, geringe Emissionen<br />
(Lärm, Erschütterungen) und eine erwartete<br />
Nutzungsdauer der Sanierungsmaßnahme<br />
von mindestens 60 bis 70 Jahren.<br />
Permanente Weiterentwicklung<br />
Bei der Fortschreibung des Anforderungsprofils<br />
für die Renovierung mit GFK-Rohren<br />
werden die Erfahrungen und Fachkenntnisse<br />
von Auftraggeber- und Auftragnehmerseite<br />
sowie der Rohrhersteller<br />
genutzt. Das überarbeitete Anforderungsprofil<br />
stellt einen aktuellen Stand der Technik<br />
dar und kann deshalb nur als Bearbeitungsstand<br />
angesehen werden, der durch<br />
permanente Weiterentwicklung den Änderungen<br />
des Marktes anpasst werden muss.<br />
Hierin sehen die Mitglieder der süddeutschen<br />
Kommunen und die Verantwortlichen<br />
auf Seiten des RSV eine wesentliche<br />
Aufgabe ihrer gemeinsamen Bestrebungen.<br />
Kontakt: RSV – Rohrleitungssanierungsverband<br />
e. V., Lingen (Ems),<br />
Tel. +49 5963 9 81 08 77,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-online.de,<br />
www.rsv-ev.de<br />
600 8-9 / 2011
Personalien<br />
Nachrichten<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus Homann mit Bunsen-<br />
Pettenkofer-Ehrentafel ausgezeichnet<br />
Im Rahmen der DVGW-Mitgliederversammlung<br />
am 6. Juli 2011 in Bonn ist Prof.<br />
Dr.-Ing. Klaus Homann mit der Bunsen-<br />
Pettenkofer-Ehrentafel ausgezeichnet<br />
worden. Die Bunsen-Pettenkofer- Ehrentafel<br />
ist die höchste Auszeichnung, die der<br />
DVGW zu vergeben hat. Sie wurde anlässlich<br />
der 40. Jahresversammlung am 12. Juni<br />
1900 in Mainz gestiftet und erinnert an<br />
die bedeutenden Chemiker und Hygieniker<br />
Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) und<br />
Max Josef von Pettenkofer (1818-1901).<br />
Mit Klaus Homann zeichnet der DVGW<br />
eine Persönlichkeit aus, die sich in hervorragender<br />
Weise um die Förderung des Vereins<br />
sowie auf nationaler und internationaler<br />
Ebene um die wissenschaftliche und<br />
praktische Arbeit im Gasfach verdient<br />
gemacht hat. Klaus Homann begann seine<br />
berufliche Karriere 1979 bei der Vereinigten<br />
Elektrizitätswerke Westfalen AG<br />
(VEW), wo er bis 1998 verschiedene leitende<br />
Positionen im Bereich Gasversorgung/Gastechnik<br />
bekleidete. Von 1998<br />
bis 2004 war er Mitglied des Vorstandes<br />
RWE Gas AG. Seit 2004 war Homann Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der RWE<br />
Transportnetz Gas GmbH und zuletzt Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der Thyssengas<br />
GmbH in Dortmund. Homann ist<br />
seit dem Jahr 2000 Mitglied des DVGW-<br />
Vorstands. Dem DVGW-<br />
Präsidium, das er von<br />
2005 bis 2007 als Präsident<br />
führte, gehörte<br />
er von 2002 bis 2009<br />
an. Homann engagierte<br />
sich darüber hinaus in<br />
zahlreichen Fachgremien<br />
des DVGW. Von 2003 bis<br />
2006 bekleidete er das<br />
Amt des Präsidenten der<br />
europäischen technischwissenschaftlichen<br />
Vereinigung<br />
der Gasindustrie<br />
(Marcogaz). Bis 2009<br />
war er Mitglied des Executive<br />
Board der Internationalen<br />
Gasunion (IGU),<br />
der weltweiten gasfachlichen<br />
Vereinigung. Seit<br />
2009 ist er Präsident des DIN Deutsches<br />
Institut für Normung e.V.<br />
Neben Homann wurden Prof. Dr.-Ing.<br />
Wolfgang Kühn mit der DVGW-Ehrenmitgliedschaft<br />
und Dipl.-Ing. Fritz Guther mit<br />
dem DVGW-Ehrenring für ihre Verdienste<br />
um das Gas- und Wasserfach ausgezeichnet.<br />
Wolfgang Kühn hat sich im Laufe von<br />
40 Jahren in der DVGW-Wasserforschung<br />
durch sein herausragendes Engagement<br />
für das deutsche Wasserfach und um die<br />
Mit der Bunsen-Pettenkofer-Ehrentafel erhielt Prof. Dr.-Ing.<br />
Klaus Homann für seine Verdienste im Rahmen der DVGW-<br />
Mitgliederversammlung Anfang Juli die höchste Auszeichnung,<br />
die der DVGW zu vergeben hat<br />
erfolgreiche Vernetzung der Wasserforschung<br />
in Europa verdient gemacht. Fritz<br />
Guther hat einen entscheidenden Beitrag<br />
bei der Überarbeitung der Technischen Regel<br />
für Gasinstallationen (DVGW-TRGI),<br />
eines in Europa einzigartigen Regelwerks,<br />
geleistet. Darüber hinaus hat sich Guther<br />
während seiner Obmannschaft im Technischen<br />
Komitee „Gasinstallation“ in über 20<br />
Jahren bleibende Verdienste in der Regelwerksarbeit<br />
erworben.<br />
Innovationen für den Tiefbau<br />
www.schoengen.de<br />
Tel. 0 53 41 / 7 99 - 0 · Fax 0 53 41 / 7 99 - 1 99<br />
8-9 / 2011 601
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
Abwassersysteme im Fokus der Nachhaltigkeit<br />
Unter dem Motto „Aus der Praxis für<br />
die Praxis“ lädt der KRV zu dem Seminar<br />
„Wirtschaftliche Wassersysteme im Fokus<br />
der Nachhaltigkeit“ am 15. November<br />
2011 nach Düsseldorf ein. Nachhaltigkeit<br />
ist ein vielfach zitierter Begriff, der häufig<br />
unterschiedlich verstanden wird. Er umfasst<br />
ökologische Belange, insbesondere<br />
den schonenden Umgang mit Ressourcen<br />
und den Erhalt von Natur und Umwelt für<br />
die nachfolgenden Generationen, soziale<br />
Aspekte hinsichtlich der Erreichung einer<br />
lebenswerten Gesellschaft und ökonomische<br />
Gesichtspunkte.<br />
Im kritischen Dialog sollen Vorurteile<br />
und Vorbehalte gegenüber biegeweichen<br />
Rohren diskutiert werden. Sachargumente<br />
und die Vermittlung von Faktenwissen<br />
stehen im Mittelpunkt zahlreicher Fachbeiträge<br />
namhafter Experten. Sie berichten<br />
über ihre Erfahrungen beim Einsatz von<br />
Kunststoffrohrsystemen und geben im kritischen<br />
Dialog Antworten auf Fragen, worauf<br />
es in Theorie und Praxis ankommt.<br />
Das Seminar richtet sich an kommunale<br />
Entscheidungsträger, Mitarbeiter von<br />
Stadtentwässerungen und Tiefbauämtern<br />
sowie Ingenieurbüros und Bauunternehmen,<br />
die an der Projektplanung, Ausschreibung<br />
und Ausführung beteiligt sind.<br />
Kontakt: Kunststoffrohrverband e.V.,<br />
Bonn, Tel. +49 228 91477-13, E-mail:<br />
martina.schumer@krv.de, www.krv.de<br />
Deutschland mit zwei Gruppenständen auf der<br />
ECWATECH 2012<br />
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat<br />
zum zweiten Mal die ECWATECH ins Auslandsmesseförderprogramm<br />
aufgenommen.<br />
Weiterhin wird es auch erneut auf Initiative<br />
des VDMA, Frankfurt, einen deutschen<br />
Firmengemeinschaftsstand geben.<br />
Auch Nicht-Mitglieder aus dem gesamten<br />
Bundesgebiet können sich an diesem deutschen<br />
Gruppenstand beteiligen. Ebenso<br />
ist im Rahmen dieses deutschen Gemeinschaftsstandes<br />
ein Gruppenauftritt von<br />
German Water Partnership geplant.<br />
Bereits zum 10. Mal findet Russlands<br />
führende Fachmesse und Kongress für<br />
Wasser-Technologien statt. Mit gut 77<br />
deutschen Ausstellern war Deutschland<br />
unter den insgesamt 739 Ausstellern, bei<br />
einem Auslandsanteil von 32 %, die stärkste<br />
Nation bei der letzten ECWATECH im<br />
Jahr 2010. Es wurden 12.600 Fachbesucher<br />
und 1.000 Kongressteilnehmer registriert.<br />
Die ECWATECH umfasst die Ausstellungsbereiche<br />
WASSER und ABWAS-<br />
SER: von der Gewinnung über die Aufbereitung,<br />
Behandlung, Verteilung bis hin zur<br />
Ableitung, Entsalzung, Mess-, Regel- und<br />
Analysetechniken, Industrieausrüstungen,<br />
Dienstleistungen. In 2012 findet die EC-<br />
WATECH vom 5. bis 8. Juni 2012 auf dem<br />
Crocus Messegelände in Moskau statt.<br />
Russlands Regierung hat in 2011 mit<br />
der Umsetzung des Programms „Sauberes<br />
Wasser“ begonnen. Mit diesem föderalen<br />
Zielprogramm, das bis zum Jahr 2017<br />
läuft, soll sich die Situation der Wasserversorgung<br />
und Abwasserreinigung verbessern.<br />
In den kommenden sechs Jahren sind<br />
Investitionen von ca. 8 Mrd. Euro geplant.<br />
Wie groß der Nachholbedarf bei Ausrüstungen<br />
für die russischen Wasserwerke<br />
und Klärsysteme ist, hat sich schon 2010<br />
an den Importzahlen gezeigt. Die Einfuhren<br />
von entsprechender Technik sind<br />
zweistellig gewachsen. Dabei sind deutsche<br />
Hersteller in der Regel die beliebtesten<br />
Lieferanten für Wassertechnologie.<br />
Ein großes Problem der russischen<br />
Wasserwirtschaft ist auch der Personalmangel.<br />
Viele Mitarbeiter der Wasserwerke<br />
und Kläranlagen haben das Pensionsalter<br />
überschritten. Jede zehnte Stelle<br />
bleibt mangels Bewerbern unbesetzt. Laut<br />
Russlands Regierung fehlen der Branche<br />
15.000 Ingenieure, Betriebswirte und andere<br />
Spezialisten mit Hochschulausbildung.<br />
Hier können sich deutsche Dienstleister<br />
für Fort- und Weiterbildung engagieren.<br />
Auch Technologielieferanten für die Wassertechnologie,<br />
die Russland bei der Ausbildung<br />
seiner Fachkräfte unterstützt, sind<br />
willkommen.<br />
Kontakt: MESSE & MARKETING,<br />
Michael Pittscheidt, Tel +49 2253-<br />
932188, E-Mail info@pittscheidt.de<br />
602 8-9 / 2011
8-9 / 2011 603
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
15. Workshop Kolbenverdichter 2011<br />
Zum 15. Mal findet der Workshop mit<br />
Themen rund um den Kolbenverdichter<br />
in diesem Jahr statt. Die jährliche Veranstaltung,<br />
die regelmäßig im Oktober,<br />
19./20.10.2011 in Rheine, durchgeführt<br />
wird, ist bekannt für ihre hochqualifizierten<br />
und praxisnahen Vorträge und Referenten.<br />
Für Mitarbeiter von Raffinerien (Erdöl), der<br />
Gasversorgung (Erdgas), der chemischen<br />
Das SKZ ist eine Gruppe expandierender Dienstleistungsunternehmen im Bereich Kunststoffe mit<br />
den Schwerpunkten Forschung und Entwicklung; Prüfung, Überwachung, Gütesicherung, Zertifizierung<br />
von Produkten; Aus- und Weiterbildung sowie Zertifizierung von Managementsystemen.<br />
Für unseren Bereich Überwachung Rohrsysteme (z. B. für Trinkwasserversorgung und<br />
-installation, Abwasserleitungen und -kanäle) suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen<br />
Dipl.-Ing. (FH/TU)<br />
Kunststofftechnik/Werkstoffwissenschaften (m/w)<br />
Eingebunden in ein Team engagierter Kollegen warten folgende Aufgaben auf Sie:<br />
• Durchführung von Produktaudits im In- und Ausland<br />
• Organisatorische Abwicklung von Überwachungen nach nationalen und internationalen Normen,<br />
Spezifikationen und Zertifizierungsprogrammen<br />
• Erstellung von Angeboten<br />
• Erstellung von Überwachungsberichten<br />
Diese Ausbildung und Eigenschaften sollten Sie mitbringen:<br />
• Abgeschlossenes Ingenieurstudium (FH/TU)<br />
• Berufserfahrung in der Qualitätssicherung von Kunststofferzeugnissen<br />
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift<br />
• Fundierte EDV-Kenntnisse (MS-Office, gerne auch Lotus Notes und Navision)<br />
• Verantwortungsbewusste und eigenständige Arbeitsweise<br />
• Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität<br />
• Bereitschaft zur Reisetätigkeit im In- und Ausland<br />
• Sicheres Auftreten im Umgang mit Kunden<br />
Ihr <strong>neue</strong>r Arbeitsplatz bietet Ihnen ein professionelles Umfeld in einem modernen und zukunftssicheren<br />
Unternehmen, interessante und vielseitige Aufgaben, selbständiges Arbeiten, eine<br />
gründliche Einarbeitung sowie Möglichkeiten zur Weiterbildung.<br />
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15. November 2011 an:<br />
SKZ • Personalabteilung<br />
Frankfurter Str. 15-17 • 97082 Würzburg<br />
Tel.: 0931 4104-0 • Fax: 0931 4104-177<br />
bewerbung@skz.de<br />
Industrie (Chemie), aus der Betriebsführung,<br />
dem Service und der Instandhaltung<br />
sowie von Hochschulen, bietet sie den idealen<br />
Rahmen für einen intensiven Erfahrungsaustausch.<br />
Erwartet werden in diesem Jahr beispielsweise<br />
die folgenden Vorträge: von<br />
der RWTH Aachen kommt T. Spilker, er<br />
spricht über ein virtuelles Kolbenringmodell<br />
für die Bewertung des Ölbedarfs<br />
in gasgeschmierten Kolbenverdichtern,<br />
Dr. R. Sick-Sonntag von der Firma Bayer<br />
MaterialScience AG berichtet über seine<br />
Erfahrungen des Debottleneckings für<br />
mehr als Kapazitätssteigerung. Dr. V. Kacani<br />
von der Leobersdorfer Maschinenfabrik<br />
GmbH & Co.KG referiert über die<br />
Berechnung der Verbindung zwischen<br />
Kolben und Kolbenstange. Zum Thema<br />
Monitoring werden Beiträge durch<br />
die Firma PROGNOST Systems GmbH<br />
erwartet und B. Schmidt von der Firma<br />
PSE Engineering spricht zusammen<br />
mit einem Mitarbeiter der ESK GmbH<br />
über ober- und untertägige Gasanlagen<br />
und die Überwachung durch intelligentes<br />
Monitoring. Zugesagt hat auch Prof.<br />
Dr. L. Rinder (i.R.) der TU Wien mit dem<br />
Thema Kolbenkompressor oder Schraubenkompressor<br />
– ein Vergleich bei Anwendungen<br />
für mittlere Drücke und<br />
kleine Liefermengen. Nach den jeweiligen<br />
Vorträgen steht ausreichend Zeit<br />
für Fragen aus dem Publikum und für<br />
Diskussionen zur Verfügung.<br />
Vorausgehend zu diesem Workshop<br />
findet am Dienstag, den 18.10.2011<br />
ein Seminar mit dem Titel „Technische<br />
Akustik – Schwerpunkt Kolbenverdichter“<br />
statt. Dieses befasst sich mit den<br />
Grundlagen der Schallschutztechnik,<br />
der technischen Akustik und Lärmbekämpfung<br />
unter besonderer Berücksichtigung<br />
der speziellen Gegebenheiten<br />
bei Kolbenverdichtern. Es werden<br />
die Bewertungen und Beeinflussungen<br />
von Schallquellen mit der Messung von<br />
Lärmemissionen und -immissionen sowie<br />
die zugrundeliegenden Regelwerke<br />
erklärt. Außerdem wird neben Erläuterungen<br />
zur Arbeitslärmrichtlinie<br />
und zur TA Lärm das Wissen um Analysen<br />
von Lärmquellen und dem primären<br />
und sekundären Schallschutz erweitert.<br />
Während dieses Seminars werden auch<br />
praktische Versuche gezeigt, die verschiedene<br />
Phänomene der Akustik veranschaulichen.<br />
Kontakt: KÖTTER Consulting<br />
Engineers KG, KCE-Akademie,Martina<br />
Brockmann, Tel. +49 5971 9710 65,<br />
E-Mail: martina.brockmann@koetterconsulting.com,<br />
www.kce-akademie.de<br />
604 8-9 / 2011
Seit 1978 den Pulsationen<br />
und Vibrationen auf der Spur...<br />
IKV-Erfahrungsaustausch<br />
bei PLASSON in Wesel<br />
Das Institut für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen (IKV)<br />
veranstaltet jährlich einen Erfahrungsaustausch zum Thema Kunststoffverarbeitung<br />
für die Gas- und Wasserversorgung nach dem<br />
DVGW-Regelwerk GW 330/331. Diese Fachveranstaltung richtet<br />
sich deutschlandweit an alle IKV-Kunststoffausbilder sowie<br />
Schweißaufsichtspersonen der Versorgungsunternehmen.<br />
Gastgeber war in diesem Jahr die PLASSON GmbH aus Wesel.<br />
In der Zeit vom 20. bis zum 22. Juni 2011 wurden den über<br />
60 Teilnehmern in Wesel<br />
Innovationen im Segment<br />
der Gas- und Wasserversorgung<br />
vermittelt. Mit<br />
den vielfältigen Themenbereichen<br />
aus Wirtschaft<br />
und Wissenschaft verschafften<br />
die Referenten<br />
aus Industrie und Versorgung<br />
den Ausbildern und<br />
Schweißaufsichtspersonen einen umfangreichen Überblick über<br />
<strong>neue</strong> Werkstoff-, System- sowie Schweißgeräteentwicklungen.<br />
Ein anschließender Praxisworkshop rundete das Programm<br />
ab. Durch den jährlich stattfindenden Erfahrungsaustausch wird<br />
die Aktualität der bundesweit durchgeführten Lehrgänge optimiert.<br />
Bundesweit werden über dieses System weit über 6.000<br />
PE-Schweißer pro Jahr auf hohem Niveau qualifiziert.<br />
Kontakt: PLASSON GmbH, Wesel, Tel. +49 281 95272 24,<br />
E-Mail: k.schyja@plasson.de, www.plasson.de<br />
Industrietage<br />
Wassertechnik<br />
Das Management und die Behandlung von industriellen Roh-,<br />
Prozess- und Abwässern steht im Fokus einer Gemeinschaftsveranstaltung,<br />
zu der die DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e. V. – zusammen mit der<br />
DECHEMA – Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie<br />
e. V. – einlädt. Die Tagung, die am 7. und 8. November<br />
2011 in Frankfurt/Main stattfindet, befasst sich schwerpunktmäßig<br />
mit den Themen Energie- und Kosteneffizienz, Umsetzung<br />
innovativer Verfahren zur Reduktion von Umweltbelastungen sowie<br />
Automatisierung und Optimierung von Prozessen. Informationen<br />
zu Förderprogrammen für Unternehmen runden das Tagungsprogramm<br />
ab.<br />
Parallel zur Veranstaltung präsentieren sich Unternehmen mit<br />
ihren Produkten und Dienstleistungen für die Behandlung von<br />
Industriewasser. Tagungsbesucher können sich so direkt vor Ort<br />
informieren und beraten lassen.<br />
15. Workshop<br />
Kolbenverdichter<br />
am 19./20. Oktober 2011 in Rheine<br />
KÖTTER Consulting Engineers KG • Bonifatiusstr. 400 • 48432 Rheine<br />
Tel.: 05971 - 9710.0 • info@koetter-consulting.com<br />
Reinigung von TW- Verteilungsleitungen<br />
! Diensteleister, WVU, Existenzgründer !<br />
effiziente Saugspülanlagen, Neuauflage<br />
·<br />
·<br />
Kontakt:<br />
komplettes Know-how-Paket,<br />
inkl. Software, Werbeschriften<br />
ausgereifte, leicht bedienbare Technik<br />
auf Transporter für 1-Mann Bedienung<br />
·<br />
umfassende Schulung/<br />
praktische Ausbildung mit Zertifikat<br />
· diverse modifizierte Gebrauchtanlagen<br />
WtL Edgar Klose<br />
Fiete Schulze-Str. 13<br />
06116 Halle/Saale<br />
Innovationen · Betriebsabläufe<br />
Überwachung · Instandhaltung<br />
Praxiserfahrungen · Wartung<br />
Fachausstellung · Diskussion<br />
Demonstration · und vieles mehr<br />
...damit<br />
Sie nicht in<br />
die Röhre<br />
schauen!<br />
Jetzt online ANMELDEN! www.kce-akademie.de<br />
Tel. 0345-685 90 71<br />
Fax 0345-685 91 01<br />
wtl.klose@t-online.de<br />
Hotline 0172-346 20 20<br />
Kontakt: www.dechema.de/wassertechnik2011<br />
8-9 / 2011 605
24.10.<br />
24.10.
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
<strong>Neue</strong> Gesetze verändern die<br />
Energiebranche<br />
Von Christian Fürst<br />
MaSSnahmenpaket zur Energiewende<br />
Die im Nachgang zur Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima<br />
forcierten Aktivitäten des deutschen Gesetzgebers<br />
zur Beschleunigung des Ausstiegs aus der Kernenergie und<br />
des Ausbaus der Stromerzeugung aus regenerativen Energien<br />
sowie zur Umsetzung des dritten Richtlinienpakets der EU-<br />
Kommission haben im besonderen Sinn des Wortes zu einer<br />
Energiewende geführt, bei der die Praxis wird zeigen müssen,<br />
ob es sich um eine segeltaugliche, moderate Halse oder<br />
eher um einen bolidentypischen Powerslide handelt. Bereits<br />
im parlamentarischen Verfahren hatte es einige Wendemanöver<br />
gegeben, als die Bundesregierung kurz vor der finalen<br />
Bundesratssitzung Einfluss auf die zuvor ablehnende Haltung<br />
einiger Bundesländer nahm und deren Ministerpräsidenten<br />
mit Zugeständnissen auf einen gemeinsamen Kurs brachte.<br />
Zur Bewertung dieses Kurswechsels gilt es zunächst zur<br />
Kenntnis zu nehmen, mit welchen gesetzgeberischen Einzelmaßnahmen<br />
die Energiewende eingeleitet wurde.<br />
1.1 Energiewirtschaft<br />
Am 3. August 2011 ist das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher<br />
Vorschriften, das im Wesentlichen die Neuregelungen<br />
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) umfasst,<br />
im Bundesgesetzblatt (Nr. 41/2011, S. 1554 ff.) verkündet<br />
worden. Es dient in erster Linie der Umsetzung des<br />
dritten EU-Richtlinienpakets, der Förderung von Investitionen<br />
und Versorgungssicherheit sowie der Stärkung von Verbraucherrechten.<br />
Das Artikelgesetz trat am 4. August 2011<br />
in Kraft. Damit erlangen die <strong>neue</strong>n Vorschriften unmittelbare<br />
Geltung. Das bedeutet, die Neuregelungen der einzelnen<br />
Gesetze sind grundsätzlich sofort anzuwenden, deren Vorgaben<br />
also umgehend umzusetzen. Etwas anderes gilt nur<br />
in den Fällen, in denen Übergangsvorschriften (§§ 118 bis<br />
118b EnWG) explizit Ausnahmen von der sofortigen Anwendbarkeit<br />
enthalten.<br />
1.2 Netzausbau<br />
Das Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus<br />
der Elektrizitätsnetze ist am Tag seiner Verkündung<br />
im Bundesgesetzblatt (Nr. 43/2011, S. 1690 ff.) am 5. August<br />
2011 in Kraft getreten. Kernelement dieses ebenfalls<br />
als Artikelgesetz ausgestalteten Pakets ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz<br />
(NABEG). Es verfolgt das Ziel, die<br />
Voraussetzungen für einen schnelleren Ausbau der Stromübertragungsnetze<br />
zu schaffen, um so unter anderem eine<br />
schnellere Integration er<strong>neue</strong>rbarer Energien in die bestehende<br />
Stromlandschaft zu erzielen. Weitere Anpassungen<br />
des Artikelgesetzes betreffen das EnWG, die Stromnetzentgeltverordnung<br />
(StromNEV) und die Anreizregulierungsverordnung<br />
(ARegV).<br />
1.3 Atomenergie<br />
Das 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes (AtG) wurde<br />
ebenfalls am 5. August 2011 im Bundesgesetzblatt (Nr.<br />
43/2011, S. 1704 ff.) verkündet. Es regelt den stufenweisen<br />
Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022 und trat am<br />
6. August 2011 in Kraft. Der Rückhalt im politischen Umfeld<br />
für den eigentlichen Atomausstieg war derart groß, dass die<br />
Novelle bei der abschließenden Sitzung im Bundesrat nicht<br />
einmal mehr debattiert wurde, die Zustimmung der Länder<br />
wurde lediglich zu Protokoll gegeben.<br />
1.4 Klimaschutz<br />
Bereits am 30. Juli 2011 ist ein weiteres Gesetz, das Teil des<br />
Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur Energiewende<br />
ist, nach Verkündung im Bundesgesetzblatt (Nr. 39/2011,<br />
S. 1509 ff.) in Kraft getreten: das Gesetz zur Förderung des<br />
Klimaschutzes bei der Entwicklung in Städten und Gemeinden.<br />
Darin geht es im Wesentlichen um Änderungen im Bauund<br />
Planungsrecht in Bezug auf Windenergie- und Photovoltaikanlagen.<br />
Eine Klimaschutzklausel erweitert die Festsetzungsmöglichkeiten<br />
zur Nutzung von er<strong>neue</strong>rbaren Energien<br />
und Kraft-Wärme-Kopplung.<br />
Zusätzlich wurde am 5. August 2011 im Bundesgesetzblatt<br />
(Nr. 43/2011, S. 1702 ff.) verkündet und trat am 6. August<br />
2011 in Kraft das Gesetz zur Änderung des Gesetzes<br />
zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“.<br />
Es dient insbesondere der Finanzierung von Maßnahmen<br />
im Bereich des internationalen Klima- und Umweltschutzes<br />
sowie der Förderung von Investitions- und Forschungsvorhaben<br />
im Zusammenhang mit der Energiewende.<br />
1.5 Er<strong>neue</strong>rbare Energien<br />
Das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung<br />
der Stromerzeugung aus er<strong>neue</strong>rbaren Energien ist<br />
am 4. August 2011 im Bundesgesetzblatt (Nr. 42/2011,<br />
S. 1634 ff.) erschienen. Neben diversen Gesetzesanpassungen<br />
enthält es als Hauptbestandteil das EEG 2012. Gemäß<br />
Artikel 13 tritt dieses Gesetz jedoch erst am 1. Januar 2012<br />
in Kraft. Einzige Ausnahme ist die Regelung zur Stromkennzeichnung<br />
(§ 54 EEG 2012), die bereits zum 1. September<br />
2011 in Kraft tritt.<br />
608 8-9 / 2011
© Berni - Fotolia.com<br />
Berichterstattung in der <strong>3R</strong><br />
Die genannten Gesetze werden die Energiebranche nachhaltig<br />
verändern. Davon sind auch die in der Berichterstattung<br />
der <strong>3R</strong> interessierenden Themen rund um die Rohrleitungspraxis<br />
und den Rohrleitungsbau betroffen – rechtlich, politisch,<br />
wirtschaftlich. In einer speziellen Reihe zur Energiewende<br />
werden wir uns daher in den folgenden Ausgaben der <strong>3R</strong><br />
mit einzelnen Schwerpunkten, grundlegenden gesetzlichen<br />
<strong>Neue</strong>rungen, besonderen Anforderungen und nachhaltigen<br />
Auswirkungen befassen.<br />
Den Anfang macht eine vertiefende Darstellung des EnWG<br />
in Heft 10, das rechtzeitig zur GAT 2011 erscheinen wird. Hier<br />
werden auch die Auswirkungen der forcierten Entflechtung<br />
erneut dargestellt, die auf der Grundlage des 3. EU-Binnenmarktpakets<br />
zuletzt in Heft 5/2010 thematisiert wurden.<br />
In Heft 11 wird der Schwerpunkt der rechtlichen Betrachtung<br />
auf den Neuregelungen zum Netzausbau und den Bemühungen<br />
zu dessen Beschleunigung, insbesondere auf der<br />
Grundlage des NABEG, liegen.<br />
Abschließend beschäftigt sich Heft 12 mit der alternativen<br />
Energietechnik und dem Maßnahmenpaket für er<strong>neue</strong>rbare<br />
Energien. Die geplante Darstellung umfasst einen Überblick<br />
zum EEG 2012.<br />
Fazit<br />
Etwas mehr Verantwortungsbewusstsein als bei einem noch<br />
so kontrolliert ausgeführten Powerslide wird man einem parlamentarischen<br />
Gesetzgebungsprozess wohl zubilligen müssen.<br />
Gleichwohl werden etliche Bestandteile der o.g. Gesetze<br />
zeigen, dass in dem – unter großem politischem und zeitlichem<br />
Druck betriebenen – Gesetzgebungsverfahren etliche<br />
Kritikpunkte nicht ausreichend im parlamentarischen Diskurs<br />
gewürdigt wurden. Die Folge ist, dass es den Gesetzestexten<br />
nicht selten an Klarheit fehlt. Zumindest die sprachliche Verständlichkeit<br />
bewegt sich häufig an der Grenze dessen, was<br />
in der deutschen Sprache noch an Komplexität hinzunehmen<br />
ist. Dieser legislative Mangel muss von der Administrative in<br />
der Gesetzesanwendung und der Judikative in der nachgelagerten<br />
Streitbeilegung korrigiert werden. Auch legislativer<br />
Nachbesserungsbedarf wurde bereits zeitnah für den Herbst<br />
2011 angemahnt.<br />
Um im Bild der Segler zu bleiben, mag es sich also wohl<br />
um eine als Halse ausgestaltete Energiewende handeln. Dann<br />
ist es aber zumindest eine Regattahalse, also ein schnelleres<br />
Wendemanöver, das speziell für Regatten entwickelt wurde.<br />
Hoffentlich verkommt dieses Manöver nicht zu einer Patenthalse;<br />
darunter versteht man eine unbeabsichtigte Halse,<br />
auf die weder Schiff noch Mannschaft vorbereitet sind und<br />
bei der durch einen überschlagenden Segelbaum Gefahr für<br />
Schiff und Besatzung bestehen kann.<br />
Autor<br />
RA Christian Fürst<br />
Erdgas Münster , Münster<br />
Tel. +49 251/2800-107<br />
E-Mail: Christian.Fuerst@erdgas.de<br />
8-9 / 2011 609
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Rohrleitungssysteme aus GfK<br />
Standards, Prüfungen und Zertifikate – Versprechen gehalten?<br />
Von Achim Dörfler und Marcus Demetz<br />
Zusammenfassung: Industriell gefertigte Produkte aus glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK), insbesondere Rohrleitungssysteme,<br />
eroberten auch in den vergangenen Jahren kontinuierlich weitere Anwendungsgebiete und Marktanteile.<br />
Vor allem in strukturell anspruchsvollem Umfeld oder wenn überragende chemische bzw. korrosive Beständigkeit gefordert<br />
sind, hat GFK in der Anlagentechnik und dem Bauwesen eine fortschreitende und nachhaltige weitere Entwicklung<br />
genommen. Die Vielzahl an Vorteilen gegenüber „klassischen“ Werkstoffen geben hierfür gute Gründe.<br />
Im Gegenzug zu dieser positiven Entwicklung und vor dem Hintergrund einer zunehmenden Globalisierung des Markts<br />
werden jedoch auch besondere <strong>Herausforderungen</strong> im Zusammenhang mit der Bewertung von Eignung und Güte von<br />
angebotenen GFK-Rohrsystemen offenbar. Hier soll ein näherer, auch kritischer Blick auf die ganzheitliche Zertifizierung,<br />
Ausführung, Güteüberwachung und Dokumentation von Rohrleitungssystemen aus GFK gegeben werden.<br />
Einführung<br />
Das Wort „Zertifikat“ lässt sich ableiten vom Lateinischen<br />
“certus“ (= sicher, bestimmt) und „facere“ (= machen). Zertifizierung<br />
ist also ein Verfahren, in dem ein unabhängiger Dritter<br />
schriftlich bestätigt, dass ein Erzeugnis, ein Verfahren oder<br />
eine Dienstleistung vorgeschriebene Anforderungen einhält.<br />
Was aber ist konkret für den Werkstoff GFK zu tun, um<br />
Auswahl und Anwendung grundsätzlich abzusichern? Auch<br />
und gerade vom Werkstoff GFK werden, wie von jedem anderen<br />
Konstruktionswerkstoff, „zugesicherte“ Eigenschaften<br />
gefordert.<br />
Zumindest wenn es um weitgehend standardisierte oder<br />
seriell produzierte Komponenten bzw. Halbzeuge geht, werden<br />
(im Unterschied zu individuellen Expertisen) meist allgemein<br />
gültige Bauart-Zulassungen erwartet. Darunter fällt als<br />
typisches, teils anspruchsvolles und stets variantenreiches<br />
Beispiel die Gruppe der GFK-Rohrsysteme, zu deren Marktfähigkeit<br />
es somit unabdingbare Voraussetzung ist, dass sowohl<br />
Hersteller als auch das Produkt selbst von neutraler und<br />
benannter Stelle allgemein zugelassen worden ist.<br />
Insbesondere bei GFK muss immer noch Vertrauen aufgebaut<br />
werden, das nur durch allgemeines Material- und<br />
Prozessverständnis erzeugt werden kann, welches wiederum<br />
nachvollziehbare Vorgänge zur Eignungsfeststellung und<br />
Qualitätssicherung voraussetzt.<br />
Vor dem Hintergrund dessen sind zu diesem Thema nützliche<br />
und international gültige Regelwerke verfügbar. Danach<br />
erstellte Dokumentationen müssten also weitgehend äquivalent<br />
und vergleichbar sein. Allerdings sind auch nicht alle eingeführten<br />
Normen und Regelwerke in jedem Punkt fachlich<br />
hinreichend oder korrekt.<br />
Für den Anwender stellt sich oft als zentrales Problem, zu<br />
beurteilen ob Angebote und vorgelegte Dokumente jeweils<br />
auch bei näherem Hinsehen fachlich den an sie zu stellenden<br />
Ansprüchen gerecht werden. Und ist überhaupt eine Argumentationskette<br />
erkennbar, die wenigstens in sich nachvollziehbar<br />
und noch dazu für die spätere Anwendung von Relevanz<br />
ist?<br />
Erfüllt also das Zertifikat sein Versprechen, einen für den<br />
Hersteller als auch Produkt ausreichenden oder gar umfassenden<br />
und anwendungsrelevanten Nachweis zu liefern?<br />
Gerade für den überaus variablen Werkstoff GFK ist das<br />
Thema Zertifizierung vergleichsweise komplex. So ist es häufig<br />
eine Herausforderung, deutlich offensichtliche Preisunterschiede<br />
von „gleichwertig“ erscheinenden Systemanbietern<br />
hinreichend fachlich, anwendungsbezogen und ökonomisch zu<br />
bewerten. Dies gilt umso mehr, wenn ein Mangel an Expertise<br />
mit primärer Kostenorientierung einhergeht. Im Interesse<br />
eines fairen, globalen Anbieter-Wettbewerbs erscheinen im<br />
Überwachungs- und Zertifikatswesen aus aktuellen Anlässen<br />
und Beobachtungen Verbesserungen nötig.<br />
GFK – aber nur mit ganzheitlichem<br />
Ansatz<br />
Das Ziel aller Standards, Prüfungen und Zertifizierungen besteht<br />
im Wesentlichen darin, sicherzustellen, dass jedes gelieferte<br />
Serienprodukt den vordefinierten, d. h. vom Baumuster<br />
erwarteten Anforderungen entspricht. Hierzu sollen zwei<br />
wesentliche Begriffe und deren allgemeine Zielsetzung genannt<br />
werden:<br />
1. Qualifikation…<br />
…ist die umfassende und nachvollziehbare Erlangung von<br />
Kenntnissen über das exakte Werkstoffverhalten. Sie beinhaltet<br />
vor allem den Gewinn aller auslegungsrelevanter<br />
Kennwerte, Einsatzgrenzen, Toleranzen und Streuungen<br />
der Bauteile, Baumuster oder Prototypen- und zwar unter<br />
realen/zur Serie repräsentativen Fertigungsbedingungen.<br />
2. Konformität…<br />
…ist die klassische Qualitätssicherung. Sie findet zumeist<br />
im Serienprozess statt und beinhaltet die Sammlung und<br />
Auswertung nachvollziehbarer, bedarfsgerechter und sta-<br />
610 8-9 / 2011
Tabelle 1: Übergeordnete Regelwerke/ Richtlinien (Auszug)<br />
Norm Klassifikation Geltungs-/<br />
Nennweitenbereicstufen<br />
Nenn-Druck-<br />
Nenn-Steifig-<br />
Anwendungs bereich<br />
PN [bar] keiten SN<br />
DN [mm]<br />
[N/m]<br />
Bemerkung/<br />
Gültigkeit<br />
Übergeordnete Regelwerke/ Richtlinien<br />
W.E.G.<br />
Richtlinie<br />
(2010)<br />
diverse diverse n/a Öl- und Gasförderung, gültig (D)<br />
ASTM D2996 (2001) diverse diverse n/a Vorgabe zur Klassifikation von<br />
GFK-Rohren<br />
VGB R609<br />
(2003)<br />
n/a n/a n/a Richtlinie Konstruktion, Anwendung<br />
und Güteüberwachung von<br />
GFK im Kraftwerksbau<br />
ATV A-127 (2000) alle 1 alle Rohr-Rohrgraben statische<br />
Berechnung Drucklose Kanäle<br />
AWWA M45 Fiberglass Pipe<br />
Design (2nd. Edition 2005)<br />
25 – 3600 alle alle Handbuch GFK-Rohre und<br />
Auslegung inkl. statische<br />
Berechnung Rohr-/ Rohrgraben für<br />
Wasserwesen auch Druckrohre<br />
gültig (US, Int.)<br />
Gültig (D),<br />
in Überarbeitung<br />
Gültig (D, EU)<br />
ASTM D2310 (2001) n/a n/a alle- Klassifikation Gültig (US)<br />
In Referenz zu GFK-Rohrnorm ANSI/<br />
AWWA C-950 sowie Ansatz kompatibel<br />
zu anerkannten ASTM/ ISO/ EN<br />
Gültig (Int.)<br />
tistisch gesicherter Überwachungsdaten entlang der Fertigung.<br />
Allgemein vorherrschend ist das Verständnis von Qualität im<br />
Sinne von Qualitätssicherung bzw. deren Mechanismen. Dagegen<br />
treten besonders bei „<strong>neue</strong>n“ Werkstoffen Unklarheiten,<br />
unterschiedliche Ansätze oder Differenzen dann auf,<br />
wenn es um deren zugesicherte Kennwerte bzw. Einsatzgrenzen<br />
geht. Also um die Beschaffenheit (Qualität) an sich, so wie<br />
sie in der Typ- oder Zulassungsprüfung gewonnen wurden.<br />
Diese allein aber sind geeignet, Basis für jegliche weitere Bewertungen<br />
zu liefern.<br />
Darum sollte ein grundlegendes Prüf-, Bauteil- und Werkstoffwissen<br />
möglichst umfassend auch beim Hersteller „erzeugt“<br />
werden, um optimierte bzw. anwendungsgerechte<br />
Produkte zu entwickeln, sowie der angeschlossenen Qualitätssicherung<br />
eine klare Bewertungsbasis (z. B. Maße, Toleranzen,<br />
Parameter) zu liefern, auch später wirksam in Form<br />
von Vertragsbestandteilen zwischen Kunden und Lieferanten.<br />
Konsequenterweise wird es daher auch von TÜV SÜD unterstützt,<br />
im Rahmen von Zulassungen einen sinnvollen Teil an<br />
Prüftätigkeit im Werk zu belassen (z. B. große Bauteile, lange<br />
Prüfdauer, Prüfaufwand/Personalkosten). Dazu stehen für die<br />
Dauer der entsprechenden Versuchsreihen bewährte Messgeräte<br />
und Datenübertragungssysteme für die elektronische<br />
Fernüberwachung bereit.<br />
In der Folge wird es für den so qualifizierten Hersteller,<br />
ganz im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes möglich sein,<br />
dass in möglichst erkenntnisreicher Weise die eigenen Ergebnisse<br />
aus der regelmäßigen Gütesicherung mit entsprechenden<br />
bauarttypischen Kriterien verknüpft und interpretiert<br />
werden können. Darin müssen die besondere Kunst und<br />
das Wissen eines Lieferanten liegen, denn es ist die Problematik<br />
aller entsprechenden Normen, Spezifikationen oder QM-<br />
Systeme, hierzu nur allgemeingültige Mindeststandards definieren<br />
zu können.<br />
Normen und Regelwerke<br />
Allgemein sind zu unterscheiden:<br />
Produktnormen<br />
Prüfnormen<br />
Sonstige/übergeordnete Regeln, Richtlinien, Spezifikationen<br />
Erstere definieren bestimmte Erzeugnisse, deren Anwendungsbereich<br />
und das an sie gestellte (Mindest-) Anforderungsprofil.<br />
Prüfnormen dagegen stellen geregelte Prüfmethoden<br />
für die konkrete Nachweisführung zur Verfügung. Da<br />
die Prüfnormen meist als bindende Referenzen in der Produktnormung<br />
enthalten sind, kann auf explizites Listen in der<br />
Regel verzichtet werden.<br />
Normen sind also für jeden nachvollziehbaren Bewertungsprozess<br />
eine unerlässliche Voraussetzung.<br />
Darüber hinaus können je nach Anwendungsfall weitere,<br />
übergeordnete Richtlinien zu beachten sein, z. B. Bergrecht,<br />
TRFL (Fernleitungen) und insbesondere die Druckgeräterichtlinie<br />
97/23 EG. Auch aus diesen heraus entsteht meist die<br />
Notwendigkeit, spezifische Nachweise nach dem Stand der<br />
Technik erbringen zu müssen. Weitere Richtlinien oder Spezifikationen<br />
existieren daneben teils in Ergänzung zu verbindlichen<br />
Normen, die auch informativ sein können und weitere<br />
Hilfestellungen oder Anleitungen bieten.<br />
Eine Übersicht über gültige Normen von GFK-Bauprodukten<br />
nebst Gültigkeitsbereichen geben die Tabellen 1 bis 5.<br />
Zertifizierung oder Zertifikat?<br />
Derzeit wird Zertifikaten als Papier im globalen Marktumfeld<br />
eine übermäßige Attraktivität zugemessen. Die Zertifizierung<br />
als dahinter stehender Prozess erscheint weit weniger populär.<br />
Viele Anfragen, vor allem aus außereuropäischen Ländern,<br />
betreffen nach der Erfahrung von TÜV SÜD möglichst umfängliche<br />
Freigabe-Zertifikate für Hersteller von GFK-Rohren.<br />
8-9 / 2011 611
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Tabelle 2: Chemie-/ Produktenleitungen, Druckrohre aus GFK und Anwendungsbereiche (Auszug)<br />
Norm Klassifikation Geltungsbereich/<br />
Anwendungsbereich<br />
Harzbasis<br />
Nennweitenbereich<br />
DN [mm]<br />
Nenn-<br />
Druckstufen<br />
PN [bar]<br />
Nenn-Steifigkeiten<br />
SN<br />
[N/m]<br />
Rohrnormen<br />
DIN 16965-1-5 (1982) UP, VE 25 - 1000 2,5 - 16 - GFK-Druckrohre Industrie,<br />
verschiedene Bauarten<br />
DIN 16966-1-8 (1988) UP, VE 25 - 1000 2,5 - 16 - Formstücke/ Verbindungen<br />
Industrie, verschiedene<br />
Bauarten<br />
DIN 16964 (1988) UP, VE 25 - 1000 2,5 - 16 - GFK-Druckrohre Industrie,<br />
verschiedene Bauarten<br />
API 15LR (2001) EP, UP 50 - 600 diverse - Öl- und Gasförderung Gültig (US)<br />
API 15HR (2001) EP, UP, VE 25 - 250 diverse - Öl- und Gasförderung Gültig (US)<br />
ASTM D2517 (2000)<br />
ISO 14692<br />
Teil 1-4 (2002)<br />
EP, VE, UP,<br />
PF<br />
bis ca.1000 alle n/a<br />
(Derzeit)<br />
Öl- und Gasförderung, auch:<br />
Standard für diverse<br />
Industrieleitungen/<br />
Produktenleitungen (in<br />
Teilen)<br />
Bemerkung/ Gültigkeit<br />
Referenz zueinander.<br />
Ausführungsvorschrift, kein<br />
Kennwert-basiertes<br />
Qualifikationsprogramm (D)<br />
Prüfnorm in Referenz zu<br />
DIN 16965/ 16966 (D)<br />
allg. anerkannt umfassende<br />
Nachweise zur Qualifikation<br />
(Teil 2), in ständiger<br />
Überarbeitung<br />
Gültig (Int.)<br />
Tabelle 3: Regelwerke Wasserwesen/ Großrohre/ Niederdruck und Anwendungsbereiche (Auszug)<br />
Norm Klassifikation Geltungsbereich/<br />
Harzbasis Nennweitenbereich<br />
Nenn- Nenn-Stei-<br />
Anwendungsbereich<br />
Druckstufigkeiten<br />
SN<br />
DN [mm] fen PN [bar] [N/m]<br />
Rohrnormen<br />
DIN 19565-1-2 (1989) UP 200 - 2000 1 - 6 2500<br />
- 10000<br />
Abwasserkanäle geschleudert,<br />
gefüllt<br />
DIN 16868-1-2 UP (VE) 100 - 3200 1 - 25 630 - 10000 Rohre aus UP-GF (Wasserwesen)<br />
gewickelt, gefüllt<br />
ISO 10467 (2004) UP 50 - 4000 1 - 32 500 - 10000 Abwasser/ Entwässerung/<br />
Industrie<br />
EN 14364 (2006) UP 100 - 3000 1 - 32 500 - 10000 Abwasser / Entwässerung/<br />
Industrie<br />
Bemerkung/<br />
Gültigkeit<br />
Ersetzt durch EN 1796/<br />
EN 14364 (D)<br />
Ersetzt durch EN 1796/<br />
EN 14364 (D)<br />
äquivalent/<br />
gültig<br />
(Int.)<br />
EN 1796 (2006) UP 100 - 3000 1 - 32 500 - 10000 Wasserversorgung äquivalent/<br />
ISO 10639 (2004) UP 50 - 4000 1 - 32 500 - 10000 Wasserversorgung<br />
gültig<br />
(Int.)<br />
CEN/TS 14632 (2008) UP alle alle alle Wasserversorgung Abwasser/<br />
Entwässerung/ Industrie<br />
ANSI / AWWA C950<br />
(2002)<br />
EP, UP, VE 25 - 3600 3 - 17 - GFK-Rohre Wasserwesen Gültig (US)<br />
ASTM D3262 (2001) UP, VE, EP 200 - 3700 1 - Abwasser / Industrie<br />
Kanäle drucklos<br />
Konformitätsverfahren in<br />
Referenz zu EN 1796/<br />
EN 14364 (äquivalent ISO<br />
10639/ ISO 10467)<br />
gültig (US)<br />
ASTM D 3754 (2001) EP, UP, VE 200 - 3700 1 - 17 alle Abwasser / Industrie gültig (US)<br />
ASTM D3517 (2001) EP, UP 200 - 3700 1 - 17 alle GFK-Druckrohre gültig (US)<br />
ASTM D2997 (2001) EP, UP, div. 25 - 350 - - GFK-Rohre geschleudert/<br />
gefüllt<br />
ASTM D4161 (2001) - 200 - 3700 1 - 17 - Kupplungen GFK-Rohre mit<br />
Elastomerdichtungen<br />
gültig (US)<br />
Gültig (US)<br />
612 8-9 / 2011
Tabelle 4: Regelwerk Pultrusionsprofile<br />
Norm Harzbasis Klassifikation Geltungsbereich/ Anwendungsbereich<br />
Nenn-Festigkeit<br />
[N/mm²]<br />
Nenn-Steifigkeiten<br />
SN [N/m]<br />
Pultrusionsprofile für tragende Strukturen<br />
EN 13706-1-2 (2002) diverse E 17 / E 23 Pultrudierte Profile aus GFK,<br />
Bauwesen<br />
Bemerkung/ Gültigkeit<br />
Klassifikationssystem, Spezifikation,<br />
gültig (Int.)<br />
Tabelle 5: Regelwerk Behälter (Auszug)<br />
Norm Harzbasis Klassifikation Geltungsbereich/ Anwendungsbereich<br />
Tanks und Behälter<br />
EN 13121-1-4 (2003-2010) diverse keine Oberirdische GFK-Tanks und<br />
Behälter<br />
Bemerkung/ Gültigkeit<br />
Inkl. Spezifikation,<br />
gültig (Int.)<br />
Auch sind derartige Zertifikate in teils extrem kurzer Form,<br />
aber auf umfangreicher Normenbasis im Markt.<br />
Bei einigen Akteuren scheint hier die Erwartungshaltung<br />
vorzuliegen, Eignungs- und Konformitätsnachweise als vorwiegend<br />
formalen Akt behandelt und möglichst nach allen<br />
verfügbaren Produktnormen bescheinigt zu bekommen. Dies<br />
offenbar mit dem Ziel, mit überschaubarem Aufwand – d. h.<br />
ohne besondere Prüfungen oder weitere Voraussetzungen zu<br />
bieten – eine überregionale Marktreife zu erlangen. Diese Einschätzung<br />
ist grundlegend falsch, da die Zulassungsprüfung<br />
von GFK-Produkten allgemein und insbesondere von Rohren<br />
eine Vielzahl an Einzelnachweisen voraussetzt, also sowohl<br />
ein hochgradig technisches als auch formal anspruchsvolles<br />
Prozedere darstellt. Kann die gesamte Zulassung und<br />
Konformitätsbescheinigung also beispielsweise auf einseitige<br />
Zertifikate passen?<br />
Derzeit kursieren eine Vielzahl derartiger „Freibriefe“ aus<br />
unterschiedlichsten Quellen. Solche Dokumente, wie auch<br />
entsprechend umfassende Ausführungen und Referenzen in<br />
Katalogen o. ä., sollten vor Auftragsvergabe also stets kritisch<br />
hinterfragt werden.<br />
Zertifikate mit substanziellem Inhalt werden daher stets<br />
eindeutig Aufschluss geben über<br />
Anschrift der benannten Stelle (d. h. einer akkreditierten<br />
Stelle),<br />
Datum der Zertifikatserstellung,<br />
Auftragsnummer,<br />
Nummer des bezogenen Prüfberichts,<br />
Gegenstand der Untersuchung/Anwendungsbereich,<br />
Produkt-/Herstellerbezeichnung,<br />
bei konkreten Prüfungen/Audits: Zeitraum der Prüfung,<br />
Normative Verweise, ggf. inkl. Limitierung/Einschränkung/Ausnahme,<br />
Gültigkeitszeitraum/Ablauf,<br />
Datum, Stellenbezeichnung/Unterschrift der Verantwortlichen<br />
(Namen lesbar in Reinschrift) usw.<br />
Weiterhin sind beispielsweise allgemeine Grundlagen wie das<br />
durchgängige 4-Augen-Prinzip, d. h. die Trennung zwischen<br />
Fach-Zertifizierer und Prüfer einzuhalten usw. Im Anhang ist<br />
das Beispiel einer nachvollziehbaren und weiterführenden<br />
Zertifikatserstellung gegeben (hier: bezeugte Druckprüfung).<br />
Fehlen aber insbesondere Referenzen zu entsprechend<br />
konkreten Prüfberichten oder die Angaben zu Akkreditierungen<br />
der Stelle, Verweise auf durchgeführte substanzielle Tätigkeiten<br />
oder ähnliche Nachweise, kann das betreffende Dokument<br />
ohne Ansehen der Urheberschaft guten Gewissens<br />
zurückgewiesen werden.<br />
Prüfungen<br />
Bild 1 zeigt die Besonderheiten von GFK.<br />
Bild 1:<br />
8-9 / 2011 613
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Bild 2:<br />
Im Gegensatz zu metallischen oder anderen anorganischen<br />
bzw. isotropen Werkstoffen haben für Kunststoffe die<br />
Parameter Zeit, Spannung, Temperatur und Medieneinfluss<br />
den wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer.<br />
Besonders hervorzuheben ist, dass bei der Produktion<br />
von GFK-Komponenten grundsätzlich sowohl der Werkstoff<br />
selbst irreversibel gebildet, als auch die Formgebung vollzogen<br />
wird. Aus diesem fundamentalen Zusammenhang heraus<br />
ist es ersichtlich, welche annähernd unbegrenzten Einflussmöglichkeiten<br />
und Gestaltungsfreiheiten dem Produzenten<br />
zur Hand stehen. Und auch, dass hier im Vergleich zu „klassischen“<br />
Materialien auf der einen Seite ein großes Optimierungs-,<br />
auf der anderen aber auch entsprechendes Fehlerpotenzial<br />
liegen kann.<br />
Als Konsequenz hieraus sind im Umgang mit GFK also an<br />
jeder Stelle besondere Ansprüche und ein umfassendes Werkstoffverständnis<br />
an die Lieferanten sowie die Überwacher und<br />
Fachzertifizierer zu stellen.<br />
Bestimmte Voraussetzungen zu den herstellereigenen<br />
Prüftätigkeiten sollten gegeben und weitgehend schon zur<br />
Zulassungs- und Bauteilprüfung genutzt werden. Hier sind v.<br />
a. qualifiziertes Personal, entsprechende Labore und Räumlichkeiten<br />
mit einer spezifischen Ausrüstung für die wesentlichen<br />
Bauteilprüfungen gemeint, wie<br />
Stationen für Kurzzeit- und Zeitstand-Innendrucktests<br />
nebst Klimakammern, Pumpen und Messmittel/Sensoren,<br />
Scheiteldruck-/ bzw. Biegeprüfstände,<br />
Prüfvorrichtungen für Zeitstand-Versuche wie Einlagerungs-,<br />
Spannungsriss- oder Kriechversuche,<br />
Universal-Prüfmaschinen zur Durchführung weiterer mechanisch-technologischer<br />
Werkstoffprüfungen,<br />
Laborausstattung für thermische, nasschemische oder<br />
Korrosionsuntersuchungen.<br />
Ist ein derart ausgestattetes Werkstofflabor, Entwicklungsoder<br />
Technologiezentrum nicht nur unabhängig von der Fertigung<br />
organisiert, sondern idealerweise (z. B. im Sinne ISO /<br />
IEC 17025:2005) eigens zertifiziert, kann es auch formal vom<br />
Fachzertifizierer als Lieferant von Teilergebnissen bei beaufsichtigten<br />
Typprüfungen anerkannt werden. Es ist so in der<br />
Lage, nicht nur im Rahmen der Zertifizierung „eigene“ Unter-<br />
suchungsergebnisse darzustellen. Diese Konstellation (zertifiziert<br />
wie im Anhang dargestellt) kann besonders vorteilhaft<br />
sein im Zusammenhang mit zeit- und kostenintensiven Eignungs-<br />
und Bauteiluntersuchungen, die ggf. im Rahmen des<br />
„Witnessing“ oder Parallelprüfens durch den Zertifizierer vollumfänglich<br />
anerkannt werden können.<br />
Hinsichtlich der regulären Qualitätssicherung sind ohnehin<br />
bestimmte Prüfmittel vorauszusetzen, z. B. Werkzeuge<br />
zur Probennahme, Maß- und Dickenprüfung, optischen Kontrolle<br />
u. a. die jeweils einer entsprechenden Prüfmittelüberwachung<br />
unterliegen.<br />
Erst- oder Typprüfung (ITT)<br />
Diese grundlegenden Zulassungsprüfungen werden als Erst-,<br />
Typ- oder Baumusterprüfungen bezeichnet. Annähernd alle<br />
Regelwerke für GFK-Rohre stimmen hierzu in einem grundsätzlich<br />
Kennwert- oder „Performance“-basierten Ansatz<br />
überein. Bewusst wird dem Anbieter dabei eine weitgehende<br />
Gestaltungsfreiheit belassen dahingehend, wie er allgemein<br />
definierte Anforderungen erreichen könnte – er muss eben deren<br />
Nachweis führen. Dieser Ansatz löst zunehmend die früher<br />
verbreitete Vorstellung ab, wonach unter Normierung eine<br />
Gestaltungsvorschrift verstanden wird (was für isotrope, homogene<br />
und umformbare Werkstoffe auch eher ein adäquater<br />
Ansatz ist). Das Konzept ist daher besonders werkstoffgerecht.<br />
Dabei ist es üblich, das Verhalten des Verbundwerkstoffs im<br />
Zusammenhang mittels grundlegender Tests an repräsentativen<br />
Referenzproben nachzuweisen, d. h. vorrangig Erkenntnisse<br />
über das Langzeitverhalten, die Betriebsgrenzen zu ermitteln,<br />
aber auch bereits evtl. Produktionsstreuungen statistisch<br />
zu quantifizieren.<br />
Allgemein bzw. formal wird das Procedere einer repräsentativen<br />
Typprüfung z. B. in der Druckgeräterichtlinie 97/23 EG<br />
(Baumusterprüfung, Anhang 3, Modul B) vorgeschlagen und<br />
umrissen, natürlich aber nicht werkstofflich bezogen.<br />
Da an einer werkstofflichen und bauartspezifischen Referenz<br />
das grundlegende Verhalten geprüft wird, muss, auch um<br />
die Repräsentativität zur Serie zu belegen, an erster und wichtigster<br />
Stelle der Zulassungsprüfung stehen:<br />
eine eindeutige Identifikation und nachvollziehbare „Historie“<br />
der Prüflinge,<br />
die exakte Dokumentation der eingesetzten Rohmaterialien,<br />
die Darstellung der Bauweise, der Fertigungsparameter und<br />
-verfahren,<br />
allgemeine mitgeltende Vorschriften und Anweisungen,<br />
zulässige Varianzen/Maße/Toleranzen,<br />
Prüfbedingungen.<br />
In den anwendbaren Produktnormen sind für alle relevanten<br />
Bauteil- und Werkstoffprüfungen Referenzen zu jeweils anerkannten<br />
Prüfmethoden enthalten. Dies macht die ermittelten<br />
Kennwerte vergleichbar und weitgehend auch übertragbar.<br />
Ein solches Programm einer repräsentativen Typprüfung<br />
von GFK-Rohren wird in besonders detaillierter und werkstoffspezifischer<br />
Form in der ISO 14692-2 angewandt, weshalb<br />
diese als konkretes Beispiel bzw. zur Übersicht über Elemente<br />
einer Bauartzulassung von Druckrohren aus GFK dienen kann.<br />
614 8-9 / 2011
Composites korrodieren nicht, aber sie „bauen ab“. Der<br />
entsprechende Gradient dieser gesamten, teils interagierenden<br />
Degradation nach Zeit, Temperatur, Chemie und Spannung<br />
sollte also am Muster bekannt und so für die Anwendung nachvollziehbar<br />
prognostizierbar werden.<br />
In ISO 14692-2, wie auch in annähernd allen derzeit gültigen<br />
Normen, wird deshalb als zentraler Werkstoff- und Bauartnachweis<br />
die Zeitstand-Innendruckfestigkeit geprüft. Eine<br />
dazu allgemein übliche Prüfmethode ist die Regressionsanalyse<br />
z. B. nach ASTM D 2992, wie in Bild 2 exemplarisch<br />
ausgewertet.<br />
Die entsprechenden Zeitstand-Versuche<br />
werden unter vorher festgelegten,<br />
dem Anwendungsfall und Werkstoff<br />
angepassten Betriebstemperaturen unter<br />
Wassereinwirkung gefahren und liefern<br />
in nachvollziehbarer Weise:<br />
die von Matrix, Laminat und Technologie<br />
sowie Temperatur- und Medieneinfluss<br />
abhängige Belastbarkeit/<br />
Grenzspannung,<br />
das für das Produkt/Laminat typische<br />
Langzeit-Verhalten (Warm-,<br />
Kriechverhalten, Grenzdehnung),<br />
d. h. von der Prüftemperatur und<br />
dem Laminat abhängige, dehnungsbasierte<br />
lineare Gradienten zur Extrapolation<br />
der Lebensdauer bzw. der<br />
daraus errechneten zulässigen Betriebsspannung<br />
(s. ISO 14692-2:<br />
„qualified stress at qualified temperature“)<br />
anhand ausreichender Anzahl Prüfkörper/Versagenspunkte<br />
(min. 18)<br />
eine statistische Verteilung der Fertigungsstreuung<br />
und statistisch errechnete<br />
Vertrauensgrenzen.<br />
Der englische Begriff „Hydrostatic Design<br />
Basis, HDB“, weist darauf hin, dass<br />
das Verfahren die grundlegenden Eingangsdaten<br />
für die Auslegung und Berechnung<br />
repräsentativer Laminate liefert.<br />
Aber darüber hinaus<br />
wird die Basis-Anforderung dargestellt<br />
zum Nachweis aller weiteren<br />
Komponenten innerhalb des Systems<br />
mit ggf. unterschiedlichem Aufbau<br />
(z. B. Formstücke),<br />
dient der HDB-Wert als Referenz<br />
bzw. Bemessungsgröße für die vereinfachte<br />
Zulassungs- und Freigabeprüfung<br />
bei „Änderungen“, d. h. alternative<br />
Rohstoffe, Bauweisen,<br />
Technologien usw.<br />
Das gesamte weitere Konzept basiert<br />
wesentlich auf dem Gradienten für das<br />
Zeitstandverhalten, ermittelt an diesem<br />
„family representative“ und der Klassifizierung nach Nenndruck<br />
(PN) entsprechend.<br />
Erwähnenswert ist auch die in ISO 14692-2 konkret vorgeschlagene<br />
Form („Annex J, qualification summary form“) zur<br />
Begleitdokumentation. Diese eignet sich als Vorlage zu einer<br />
übersichtlichen Beschreibung des Prüfgegenstandes und stellt<br />
die wesentlichen Kennwerte in Abhängigkeit der typgeprüften<br />
Rohstoffe und Laminatkonstruktion dar.<br />
Eine derartige oder vergleichbare Dokumentation (natürlich<br />
ggf. mit angepasstem Inhalt), kann als Teil oder zumindest als<br />
Institut für Kunststoffe –<br />
40 Jahre umfassendes Know-how.<br />
Seit 40 Jahren widmen wir unsere ganze Leidenschaft der Welt der Kunststoffe.<br />
Wir beraten. Wir prüfen und analysieren. Wir begutachten nach verschiedensten<br />
Prüfnormen und -verfahren. Unsere Arbeit erhöht die Sicherheit Ihrer Bauteile und<br />
verbessert die Qualität und Lebensdauer Ihrer Produkte.<br />
Nutzen auch Sie die Erfahrung und das Know-how vom Institut für Kunststoffe.<br />
TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Telefon +49 (0)89 5791–3228 · www.tuev-sued.de/ifk<br />
110530_Anz_IfK_<strong>3R</strong>-International.indd 1 31.05.2011 11:06:08<br />
8-9 / 2011 615
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
mitgeltende Referenz eines nachvollziehbaren Werkstoff- und<br />
Eignungsgutachtens stets vorausgesetzt werden.<br />
Im Ergebnis werden somit die am Bauteil ermittelten materialimmanenten<br />
Kurz- und Zeitstand-Kennwerte nicht nur als<br />
Eingangsdaten für die gesamte weitere Detail-Auslegung oder<br />
für Spannungsanalysen nutzbar, sondern sie können auch maßgeblicher<br />
Vertragsbestandteil der Lebensdauer/Garantiedauer<br />
bzw. Bemessungsgröße für die Bewertung von evtl. Abweichungen<br />
sein.<br />
In ähnlicher Weise, d. h. innerhalb eines nachvollziehbaren<br />
Prüfprogrammes werden zur Zulassung sämtliche weitere designbestimmende<br />
Kennwerte im Rahmen der Typprüfung bestimmt.<br />
Diese sind nachfolgend nach Anwendung und Norm nur<br />
kurz aufgeführt denn grundsätzlich folgen alle diese Nachweise<br />
der vorangehend geschilderten Philosophie:<br />
Kurz- und Langzeit-Scheiteldruckversuche zur Bestimmung<br />
der spezifischen Ringsteifigkeit, Verformbarkeit und Grenzdehnung<br />
(bei Rohren für erdgedeckten Einbau, Klassifizierung:<br />
SN),<br />
Spannungsrissbeständigkeit („strain-corrosion“) zur Ermittlung<br />
der Beständigkeit gegen Rissbildung unter dem<br />
Einfluss von Verformung und korrosivem Medium,<br />
Langzeit Kriech- und Relaxationsfaktor (naß),<br />
Einlagerungsversuche in Medien zur Bestimmung der chemischen<br />
oder Hydrolyse-Beständigkeit,<br />
sonstige, z. B. hygienische, toxikologische Untersuchungen,<br />
Brandverhalten, elektrische Leitfähigkeit usw.<br />
Konformität, Überwachungsprüfung,<br />
Qualitätssicherung (QS)<br />
Wird von einem nachgewiesenen Produkt gesprochen, d. h. im<br />
engeren Sinne auch ein „zertifizierbares“, werden im Wesentlichen<br />
zwei Dinge vorausgesetzt:<br />
ein kontrollierter Herstellungsprozess<br />
der statistisch gesicherte Nachweis der Einhaltung vordefinierter<br />
Mindesteigenschaften<br />
Beides zu gewährleisten ist zentrale Aufgabe aller qualitätssichernden<br />
Maßnahmen, wie dies auch in allgemeinen Normen<br />
wie ISO 9001 beschrieben wird. Bei GFK-Produkten entsteht<br />
bei genauerer Betrachtung ein zielführendes Konzept von<br />
Überwachungsprüfungen aber nur aus fachgerecht vorgenommenen<br />
Qualifikationstests heraus.<br />
Umfassend wird der gesamte Zusammenhang beispielsweise<br />
in der CEN-TS 14632 1 beschrieben, die in Referenz zu den<br />
allg. Produktnormen EN 1796/EN 14364 steht (de facto also<br />
ebenso zu ISO 10639/ISO 10467).<br />
Entscheidende Bedeutung für die Beurteilung der Konformität<br />
des Serienbauteils zum Baumuster hat grundlegend die<br />
Korrelation zwischen „indirekten Prüfungen“, d. h. Prüfverfahren,<br />
die nur Überwachungswerte im Rahmen der QS liefern und<br />
denjenigen „festgelegten“ aus der Typprüfung, d. h. die v. a. für<br />
Auslegungszwecke geeigneten Kennwerte.<br />
1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Entwässerung und<br />
Wasserversorgung mit und ohne Druck – Glasfaserverstärkte<br />
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von Polyesterharz<br />
(UP) – Empfehlungen für die Beurteilung der Konformität<br />
Zur Veranschaulichung eines möglichen Konfliktes soll als<br />
Beispiel im „Annex J“, Seite 14 dienen („6 general properties<br />
and dimensions“). Die Axial-Zugfestigkeit des Kreuzwickellaminates<br />
wurde hier gemäß ISO 527-4 mit einem Wert von 56<br />
N/mm² angegeben was ungefähr dem Wert eines unverstärkten<br />
Harzes entspricht.<br />
Im selben Dokument wird unter „4.“ ein biaxialer Berstdruck<br />
(p sthp<br />
) von rund 56 bar (g) für dasselbe Baumuster bescheinigt,<br />
der mit o. g. Festigkeit völlig unrealistisch wäre.<br />
Das (nicht zur Streifenprobe geschnittene) geschlossene<br />
Bauteil liefert also tatsächlich eine mehrfach höhere Kurzzeit-<br />
Axialzugfestigkeit von ca. 160 N/mm², die sich wiederum aus<br />
der ermittelten Bruchspannung nach der Kesselformel errechnen<br />
lässt.<br />
So ungeeignet und unzulässig sie also für die Bauteilauslegung<br />
sein mag, als korrelierende Kurzzeit-Überwachungsprüfung<br />
kann eine bestimmte Prüfmethode dennoch sinnvoll eingesetzt<br />
werden (überdies sind Zug-E-Modul und Querkontraktionszahl<br />
nach ISO 527-4 für die Auslegung und Spannungsanalyse<br />
verwendbar).<br />
In diesem Zusammenhang sollte auch auf besondere Gegebenheiten<br />
und „Unzulänglichkeiten“ der hier ebenfalls oft referenzierten<br />
EN 1796 und EN 14364 in Bezug auf geforderte<br />
Axial-Zugfestigkeiten hingewiesen werden. Da diese Normen<br />
vorwiegend der Intention und Bauart erdverlegter (oder uniaxial<br />
belasteter) Rohrsysteme folgen, sollten klassische/freiverlegte<br />
Druckrohre abweichende, zumindest zusätzliche Vorgaben<br />
erfüllen.<br />
Wiederum allgemein gültig und eines der wesentlichsten<br />
weiteren Elemente im Konformitätsnachweis von GFK-Produkten<br />
liegt darin, sämtliche zur Produktion freigegebenen Rohstoffe<br />
explizit aufzulisten, zu beschreiben sowie die Wareneingangs-<br />
und Rohstoffkontrollen an der Einhaltung dieser Vorgaben<br />
auszurichten.<br />
Die Notwendigkeit hierzu resultiert aus der bereits angedeuteten<br />
irreversiblen Verbindung unterschiedlicher Rohstoffe<br />
(Verstärkungsfaser und Matrix) zu einem <strong>neue</strong>n „kombinierten“<br />
Werkstoff. Daher ist das Verfahren Bestandteil aller relevanten<br />
GFK-Rohrnormen (z. B. ISO 14692-2: „raw-material<br />
acceptance tests“).<br />
Dabei unabdingbar ist, dass vor der Freigabe von Rohstoffen<br />
mit potenziellem Einfluss auf das Werkstoffverhalten, in<br />
sämtlichen Kriterien nachgewiesen wird, dass die <strong>neue</strong> Komposition<br />
mindestens den Anforderungen der Referenz (s. ITT) entspricht.<br />
Hierbei müssen nicht zwangsläufig vollständige Langzeit-Qualifikationstests<br />
durchgeführt werden, sondern es wird<br />
verbindlich unterschieden, ob eine Änderung oder das Rohmaterial<br />
einen geringen, moderaten oder wesentlichen Einfluss<br />
auf das langzeitige Eigenschaftsbild des Produkts haben kann.<br />
Nach dieser Hierarchie sind die jeweiligen Anforderungen zur<br />
Nachprüfung normativ geregelt, z. B. treffend unter der Bezeichnung<br />
„Re-qualification“ in der ISO 14692-2 bezeichnet,<br />
aber auch in EN 1796/EN 14364 sowie insbesondere CEN-TS<br />
14632, Anhang C und Anhang D enthalten.<br />
Natürlich enthält der gesamte qualitätssichernde Prozess,<br />
der entlang einer zertifizierten GFK-Fertigung stattfindet, eine<br />
Vielzahl an weiteren typischen Verfahren und Prüfungen,<br />
616 8-9 / 2011
die eine statistisch hinreichende stichprobenartige Qualitätskontrolle<br />
und eine vollständige, rückführbare Dokumentation<br />
gemäß der im Vorfeld erarbeiteten Qualitäts- und Prüfpläne<br />
darstellt. Inhalte sind beispielsweise:<br />
Wareneingangs- und Rohstoffkontrollen inkl. Materialzeugnisse,<br />
visuelle Kontrollen,<br />
Messung von Wickelwinkeln, Laminatkomposition,<br />
Messung Harz- und Verstärkungsanteil sowie Lagenaufbau<br />
(Glasgehalt/„LOI“),<br />
Maßprüfung (insbes. Wandstärken, Laminatlängen, -verteilung),<br />
Messung der Aushärtung (Barcol-Härte und/oder DSC)<br />
nach ausreichender Härtung bzw. Nachhärtung,<br />
Messung von Toleranzen/Passungen,<br />
Messung der E-Module auf einem Prüfstand (z. B. chargenweise/Stichproben<br />
an GFK-Profilen).<br />
Die jeweiligen spezifischen Inhalte können dabei je nach Produkt,<br />
Norm und Anwendung unterschiedlich sein, wobei durch<br />
den Zertifizierer schließlich beurteilt wird, dass in beschriebener<br />
Weise die jeweilige Korrelation der Ergebnisse mit den performancebasierten<br />
Kriterien aus der Baumuster-Qualifikation<br />
hergestellt werden kann.<br />
Abschließend findet diese komplexe, geschlossene Argumentationskette<br />
beispielsweise durch eine entsprechende<br />
Konformitätserklärung Ausdruck, welche infolge der Überwachungsprüfung<br />
selbstverständlich durch die Zertifizierstelle<br />
offiziell bescheinigt werden kann. Auch hier ist auf die besonders<br />
wichtigen Elemente zur Weiterverfolgung des dahinterstehenden<br />
Vorganges Wert zu legen, allgemein:<br />
Nummer des referenzierten Untersuchungsberichtes<br />
Gegenstand und Umfang der Untersuchungen<br />
Methoden/Prüfnormen<br />
Ein- oder Beschränkungen, ggf. Ablaufdatum (bei allg. Audits<br />
nicht zwingend erforderlich)<br />
Datum, Stellenbezeichnung, Unterschrift der Verantwortlichen<br />
(identifizierbar)<br />
Versprechen gehalten?<br />
Zertifizierungsprozesse können und werden, sofern adäquat geprüft<br />
wird und die Ergebnisse im Zusammenhang dargestellt werden,<br />
dem Anwender in der Tat weitreichende Sicherheiten und Daten<br />
für die Auslegung, Anwendung sowie Grenzen bieten.<br />
Im Gegensatz dazu werden jedoch leichtfertig oder mit mangelnder<br />
Fachkenntnis erstellte Zertifikate nicht nur vermeintliche<br />
Sicherheit vorspiegeln. Bleibt die Bedeutung des Zertifikats auf ein<br />
formales Papier begrenzt oder wird gar als „notwendiges Übel“ angesehen,<br />
dürfte zudem eine gefährliche Wettbewerbsverzerrung<br />
zulasten einer von Sorgfalt geprägten Kultur Einzug halten.<br />
Seitens der Überwachungs- und Zertifizierungsstellen sollte<br />
stets die Werthaltigkeit ihrer Prüfungen, Methoden und Voraussetzungen<br />
selbstkritisch hinterfragt werden. Dazu ist eine unbedingte<br />
Voraussetzung, sich auch der Wirkung der am Ende erstellten<br />
Dokumente im Klaren zu sein.<br />
Autoren<br />
Achim Dörfler<br />
TÜV SÜD Industrie Service GmbH,<br />
Institut für Kunststoffe, München<br />
Tel. +49 7034 237277<br />
E-Mail: achim.doerfler@tuev-sued.de<br />
Marcus Demetz<br />
TÜV SÜD Industrie Service GmbH,<br />
Institut für Kunststoffe, München<br />
Tel. +49 89 5190-3229<br />
E-Mail: marcus.demetz@tuev-sued.de<br />
GFK-Rohrsysteme für den Anlagenbau<br />
korrosionsbeständig l leicht l variable Rohrtypen l Systemlösungen l hoher Servicegrad<br />
E Rohre GmbH l Gewerbepark 1/Hellfeld l 17034 Neubrandenburg l T +49.395.45 28 0 l F +49.395.45 28 100 l www.hobas.de<br />
8-9 / 2011 617
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Die bruchmechanischen Eigenschaften<br />
der Polyolefine - Sind<br />
die in den Normen vorgesehenen<br />
Anwendungsbereiche realistisch?<br />
Von H.-J. Kocks, C. Bosch, M. Betz<br />
Zusammenfassung: Mit dem Erscheinen der ISO 21809-1 in 2012 werden die Anforderungen an dreischichtigen<br />
extrudierten Ausführungen der Polyethylen- und Polypropylenumhüllung international für Öl- und Gastransportleitungen<br />
festgeschrieben. Die nicht erfassten Anwendungsbereiche, wie z. B. der Bereich der Gas- und Wasserverteilung,<br />
werden national mit der Überarbeitung der DIN 30670 für die PE-Umhüllungen und der DIN 30678 für PP-Umhüllungen<br />
als Restnormen abgedeckt. Die ISO 21809-1 wurde als Normentwurf bereits 2010 veröffentlicht. In dieser<br />
Norm sind zukünftig Einsatzgrenzen festgelegt, die als Grundlage für vertragliche Vereinbarungen nicht unkommentiert<br />
akzeptiert werden sollten. Die Hintergründe dazu sind auf die Materialeigenschaften von Polyethylen bzw. Polypropylen<br />
zurückzuführen.<br />
Tabelle 1: Anwendungsbereiche der Umhüllungsarten nach<br />
ISO 21809-1 in Abhängigkeit von der Umhüllungschichtdicke und des<br />
Rohrgewichtes [3]<br />
Schichtdickenklasse 1 2 3<br />
Bodenbeschaffenheit<br />
LDPE-Decklage,<br />
Gesamtschichtdicke<br />
MDPE/HDPE-Decklage,<br />
Gesamtschichtdicke<br />
Onshore: sandiger<br />
Boden<br />
Tonböden ohne<br />
Füllmaterial<br />
Steinige Böden<br />
oder Offshore<br />
1,8–3,2 mm 2,1–3,8 mm 2,6–4,7 mm<br />
1,3–2,5 mm 1,8–3,3 mm 2,3–4,2 mm<br />
1,3–2,5 mm 1,7–3,0 mm 2,1–3,8 mm<br />
Tabelle 2: Anwendungstemperaturen der Umhüllungsarten nach<br />
ISO 21809-1 [3]<br />
Decklage LDPE MDPE/HDPE PP<br />
PP-Decklage, Gesamtschichtdicke<br />
Anwendungstemperaturen<br />
–20 bis +60 °C –40 bis +80 °C –20 bis +110 °C<br />
Einleitung<br />
Polyethylen- und Polypropylenumhüllungen sind seit Jahrzehnten<br />
für Stahlrohre im Einsatz. National sind diese Korrosionsschutzsysteme<br />
in DIN 30670 und DIN 30678 beschrieben<br />
[1, 2]. Die ersten Normentwürfe zur DIN 30670 wurden<br />
bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts<br />
erarbeitet. Demgegenüber entstand die DIN 30678 für die<br />
Polypropylenumhüllungen erst 1992 zu einer Zeit, als bereits<br />
erste Schritte für die internationale Festlegung der Anforderungen<br />
für Polyethylen- und Polypropylenumhüllungen<br />
unternommen wurden. Erst mit der ISO 21809-1 fanden jedoch<br />
die internationalen Bemühungen für die Harmonisierung<br />
dieser Lieferbedingungen ihren Abschluss [3].<br />
In DIN 30670 und DIN 30678 sind nicht nur die Anforderungen<br />
und Prüfungen festgelegt, sondern auch Hinweise<br />
für die Anwendung und Einsatzgrenzen dieser Umhüllungen<br />
zu finden. Der Anwendungsbereich dieser Normen ist<br />
auf erd- und wasserverlegte Leitungen eingeschränkt. In DIN<br />
30670 sind für die Polyethylenumhüllungen zwei Ausführungen<br />
beschrieben. Die Einsatztemperatur für die Ausführung N<br />
ist auf 50 °C, die der Ausführung S auf 70 °C begrenzt. Die<br />
DIN 30678 sieht für die Polypropylenumhüllung eine maximale<br />
Betriebstemperatur von 90 °C vor. Im Falle der Polypropylenumhüllung<br />
wird darüber hinaus auf die eingeschränkte<br />
Nutzungsdauer bei höhern Einsatztemperaturen hingewiesen.<br />
Die Empfindlichkeit des Materials bei tiefen Temperaturen<br />
erfordert eine Prüfung der Schlagbeständigkeit bei 0 °C.<br />
Weitergehende Anforderungen an das Bettungsmaterial<br />
für polyethylen- oder polypropylenumhüllte Rohre finden<br />
sich darüber hinaus beispielsweise in den Richtlinien und Regelwerken<br />
rund um Planung und Bau von Rohrleitungen in<br />
der Gas- und Wasserversorgung. Hier wird generell der Einsatz<br />
von steinfreiem Material zur Bettung solcher Leitungen<br />
gefordert.<br />
Die ISO 21809-1 weitet diese Anwendungsbereiche auf.<br />
So werden im Falle größerer Schichtdicken auch steinige Böden<br />
zur Bettung zugelassen, da offensichtlich aufgrund der<br />
Forderung einer entsprechenden Spannungsrissbeständigkeit<br />
im sogenannten Belltest nach ASTM D 1693 [4] eine Eignung<br />
des Materials gegenüber Punktlasten und Punktlagerungen<br />
618 8-9 / 2011
Bild 1: Schaden an einer PP-Umhüllung nach einem Rohreinzug<br />
Bild 2: Schaden an einer PP-Umhüllung auf dem Rohrlager<br />
angenommen wird (Tabelle 1). Bei dem sogenannten Belltest<br />
handelt es sich um eine Prüfung der Rissbeständigkeit unter<br />
Netzmitteleinsatz und ist eine mit dem inzwischen besser<br />
bekannten FNCT (Full-Notch-Creep-Test) vergleichbare Materialprüfung.<br />
Die Ergebnisse des FNCT dienen wie beispielsweise<br />
im Falle der PAS 1075 auch als Nachweis der Eignung<br />
von Kunststoffmaterialien für kritische Einbaubedingungen<br />
alternativer Verlegetechniken [5].<br />
Auch im Falle der Anwendungen bei niedrigen Temperaturen<br />
wurden Einsatzgrenzen in der ISO 21809-1 aufgenommen.<br />
Im Falle von Polyethylen ist die mit dem Typ N nach<br />
DIN 30670 vergleichbare Umhüllungsart für den Temperaturbereich<br />
von -20 bis +60 °C, die mit der Ausführung S vergleichbare<br />
Umhüllungsart für den Temperaturbereich von -40<br />
bis +80 °C vorgesehen. Die Polypropylenumhüllung kann lt.<br />
Norm in einem Bereich von -20 bis 110 °C eingesetzt werden<br />
(Tabelle 2). Hinweise auf eine eingeschränkte Nutzungsdauer<br />
bei höheren Betriebstemperaturen, wie diese in der<br />
DIN 30678 zu finden sind, fehlen.<br />
Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass diese Einsatzgrenzen<br />
mit Blick auf die Materialeigenschaften und insbesondere<br />
in Bezug auf die bruchmechanischen Zusammenhänge<br />
von Temperatur und Alterung einer genaueren Betrachtung<br />
bedürfen.<br />
den Datenblättern war für den hier verwendeten Polypropylentyp<br />
eine Glasübergangstemperatur von -40 °C angegeben. Mit<br />
den üblichen Schlagprüfungen nach DIN 30678 konnten auch bei<br />
-20 °C keine Hinweise auf das mögliche Versagen der Umhüllung<br />
gefunden werden. Angesichts der in ISO 21809-1 vorgesehenen<br />
Einsatztemperatur von -20 bis +110 °C musste daher<br />
eine Prüfung der Umhüllungen gefunden werden, die eine realistische<br />
Aussage über den Anwendungsbereich der Umhüllungen<br />
ermöglicht.<br />
Im Fall der oben erwähnten Schlagprüfung nach DIN 30678<br />
wäre an einem kälteversprödeten Material ein grobes Abplatzen<br />
bzw. die Bildung von Rissen erwartet worden, wie es z. B.<br />
bei -4 °C an den Lagerrohren der Fall war. Der Prüfaufbau für<br />
die Schlagprüfung nach DIN 30670 bzw. DIN 30678 ist dafür<br />
bei genauerer Betrachtung prinzipiell wenig geeignet. Die bei<br />
der Prüfung verwendete Aufschlagsfläche ist halbkugelförmig.<br />
Der Durchmesser dieser Halbkugel beträgt normgemäß 25 mm.<br />
Durch die halbkugelförmige Aufschlagsfläche wird das Beschichtungsmaterial<br />
beim Auftreffen des Gewichtes zu den Rändern<br />
der Prüffläche hin verdrängt. Mit der Wulstbildung entstehen<br />
Druckspannungen in einem Bereich, wo die Rissbildung ausgelöst<br />
werden sollte (Bild 3).<br />
Das Tieftemperaturverhalten von<br />
Polypropylen und Polyethylen<br />
Von Polypropylenumhüllungen sind Schäden bei tiefen Umgebungstemperaturen<br />
bekannt. Bild 1 und Bild 2 zeigen Beispiele<br />
solcher Schadensformen. In Bild 1 handelt es sich um<br />
einen im Spülbohrverfahren eingezogenen Rohrstrang. Das<br />
Rohrende in Zugrichtung ragt aus der Bohrung und zeigt nach<br />
einer Kälteperiode mit -10 bis -15 °C deutliche Abplatzungen.<br />
Auch im Falle der noch unbeanspruchten Rohre auf dem<br />
Rohrlager fanden sich erste Risse (Bild 2). Bei einem Schlag<br />
mit dem Hammer konnte bei -4 °C an Lagerrohren diese<br />
Rissbildung ebenfalls beobachtet werden. Untersuchungen<br />
der abgeplatzten Decklage zeigten, dass die Polypropylenbeschichtung<br />
sämtliche Qualitätsanforderungen erfüllt. In<br />
Bild 3: Bild des Prüfbereiches<br />
einer Umhüllung<br />
nach dem klassischen<br />
Schlagversuch<br />
8-9 / 2011 619
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Bild 4: Fallgewicht für den modifizierte Schlagversuch<br />
Unter Verwendung einer flachen Aufschlagsfläche wird<br />
dieser Effekt vermieden (Bild 4). Der gewählte Durchmesser<br />
für den Prüfstempel dieser modifizierten Schlagprüfung beträgt<br />
21 mm. Es wurde ein Gewicht von 10 kg gewählt, das<br />
aus einer Höhe von 1,0 m auf die Oberfläche fällt. Die Schlagenergie<br />
beträgt somit 98,1 J. Die Prüfung wird bei unterschiedlichen<br />
Temperaturen durchgeführt, so dass eine minimale<br />
Temperatur ermittelt werden kann, bei welcher keine<br />
Rissbildung zu beobachten ist.<br />
Zur Überprüfung der Aussagekraft des Prüfverfahrens<br />
wurden in einem ersten Schritt Rohrsegmente der Dimension<br />
(DN 200) mit einem dreischichtigen Aufbau der Umhüllung<br />
bestehend aus Epoxidharzprimer, Kleber und Polyolefindeckschicht<br />
(Polyethylen, PE bzw. Polypropylen, PP) untersucht.<br />
Die Schichtdicke der hier geprüften Polyolefinumhüllungen<br />
lag in einem Bereich von 2,4 und 3,0 mm. Für die<br />
vergleichende Untersuchung an einer 2-lagigen Pulverepoxidharzbeschichtung<br />
(dual layer FBE) wurde bei unveränderter<br />
Fallhöhe das Gewicht auf 5 kg reduziert, da die Dicke der Epoxidharzschicht<br />
nur 770 µm betrug.<br />
Die verschiedenen Polyolefine liefern in dieser Prüfung<br />
Ergebnisse, die mit den Beobachtungen in der Praxis gut korrelieren<br />
(Tabelle 3). Für LDPE liegt die Versprödungstemperatur<br />
unterhalb -27 °C und für HDPE unterhalb -40 °C. Hier<br />
sind in der ISO 21809-1 als untere Einsatzgrenzen für LDPE<br />
-20 °C und für HDPE -40 °C angegeben. Beim PP werden<br />
im Falle des dreischichtigen Umhüllungssystems Versprödungstemperaturen<br />
im Bereich von 0 °C bis +6 °C gefunden.<br />
Auch diese Ergebnisse entsprechen den Beobachtungen<br />
in der Praxis. Eine Anwendungstemperatur lt. ISO 21809-1<br />
Tabelle 3: Ermittelte minimale Temperaturen ohne Rissbildung bzw.<br />
Abplatzen<br />
LDPE HDPE PP1 PP2 PP3 Zweischicht<br />
FBE<br />
Dreischicht –27 °C –40 °C +6 °C +4 °C 0 °C<br />
Zweischicht +15 °C<br />
Einschicht –12 °C –20 °C 0 °C<br />
Platten –33 °C < –50 °C –10 °C –15 °C –5 °C<br />
von –20 °C kann nicht realisiert werden. Die vergleichend<br />
durchgeführte Prüfung am Epoxidharzsystem zeigt die wesentlich<br />
größere Empfindlichkeit gegenüber mechanischen<br />
Beanspruchungen, die insbesondere beim Handling derart<br />
beschichteter Rohre auch bekannt ist. Die mit dieser Prüfung<br />
ermittelte Temperatur ist somit als die niedrigste empfohlene<br />
Einsatztemperatur des Beschichtungsmaterials anzusehen.<br />
Unterhalb dieser Temperatur sind je nach Lastfall<br />
Rissbildungen durch Kälteversprödung bzw. ein Abplatzen<br />
der Beschichtung nicht auszuschließen.<br />
Neben den dreischichtigen Systemen wurden auch einschichtig<br />
auf Stahlrohre extrudierte Umhüllungsmaterialien<br />
untersucht. Diese Beschichtungen wurden ausschließlich für<br />
den Vergleich mit den dreischichtigen Umhüllungen hergestellt<br />
und besitzen keine Anwendung im Feld. In jedem Fall<br />
sind hier für die 1-Lagen Beschichtungen niedrigere Versprödungstemperaturen<br />
zu beobachten, so dass nicht auszuschließen<br />
ist, dass der dreischichtige Aufbau einen wesentlichen<br />
Beitrag zu diesem Bruchverhalten liefert. Die Ergebnisse<br />
an den einschichtig extrudierten Rohrproben und<br />
die ebenfalls durchgeführten Untersuchungen an Platten<br />
zeigen dabei eine weitgehende Übereinstimmung.<br />
Da die technischen Produktdatenblätter lediglich bedingt<br />
Informationen über die bruchmechanischen Eigenschaften<br />
liefern, wurde in einem zweiten Schritt versucht, die Unterschiede<br />
bei den verschiedenen Polypropylentypen mit Hilfe<br />
des FNCT (Prüfung mit umlaufender Kerbe) bzw. 2NCT<br />
(Prüfung zweiseitig gekerbter Proben) zumindest qualitativ<br />
zu bewerten. Angaben über Ergebnisse von FNCT oder Belltest<br />
sind üblicherweise Bestandteil der technischen Datenblätter<br />
und könnten so als Auswahlkriterium für Einsatzmaterialien<br />
genutzt werden.<br />
Es konnte keine Korrelation zwischen den gefundenen<br />
Versprödungstemperaturen und den Ergebnissen des hier<br />
angewendeten 2NCT nachgewiesen werden. Für den Vergleich<br />
wurden die Standzeiten im 2NCT-Test und die mit<br />
der modifizierten Schlagprüfung ermittelte minimale Einsatztemperatur<br />
herangezogen. Das Material PP2 mit den<br />
schlechtesten Ergebnissen im 2NCT zeigte bei den modifizierten<br />
Schlagversuchen erst unterhalb von -15 °C eine<br />
Tendenz zur Rissbildung. Bei den anderen Materialien mit<br />
den deutlich besseren Ergebnissen im 2NCT liegen die Versprödungstemperaturen<br />
unterhalb -5 °C bzw. -10 °C und<br />
damit auf deutlich höherem Niveau (Bild 5 und Bild 6). Angesichts<br />
der Tatsache, dass die Prüfung im FNCT bzw. 2NCT<br />
bei hohen Temperaturen durchgeführt wird, kann somit weder<br />
der Wechsel dieser bruchmechanischer Eigenschaften<br />
erfasst und noch eine qualitative Bewertung der Materialien<br />
vorgenommen werden.<br />
Mechanistische Betrachtung der<br />
Rissbildung<br />
Im Zuge der Untersuchung der Kälteversprödung des Polypropylens<br />
wurden auch mechanische Prüfungen zum Verständnis<br />
der Ursachen durchgeführt. Die bei unterschiedlichen<br />
Temperaturen vorgenommenen Zugversuche bestätig-<br />
620 8-9 / 2011
ten die bereits früher an gealterten und damit versprödeten<br />
Polyethylenumhüllungen festgestellten Zusammenhänge<br />
[6]. Bild 7 und Bild 8 zeigen einerseits den Vergleich von<br />
Zugversuchen an einer durch Alterung versprödeter Polyethylenumhüllung<br />
gegenüber einem nicht gealterten Material,<br />
anderseits die Zugversuche an Polypropylen bei Raumtemperatur<br />
und im Bereich der beobachteten Versprödungstemperatur.<br />
Bei beiden Proben ist der Einbruch in der Reißdehnung<br />
offensichtlich, der letztlich auf ein ungünstiges<br />
Verhältnis von Streckspannung und Reißfestigkeit zurückzuführen<br />
ist. Dieses ungünstige Verhältnis von Streckspannung<br />
und Reißdehnung ist in den Grafiken durch die gestrichelten<br />
Linien angedeutet.<br />
Der einzige Unterschied liegt in der Tatsache, dass im<br />
Falle der Kälteversprödung die Streckspannung gegenüber<br />
der Reißfestigkeit ansteigt, während im Falle der Alterung<br />
die Reißfestigkeit gegenüber der Streckspannung abgebaut<br />
wird. Die Streckspannung bleibt im Falle der Alterung beim<br />
versprödeten Material unbeeinflusst.<br />
Wesentliche Voraussetzung für die Rissbildung ist die<br />
Überschreitung von Streckspannung bzw. Streckdehnung.<br />
Die Überschreitung dieser kritischen Werte kann das gesamte<br />
Bauteil betreffen, wenn bspw. aufgrund unterschiedlicher<br />
Wärmeausdehnungskoeffizienten mit fallenden Temperaturen<br />
„Kältespannungen“ aufgebaut werden. Eine solche Überschreitung<br />
kann aber auch sehr lokal bei Punktlasten, Punktlagerungen,<br />
Quetschungen usw. auftreten [7].<br />
Im Falle der Rissbildung aufgrund einer UV-Schädigung<br />
der Polyethylenumhüllung konnte dieser Zusammenhang in<br />
der Praxis sehr gut dokumentiert werden. Bild 9 zeigt die<br />
durchgeführten mechanischen Untersuchungen an einem<br />
über den Umfang abgelösten Abschnitt des geschädigten<br />
Rohres. Der geschädigte Bereich beschränkt sich zwangsläufig<br />
auf die der Sonne zugewandten Seite und ist in Bild 9<br />
an einer Farbänderung von gelb nach farblos erkennbar. Die<br />
Unterseite ist unbeschädigt und daher noch gelb gefärbt.<br />
Im beschädigten Bereich erstreckte sich die Verfärbung bis<br />
zu mindestens 1/3 der Dicke der PE-Decklage. Anzumerken<br />
ist hier dass die beobachtete Verfärbung auf einer Zersetzung<br />
des dem PE beigemischten gelben Farbstoffes beruht.<br />
Die Streckspannung liegt sowohl im geschädigten als<br />
auch im nicht geschädigten Bereich je nach Schichtdicke bei<br />
Werten um 155 bis 160 N (Bild 9). Im geschädigten Bereich<br />
weisen die Reißdehnung und die Reißfestigkeit viel kleinere<br />
Werte auf, als im ungeschädigten Bereich.<br />
Hier zeigt sich, dass mit zunehmender UV-Schädigung<br />
die Reißfestigkeit abnimmt. Mit Abnahme der Reißfestigkeit<br />
wird ein ungünstiges Verhältnis zur Streckspannung erreicht<br />
und die Reißdehnung bricht grenzwertig zusammen. Auch<br />
diese Ergebnisse aus der Praxis bestätigen das Zusammenspiel<br />
von Streckspannung und Reißfestigkeit und deren Einfluss<br />
auf die Dehnbarkeit und damit die Flexibilität des Materials.<br />
Der Versuch mit Blick auf die Kälteversprödung allein<br />
auf Basis der Daten einer Zugprüfung die möglichen Anforderungen<br />
an das Einsatzmaterial festzulegen scheitert, da<br />
die Prüfung durch eine Erwärmung des Materials im Bereich<br />
der sich bildenden Einschnürungen beeinflusst wird.<br />
Bild 7: Vergleich der Zugversuche: Alterung von HDPE<br />
Bild 5 und Bild 6:<br />
Vergleich der Ergebnisse<br />
von 2 NCT-Test und<br />
Schlagprüfungen (Platten)<br />
Bild 8: Vergleich der Zugversuche: Kälteversprödung von PP<br />
8-9 / 2011 621
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Bild 9: Untersuchung<br />
einer<br />
durch UV-geschädigten<br />
Umhüllung<br />
des Stahlrohres<br />
– Zugversuche<br />
Ein Vergleich der Bruchbilder dieser Schadensformen bestätigt<br />
den ursächlichen Zusammenhang dieser Schadensformen<br />
(Bild 10 und Bild 11). In beiden Fällen ergibt sich eine<br />
identische Form der Rissbildung am Rohr.<br />
In der Praxis müssen Alterung und Kälteversprödung<br />
zwangsläufig auch in der Kombination betrachtet werden.<br />
Wenn sich aufgrund der Alterung die Reißfestigkeit der<br />
Streckspannung annähert, wird bei fallender Temperatur<br />
durch den Anstieg der Streckspannung auch früher der Ver-<br />
sprödungspunkt erreicht. Ein gealtertes Material wird daher<br />
mit fallender Temperatur bruchanfälliger als das neuwertige<br />
Material sein. Da an Umhüllungen üblicherweise keine Zeitstandsuntersuchungen<br />
durchgeführt werden, bietet sich in<br />
Bezug auf die Werkstoffalterung ein Blick auf die Erfahrungen<br />
und damit den Erkenntnissen an Bauteilen aus dem Vollmaterial<br />
geradezu an (Bild 12).<br />
Aus Zeitstandsinnendruckversuchen an PE-Rohren ist bekannt,<br />
dass sich der 2. Ast mit einem spröden Bruchverhal-<br />
Bild 10 und Bild 11: Vergleich des Rissbildes einer Kälteversprödung (links) und Werkstoffalterung (rechts)<br />
622 8-9 / 2011
ten zu einem Zeitpunkt andeuten sollte, wenn sich durch die<br />
Extrapolation auf 20 °C eine theoretische Betriebsfähigkeit<br />
von mind. 50 Jahren ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass<br />
im Falle einer solchen Prüfung z. B. bei +80 °C die Versprödungstemperatur<br />
zu diesem Zeitpunkt selbst unter der weitgehend<br />
gleichförmigen Innendruckbeanspruchung ein Niveau<br />
von +80 °C erreicht ist.<br />
Der Ausgangspunkt der Versprödungstemperatur für das<br />
neuwertige Material liegt jedoch weit unterhalb von 0 °C.<br />
Wird für die überwiegend ruhende Beanspruchung eines Innendruckversuches<br />
als Ausgangspunkt die Glasübergangstemperatur<br />
angenommen, so ist bei den heute eingesetzten<br />
HDPE-Typen eine Temperatur von etwa –120 °C anzusetzen.<br />
Während sich in Bezug auf die Materialfestigkeit (Streckspannung)<br />
somit kaum Änderungen ergeben, ist unter Berücksichtigung<br />
von Ausgangs- und Endpunkt die Verlagerung<br />
der Versprödungstemperatur erheblich. Der tatsächliche Verlauf<br />
der Versprödungstemperatur entlang der logarithmischen<br />
Zeitachse ist derzeit nicht bekannt. Aus diesem Grunde ist<br />
der Verlauf in Bild 12 gestrichelt dargestellt. Entscheidend<br />
für das spröde Bruchverhalten in der Praxis ist der Schnittpunkt<br />
mit der jeweils niedrigsten Betriebstemperatur. Dieser<br />
Schnittpunkt hat jedoch nichts mit der im Zeitstandsinnendruckversuch<br />
ermittelten theoretischen Betriebsfähigkeit unter<br />
Festigkeitsaspekten zu tun. Die zu berücksichtigende minimale<br />
Betriebstemperatur ist abhängig von den klimatischen<br />
Gegebenheiten und der jeweiligen Verlegetiefe der Gewerke.<br />
Für Wasserrohre beispielsweise, die in der Regel frostfrei<br />
verlegt werden, wurde hier in der Betrachtung eine minimale<br />
Betriebstemperatur von 0 °C angenommen. Trotz unveränderter<br />
Festigkeitswerte reagiert das Material am Schnittpunkt<br />
mit 0 °C unter äußeren Einwirkungen spröde.<br />
Ein Hinweis für die Richtigkeit dieser Zusammenhänge ergibt<br />
sich möglicherweise auch durch einen Vergleich von Klimadaten<br />
und Schadensraten. Stahlrohrumhüllungen sind dazu<br />
wenig geeignet, da der Schadensfall an einer PE-Umhüllung<br />
entweder im Rahmen von Messungen des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes oder eher zufällig bei späteren Aufgrabungen<br />
entdeckt wird. Eine zeitliche Zuordnung der Schadensinitiierung<br />
und damit die Zuordnung der zu diesem Zeitpunkt<br />
vorherrschenden klimatischen Verhältnisse sind hier nur<br />
schwer darstellbar. Einfacher ist diese Zuordnung an Bauteilen<br />
aus dem Vollmaterial, die im Zuge einer Versprödung und<br />
der damit verbundenen größeren Anfälligkeit gegenüber mechanischen<br />
Einwirkungen wie Punktlasten, Punktlagerungen,<br />
Verformungen usw. unmittelbar auftretende Undichtigkeiten<br />
zur Folge haben.<br />
Für einen solchen Vergleich wurde die vom DVGW veröffentlichte<br />
Schadenstatistik [8] und die Klimadaten vom Deutschen<br />
Wetterdienst übernommen (Bild 13). Als Maß für die<br />
Härte des Winters bietet sich die Zahl der registrierten Eistage<br />
an. Eistage sind Tage, an denen die Temperatur von 0 °C<br />
nicht überschritten wurde. Eine hohe Zahl an Eistagen ergibt<br />
sich in der Regel, wenn eine stabile Hochdruckwetterlage im<br />
Winter vorherrscht. Im Zuge solcher Wetterlagen wird auch<br />
der Frost in tiefere Bodenschichten vordringen. Die Abbildung<br />
zeigt die Lage der ausgewählten Wetterstationen. Es<br />
Bild 12: Erläuterung des Versprödungsverhaltens am Beispiel des<br />
Zeitstandsinnendruckversuches<br />
wurde dabei bewusst auf Extremlagen wie beispielsweise der<br />
Brocken im Harz, die Zugspitze oder Kap Arkona verzichtet.<br />
Aus den registrierten Eistagen der Jahre 1997 bis 2004 ergibt<br />
sich eine Mittelwertkurve, die mit den vom DVGW veröffentlichten<br />
Schadensraten für den gleichen Zeitraum gegenübergestellt<br />
wurden.<br />
Die Korrelation der Klimadaten mit der DVGW-Schadenstatistik<br />
spricht beim Polyethylen eindeutig für den kausalen<br />
Zusammenhang von Alterung und Kälteversprödung, auch<br />
wenn die Kurve dazu leicht geneigt und die Schadensrate<br />
für das Jahr 1999 eine geringfügige Abweichung zeigt.<br />
Aber auch unabhängig von diesem Vergleich der Klimadaten<br />
mit den Schadensraten ist offensichtlich, dass sich die alterungsbedingte<br />
Versprödung durch eine zunehmende Anfälligkeit<br />
der Polyolefine bei niedrigen Temperaturen äußert<br />
und damit im Falle äußerer Einwirkungen durch Punktlagerungen,<br />
Punktlasten, Verformungen, usw. schadensursächlich<br />
ist.<br />
Von entscheidender Bedeutung ist dabei die schon für<br />
die Kälteversprödung festgestellte Tatsache, dass eine Bewertung<br />
der Materialien durch Netzmitteluntersuchungen<br />
wie FNCT, Belltest o.ä. weder quantitativ noch qualitativ<br />
Hinweise für die Bruchbeständigkeit unter Punktlasten,<br />
Punktlagerungen, Verformungen usw. liefert. Die Versuche<br />
werden bei hohen Temperaturen durchgeführt. Der Wechsel<br />
der bruchmechanischen Eigenschaften bei niedrigeren<br />
Temperaturen kann weder bei neuwertigen, geschweige<br />
denn bei gealterten Materialien erfasst werden. Über diese<br />
Problematik wurde schon in früheren Beiträgen berichtet<br />
[6] [9] [10]. Darüber hinaus ist im Vorwort zur aktuell<br />
überarbeiteten Fassung der DIN 30670 ein entsprechender<br />
Hinweis zu finden [11].<br />
8-9 / 2011 623
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Bild 13: Vergleich<br />
der Klimadaten<br />
mit der DVGW-<br />
Schadenstatistik<br />
von PE-Rohren [8]<br />
Schlussfolgerungen<br />
Nach derzeitigem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung<br />
der veröffentlichten Daten können mit Blick auf die anfangs<br />
gestellte Frage die in technischen Lieferbedingungen wie der<br />
ISO 21809-1 zugesagten Anwendungsbereiche nicht vollständig<br />
abgedeckt werden. Sowohl die Tieftemperatureigenschaften<br />
im Falle der Polypropylenumhüllung, als auch die dort<br />
für Polyethylen und Polypropylen genannten Freiräume im<br />
Falle der Bettungsbedingungen würden in der Praxis zwangsläufig<br />
zu Problemen führen. Umhüllte Stahlrohre werden über<br />
den kathodischen Korrosionsschutz permanent überwacht<br />
und Umhüllungsfehlstellen zwangsläufig zeitnah festgestellt.<br />
Die sich dann ergebenden Diskussionen über versteckte Mängel<br />
können durch die entsprechende Kommentierung und Erläuterung<br />
der tatsächlichen Einsatzgrenzen im Vorfeld vermieden<br />
werden.<br />
Die Untersuchungen zeigen, dass die derzeit üblicherweise<br />
eingesetzten Polypropylentypen als dreischichtiges Umhüllungssystem<br />
einen Anwendungsbereich bis -20 °C, wie er<br />
in der ISO 21809-1 beschrieben ist, nicht zulassen. Die Ergebnisse<br />
legen eine vorläufige Beschränkung für die Handhabung<br />
und Verlegung auf Temperaturen oberhalb 0 °C nahe.<br />
Prinzipiell wird dies auch über die in DIN 30678 bei 0 °C<br />
geforderte Schlagbeständigkeitsprüfung abgedeckt. In der<br />
endgültigen Normenfassung der ISO 21809-1 wird dieser<br />
Aspekt zwar noch nicht berücksichtigt sein. Es konnte jedoch<br />
erreicht werden, dass auf die Kälteempfindlichkeit zumindest<br />
in einer Fußnote für das Handling und die Verlegung<br />
hingewiesen wird.<br />
Im Zusammenhang mit der weiterführenden Untersuchung<br />
der Schadensmechanismen konnte gezeigt werden, dass die<br />
Rissbildung durch Alterung und Kälteversprödung letztlich auf<br />
624 8-9 / 2011
gleiche Ursachen zurückzuführen sind. Dafür sprechen die<br />
gleichen mechanischen Zusammenhänge, das gleiche Schadensbild<br />
und der Vergleich von Klimadaten mit den DVGW-<br />
Schadenstatistiken.<br />
Aufgrund der sich ändernden Bruchmechanismen lassen<br />
die Daten aus Netzmitteluntersuchungen keinen Rückschluss<br />
auf die Empfindlichkeit gegen Kälteversprödung zu.<br />
Gleiches gilt zwangsläufig für die alterungsbedingte Versprödung,<br />
die letztlich im Sinne einer Kälteversprödung zu<br />
behandeln ist. Derzeit existieren keinerlei Erfahrungen, wie<br />
sich die Versprödungstemperatur im Laufe der Betriebsjahre<br />
verändert. Der Versuch, diesen Verlauf bspw. über die Bestimmung<br />
der Glasübergangstemperatur an unterschiedlich<br />
in der Wärme gealterten Proben zu ermitteln, scheitert, da<br />
Literatur<br />
[1] DIN 30670 „Umhüllung von Stahlrohren und -formstücken<br />
mit Polyethylen“ (1991-04)<br />
[2] DIN 30678 „Umhüllung von Stahlrohren mit Polypropylen“<br />
(1992-10)<br />
[3] ISO 21809-1 „Erdöl- und Erdgasindustrie - Umhüllungen<br />
für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen<br />
- Teil 1: Polyolefinumhüllungen (3-Lagen-PE und<br />
3-Lagen-PP)“ (ISO/DIS 21809-1:2010); Englische Fassung<br />
prEN ISO 21809-1, (2010-05)<br />
[4] ASTM D1693 „Standard Test Method for Environmental<br />
Stress-Cracking of Ethylene Plastics“ (2008)<br />
[5] PAS 1075 „Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken<br />
- Abmessungen, technische Anforderungen und<br />
Prüfung“ (2009-04)<br />
[6] Kocks, H.-J.: Die Korrosion von Polyethylen – Optimierungspotential<br />
der Polyethylenumhüllung von Stahlrohren,<br />
<strong>3R</strong> international 47 (2008) Nr. 1/2, S. 79–85<br />
[7] Adams, A.; Adams, M.; Blümich, B.; Kocks, H.-J.; Hilgert, O.;<br />
Zimmermann, S.: Optimierung der Umhüllung von Stahlrohren<br />
- Zerstörungsfreies Untersuchungsverfahren zur<br />
Bewertung bruchmechanisch relevanter Veränderungen<br />
in teilkristallinen Polymeren, <strong>3R</strong> international 49 (2010)<br />
Nr. 4, S. 216–225<br />
[8] Niehues, B.: DVGW-Schadenstatistik Wasser: Ergebnisse<br />
aus den Jahren 1997 bis 2004, ewp (2006) Nr. 10,<br />
S. 18–22<br />
[9] Kocks, H.-J.: Prüfgrundlagen und Stand der Normen für<br />
Stahlleitungs- und Kunststoffrohre - Regelwerke mit<br />
zweierlei Maß, 2004 – Rohrleitungen im Jahr der Technik;<br />
Vulkan Verlag Essen, 2004, Schriftenreihe aus dem Institut<br />
für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg;<br />
Bd. 28, S. 385–398 (ISBN 3-8027-5391-7)<br />
[10] Kocks, H.-J.: Die Spannungsrissbildung von Polyethylen, <strong>3R</strong><br />
international 45 (2006) Nr. 3/4, S. 135–142<br />
[11] Norm-Entwurf DIN 30670 „Polyethylen-Umhüllungen von<br />
Rohren und Formstücken aus Stahl“, Februar 2011<br />
[12] Gaugler, H.; Kocks, H.-J.: Sinn und Unsinn von Nutzungsdauerstatistiken<br />
– Zustandsorientierte Instandhaltung kathodisch<br />
geschützter Rohrleitungen, <strong>3R</strong> international 46<br />
(2007) Nr. 6, S. 385–391<br />
[13] Celina, M.; Gillen, K.T.; Wise, J.; Clough, R.L.: Anomalous<br />
aging phenomena in a crosslinked polyolefin cable insulation,<br />
Radiat. Phys. Chem. 48 (1996) H. 5, S. 613 - 626<br />
sich der Übergang von duktilem zu spröden Bruchverhalten<br />
aus der Wärme oder aus der Kälte kommend jeweils anders<br />
darstellt. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass<br />
unter Praxisbedingung gealterte und versprödete Proben<br />
durch die Wärmebehandlung wieder ein duktiles Bruchverhalten<br />
annehmen können [10], [13]. Dies ist einerseits nur<br />
möglich, solange diese Versprödung zu einem Zeitpunkt der<br />
Wärmebehandlung unterzogen wird, zu dem die Betriebsfähigkeit<br />
im Sinne einer Zeitstandsinnendruckprüfung noch<br />
nicht aufgezehrt ist und die Temperatur für den Übergang<br />
von duktilem zu spröden Verhalten aus der Wärme kommend<br />
zu tieferen Werten hin verlagert ist. Gerade das Beispiel der<br />
Kälteversprödung beim Polypropylen zeigt, wie wichtig eine<br />
Eignungsprüfung für Anwendungsbereiche ist, die im Rahmen<br />
einer technischen Lieferbedingung zugesagt werden.<br />
Da für eine sandbettfreie Verlegung die einzige diesbezügliche<br />
Anforderung der ISO 21809-1 in einem Nachweis der<br />
Rissbeständigkeit des Vormaterials unter Netzmitteleinfluss<br />
(Bell-Test) besteht, ist dieser Anwendungsbereich mangels<br />
aussagefähiger Eignungsprüfung nicht abgedeckt. Im Falle<br />
einer steinfreien Bettung, wie sie bisher durchgängig gefordert<br />
war, wird selbst eine völlig versprödete PE-Umhüllung<br />
in Kombination mit einem Stahlrohr die als Korrosionsschutz<br />
erforderliche Barrierewirkung erfüllen, solange nicht<br />
beispielsweise durch Kälteeinwirkung die Streckspannung<br />
überschritten wird. Entsprechende Erfahrungen dazu sind<br />
dokumentiert [12].<br />
Autoren<br />
Dr. Hans-Jürgen Kocks<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH,<br />
Siegen, Germany<br />
Tel. +49 271 691 170<br />
E-Mail: hans-juergen.kocks@smlp.eu<br />
Dr.-Ing. Christoph Bosch<br />
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH,<br />
Duisburg, Germany<br />
Tel. +49 203 999-3183<br />
E-Mail: c.bosch@du.szmf.de<br />
Dr. rer. nat. Markus Betz<br />
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH,<br />
Duisburg,Germany<br />
Tel. +49 203 999-3113<br />
E-Mail: m.betz@du.szmf.de<br />
8-9 / 2011 625
Faszination Technik<br />
„Ein heißes Eisen“<br />
Fotoquelle: Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH
Herstellung mit<br />
langer Tradition<br />
Die Wurzeln der modernen Herstellung hochwertiger Gussrohre gehen weit<br />
zurück ins Mittelalter. Im Jahre 1455 wurde, nach heutigem Wissensstand, für das<br />
Schloss Dillenburg die weltweit erste Gussrohrleitung verlegt. Bis zur Zerstörung<br />
des Schlosses um 1760 war diese Rohrleitung in Betrieb. Zu dieser Zeit wurden<br />
Gussrohre in waagerecht liegenden Sandformen, die aus einem Ober- und Unterkasten<br />
bestanden, gegossen.<br />
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Karusselgießverfahren<br />
entwickelt, bei dem die Sandformen in senkrecht stehenden Gießkarussels angeordnet<br />
waren, sodass erstmalig ein kontinuierlicher Gießprozess möglich wurde.<br />
Ein weiterer Meilenstein war die Entwicklung des Schleudergießverfahrens<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts, das die Maßhaltigkeit des Gussrohres erheblich<br />
verbesserte und den Gießprozess wesentlich beschleunigte.<br />
In den 1960er Jahren wurde dann der bis dahin gebräuchliche Grauguss durch<br />
duktiles Gusseisen ersetzt. Hieraus resultierte in den Folgejahren ein Innovationsschub.<br />
Neben modernen Innen- und Außenbeschichtungen, wie zum Beispiel der<br />
Zementmörtel-Umhüllung, brachte diese Phase auch längskraftschlüssige<br />
Verbindungssysteme hervor.<br />
Heute können durch eine präzise Steuerung der Gießmaschinen extrem<br />
belastbare Rohre mit gleichbleibenden Wanddicken in verschiedensten Nennweiten<br />
und Längen hergestellt werden. Eingesetzt werden Gussrohre vornehmlich<br />
in der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sowie beim Bau von<br />
Beschneiungssystemen, Feuerlösch- und Turbinenleitungen. Durch hochwertige<br />
formschlüssige Verbindungssysteme gepaart mit einer Zementmörtel-Umhüllung<br />
sind duktile Gussrohre überdies bestens für grabenlose Einbauverfahren<br />
geeignet.<br />
Faszination Technik<br />
Für Sie in jeder <strong>3R</strong>-Ausgabe eine spannende<br />
Bilddokumentation über Rohrsysteme und ihr Umfeld –<br />
die Lebensadern moderner Gesellschaften<br />
Kontakt zur Redaktion:<br />
Barbara Pflamm, Tel. 0201 82002-28, E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de
Produkte & Verfahren<br />
Max Wild entwickelt umweltfreundliche<br />
250-Tonnen-Horizontalbohranlage<br />
Eine komplett neuartige Anlage für die<br />
verlaufsgesteuerte Horizontalbohrtechnik<br />
hat die Max Wild GmbH entwickelt.<br />
Die MW 1125/45 verfügt nicht nur über<br />
eine patentierte umweltschonende Antriebstechnologie<br />
mit Emission-Null-Option,<br />
sondern ist mit einer Nennzugkraft<br />
von 250 t und einem Drehmoment von<br />
110.000 Nm auch ein echtes Kraftpaket.<br />
Die MW 1125/45 ist weltweit die erste<br />
Horizontalbohranlage, die mit Strom aus<br />
der Steckdose betrieben werden kann.<br />
„Mit unserer langjährigen Erfahrung als<br />
Horizontalbohrspezialist hatten wir konkrete<br />
Ansprüche an eine umweltfreundliche<br />
Anlage für künftige Aufträge. Da unsere<br />
bisherigen Anlagenpartner unsere Wünsche<br />
allerdings für nicht realisierbar hielten,<br />
haben wir die <strong>neue</strong> Anlage jetzt in einem<br />
20monatigen Projekt selbst entwickelt.“,<br />
sagt Christian Wild, Leiter des Geschäftsbereichs<br />
Horizontalbohrtechnik. Gemeinsam<br />
mit der Abteilung Systementwicklung realisierte<br />
das Team der Horizontalbohrtechnik<br />
eine Anlage, die als umweltfreundlichste<br />
Horizontalbohranlage Geschichte schreibt.<br />
Die patentierte <strong>neue</strong> Antriebstechnologie<br />
der Anlage verbindet Elektroantriebe mit<br />
intelligenten Steuerungseinheiten. So ist es<br />
möglich, die Anlage ausschließlich über das<br />
Stromnetz zu betreiben, da auf Komponenten<br />
verzichtet wurde, die herkömmlich mit<br />
Diesel betrieben werden.<br />
„Für uns war es ein entscheidendes<br />
Kriterium, dass wir Horizontalbohrtechnik<br />
auch in ökologisch sensiblen Gebieten einsetzen<br />
können. Mit den bisherigen Anlagen<br />
ging das nicht. Insofern war es für uns eine<br />
besonders große Herausforderung, hier eine<br />
Lösung zu finden, die allen Ansprüchen<br />
gerecht wird“, sagt Markus Hörmann, Leiter<br />
der Abteilung Systementwicklung.<br />
Bei der Eigenentwicklung legten die<br />
Spezialisten Wert auf niedrige Emission<br />
und umweltfreundliche Betriebsmittel.<br />
Die elektrische Antriebstechnik ermöglicht<br />
durch ihre hohen Wirkungsgrade ein<br />
besonders energieeffizientes Arbeiten.<br />
Durch den Einsatz einer Wasserhydraulik<br />
für Zylinderfunktionen kann auf umweltbelastendes<br />
Hydrauliköl komplett verzichtet<br />
werden. Die komplett neu integrierte<br />
Energieschnittstelle ermöglicht es, die<br />
Bohranlage mit „Null-Emission“ über einen<br />
Direktanschluss an das öffentliche Stromnetz<br />
zu betreiben. Die Umweltfreundlichkeit<br />
geht nicht zu Lasten der Leistung. Im<br />
Gegenteil: Mit der MW 1125/45 gelang es<br />
Max Wild, eine Anlage mit unvergleichlich<br />
niedrigen Emissionswerten und einer sehr<br />
hohen Leistungsausbeute zu entwickeln.<br />
Mit dieser Bohranlage sind Bohrungen bis<br />
zu 2.000 m Länge möglich. Sie ist zwar für<br />
eine Nennzugkraft von 250 t ausgelegt,<br />
schafft aber auch kurzzeitige Spitzenzugkräfte<br />
von bis zu 450 t. Dank des hohen<br />
Drehmomentes von 110.000 Nm können<br />
die Spezialisten mit der <strong>neue</strong>n Anlage<br />
Durchmesser von bis zu 2.000 mm bohren.<br />
Die selbst entwickelte Steuerungsund<br />
Regelungstechnik sichert ihnen in<br />
Verbindung mit der Hybridantriebstechnik<br />
eine exakte und zuverlässige Bedienung.<br />
Sämtliche Begrenzungen und Vorgaben<br />
können frei definiert und geregelt werden.<br />
Das gleiche gilt für das Abbilden der<br />
Prozessparameter über die Steuerungsund<br />
Regelungstechnik, die den Bohrverlauf<br />
zuverlässig dokumentieren.<br />
Die Konzeption<br />
dieser Anlage ist dabei<br />
nicht nur für den<br />
firmeninternen Einsatz<br />
entwickelt, sondern<br />
ermöglicht auch<br />
Kooperationen mit<br />
Herstellern und Anwendern.<br />
Den hohen<br />
Innovationsgrad dieser<br />
Anlage hat auch<br />
das Bundesministerium<br />
für Wirtschaft<br />
erkannt und daher<br />
Fördermittel für die<br />
Entwicklung zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Kontakt:<br />
Max Wild GmbH,<br />
Berkheim,<br />
Tel. +49 8395<br />
920-0, E-Mail:<br />
info@maxwild.com,<br />
www.maxwild.com<br />
8-9 / 2011 629
Produkte & Verfahren<br />
Gegen Geruch und biogene<br />
Schwefelwasserstoffkorrosion<br />
Mit dem Cut Breeze und dem zum Patent<br />
angemeldeten Unterflur-Dosiersystem<br />
stellt die Cornelsen Umwelttechnologie<br />
GmbH ein System vor, mit dem die<br />
Bildung giftiger Gase wie Schwefelwasserstoff<br />
(H 2<br />
S), Methanthiol (CH 4<br />
S) und Ethantiol<br />
(C 2<br />
H 6<br />
S) umweltfreundlich und sicher<br />
unterbunden werden kann. Die geruchsfreie,<br />
ökologisch unbedenkliche Flüssigkeit<br />
verhindert zuverlässig die Sulfatatmung<br />
und kann damit der Entstehung von<br />
unangenehmen Gerüchen und Korrosionsschäden<br />
vorbeugen.<br />
Das Unterflurosiersystem bringt das<br />
ausgewogene Wirkstoffsystem auch auf<br />
engstem Raum unkompliziert in das Rohrsystem<br />
ein – ohne teure Bauarbeiten an<br />
Kanälen, Schächten und Straßen. Dafür<br />
verlagert das Unternehmen die Dosieranlage<br />
platzsparend unter den Kanaldeckel. An<br />
einem Tragring kann das System mit wenigen<br />
Handgriffen direkt in den Schachthals<br />
gehängt werden. Unmittelbar unter dem<br />
Laubfangkorb montiert, kann es bei Bedarf<br />
jederzeit von oben wiederbefüllt<br />
werden. Nur der Kanaldeckel muss<br />
kurzfristig entfernt werden. Damit<br />
eignen sich Cut Breeze und das Unterflur-Dosiersystem<br />
ideal für den<br />
Einsatz in Wohngebieten mit engen<br />
Straßen, Fußgängerzonen und sensiblen<br />
Flächen wie Parkanlagen.<br />
Diese Lösung verzichtet deshalb<br />
zusätzlich auf teure, störanfällige<br />
und wartungsintensive High-Tech-<br />
Elektronik. So wird auch die Anbindung<br />
an Strom- und Steuerleitungen überflüssig.<br />
Stattdessen wird Cut Breeze über eine<br />
Tropfdüse nach dem Schwerkraftprinzip in<br />
den Abwasserstrom dosiert. Auch temporäre<br />
Einsätze, zum Beispiel bei Spitzenbelastungen<br />
in der Sommerzeit oder an vormals<br />
problemfreien Kanalabschnitten sind<br />
dank der völlig unkomplizierten Montage<br />
(und Demontage) jederzeit möglich.<br />
Vor einem Einsatz untersuchen die erfahrenen<br />
Chemie- und Verfahrensingenieure<br />
der Cornelsen Umwelttechnologie<br />
Die clevere Lösung: Das Unterflurdosiersystem von<br />
Cornelsen verschwindet vollkommen im Schachthals<br />
und ist somit vor Zugriffen sicher<br />
GmbH auf Wunsch des Kunden die Lage<br />
vor Ort. In einem Pilottest ermitteln sie<br />
mithilfe von H 2<br />
S-Messensoren die ideale<br />
Cut Breeze-Dosiermenge. Damit stellen<br />
sie sicher, dass nur soviel des zwölf Monate<br />
lager-stabilen Wirkstoffkomplexes verbraucht<br />
wird, wie nötig. Die explosionsgeschützten<br />
Sensoren messen außerdem den<br />
Erfolg der Dosierung und ermöglichen somit<br />
eine flexible Optimierung.<br />
Kontakt: Cornelsen Umwelttechnologie<br />
GmbH, Essen, Tel.: +49 20152037-0,<br />
E-Mail: office@cornelsen-umwelt.de,<br />
www.cornelsen-umwelt.de<br />
<strong>Neue</strong> Rohrgeneration mit erhöhter Abriebfestigkeit<br />
Beim Transport von feststoffhaltigen Medien,<br />
wie beispielsweise zur maritimen<br />
Landgewinnung (Aufschüttungen)<br />
oder von Kiesen aus Kiesgruben,<br />
werden wegen der hohen<br />
mechanischen Reibung<br />
durch das zu transportierendem<br />
Flüssig-/Feststoffgemisch<br />
die Innenflächen eines Kunststoffrohres<br />
hoch belastet.<br />
Sowohl PE 80- als auch<br />
PE 100-Rohre eigenen sich<br />
auf Grund ihrer guten mechanisch-hydraulischen<br />
Materialeigenschaften<br />
und ihrer Korrosions-<br />
und Inkrustationsbeständigkeit<br />
für den hydraulischen<br />
Feststofftransport. Um<br />
diese guten Eigenschaften<br />
weiter zu verbessern und die<br />
wirtschaftliche Nutzungsdauer<br />
von Rohrleitungssystemen<br />
in diesen Anwendungsbereichen<br />
zu erhöhen, hat die SIMONA AG eine<br />
<strong>neue</strong> Rohrgeneration entwickelt. Hierbei<br />
werden im Coextrusionsverfahren<br />
in der Schmelze unterschiedliche<br />
PE-Materialien zusammengefügt.<br />
Ein PE 100-Basisrohr wird<br />
mit einer Innenschicht eines<br />
höher molekularen PE-Werkstoffes<br />
kombiniert. Die coextrudierte,<br />
verschleißfeste Innenschicht<br />
ist in die genormte<br />
Rohrwandgeometrie integriert.<br />
Dies bedeutet, dass die<br />
Rohre in ihrer Dimension den<br />
Anforderungen der DIN 8074<br />
entsprechen und somit mit den<br />
bekannten und am Markt erhältlichen<br />
Formteilen verbunden<br />
und verarbeitet werden<br />
können. Untersuchungen (z. B.<br />
Zeitstandinnendruckversuche)<br />
haben ergeben, dass die Anforderungen<br />
der DIN 8075 an die Festigkeitseigenschaften<br />
erfüllt werden.<br />
Die stoffschlüssige Verbindung der<br />
Rohre im Heizelementstumpfschweißverfahren<br />
sowie im Heizwendelschweißverfahren<br />
gemäß DVS-Richtlinien ist sowohl<br />
untereinander als auch in Verbindung mit<br />
normierten PE 80- und PE 100-Druckrohren<br />
und Formteilen gegeben. Diese<br />
Produktlinie wird hauptsächlich im Druckrohrbereich<br />
bei hydraulischen Feststofftransporten<br />
zum Einsatz kommen. Für diese<br />
Materialkombination wird eine Standzeiterhöhung<br />
des Rohrleitungssystems<br />
in Abhängigkeit des Fördermediums von<br />
30 % bis 50 % erwartet. In einem ersten<br />
Produktionsschritt wurden Rohre der Dimension<br />
da = 315 mm und da = 355 mm,<br />
SDR 17 gefertigt.<br />
Kontakt: SIMONA AG, Kirn, Tel.: +49<br />
675214-0, E-Mail: mail@simona.de,<br />
www.simona.de<br />
630 8-9 / 2011
RAUDRIL Rail erhält Eisenbahn-<br />
Bundesamt-Zulassung<br />
Sorgfältig geplante Entwässerungsmaßnahmen<br />
sind für den modernen Gleisbau<br />
von hoher Bedeutung. Große Transportlasten<br />
und hohe Verkehrsgeschwindigkeiten<br />
stellen nicht nur <strong>Herausforderungen</strong> für<br />
den Oberbau dar, sondern <strong>erfordern</strong> einen<br />
bei jeder Wetterlage tragfähigen Unterbau.<br />
Nur so kann verhindert werden, dass keine<br />
dauerhaften Veränderungen der Gleislage<br />
auftreten. Anfallendes Niederschlagswasser<br />
ist daher schnell und sicher aus den<br />
Tragschichten abzuleiten.<br />
Für den Einsatz im Gleisbau hat REHAU<br />
deshalb das Vollwand-Sickerleitungsrohrsystem<br />
RAUDRIL Rail PP entwickelt. Es besteht<br />
aus Polypropylen PP-HM nach DIN<br />
EN 1852 und bietet Sicherheit für höchste<br />
Ansprüche. Die Rohre können direkt<br />
im Lastbereich von Gleiskörpern verbaut<br />
werden und stehen je nach statischen Erfordernissen<br />
in SN 8 oder SN 16 zur Verfügung.<br />
Das gesamte Rohrsystem ist gemäß<br />
den Anforderungen der DBS 918.064 nach<br />
der „Herstellerbezogenen Produktqualifikation“<br />
(HPQ) zur Entwässerung von Bahnanlagen<br />
der Deutschen Bahn (DB) AG zugelassen.<br />
Zusätzlich hat der Hersteller nun<br />
für RAUDRIL Rail PP SN 16 die Eisenbahn-<br />
Bundesamt Zulassung (21.41 Ibzit 23/04)<br />
erhalten. Hierdurch können die Rohre auch<br />
ohne Zustimmung im Einzelfall (ZiE) im Einflussbereich<br />
von Eisenbahnverkehrslasten<br />
und speziell im inneren Lastbereich eingesetzt<br />
werden.<br />
Die Ansprüche der DB AG an Sickerleitungsrohre<br />
sind in den einschlägigen Richtlinien<br />
festgelegt. Es wird hierbei unterschieden,<br />
für welchen Lastbereich das Material<br />
vorgesehen ist. Im Gleisbau wird zwischen<br />
„innerem Lastbereich“, „äußerem Lastbereich“<br />
und „außerhalb Lastbereich“ unterschieden.<br />
Für eine optimale Anpassung an<br />
den jeweiligen Einsatzbereich ist das Rohrsystem<br />
in verschiedenen Ringsteifigkeitsklassen<br />
und Schlitzbreiten vorhanden. Zusätzlich<br />
bietet das Unternehmen ein auf die<br />
verschiedenen Anwendungen abgestimmtes<br />
Schachtprogramm an. So steht Kunden<br />
ein durchdachtes Gesamtsystem für die Planung<br />
und den Bau von Sickerleitungen zur<br />
Verfügung.<br />
Kontakt: REHAU AG + Co, Erlangen,<br />
Tel. +49 9131 92-5496, E-Mail: info@<br />
rehau.com, www.rehau.com<br />
8-9 / 2011 631
Produkte & Verfahren<br />
<strong>Neue</strong>ste Techniken für die grabenlose Verlegung<br />
und Er<strong>neue</strong>rung<br />
Auf der NORDBAU in Neumünster zeigte<br />
die TRACTO-TECHNIK vom 08.-13.9.2011<br />
wieder innovative Weiterentwicklungen<br />
und die <strong>neue</strong>sten Techniken für die grabenlose<br />
Verlegung und Er<strong>neue</strong>rung von<br />
Rohrleitungen.<br />
<strong>Neue</strong> Generation der<br />
Grundomat-Erdrakete<br />
Unter anderem wurde eine grundlegend<br />
<strong>neue</strong> Generation der seit 1970 bekannten<br />
Grundomat-Erdraketen präsentiert.<br />
Ein markantes Merkmal des <strong>neue</strong>n Grundomat-N<br />
ist die außergewöhnliche Kopfform,<br />
die als Kronenkopf bezeichnet wird.<br />
Dieser Kopf ist einzigartig und steht für eine<br />
noch höhere Durchschlagskraft und eine<br />
ungewöhnlich präzise Arbeitsweise mit<br />
hoher Zielgenauigkeit. Die <strong>neue</strong> Dreigangsteuerung<br />
hat zwei wählbare Vorlaufpositionen<br />
mit unterschiedlichen Schlagfrequenzen<br />
je nach Boden und eine Rücklaufsteuerung.<br />
Darüber hinaus ist der<br />
<strong>neue</strong> Grundomat-N noch servicefreundlicher<br />
geworden. Wenn z.B. ein Dichtring<br />
ausgetauscht oder das Hülsrohr angebaut<br />
werden muss, kann die Montage auf der<br />
Baustelle ausgeführt werden. Der Trick:<br />
ein Spannelement spreizt das Gewinde<br />
wie einen Dübel und fixiert so die Endverschraubung<br />
im Gehäuse. Mit der Gebäudeeinführung<br />
von Hauff ist der Erdrakete<br />
ideal für Hausanschlüsse.<br />
Der „King of Rock“:<br />
das <strong>neue</strong> HDD-System<br />
Grundodrill 18ACS für<br />
Standard- und Felsbohrungen.,<br />
das sich härtesten<br />
Bohrbedingungen<br />
optimal anpasst<br />
HDD-Bohrtechnik<br />
Mit dem <strong>neue</strong>n GRUNDODRILL 18ACS ist<br />
dem Hersteller ein Quantensprung in der<br />
HDD-Felsbohrtechnik gelungen. Erstmalig<br />
wurde der „Rack and pinion Antrieb“<br />
(Zahnstange und Ritzel) gewählt. Er arbeitet<br />
mit einem Doppelbohrgestänge.<br />
Das Innenrohr treibt den Rollenmeißel für<br />
die Pilotbohrung an. Das Außenrohr steuert<br />
den Rockbreaker (Felsbohrkopf) durch<br />
Drehen des abgewinkelten Gehäuses. In<br />
harten Fels- und Geröllböden hat das Außenrohr<br />
auch eine Schutzfunktion und verhindert<br />
eine Blockade des Felsbohrkopfes.<br />
Der Bohrbetrieb wird nicht beeinträchtigt.<br />
Damit ist der GRUNDODRILL 18ACS das<br />
optimale HDD-System für Bohrstrecken<br />
mit wechselnden Gesteinsarten, die bohrtechnisch<br />
deutlich anspruchsvoller sind als<br />
gleichmäßige Felsstrukturen.<br />
Im Bereich HDD-Technik präsentierte<br />
TT außerdem die kleinste fahrbare Spülbohranlage<br />
GRUNDODRILL 4X für Bohrlängen<br />
bis 100 m und Rohre bis Ø 160 mm<br />
und den in seiner Klasse leistungsstärksten<br />
GRUNDODRILL 25N mit dem bewährten<br />
dynamischen Schlagwerk für Bohrlängen<br />
bis 500 m und Rohre bis Ø 650 mm. Das<br />
besonders für Hausanschlüsse geeignete<br />
Mini-Bohrsystem Grundopit 40/60 rundete<br />
die Palette der gezeigten steuerbaren<br />
Bohrtechnik ab.<br />
Langrohreinzug über den<br />
Revisionsschacht<br />
Stand der Technik ist die Er<strong>neue</strong>rung<br />
von Altrohrleitungen mit dem GRUNDO-<br />
BURST-Berstliningverfahren mit dem marode<br />
Druck- oder Abwasserrohre durch<br />
gleichgroße oder größere Neurohre ersetzt<br />
werden. Mit der <strong>neue</strong>n Zusatzvorrichtung<br />
BURSTFORM ist der Einzug von<br />
PE-HD-Langrohren über einen Revisionsschacht<br />
(Durchmesser ≥ 1000 mm) in den<br />
Altkanal möglich.<br />
Kontakt: Tracto-Technik GmbH & Co.<br />
KG, Lennestadt, Tel. + 49 2723808-0,<br />
www.tracto-technik.de<br />
<strong>Neue</strong>s Wasserlecksuchgerät von SEWERIN<br />
Mit dem <strong>neue</strong>n Teststab AquaTest T10 erweitert SEWERIN die<br />
Palette von Geräten zur elektroakustischen Wasserlecksuche im<br />
Außenbereich. Dem Praktiker in der Rohrnetzüberprüfung steht<br />
jetzt ein Gerät zur Verfügung, das die perfekte Sewerin-Mikrofontechnik<br />
mit einer <strong>neue</strong>n ergonomischen Gehäuseform und einfacher<br />
Bedienbarkeit kombiniert. Das bewährte Stethophon® 04<br />
für die Lecksuche im Gebäude erhält damit sein Pendant für den<br />
Außenbereich.<br />
Vorortung von Leckagen in Wasserrohrnetzen<br />
Der <strong>neue</strong> Teststab zeichnet sich durch innovative Technik und ergonomisches<br />
Design aus und ist konzipiert für die Vorortung von<br />
Leckagen in Wasserrohrnetzen. Darüber hinaus ist er der erste<br />
Teststab des Unternehmens, für den kein zusätzlicher Empfänger<br />
erforderlich ist. Das Hören der Leckgeräusche wird nicht über die<br />
übliche Taste, sondern über ein spezielles Sensorfeld aktiviert. Die<br />
Visualisierung der aufgenommenen Geräusche erfolgt über ein Dis-<br />
632 8-9 / 2011
play, das in den Griff integriert ist. In der Produktvariante<br />
mit SDR-Funkmodul (SEWERIN Digital Radio) wird<br />
der Teststab mit rauschfreiem Funkkopfhörer verwendet.<br />
Dadurch stören beim Arbeiten keinerlei Kabel mehr,<br />
störende Windgeräusche werden vermieden.<br />
Bei Leckagen an Druckrohrleitungen strömt Wasser<br />
mit hoher Geschwindigkeit aus der Bruchstelle ins<br />
Erdreich. Das Rohrmaterial wird an der Austrittsstelle<br />
zum Schwingen angeregt. Das Wasserrohr überträgt<br />
diese Schwingungen, die so auch an entfernten Kontaktstellen,<br />
z. B. Armaturen, wahrgenommen werden können.<br />
Die hochwertige Mikrofontechnik ermöglicht eine<br />
erstklassige Aufnahme der Geräusche. Selbst kleinste<br />
Leckagen werden sicher erkannt. Soll der Teststab<br />
auf tiefer unter der Oberfläche liegende Objekte aufgesetzt<br />
werden, können zwischen Tastspitze und Mikrofon<br />
problemlos Verlängerungen geschraubt werden.<br />
Um die akustischen Ergebnisse individuell zu optimieren,<br />
besteht die Möglichkeit, zwischen acht verschiedenen<br />
Frequenzbändern zu wählen. Im Tastmodus ist<br />
das Fließgeräusch an den Armaturen durch einfaches<br />
Auflegen des Daumens auf das Sensorfeld zu hören. So<br />
werden störende Tastgeräusche im Kopfhörer vermieden.<br />
Der AquaTest T10 zeigt im Display den jeweils aktuellen<br />
und den vorherigen Minimalpegel sowie die aktuelle<br />
Geräuschintensität. Die Minimalpegel werden als<br />
Zahlenwerte angegeben, die Geräuschintensität wird in<br />
einer Balkengrafik dargestellt. Damit erhalten auch weniger<br />
geübte Anwender optische Unterstützung bei der<br />
Entscheidung, ob sie sich einer Leckage nähern.<br />
Lokalisieren und akustische<br />
Leitungsortung<br />
Vorgeortete Leckagen können mit dem <strong>neue</strong>n Stab auch<br />
lokalisiert werden. Dazu wird die Tastspitze durch einen<br />
Dreifuß ersetzt. Dieser nimmt das Leckgeräusch wie<br />
ein Bodenmikrofon an der Oberfläche auf. Das systematische<br />
Abhorchen der Oberfläche in kleinen Abständen<br />
ermöglicht dann die aufgrabungsreife Lokalisation<br />
der Leckage. Wird eine Rohrleitung in Schwingung versetzt,<br />
z. B. mit dem Klopfer oder Stopper aus dem System<br />
COMBIPHON®, kann die Leitungslage geortet werden.<br />
Dazu wird die Erdoberfläche in kurzen Abständen<br />
ebenfalls systematisch geprüft. Bei der Annäherung an<br />
die schwingende Rohrleitung nimmt die Lautstärke zu.<br />
Direkt über der Leitung ist das Geräusch am lautesten.<br />
Zubehör<br />
Der AquaTest T10 wird standardmäßig in einer strapazierfähigen<br />
Nylontasche ausgeliefert. Neben dem Gerät<br />
sind im Lieferumfang der Funkkopfhörer und die Ladetechnik<br />
enthalten. Als optionales Zubehör bietet SE-<br />
WERIN den Dreifuß und die Verlängerung der Tastspitze<br />
zusätzlich an.<br />
Kontakt: Sewerin, Gütersloh, Tel. 0049 52419340,<br />
E-Mail: info@sewerin.com, www.sewerin.com<br />
PoroTest-o- 92x133:PoroTest 1-89x125-<strong>3R</strong>-d-e 06.04.2010 12:<br />
PoroTest 7<br />
Poren sicher finden in allen<br />
isolierenden Schichten auf<br />
Metall:<br />
• Rohrbeschichtungen<br />
• Rohrinnenauskleidungen<br />
• Korrosionsschutzschichten<br />
auf oder in Schiffsrümpfen,<br />
Mineralöltanks, Behältern,<br />
Pipelines und Armaturen<br />
• Email-, Epoxy-, Kunststoff -<br />
beschichtungen<br />
Elektronische Regelung<br />
der Prüfspannung<br />
ElektroPhysik<br />
Pasteurstr. 15 · 50735 Köln<br />
Tel.: (0221)75204-0 · Fax: (0221)75204-67<br />
www.elektrophysik.com · info@elektrophysik.com<br />
Wir gehen Oberflächen auf den Grund<br />
Porenprüfung mit Hochspannung<br />
8-9 / 2011 633
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Erdgas aus Deutschland – sicher,<br />
sinnvoll und umweltverträglich<br />
Josef Schmid<br />
Zusammenfassung: Deutschland ist in der Lage, rund 14 % seines Erdgasbedarfs aus eigenen Quellen zu decken,<br />
und es bestehen berechtigte Hoffnungen, noch <strong>neue</strong> Potenziale erschließen zu können. Dabei erfolgt die Erdgasproduktion<br />
in Deutschland umweltverträglich und unter höchsten Sicherheitsstandards. Ein wichtiges Augenmerk gilt dabei<br />
dem Schutz des Trinkwassers.<br />
Erdgasproduktion in Deutschland<br />
Erdgas wird auch zukünftig in der Energieversorgung eine gewichtige<br />
Rolle spielen. Als kohlenstoffärmster fossiler Energieträger<br />
wird Erdgas eine wachsende Bedeutung insbesondere<br />
in der Stromerzeugung erhalten. Erdgas erweist sich als<br />
ideale Ergänzung zur fluktuierenden Einspeisung der regenerativen<br />
Energien und ist nicht deren Konkurrent. Damit ist<br />
Erdgas gleichermaßen Brücken- und Zukunftsenergie für die<br />
von der Bundesregierung geplante Energieversorgung auf Basis<br />
eines höheren Anteils an regenerativen Energien.<br />
Besondere Vorteile weist die Erdgasproduktion in Deutschland<br />
auf. Seit mehr als vier Jahrzehnten wird in Deutschland<br />
Erdgas in nennenswertem Umfang produziert. 2010 betrug<br />
die inländische Erdgasproduktion 13 Mrd. m 3 oder 14 %<br />
des deutschen Erdgasverbrauchs [1]. Damit leisten die deutschen<br />
Erdgasproduzenten einen wichtigen und unverzichtbaren<br />
Beitrag zur sicheren Versorgung Deutschlands mit umweltverträglicher<br />
Energie. Wenn in den nächsten Jahrzehnten<br />
– darin sind sich die meisten Prognosen einig – der weltweite<br />
Erdgasbedarf weiter ansteigen wird, ergeben sich für die<br />
Bild 1: Der Platzbedarf für eine Erdgasproduktionsstätte ist mit ungefähr der Größe eines Fußballplatzes sehr gering<br />
634 8-9 / 2011
Erdgasversorgung Deutschlands auch eine Reihe von geopolitischen<br />
Fragen. Versorgungssicherheit bei Erdgas wird<br />
ein zunehmend wichtigeres Thema. Die Erdgasproduktion in<br />
Deutschland leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, denn im<br />
Umfang der Produktion in Deutschland werden Importe von<br />
Erdgas vermieden.<br />
Mit ihrer Tätigkeit schafft und sichert die deutsche Erdgasgewinnungs-Industrie<br />
hochqualifizierte Arbeitsplätze in<br />
Deutschland, insbesondere in strukturschwachen Regionen<br />
und in der technologisch orientierten Service-Industrie. Hinzu<br />
kommen noch zahlreiche Arbeitsplätze im lokalen Umfeld<br />
in den meist ländlichen Kommunen, in denen Erdgas produziert<br />
wird. Für diese Kommunen sind die Erdgasproduzenten<br />
wichtige Arbeitgeber und oft größter Gewerbesteuerzahler.<br />
Außerdem hat die Erdgasproduktion große Bedeutung<br />
für Länderhaushalte durch Steuern- und Förderabgabe. In<br />
den letzten zehn Jahren haben die Produzenten alleine an<br />
Förderabgaben mehr als 7 Mrd. € an die Bundesländer abgeführt.<br />
Die Erdgasproduktion in Deutschland ist die Basis für<br />
die Entwicklung einer technologisch im Weltmaßstab führenden<br />
Service-Industrie und bietet auch die Grundlage für<br />
Universitäten und Forschungsinstitutionen in Deutschland.<br />
Hierdurch entsteht in Deutschland Know-how, das für internationale<br />
Aufträge genutzt werden kann und damit <strong>neue</strong><br />
Beschäftigungs- und Wachstumschancen eröffnet, und von<br />
dem auch andere Bereiche der Energiewirtschaft, wie beispielsweise<br />
die Geothermie, profitieren können.<br />
Für die Erdgasproduktion in Deutschland bestehen berechtigte<br />
Hoffnungen, <strong>neue</strong> Potenziale erschließen zu können.<br />
Dies betrifft die weitere Entwicklung in den bewährten,<br />
seit Jahren erschlossenen Lagerstätten z. B. im Zechstein<br />
oder im Rotliegenden, aber auch die seit über 15 Jahren<br />
in Deutschland genutzten Erdgasvorkommen in dichten<br />
Sandsteinen (Tight Gas). In Deutschland werden zusätzliche<br />
wertvolle, noch nicht erschlossene Gasvorkommen in nichtkonventionellen<br />
Lagerstätten vermutet, z. B. in Schiefergesteinen<br />
oder in Kohleflözen, die derzeit auf eine wirtschaftliche<br />
Nutzbarkeit hin untersucht werden. Die Erdgasproduzenten<br />
in Deutschland haben hohes technisches Know-how,<br />
das sie auch in die Erschließung dieser nicht-konventionellen<br />
Erdgaslagerstätten einbringen werden.<br />
Moderner Rechtsrahmen<br />
Der rechtliche Rahmen für die Aufsuchung und Gewinnung<br />
von Kohlenwasserstoffen ergibt sich aus dem Bundesberggesetz<br />
(aus dem Jahr 1982, zuletzt geändert 2009) sowie<br />
zahlreichen Verordnungen. Das Bundesberggesetz verpflichtet<br />
die Unternehmen, im Interesse einer sicheren Versorgung<br />
die in Deutschland wirtschaftlich gewinnbaren Rohstoffe umweltgerecht<br />
zu erschließen und zu nutzen. Neben dem Bergrecht<br />
sind von den Unternehmen weitere Gesetze zu beachten.<br />
Dazu gehören beispielsweise das umfangreiche naturschutzrechtliche<br />
Regelwerk, das Wasserhaushaltsgesetz und<br />
das Bundesimmissionsschutzgesetz, in denen weitere Umweltanforderungen<br />
geregelt sind.<br />
Das Bergrecht ist in seiner Konstruktion ein modernes<br />
Rechtssystem. Im Bundesberggesetz und den bergrechtlichen<br />
Verordnungen sind alle wesentlichen Regelungen zusammengefasst,<br />
die für eine umweltgerechte Aufsuchung und Gewinnung<br />
von Rohstoffen notwendig sind. Dieser Ansatz wurde<br />
beispielsweise auch bei den Überlegungen zur Schaffung eines<br />
Umweltgesetzbuches verfolgt, hier allerdings erfolglos.<br />
Das Bergrecht entspricht auch modernen Verwaltungsanforderungen,<br />
indem alle relevanten Genehmigungsverfahren<br />
in einer Behörde gebündelt sind. In anderen Verwaltungsbereichen<br />
wird dies unter dem Schlagwort „one face to the customer“<br />
angestrebt. Alle Aktivitäten im Bereich der Exploration<br />
und Produktion von Kohlenwasserstoffen unterliegen der Genehmigung<br />
und Überwachung durch die fachlich hierfür kompetent<br />
ausgestattete Bergbehörde des jeweiligen Bundeslandes.<br />
Dies erfolgt nach dem im Bundesberggesetz festgeschriebenen<br />
Betriebsplanverfahren. In die Genehmigungsverfahren<br />
bezieht die zuständige Bergbehörde auch die Gebietskörperschaften,<br />
andere Behörden und andere Beteiligte ein.<br />
Im Jahr 1990 wurde das obligatorische Betriebsplanverfahren<br />
mit Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt. Es ist<br />
im Bundesberggesetz und der Verordnung über die Umweltverträglichkeit<br />
bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) geregelt.<br />
Eine UVP ist bei Bohrungen vorgesehen, die aufgrund<br />
ihrer erwarteten Produktion eine gewisse Größe und auch<br />
Betriebsdauer erwarten lassen.<br />
Höchste Sicherheitsstandards bei der<br />
Erdgasproduktion<br />
In Deutschland werden bei Bohrungen und bei der Produktion<br />
von Kohlenwasserstoffen höchste Umwelt- und Sicherheitsstandards<br />
angewendet. Dies wird auch durch das Bundesumweltministerium<br />
bestätigt [2]. Auch aufgrund der technischen<br />
Standards weist die deutsche Erdgasproduktion eine sehr hohe<br />
technische Integrität der Anlagen auf, was sich dadurch<br />
ausdrückt, dass es in der Vergangenheit nur einige wenige<br />
und begrenzte Schadensfälle gegeben hat. Soweit es hierbei<br />
zu Auswirkungen auf die Umwelt gekommen ist, wurden diese<br />
vollständig beseitigt. Relevante Vorfälle – auch in anderen<br />
Ländern – führen zu einer Überprüfung und ggf. Verbesserung<br />
der Verfahren zur Vermeidung zukünftiger Ereignisse.<br />
Sicherung des Bohrlochs<br />
Zur Sicherung des Bohrlochs dienen Schutzrohre, deren Dimensionierung<br />
von den geologischen Verhältnissen abhängig<br />
ist und die durch Einpumpen von Spezialzement fest mit<br />
der Bohrlochwand verbunden werden (Bild 2). Der hochfeste<br />
Zement verhindert auch, dass die Rohre durch Außenkorrosion<br />
angegriffen werden. Den oberen Abschluss der Verrohrung<br />
bildet die sogenannte Verflanschung, die aus mehreren<br />
Flanschverbindungen und Absperrschiebern besteht. In Produktionsbohrungen<br />
befindet sich etwa 30 bis 40 m unter der<br />
Erdoberfläche zusätzlich ein selbstschließendes Sicherheitsventil,<br />
das bei Störungen den Erdgaszufluss blockiert. Dieses<br />
System aus obertägigen und untertägigen Installationen sichert<br />
das Bohrloch in der Phase der Erdgasförderung.<br />
8-9 / 2011 635
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Bild 2: Ein Verbundsystem<br />
aus einzementierten<br />
Stahlrohren sichert<br />
das Bohrloch und<br />
schützt die Umwelt<br />
Frac-Technologie ist bewährt, sicher und<br />
beherrscht<br />
Bei der Erschließung von Erdgaslagerstätten wird in Deutschland<br />
schon seit über 30 Jahren die sog. Frac-Technik angewandt.<br />
Sie ist bewährt, erfolgreich, sicher und wird von der E&P-Industrie<br />
beherrscht. Die Technik zielt darauf ab, die Durchlässigkeit<br />
der Lagerstätte durch die Schaffung von künstlichen<br />
Fließwegen zu steigern. Dazu wird das Gestein durch Einpressen<br />
einer mit Spezialsand beladenen Flüssigkeit unter hohem<br />
Druck aufgebrochen (daher nach dem englischen Wort die Bezeichnung<br />
Frac-Verfahren). Ein hydraulischer Druck von rund<br />
1.000 bar erzeugt im Gestein Risse von bis zu wenigen 100<br />
m Länge. Der in der Flüssigkeit enthaltene Spezialsand füllt die<br />
Risse als Stützmittel, um sie offen zu halten und damit dauerhaft<br />
bessere Fließbedingungen für das Erdgas zu schaffen.<br />
Seit den sechziger Jahren wurden in Deutschland bereits<br />
rund 300 Fracs durchgeführt. In vielen Lagerstätten wurde<br />
hierdurch erst eine wirtschaftliche Förderung möglich.<br />
Die Frac-Technik ist sicher. Sie unterliegt der Genehmigung<br />
und Aufsicht durch die jeweilige Bergbehörde. Die Sicherheitsstandards<br />
sind eindeutig festgelegt. Die Tiefbohrverordnungen<br />
der Länder schreiben die wesentlichen technischen Bedingungen<br />
für die untertägigen Arbeiten fest. Diese werden<br />
durch Rundverfügungen des LBEG weiter spezifiziert, und<br />
WEG-Richtlinien beschreiben einen Industriestandard für bestimmte<br />
Arbeiten. Das Regelwerk ist vorhanden und es stellt<br />
sicher, dass vor Durchführung der Maßnahme die damit verbundenen<br />
Gefährdungen zu beurteilen und gegebenenfalls erforderliche<br />
Sicherheitsmaßnahmen festzulegen sind. So ist es<br />
in § 33 Abs. 8 der Tiefbohrverordnung für Niedersachsen festgelegt<br />
[3]; in den anderen Bundesländern gelten nahezu wortgleiche<br />
Regelungen.<br />
Die Sicherheitsvorschriften in Deutschland sind auch eine<br />
der Ursachen dafür, dass die Frac-Technik hier beherrscht<br />
ist. Bei 300 Fracs, die in Deutschland durchgeführt worden<br />
sind, ist in keinem einzigen Fall eine Umweltbeeinträchtigung<br />
durch den Frac bekannt geworden.<br />
Bild 3: Den Abschluss der Verrohrung bildet die sogenannte Verflanschung,<br />
die aus mehreren Flanschverbindungen und Absperrschiebern<br />
besteht<br />
Umweltverträgliche Erdgasproduktion<br />
Die Erdgasproduktion in Deutschland erfolgt umweltverträglich<br />
und weist aufgrund der Nähe zum Verbraucher zusätzliche<br />
Umweltvorteile auf. So werden durch die heimische Produktion<br />
Treibhausgasemissionen vermieden, die ansonsten auf<br />
dem Transportweg für Importe anfallen würden – immerhin<br />
jährlich rund 5 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalent.<br />
Die Erdgasproduktion hat nur einen außerordentlich geringen<br />
Flächenbedarf. Auf einer Fläche eines Fußballfeldes kann<br />
aus einer üblichen Erdgasbohrung so viel Erdgas produziert werden,<br />
dass damit rund 15.000 Haushalte versorgt werden können.<br />
Außerdem wird die Fläche nur für einen vorübergehenden<br />
Zeitraum genutzt und anschließend für eine Nachnutzung<br />
wieder hergestellt.<br />
Der Schutz des Trinkwassers ist bei allen Aktivitäten ein<br />
wichtiger Aspekt und auch Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit<br />
von Projekten. Im Bereich der Erdgasgewinnung<br />
werden alle Anstrengungen zum Trinkwasserschutz unternommen.<br />
Dies reicht von der Bohrplatzgestaltung, die so geplant<br />
und angelegt werden, dass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten<br />
in den Untergrund versickern können, bis zum Trinkwasserschutz<br />
beim Bohren selbst. Beim Durchbohren Trinkwasser<br />
führender Schichten, das nur kurze Zeit in Anspruch nimmt,<br />
wird tonhaltige Frischwasserspülung eingesetzt, um das Bohrloch<br />
nach außen hin abzudichten. Zusätzlichen Schutz bietet ein<br />
Standrohr, das bis zu ca. 60 m tief gerammt wird. In den darunter<br />
liegenden festen Gesteinsschichten wird das Bohrloch mit<br />
Rohren ausgekleidet und der Zwischenraum zur Bohrlochwand<br />
mit Spezialzement sicher abgedichtet.<br />
636 8-9 / 2011
Trinkwasserschutz<br />
Eine Gefährdung des Trinkwassers durch Fracs ist aus technischen<br />
Gründen nicht zu erwarten. Der große Abstand zwischen<br />
den flach liegenden Grundwasserschichten und den tief<br />
liegenden Erdgaslagerstätten mit einer dichten Überdeckung<br />
macht es unmöglich, dass durch eine Frac-Behandlung eine<br />
Verbindung zwischen Lagerstätte und Grundwasser hergestellt<br />
werden kann. Zusätzliche Sicherheit stellt das Verbundsystem<br />
aus Stahlrohren und Zementierung in der Bohrung dar,<br />
und die Bohrplatzgestaltung schützt Boden und Grundwasser<br />
vor Verunreinigungen.<br />
Literatur<br />
[1] WEG Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung,<br />
Jahresbericht 2010, Zahlen und Fakten<br />
[2] Bericht des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz<br />
und Reaktorsicherheit „Havarievermeidung, Kontrollmechanismen<br />
und Katastrophenbekämpfung betreffend<br />
Bohrinseln in Deutschland“ vom 16. Juni 2010<br />
[3] Bergverordnung für Tiefbohrungen, Untergrundspeicher<br />
und für die Gewinnung von Bodenschätzen durch Bohrungen<br />
im Land Niedersachsen (Tiefbohrverordnung – BVOT)<br />
Chancen für die zukünftige<br />
Erdgasproduktion<br />
Mit den hohen Umweltschutz- und Sicherheitsstandards in<br />
Deutschland und speziell in der Erdgasgewinnungs-Industrie,<br />
den hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern und mit<br />
der Bereitschaft der Unternehmen, mit hohen Investitionen<br />
<strong>neue</strong> Lagestätten zu erschließen, sieht sich die Branche in<br />
Deutschland gut aufgestellt, um auch in der Zukunft einen<br />
wichtigen Beitrag zu einer sicheren, wettbewerbsfähigen und<br />
umweltschonenden Energieversorgung beitragen zu können.<br />
Autor<br />
Josef Schmid<br />
Hauptgeschäftsführer des WEG<br />
Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung<br />
e.V.<br />
Tel. +49 511 12172-0<br />
E-Mail: info@erdoel-erdgas.de<br />
7 th Pipeline Technology<br />
Conference<br />
Pipeline Technology<br />
Conference 2010<br />
28.-30. März 2012, Hannover Congress Centrum<br />
HANNOVER MESSE, 4.-8. April 2011<br />
das wichtigste Technologieereignis im Jahr<br />
www.hannovermesse.de<br />
Call for Papers<br />
veröffentlicht!<br />
6 th Pipeline Technology Conference, 4.-5. April 2011<br />
mit begleitender Fachausstellung im Konferenzbereich<br />
www.pipeline-conference.com<br />
Mehr Informationen und Newsletter mit aktuellen Nachrichten unter www.pipeline-conference.com<br />
Euro Institute for Information<br />
and Technology Transfer<br />
German Society for<br />
Infrastructure Solutions Transfer<br />
S I S T<br />
8-9 / 2011 637
Projekt kurz beleuchtet<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
<strong>Neue</strong> Gas-Hochdruckleitung<br />
verbindet Spenge und Bünde<br />
Die Gasversorgung in der Stadt Spenge war bis September 2010 durch eine in die Jahre gekommene Übernahmestation als<br />
Insellösung von der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) gewährleistet. Um die umfangreiche Sanierung dieser<br />
Station zu vermeiden und um die im Jahr 2004 begonnene Optimierung und Effizienzsteigerung der Hochdruckleitungssysteme<br />
abzuschließen wurde über eine Strecke von ca. 8 km eine <strong>neue</strong> Gas-Hochdruckleitung von Bünde nach Spenge gebaut.<br />
Dabei gehörten die extrem kurze Planungs- und Realisierungsphasen und die unter- und oberirdische Infrastruktur zu den<br />
größten <strong>Herausforderungen</strong>.<br />
Polyethylen-Rohre für Gashochdruckleitung<br />
Im Jahr 2004 entstand die Idee zum Bau einer Gashochdruckverbindung<br />
mit einem Betriebsdruck von 8,0 bar vom bestehenden<br />
Hochdrucknetz in Bünde zur bisherigen Inselversorgung<br />
in Spenge. Für den Neubau der Leitung sprachen u. a.<br />
die anstehenden Sanierungen an der bestehenden Gas-Übernahmestation<br />
in Spenge aber auch der notwendige Rückbau<br />
der vorhandenen Hochdruckleitung DN 200 ST aus dem Jahr<br />
1969. Für eine vernünftige Trassenlösung wurden die Hauptaugenmerke<br />
auf die Baulängen, auf Art und Wertigkeit der<br />
Oberflächen und auf die Besiedelungsdichte gelegt. Zudem<br />
sollte ein Trassenverlauf an Bundes- und Landstraßen vermieden<br />
werden, um Verkehrsbehinderungen und kostenintensive<br />
Oberflächenwiederherstellungen zu vermeiden. Des<br />
Weiteren stand aufgrund der Lage des Konzessionsgebietes<br />
nur ein begrenzter Korridor zur Verfügung. Dennoch waren<br />
die Kreuzung dreier Ferngasleitungen, eine Flusskreuzung (die<br />
Else) und mehrere Bachlaufkreuzungen nicht zu vermeiden.<br />
Nach der Festlegung des Verlaufs und unter Berücksichtigung<br />
der Ergebnisse der durchgeführten Rohrnetzberechnungen<br />
wurde entschieden, die <strong>neue</strong>n Rohrleitungen in DN 200 zu<br />
verlegen.<br />
Parallel wurde die Materialauswahl diskutiert: aufgrund<br />
der geringeren Bauzeit und -kosten gegenüber Stahlrohren<br />
sprach letztlich alles für Rohre aus Polyethylen. Neben den<br />
wirtschaftlichen Aspekten hatte ein Höchstmaß an Sicherheit<br />
für den Bau und den Betrieb dieser Leitung oberste Priorität.<br />
Durch die Bodenbeschaffenheiten wie felsiger Untergrund bei<br />
der gewählten Trasse sowie erforderlicher Querungen, fiel die<br />
Wahl auf Schutzmantelrohre aus Polyethylen, Fabrikat egeplast<br />
SLM RC plus . Dieses Rohrsystem hat zusätzlich zur drucktragenden<br />
Rohrwand einen aufextrudierten Schutzmantel<br />
und kann somit auch bei schwierigen Bodenverhältnissen oh-<br />
BILD 1: Die Verbindung der Rohrenden und die Verlegung durch den<br />
Rohrleitungsbau wurde sowohl von den Projektverantwortlichen als auch<br />
vom Lieferanten betreut<br />
BILD 2: Der ausgelegte Rohrstrang für die Bohrung<br />
638 8-9 / 2011
BILD 4: Bei den Trassen in offener Verlegung wurde das Schutzmantelrohr<br />
unter Wiederverwendung des Bodenaushubs verlegt<br />
BILD 3: Sicherheit für die Rohrleitung hatte bei der<br />
Verlegung oberste Priorität: Daher wurden Schutzmantelrohre<br />
für die offene Verlegung ohne Sandbett und die<br />
Bohrungen eingesetzt. Beschädigungen durch Kratzer<br />
und Riefen werden dabei von einer additiven Schutzschicht<br />
aufgenommen, das drucktragende Kernrohr ist<br />
somit riefen- und kratzerfrei<br />
Auftraggeber / Bauherr:<br />
Geschäftsführer:<br />
Projektverantwortlich:<br />
Planung und Projektentwicklung:<br />
Baubeauftragter für Bau<br />
Hochdruckleitung:<br />
Rohrnetzberechnung und<br />
Bauüberwachung:<br />
Rohrleitungsbau:<br />
Lieferant und konzeptionelle<br />
Unterstützung:<br />
Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH<br />
Dipl.-Ing. Alfred Würzinger<br />
Karsten Klußmann (EWB)<br />
Frank Hüffmeier (EWB)<br />
Jürgen Hellmeier (EWB)<br />
Projekthaus GmbH, Bremen<br />
PRT Rohrtechnik Spenge GmbH<br />
egeplast Werner Strumann GmbH & Co. KG, Greven<br />
ne Sandbettung oder grabenlos verlegt werden. Nachgewiesen<br />
ist die Eignung dieser Rohrsysteme für solche Einsatzzwecke<br />
durch die uneingeschränkte Zertifizierung nach PAS<br />
1075. Schutzmantelrohre entsprechen dem Typ 3 der Klassifizierung<br />
nach PAS.<br />
Unter Beteiligung des Rohrherstellers wurde ein Gesamtkonzept<br />
erarbeitet, bei dem im Bereich der Horizontalbohrstrecken<br />
ein zusätzlicher Sicherheitsbaustein mit der Verwendung<br />
des SLM-DCT-Rohres eingebaut wurde: bei diesem<br />
Rohrsystem kann durch integrierte Leiterbänder zwischen<br />
Rohrwand und Schutzmantel zusätzlich die Leitung nach der<br />
Verlegung auf Nichtbeschädigung überprüft werden.<br />
Reibungsloser Ablauf<br />
Nach Ausschreibung der Bauleistungen stand mit der Firma<br />
PRT Rohrtechnik Spenge GmbH ein leistungsfähiges und qualifiziertes<br />
Fachunternehmen aus der Region für dieses Projekt<br />
zur Verfügung. Im April 2010 begannen die Baumaßnahmen<br />
und verliefen dank der guten Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber,<br />
Auftragnehmer und Rohrhersteller sowie des optimalen<br />
Wetters reibungslos. Auch der teilweise felsige Untergrund<br />
war kein großes Hindernis, so dass Mitte August<br />
2010 die gesamten 7.940 m bereits verlegt waren. Mit der<br />
Lieferung der <strong>neue</strong>n Gas-Druckregel- und Messanlage, die<br />
zur Regelung des Vordrucks von 8,00 bar auf den im Hochdrucknetz<br />
von Spenge verwendeten Druck von 4,00 bar benötigt<br />
wurde, war ein weiterer Meilenstein gesetzt. Somit<br />
musste nur noch die letzte Hürde genommen werden. Durch<br />
einen Fußweg wurde auf einer Länge von ca. 280 m eine SLM<br />
RC plus -Leitung der Nennweite OD 355 mm verlegt. Auch hier<br />
verlief die Verlegung reibungslos. Nach erfolgter Druckprüfung<br />
konnte Anfang September 2010 mit der letzten Einbindung<br />
in Spenge die Leitung in Betrieb genommen werden.<br />
Insgesamt versorgt die EWB rund 90.000 Einwohner der<br />
Orte Bünde, Rödinghausen, Kirchlengern und Spenge mit Erdgas.<br />
Die Gesamtfläche des Gebiets beträgt ca. 170 km², die<br />
Rohrnetzlänge der Gasleitungen in diesem Gebiet beträgt<br />
450 km. Dabei blickt das Unternehmen auf eine 120-jährige<br />
Geschichte in der Gasversorgung zurück.<br />
Kontakt<br />
Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH,<br />
Frank Hüffmeier, E-Mail: hueffmeier@ewb.aov.de;<br />
egeplast Werner Strumann GmbH & Co. KG, Andreas Regeling,<br />
E-Mail: Andreas.Regeling@egeplast.de<br />
8-9 / 2011 639
Projekt kurz beleuchtet<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Erdverkabelung im Fels unter ICE<br />
Strecke, Autobahn und Landstraße<br />
Keine einfache BaumaSSnahme<br />
Schon vor etwa einem Jahr war die Firma Clemens Reuschenbach,<br />
Roßbach an der Erdverkabelungsmaßnahme der Verbindungsleitung<br />
von Puderbach nach Oberhonnefeld mit zwei<br />
20-kV-Kabeln und einem Glasfaserkabel beteiligt. Veranlassung<br />
ist der Rückbau von 20-kV-Freileitungen der SÜWAG<br />
Frankfurt, um die Stromversorgung sicherer zu machen. Jetzt<br />
stand mit der Unterquerung der ICE-Strecke Frankfurt-Köln,<br />
A3 und der L 265 in unmittelbarer Nähe der Mülldeponie Linkenbach,<br />
Kreis Neuwied, mit insgesamt 375 m Länge der Lückenschluss<br />
an. Das ehrgeizige Bohrprojekt führte die Firma<br />
Clemens Reuschenbach gemeinsam mit ihrer Tochterfirma<br />
REVOR GmbH aus Rossbach / Wied durch.<br />
Zunächst musste die zweigleisige und stark frequentierte<br />
ICE-Hochgeschwindigkeitstrecke Köln-Frankfurt mit Zuggeschwindigkeiten<br />
über 300 km/h auf einer Länge von 50 m<br />
mit einem Stahlschutzrohr unterquert werden. Gemäß Vorgabe<br />
der DB Netz Frankfurt darf aus Sicherheitsgründen nur<br />
mit dem Ramm- oder Bohrpressverfahren gearbeitet werden.<br />
Die Anwendung des HDD-Spülbohrverfahrens war daher<br />
über die Gesamtlänge von 170 m nicht möglich.<br />
Auch messtechnisch gibt es Einschränkungen, da der<br />
Bohrkopf bei der Autobahnunterquerung nur auf der jeweiligen<br />
Standspur geortet werden kann. Zudem befinden sich<br />
unterhalb des Straßenraumes in 3,50 m Tiefe Entwässerungskanäle.<br />
Insgesamt war die geplante Bohrtrasse unübersichtlich<br />
und schwer zugänglich. Die dreispurige Autobahn<br />
A3 liegt laut Höhenprofil ca. 1,70 m tiefer als die ICE-Strecke.<br />
Zu guter Letzt wies das Bodengutachten im Bohrtras-<br />
senbereich durchgehend Tonschiefer der Bodenklasse 6-7<br />
aus. Keine einfachen Bedingungen, so der Geschäftsführer<br />
von REVOR, Clemens Reuschenbach.<br />
Baudurchführung<br />
Einbau des Stahlschutzrohres<br />
Zunächst wurde ein Stahlrohr Da 406 x 14,2 mm auf 50 m<br />
Länge mit 15 % Gefälle vorgepresst und mit einer Bohrschnecke<br />
geräumt. Dazu wurde am Startpunkt eine 5 m tiefe,<br />
mit Magnum-Verbauplatten abgesicherte, Grube erstellt.<br />
Um die genaue Höhe der Stahlrohrbohrung sicherzustellen,<br />
wurde das Gefälle mit einem Laser auf 50 m festgestellt und<br />
in das Bohrprofil übertragen. Nach Beendigung des Vortriebs<br />
schob man zur Führung der HDD-Pilotbohrung innerhalb des<br />
Stahlrohres ein Hilfsrohr DN 160 mit Abstandhaltern bis zur<br />
Ortsbrust ein. Der Vortrieb des Stahlrohres mit der Bohrpressanlage<br />
sowie der Einschub des Hilfsrohres dauerten<br />
fünf Arbeitstage. Im Anschluss an diese Arbeiten wurde die<br />
Baugrube angefüllt und der Untergrund für die Positionierung<br />
der GRUNDODRILL Spülbohranlage, Typ 15 N, vorbereitet.<br />
Pilotbohrung<br />
Danach begann die Pilotbohrung mit dem Vorschub der Bohrgestänge,<br />
an dessen Spitze ein Bohrkopf für Hartgestein mit<br />
einer Tiefensonde angebracht war. Der Bohrkopf wurde zum<br />
ersten Mal nach dem Austritt aus dem Hilfsrohr hinter der<br />
BILD 1: Überblick Bohrtrasse<br />
640 8-9 / 2011
ICE-Strecke geortet und wenig später die Richtungsänderung<br />
von 15 % Neigung auf 15 % Steigung<br />
eingeleitet. Auf der ostseitigen Standspur der<br />
A3 betrug die Überdeckung 6,70 m. Ab diesem<br />
Punkt war eine Ortung nicht mehr möglich. Die<br />
nächste Ortung wurde erst wieder auf der anderen<br />
Seite vorgenommen und zeigte eine planmäßige<br />
Überdeckung von 8,30 m.<br />
Die Pilotbohrung konnte schneller als erwartet<br />
innerhalb von zwei Arbeitstagen erstellt werden.<br />
Aufweiterungsbohrungen und<br />
Rohreinzug<br />
Der 1. Aufweitungsvorgang begann morgens mit<br />
einem 140er Backreamer, der noch durch das Hilfsrohr<br />
DN 160 auf der anderen Seite eingezogen<br />
werden konnte. Das Hilfsrohr wurde danach nicht<br />
mehr benötigt und konnte herausgezogen und geborgen<br />
werden.<br />
Am Nachmittag begann die Umsetzung der<br />
Bohranlage und die Vorbereitung für die 2. Aufweitungsbohrung<br />
mit dem Anschluss eines 280er<br />
Backreamers, die ebenso wie die 3. Aufweitungsbohrung,<br />
die mit einem 380er Backreamer durchgeführt<br />
wurde, innerhalb von zwei Arbeitstagen<br />
erledigt war.<br />
Mit dem gleichen Backreamer erfolgte dann der<br />
Einzug des 170 m Rohrbündels, bestehend aus zwei<br />
PE-HD-Rohren DN 140 und einem PE-HD-Rohr<br />
DN 90 von morgens 10.00 Uhr bis nachmittags<br />
14.00 Uhr inklusive zweimaliger Unterbrechungen<br />
durch Schweißarbeiten zur Verlängerung des Rohrstrangs.<br />
BILD 2: Pilotbohrung im Hilfsrohr - im Hintergrund die ICE-Strecke<br />
Fazit<br />
Der Bentonitverbrauch für die gesamte Maßnahme<br />
lag bei ca. 2,2 t. Die Wasserversorgung wurde<br />
durch einen 24 m 3 Wassertank sichergestellt. Die<br />
gebrauchte Bentonitspülung wurde abgesaugt und<br />
entsorgt. So konnte diese nicht alltägliche Leitungsverlegung<br />
termingerecht und technisch planmäßig<br />
ausgeführt werden. Die kreative Planung<br />
des Unternehmens, das Zutrauen des Auftraggebers<br />
sowie das Können und die Erfahrung des<br />
Bohrteams haben durch die Kombination von Bohrpress-<br />
und HDD-Technik zum Erfolg geführt.<br />
Kontakt<br />
E-Mail: Info@clemens-reuschenbach.de;<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt,<br />
Günter Naujoks, E-Mail: guenter.naujoks@<br />
tracto-technik.de, www.tracto-technik.de<br />
BILD 3: Einzug des Rohrbündels von der Startgrube<br />
8-9 / 2011 641
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Optimierung der<br />
Wasserversorgungsanlagen unter<br />
Anwendung des TASI-Moduls<br />
Von Esad Osmancevic und Marius Greza<br />
Zusammenfassung: Heute werden hohe Ansprüche an die Planung, Sanierung und Optimierung von Wasserversorgungsanlagen<br />
und Wasserversorgungsnetze gestellt. Bezogen auf die Leitungstrassierung, Netzgestaltung, hydraulische<br />
Bemessung und Auswahl sowie Anordnung von Anlagenteilen ergeben sich ständig <strong>neue</strong> Anforderungen.<br />
Seit geraumer Zeit ist es möglich, diese Anforderungen unter Nutzung moderner Rechennetzprogramme zu erfüllen.<br />
Der Einsatz derartiger Programme ist mittlerweile unverzichtbar geworden und entspricht dem Stand der Technik.<br />
Nur mit diesen Werkzeugen kann in komplexen Systemen bzw. Netzen das Zusammenwirken zahlreicher hydraulischer<br />
Vorgänge simuliert werden.<br />
Der vorliegenden Fachartikel beinhaltet Ergebnisse einer Bachelorarbeit mit dem Thema „Optimierung der Wasserversorgungsanlagen<br />
eines Zweckverbandes in der Nähe von Stuttgart“. Nachfolgend sind nur die Ergebnisse der Kalibrierung<br />
des Rechennetzmodells unter Anwendung des TASI-Moduls (Tagessimulation) dargestellt.<br />
Die quasidynamische Berechnung<br />
Auf dem Markt wird derzeit eine breite Palette an Netzberechnungsprogrammen<br />
angeboten. Die Grundanwendung der<br />
Netzberechnungsprogramme in der Versorgung ist die stationäre<br />
Berechnung, die die Beurteilung zu einem festgelegten<br />
unveränderlichen Netzzustand ermöglicht (Bild 1).<br />
In vielen Fragestellungen aus der Praxis spielen der Druck<br />
und der Durchfluss im Netz über einen längeren Zeitraum eine<br />
bedeutende Rolle. Besonders betrifft dies die Beurteilung<br />
der Speicherfähigkeit und Bewirtschaftung von Wasserspeicheranlagen,<br />
die Arbeitsweise bestehender Wasserförderanlagen<br />
sowie den Einfluss von Regel- und Steuerorganen<br />
auf das System. Diese Fragestellungen können bei stationären<br />
Berechnungsverfahren nur oberflächlich qualitativ beurteilt<br />
werden.<br />
Das TASI-Modul der Berechnungssoftware STANET [7]<br />
greift diese Problematik auf und ermöglicht die Simulation<br />
dieser Vorgänge durch das quasidynamische Berechnungsmodul<br />
(vgl. Bild 1). Druck und Durchfluss werden über einen<br />
vorgegebenen bestimmten Zeitraum, über definierte Zeitschritte,<br />
in Abhängigkeit von vorgegebenen Abnahmemengen<br />
(Bild 2), Steuerungen und Förderkapazitäten berechnet.<br />
Generell lassen sich mit dem TASI-Modul (Tagessimulation)<br />
alle praktischen Anwendungen in den Verteilungsanlagen mit<br />
den integrierten Features zur Netzmodellierung funktionsgetreu<br />
nachgestalten.<br />
BILD 1: Netzberechnung<br />
– Netzzustände<br />
642 8-9 / 2011
Wann ist die quasidynamische Berechnung<br />
sinnvoll?<br />
Diese Berechnung ist für Versorger interessant, die entsprechend<br />
ihrer betriebenen Anlagen, neben der klassischen stationären<br />
Berechnung, eine Beurteilung und Optimierung von Befüllungs-<br />
und Einspeisungsvorgängen sowie der zeitlich veränderlichen<br />
Belastung der einzelnen Netzabschnitte wünschen.<br />
Schließlich kommt es im Netz durch das Zusammenwirken von<br />
Anlagen (Pumpen, Behälter, Druckminderventile, usw.) zu komplexen<br />
Überlagerungen über längere Zeit, die durch die quasidynamische<br />
Berechnung wiedergegeben werden können. Wie<br />
versorgungssicher ist die Bewirtschaftung meiner Speicheranlagen?<br />
Kann ich Betriebs- und Wartungskosten durch Stilllegung<br />
einzelner Anlagen sparen? Wie verhalten sich meine Fördereinrichtungen<br />
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Auslastung?<br />
Dies sind nur einige Fragen, die den Versorger beschäftigen<br />
und ihn zugleich veranlassen nicht nur das Netz sondern<br />
das ganze Versorgungssystem zu betrachten.<br />
Voraussetzungen für die quasidynamische<br />
Berechnung<br />
Bei der quasidynamischen Berechnung handelt es sich um ein<br />
sehr komplexes und aufwändiges Simulationsverfahren, das<br />
ebensolche Ansprüche an die Kenntnisse des zu untersuchenden<br />
Versorgungssystems (Bild 3) und der dort betriebenen<br />
Anlagen stellt. Es ist daher erforderlich eine Bestandsaufnahme<br />
aller im Netz installierten und in Betrieb befindlichen Speicher-,<br />
Regel- und Förderanlagen vorzunehmen.<br />
Im Zeitalter der Automatisierung und Fernübertragung<br />
verfügen bereits viele Versorger über ein Prozess- und Fernleitsystem,<br />
das dem Betriebspersonal ermöglicht, die Anlagen<br />
im System anhand von kontinuierlichen Messwerten zu überwachen<br />
und diese zu erfassen und langfristig abzuspeichern.<br />
Je nachdem wie lange und in welcher „Feinheit“ der Betreiber<br />
die Messwerte im Archiv hinterlegt, lassen sich daraus bereits<br />
repräsentative Erkenntnisse in Bezug auf die Durchflussmengen<br />
über einen bestimmten Zeitraum gewinnen. So können<br />
beispielsweise Tage mit maximaler Abnahme oder maximaler<br />
Stundenlast genau ermittelt und entsprechend des Messintervalls<br />
als Ganglinie dargestellt werden (Bild 2).<br />
Versorger profitiert bereits bei der<br />
Grundlagenermittlung<br />
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass bereits im Verlauf der<br />
Grundlagenermittlung und der Verarbeitung von Messwerten<br />
aus dem Prozessleitsystem wertvolle Erkenntnisse über<br />
die Qualität der erfassten Daten sowie deren Relevanz und<br />
Aussagekraft für die alltägliche Anwendung und Bewertung<br />
seitens des Versorgers gewonnen werden können.<br />
Da wir uns von der Anwendung des TASI-Moduls eine allumfassende<br />
Beurteilung sämtlicher Anlagen im System wünschen,<br />
ist die Anwendung auf einen einhergehenden umfangreichen<br />
Plausibilitäts-Check angewiesen. Die Fülle an kontinuierlich<br />
erfassten Messwerten von Behälterein- und -ausläufen<br />
sowie Netzeinspeisungen und der gemessene Verbrauch von<br />
Großabnehmern, bietet die Möglichkeit Unstimmigkeiten zu<br />
entdecken und den Ursachen mit dem Betreiber auf den Grund<br />
BILD 2: Tagesprofil – vorgegebene Abnahmemengen<br />
BILD 3: Untersuchtes Versorgungsgebiet<br />
zu gehen. Fehlerhafte oder defekte Messwertübertragungen,<br />
überdimensionierte Wasserzähler sowie Wasserverluste können<br />
die Urheber zuvor erwähnter Unstimmigkeiten darstellen.<br />
Auch können bereits in diesem Stadium der Untersuchung fundierte<br />
Verbesserungs- und Optimierungsvorschläge zum zukünftigen<br />
Betrieb und der Dringlichkeit weiterer Messeinrichtungen<br />
getroffen werden.<br />
Vom Computermodell zum Abbild des<br />
Netzes/Systems<br />
Die Vorgehensweise hat das Ziel, das Rechennetz anhand<br />
gemessener Druck- und Durchflussdaten zu kalibrieren. Der<br />
Messumfang im Wasserversorgungssystem umfasst zwei<br />
Messvarianten. Bei der ersten Messvariante soll über den<br />
8-9 / 2011 643
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Zeitraum von mehreren Tagen (Langzeitmessung) der Normalbetrieb<br />
der Wasserverteilungsanlagen erfasst werden.<br />
Durch die Aufnahme von Druckdaten über einen längeren<br />
Zeitraum und die Aufzeichnungen des Prozessleitsystems erhält<br />
man eine Aussage über die Verbrauchsverteilung, auftretende<br />
Fließdrücke, Fließmengen sowie deren sich daraus<br />
ergebenden Tagesganglinien, wie sie für die Tagessimulation<br />
benötigt werden. Des Weiteren werden Erkenntnisse über<br />
die sich ändernden Abnahmemengen zu den verschiedenen<br />
Tageszeiten sowie über die sich unterscheidenden Abnahmemengen<br />
an Werktagen und am Wochenende gewonnen.<br />
Die zweite Messvariante erfolgt durch eine gezielte Entnahme<br />
von Wasser aus dem Netz über einen bestimmten<br />
Zeitraum (Kurzzeitmessung). Ziel der künstlichen Belastung<br />
ist es, jeden Netzabschnitt mit maximal möglichem Durchfluss<br />
zu belasten, um auswertbare Druckabfälle zu erzeugen.<br />
Zeitgleich mit der Messung sind zusätzlich die Behälterstände<br />
und Durchflüsse an den Einspeisestellen sowie der<br />
Verbrauch von den einzelnen Abnehmern zu dokumentieren.<br />
Diese werden Idealerweise auch vom Prozessleitsystem erfasst<br />
und aufgezeichnet.<br />
Bei der stationäre Berechnung geschieht dies durch die<br />
Simulation des Messzustandes und den Abgleich der gerechneten<br />
Druckverhältnissen (gerechneter momentaner Druck)<br />
zu den gemessenen Druckverhältnissen (Durchschnittswert<br />
im gemessenen Zeitraum). Hier findet die Anpassung der betrieblichen<br />
Rauhigkeit statt, ein Parameter, der als Maß für das<br />
hydraulische Verhalten der Rohrleitungen gilt. Dies bietet die<br />
Möglichkeit, den Ist-Zustand des Netzes zu beurteilen und gilt<br />
als Entscheidungsgrundlage für nachhaltige sowie wirtschaftliche<br />
Optimierungs-, Ausbesserungs- und Reparaturmaßnahmen<br />
bezüglich der Rohrleitung.<br />
Unter Anwendung der quasidynamischen Berechnung wird<br />
das Modell bezüglich der in der Realität vorliegenden Steuerungen<br />
und Regler (Sollwerte) von Behältereinläufen, Pum-<br />
pen, Schiebern und Ventilen kalibriert. Durch den Import der<br />
gemessenen Druckdaten ins Rechennetz-Programm, können<br />
in einem integrierten Zeitverlaufsdiagramm der gemessene<br />
und gerechnete Druck über einen definierten Zeitraum<br />
grafisch verglichen werden. Dieses Werkzeug liefert die Erkenntnis,<br />
inwieweit sich die dynamischen Vorgänge wie Behälterbefüllungen,<br />
Pumpvorgänge und Druckschwankungen im<br />
Netz anhand des Rechennetzes wiedergeben lassen (Bild 4).<br />
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die aus den Daten des<br />
Prozessleitsystems hervorgehenden Abnahme-, Einspeise-,<br />
Befüllungs- und Fördervorgänge in Echtzeit mit dem TASI-<br />
Modul wiederzugeben, um damit die virtuellen Steuerungen,<br />
Regler und Aggregate in ihrer Wirkungsweise an ihre realen<br />
Vorbilder anzupassen. Zudem lässt sich die Qualität der zuvor<br />
durchgeführten stationären Messvergleichsberechnung (vgl.<br />
Bild 4) veranschaulichen. Für jeden Punkt im Netz, für den eine<br />
Messkurve vorliegt, können nun die Druckkurven übereinander<br />
gelegt und verglichen werden.<br />
Für dieses Vorhaben werden die vom Prozessleitsystem<br />
aufgezeichneten Abnahmeprofile von einem der Messtage ausgewählt,<br />
per Import in der Datenbank des Rechennetzprogramms<br />
STANET hinterlegt und mit dem TASI-Modul im Rechennetz<br />
simuliert.<br />
Vergleich von quasidynamischer<br />
Berechnung und Realität<br />
Die Leitungselemente des Rechennetzes wurden durch Anpassung<br />
der betrieblichen Rauhigkeit an die real existierenden,<br />
hydraulischen Verhältnissen angepasst, die Steuer- und Regelorgane<br />
konfiguriert, die Funktionsweise von Förderanlagen<br />
durch die Eingabe von Kennlinien definiert sowie die Geometrie<br />
der Speicherbehälter anhand ihrer realen Vorbilder festgelegt.<br />
Man stelle sich ein Transportleitungsnetz (vgl. Bild 3) vor,<br />
das über eine oder mehrere Förder- und Fallleitungen Trink-<br />
BILD 4: Gemessener<br />
und gerechneter<br />
Druck im<br />
Netz<br />
644 8-9 / 2011
BILD 5: Druckverlaufsdiagramm<br />
– Fallleitung<br />
(Befüllung mehrerer Behälter)<br />
BILD 6: Druckverlaufsdiagramm<br />
– Fallleitung (Befüllung eines Behälters)<br />
wasser an verschiedene Hochbehälter oder direkt in anliegende<br />
Ortsnetze einspeist. Für jedes Ortsnetz stehen individuelle<br />
gemessene Tagesprofile zur Verfügung, jeder Behälter wurde<br />
mit Zulaufsteuerungen und Sollwerten definiert. Wie verhält<br />
sich nun aber das Rechennetz als Ganzes im Vergleich zur Realität?<br />
In wieweit können die Überlagerungen und hydraulischen<br />
Wechselwirkungen von mehreren in der Realität existierenden<br />
Anlagen am Rechner wiedergegeben werden?<br />
Ein Teil unseres Bestrebens bei der Anwendung des TASI-<br />
Moduls war zunächst, genau diese Fragen anhand des Vergleiches<br />
von gemessenen und gerechneten Druckdaten zu beantworten.<br />
Dies kann anhand des Vergleiches von gemessenem<br />
und gerechnetem Druck über mehrere Stunden untersucht<br />
werden. In der Tat liefert der Vergleich das Ergebnis, dass<br />
die gemessene Druckverlaufskurve an einer bestimmten Stelle<br />
im Netz, weitgehend mit den berechneten Werten, bei einer<br />
tolerierbaren Differenz übereinstimmt. Die zeitliche Übereinstimmung<br />
der Druckkurven ist im Allgemeinen ein Maß dafür,<br />
wie genau die realen Überlagerungsvorgänge (Behälterbefüllungen,<br />
Abnahme und Betrieb der Fördereinrichtungen) im Rechennetzmodell<br />
stattfinden.<br />
Bild 5 zeigt den Vergleich von gemessenem und gerechnetem<br />
Druck auf einer Fallleitung, die mehrere Hochbehälter befüllt<br />
und in mehrere Ortsnetze einspeist. Eine sehr gute Übereinstimmung<br />
lässt sich ebenfalls bei der Simulation einer Fallleitung<br />
erkennen, die zur Befüllung eines Hochbehälters dient<br />
(Bild 6), mit einem entsprechend dem Füllstand gesteuerten<br />
Zulauf. Bei der Betrachtung folgender Abbildung wird ebenfalls<br />
deutlich, dass die gemessenen Druckverläufe der Fallleitung,<br />
auf einen sich langsam entwickelnden Abfall des Fließdruckes<br />
schließen lassen, während bei der Simulation im Rechennetz die<br />
Druckentwicklung schlagartig vonstatten geht. Betrachtet man<br />
den gemessenen und gerechneten Druckverlauf auf einer Förderleitung,<br />
dessen Pumpwerk anhand der Füllstandshöhe eines<br />
zu befüllenden Behälters gesteuert wird, ergibt sich Bild 7.<br />
Während im Rechennetz die Pumpe sofort nach Einschalten<br />
die maximale Fördermenge bei maximalem Förderdruck aufbringt,<br />
lässt der gemessene Druckverlauf auf einen langsamen<br />
Druckaufbau schließen, der durch die entgegenwirkende Wassersäule<br />
verursacht wird. Es dauert im realen Betriebszustand,<br />
bis die Pumpen mit konstantem Druck fahren. Auch bei Betrachtung<br />
des Druckabfalls beim Abschalten der Pumpen lässt<br />
sich feststellen, dass sich in der Realität der Druck durch das<br />
8-9 / 2011 645
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
langsame Auslaufen der Pumpe schleppend abbaut, während<br />
bei der Simulation der Druck schlagartig abfällt. Der grafische<br />
Vergleich des gemessenen und gerechneten Druckverlaufs in<br />
Bild 7 zeigt jedoch, dass Simulation und Realität aus quantitativer<br />
Sicht übereinstimmen.<br />
Auf die Eingangsdaten kommt es an<br />
Vorneweg sei gesagt, dass die Ergebnisse einer Berechnungssoftware<br />
nicht besser sein können als die Daten, die man ihr<br />
zur Verarbeitung liefert. Nicht anders ist es bei der Rohrnetzberechnung<br />
mit Hilfe des TASI-Moduls. Hier ist man, wie zuvor<br />
erwähnt, auf eine gepflegte Datensicherungssystematik<br />
des Versorgers angewiesen, der Messwerte aller Art detailliert<br />
und auswertbar archiviert. Nur durch diese Daten lassen sich<br />
Kenntnisse über die Betriebsweise des Systems sowie genaue<br />
Tagesprofile der Abnehmer erlangen.<br />
Wie alle Messwerte sind auch die Messwerte von Wasserzählern,<br />
Füllstandspegeln sowie die Messwerte der vor Ort eingebauten<br />
Druckmessgeräte mit Fehlern bzw. Ungenauigkeiten<br />
behaftet. Auch die in der Berechnungssoftware STANET hinterlegten<br />
geometrischen Daten der Hochbehälter sowie deren<br />
Maximal- und Minimalpegel können mit Ungenauigkeiten behaftet<br />
sein. Die Auswirkungen solcher Fehler wurden aus den<br />
zuvor gezeigten Abbildungen ersichtlich und bewegen sich bei<br />
sorgfältiger Analyse der einzugebenden Daten in einem vernachlässigbaren<br />
Bereich.<br />
BILD 7: Druckverlaufsdiagramm<br />
– Förderleitung (Befüllung<br />
eines Behälters)<br />
BILD 8: Mögliche Fehlerquellen<br />
für die quasidynamische<br />
Berechnung<br />
646 8-9 / 2011
Fehler und Ungenauigkeiten lassen sich in der Praxis kaum<br />
vermeiden, jedoch hilft schon die Kenntnis über mögliche<br />
Fehlerquellen bei der Verarbeitung von Messdaten sowie bei<br />
der späteren Interpretation von Rechenergebnissen. Bild 8<br />
verdeutlicht die Fehlerquellen und die daraus hervorgehenden<br />
Auswirkungen auf die quasidynamische Berechnung.<br />
Ist das Rechennetz aus hydraulischer und funktionstechnischer<br />
Sicht erst einmal geeicht und kalibriert, steht dem<br />
Anwender ein Werkzeug zur Verfügung, das bei sämtlichen<br />
Fragestellungen in der Gas- und Wasserversorgung eine Entscheidungsgrundlage<br />
für zukünftige Maßnahmen bietet. Gerade<br />
in der Wasserversorgung besteht ein großes Einsparpotenzial<br />
bei der Bewirtschaftung von mehreren Hochbehältern<br />
(Bild 9) sowie beim Betrieb von Förderanlagen. In vielen Fällen<br />
können, über längere Zeit gewachsene Netze bzw. Systeme<br />
in einer Versorgungsstruktur, durch diese Art der Simulation<br />
beurteilt und ggf. durch Umgestaltungsmaßnahmen und<br />
Stilllegung älterer Anlagenbestände immense laufende Betriebskosten<br />
eingespart werden. In Bezug auf weitere Bereiche<br />
des Netzmanagements bietet das TASI-Modul die Möglichkeit<br />
Ausfallszenarien aller Art realitätsgetreu zu berechnen,<br />
visuell darzustellen und ist speziell für diese Problematik ein<br />
zuverlässiges Tool, auch bezogen auf die Planung von Notversorgungen<br />
und die Optimierung der Versorgungssicherheit.<br />
Fazit<br />
Die Arbeit mit dem TASI-Modul ermöglichte nicht nur die<br />
Einarbeitung und Handhabung dieses Werkzeuges, sondern<br />
brachte vor allem wichtige Erfahrungen in Bezug auf die Stärken,<br />
die Grenzen und die Fähigkeiten der Tagessimulation.<br />
Durch die Komplexität des Projektes konnte das TASI-Modul<br />
wirkungsvoll bei der Bachelorarbeit eingesetzt werden und<br />
ermöglichte eine tiefgehende Untersuchung des veränderlichen<br />
hydraulischen Zustandes des Transportleitungsnetzes<br />
bzw. Wasserversorgungssystems. Durch die quasidynamische<br />
Berechnung der „Netzatmung“ knüpft dieses Werkzeug<br />
dort an, wo die herkömmliche stationäre Berechnung<br />
in ihrer Aussage begrenzt wird und bildet somit eine Grundlage<br />
für präzisere und weiterführende Ergebnisse, Beurteilungsgrundlagen<br />
und die Optimierung von Netzen bzw. des<br />
ganzen Wasserversorgungssystems.<br />
Anhand auftretender Problemstellungen im Umgang mit<br />
dem TASI-Modul entstand eine fundierte Analyse von Fehlerquellen<br />
und Bewertung der Sensibilität des Moduls sowie<br />
die Beurteilung und Abgrenzung der Ergebnisse stationärer<br />
und quasidynamischer Berechnungsergebnisse. Insbesonde-<br />
BILD 9: Bewirtschaftung der Speicherbehälter<br />
re durch die Analyse der Fehlerquellen konnte die Abhängigkeit<br />
der Tagessimulation von der Qualität der Datenaufzeichnung<br />
durch Prozessleitsysteme herausgearbeitet werden.<br />
Dies ermöglicht einerseits eine Entscheidungsgrundlage<br />
für den Einsatz der Tagessimulation für zukünftige Aufgabenstellungen,<br />
zum anderen bildet es eine Empfehlungs- und<br />
Verbesserungsgrundlage für Wasserversorger, die über ein<br />
Prozessleitsystem verfügen und dieses nicht im Rahmen ihrer<br />
Möglichkeiten nutzen.<br />
Literatur<br />
[1] STANET Monitor: Netzberechnung und Netzinformationssystem<br />
für Versorgungsnetze<br />
[2] DVGW-Arbeitsblatt W 300 „Wasserspeicherung – Planung,<br />
Bau, Betrieb und Instandhaltung von Wasserbehältern<br />
in der Trinkwasserversorgung“ (2005-06)<br />
[3] DVGW-Arbeitsblatt GW 303-1 „Berechnung von Gas- und<br />
Wasserrohrnetzen (Teil 1: Hydraulische Grundlagen, Netzmodellisierung<br />
und Berechnung)“<br />
[4] DVGW-Arbeitsblatt W 400 -1 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(Teil 1: Planung)“ (2004-10)<br />
[5] DVGW-Arbeitsblatt W 400-3 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(Teil 3: Betrieb und Instandhaltung)“<br />
(2006-09)<br />
[6] DVGW-Arbeitsblatt W 410 „Wasserbedarf – Kennwerte<br />
und Einflussgrößen“ (2007-09)<br />
[7] Ingenieurbüro Fischer-Uhrig Berlin: Quasidynamische<br />
Netzberechnung TASI (Stand: 8.2.2006), Broschüre, Vorstellung<br />
und Anwendung von TASI<br />
Autoren<br />
Dr.-Ing. Esad Osmancevic<br />
Teamleiter Netze<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel. +49 711 289513-20<br />
E-Mail: e.osmancevic@rbs-wave.de<br />
Marius Greza<br />
Projektleiter Netze<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel. +49 711 289513-28<br />
E-Mail: m.greza@rbs-wave.de<br />
8-9 / 2011 647
Projekt kurz beleuchtet<br />
Wasserversorgung<br />
Spezialanwendung<br />
demineralisiertes Prozesswasser<br />
Synergien nutzen durch zentrale<br />
Versorgung<br />
In der Scheldelaan in Antwerpen schlägt das Herz der (petro-)<br />
chemischen Industrie in Belgien. Eine Vielzahl internationaler<br />
Unternehmen betreibt hier in der Nähe des Antwerpener<br />
Hafens Raffinerien und Polymerisationsanlagen, so<br />
auch die egeplast-Lieferanten Total Petrochemicals und Ineos.<br />
Ein zentraler Standortfaktor ist neben dem Rohöl auch<br />
die Versorgung mit ultrasauberem demineralisiertem Wasser<br />
für die chemischen Prozesse. Ursprünglich betrieb jede Fabrik<br />
ihre eigene Deionisierung zur Erzeugung des demineralisierten<br />
Wassers.<br />
Aufgrund von steigendem Kostendruck sollten nun Synergieeffekte<br />
durch eine gemeinsame zentrale Versorgung<br />
erzielt werden. Zusammen mit Induss (Industrial Water Solutions),<br />
einer Unternehmenstochter der water-link, wurden<br />
verschiedene Optionen geprüft. Als Ergebnis erhielt Induss<br />
als Wasserexperte die Aufgabe, eine zentrale Anlage zu betreiben,<br />
die Industrieunternehmen anzuschließen und mit<br />
der notwendigen Wassermenge sicher und redundant zu<br />
versorgen.<br />
Die Baumaßnahmen starteten im Herbst 2010 und sollen<br />
innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Die Planung<br />
stellte Induss vor besondere <strong>Herausforderungen</strong>. Das<br />
hochkorrosive deionisierte Wasser musste unter höchsten<br />
Ansprüchen an die Reinheit und Versorgungssicherheit durch<br />
ein Industriegebiet mit jahrelangem Chemie- und Raffineriebetrieb<br />
in unmittelbarer Nähe transportiert werden und<br />
war somit dem Risiko von kontaminiertem Erdreich ausgesetzt.<br />
Eine weitere Herausforderung stellte die Kreuzung<br />
mehrerer vielbefahrener Straßen dar, die mittels gesteuerter<br />
Bohrungen unterdükert werden mussten. Induss suchte<br />
daher ein geeignetes Rohrsystem mit folgendem Anforderungsprofil:<br />
Hochbeständig gegen Korrosion<br />
Schutz gegen Verunreinigungen aus dem Erdreich<br />
kein Leaching des Rohrmaterials in das Medium<br />
Geeignet zur Verlegung im Spülbohrverfahren<br />
Bild 1: Spezialanwendung demineralisiertes Prozesswasser<br />
648 8-9 / 2011
<strong>Wege</strong>n des korrosiven Mediums rückten Kunststoffrohre in<br />
den Fokus der Planer. Es gab jedoch zunächst Bedenken, ob<br />
die Migration von Additiven (bzw. ein „Auswaschen“<br />
(„Leaching“) flüchtiger Polymerbestandteile) die Reinheit des<br />
Mediums gefährden könne. Daher forderte Induss von allen<br />
potentiellen Anbietern den Nachweis eines „Leaching“-Tests,<br />
der bei VITO in Belgien durchgeführt werden musste. Gefordert<br />
war nach Ablauf einer längeren Einwirkzeit des Rohrmaterials<br />
auf ein deionisiertes Wasser die Einhaltung eines<br />
Grenzwertes der elektrischen Leitfähigkeit des DI-Wassers.<br />
Die maSSgeschneiderte Lösung<br />
Als Druckrohrmaterial wurde PP-R 100 ausgewählt. PP-R-<br />
Rohre werden schon seit Jahren in der Industrie mit sehr positiven<br />
Erfahrungen für unterschiedlichste Medien eingesetzt<br />
und bieten neben der Korrosionssicherheit des homogenen<br />
Werkstoffs auch die Möglichkeit einer homogenen Schweißverbindung.<br />
Um eine Verunreinigung des ultrasauberen Wassers<br />
durch Permeation aus dem Erdreich sicher auszuschließen,<br />
wurde wie beim bewährten SLA ® Barrier Pipe eine Aluminium-Sperrschicht<br />
und ein Schutzmantel auf das Druckrohr<br />
aus PP-R 100 aufextrudiert. Die Aluminium-Barriereschicht<br />
dient als Diffusionssperre. Der Schutzmantel aus<br />
mineralverstärktem Polypropylen schützt die Rohrkonstruktion<br />
und ermöglicht auch die Verlegung durch gesteuerte<br />
Bohrungen bei Straßenkreuzungen.<br />
Das neu entwickelte egeplast SLA ® PP-R-Rohr kombiniert<br />
somit die Vorteile eines Kunststoffrohres (Korrosionsfreiheit,<br />
Flexibilität, grabenlos verlegbar) mit denen eines Metallrohres<br />
(Barriereeigenschaft).<br />
Nachdem die Nachweise nach Abschluss des „Leaching“-<br />
Tests erbracht waren, wurde das Projekt zusammen mit Guy<br />
Colman, Cynerpro, Partner von egeplast in Belgien, zu Ende<br />
geplant, inklusive der Systemtechnik sowie der erforderlichen<br />
Bohrungen. Die Entscheidung für egeplast SLA ® PP-R-Rohre<br />
fiel dann im Sommer 2010.<br />
Um Synergien in der Bauphase zu schaffen, wurde eine<br />
zweite Leitung zum Transport einer 22-prozentigen Natronlauge<br />
direkt mit verlegt. Auch hierfür fiel die Wahl auf das maßgeschneiderte<br />
PP-R 100- SLA ® Barrier Pipe. Die Verlegung der<br />
Rohre erfolgte im Open Trench/Directional Drilling. Die Dükerungen<br />
bei Straßenkreuzungen erfolgten im Rohrbündel.<br />
In diesem Fall hat das SLA ® Barrier Pipe alle technischen Anforderungen<br />
erfüllt und bot zudem eine wirtschaftliche Lösung.<br />
Bild 2: Kennzeichnung der DI Pipeline (Denionisiertes Wasser)<br />
Bild 3: Einzug der 3 x 300 m langen Rohre im Spülbohrverfahren<br />
Kontakt<br />
Cynerpro NV, Guy Colman, E-Mail: Guy.Colman@cynerpro.be;<br />
egeplast Werner Strumann GmbH & Co. KG, Dr. Thorsten<br />
Späth, E-Mail: Thorsten.Spaeth@egeplast.de<br />
8-9 / 2011 649
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
<strong>3R</strong> + gwf Wasser Abwasser<br />
im Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
<strong>3R</strong> International erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser Abwasser erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (12 Ausgaben) und<br />
gwf Wasser Abwasser (12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
□ Als Heft für 528,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 528,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ Als Heft für 264,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 264,- pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr. Die sichere und pünktliche Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,–<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN0411<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Marktübersicht<br />
2011<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de
2011<br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Absperrklappen<br />
Anbohrarmaturen<br />
Schaugläser für Rohrleitungen<br />
Rohre<br />
Fernwärmerohre PE 100-RC Rohre Schutzmantelrohre<br />
652 8-9 / 2011
RohRe + Komponenten<br />
2011<br />
Kunststoff<br />
Formstücke<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
8-9 / 2011 653
2011<br />
mAschInen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Berstlining<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
654 8-9 / 2011
mAschInen + GeRäte<br />
2011<br />
Leckageortung<br />
Inspektion<br />
Marktübersicht<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
8-9 / 2011 655
2011<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
656 8-9 / 2011
KoRRosIonsschutZ<br />
2011<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
8-9 / 2011 657
2011<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
Dienstleistungen<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Ingenieurdienstleistungen<br />
658 8-9 / 2011
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
2011<br />
sanierung<br />
Sanierung Gewebeschlauchsanierung Schächte<br />
Marktübersicht<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Institute<br />
8-9 / 2011 659
2011<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
660 8-9 / 2011
Sprechstunde<br />
2. Explosionsschutz-Sprechstunde<br />
Explosionsschutz<br />
17. + 18.11.2011, Mannheim, Pepperl+Fuchs GmbH<br />
www.explosionsschutz-sprechstunde.de<br />
Programm<br />
Eigensicherheit<br />
SIL und Explosionsschutz<br />
Zündschutzarten und ausgewählte Beispiele<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
Technische Richtlinie Betriebssicherheit TRBS<br />
Referenten<br />
Jürgen George, Dr. Andreas Hildebrandt,<br />
Gerhard Jung, Patrick Lerévérend,<br />
Michael Wenglorz, Thomas Westers<br />
Pepperl+Fuchs GmbH<br />
Wolfgang Gohm<br />
Extronic Gohm Consulting<br />
Arnold Staedel<br />
TÜV SÜD Industrie Service GmbH<br />
Reinhard Wilkens<br />
Physikalisch-Technische-Bundesanstalt<br />
Christoph Thust<br />
Infracor GmbH<br />
Dr. Michael Wittler<br />
DEKRA Exam GmbH<br />
Moderation: Jürgen George,<br />
Pepperl+Fuchs GmbH<br />
Wann und Wo?<br />
Termin<br />
Donnerstag, 17.11.2011<br />
Veranstaltung (11:30 – 17:30 Uhr)<br />
„Get-Together“ mit Abendessen (ab 18:30 Uhr)<br />
Freitag, 18.11.2011<br />
Veranstaltung (9:00 – 15:00 Uhr)<br />
Ort<br />
Mannheim, Pepperl+Fuchs GmbH<br />
Zielgruppe<br />
Anwender und Hersteller aus der<br />
Prozessautomatisierung<br />
Teilnahmegebühr<br />
atp edition-Abonnenten 540 €<br />
Firmenempfehlung 590 €<br />
reguläre Teilnahmegebühr 690 €<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (Kaffee, 2x Mittagsimbiss,<br />
„Get-Together“ mit Abendessen).<br />
Veranstalter<br />
§ 12<br />
BetrSichV<br />
Fragen Sie!<br />
Die Explosionsschutz-Sprechstunde gibt Ihnen ausreichend<br />
Gelegenheit, Ihre individuellen Fragen zu stellen und offen<br />
mit den praxiserfahrenen Referenten zu diskutieren.<br />
Stellen Sie Ihre Fragen rechtzeitig unter<br />
www.explosionsschutz-sprechstunde.de.<br />
Weitere Informationen und Online-Anmeldung unter<br />
www.explosionsschutz-sprechstunde.de<br />
Fax-Anmeldung: 089 - 450 51-323 oder unter www.explosionsschutz-sprechstunde.de<br />
Ich habe die atp edition abonniert<br />
Ich habe die atp edition nicht abonniert<br />
Ich komme auf Empfehlung von Firma: .....................................................................................................................................................................<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Ihre freiwilligen Angaben werden zusammen mit den für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten von uns und der Unternehmensgruppe, unseren Dienstleistern sowie anderen<br />
ausgewählten Unternehmen verarbeitet und genutzt, um Sie über Produkte und Dienstleistungen zu informieren.<br />
Wenn Sie dies nicht mehr wünschen, schreiben Sie bitte an: Oldenbourg Industrieverlag, Rosenheimer Str. 145, D-81671 München
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Sanierung eines Mischwasserkanals<br />
DN 300 mit Burstform-Umformtechnik<br />
In Berlin Köpenick entlang des Müggelheimer Dammes wurden 850 m Mischwasserkanal DN 300 komplett grabenlos saniert.<br />
Dabei wurden Neurohre aus Polyethylen und Polypropylen im sogenannten TIP-Verfahren eng anliegend (Tight in Pipe) in den<br />
vorhandenen Kanal eingebracht.<br />
Das TIP-Verfahren zur grabenlosen Sanierung von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen durch den Einbau von Einzelrohren<br />
oder vorgefertigten Rohrsträngen hat sich mittlerweile<br />
deutschlandweit fest als gängiges Sanierungsverfahren etabliert.<br />
Das besondere bei diesem Verfahren liegt darin, dass<br />
spezielle, auf den Innendurchmesser der Altrohre angepasste,<br />
kreisrunde und statisch tragfähige Neurohre eng anliegend<br />
(Tight in Pipe) mit einer vorlaufenden Kalibrierhülse in die vor-<br />
handenen Abwasserleitungen und -kanäle eingebracht werden.<br />
Dadurch ist es möglich, Muffenversätze und Deformationen<br />
in den vorhandenen Rohren auszugleichen und im gleichen<br />
Arbeitsgang <strong>neue</strong>, kreisrunde Rohre einzubauen. In einschlägigen<br />
Regelwerken wie dem DWA-Merkblatt M 143-13<br />
und dem demnächst erscheinenden RSV Merkblatt 2.2 wird<br />
dieses Verfahren beschrieben.<br />
Neu ist hingegen eine Verfahrensvariante bei der es nun<br />
auch möglich ist, vorgeschweißte Rohrstränge aus PE 100 RC<br />
über Schächte mit 1 m Durchmesser einzubauen.<br />
Bauausführung<br />
Diese <strong>neue</strong> Verfahrensvariante des TIP-Verfahrens kam auch<br />
in Berlin zur Anwendung. Entlang des Müggelheimer Dammes<br />
war ein vorhandener Schmutzwasserkanal DN 300 auf einer<br />
Länge von ca. 850 m zu sanieren. Die Sanierung sollte komplett<br />
grabenlos über die vorhandenen Schächte erfolgen. Die<br />
Berliner Wasserbetriebe entschieden sich für den Einsatz des<br />
TIP-Verfahrens und schrieben dies entsprechend aus. Mit der<br />
Ausführung der Arbeiten wurde die Firma Frisch & Faust Tiefbau<br />
GmbH aus Berlin beauftragt, die über unfangreiche Erfahrungen<br />
bei der grabenlosen Kanalsanierung mit den unterschiedlichsten<br />
Verfahren verfügt.<br />
Damit der Einbau der Rohre bei dieser Baumaßnahme<br />
komplett grabenlos über die vorhandenen Schächte erfolgen<br />
konnte, wurde eine Kombination aus dem Einbau von Kurzrohren<br />
von Schacht zu Schacht und dem Einbau von verschweißten<br />
Rohrsträngen mit der <strong>neue</strong>n Burstform-Umformtechnik<br />
gewählt. In beiden Fällen kamen Neurohre der Firma<br />
Karl Schöngen KG aus Salzgitter und die Maschinentechnik<br />
der Firma Tracto-Technik aus Lennestadt zum Einsatz.<br />
Bild 1: Einzug des PE 100-RC-Rohrstrangs über die Umformeinheit<br />
und den Schacht in die Altrohrleitung<br />
Einsatz der Burstform-Umformtechnik<br />
Bei der Burstform-Umformtechnik werden vorgeschweißte<br />
Rohrstränge aus PE 100 RC über Revisionsschächte mit 1 m<br />
Durchmesser in die Altrohre eingezogen. Um dies realisieren<br />
zu können, wird der Rohrstrang vor dem Einzug in den<br />
Schacht mittels einer speziellen, über dem Schacht aufgebauten<br />
Umformeinrichtung ovalisiert und um 90° umgelenkt.<br />
Über eine weitere, im Schacht eingebaute Umformeinrichtung<br />
wird der ovalisierte Rohrstrang innerhalb des<br />
662 8-9 / 2011
Schachtes wieder um 90° in die horizontale Richtung umgelenkt<br />
und danach unmittelbar vor dem Einzug in das Altrohr<br />
kreisrund zurückverformt. Durch den Einzug des kreisrunden,<br />
statisch tragfähigen Rohrstranges mit einer vorlaufenden<br />
Rollenkalibrierung aus Metall können Muffenversätze<br />
und Deformationen ausgeglichen werden. Beim Einsatz dieser<br />
Burstform Umformtechnik können nur Neurohre aus PE<br />
100 RC mit Werkstoffeigenschaften nach PAS 1075 verwendet<br />
werden. Bei dieser Baumaßnahme wurde als Neurohr<br />
der Concept-RC-Liner aus PE 100 RC in der Abmessung d<br />
292 x 13,0 mm verwendet und in den vorhandenen Schmutzwasserkanal<br />
DN 300 eingezogen. Diese Rohre verfügen über<br />
eine inspektionsfreundliche, grüne Farbgebung und sind<br />
komplett aus PE 100 RC gefertigt.<br />
Die Kraft zum Einziehen des Rohrstanges wurde über eine<br />
Berstlafette, die ebenfalls in einem Schacht mit 1 m<br />
Durchmesser eingebaut werden kann, aufgebracht. Allerdings<br />
ist beim Einsatz der Burstform-Umformtechnik entweder<br />
eine Baugrube oder ein Zwischenschacht erforderlich,<br />
um die verwendete Rollenführungshülse zu bergen und den<br />
Rohrstrang weit genug in die Baugrube bzw. den Schacht zu<br />
ziehen, damit der Zugkopf von Rohrstrang getrennt werden<br />
kann. Aus diesem Grund wurde die Burstform-Umformtechnik<br />
bei den Haltungen eingesetzt, die über einen Zwischenschacht<br />
mit geradem Durchlauf verfügen. Bei den anderen<br />
Haltungen wurden Kurzrohre von Schacht zu Schacht eingebaut.<br />
Einsatz Kurzrohre von Schacht zu<br />
Schacht<br />
Hierbei werden einzelne Rohrmodule aus PP-HM diskontinuierlich<br />
über Revisionsschächte mit 1 m Durchmesser in die<br />
Altrohre eingezogen. Um dies zu ermöglichen müssen die<br />
Rohrmodule eine Gesamtlänge von deutlich unter 1 m haben.<br />
Die Rohrmodule werden hintereinander direkt im<br />
Schacht miteinander verbunden. Um ein Aufbeulen der Rohre<br />
beim Einbau weitestgehend zu vermeiden, wurden Rohre<br />
aus hochmodularem Polypropylen (PP-HM) verwendet und<br />
durch den Einsatz entsprechender Einbautechnik eine<br />
Krafttrennung der Kräfte zum Auskalibrieren der Altrohre<br />
und der Kräfte zum Verspannen der Neurohre durchgeführt.<br />
Wie bei den Langrohrsträngen, wurden wieder Neurohre der<br />
Abmessung d 293 x 13,0 mm in den vorhandenen Schmutzwasserkanal<br />
DN 300 eingebaut.<br />
Diese verwendeten Concept-HL-Vortriebsrohre verfügen<br />
über spezielle in der Rohrwandung integrierte Verbindungen<br />
mit zwei Lippendichtringen. Die Kraft zum Einbau<br />
der Rohre wurde wieder über die direkt im Schacht einbaubare<br />
Zuglafette aufgebracht. Bei dieser Verfahrensvariante<br />
ist jedoch kein/e Zwischenschacht oder Baugrube erforderlich.<br />
Bei beiden Verfahrensvarianten muss, zum Einbau der<br />
Maschinentechnik in den jeweiligen Schacht, das vorhandene<br />
Gerinne vollständig entfernt werden. Ebenfalls ist eine<br />
tatsächliche lichte Weite von mindestens 1 m im Verlauf der<br />
Rohrachse erforderlich. Verkürzen Einbauten wie beispiels-<br />
Bild 2: Einbau der Kurzrohre über einen Revisionsschacht<br />
Bild 3: Prinzipskizze des Tight in Pipe-Verfahrens<br />
weise vorgezogenen Klinkerspiegel an der Rohreinführung<br />
dieses Maß, so müssen diese Einbauten ebenfalls entfernt<br />
werden.<br />
Fazit<br />
Durch die Kombination verschiedener Verfahrensvariationen<br />
des TIP-Verfahrens konnte innerhalb einer sehr kurzen Bauzeit<br />
von drei Wochen in denen in Schichten 24 h am Tag gearbeitet<br />
wurde ein 850 m Schmutzwasserkanal saniert werden.<br />
Dabei wurden als Neurohre industriell gefertigte und<br />
qualitätsüberwachte Rohre aus PP-HM und PE 100 RC mit<br />
einer Lebensdauer von 100 Jahren eingebaut. Die ausführende<br />
Baufirma Frisch und Faust aus Berlin, die das TIP-Verfahren<br />
mit der Burstform Umformtechnik zum ersten Mal einsetzte<br />
und die Berliner Wasserbetriebe als Auftraggeber sind<br />
mit dem Einsatz dieses Sanierungsverfahrens zufrieden.<br />
Kontakt<br />
Karl Schöngen KG, Salzgitter-Engerode, Tel. +49 5341<br />
799225, schlenther@schoengen.de, www.schoengen.de<br />
8-9 / 2011 663
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Gut gewickelt unter dem Leuzetunnel<br />
Zwei hochbelastete Bundesstraßen, die sich einen Tunnel teilen, fast darüber ein vielbesuchtes Freizeitbad und unter dem<br />
Ganzen einer der Hauptstränge des Stuttgarter Abwasser-Kanalisationsnetzes: Diese extreme Ballung von Infrastruktur war<br />
die Ausgangslage für ein spektakuläres Kanalsanierungsprojekt in Stuttgart, das das Bauunternehmen KMG Pipe Technologies<br />
durchführte. Beim Sanierungsprojekt „Stuttgart-Schwanenplatz“ wurden drei begehbare Großprofile über eine Länge von<br />
insgesamt 260 m grabenlos mit dem SPR TM -Wickelrohrverfahren der SEKISUI SPR Gruppe renoviert. Einer der Bauabschnitte,<br />
ein Haubenprofil 1900/2320 mm, ist die bislang größte Nennweite, die in Deutschland mit disem Verfahren saniert wurde.<br />
Mehrstöckige Infrastruktur – und<br />
darunter das Abwasser<br />
Am Neckarufer in Höhe der König-Karls-Brücke konzentriert<br />
sich die Infrastruktur in einer fast beispiellosen Dichte. Die Brücke<br />
überquert den Neckar und verbindet 6-spurig Stuttgart<br />
mit dem Teilort Bad Cannstatt. Unter der Brücke verlaufen im<br />
sogenannten Leuzetunnel auf vier Fahrspuren die hochbelasteten<br />
Bundesstraßen B10 und B14, die sich wiederum im weiteren<br />
Tunnelwerk, dem Bergertunnel, tangential treffen. Im<br />
Uferstreifen zwischen B10 und König-Karls-Brücke liegt zu-<br />
dem das Leuzebad, ein vielbesuchtes Mineral- und Freizeitbad<br />
in Stuttgart. Tief unter den Verkehrsbauwerken und dem Mineralbad<br />
liegt schließlich der Problemfall, mit dem sich das von<br />
dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt<br />
Stuttgart beauftragte Ingenieurbüro auseinander zu setzen<br />
hatte: Der Hauptsammler links des Neckars besteht aus zwei<br />
parallel verlaufenden Kanälen und ist mit Abflussspitzen von bis<br />
zu 4,4 m³/s ein wichtiger Abwasserstrang der Stuttgarter Kanalisation.<br />
Seine ältesten gemauerten Bauabschnitte stammen<br />
schon aus dem Jahre 1898, die jüngsten wurden Anfang der<br />
Bild 1: Hauptzugang zum Sanierungsbereich: Ein Schachtbauwerk im Eingangsbereich des Leuzebades, hier mit den Spulen,<br />
die jeweils 1000 m des Wickel-Profilstreifens aufnehmen.<br />
Bild: KMG Pipe Technologies GmbH<br />
664 8-9 / 2011
1960er Jahre gebaut. Darunter ist auch das größte Profil des<br />
Sanierungsvorhabens, ein Haubenprofil H/B 2320/1900 mm.<br />
Ein Fall für GroSSprofil-Experten<br />
Bei den nach der baden-württembergischen Eigenkontrollverordnung<br />
vorgeschriebenen Routineuntersuchung war der<br />
Leuzesammler aufgrund diverser Schadensbilder zum prioritären<br />
Sanierungsfall geworden. Hauptproblem der Bauwerke<br />
des Leuzesammlers war nicht allein das teils schon sehr hohe<br />
Alter, sondern auch die Zusammensetzung des hier eingeleiteten<br />
Mischwassers. Durch die Lage innerhalb der Aufstiegszone<br />
der Mineralquellen ist dessen Kohlensäuregehalt erhöht.<br />
Für mineralische Bauwerke, insbesondere deren zementgebundene<br />
Komponenten, ist dies extrem schädlich. Das machte<br />
insbesondere dem größten Profil des Sammlers zu schaffen.<br />
Das Haubenprofil mit den Abmessungen 2320/1900 mm<br />
wurde 1961 in Ortbetonbauweise gebaut und hat unter dem<br />
ein halbes Jahrhundert andauernden Säureangriff schwer gelitten.<br />
Immerhin wurden den Kanälen im Sanierungsbereich<br />
im Gutachten, durchgeführt durch den TÜV Rheinland – LGA<br />
Nürnberg, eine ausreichende Standsicherheit des Altrohr-Boden-Systems<br />
zugeschrieben, allerdings unter der Voraussetzung,<br />
dass eine grundlegende Ertüchtigung der Bauwerksinnenwand<br />
in puncto Druckaufnahme erfolge. Damit war auch<br />
hier die Grundvoraussetzung für eine grabenlose Sanierung<br />
des vorhandenen Bauwerksbestands gegeben.<br />
Exotische Profile in 12 m Tiefe<br />
Erschwerend kam bei diesem Projekt hinzu, dass alle drei zu<br />
sanierende Bauabschnitte unterschiedliche Profile aufweisen.<br />
Neben dem Haubenprofil galt es, ein gedrücktes Kreisprofil<br />
1650/1850 mm und ein gemauertes Kreisprofil DN 1200 zu<br />
sanieren, in letzterem waren zudem deutliche Bögen als Einschränkung<br />
zu berücksichtigen. Die exakten Innenmaße und<br />
Geometrien wurden im Vorfeld der Sanierungsplanung per<br />
3D-Laserscan ermittelt. Die wohl restriktivste Vorgabe überhaupt<br />
war die äußerst problematische Zugänglichkeit sämtlicher<br />
Bauabschnitte, deren Scheitel bis zu 10 m unter der Bodenoberfläche<br />
liegen. Die Sanierungsarbeiten zweier Bereiche<br />
sind maßgeblich nur über ein 12 m tiefes Zugangsbauwerk<br />
erreichbar, das unmittelbar neben dem Eingangsbereich<br />
des Leuzebades liegt. Die Abmessungen ließen den Einsatz<br />
von GFK-Bauelementen nicht zu. Für ein Relining mit maßgefertigten<br />
Kurzrohren hätten nicht nur der Schacht, sondern<br />
auch angrenzende Teile des Bades abgebrochen werden müssen<br />
– eine absolut indiskutable Vorstellung.<br />
An dieser Stelle kam das SPR TM -Wickelrohrverfahren von<br />
SEKISUI SPR zum Einsatz. Die Technologie erfüllte ausschließlich<br />
alle Rahmenbedingungen eines Sanierungsprojektes in<br />
dieser Größenordnung:<br />
es musste über die vorhandenen Schachtbauwerke und<br />
ohne weitere Tiefbaumaßnahmen gearbeitet werden<br />
es musste eine der Geometrie und der Größenordnung<br />
der drei unterschiedlichen Bauabschnitte anpassbare<br />
Sanierungslösung eingesetzt werden<br />
Bild 2: Der eigens für dieses Profil gebaute Führungsrahmen<br />
formt aus dem stahlverstärkten Profilstreifen ein<br />
Haubenprofil mit den Maßen H/B 1983/1693 mm.<br />
Bild: KMG Pipe Technologies GmbH<br />
die problemlose Ausführung von Bögen war eine weitere<br />
wichtige Voraussetzung<br />
die Materiallogistik unter Tage musste über Strecken von<br />
bis zu 100 m reibungslos funktionieren<br />
es war eine Sanierungslösung gefragt, die auch ein Fluten<br />
des Sanierungsabschnittes im Hochwasserfall jederzeit<br />
zulässt<br />
die eingesetzte Sanierungstechnik musste die Vorgaben<br />
dauerhaft erfüllen und das auch unter der Randbedingung<br />
des eingeleiteten Mischwassers<br />
schließlich war eine schnell realisierbare Sanierungslösung<br />
gefragt.<br />
Beim Wickelrohr-Lining wird aus einem Kunststoff-Profilstreifen<br />
mit Nut-Feder-Verbindung im vorhandenen Kanal ein Rohr<br />
mit Untermaß gegenüber dem Altkanal gewickelt. Die Wickelrohrtechnologie<br />
kann über einen minimalen Zugang eingesetzt<br />
werden. Ein Standard-Kontrollschacht ist ausreichend,<br />
um Verfahrenstechnik und Material zuzuführen. Der Vorteil<br />
des SPR TM -Verfahrens ist, dass mit einem stahlverstärkten<br />
Kunststoff-Endlosprofil und patentierten Wickelrahmen, die<br />
sich auf Größe und Geometrie des jeweiligen Kanals hin anfertigen<br />
lassen, nicht nur Kreisprofile, sondern auch beliebige<br />
Sonderprofile gewickelt werden können; wie z.B. Ei-, Kasten-<br />
8-9 / 2011 665
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
oder eben auch Haubenprofile. In dem Haubenprofil in Stuttgart<br />
konnte somit die beauftragte KMG Pipe Technologies<br />
GmbH ein Wickelrohr passender Geometrie mit den Maßen<br />
H/B 1983/1693 mm und in diesem Fall Strecken von 100 m<br />
einbauen.<br />
GroSSprofilsanierung ohne<br />
Wasserhaltung<br />
Heikel ist bei der Sanierung derart zentraler Sammler natürlich<br />
vor allem die Abwasserhaltung während der Bauarbeiten.<br />
Nicht selten bei Projekten dieser Größenordnung ist die Abwasserhaltung<br />
letztlich teurer als die eigentliche Sanierungsmaßnahme.<br />
Abgesehen von purer technischer Undurchführbarkeit<br />
einer oberirdischen Bypass-Lösung am Schwanenplatz<br />
hätten die Kosten wohl auch hier jeden Rahmen gesprengt.<br />
„Das SPR TM -Verfahren bot jedoch die Lösung, denn<br />
bei dem Wickelprozess ist keine Wasserhaltung notwendig“,<br />
erläuterte Sener Polat, Niederlassungsleiter KMG Süd/West.<br />
„Im Hochwasserfall können die Arbeiten zu jedem Zeitpunkt<br />
unterbrochen werden, da die im Rohr verspannte Wickelmaschine<br />
einen durchgängigen Restquerschnitt gewährleistet.<br />
Dadurch konnte die Aufrechterhaltung der Vorflut ohne Ausbau<br />
der Maschine sichergestellt werden.“ Gleichwohl war natürlich<br />
ein reibungslos funktionierendes Hochwasser-Frühwarnsystem<br />
ein entscheidender Bestandteil des sehr umfangreichen<br />
Sicherheitskonzeptes, so dass die Mitarbeiter<br />
den Sanierungsbereich bei Starkregen rechtzeitig und sicher<br />
verlassen konnten.<br />
Liner als Schalung<br />
Beim SPR TM -Verfahren wird der Liner stets mit einem definierten<br />
Untermaß gegenüber dem Bauwerk eingebaut. Der entstandene<br />
Ringraum wird im weiteren Verlauf abschnittsweise<br />
mit einem Spezialmörtel verfüllt, dessen Fließfähigkeit und<br />
Härtungsverhalten speziell auf diesen Anwendungsfall optimiert<br />
wurden. Während der SPR TM -Liner also quasi „nur“ eine<br />
korrosionssichere Schalung darstellt, beruht die eigentliche<br />
statische Tragwirkung auf der in situ neu hergestellten Betonwand.<br />
Im großen Haubenprofil am Schwanenplatz beträgt deren<br />
Stärke zwischen 50 mm und 75 mm, im statisch relevanten<br />
Kämpferbereich. Ein System von Abstandselementen stellt<br />
vor der Verfüllung sicher, dass der Liner, nachdem ihn die Wickelmaschine<br />
in die richtige Geometrie gebracht hat, auch die<br />
berechneten Abstände zur Wand des Altrohrs hat.<br />
Dauerhafter Korrosionsschutz des<br />
Betonbauwerks<br />
Langfristig bietet das <strong>neue</strong> Betonbauwerk einen wichtigen<br />
betrieblichen Pluspunkt: Da das stahlverstärkte Kunststoffwickelrohr<br />
keine temporäre Einbauhilfe ist, sondern fester<br />
konstruktiver Bestandteil der Sanierungslösung bleibt,<br />
schützt es das Altrohr und den eingebrachten Ringraummörtel<br />
dauerhaft vor mechanischem Verschleiß und vor chemischen<br />
Angriffen aus der Abwasserzusammensetzung. Die<br />
Ringraumverfüllung wird abwasserseitig unangreifbar, die<br />
kohlensäurehaltigen Wässer können die Rohrsubstanz nun<br />
nicht weiter schädigen. Eine Konstellation, die für eine sehr<br />
lange Lebensdauer dieser Hauptschlagader des Stuttgarter<br />
Abwassernetzes spricht.<br />
Zudem wurde mit dem SPR TM -System im Resultat eben<br />
nicht nur eine nachhaltige, und wirtschaftliche, sondern auch<br />
eine vergleichsweise schnell realisierbare Sanierungstechnik<br />
für diese herausfordernde Baumaßnahme gefunden. Nachdem<br />
das Sanierungskonzept im Januar 2011 beschlossen<br />
wurde, stand nur acht Monate später, Ende August 2011,<br />
der erfolgreiche Abschluss eines höchst anspruchsvollen Kanalsanierungsprojektes<br />
auf dem Bauplan.<br />
Bild 3: Während der Profilstreifen von hinten nachgeführt<br />
wird, wandert der Führungsrahmen im Bauwerk dem<br />
anwachsenden SPR-Liner voran.<br />
Bild: KMG Pipe Technologies GmbH<br />
Kontakt<br />
KMG Pipe Technologies GmbH, Schieder-Schwalenberg,<br />
Tel. +49 5284/705-0, E-Mail: mail@kmg.de, www.kmg.de<br />
666 8-9 / 2011
Wissen für die praxis<br />
RSV-Regelwerk<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2006, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Rohren aus<br />
thermoplastischen Kunststoffen durch Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung mit dem TIP-Verfahren ohne Ringraum (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner<br />
(partielle Inliner)<br />
2009, 25 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbauwerken<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Schachtsanierung (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen / Anschlußleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 24 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlußleitungen – Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Er<strong>neue</strong>rung von Entwässerungskanälen und Anschlussleitungen mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Faxbestellschein an: 0201/82002-34<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Garantie: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen bei der Vulkan-Verlag GmbH, Postfach 10 39 62, 45039 Essen schriftlich widerrufen<br />
werden. Die rechtzeitige Absendung der Mitteilung genügt. Für die Auftragsabwicklung und die Pflege der Kommunikation werden Ihre<br />
persönlichen Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich per Post, Telefon, Telefax<br />
oder E-Mail über interessante Verlagsangebote informiert werde. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
<strong>Neue</strong> Abwasserleitungen für die<br />
Düsseldorfer Altstadt<br />
Rund zwei Jahre haben die umfangreichen Kanalsanierungsarbeiten in der Düsseldorfer Altstadt gedauert. Insgesamt 1,6 km<br />
Kanalisation wurden während der Bauzeit im Auftrag des Stadtentwässerungsbetrieb Landeshauptstadt Düsseldorf er<strong>neue</strong>rt.<br />
Während der überwiegende Teil der stark beschädigten Kanalrohre in der so genannten Stollenbauweise er<strong>neue</strong>rt wurden,<br />
erhielten rund 400 m der alten Abwasserleitungen eine <strong>neue</strong> Auskleidung in Form eines Schlauchliners. Den Auftrag für den<br />
Einbau des mit Epoxidharz getränkten Nadelfilzschlauchs erhielt die Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH&Co. KG, die mit<br />
der Sanierung von weiteren Haltungen in der Mittel- und Grabenstraße sowie auf der Königsallee den vorläufigen Schlusspunkt<br />
hinter die Tiefbauarbeiten setzen konnte.<br />
Große Teile der über 100 Jahre alten Kanalisation in der Düsseldorfer<br />
Altstadt waren nach Auskunft des Auftraggebers<br />
stark beschädigt und mussten saniert werden. Dabei wurde<br />
das Kanalsystem von der Hafenstraße über die Berger Stra-<br />
Bild 2: Einzug des<br />
Preliners<br />
Foto: DIRINGER&SCHEIDEL<br />
ROHRSANIERUNG<br />
Bild 1: Das Ergebnis<br />
einer Sanierung mit dem<br />
Schlauchliner ist ein<br />
Produkt, dessen Standard<br />
und Qualität allen<br />
Anforderungen in punkto<br />
Dichtheit, statischer Tragfähigkeit<br />
und hydraulischem<br />
Abflussverhalten<br />
gerecht wird<br />
Foto: DIRINGER&SCHEIDEL<br />
ROHRSANIERUNG<br />
ße, Flinger- und Hunsrückenstraße bis zur Mutter-Ey-Straße<br />
auf rund 1200 m grundlegend er<strong>neue</strong>rt, ebenso wie die Kanäle<br />
in der Bolkerstraße, der Rheinstraße, der Marktstraße<br />
sowie in der Mertensgasse. „Rund 680 m Eiprofilrohre in der<br />
Nennweite DN 800/1200 mm sowie 520 m Steinzeugrohre<br />
in den Nennweitenbereichen von DN 400 bis DN 500 wurden<br />
dabei überwiegend in Stollenbauweise eingebaut“, erklärt<br />
Bauleiter Andreas Schneider, Stadtentwässerungsbetrieb<br />
Landeshauptstadt Düsseldorf.<br />
Lediglich in der Hafenstraße wurde ein Teilstück des über<br />
100 Jahre alten Leitungsnetzes in offener Bauweise er<strong>neue</strong>rt.<br />
Darüber hinaus zählte die Erstellung von 34 <strong>neue</strong>n<br />
Schachtbauwerken zum Leistungsumfang der durchgeführten<br />
Tiefbauarbeiten, in deren Verlauf die Stadtwerke 240 m<br />
Wasserleitungen und 170 m Gasleitungen verlegt haben.<br />
Grabenlos mit Vorteilen<br />
Nach Aussage von Schneider hat sich der Auftraggeber für<br />
eine unterirdische Bauausführung entschieden, da auf diese<br />
Weise auf die Umverlegung sensibler Versorgungsleitungen<br />
weitestgehend verzichtet werden konnte. Ebenso wichtig<br />
war der Umstand, dass bei dieser Vorgehensweise Aufgrabungen<br />
weitestgehend entfallen konnten: eine wichtige<br />
Voraus setzung für die Arbeiten in verkehrstechnisch und touristisch<br />
stark frequentierten Bereichen wie der Düsseldorfer<br />
Altstadt.<br />
In den Leitungsabschnitten, die mit geringerem Aufwand<br />
ertüchtigt werden konnten, entschied sich der Auftraggeber<br />
für den Einsatz eines Schlauchliners von der Diringer &<br />
Scheidel Rohrsanierung. Bei dem Verfahren wird ein außenseitig<br />
PU-beschichteter Nadelfilzschlauch unmittelbar vor<br />
dem Einbau auf der Baustelle in einer eigens dafür konstruierten<br />
Mischanlage mit einem Epoxidharz getränkt, kontrolliert<br />
kalibriert, und dann mit Wasserdruck im Inversionsverfahren<br />
in die vorbereitete Haltung eingebracht. Hierbei wird<br />
der Schlauch mit Wasserdruck formschlüssig an die Rohrwandung<br />
angepasst und anschließend mit Warmwasser ausgehärtet.<br />
Das Ergebnis ist ein Produkt, dessen Standard und<br />
Qualität allen Anforderungen in punkto Dichtheit, statischer<br />
Tragfähigkeit und hydraulischem Abflussverhalten gerecht<br />
wird.<br />
668 8-9 / 2011
MaSSgeschneiderte Auskleidung<br />
Vor dem Einbau des Schlauchliners sind wichtige Vorarbeiten<br />
auszuführen. „Hierzu zählen unter anderem die Vorbereitung<br />
der Haltungen mit dem KA-TE-Roboter, einem hydraulischen<br />
Fräsroboter, der den Kanal von einragenden Scherben oder<br />
Ablagerungen und anderen Hindernissen befreit“, erklärt Jürgen<br />
Humpert, Diringer&Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co.<br />
KG, NL Herne.<br />
Im gleichen Arbeitsgang werden noch einmal Lage und<br />
Position der vorhandenen Abzweige bzw. Stutzen ermittelt,<br />
um sie nach Einzug und Aushärten des Liners problemlos mit<br />
dem Fräsroboter öffnen zu können. Nach dem Einbau eines<br />
Preliners kann dann der für die jeweilige Haltung maßgeschneiderte<br />
Nadelfilzschlauch in das beschädigte Rohr inversiert<br />
werden. Über den Inversionsturm wird der Schlauchliner<br />
in die Sanierungsstrecke eingebracht. Vorher wird der<br />
Schlauch in einer eigens konstruierten Dosier- und Mischanlage<br />
mit Epoxidharz getränkt und durch zwei Walzen kontrolliert<br />
kalibriert. Die mobile Tränkstation verfügt über je einen<br />
Harz- und einen Härtertank. „Sie sind klimatisiert, um die<br />
Harztemperaturen unabhängig von den Außentemperaturen<br />
auf einem definierten Stand zu halten“, so Humpert weiter.<br />
Die Überwachung erfolgt über integrierte Messgeräte. Regelbare<br />
Förderpumpen sorgen für den Transport der fest definierten<br />
Harz- und Härtermengen zum Zwangsmischer. Nun<br />
werden die Komponenten unter Luftausschluss zusammengeführt<br />
und in den Filzschlauch eingebracht.<br />
Der vorbereitete Inliner wird dann mit Wasserdruck im Inversionsverfahren<br />
in die zu sanierende Haltung eingebracht.<br />
„Der Druck der Wassersäule sorgt dafür, dass sich der Inliner<br />
aufweitet und formschlüssig an die Wandung des alten Kanals<br />
anpasst“, erläutert Humpert. Nach der vollständigen Auskleidung<br />
der Haltung wird das Wasser erwärmt, um den<br />
Schlauchliner auszuhärten.<br />
Qualität überzeugt<br />
Die Qualität des Produktes hat den Auftraggeber überzeugt,<br />
ebenso wie die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. „Um die<br />
Kosten insgesamt so gering wie möglich zu halten, hat der<br />
Stadtentwässerungsbetrieb im Vorfeld Sanierungsmaßnahmen<br />
in der Altstadt geprüft, bei denen der bestehende Kanal<br />
mittels eines erhärtenden Schlauches stabilisiert und abgedichtet<br />
wird, ohne dass die Straßenfläche aufgebrochen werden<br />
muss“, so Schneider.<br />
Bei der Auswahl des Produktes und der Auftragsvergabe<br />
hatten die Sanierungsprofis von D&S dann die Nase vorn –<br />
auch hinsichtlich Qualität und Qualifikation. „Aufgrund der bei<br />
der Sanierung eingesetzten Verfahrenstechnik ist es für den<br />
Sanierungserfolg von erheblicher Bedeutung, dass die Sanierungsunternehmen<br />
geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung<br />
durchführen und diese durch unabhängige Zertifizierungen<br />
gegenüber dem Auftraggeber nachweisen“, macht<br />
Andreas Schneider deutlich. Anforderungen, die sowohl das<br />
Unternehmen als auch das eingesetzte Verfahren erfüllen. Die<br />
Diringer & Scheidel Rohrsanierung ist nach DIN EN ISO<br />
9001:2008 zertifiziert und führt ein Gütezeichen der Beurteilungsgruppe<br />
S, das die fachgerechte Handhabung sowie<br />
die gütegesicherte Ausführung bescheinigt. Zudem liegt für<br />
das Produkt die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom<br />
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) vor – ein weiteres<br />
Plus an Sicherheit für Auftraggeber und Anwender.<br />
Bis 2015 sollen die Kanalsanierungsarbeiten vollständig<br />
abgeschlossen sein. Bis dahin erhalten noch rund 18.000 m 2<br />
Straßenflächen in der Altstadt einen <strong>neue</strong>n Belag.<br />
Kontakt<br />
DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG,<br />
Mannheim, Tel. +49 621 8607440,<br />
E-Mail: zentrale.rohrsan@dus.de, www.dus-rohr.de<br />
Bild 3: Mit der<br />
Sanierung von Haltungen<br />
in der Mittel- und<br />
Grabenstraße sowie auf<br />
der Königsallee hat D&S<br />
den vorläufigen Schlusspunkt<br />
hinter die Tiefbauarbeiten<br />
in der Düsseldorfer<br />
Altstadt gesetzt<br />
Foto: DIRINGER&SCHEIDEL<br />
ROHRSANIERUNG<br />
Einer für alles: Bers tlining, Sanflex , Z M-Auskleidung, Compact Pipe, Swagelining<br />
www.dus-rohrsanierung.de<br />
Wilhelm-Wundt-Straße 19 · 68199 Mannheim · Tel.: 0621 8607440 · Fax: 0621 8607449 · Email: zentrale.rohrsan@dus.de<br />
8-9 / 2011 669
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Schlauchliner-Sanierung am<br />
Heidelberger Schloss<br />
In Heidelberg wurde von der Firma Erles Umweltservice GmbH aus Meckesheim (EUS) eine der beiden Hauptentwässerungsleitungen<br />
des historischen Heidelberger Schlosses per Schlauchliner saniert. Speziell die hohen Gefällestrecken von bis zu 46 %<br />
stellten die Techniker der EUS vor eine sehr anspruchsvolle und vor allem kraftintensive Aufgabe.<br />
Hintergrund<br />
Das Heidelberger Schloss gehört zu einem der berühmtesten<br />
historischen Gebäude Deutschlands und ist das Wahrzeichen<br />
der Stadt Heidelberg. Das erstmals 1225 erwähnte Schloss<br />
und die dazu gehörige Schlossanlage ziehen jährlich über eine<br />
Million Besucher in ihren Bann. In herrlicher Lage über dem<br />
Schloss liegt das dazugehörige, ehemalige Schlosshotel, das<br />
im Rahmen einer Umnutzung von der Firma HOCHTIEF Solution<br />
AG aufwändig saniert und zu einer exklusiven Wohnanlage<br />
umgebaut wurde.<br />
Im Rahmen der behördlichen Auflagen wurde durch die<br />
EUS die 227 m lange Entwässerungsleitung DN 400 bis hinunter<br />
in die Altstadt von Heidelberg untersucht. Dabei wurden<br />
auf der gesamten Strecke Undichtigkeiten, Korrosionen,<br />
Riss- und Scherbenbildungen aufgrund statischer Überlastung<br />
festgestellt. Ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen<br />
waren die einzelnen Schachtbauwerke. Verbunden mit der<br />
exponierten Lage hoch über den Dächern von Heidelberg sind<br />
jedoch die Entwässerungssysteme alles andere als ein verzückender<br />
Augenschmaus sondern sehr aufwändig und kompliziert<br />
aufgebaut.<br />
Um den baubehördlichen und gesetzlichen Vorgaben zu<br />
entsprechen wurde gemeinsam mit der Vermögen und Bau<br />
Baden-Württemberg, dem Eigentümer des Heidelberger<br />
Schlosses, sowie der HOCHTIEF Solution AG und dem baubegleitenden<br />
Ingenieurbüro PGT aus Freiburg festgelegt, dass<br />
zur Gewährleistung einer weiteren dauerhaften Nutzung die<br />
komplette Entwässerungsleitung mittels Inliner-Auskleidung<br />
renoviert werden soll. Nicht mehr benötigte Schachtbauwerke<br />
sollten mit dem Inliner durchfahren und danach verschlossen<br />
bleiben. Die EUS setzte hier auf den GL01, ein Produkt<br />
aus dem Hause iMPREG. „Der GL01 ist durch seine nahtlosen,<br />
überlappenden und in Längsrichtung verlaufenden Glasfaserbahnen<br />
hervorragend für den Einzug in langen Strecken geeignet“,<br />
meint Jens Wohlrabe, Projektleiter der EUS.<br />
Vorgehensweise<br />
Bedingt durch die Lage und den schwierigen Zugang musste<br />
der GFK-Inliner in der Dimension 400 über die gesamte Strecke<br />
von 226 m an einem Stück eingebaut werden. Das größte<br />
Gefälle hier beträgt 46 %. Erschwerend kam hinzu, dass<br />
BILD 1: „Über den<br />
Dächern von Heidelberg“<br />
wurde der Inliner mit<br />
dem von Erles gebauten<br />
Spezial-LKW etwa<br />
30 Meter über die<br />
Balustrade in den<br />
Schacht abgelassen<br />
670 8-9 / 2011
die Leitung nicht gerade verlief und mit Abwinklungen von bis<br />
zu 20° ins Tal führte. Nach dem Aufbau der Wasserhaltung<br />
und abschließender Reinigung unter TV-Beobachtung wurde<br />
eine massivere als sonst zum Einsatz kommende Gleitfolie<br />
eingezogen. Diese musste, anders als üblich, in allen verfügbaren<br />
Zwischenschächten zusätzlich gesichert werden. Für<br />
den folgenden Liner-Einzug wurden in den Zwischenschächten<br />
mit den extremen Abwinklungen noch Umlenkrollen installiert,<br />
um die Einzugsfolie nicht zu beschädigen.<br />
Beim folgenden Einbau des Inliners wurde dieser unter Zuhilfenahme<br />
des Einbaufahrzeuges der EUS über die Balustrade<br />
der Schlossterrasse materialschonend in den Einzugsschacht<br />
eingelassen. Die Höhendifferenz von der Balustrade<br />
zum Einzugsschacht beträgt 25 m. Für solche Extremsituationen<br />
verfügt die EUS über ein hochmodernes, größtenteils<br />
selbst entwickeltes Equipment. Mit Hilfe dieses Einbaufahrzeuges<br />
mit hydraulisch angetriebenen profilierten Rollen<br />
konnte der Liner kontrolliert und ohne jedes Risiko jederzeit<br />
gezogen und bei Bedarf auch gestoppt werden.<br />
Nach dem Einziehen des Inliners musste dieser speziell in<br />
den Schächten fixiert werden, um ein Durchrutschen des<br />
Schlauches bei diesem extremen Gefälle zu verhindern. Hierbei<br />
mussten EUS-Projektleiter Wohlrabe und sein Team ebenfalls<br />
individuelle Lösungen suchen. Heraus kamen nach einigen<br />
Probeläufen eigens angefertigte Ankerbefestigungen.<br />
Dank dieser und weiterer innovativer Individuallösungen war<br />
eine solch anspruchsvolle Installation möglich.<br />
Im Anschluss an die Fixierung des Inliners wurden die Packerschleusen<br />
angebunden und die Leitung auf gesamter Länge<br />
mit Luftdruck beaufschlagt. Nach dem Einsetzen der Lichtquelle<br />
und der folgenden Abnahmefahrt zum Startpunkt der<br />
Aushärtung konnte das Team der EUS erstmals an diesem anstrengenden<br />
Tag durchatmen. Die Aushärtung erfolgt vollständig<br />
automatisiert unter Steuerung und Beobachtung eines<br />
Technikers und konnte planmäßig nach fünf Stunden beendet<br />
werden. Die Liner-Enden und die noch benötigten Zwischenschächte<br />
wurden im Anschluss an die Aushärtung aufgeschnitten<br />
und mit PCC-Mörtel eingebunden. Ein weiterer<br />
„Gewaltakt“ war die Sanierung der Schächte. Auch hier mussten<br />
alle benötigten Materialien fußläufig an der extremen<br />
Hanglage herbeigeschafft werden.<br />
Positives Fazit gezogen<br />
Nach Fertigstellung wurde der sanierte Kanal befahren und<br />
vom Auftraggeber abgenommen. In der abschließenden Betrachtung<br />
wurden noch einmal der reibungslose Ablauf sowie<br />
der Umgang mit dem Material und Extremsituationen hervorgehoben.<br />
Auch die ins Labor gegebenen Materialstücke<br />
bescheinigten am Ende Bestwerte des Materials.<br />
Nicht zuletzt dies gilt als Beweis dafür, dass sich eine langjährige<br />
Partnerschaft zwischen Anwender und Hersteller und<br />
dem aufgebauten Erfahrungsschatz für den Kunden und die<br />
Beteiligten am Ende auszahlt. „Dort wo andere meinen, die<br />
Lichthärtung sei an ihre Grenze gelangt, fangen wir mit innovativen<br />
Lösungen an“, stellt der Geschäftsführer Andreas Erles<br />
nach Beendigung der Maßnahme beim abschließendem<br />
Gespräch mit allen Beteiligten auf der Baustelle fest.<br />
BILD 2: Beengte Verhältnisse im Startschacht<br />
DN 700/700<br />
BILD 4: Inliner in einem der Zwischenschächte während<br />
des Aushärtevorgangs<br />
BILD 5: Fertig eingebauter Inliner mit den Rohreinbindungen<br />
aus PCC-Mörtel<br />
Kontakt<br />
Erles Umweltservice GmbH, Meckesheim, Andreas Erles,<br />
Tel. +49 6226 4296-85, E-Mail: Andreas.Erles@erles.de<br />
8-9 / 2011 671
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
AXEO Brumath realisiert bislang<br />
größtes Schlauchlining-Projekt in<br />
Frankreich<br />
Auf 4 km Länge wurden in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Lille Kanäle grabenlos saniert. Hierbei kamen UV-lichtaushärtende<br />
Schlauchliner DN 600 bis DN 1200 von RELINEEUROPE zum Einsatz. Ein Projekt, wie es bisher noch kein vergleichbares<br />
in Frankreich gab.<br />
Referenzprojekt mit hohem<br />
Aufmerksamkeitswert<br />
Anfangs noch skeptisch, ließ sich der kommunale Auftraggeber,<br />
die Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) von den<br />
Vorteilen der grabenlosen Kanalsanierung durch den Alphaliner<br />
von RELINEEUROPE überzeugen. Den Zuschlag für das in<br />
dieser Größe einmalige Projekt bekamen die Kanalsanierungsspezialisten<br />
von AXEO Brumath, Frankreich. Innerhalb weniger<br />
Monate, von März bis Juli 2011, musste das Projekt abgeschlossen<br />
werden.<br />
In Emmerin bei Lille in Nord-Frankreich war der Hauptsammlerkanal<br />
zum Klärwerk marode. Der in den 1970er Jahren<br />
erbaute Kanal wies massive Schäden auf. Zwar war die<br />
Statik des Altrohres erhalten, starke Korrosion, versetzte<br />
Muffen und Wurzeleinwüchse machten den Kanal aber undicht.<br />
Ein Teil der Rohre war bis zu 90 % zugewachsen. Eine<br />
Sanierung war deshalb unumgänglich. Bei einer Kanallänge<br />
von insgesamt 4 km und Rohrdurchmessern von bis zu<br />
DN 1200 ergab sich somit ein anspruchsvolles Sanierungsprojekt<br />
mit einem engen Zeitplan. Der Kanal verläuft am<br />
Bild 1: Vorbereitungen zum Einzug des Schlauchliners<br />
672 8-9 / 2011
Rande eines Naturschutzgebietes, das Mitte des Jahres<br />
2011 restrukturiert werden soll. „Das ist das bislang<br />
größte Projekt dieser Art in Frankreich. Allein schon<br />
aufgrund der Länge, der Durchmesser und der kurzen<br />
Ausführungsfrist betrachtet die gesamte französische<br />
Sanierungsbranche die Maßnahme als Referenzprojekt“,<br />
sagt Michel Moller, Bauleiter bei AXEO Brumath,<br />
dem von der Kommunalverwaltung der Stadt Lille beauftragtem<br />
Sanierungsunternehmen.<br />
Das GFK-Liner-System und die UV-Technologie waren<br />
bis dahin beim Auftraggeber unbekannt. Daher waren<br />
die Entscheider anfangs noch skeptisch. Überzeugen<br />
konnte das Alphaliner-Verfahren letztlich durch die<br />
Dokumentation der bisherigen Einbauergebnisse und<br />
bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte. Außerdem<br />
ist das Alphaliner-Verfahren seit kurzem durch die CSTB<br />
(Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen,<br />
Frankreich) auch in Frankreich zertifiziert.<br />
Bild 2: 1,4 km lange Wasserhaltung beim ersten Teilbereich der<br />
Sanierungsmaßnahme<br />
Enge Zeitfenster als Herausforderung<br />
Die Herausforderung für die Fachleute von AXEO<br />
Brumath lag nun darin, das Projekt inklusive Vor- und<br />
Nacharbeiten, der sich anschließenden Schachtsanierung<br />
und der Inbetriebnahme innerhalb des engen Zeitfensters<br />
abzuschließen. Bei den betroffenen Kanälen<br />
handelt es sich um zwei Hauptsammler. Der eine verläuft<br />
mit einer Länge von 1.255 m und einem Durchmesser<br />
von DN 1000 vom Pumpwerk am nahegelegenen<br />
Industriegebiet und dem Hafen Santes entlang des<br />
Naturschutzgebietes“ Le parc de la Deûle“ bis hin zum<br />
Klärwerk. Der zweite zu sanierende Sammler DN 1200<br />
verbindet mit einer Länge von 3.009 m den Ort Wattignies<br />
mit der Kläranlage. Außerdem wurde bereits auf<br />
einer Länge von 243 m ein Zulauf zu diesem Hauptsammler<br />
mit einem Querschnitt von DN 600 saniert.<br />
Begonnen wurde mit den Arbeiten im Teilbereich<br />
vom Pumpwerk zur Kläranlage. Hier musste zuerst eine<br />
Wasserhaltung auf 1,4 km Länge verlegt werden,<br />
durch die das Wasser vom Industriegebiet und dem Hafen<br />
während der Bauzeit zum Klärwerk hin fließt. Michele<br />
Moller erklärt: „Die Wasserhaltung in einem einzigen<br />
großen Stück zu verlegen, macht Sinn. So kann<br />
man auf dem gesamten Streckenabschnitt zügig arbeiten,<br />
ohne großen Zeitverlust, der zum Beispiel durch<br />
eine tägliche Kanalreinigung entstehen würde.“ Nun<br />
wurden hier in dem ersten Teilabschnitt ein Alphaliner<br />
DN 1000 mit einer Wandstärke von 7,2 mm auf einer<br />
Länge von 1.255 m installiert. Schon die Logistik hierbei<br />
war immens. Das Gesamtgewicht aller zu verlegenden<br />
Liner lag bei ca. 236,5 t. Relineeurope lieferte die<br />
Liner in für die jeweiligen Einbauabschnitte verlegefertigen<br />
Längen an. Die Alphaliner wurden dann mit Hilfe<br />
eines Förderbandes direkt vom LKW in den Kanal eingezogen.<br />
Vor Ort war auch David Veltz von Relineeurope,<br />
der schon bei der Baustellenvorbereitung eng mit<br />
Bild 3: Der Liner wurde vom LKW über ein Förderband direkt in den<br />
Kanal eingezogen<br />
Bild 4: Überwachung des Aushärteprozesses<br />
8-9 / 2011 673
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und<br />
Verfahren im Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der<br />
Abwasserentsorgung, der Nah- und Fernwärmeversorgung,<br />
des Anlagenbaus und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.3r-international.de<br />
AXEO Brumath zusammengearbeitet hatte: „Mit einer so<br />
großen Aufgabe in den französischen Markt einzusteigen,<br />
ist für uns natürlich eine Herausforderung. Aber alle haben<br />
an einem Strang gezogen, von den Produktionsmitarbeitern<br />
bis hin zur Geschäftsleitung. Der Erfolg ist der guten Zusammenarbeit<br />
der Stadt Lille, AXEO Brumath und Relineeurope<br />
zu verdanken.“<br />
Schnelle Aushärtung reduzierte die<br />
Einbauzeit<br />
Im Anschluss wurden die Arbeiten an dem ca. 3.000 m langen<br />
Sammler DN 1200 ausgeführt. Auch hier konnten die<br />
Sanierungsfahrzeuge nur über die eigens angelegte Baustraße<br />
an die Kanalhaltungen heranfahren. Durch eine geschickte<br />
Wahl der Einbauabschnitte und das parallele Arbeiten von<br />
zwei Kolonnen konnte das Team um Bauleiter Moller die Baustelle<br />
sogar schneller abwickeln als ursprünglich geplant. Pro<br />
Woche wurden bis zu fünf Liner installiert.<br />
Vor Ort wurden die Großprofil-Liner mit einer Seilwinde<br />
in das Kanalsystem eingezogen. Durch die Verwendung eines<br />
1,5 km langen Windenseils konnten die Rüstzeiten zwischen<br />
den einzelnen Einbauabschnitten zusätzlich minimiert<br />
werden. Nach dem Aufblasen der Liner erfolgte die UV-<br />
Lichthärtung mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 cm pro<br />
Minute. Dafür wurde eine Lichterkette mit neun UV-Strahlern<br />
à 1.000 Watt durch den aufgestellten Liner gezogen.<br />
Die Aushärtung war so auch bei längeren Abschnitten innerhalb<br />
weniger Stunden abgeschlossen. Durch die klare Strukturierung<br />
der Arbeiten und das an sich schon sehr schnelle<br />
Verfahren konnte die Sanierung von bis zu 150 m Kanal täglich<br />
im Rahmen eines normalen Arbeitstages realisiert werden.<br />
Den engen Zeitplan für das Gesamtprojekt in grabenloser<br />
Kanalsanierung einzuhalten, war somit kein Problem<br />
mehr.<br />
Neben der Zeitersparnis und dem Umweltschutz hat die<br />
grabenlose Kanalsanierung mit GFK-Schlauchlinern mit UV-<br />
Lichtaushärtung aber noch einen weiteren Vorteil, den auch<br />
Bauleiter Michel Moller sieht: „Nach 30 Jahren Erfahrung in<br />
der Kanalsanierung mit Warmwasser-Aushärtung konnte ich<br />
jetzt die beiden Systeme miteinander vergleichen. Neben der<br />
Umweltfreundlichkeit ist das UV-System auch für die Anwohner<br />
von Vorteil. Wo bei der Warmwasser-Härtung die<br />
Baustelle Tag und Nacht laufen muss, kann man hier die Arbeiten<br />
unterbrechen und sie am nächsten Tag wieder aufnehmen.“<br />
Kontakt<br />
AXEO Agence Réhabilitation Assainissement / Centre<br />
d’Exploitation Est, BRUMATH, Tel. +33 3 88 64 59 80,<br />
www.axeo-tp.fr;<br />
RELINEEUROPE Liner GmbH & Co. KG, Rohrbach,<br />
Tel. +49 6349-93934-0, E-Mail: info@relineeurope.com,<br />
www.relineeurope.com<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-international.de<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
674 8-9 / 2011
Dauerbeständige Schachteinbindung<br />
– Kaiserslauterns Schlauchliner<br />
sehen „rot“<br />
Eine klassische Schwachstelle von Schlauchlinersystemen ist die meist mit mineralischen Mörtelsystemen vorgenommene<br />
Schachteinbindung. In Kaiserslautern wird nun als grundsätzliche Alternative das Kunstharz-System Harz8 RE20 der<br />
resinnovation GmbH eingesetzt. Die Erfahrungen, die man bei der N. Dörr Abflussreinigung als Auftragnehmer der<br />
Stadtentwässerung Kaiserslautern mit dem System gemacht hat, sind überaus positiv.<br />
Wenngleich den aktuell marktgängigen Schlauchlinersystemen<br />
durchgängig eine hohe Qualität attestiert werden kann, bleiben<br />
in jedem Schlauchliner nach erfolgreicher Sanierung ein<br />
paar systembedingte, potentielle Schwachstellen. Diese ergeben<br />
sich aus den Nebengewerken, die zur Fertigstellung des<br />
Systems erforderlich sind. Dazu gehört neben dem Öffnen und<br />
Anbinden der Zuläufe vor allem die Einbindung des Liners in<br />
die Revisionsschächte. Das Ziel einer Anbindung ohne Hinter-<br />
läufigkeiten im Einbindungsbereich wird mit den herkömmlichen<br />
mineralisch basierten Werkstoffen vielfach unzureichend<br />
erreicht. Schon aufgrund der höchst unterschiedlichen Elastizität<br />
von Liner- und Mörtelsystemen klaffen im Einbindungsbereich<br />
allzu oft nach kurzer Zeit wieder Risse – schlimmstenfalls<br />
schon in dem Moment, wenn sich die einbaubedingten<br />
Spannungen im Liner abgebaut haben. Dabei spielt auch<br />
eine Rolle, dass eine kraftschlüssige Verbindung zwischen<br />
BILD 1: Die Anwendung von Harz 8 im Bereich der Schachteinbindung ermöglicht eine schnelle Wiederinbetriebnahme<br />
des Kanals und bietet aufgrund seiner Dauerelastizität eine langfristig haltbare Lösung<br />
8-9 / 2011 675
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Kunststoffen und mineralischen Mörteln nur eingeschränkt<br />
herstellbar ist: Eine Schwachstelle also im ursprünglichen Sinne<br />
des Wortes.<br />
BILD 2: Im Bereich der Schachteinbindung wird rund um den<br />
ausgehärteten Liner der Ringspalt aufgeweitet, um den Einbau des<br />
Harzes in der benötigten Stärke zu schaffen<br />
BILD 3: Manuell wird das Harz sorgfältig auch in die kleinsten<br />
Hohlräume eingearbeitet<br />
Pilotprojekt in Kaiserslautern<br />
Diese Schwachstelle ist auch den Verantwortlichen der Stadtentwässerung<br />
Kaiserslautern bekannt, die seit langem intensiv<br />
mit Schlauchlinersystemen arbeiten. Man steht deshalb alternativen<br />
Lösungen des Problems Schachteinbindung aufgeschlossen<br />
gegenüber und realisiert aktuell ein interessantes Pilotprojekt.<br />
Alle Schachteinbindungen an <strong>neue</strong> Schlauchliner<br />
werden mit dem Zweikomponenten-Kunstharzsystem „Harz8<br />
RE20“ der resinnovation GmbH hergestellt. Auf diese Weise<br />
stellt das Saarbrücker Sanierungsunternehmen N. Dörr GmbH<br />
in den Kaiserslauterner Schlauchlinern aber nicht nur die Verbindungen<br />
von Schacht und Schlauchliner in Kanälen aller<br />
Nennweiten und Profile her, sondern nach Bedarf – mit der<br />
Materialvariante Harz8RE40 – auch die Stutzen-Einbindung<br />
im Schlauchliner.<br />
Dörr-Projektleiter Harald Engel, der in Kaiserslautern die<br />
Projekte betreut, schwört inzwischen auf Harz8 RE20, obwohl<br />
Material und Einbau etwas kosten- und zeitaufwändiger<br />
sind als bei der klassischen Mörtelsanierung.<br />
Harz8 ist ein primär für die manuelle Verarbeitung konzipiertes<br />
zwei-komponentiges Harz auf Epoxid-Basis, das sich<br />
im Vergleich vor allem dadurch auszeichnet, dass es in kürzester<br />
Zeit riss- und schwundfrei aushärtet. Weitere wichtige Eigenschaften<br />
sind:<br />
Durch die Optimierung für eine händische Verarbeitung<br />
ergeben sich erhebliche Beschleunigungen von Arbeitsvorgängen<br />
Harz8 RE20 ist Hochdruck-spülfest<br />
Es bietet eine intensive Haftung an allen bekannten<br />
Linersystemen<br />
Sowohl Schachteinbindungen von Linern als auch sanierte<br />
Stutzen in begehbaren Nennweiten bieten eine exzellente<br />
Optik<br />
Nachhaltige Haftung und dauerhaft zuverlässige Dichtheit<br />
Harz 8 wird inzwischen in zwei anwendungsspezifischen Rezepturvarianten<br />
angeboten: Für die Schachtanbindung von<br />
Linern ist Harz 8 RE 20 das System der Wahl, das für den manuellen<br />
Einsatz optimiert wurde. Bei einer Topfzeit von 10<br />
Minuten ist es in abgebundenem Zustand etwa 30 Minuten<br />
lang verarbeitbar. Es bleibt zudem dauerhaft flexibel.<br />
Dem gegenüber deutlich „reaktionsträger“ ist die Variante<br />
für den Robotereinsatz, mit der Stutzen saniert werden:<br />
Harz8 RE40 bindet bei einer Topfzeit von 25 bis 30 Minuten<br />
binnen zwei Stunden (im Winter vier Stunden) ab und wird als<br />
Endprodukt fest.<br />
BILD 4: Schließlich glättet ein Mitarbeiter die fertige und zuvor<br />
angefeuchtete Einbindung<br />
Verarbeitungserfahrungen<br />
Die exzellenten Materialqualitäten von Harz8 RE20 kommen<br />
dann am besten zum Tragen, wenn sie sich mit maximaler<br />
Sorgfalt beim manuellen Einbau verbinden. Dabei gilt besonderes<br />
Augenmerk den vorbereitenden Arbeiten am Kanalbau-<br />
676 8-9 / 2011
werk. Was das bedeutet, war in Kaiserslautern „live“ zu beobachten.<br />
Die Einbindung des spannungsfrei ausgehärteten Liners beginnt<br />
damit, dass man um den zur Schachtwand hin abgefrästen<br />
Liner per Meißel einen künstlichen Ringspalt schafft oder<br />
den vorhandenen gezielt erweitert, um Raum für den Eintrag<br />
des Harzes zu schaffen. Die dauerelastische Einbindung/Abdichtung<br />
setzt eine gewisse Mindeststärke des Harzes voraus.<br />
Es wird mechanisch ein Raum ca. 3,5 cm Tiefe und 2 cm Breite<br />
eröffnet. Währendessen mischt ein Mitarbeiter „über Tage“<br />
das einsatzbereite Harz aus seinen beiden Komponenten an;<br />
dazu werden die beiden Komponenten exakt 4 Minuten lang<br />
in einem Kunststoffbeutel bei Luftausschluss durchgeknetet.<br />
Im Schacht wird mit einem Trennschleifer die Außenfolie<br />
restlos vom Liner entfernt, um den lückenlosen Kontakt zwischen<br />
den Werkstoffen zu gewährleisten. Nachdem alle losen<br />
Materialrückstände aus dem Liner und dem Schacht entfernt<br />
worden sind, trocknet man das Umfeld der Schachteinbindung<br />
so weit ab, dass es nur noch leicht feucht ist; Harz8<br />
RE20 ist zwar für den Dauereinsatz in feuchtem Milieu optimiert,<br />
erzielt jedoch selbstverständlich seine maximale Verbundwirkung<br />
bei Einbau auf nahezu trockenen Oberflächen.<br />
Im Hauptarbeitsgang wird das markant rote Harz über eine<br />
abgeschnittene Ecke des Beutels wie aus einer Spritztülle in den<br />
erweiterten Ringraum verpresst und dort sorgfältig per Hand<br />
eingearbeitet. Bei Auftrag wird sichergestellt, dass das Harz sowohl<br />
die Schachtwand als auch die Linerinnenfläche mehrere<br />
Zentimeter weit überlappt. Dies geschieht – je nach zu verarbeitendem<br />
Materialvolumen – in mehreren Durchgängen.<br />
Abschließend wird die Oberfläche befeuchtet und sorgfältig<br />
manuell geglättet. Die Reaktionszeiten des Harzes sind, beginnend<br />
mit dem Mischvorgang, so eingestellt, dass beim glätten<br />
der Abdichtung die Härtungsreaktion schon deutlich fortgeschritten,<br />
aber noch nicht abgeschlossen ist. Wenige Minuten<br />
nachdem der Mitarbeiter den Schacht und die endfertige<br />
Einbindung verlassen hat, kann der Schacht bereits wieder in<br />
Betrieb genommen werden, indem man die zuvor eingesetzte<br />
Dichtblase entlüftet und entfernt. Dennoch bleibt die Einbindung<br />
so elastisch, dass eventuelle Bewegungen des Liners ohne<br />
Funktionsbeeinträchtigungen aufgefangen werden können.<br />
Der gesamte Arbeitsgang ist zwar abhängig vom verarbeiteten<br />
Harzvolumen und damit von der Nennweite des Liners,<br />
dauert aber bei einem Liner der Dimension DN 300-500<br />
mit allen Arbeitsgängen näherungsweise eine Stunde.<br />
Kontakt<br />
resinnovation GmbH, Rülzheim, Dino Heuser, Tel. +49 7272<br />
702502, E-Mail: mail@resinnovation.de;<br />
Abflussreinigung N. Dörr GmbH, Saarbrücken, Harald Engel,<br />
Tel. +49 681 976550, E-Mail: info@kanaltechnik-duerr.de<br />
8-9 / 2011 677
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Sanierung eines Haubenkanals<br />
2525/2290 mm mit Spritzbeton<br />
Hintergrund<br />
Im Zuge der Kanalsanierung des Altstädter Abfangkanals in<br />
Dresden erhielt die ARGE Insituform Rohrsanierungstechniken<br />
GmbH/Heinrich Lauber GmbH den Auftrag zur Sanierung<br />
des Elbauslasskanals „Semperoper“. Dieser ca. 1880 erbaute<br />
Kanal aus gemauertem Sandstein diente ursprünglich zur Entwässerung<br />
des Stadtkerns rund um die Semperoper. Nach<br />
dem Bau des Altstädter Abfangkanals und der Inbetriebnahme<br />
der Kläranlage Kaditz im Jahre 1910 wurde über ihn das<br />
Abwasser zum Altstädter Abfangkanal geleitet. Der Auslass<br />
vom Abfangkanal in Richtung Elbe diente ab diesem Zeitpunkt<br />
nur noch der Entlastung des Kanalnetzes bei Starkregenereignissen.<br />
Auswahl des Sanierungsverfahrens<br />
Das Haubenprofil hat eine Länge von ca. 115 m und die Abmaße<br />
2525/2290 mm. Aufgrund dieser Größe kam nur die Ertüchtigung<br />
mittels Beschichtung oder GFK-Kurzrohr-Relining<br />
in Frage. Da es jedoch nicht realisierbar war eine Einziehgrube<br />
im Bereich des Europa-Elbradweges oder im Gelände der Semperoper<br />
zu errichten, schied das Relining-Verfahren aus.<br />
Das planende Ingenieurbüro ACI-Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft<br />
mbH favorisierte als bautechnische Lö-<br />
sung eine umlaufende Betonschale C25/30 der Stärke 15 cm<br />
mit doppelter Bewehrungslage.<br />
Um diese Stärke an Beton einzubauen, entschied sich die<br />
ARGE dafür die Sohle durch Ortbeton und die Haube durch<br />
Spritzbeton im Trockenspritzverfahren herzustellen. Beim<br />
Trockenspritzverfahren werden Zement und Zuschlagstoffe<br />
trocken zusammengemischt und auf die Baustelle geliefert.<br />
Der eingesetzte Druckluftstrom befördert die Mischung dann<br />
freischwimmend durch eine Rohr-/Schlauchleitung zu einer<br />
Mischdüse. Im Düsenbereich wird dem Trockengemisch Wasser<br />
zugeführt und anschließend in einem ununterbrochenen<br />
Strahl aufgetragen. Dabei nutzt man die Anprallenergie zur<br />
Verdichtung des Betons. Beim Spritzvorgang prallt ein Teil des<br />
Spritzguts, der so genannte „Rückprall“ ab, wodurch sich eine<br />
nicht unerhebliche Veränderung der Ausgangsmischung<br />
ergibt. Diese Veränderung muss für das Erreichen der vorgesehenen<br />
Betoneigenschaften bei der zu bestimmenden Betonzusammensetzung<br />
unbedingt Berücksichtigung finden.<br />
Ablauf und Besonderheiten der<br />
Sanierung<br />
Da der Auslasskanal während der Sanierung des Altstädter<br />
Abfangkanals als Abwasserumleitung zum Einsatz kam, war<br />
Bild 1: Vorbereitung der<br />
Beschichtung der Sohle mit<br />
Ortbeton<br />
678 8-9 / 2011
zunächst eine gründliche Reinigung und Oberflächenbehandlung<br />
notwendig. Dem nächsten Arbeitsschritt, der<br />
zweilagigen Bewehrung und Betonage der Bodenplatte,<br />
folgte - nach deren Aushärtung - die Bewehrung der Haube.<br />
Die Verbindung von Sohl- und Haubenbewehrung gewährleisten<br />
die „Anfängereisen“: L-förmig geformte Bewehrungsstäbe,<br />
die mit in die Botenplatte betoniert und<br />
an denen die Haubenbewehrung angeschlossen wurde.<br />
Für die Herstellung der Betonage mit der geforderten<br />
Schichtstärke von ca. 15 cm sind im Trockenspritzverfahren<br />
zwei Spritzgänge erforderlich: Zuerst bis zur ersten<br />
Bewehrungslage und danach bis über die zweite Bewehrungslage.<br />
Zur Minimierung der Rauigkeit und zur Verbesserung<br />
der Oberflächeneigenschaften wurde als Endschicht<br />
eine ca. 2 cm starke Schutzschicht aus SPCC-<br />
Mörtel im Nassspritzverfahren aufgetragen.<br />
Die große Herausforderung dieser Baustelle bestand<br />
in der unmittelbaren Nähe zur Elbe sowie die für das Trockenspritzen<br />
„kleine“ Dimension des Kanals und der damit<br />
verbundenen hohen Rückprallmenge. So musste der<br />
Rückprall täglich manuell aus dem Kanal gefördert werden.<br />
Dies war insofern beschwerlich, da nur am Endschacht<br />
eine Fördermöglichkeit über Schrägaufzug bestand.<br />
Die Abhängigkeit der Baumaßnahme vom Elbpegel war<br />
durch den Einbau eines Absenkschützes (Schieber), das<br />
im Vorfeld zur Abwasserumleitung eingebaut wurde, relativ<br />
gering. Es ermöglichte ein Arbeiten bis zu einem Elbpegel<br />
von 2,00 m. Leider trat im Sommer 2010 durch die<br />
enormen Starkniederschläge dreimal eine Überschreitung<br />
des Pegels ein, so dass der Auslasskanal geflutet werden<br />
musste. Im engen Zusammenhang zum Elbpegel steht<br />
auch der Grundwasserspiegel, der zu stellenweisen<br />
Grundwassereintritten führte. Die „nassen“ Stellen bedurften<br />
einer Vorbehandlung mit „Konsolidierungsmörtel“,<br />
bevor ein weiteres Auftragen des eigentlichen Trockenmörtels<br />
erfolgte. Dieser Prozess beschleunigte jedoch<br />
den Baufortschritt.<br />
Durch geeignete Maßnahmen, wie das Einhausen der<br />
Silotechnik, der Schachteinstiege und dem Zwangsbelüften<br />
des Kanals, wurde die enorme Staubentwicklung des<br />
Trockenspritzens weitestgehend minimiert.<br />
Nach Beendigung der Betonarbeiten im Kanal war abschließend<br />
der Schacht auf dem Europa-Elbradweg zu einem<br />
Einstiegs- und Kontrollschacht umzubauen sowie der<br />
Radweg wiederherzustellen.<br />
Damit konnte der letzte Abschnitt des Großprojektes<br />
„Sanierung des Altstädter Abfangkanals in Dresden“ dem<br />
Auftraggeber Stadtentwässerung Dresden GmbH übergeben<br />
werden.<br />
Bild 2: Beschichtung der Sohle mit Ortbeton<br />
Bild 3: Beschichtung durch Spritzbeton im Trockenspritzverfahren<br />
Kontakt<br />
Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH,<br />
E-Mail: info@insituform.de, www.insituform.de<br />
Bild 4: Teilweise beschichteter Kanal<br />
8-9 / 2011 679
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Staukanal und Pumpwerk aus GFK<br />
Staukanäle und groß dimensionierte Sonderbauwerke aus GFK-Wickelrohr haben sich in den letzten Jahren zu einem<br />
Aushängeschild in der Produktpalette des GFK-Rohrherstellers Amitech Germany, Mochau, entwickelt. Bei der Modernisierung<br />
des Abwasser-Pumpwerks Lehmweg in Frankfurt/Oder kam beides zusammen: Die Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Königs Wusterhausen GmbH & Co KG verlegte im Juni 2011 im Auftrage der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft<br />
(FWA) nicht nur einen gewaltigen Staukanal DN 2400 mit 180 Kubikmeter Fassungsvermögen, sondern auch einen<br />
konstruktiv hoch komplexen Pumpenschacht DN 3000.<br />
Hintergrund<br />
Der „Medienring“ in Frankfurt/Oder ist keineswegs eine Vereinigung<br />
brandenburgischer Zeitungsverleger, wie der Begriff<br />
intuitiv vermuten lässt, sondern die Hauptschlagader<br />
der Frankfurter Abwasserentsorgung. Dieser rund 13 km<br />
langen Druckleitung wird über 15 Pumpwerke das Schmutzwasser<br />
der einzelnen Ortsteile und Gewerbegebiete zugeführt.<br />
Über den Medienring gelangt das Abwasser schließlich<br />
in die am Oderufer gelegene Kläranlage.<br />
Ein sensibler Punkt bei der Bemessung dieser auf einer<br />
zentralen Druckleitung beruhenden Abwasserentsorgung<br />
sind naturgemäß die vorgeschalteten Pumpwerke und ihre<br />
Kapazität. Diese muss mit den hydraulischen Anforderungen<br />
auch bei Starkregenereignissen so korrespondieren, dass es<br />
nicht zum Überstau in den vorgelagerten Freigefällenetzen<br />
kommen kann. Da weder die Stadtentwicklung noch das Abwasseraufkommen<br />
eine statische Größe ist, sind hydraulische<br />
Berechnungen für diese Knotenpunkte nicht für die<br />
Ewigkeit gemacht und müssen bauliche Gegebenheiten notfalls<br />
angepasst werden.<br />
Ein idealtypisches Beispiel dafür war zuletzt das Pumpwerk<br />
Lehmweg im Ortsteil Markendorf-Siedlung, das nicht<br />
nur den Ortsteil mit über 400 Einwohnern entsorgt, sondern<br />
auch das Gewerbegebiet „Markendorf II“. Hier fand<br />
Bild 1: Blick durch einen Flügel des Staukanals auf den Pumpenschacht<br />
680 8-9 / 2011
2010 eine für Frankfurt höchst erfreuliche Industrieansiedlung<br />
statt: Der Solartechnikkonzern<br />
First Solar eröffnete hier sein zweites<br />
Werk vor Ort. Mehr Solarmodule – das bedeutet<br />
aber nicht nur mehr Arbeitsplätze und<br />
mehr Gewerbesteuer, sondern für die FWA<br />
vor allem: mehr Schmutzwasseraufkommen.<br />
Und das muss letztlich ebenfalls via Medienring<br />
in die Zentralkläranlage. Dazwischen lag<br />
aber das mit 70 Kubikmetern/Stunde Pumpleitung<br />
bemessene Pumpweg Lehmweg – zu<br />
schwach für die nun zu erwartenden Schmutzwasser-Spitzenlasten,<br />
vor allem, wenn bei<br />
Starkregen noch Oberflächenwasser in die<br />
Netze eindringt.<br />
MaSSgeschneiderte Lösung<br />
Die Lösung fand die FWA in Abstimmung mit<br />
dem Fürstenwalder Ingenieurbüro drus +<br />
wolff: Die von zwei Seiten ins bisherige Pumpwerk<br />
einmündenden, klein dimensionierten<br />
Abwasserkanäle wurden aufgenommen und<br />
auf rund 50 m Länge durch mächtige Staukanal-Röhren<br />
DN 2400 ersetzt. Diese können<br />
insgesamt 180 Kubikmeter Schmutzwasser<br />
speichern und dienen als Vorlage für eine <strong>neue</strong>,<br />
115 Kubikmeter stündlich fördernde und zentral<br />
im Staukanal positionierte Pumpenanlage.<br />
Sowohl der Staukanal als auch der zentrale<br />
Pumpenschacht von 3 m Durchmesser und<br />
knapp 5 m Tiefe wurden im GFK-Wickelrohrsystem<br />
FLOWTITE der Amitech Germany<br />
GmbH (Mochau) gefertigt. Bemerkenswert ist<br />
dabei nicht nur die bloße Dimension der Bauelemente,<br />
sondern auch die konstruktive<br />
Komplexität des Schachtbauwerks. Diese ist<br />
ein geradezu typisches Merkmal des FLOW-<br />
TITE-Systems, mit dem sich Sonderbauteile<br />
und hoch komplexe „Spools“ wie der Pumpenschacht<br />
für den Lehmweg exakt nach den Anforderungen<br />
der Ingenieure fertigen lassen.<br />
Beim Bau von Staukanal und Pumpenschacht<br />
spielte der Werkstoff GFK gewissermaßen<br />
noch ein weiteres „Ass“ aus: Das sehr<br />
geringe spezifische Gewicht ermöglicht, dass<br />
auch die größten Rohre und Schächte noch mit<br />
konventionellen Baugeräten bewegt und verlegt<br />
werden können, was die Bauvorgänge<br />
enorm beschleunigt. Die Verlegung von Staukanälen<br />
und Pumpenschacht am Pumpwerk<br />
Lehmweg durch die Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Königs Wusterhausen GmbH & Co KG<br />
dauerte nicht einmal zwei Arbeitswochen, sodass<br />
das Schmutzwasser von Markendorf bereits<br />
seit Juli 2011 über die <strong>neue</strong> Pumpanlage<br />
in den Medienring gefördert wird.<br />
Bild 2: Einbau des mächtigen GFK-Schachtbauwerks vor dem<br />
Pumpwerk Lehmweg<br />
Bild 3: 180 Kubikmeter Schmutzwasser fasst der <strong>neue</strong> Staukanal aus<br />
GFK-Wickelrohr, der dem Pumpwerk Lehmweg vorgeschaltet ist<br />
Kontakt<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau, Sophie Schubert,<br />
Tel +3431 71 82-0, E-Mail: presse@amitech-germany.de,<br />
www.amitech-germany.de<br />
8-9 / 2011 681
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Er<strong>neue</strong>rung der Schmutz- und<br />
Regenwasserkanäle entlang der<br />
Bundesstraße B 417<br />
Im Wasserhaushaltsgesetz wird die Notwendigkeit zur Überwachung von Zustand und Funktionsfähigkeit der Abwasserkanäle<br />
und Leitungen festgelegt, um Abwasser anforderungsgerecht zu beseitigen. Dies bildet die Grundlage der Instandhaltungspläne<br />
für Abwasserkanäle und -leitungen mit konkreten Inspektions- und Wartungsintervallen. Eine Kanalinspektion bringt schnell ans<br />
Licht, inwieweit die Kanäle noch funktionstüchtig sind oder entsprechend dem Alter, der Bauausführung und den örtlichen<br />
Belastungen Schäden aufweisen.<br />
Je nach Schadensklasse sind die Kanäle dann kurzfristig oder erst mittel- bis langfristig zu sanieren. Damit beginnt die Qual der<br />
Wahl: Ist eine konventionelle Er<strong>neue</strong>rung der Kanäle im offenen Graben sinnvoll oder ist eine grabenlose Er<strong>neue</strong>rung unter den<br />
gegebenen örtlichen Bedingungen wirtschaftlicher? Und welches grabenlose Sanierungsverfahren ist im konkreten Fall das<br />
geeignetste?<br />
Generelle Anforderungen an kostensparenden,<br />
grabenlosen Leitungsbau<br />
Werden bei konventionellen Baumaßnahmen die Gesamtkosten<br />
betrachtet, so wird schnell deutlich, dass davon das eingesetzte<br />
Material, sprich die Kanalrohrleitung, nur 10 bis 20 %<br />
ausmacht. Der Großteil wird durch arbeits- und lohnintensive<br />
Posten, wie das Herstellen der Rohrgräben, die Entfernung<br />
der Altleitung, das Verlegen der <strong>neue</strong>n Leitung, das Beistellen<br />
und Verdichten des Bettungsmaterials und die Wiederherstellung<br />
der Oberflächen verursacht. Nicht bezifferbar sind die<br />
sozialen Kosten wie Lärm- und Geruchsbelästigungen infolge<br />
von Verkehrsstaus, Einschränkungen der Zugänglichkeit,<br />
beispielsweise von Geschäften, Wohnhäusern oder sozialen<br />
Einrichtungen sowie die Genehmigungen der Grundstückseigentümer<br />
zum geplanten Trassenverlauf.<br />
Bild 1: Geringer Eingriff<br />
und Behinderung bei einer<br />
Leitungser<strong>neue</strong>rungsmaßnahme<br />
an der B 417 im<br />
rheinland-pfälzischen Diez<br />
dank grabenlosem Er<strong>neue</strong>rungsverfahren<br />
Gerade diese Nebenwirkungen führen oftmals zur Entscheidung<br />
für grabenlose Er<strong>neue</strong>rungsmaßnahmen. Denn<br />
Lärm- und Geruchsbelästigungen werden auf ein Minimum<br />
beschränkt und auch die Zugänglichkeit zu den Anliegern ist<br />
weiterhin gegeben. Ist eine Leitung bereits vorhanden, kann<br />
die Leitungstrasse für die <strong>neue</strong> Rohrleitung genutzt werden.<br />
Zusätzlich bleiben der gestandene Boden und die möglicherweise<br />
vorhandenen Baumbestände unangetastet – ein deutliches<br />
Plus in Sachen Umweltschutz. All diese Vorteile macht<br />
auch das Beispiel der Er<strong>neue</strong>rung der Schmutz- und Regenwasserkanäle<br />
in der Limburger Straße im rheinland-pfälzischen<br />
Diez deutlich.<br />
Umsetzung in der Praxis –<br />
BaumaSSnahme in Diez<br />
Die von der Verbandsgemeinde-Werke Diez beauftragte Inspektion<br />
der auf beiden Seiten unter der Bundesstraße B 417<br />
gelegenen, rund 60 Jahre alten Kanalleitungen aus Betonfalzrohren<br />
zeigten, dass ihre Standsicherheit und Dichtheit nicht<br />
mehr gewährleistet war. Ohne Er<strong>neue</strong>rungsmaßnahmen wäre<br />
über kurz oder lang die Verkehrssicherheit nachteilig beeinträchtigt<br />
worden. Die Schmutzwasserkanäle wiesen mehrere<br />
Höhenversätze auf und die Kanalsohle war weitestgehend<br />
ausgewaschen. Die 1980 verlegten Regenwasserkanäle<br />
waren zwar noch in deutlich besserem Zustand, wiesen aber<br />
ebenfalls schon geringe Schäden auf.<br />
Verschärfend wirkte sich aus, dass die in etwa 2,5 bis<br />
3,5 m liegenden Kanäle mit Strom-, Telekommunikations- und<br />
Medienleitungen überbaut waren und eine Verkehrsunterbrechung<br />
nicht in Frage kam. Die Verbandsgemeinde-Werke entschied<br />
sich deshalb für den Einsatz von grabenlosen Er<strong>neue</strong>rungsverfahren<br />
unter Nutzung der alten Betonleitung in neuralgischen<br />
Leitungsabschnitten, ohne dabei den Verkehr auf<br />
der B 417 unterbrechen zu müssen. In den verbleibenden Leitungsabschnitten<br />
wurde in konventioneller offener Bauweise<br />
verlegt, bei der dann auch die Schächte neu gesetzt wurden.<br />
682 8-9 / 2011
Bild 2: Schraubverbindung<br />
des AWADUKT PP TL<br />
ermöglicht glatte Rohrverbindungen<br />
Planung<br />
Mit der Planung und Koordination der Bauausführung beauftragte<br />
die Verbandsgemeinde die Ingenieurgesellschaft<br />
Christmann mbH in Diez. Für die grabenlose Er<strong>neue</strong>rung<br />
mussten zunächst die Inspektionsunterlagen zur Bewertung<br />
der Schadenshöhe gesichtet und eine Vorauswahl geeigneter<br />
Er<strong>neue</strong>rungsverfahren getroffen werden. Einen wesentlichen<br />
Einfluss darauf hatten vor allem die verbleibende Standsicherheit<br />
und die hydraulischen Anforderungen. Auf Empfehlung<br />
des Ingenieurbüros entschied sich die Verbandsgemeinde<br />
schließlich für die grabenlose Er<strong>neue</strong>rung der Schmutzwasserkanäle<br />
im Reliningverfahren. Die Bauausführung übernahm<br />
die Koch GmbH & Co.KG aus Westerburg.<br />
Bauausführung und besondere<br />
<strong>Herausforderungen</strong><br />
Bei der Verlegung des Kanalrohrsystems aus dem Material Polypropylen<br />
überzeugte vor allem die Robustheit und Baustellentauglichkeit<br />
der Rohre bei gleichzeitig geringem Gewicht.<br />
Sowohl bei der Lagerung auf der Baustelle, beim Transport oder<br />
Handling in der Baugrube, bei der Verbindung oder beim Einschieben<br />
bzw. Einziehen der Rohre in brüchige Kanäle bewies<br />
das eingesetzte Kanalrohrsystem AWADUKT PP TL seine hohen<br />
Reserven hinsichtlich seiner mechanischen Festigkeiten,<br />
Flexibilität und Kratzfestigkeit. Werden die Rohre beispielsweise<br />
auf steinigen Böden gelagert oder in Betonrohre mit rauen<br />
Innenflächen eingezogen, sind die Kratzer auf der Rohraußenseite<br />
nur äußerst gering. Beim Transport der Rohre auf der Baustelle<br />
oder beim Ablassen in die Baugrube sind dank des geringen<br />
Gewichts keine besonderen Hilfsmittel erforderlich. Außerdem<br />
führen aufgrund der Materialflexibilität selbst ein Verkanten<br />
der Rohrenden bei der Verbindung und entsprechendes Gegendrücken<br />
nicht zwangsläufig zum Bruch der Rohrenden.<br />
AWADUKT PP TL zeichnet sich darüber hinaus durch eine<br />
hohe Steifigkeit von mindestens 20 kN/m 2 (SN 20) aus. Nachträgliche<br />
Bodensetzungen durch Bauarbeiten in Leitungsnähe,<br />
Lageabweichungen oder erhöhte Verkehrslasten im Leitungsbereich<br />
sind daher kein Thema mehr.<br />
Neben der Steifigkeit sind die enorme Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit<br />
gegen Schlagbeanspruchungen zu nennen, die<br />
eine Verlegung der Rohre selbst in der kalten Jahreszeit ermöglichen.<br />
Bei der erhöhten Materialfestigkeit sorgt die enorme<br />
Flexibilität der Rohrverbindung für eine einwandfreie Montage<br />
und Verlegung der Rohre in vorhandene Leitungen. Nicht zuletzt<br />
deshalb fiel die Wahl auf AWADUKT PP TL. Denn der Baubeginn<br />
sollte noch im Winter 2010 erfolgen und dies bei Außentemperaturen<br />
von unter 0 °C. So konnte die erste Etappe,<br />
die grabenlose Er<strong>neue</strong>rung der Kanäle auf einer Länge von rund<br />
60 m, im November 2010 und die zweite Etappe, die Er<strong>neue</strong>rung<br />
auf weiteren 145 m, im April 2011 fertiggestellt werden.<br />
Ein weiterer Vorteil des Kanalrohrsystems sind die außen<br />
und innen glatten Rohrverbindungen, die auch bei rauen oder<br />
gebrochenen Rohrwänden des Altkanals ein kontinuierliches<br />
Einschieben oder Einziehen in die Kanalleitung ermöglichen, ohne<br />
Gefahr zu laufen im Altrohr hängen zu bleiben. Bei der Baumaßnahme<br />
in Dietz verlief der Kanal in einem leichten Bogen,<br />
so dass auftragende Muffenverbindungen mit Sicherheit an den<br />
Bild 3: Einzug des<br />
<strong>neue</strong>n Leitungsstranges<br />
in die Altrohrleitung aus<br />
Betonfalzrohren<br />
Rohrstößen hängen geblieben wären und ein Aufgraben der Leitung<br />
erfordert hätten. Mit dem eingesetzten Rohrsystem konnte<br />
dies vermieden und gleichzeitig durch die minimierte Reibung<br />
der Rohre an der Innenwandung des Kanals eine schnellere Verlegung<br />
erzielt werden.So konnten die 1 m langen Rohre DN 200<br />
mit zwei Mann in der Startgrube in wenigen Minuten verschraubt<br />
und bis zu 80 m ohne weitere Hilfsmittel in den Kanal<br />
geschoben werden. Insgesamt nahm die Rohrverlegung nur etwa<br />
1,5 Stunden in Anspruch.<br />
Auch die Gefahr partieller Rohrbeschädigungen wurde auf<br />
ein Minimum reduziert. Sowohl der im Zielschacht eintreffende<br />
Rohrkopf als auch die ersten Rohrlängen wiesen keine<br />
signifikanten Kerben oder Kratzer auf.<br />
Besonders vorteilhaft sind die durch akkreditierte Institute<br />
bestätigten Zug- und Schubfestigkeiten der Schraubverbindungen.<br />
Sie ermöglichen ein Einschieben der Rohre in<br />
den Kanal mit mehr als sieben Tonnen und falls erforderlich<br />
auch die Unterstützung durch gleichzeitiges Einziehen der<br />
Rohre mit mehr als vier Tonnen. Damit ist das Kanalrohrsystem<br />
nicht nur für das Relining, sondern auch für Vortriebsund<br />
Berstverfahren geeignet. Die Dichtheit der Rohrverbindungen<br />
wird durch eine Doppeldichtung gesichert: Während<br />
eine Lippendichtung als Primärdichtung die Abdichtung unter<br />
Standard-Einbaubedingungen übernimmt, sorgt eine Sekun-<br />
8-9 / 2011 683
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
festen, dichten Sitz auf dem AWADUKT PP TL, so dass in maximal<br />
einer Stunde alle Anschlussleitungen gelegt waren.<br />
Über 200 m AWADUKT PP TL DN 200 sowie neun PP-<br />
Schächte DN 1000 sorgen nun für eine wirtschaftliche und<br />
sichere Kanalisation in der Limburger Straße.<br />
Bild 4: Der im Zielschacht eintreffende Rohrkopf und die<br />
ersten Rohrlängen wiesen keine signifikanten Kerben oder<br />
Kratzer auf<br />
Fazit<br />
Rolf Christmann vom Ingenieurbüro Christmann zog nach Abschluss<br />
der Verlegung ein überaus positives Resümee. „Der<br />
Einsatz von AWADUKT PP TL in Verbindung mit AWADOCK<br />
POLYMER CONNECT bei Abzweigen erwies sich bei der grabenlosen<br />
Er<strong>neue</strong>rung der Kanalleitung deutlich wirtschaftlicher<br />
als die Sanierung der Kanalleitung mit einem Inliner. Auch<br />
die Ausführung hat reibungslos geklappt. Die robuste, längskraftschlüssige<br />
Verbindung konnte einfach und schnell montiert<br />
werden, so dass die <strong>neue</strong> Leitung in nur wenigen Stunden<br />
grabenlos verlegt war.“<br />
därdichtung Q-TEC-C für zusätzliche Sicherheit bei Extrembedingungen,<br />
wie zum Beispiel bei größeren Abwinklungen.<br />
Bei den insgesamt sechs Anschlüssen kam AWADOCK PO-<br />
LYMER CONNECT als sichere und geprüfte Anbindung von Seitenzuläufen<br />
in offener Bauweise zum Einsatz. Die Montage<br />
dauerte je nur maximal fünf Minuten, vom Anbohren bis zum<br />
Kontakt<br />
Dipl.-Ing. (TH) Frank Krause, Entwicklung<br />
Umwelt-/Abwassertechnik, REHAU AG + Co,<br />
Tel. +49 9131 92-5297,<br />
E-Mail: frank.krause@rehau.com<br />
684 8-9 / 2011
Praxis-tipps<br />
Services<br />
Mobiles Fernsehen live am iPad 2<br />
Fernsehen auf dem iPad 2: keine<br />
Internetverbindung nötig, dafür<br />
mit vielen Extras ausgestattet<br />
Der EyeTV Mobile von Elgato wurde speziell für das iPad 2<br />
entwickelt. Er kann ganz einfach direkt am iPad angeschlossen<br />
und mit der dazugehörigen App geöffnet werden.<br />
EyeTV Mobile empfängt das Fernsehsignal über die kleine<br />
Teleskopantenne. So macht er das Fernsehschauen ohne<br />
Internetverbinung möglich. Selbstverständlich bleiben die<br />
auf dem Gerät gespeichterten Daten unangetastet. Der<br />
EyeTV Mobile verfügt über einen eigenen Akku, kann aber<br />
auch auf den Akku des iPads zurückgreifen.<br />
Ein besonderer Pluspunkt: Die laufende Sendung kann<br />
ganz einfach angehalten oder gespult werden; zeitversetztes<br />
Fernsehen wird möglich. Die integrierte Recordingfunktion<br />
macht es möglich Sendungen direkt auf dem iPad<br />
aufzunehmen. Außerdem zeigt das dazugehörende App die<br />
momentan laufende Sendung sowie die Folgesendung an,<br />
alle über den DVB-T-Stream mitgesendeten Programminformationen<br />
werden bequem angezeigt. 99,95 Euro soll<br />
das mobile Fernsehen kosten und direkt über das Onlineportal<br />
des Händers bestellbar sein.<br />
Kontakt:<br />
www.elgato.com<br />
Newsletter-Software optimiert<br />
Kundenbindung<br />
Das NLX Mail Newsletter-System von ATeO-Service wurde speziell<br />
für den Einsatz von HTML-Newslettern entwickelt. Es ist sowohl<br />
für eine geringe Anzahl an Empfängern als auch für eine größere<br />
Anzahl Newsletter-Abonnenten (bis ca. 2 Mio. E-Mails) geeignet.<br />
Je nach Anzahl der Empfänger können Newsletter manuell<br />
über einen Browser oder zeitgesteuert per „Cron-Job“<br />
von einem Server versendet werden. Um den optimalen<br />
Versand zu garantieren, können Versandoptionen für einzelne<br />
Provider festgelegt werden. Die versendeten E-Mails<br />
sollen auch bei den empfangenden Providern als Newsletter<br />
verstanden werden. Unangenehme Überlastungen<br />
bei der Übergabe größerer Aussendungen werden somit<br />
umgangen, was außerdem die ungewollte und unnötige<br />
Einstufung als SPAM verhindert. Die Zielgruppensegmentierung<br />
bei der Anmeldung hilft, Teilnehmer verschiedenen<br />
Themen zuzuordnen. Die Newsletter für ein bestimmtes<br />
Thema werden dann zielgruppengerecht versendet. Mit<br />
dem Kampagnenmanager kann eine Serie von Mails erstellt<br />
werden, die dann automatisch und zeitgesteuert als Newsletter<br />
versendet wird.<br />
Kontakt:<br />
www.ateo.de<br />
Diese NLX Mail Newsletter-Software<br />
vereinfacht die Kommunikation mit dem<br />
Kunden u.a. durch zeitgesteuerte E-Mails<br />
8-9 / 2011 685
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – brbv<br />
Spartenübergreifend<br />
Grundlagenschulungen<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt W<br />
324 – Grundkurs<br />
17./18.11.2011 Gera<br />
08./09.12.2011 Gera<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt W<br />
324 – Nachschulung<br />
02.12.2011 Gera<br />
Baustellenabsicherung und Verkehrssicherung<br />
RSA/ZTV-SA – 1 Tag<br />
08.11.2011 Ettersburg<br />
13.12.2011 Frankfurt/Main<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Spartenübergreifende Hausanschlusstechnik<br />
17.11.2011 Kassel<br />
Arbeitsvorbereitung und Kostenkontrolle<br />
im Rohrleitungsbau – Arbeitskalkulation<br />
16.11.2011 Hannover<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren<br />
– Fortbildungsveranstaltung nach GW 329<br />
07.12.2011 Kassel<br />
Arbeitssicherheit im Tief- und Rohrleitungsbau<br />
23.11.2011 Magdeburg<br />
15.12.2011 Kerpen<br />
Baurecht 2011<br />
16.11.2011 Magdeburg<br />
Kalkulationsgrundlagen<br />
06.12.2011 Berlin<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und Sanierung<br />
29.11.2011 Bad Vilbel<br />
Gas/Wasser<br />
Grundlagenschulungen<br />
GW 128 Grundkurs „Vermessung“<br />
9 Termine ab 07.11.2011 bundesweit<br />
GW 128 Nachschulung „Vermessung“<br />
11 Termine ab 02.11.2011 bundesweit<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
21.-25.11.2011 Würzburg<br />
21.-25.11.2011 Leipzig<br />
28.11.-02.12.2011 Hannover<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
23 Termine ab 07.11.2011 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerung<br />
64 Termine ab 01.11.2011 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Grundkurs<br />
21 Termine ab 02.11.2011 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Nachschulung<br />
23 Termine ab 04.11.2011 bundesweit<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
17.-19.10.2011 Gera<br />
07.-09.11.2011 Rostock<br />
14.-16.11.2011 Gera<br />
Kunststoffrohrleger<br />
4 Termine ab 07.11.2011 bundesweit<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500<br />
Kap. 2.31<br />
24.11.2011 Magdeburg<br />
08.12.2011 Gütersloh<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und Wasserversorgung<br />
– Verlängerung zur GW 331<br />
17.11.2011 Kassel<br />
06.12.2011 Berlin<br />
Bau von Gas- und Wasserrohrleitungen<br />
22./23.11.2011 Potsdam<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
14./15.12.2011 Bad Vilbel<br />
Sachkundiger Gas bis 4 bar<br />
30.11.2011 Erfurt<br />
Sachkundiger Wasser – Wasserverteilung<br />
01.12.2011 Erfurt<br />
Fernwasserleitungen – Bau, Betrieb und<br />
Dienstleistungen<br />
13.12.2011 Karlsruhe<br />
Fachaufsicht für die Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 316-2<br />
30.11./01.12.2011 Koblenz<br />
Instandsetzung von Trinkwasserbehältern<br />
– Verlängerung zur W 316-2<br />
01.12.2011 Koblenz<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 – Qualitätsanforderungen<br />
für Rohrleitungsbauunternehmen<br />
03.11.2011 Augsburg<br />
Praxisseminare<br />
Druckprüfung von Gasrohrleitungen<br />
22.11.2011 Nürnberg<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
23.11.2011 Nürnberg<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500, Kap.<br />
2.31 – Fachaufsicht<br />
07.-11.11.2011 Gera<br />
12.-16.12.2011 Gera<br />
Einführung in die Gasdruckregel- und<br />
Messtechnik<br />
07.-09.11.2011 Erfurt<br />
DVS 2202-1 – Beurteilung von Kunststoffschweißverbindungen<br />
15.11.2011 Kerpen<br />
01.12.2011 Mellendorf<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
10.11.2011 Kerpen<br />
07.12.2011 Hamburg<br />
Fernwärme<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Bau und Sanierung von Nah- und Fernwärmeleitungen<br />
16./17.11.2011 Bremen<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
09.11.2011 Frankfurt/Main<br />
Kanalbau<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Aufbaulehrgang Kanalbau<br />
24.11.2011 Berlin<br />
Sanierung privater Abwasserkanäle<br />
16.11.2011 Wedemark<br />
Brunnenbau<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Qualitätssicherung und Risikominimierung<br />
bei Geothermiebohrungen und –anlagen<br />
04.11.2011 Kassel<br />
Betriebliche Management-Systeme (BMS)<br />
in Brunnenbau und Geothermieunternehmen<br />
17.11.2011 Stuttgart<br />
Kontaktadresse<br />
brbv<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
GmbH, Köln,<br />
Tel. 0221/37 658-20,<br />
E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
686 8-9 / 2011
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Lehrgänge – RSV<br />
Praxislehrgänge<br />
Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater<br />
Bad<br />
Zwischenahn 1. Woche: 26.09.-01.10.2011<br />
2. Woche: 10.-14.10.2011<br />
3. Woche: 31.10.-04.11.2011<br />
4. Woche: 21.-26.11.2011<br />
Seminare<br />
Grundlagen Kanalbau<br />
10.10.2011 Darmstadt<br />
21.11.2011 Lünen<br />
Sachkundelehrgang Fräs- und Robotertechnik<br />
26./27.09.2011 Darmstadt<br />
Sachkundelehrgang partielle Sanierung mit<br />
Kurzlinern und Innenmanschetten<br />
28.-30.09.2011 Darmstadt<br />
Sicherheitsunterweisung gemäß UVV<br />
26.09.2011 Lünen<br />
27.10.2011 Darmstadt<br />
Sicherheitsunterweisung gemäß UVV und<br />
Ersthelferlehrgang<br />
27./28.10.2011 Darmstadt<br />
17./18.11.2011 Lünen<br />
Abschlusslehrgang Fachkunde<br />
Kanalsanierung (RSV/SAG)<br />
14.-16.12.2011 Darmstadt<br />
Kontaktadresse<br />
RSV<br />
RSV – Rohrleitungssanierungsverband e. V.,<br />
49811 Lingen (Ems), Tel. 05963/9 81 08 77,<br />
Fax 05963/9 81 08 78, E-Mail: rsv-ev@<br />
t-online.de, www.rsv-ev.de<br />
Seminare – Verschiedene<br />
DVGW<br />
Intensivschulungen<br />
Verfahrenstechnik der Wasseraufbereitung<br />
30.11.-02.12.2011 Ulm<br />
EW Medien und<br />
Kongresse<br />
Seminar<br />
Gütesicherung im Kabelleitungstiefbau und<br />
Querverbund<br />
14.-18.11.2011 Erfurt<br />
HDT<br />
Seminare<br />
ASME-Kenntnisse für die Anfrage zu<br />
Druckgeräten, Rohrleitungen mit Zubehör<br />
und Schweißkonstruktionen im Maschinenbau<br />
21.11.2011 Essen<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen und<br />
Rohrleitungen nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
29.11.2011 Essen<br />
Dichtungen – Schrauben – Flansche<br />
10.11.2011 Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
18./19.10.2011 Innsbruck, Österreich<br />
Theorie und Praxis der Stopfbuchsen an<br />
Armaturen und Apparaten<br />
06.10.2011 Essen<br />
Projektmanagement im Anlagenbau: Teil<br />
2 – Qualität, Vertrag/Änderungen, Dokumentation,<br />
Recht, EDV und Beispiele<br />
10./11.10.2011 Essen<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
27.10.2011 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
23./24.11.2011 Essen<br />
Rohrleitungsplanung für Industrie- und<br />
Chemieanlagen<br />
24./25.11.2011 München<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen und<br />
Rohrleitungen nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
29.11.2011 Essen<br />
Forum Molchtechnik<br />
01./02.12.2011 Berlin<br />
Dichtungstechnik im Rohrleitungs- und<br />
Apparatebau<br />
08.12.2011 Essen<br />
TAE<br />
Seminare<br />
Kanalinstandhaltung<br />
09./10.11.2011 Ostfildern<br />
Spezialtiefbau<br />
14./15.11.2011 Ostfildern<br />
Hochspannungsbeeinflussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
02.12.2011 Ostfildern<br />
Mikrotunnelbau<br />
09.12.2011 Ostfildern<br />
TAH<br />
Seminare<br />
Lehrgang zum Zertifizierten Kanalsanierungs-Berater<br />
2011<br />
ab 10.10.2011 Weimar<br />
Instandhaltung von Abwasserkanalsystemen<br />
– Kanalsanierung von A bis Z<br />
28./29.09.2011 Hannover<br />
Auf den Punkt gebracht 2011<br />
08.11.2011 Münster<br />
09.11.2011 Rendsburg<br />
10.11.2011 Lüneburg<br />
23.11.2011 Mülheim/Ruhr<br />
24.11.2011 Limburg/Lahn<br />
Kontaktadresse<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V., Bonn; Tel. 0228/9188-607,<br />
Fax 0228/9188-997, E-Mail: splittgerber@<br />
dvgw.de, www.dvgw.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik, Essen; Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
TAE<br />
Technische Akademie Esslingen e.V., Heike Baier,<br />
Tel. 0711/3 40 08-0, Fax 0711/3 40 08-27,<br />
E-Mail: heike.baier@taw.de, www.tae.de<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.;<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
8-9 / 2011 687
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Messen und Tagungen<br />
XVII. Dichtungskolloquium<br />
29./30.09.2011 in Steinfurt; Fachhochschule Münster, Michael Reppien,<br />
Tel. 02551/9-62607, Fax 02551/9-62627, E-Mail:<br />
mreppien@fh-muenster.de, www.fh-muenster.de<br />
15. Workshop Kolbenverdichter 2011<br />
19./20.10.2011 in Rheine; KÖTTER Consulting Engineers KG, Martina<br />
Brockmann, Tel. 05971-9710-65, Fax 05971-9710-<br />
43, E-Mail: martina.brockmann@koetter-consulting.com,<br />
www.kce-akademie.de<br />
43. Kraftwerkstechnisches Kolloquium 2011<br />
25./26.10.2011 in Dresden; Technische Universität Dresden, Dipl.-Kauffr.<br />
Elke Czaplewski, Tel. 0351/463-35308, Fax 0351/463-<br />
37753, E-Mail: kwt-kollqu@tu-dresden.de, www.kraftwerkstechnik-dresden.de<br />
gat Gasfachliche Aussprachetagung<br />
25./26.10.2011 in Hamburg; DVGW, Jabeen Hussain: Tel. 0228/9188-<br />
608, E-Mail: hussain@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
6. Tag des Explosionsschutzes<br />
25./26.10.2011 Tagung in München; TÜV SÜD Akademie GmbH, Tizian<br />
Alexander, Tel. 089/5791-1122, Fax 089/5791-2833,<br />
E-Mail: congress@tuev-sued.de, www.tuev-sued.de/tagungen<br />
7. Forum Industriearmaturen<br />
27.10.2011 in Essen; Vulkan-Verlag GmbH, Helga Pelzer, Tel.<br />
0201/82002-35, Fax 0201/82002-40, E-Mail:<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de, www.industriearmaturen.de<br />
ROHRBAU Weimar<br />
21./22.11.2011 Kongress mit Fachausstellung; figawa Service GmbH, Gabriele<br />
Borkes, Tel. 0221/37658-46, Fax 0221/37658-<br />
63, E-Mail: borkesborkes@figawaservice.de, www.brbv.de<br />
Forum Molchtechnik<br />
01./02.12.2011 in Berlin; Haus der Technik Essen, Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
Tagung Rohrleitungsbau<br />
24./25.01.2012 in Berlin; figawa Service GmbH, Gabriele Borkes, Tel.<br />
0221/37658-46, Fax 0221/37658-63, E-Mail:<br />
borkes@figawaservice.de, www.brbv.de<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012<br />
09./10.02.2012 IRO GmbH Oldenburg, Tel. 0441/36 10 39-0, Fax<br />
0441/36 10 39–10, E-Mail: info@iro-online.de, www.<br />
iro-online.de<br />
IFAT 2012<br />
07.-11.05.2012 in München; Messe München GmbH, Tel. 089/9 49-113<br />
58, Fax 089/9 49-113 59, E-Mail: info@ifat.de, www.<br />
ifat.de<br />
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 649<br />
7th Pipeline Technology Conference 2012, Hannover 637<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau OT Großsteinbach 595<br />
Aqua Ukraine 2011, Kyev, Ukraine 677<br />
Aquatech Amsterdam 2011, Amsterdam, Niederlande 589<br />
Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG,<br />
Mannheim 669<br />
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar 597<br />
Egeplast Werner Strumann GmbH & Co. KG,<br />
Greven<br />
Titelseite<br />
ElektroPhysik, Köln 633<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 645<br />
Funke Kunststoffe GmbH, Hamm 599<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef 593<br />
HOBAS Rohre GmbH, Neubrandenburg 617<br />
KÖTTER Consulting Engineers KG, Rheine 605<br />
PMC International AG, Düsseldorf 603<br />
REW Istanbul 2012, Istanbul, Türkei 684<br />
Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme,<br />
Salzgitter 601<br />
SIMONA AG, Kirn 587<br />
SKZ - TeConA GmbH, Würzburg 604<br />
Steinzeug Abwassersysteme GmbH, Frechen 591<br />
Tracto-Technik GmbH & Co. KG, Lennestadt 631<br />
TÜV SÜD Industrieservice GmbH, München 615<br />
WtL Edgar Klose, Halle/Saale 605<br />
Marktübersicht 651–660<br />
688 8-9 / 2011
Impressum<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49(0)201-82002-0, Telefax +49(0)201-82002-40.<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke,<br />
Hans-Joachim Jauch<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56,<br />
45128 Essen, Telefon +49(0)201-82002-33,<br />
Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Telefon +49(0)201-82002-<br />
35, Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer, Vulkan-Verlag/Oldenbourg Industrieverlag<br />
GmbH, Telefon +49(0)89-45051-471, Telefax +49(0)89-<br />
45051-300, E-Mail: mittermayer@oiv.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL, Postfach 91 61, 97091<br />
Würzburg, Telefon +49(0)931-4170-1616, Telefax +49(0)931-<br />
4170-492, E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Gestaltung, Satz und Druck<br />
Gestaltung: deivis aronaitis design I dad I,<br />
Leonrodstraße 68, 80636 München<br />
Satz: e-Mediateam Michael Franke, Breslauer Str. 11,<br />
46238 Bottrop<br />
Druck: Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 263,- + € 27,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 263,- + € 31,50 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 34,- +<br />
€ 3,- Versand; Einzelheft (Ausland): € 34,- + € 3,50 Versand;<br />
Einzelheft als ePaper (PDF): € 34,-; Studenten: 50 % Ermäßigung<br />
auf den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten<br />
bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede Buchhandlung<br />
möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der<br />
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Auch die<br />
Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung,<br />
im Magnettonverfahren oder ähnlichem <strong>Wege</strong> bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung<br />
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der<br />
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V., Köln · Rohrleitungsbauverband<br />
e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband e.V., Essen ·<br />
Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten, Gasmeßund<br />
Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld, Vorsitzender des<br />
Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik<br />
und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) · Dipl.-Ing. K. Küsel, Heinrich<br />
Scheven Anlagen-und Leitungsbau GmbH, Erkrath · Dipl.-Volksw. H. Zech,<br />
Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln · Rechtsanwalt<br />
C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing. Th. Grage,<br />
Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen · Dr.-Ing.<br />
A. Hilgenstock, E.ON Ruhrgas AG, Technische Kooperationsprojekte, Kompetenzcenter<br />
Gastechnik und Energiesysteme /(Netztechnik), Essen · Dipl.-<br />
Ing. D. Homann, IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, RWE –<br />
Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH, Dortmund · Dipl.-Ing.<br />
J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dr. H.-C. Sorge, IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für Wasser, Biebesheim · Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter<br />
des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen · Dipl.-Ing.<br />
D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG · W. Burchard, Geschäftsführer<br />
des Fachverbands Armaturen im VDMA, Frankfurt · Bauassessor<br />
Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Köln ·<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren ·<br />
Prof. Dr.-Ing. M. Gietzelt, Vorstandsvorsitzender des Fernwärme-Forschungsinstituts<br />
e.V., Hemmingen · Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer<br />
des Rohrleitungsbauverbandes e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn,<br />
BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.‐Ing. V. Klosowski, Mitglied des Vorstands,<br />
TÜV NORD AG, Essen · Dipl.-Ing. B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure GmbH,<br />
München · Dr.-Ing. W. Lindner, Vorstand des Erftverbandes, Bergheim ·<br />
Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer des Kunststoffrohrverbands<br />
e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß, Mitglied des Vorstandes, FDBR Fachverband<br />
Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing.<br />
R. Moisa, Geschäftsführer der Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V.,<br />
Griesheim · Dipl.‐Berging. H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing.<br />
T. Schamer, Prokurist der ARKIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing.<br />
Th. <strong>Wege</strong>ner, Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg<br />
· Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische<br />
Universität Chemnitz-Zwickau · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer<br />
Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen
1. Praxistag Wasserversorgungsnetze<br />
Leckortung und<br />
Netzoptimierung<br />
am 8. November 2011 in Essen<br />
Programm<br />
Moderation:<br />
Prof. Th. <strong>Wege</strong>ner, iro<br />
Wann und Wo?<br />
Themenblock 1: Wasserverlustmanagement<br />
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen<br />
im Wasserverlustmanagement<br />
Dr. J. Kölbl, Salzburg (A)<br />
Erfahrung der Rohrnetzhydraulik –<br />
Nutzen für das Asset Management<br />
Dr. Osmancevic, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Asset Management – Rehabilitationsplanung<br />
Dr. G. Gangl, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Themenblock 2: Leckortung – Messtechnik<br />
„Wasser“ – vom Bewusstsein zur Verlustanalyse<br />
J. Kurz, SebaKMT, Baunach<br />
Permanente Leckortung –<br />
Verfahren zur Reduzierung von Wasserverlusten<br />
D. Becker, Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh<br />
Themenblock 3: Erfahrungen von Netzbetreibern<br />
Leckortung in Wasserverteilnetzen<br />
Ulrich Zigan, Stadtwerke Essen AG, Essen<br />
Leckageortung an Wassertransportleitungen am Beispiel<br />
der Hauptleitung 3 der Landeswasserversorgung<br />
Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh,<br />
Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, ZfW, iro<br />
Termin: Mittwoch, 08.11.2011,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Essen, Welcome Hotel Essen<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken und<br />
Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich Netzinspektion<br />
und -wartung<br />
Teilnahmegebühr:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 350,- €<br />
Nichtabonnenten: 390,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
Themenblock 4: Entstördienst, Wiederinbetriebnahme<br />
Optimierung des Entstördienstes<br />
J. Treiber, Friatec AG, Mannheim<br />
Reinigung, Desinfektion und Armatureninspektion<br />
Dr. N. Klein, Hammann GmbH, Annweiler am Trifels<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-55 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift