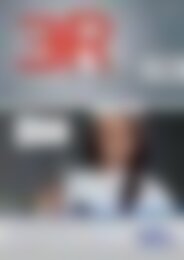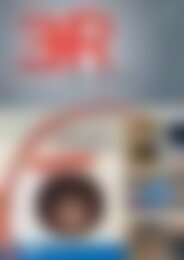3R Korrosionsschutz (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
06 | 2014<br />
ISSN 2191-9798<br />
8. Praxistag<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
02. Juni 2014, VELTINS-Arena, Gelsenkirchen<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Special Bodenmanagement<br />
Wasserversorgung<br />
Abwasserentsorgung<br />
MiniLog2<br />
MiniLog2<br />
Datenlogger GPS - Takter Intensivmessung<br />
Auswertesoftware<br />
IFO Tragegestell<br />
WinLog 2.0<br />
GPS Zeit + Position<br />
Messprobenmessung<br />
Hutschienenhalterung<br />
Leistungsschalter<br />
50 A / 100 A<br />
www.weilekes.de
4. Praxistag am 05. November 2014 in Rheine<br />
Wasserversorgungsnetze<br />
NEU<br />
Begleitende<br />
Ausstellung und<br />
Vorführungen<br />
Programm<br />
Moderation: Prof. Th. Wegener,<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg<br />
Wann und Wo?<br />
Block 1: Netzbetrieb - Analysieren und Optimieren<br />
Optimale fahrweise von Pumpen und Turbinen<br />
Dr. Gebhardt, aquatune, Aarbergen; Dr. Wolters, 3S Consult, München<br />
Rahmenbedingungen einer Zielnetzplanung<br />
Dr. Esad Osmancevic, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
ISO 55 000 – Der Standard für das Asset Management<br />
Mike Beck, Fichtner Water & Transportation GmbH, Berlin<br />
Block 2: Strategien zur Netzspülung<br />
Reinigung einer Rohwasserleitung mit dem Impulsspülverfahren<br />
Carsten Utke, Berliner Wasserbetriebe, Berlin<br />
Auswahlkriterien für Spül- und Reinigungsverfahren<br />
Dominik Nottarp-Heim, Hessenwasser, Groß-Gerau;<br />
Dr. Christian Sorge, IWW, Biebesheim am Rhein<br />
Block 3: Armaturenwechsel und -instandhaltung<br />
Wechsel von Anbohrarmaturen bei Betriebsdruck<br />
N. N., Flintab GmbH, Brüsewitz<br />
Im Fokus: Armatureninstandhaltung<br />
Axel Sacharowitz, 3S Antriebe, Berlin<br />
Block 4: Druckprüfung von Rohrleitungen<br />
Fehlerhafte Druckprüfungen bei Wasserleitungen<br />
René Stangl, Hamm<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 Druckprüfung von neu verlegten<br />
Rohrleitungen - Grundlagen, Verfahren, Anforderungen<br />
Bernd Nienhaus, Esders GmbH, Haselünne<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, iro<br />
Termin: Mittwoch, 05.11.2014,<br />
9:00 Uhr – 16:45 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Rheine<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken<br />
und Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich<br />
Netzplanung, -inspektion und<br />
-wartung<br />
Teilnahmegebühr*:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 410,- €<br />
Nichtabonnenten: 450,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen<br />
wird ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen<br />
Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet<br />
möglich) sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine<br />
schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn<br />
zu begleichen ist. Bei Absagen nach dem 24.<br />
Oktober 2014 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise<br />
verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Block 5: Netzbetrieb - Überwachung<br />
Schallgeschwindigkeit im Rohrnetz<br />
Dirk Becker, Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh<br />
Online Netzüberwachungssysteme zur Versorgungssicherheit<br />
Stefan Neuhorn, Hinni AG, Biel-Benken (CH)<br />
Erhöhte Rohrleitungsschwingungen in einem Wasserwerk<br />
Dr. Christian Jansen, KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
Dem „Rost“ auf der Spur<br />
Am 2. Juli 2014 treffen sich die Fachexperten der <strong>Korrosionsschutz</strong>branche zum<br />
„8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong>“ in der Veltins-Arena auf Schalke, um sich über die<br />
aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des <strong>Korrosionsschutz</strong>es zu informieren und<br />
auszutauschen. Die von der Zeitschrift <strong>3R</strong> in Zusammenarbeit mit dem fkks Fachverband<br />
Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> e.V. ausgerichtete Veranstaltung hat sich längst<br />
etabliert und mit rund 240 Teilnehmern im vergangenen Jahr eine Besucherbestmarke<br />
erreicht. Wie in jedem Jahr werden ein Teil der hochinteressanten Vorträge parallel in<br />
der aktuellen Ausgabe der <strong>3R</strong> publiziert. Den Beginn macht Dr. Markus Büchler mit<br />
seinem Beitrag „Der Nachweis der Wirksamkeit des KKS: Das IR-freie Potential und<br />
andere Methoden“ ab Seite 50.<br />
Bereits vom 19. bis zum 22. Mai dieses Jahres gab es ein Treffen der Branche. Anlässlich<br />
des 50jährigen Jubiläums des fkks organisierten der fkks und der DVGW den<br />
diesjährigen CeoCor-Kongress in Weimar. Darüber hinaus richtete der fkks seine<br />
Jahreshauptversammlung und den fkks Infotag aus. Auf der Jahreshauptversammlung<br />
wurde mit Professor Bernd Isecke ein neuer 1. Vorsitzender gewählt. Er tritt die<br />
Nachfolge von Hans Gaugler an, der die Arbeiten des Verbandes in den vergangenen<br />
Jahren maßgeblich mitgeprägt hat. Jürgen Barthel wurde in seinem Amt als 2. Vorsitzender<br />
bestätigt. Ein Höhepunkt der Veranstaltung in Weimar war die Verleihung der<br />
Kuhn-Ehrenmedaille an Dr. Hanns-Georg Schöneich für seine langjährigen Verdienste<br />
im Bereich des <strong>Korrosionsschutz</strong>es. Über die Veranstaltung berichten wir ab Seite 8<br />
in dieser Ausgabe.<br />
Ein anderes Thema, das immer wieder Fragen und Probleme in der Praxis aufwirft,<br />
ist der Umgang mit dem Boden. Dazu zählen beispielsweise der hohe Belegungsgrad<br />
des Untergrundes in Innenstädten, die Beeinflussung der Leitungstrassen durch<br />
Baumbestand, der Umgang mit kontaminierten Böden oder auch die Verfüllung des<br />
Leitungsgrabens mit Ersatzbaustoffen. So plant der Gesetzgeber aktuell eine neue<br />
Bauverordnung für mineralische Ersatzbaustoffe im Kanal- und Leitungsbau. Am 2.<br />
Juni fand zu diesem Themenkomplex in Gelsenkirchen das IKT-Seminar „Bodenmanagement<br />
im Leitungsbau“ statt, in dem über aktuelle technische und gesetzliche<br />
Entwicklungen berichtet wurde. Die <strong>3R</strong> wird sich diesem Thema in den nächsten<br />
Ausgaben mit dem Spezial „Bodenmanagement“ widmen.<br />
Eine „Kleinigkeit“ sei noch am Rande erwähnt: Der Vulkan Verlag ist im Mai umgezogen.<br />
Der Sitz liegt immer noch im Herzen des Ruhrgebietes,<br />
d. h. Sie finden uns nach wie vor in Essen; allerdings nunmehr<br />
in der Friedrich-Ebert Straße 55. Das schöne am<br />
Umzug ist das Entschlacken von Altlasten und das Wiederauffinden<br />
von vergrabenen Schätzen (dazu später<br />
mehr) - und vielleicht, dass man die Kisten nicht mehr<br />
selber schleppen muss.<br />
Für den „8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong>“ wünsche<br />
ich allen Teilnehmern eine spannende Veranstaltung<br />
mit regem Austausch und neuem Wissen und Anregungen<br />
für die eigene Arbeit und den Lesern dieser<br />
Ausgabe viel Spaß bei der Lektüre.<br />
Nico Hülsdau<br />
Chefredakteur <strong>3R</strong><br />
06 | 2014 1
INHALT<br />
NACHRICHTEN<br />
07<br />
32<br />
Die Firma Denso erhält Großauftrag für 2,4 Mio. m 2<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>band vom indischen Pipelinebetreiber IOCL<br />
Vom 19. bis zum 22. Mai traf sich die <strong>Korrosionsschutz</strong>branche in<br />
Weimar zum CeoCor-Kongress und forum kks<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
6 DENSO erhält Zuschlag für Lieferung von mehr als 2,4 Millionen m 2 <strong>Korrosionsschutz</strong>band<br />
6 Richtigstellung: „Diskussion über Nutzungsdauern“ im Fachbericht Prof.<br />
Dr.-Ing. Reinhard F. Schmidtke<br />
7 Wasser ist Leben<br />
7 40 Jahre Untergrundgasspeicher Bernburg<br />
8 Vitalis erweitert Fachkompetenz<br />
EDITORIAL<br />
1 „Dem Rost auf<br />
der Spur?“<br />
Nico Hülsdau<br />
INTERVIEW<br />
20 „9. Symposium<br />
grabenloser Leitungsbau<br />
und 10. Hands on<br />
days“<br />
mit Prof. Horst Görg und<br />
Günter Naujoks<br />
VERBÄNDE<br />
8 CeoCor-Kongress und forum kks 2014 in Weimar<br />
10 GECO: neuer Vorstand und geschärfte Strategie<br />
11 FVST-Hochschultag auf der IFAT<br />
12 Mitgliederversammlung des rbv in Münster<br />
PERSONALIEN<br />
14 DMT-Geschäftsfeldleiter erhält Honorarprofessur<br />
14 Christof Ströter Business Director bei Seal for Life Industries<br />
15 IKT-Förderverein Netzbetreiber:Neuer Mann an der Spitze<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
16 8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
19 Branchentreff Rohrvortrieb in Nürnberg<br />
2 06 | 2014
80 jahre rohrschutz<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>systeme<br />
für den Rohrleitungsbau<br />
46<br />
GFK-<br />
Beschichtungen<br />
Petrolatum-<br />
Bänder<br />
Die Gütersloher Unternehmensgruppe Sewerin stellt ein neues<br />
Lecksuchsystem vor<br />
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Bitumen-<br />
Bänder<br />
22 Abrasionsresistente Emails – technische Lösungen in der Förderund<br />
Prozesstechnik<br />
Franz-J. Behler<br />
24 Grabenlose Close-fit Installationen in PE 100-RC-Qualität<br />
Dipl.-Ing. (FH) Ralf Glanert , Dipl.-Ing. (FH) Johannes Grieser<br />
27 Innendichtendes Kunststoff-Presssystem für erdverlegte Rohrleitungen<br />
27 Produkt-Update in der Mess- und Fernüberwachungstechnik beim<br />
Kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
28 Lecksuche mit System<br />
29 Grenzen der Wasserleckortung neu definiert<br />
29 Flexibilität durch mehrlagige Schellenmontage<br />
30 Wellrohre sicher abdichten mit Curaflex Nova ® Senso<br />
30 Radiodetection präsentiert die nächste Generation von Präzisions-<br />
Marker-Suchsystemen<br />
31 Ortung von erdverlegten Versorgungsleitungen<br />
32 Neuer begehbarer Schacht DN 1000<br />
32 Mineralische Beschichtung gegen aggressives Abwasser und<br />
biogene Schwefelsäurekorrosion<br />
33 Komplette Systemlösung: KERAPORT Schächte<br />
33 Molchen leicht gemacht: QUICK-PIG-Station für PE-Rohrsysteme<br />
34 Die neue Premium-Line von Wavin: Großes Interesse auf<br />
der IFAT 2014<br />
8.Praxistag<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
2. Juli 2014<br />
Gelsenkirchen<br />
Veltins-Arena<br />
Einbandund<br />
Zweiband-<br />
Systeme<br />
Schrumpftechnik<br />
Unsere Dienstleistungsabteilung<br />
führt<br />
seit über<br />
50 Jahren<br />
Umhüllungsarbeiten an<br />
erdverlegten Stahlrohrleitungen<br />
und Behältern<br />
im Werk oder auf Baustellen<br />
mit allen gängigen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>-Systemen<br />
durch.<br />
– <strong>Korrosionsschutz</strong> und Abdichtung seit 1933<br />
Telefon +49 209 9615-0 · E-Mail: info@kebu.de · Internet: www.kebu.de<br />
06 | 2014 3
INHALT<br />
FACHBERICHTE<br />
78<br />
122<br />
Der Umgang mit Bestandsbäumen in der Nähe von<br />
Leitungstrassen ist in Hannover klar geregelt<br />
Wie man mit KKS die Qualität bei der HDD-Verlegung von<br />
Stahlrohrleitungen überwachen kann, zeigt der folgende<br />
Beitrag<br />
RECHT & REGELWERK<br />
36 Betreiberhaftung bei Rohrleitungsschäden<br />
RA Dr. Michael Neupert<br />
40 DWA-Regelwerk<br />
SPEZIAL BODENMANAGEMENT<br />
42 Anforderungen an Böden und Verfüllstoffe im Bereich unterirdischer Infrastruktur<br />
Prof. Dr.-Ing. BERT BOSSELER, MARCEL GOERKE, M.Sc<br />
46 In Hannover klar geregelt: Bestandsbäume auf Versorgungstrassen<br />
Jens Voshage<br />
SERVICES<br />
21 Messen | Tagungen<br />
90 Buchbesprechung<br />
92 Aktuelle Termine<br />
96 Inserentenverzeichnis<br />
97 Marktübersicht<br />
105 Impressum<br />
KOROSSIONSSCHUTZ<br />
50 Der Nachweis der Wirksamkeit des KKS: Das IR-freie Potential und alternative<br />
Methoden<br />
Dr. Markus Büchler<br />
58 IFO- oder Intensivmessung: Was ist die bessere Methode?<br />
Michael Gemsa, Thomas Basten<br />
63 Smart KKS: Intelligente Schutzstrom einspeisung zum Schutz wechsel spannungsbeeinflusster<br />
Rohrleitungen<br />
Dipl.-Phys. Rainer Deiss, Dipl.-Ing. (FH) Markus Wendling<br />
66 Qualitätssicherung bei HDD-Stahlrohrverlegungen durch den KKS – ein Praxisbeispiel<br />
Jörg Maurmann, Dr. Oliver Hohage<br />
70 Untersuchungen von Flüssigböden hinsichtlich ihres Einflusses auf den KKS von<br />
Stahlrohrleitungen<br />
Dipl.-Ing. Thomas Laier, Dipl.-Ing. Ulrich Bette, B.Eng. Mohamed Houban<br />
74 <strong>Korrosionsschutz</strong>maßnahmen an einem Düker unter dem Hafen in Emden<br />
4 06 | 2014
147<br />
Anwendungsbericht über den Einsatz des Beton-<br />
Kunststoff-Verbundrohrsystems Perfect Pipe<br />
SOLARTECHNIK<br />
Solar-Tec<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
76 Abwasserwärmenutzung: Stand in Europa und in<br />
Deutschland<br />
Dipl.-Ing. M.Sc. M.Sc Achim Hamann<br />
80 Dauerhafte DN 600 Abwasserleitung – Perfect Pipe im<br />
Einbau<br />
82 Hochleistungs-Stahlbeton rohre mit integrierter Trockenwetter-Rinne<br />
84 Heppenheim setzt auf Nachhaltigkeit<br />
86 „Hoffnungslos“ gibt es nicht mehr –<br />
Das Fräs-Strahl-Verfahren rettet Bauprojekte mit verfüllten<br />
Abwasserrohren<br />
88 Kanalsanierung in der Mineralölindustrie<br />
PVC / PMMA Messstellen<br />
Messstellen-Typen-Vielfalt für unabhängige Stromversorgung<br />
und zur sicheren Aufnahme der Messtechnik.<br />
Kabelvergussset<br />
Passiver <strong>Korrosionsschutz</strong> von Kabelanschlüssen für den<br />
kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>.<br />
Unterflur Messstelle<br />
Wasserdichtes Kunststoffgehäuse mit teleskopierbarer<br />
Klemmplatte.<br />
06 | 2014<br />
www.kettnergmbh.de
NACHRICHTEN INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
DENSO erhält Zuschlag für Lieferung von mehr als<br />
2,4 Millionen m 2 <strong>Korrosionsschutz</strong>band<br />
Applikation von DENSOLEN ® AS39P/R20HT von IOCL in Indien<br />
IOCL - Indian Oil Corporation Ltd. – Indiens größter Pipelinebetreiber<br />
und eine der weltweit führenden Ölgesellschaften,<br />
rehabilitiert kontinuierlich Teile ihres über 11.000 km langen<br />
Pipelinenetzes, das seit über 40 Jahren in Betrieb ist. Die<br />
Rehabilitierung wird unter laufendem Betrieb der Leitungen<br />
durchgeführt. Dafür wurde ein Dreischichten- (Innenwicklung)<br />
und Zweischichten- (Außenwicklung) PE/Butyl-Bandsystem auf<br />
Grund der nachweisbar hervorragenden technischen Eigenschaften<br />
und der einfachen Anwendbarkeit ausgewählt.<br />
DENSO GmbH Deutschland ist seit 1922 in der Entwicklung<br />
und Herstellung von qualitativ hochwertigen Materialien für<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>- und Dichtungstechnik tätig. Die Erfolgsgeschichte<br />
des Unternehmens beginnt mit dem weltweit ersten<br />
passivem <strong>Korrosionsschutz</strong> für Rohrleitungen: der DENSO ® -<br />
Binde (Petrolatum-Binde), die 1927 erfunden wurde. Seit dieser<br />
Zeit ist DENSO einer der weltweit führenden Hersteller von<br />
qualitativ hochwertigen <strong>Korrosionsschutz</strong>produkten, wie Petrolatumbändern,<br />
flüssigen Beschichtungen, Dichtungsbändern,<br />
Schutzsystemen für den maritimen Bereich, Schrumpfmanschetten<br />
und PE/Butyl-Bandsystemen – alle Produkte „Made<br />
in Germany“.<br />
Das Leverkusener Unternehmen lieferte bereits in den vergangenen<br />
Jahren mehr als 2,6 Millionen m 2 DENSOLEN ® AS39P/<br />
R20HT-Bandsystem für die Rehabilitierungen von Pipelines an<br />
die IOCL nach Indien. Vor kurzem hat DENSO einen Einzelauftrag<br />
zur Lieferung von mehr als 2,4 Millionen m 2 (diese Fläche<br />
entspricht mehr als 335 Fußballfeldern) des Bandsystems DEN-<br />
SOLEN ® AS39P/R20HT erhalten, die in den Jahren 2014/2015<br />
für die Rehabilitierung von ca. 320 km des IOCL-Pipelinenetzes<br />
benötigt werden.<br />
IOCL fordert einen zuverlässigen <strong>Korrosionsschutz</strong> für mindestens<br />
weitere 40 Jahre Betriebsdauer seiner Leitung. Der<br />
technische Ausschuss von IOCL ist von der hohen Qualität<br />
und der Technologie der Dreischicht/Zweischicht-PE/Butyl-<br />
Bandsysteme überzeugt, die von DENSO in Leverkusen produziert<br />
werden. DENSOLEN ® Bänder und Bandsysteme sind<br />
der weltweit einzige <strong>Korrosionsschutz</strong> mit einer nachweisbaren<br />
Langzeiterfahrung von über 40 Jahren. Von dem Bandsystem<br />
wurden in den letzten 40 Jahren bereits mehr als 100 Millionen<br />
m 2 erfolgreich in zahlreichen Pipelineprojekten weltweit<br />
verwendet.<br />
Richtigstellung: „Diskussion über Nutzungsdauern“<br />
im Fachbericht Prof. Dr.-Ing. Reinhard F. Schmidtke<br />
Bedauerlicherweise ist der Redaktion in Ausgabe <strong>3R</strong>-3/2014<br />
ein Fehler unterlaufen. Im Fachbericht „Praktische Handhabung<br />
von Nutzungsdauern in Kostenvergleichsrechnungen<br />
von Prof. Dr.-Ing. Reinhard F. Schmidtke lautet der<br />
letzte Satz auf Seite 43 richtigerweise: „Es ist klar, dass<br />
ohne Einbeziehung der Systemzusammenhänge und der<br />
Entwicklungsprozesse eine Kalkulation mit längeren Nutzungsdauern<br />
zu einer geringeren Steigerung der auf diese<br />
Weise berechneten investiven Jahreskostenanteile und damit<br />
zu einer scheinbar höheren Kosteneffizienz führt.“ Damit<br />
erklärt sich auch der Grund für „manche erbitterte Diskussion<br />
über Nutzungsdauern“, wie der Autor weiter ausführt.<br />
Interesse am Fachbericht?<br />
KONTAKT: <strong>3R</strong>-Redaktion@vulkan-verlag.de.<br />
6 06 | 2014
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT NACHRICHTEN<br />
Wasser ist Leben<br />
Rund 56.000 der ärmsten Einwohner Nairobis werden von<br />
einem Programm profitieren, das durch Borealis, Borouge und<br />
OFID sowie mit Implementierung und Projektmanagement<br />
von WSUP eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung<br />
ermöglichen soll – zu einem Zehntel des Preises, den die Einwohner<br />
derzeit an private Wasserlieferanten zahlen.<br />
Das gemeinsame Corporate Social Responsibility-Programm<br />
(CSR) Water for the World hat das Ziel, Mukuru Sinai und<br />
Korogocho, zwei Siedlungen Nairobis, einen verbesserten<br />
Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Zu diesem Zweck<br />
wurde eine detaillierte Netzwerkplanung erstellt, mit hochwertigen<br />
PE-Rohren und im Voraus bezahlten Wasserspendern,<br />
wodurch ein weitaus niedrigerer Tarif als der derzeitige<br />
angeboten werden kann.<br />
„Wasserverluste, die aufgrund von Lecks und illegalen<br />
Anschlüssen entstehen, beschränken die finanziellen Möglichkeiten<br />
der Wasser- und Abwassergesellschaft Nairobis,<br />
umliegende Armenviertel und Slums mit Wasser zu versorgen.<br />
Durch den Einsatz hochwertiger PE-Rohre können wir diese<br />
Verluste erheblich reduzieren“, erklärt Mark Garrett, Borealis<br />
Vorstandsvorsitzender. „Die erwartete Lebensdauer dieser<br />
Rohre ist dreimal so lang wie bei bestehenden Rohren. Aufgrund<br />
der höheren Widerstandsfähigkeit kommt es zu weniger<br />
Rohrbrüchen, Kontaminierungen und Lecks, und auch die<br />
Wartungskosten sinken.“<br />
Elektrodienst Rössing & Bornemann KG<br />
Die Firma Rössing & Bornemann wurde 1955 gegründet<br />
und hat ihren Stammsitz in 48529 Nordhorn.<br />
Mit modernster Technik in unserem umfangreichen<br />
Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätepark stehen wir<br />
unseren Kunden zur Verfügung.<br />
Das Tätigkeitsfeld unseres Unternehmens umfasst<br />
Deutschland und das angrenzende Ausland.<br />
Die Schwerpunkte unserer Dienstleistungen liegen<br />
in den Bereichen Elektro-, Mess- und Regeltechnik;<br />
Kabel- und PE-Rohrverlegung einschließlich<br />
Montagen, sowie Planung und Ausführung des<br />
kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es.<br />
Zu unseren langjährigen Kunden zählen Erdgasund<br />
Erdölversorgungsunternehmen, Industriebetriebe,<br />
mittelständische Unternehmen, Staatshochbauämter<br />
und Stadtwerke.<br />
Elektrodienst Rössing & Bornemann KG<br />
Marienburger Str. 23 · 48529 Nordhorn<br />
Tel. (0 59 21) 9 73 70<br />
Fax (0 59 21) 7 51 40<br />
http://roessing-bornemann.de<br />
E-Mail: info@roessing-bornemann.de<br />
40 Jahre Untergrundgasspeicher Bernburg<br />
Der Untergrundgasspeicher Bernburg (Sachsen-Anhalt) der<br />
VNG Gasspeicher GmbH (VGS) feiert in diesen Tagen sein<br />
40-jähriges Jubiläum. Der größte und flexibelste Standort des<br />
Leipziger Speicherbetreibers wurde 1974 mit der Gaserstbefüllung<br />
der Kaverne 101 in Betrieb genommen. Heute besteht<br />
die Anlage aus 33 Kavernen mit einem Fassungsvermögen für<br />
rund eine Milliarde Kubikmeter (m ³ ) Erdgas. Zum Vergleich:<br />
Die Gesamtkapazität der sechs Speicheranlagen der<br />
VGS liegt bei rund 2,7 Milliarden m ³ . Mit einer solchen<br />
Gasmenge können schätzungsweise eine Million<br />
Haushalte ein Jahr lang mit Erdgas versorgt werden.<br />
Der UGS Bernburg ist ein so genannter Hohlraumspeicher.<br />
Die Kavernen wurden durch Bohrungen und<br />
Solung in einem unterirdischen Salzstock geschaffen.<br />
Dabei wird Salz mit Hilfe von Wasser gelöst und über<br />
Tage gefördert. „Unser Speicher in Bernburg wurde<br />
seit den 1970er Jahren in Zusammenarbeit mit der<br />
ansässigen Salzindustrie kontinuierlich ausgebaut.<br />
Die langfristig gesicherte Soleabnahme der chemischen<br />
Betriebe rund um Bernburg war für uns immer<br />
ein Garant, um den Standort zu entwickeln und die<br />
Kapazitäten vor Ort zu erhöhen“, erklärte Dr. Volker<br />
511,00 m<br />
Busack, technischer Geschäftsführer der VGS anlässlich der<br />
Festveranstaltung. Er fügte hinzu: „Unser Dank gilt gleichzeitig<br />
auch der Stadt Bernburg, den umliegenden Gemeinden und<br />
unseren technischen Dienstleistern für die gute und partnerschaftliche<br />
Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf ein weiterhin<br />
vertrauensvolles Miteinander.“<br />
Volumen<br />
50.000.000 m³<br />
Kaverne am Speicherstandort<br />
Bernburg<br />
160,00 m<br />
Volumen | 190.000 m³<br />
Ulmer Münster<br />
Ulm<br />
161,50 m<br />
Volumen | 132.000 m³<br />
KölnTurm<br />
Köln<br />
148,50 m<br />
Volumen | 485.600 m³<br />
Elbphilharmonie<br />
Hamburg<br />
Dimensionierung einer Kaverne am Standort Bernburg im Vergleich<br />
110,00 m<br />
Volumen | 85.780 m³<br />
Frauenkirche<br />
Dresden<br />
91,00 m<br />
VNG Gasspeicher GmbH Imagbroschüre<br />
06 | 2014 7
NACHRICHTEN INDUSTRIE & WIRTSCHAFT / VERBÄNDE<br />
Vitalis erweitert Fachkompetenz<br />
Die seit über sechs Jahren bestehende Vitalis KKS & Elektrotechnik<br />
Service GmbH unter der Führung von Oliver<br />
Vitalis Schulz hat in den letzten Monaten weitere Nachweise<br />
und Prüfungen der Fachkompetenz für den Fachbereich<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> abgelegt. Die Prüfung als <strong>Korrosionsschutz</strong>fachunternehmen<br />
nach DVGW GW 11:2006 wurde<br />
erfolgreich abgeschlossen und erweitert um den Bereich<br />
Wechselspannungskorrosion.<br />
Das Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2008 wurde<br />
ohne Abweichungen zertifiziert. Der Arbeitssicherheitsstandard<br />
wurde von SCC** auf SCCP angehoben und durch<br />
den Auditor zertifiziert.<br />
Ein Mitarbeiter ist von der Technischen Akademie Wuppertal<br />
als CP-Specialist zertifiziert worden. Auf Grund der<br />
absolvierten Prüfungen kann das Unternehmen die stetige<br />
Qualitätsarbeit nachweisen.<br />
Der erreichte Standard, der von neutralen Dritten bestätigt<br />
wurde, muss beim Kunden jeden Tag neu bewiesen werden.<br />
Themen wie Service, Qualität, fachliches Können und<br />
Arbeitsschutz haben oberste Priorität.<br />
KONTAKT: Vitalis KKS & Elektrotechnik Service GmbH, 49176 Meppen<br />
Oliver Vitalis Schulz, Tel. +49 (0) 59 31 / 49 69 339, E-Mail:<br />
kontakt@vitalis-schulz.com, www.vitalis-schulz.com<br />
CeoCor-Kongress und forum kks 2014 in Weimar<br />
Ihren jährlichen Internationalen Kongress mit technischer<br />
Ausstellung richtete die CeoCor in diesem Jahr auf Einladung<br />
des fkks und des DVGW im Weimarer Hotel Elephant<br />
aus. Aus diesem Anlass fand auch das jährliche<br />
forum kks vom 19. bis zum 22. Mai in Weimar statt. Mehr<br />
als 150 Teilnehmer aus dem In- und Ausland nutzten die<br />
Möglichkeit zum intensiven fachlichen Austausch.<br />
Das im Jahr 1956 gegründete CeoCor ist eine internationale<br />
gemeinnützige Wissenschaftsvereinigung mit über<br />
100 Fachleuten aus Universitäten, Forschungsinstituten,<br />
Versorgungsunternehmen, Ingenieurbüros, Fachfirmen<br />
und Herstellern im Bereich des <strong>Korrosionsschutz</strong>es. Die<br />
Mehrzahl europäischer Länder ist Mitglied der Vereinigung.<br />
Die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen<br />
der CeoCor bilden die wissenschaftliche Grundlage der<br />
europäischen Normen, die sich mit den Themen Korrosion<br />
und <strong>Korrosionsschutz</strong> befassen. Somit ist CeoCor Bindeglied<br />
zur CEN, dem Europäischen Komitee für Normung,<br />
und zu den nationalen Fachverbänden der aktuell 18<br />
partizipierenden Länder.<br />
Der internationale Erfahrungsaustauch und die Vermittlung<br />
von neusten Erkenntnissen im Bereich des Korro-<br />
Hotel Elephant, historischer Austragungsort des CeoCor-Kongresses und des<br />
forum kks 2014<br />
CeoCor-Präsident Lucio de Biase (rechts) und der 1. Vorsitzende<br />
des fkks Prof. Dr.-Ing. Bernd Isecke (links) begrüßen die<br />
Teilnehmer des Festbanketts<br />
8 06 | 2014
®<br />
sionsschutzes stehen bei dem jährlichen Kongress<br />
im Mittelpunkt. Zu den allgemeinen Aufgaben der<br />
Vereinigung zählen weiterhin die Erarbeitung von<br />
wissenschaftlichen und technischen Leitfäden sowie<br />
Publikationen im Bereich des <strong>Korrosionsschutz</strong>es.<br />
Die zwei Tätigkeitsgebiete des CeoCor befassen sich<br />
mit „Innenkorrosion: Trinkwasser und Abwasser“<br />
(Commission 1) und „Außenkorrosion: Kathodischer<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> Wasser-, Gas- und Erdölrohrleitungssysteme“<br />
(Commission 2).<br />
Der internationale Erfahrungsaustausch und das Vermitteln<br />
von Fachwissen im Rahmen des Kongresses in Weimar<br />
durch Hersteller, Anwender, Verbände und Prüfgremien<br />
(Forschungsinstitutionen) bot den Teilnehmern eine interessante<br />
und attraktive Gelegenheit für Gespräche und<br />
Know-how-Transfer. Entsprechend breit gefächert war<br />
auch das Vortragsprogramm des Kongresses durch das<br />
Max Hammerer, Präsident der Commission 1, und Dr.<br />
Markus Büchler, Präsident der Commission 2, führten.<br />
Verleihung der Kuhn-Ehrenmedaille<br />
Für den Abend des 21. Mai luden fkks und DVGW<br />
die CeoCor-Teilnehmer zusammen mit den Teilnehmern<br />
der Mitgliederversammlung des fkks zu einem<br />
gemeinsamen Bankett. In diesem würdigen Rahmen<br />
wurde die Kuhn-Ehrenmedaille an Dr. rer. nat. Hanns-<br />
Georg Schöneich für seine besonderen Verdienste im<br />
Bereich des <strong>Korrosionsschutz</strong>es verliehen. Eine sehr<br />
unterhaltsame und anspruchsvolle Honoratio wurde<br />
von Dr. Markus Büchler vorgetragen. Die Medaille<br />
überreichte der neue 1. Vorsitzende des fkks, Professor<br />
Bernd Isecke. Die Kuhn-Ehrenmedaille wird<br />
seit 1970 an verdiente Pioniere des kathodischen<br />
Schutzes von Rohrleitungen verliehen und wird vom<br />
fkks Fachverband Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> e.V.<br />
gestiftet.<br />
DER BESTE<br />
SCHUTZ FÜR<br />
EIN GANZES<br />
LEBEN<br />
Zugegeben, wir haben von der Natur abgeschaut …<br />
… um für Sie den besten Schutz zu schaffen!<br />
Besuchen Sie uns!<br />
8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
VeltinsArena Gelsenkirchen<br />
02. Juli 2014<br />
π DENSOLEN ®<br />
PE/Butyl-Bandsysteme<br />
π DENSOLID ®<br />
Polyurethanbeschichtungen<br />
π DENSO ®<br />
Petrolatum-Bänder & -Massen<br />
π DEKOTEC ®<br />
Schrumpfmanschetten<br />
DENSO ist seit 1922 als Erfinder und Pionier in den Bereichen passiver<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> für Rohrleitungen sowie innovativer Dichtmittel für den<br />
Straßen-, Gleis-, Ingenieur- und Kanalbau führend. DENSO steht für<br />
höchste Qualitätsstandards in Entwicklung, Produktion und Vertrieb –<br />
Made in Germany.<br />
Mehr unter:<br />
www.DENSO.de<br />
DENSO GmbH | Felderstraße 24 | 51344 Leverkusen | Germany<br />
+49 214 2602-0 | +49 214 2602-217 | sales@denso.de<br />
Der „geehrte“ Dr. Hanns-Georg Schöneich (Mitte), Dr.<br />
Markus Büchler (links) und Prof. Bernd Isecke (rechts)<br />
Mitglied bei:<br />
Zertifiziert:<br />
Zertifiziert<br />
DIN EN ISO 9001<br />
06 | 2014
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
Der neue gewählte Vorstand: 1. Vorsitzender<br />
Professor Dr.-Ing. Bernd Isecke (links) und<br />
2. Vorsitzender Dipl.-Ing. Jürgen Barthel (rechts)<br />
Jahreshauptversammlung und fkks infotag 2014<br />
Die Jahreshauptversammlung 2014, die ebenfalls am<br />
Tagungsort Weimar stattfand und an dem der fkks sein<br />
50-jähriges Bestehen feierte, fand am 21. Mai 2014 im<br />
Hotel Elephant statt. Auf der Jahreshauptversammlung<br />
wurden Professor Dr.-Ing. Bernd Isecke zum 1. Vorsitzenden<br />
und Dipl.-Ing. Jürgen Barthel zum 2. Vorsitzenden<br />
des fkks gewählt.<br />
Einen Tag später hielt man ebendort den fkks infotag<br />
2014 ab, der sich mit dem Thema Aus- und Weiterbildung<br />
auf dem Gebiet des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es<br />
intensiv befasste. Da es kein explizites Berufsbild für Fachkräfte<br />
im Bereich kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> gibt, ist<br />
es notwendig entsprechendes Personal im Anschluss an<br />
eine erfolgreiche erste Berufsausbildung gezielt weiter zu<br />
qualifizieren. Die Aufgabenstellungen und Anforderungen<br />
an solches Personal sind in verschiedenen nationalen<br />
und internationalen Regelwerken beschrieben. Der<br />
fkks Infotag gab einen hervorragenden Überblick über<br />
Anforderungen, Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten.<br />
Diesen Themen wird sich der<br />
fkks in Zukunft weiterhin ausführlich widmen.<br />
KONTAKT: fkks Fachverband Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> e.V.,<br />
Esslingen, Hans-Gerhard Köpf,<br />
Tel.: +49 (0)711 919 927 20,<br />
E-Mai: koepf@fkks.de, www.fkks.de<br />
GECO: neuer Vorstand und geschärfte Strategie<br />
„Wenn z.B. Transportleitungen, Betonbauwerke, Spundwände<br />
oder Kupferrohre korrodieren, ist nicht selten Biokorrosion<br />
im Spiel. In kommunalen und industriellen Bereichen sind<br />
Geruchsemissionen nicht selten unterschätzte Vorboten von<br />
bevorstehenden, kostspieligen Korrosionsproblemen.“ so<br />
Dr. rer. nat. Jan Küver, Leiter der Abt. Mikrobiologe an der<br />
Materialprüfungsanstalt Bremen, der seit Januar 2014 zum<br />
Vorstandes des GECO e.V. gewählt worden ist. Seit Mai 2014<br />
sind sowohl die Arbeitsstruktur, als auch die Arbeitsgruppen<br />
deutlicher an die Ziele des Fachverbandes angepasst. Derzeitig<br />
bereitet der Fachverband ein Projekt vor, das die Branchen<br />
Tiefbau, Haustechnik, Wasser, Abwasser und Biogas berührt.<br />
Dafür sind die Ergebnisse der GECO-Arbeitsgruppen notwendig.<br />
Interessenten aus Wirtschaft, Planung und Forschung<br />
bzw. anderen Fachverbänden sind eingeladen, sich darüber<br />
zu informieren und daran zu beteiligen.<br />
Mehr Informationen unter www.geco-dialog.de<br />
INFO<br />
Der Newsletter für<br />
die Rohrleitungsbranche<br />
Anmelden unter www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU<br />
10 06 | 2014
VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
FVST-Hochschultag auf der IFAT<br />
Im Rahmen der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-,<br />
Abfall- & Rohstoffwirtschaft IFAT 2014 hat der Fachverband<br />
Steinzeugindustrie e.V. (FVST) interessierte Studenten<br />
zu seinem Hochschultag – inzwischen eine traditionelle<br />
Offerte auf den großen Branchenmessen – eingeladen.<br />
Studentinnen und Studenten der Fachrichtungen „Bauingenieur-<br />
und Umweltingenieurwesen“, „Umwelttechnik“<br />
und/oder „Umweltmanagement“ mit den verschiedensten<br />
Vertiefungsrichtungen konnten sich im Rahmen eines<br />
umfassenden Vortragsangebotes und einem Informationsbesuch<br />
am Ausstellungsstand der Steinzeug-Keramo<br />
GmbH über nachhaltige und klimaneutrale Lösungen mit<br />
Steinzeugrohrsystemen informieren.<br />
Hochschulinitiative impliziert eine win-win-Situation<br />
Der Fachverband Steinzeugindustrie e.V. nimmt sich – trotz der<br />
vielen Verpflichtungen, die eine Messe mit sich bringt – seit<br />
vielen Jahren für den Nachwuchs die Zeit zur Informationsvermittlung.<br />
Die Verbindung von Vortrag und Standbesuch<br />
ist bei den Studierenden sehr willkommen, das Angebot zur<br />
Fragestellung, Diskussion und Gespräch mit den Fachleuten<br />
nehmen sie dankend in Anspruch. Erfreulicherweise nutzten<br />
in diesem Jahr mehr Studierende als je zuvor die Gelegenheit<br />
dazu: 250 Studentinnen und Studenten mit ihren Professoren<br />
aus 13 Hochschulen. Der Fachverband verbucht diese hohe<br />
Zahl und das echte Interesse der jungen Leute an einer modernen<br />
Abwassertechnik als sehr positiv.<br />
Ein Tag auf der IFAT ist für den Nachwuchs sehr beeindruckend<br />
– die Teilnahme am Hochschultag aber ganz besonders. Es hat<br />
allen wohl gut gefallen und jeder hat für sich etwas mitgenommen<br />
– die Studierenden, die Professoren, das Steinzeug-<br />
Keramo-Messeteam und natürlich der FVST.<br />
KONTAKT: Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Frechen<br />
www.fachverband-steinzeug.de<br />
06 | 2014 11
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
Mitgliederversammlung des rbv in Münster<br />
Foto: rbv<br />
Das neue und alte Präsidium sowie die Geschäftsführung des<br />
Rohrleitungsbauverbandes: Fritz Eckard Lang, Gudrun Lohr-Kapfer,<br />
Manfred Vogelbacher und Dieter Hesselmann (v.li.),<br />
Rund 140 Teilnehmer konnte rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw.<br />
Gudrun Lohr-Kapfer zur Mitgliederversammlung des Rohrleitungsbauverbandes<br />
am 4. April 2014 in Münster begrüßen.<br />
„Europa, wir kommen!“ – mit der von Lohr-Kapfer<br />
im Grußwort ausgegebenen Losung war ein wesentliches<br />
Thema bereits klar umrissen: Schon heute sind die Herausforderungen<br />
an den Verband immer häufiger europäisch<br />
geprägt – ein Trend, der sich noch verstärken wird. Auch<br />
die Energiewende, die Sicherstellung einer funktionierenden<br />
Infrastruktur vor dem Hintergrund mangelnder<br />
Bereitschaft zur Investition in die Leitungssysteme der<br />
Ver- und Entsorgung sowie demographischer Wandel<br />
und Fachkräftemangel sind Themen, die für Verband und<br />
Mitglieder langfristig eine wichtige Rolle spielen werden.<br />
Neben dem Bericht der Geschäftsführung und Berichten<br />
über die Tätigkeiten von Technischem Lenkungskreis und<br />
Foto: rbv<br />
Mit gezielten Aktionen wirbt der rbv um Nachwuchs für den Leitungsbau<br />
Ausschuss für Personalentwicklung standen unter anderem<br />
die Wahlen von Präsident und Vizepräsidenten auf der<br />
Tagesordnung; mit der Ehrung langjähriger Verbandsmitglieder<br />
und der Abstimmung über den Veranstaltungsort<br />
und -termin der Jahrestagung 2016 fand der offizielle Teil<br />
des Treffens seinen Abschluss.<br />
Personalentwicklung, Ausbildung und mehr<br />
In Form eines aktuellen Leitfadens mit dem Titel „Zukunft<br />
Leitungsbau – Auftrag Mensch“, der vom Ausschuss für<br />
Personalentwicklung (AfP) entwickelt wurde und sich dem<br />
Thema Fachkräftesicherung durch Personalentwicklung widmet<br />
geht der rbv offensiv mit dem Thema Ausbildung und<br />
Fachkräftemangel auf seine Mitglieder zu: „Wichtig ist, dass<br />
die Unternehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand<br />
nehmen“, ist rbv-Geschäftsführer Dipl.-Ing. Dieter Hesselmann<br />
überzeugt. „Und genau hierbei soll der Leitfaden für die<br />
nötigen Impulse sorgen.“ Neben allgemeinen Kapiteln über<br />
„Arbeitsmarkt und Leitungsbau im Wandel“, „Motivationen<br />
zum frühzeitigen Handeln“ oder „Ergänzung betrieblicher<br />
Strategien im Leitungsbau“ stellt die Broschüre „Handlungsoptionen<br />
für Betriebe im Leitungsbau“ und „Werkzeuge für<br />
eine lebensphasenorientierte Personalentwicklung“ vor. „Top-<br />
10-Handlungsempfehlungen“ sowie praktische Hinweise, Literaturtipps,<br />
Adressen und Ansprechpartner runden den Inhalt<br />
des Leitfadens ab.<br />
Darüber hinaus sind ein Infopoint „Ausbildung“ für Unternehmen<br />
und ein Flyer für potentielle Auszubildende zu nennen<br />
– ebenfalls Publikationen, die vom AfP erarbeitet wurden. „Mit<br />
dem Infopoint, der sich insbesondere mit den Ausbildungsrahmenbedingungen<br />
für die Betriebe im Rohrleitungsbau<br />
beschäftigt, gehen wir gezielt auf die Unternehmen zu“, so<br />
Hesselmann weiter. Während der<br />
Infopoint einen Anreiz zur Schaffung<br />
von Ausbildungsplätzen geben<br />
soll, ist der Flyer mit dem Slogan<br />
„Cool, eine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer“<br />
an Jugendliche gerichtet,<br />
die sich beruflich noch orientieren.<br />
Sie sollen Interesse für den<br />
Beruf des Rohrleitungsbauers entwickeln.<br />
Und das ist nicht einfach, da<br />
die Ausbildung im Rohrleitungsbau<br />
immer noch mit Imageproblemen zu<br />
kämpfen hat. „Zu Unrecht“, erklärt<br />
rbv-Geschäftsführer Hesselmann,<br />
„denn es handelt sich meist um<br />
hochtechnisierte Arbeitsabläufe;<br />
zudem sind die Verdienstchancen<br />
während der Ausbildung gut und<br />
die Beschäftigungsperspektive nach<br />
der Ausbildungszeit hervorragend.“<br />
Das macht auch der Imagefilm<br />
„Zukunft Leitungsbau – Berufe mit<br />
12 06 | 2014
ANZEIGE<br />
Wir sind ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen,<br />
das im Bereich kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> (KKS) tätig<br />
ist. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:<br />
Perspektive“ deutlich, mit dem sich der rbv ebenfalls direkt<br />
an den potentiellen Nachwuchs wendet.<br />
Die aktive und konsequente Aufarbeitung und Begleitung des<br />
Themenkomplexes „Nachwuchssicherung“ ist ein wichtiger<br />
Baustein im Engagement des Rohrleitungsbauverbandes, Technik<br />
und Wissenschaft im Rohrleitungsbau und bei Netzdienstleistungen<br />
in der Ver- und Entsorgungswirtschaft zu fördern.<br />
Die Arbeit des Berufsförderungswerks des Rohrleitungsbauverbandes<br />
(brbv) als AZWV-zertifizierter Bildungsträger und der<br />
rbv GmbH ist die Grundlage für die Mitarbeiterqualifikation<br />
in den Leitungsbauunternehmen. Das umfangreiche Angebot<br />
von brbv und rbv GmbH bietet fachlich-technische Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
auf hohem Niveau.<br />
Geselle im Bereich Elektrotechnik (m/w) oder<br />
Elektrotechniker oder Meister (m/w)<br />
Das Arbeitsfeld umfasst Messungen sowie Montagen an<br />
Rohrleitung und Tankanlagen.<br />
Wir erwarten eine erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung.<br />
Sie haben Freude am selbständigen Arbeiten, sowohl zum<br />
Einzeleinsatz als auch zur Teamarbeit.<br />
Haben wir Ihr Interesse geweckt?<br />
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!<br />
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angaben Ihres<br />
frühestmöglichen Eintrittstermins.<br />
Chiffre Nr. 01-<strong>3R</strong>-06/14<br />
Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 55, 45127 Essen<br />
Europa im Blick - Statement der rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer<br />
Die Rahmenbedingungen für die Arbeit des Rohrleitungsbauverbandes<br />
(rbv) sind in fortschreitendem Maße europäisch<br />
geprägt – das haben die letzten Monate deutlich gezeigt. Die<br />
Tendenz, Verordnungen, Normen und Regelwerke nicht mehr<br />
nur national, sondern international zu regeln, hat bereits heute<br />
erheblichen Einfluss auf die tägliche Arbeit von Mitgliedsunternehmen<br />
und Verband. Hinzu kommt: Die Zukunft wird nicht<br />
weniger Europa bringen, sondern mehr.<br />
Der Rohrleitungsbauverband registriert und analysiert diese<br />
Entwicklungen und macht sich im Schulterschluss mit Partnern<br />
auf Verbandsebene aktiv für die Belange seiner Mitglieder<br />
stark. Wir wollen unseren Mitgliedern nicht nur Schutz und<br />
Heimat in Deutschland bieten, sondern auch auf europäischer<br />
Ebene.<br />
Mit Blick auf den freien Warenverkehr und einen funktionierenden<br />
Europäischen Binnenmarkt begrüßt der Rohrleitungsbauverband<br />
die Harmonisierung internationaler Normen,<br />
weist aber auch auf die Gefahr des Bedeutungsverlustes von<br />
nationalen Regelwerken hin. Das nationale Regelwerk und<br />
damit der deutsche Standard dürfen nicht auf der Strecke<br />
bleiben, sondern müssen in die europäische Normung überführt<br />
werden.<br />
So befasst sich der Arbeitskreis Strategie des rbv nicht nur mit<br />
der Weiterentwicklung des Regelwerkes in Bezug auf Relevanz,<br />
Zertifizierung und Rechtsentwicklung, sondern schaut über<br />
den Tellerrand hinaus. Wie verändern sich Märkte, Auftraggeber<br />
und Infrastrukturen, wie entwickeln sich die Ressourcen,<br />
und welche Prognosen lassen sich aus den aktuellen Entwicklungen<br />
für den Verband und seine Mitglieder ableiten? Das<br />
sind die Fragen, denen wir uns jetzt stellen müssen.<br />
Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, die deutlich machen,<br />
wie Normung, Zertifizierung und Berufsbildung Auswirkungen<br />
auf das Tagesgeschäft im Leitungsbau haben, sind das sogenannte<br />
Frabo-Urteil sowie die Klage gegen die Bauprodukteliste<br />
des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Beide Fälle zeigen<br />
deutlich, dass die Europäische Kommission nicht gewillt ist,<br />
Handelshemmnisse zu akzeptieren. Auch in anderen wichtigen<br />
Sachthemen wird versucht,<br />
Einfluss auszuüben: Hierzu<br />
zählen die EU-Breitbandverordnung<br />
und die immer<br />
wieder diskutierte deutsche<br />
Meisterausbildung.<br />
Auch zu den für unsere<br />
Branche wichtigen<br />
Zukunftsthemen Klimawandel<br />
und Energiewende<br />
beziehen wir eine klare<br />
Position. Mit Blick auf die<br />
Versorgung von morgen spielen neben Gas und Strom auch<br />
die Fern- und Nahwärme sowie Gaskraftwerke mit Kraft-<br />
Wärme-Kopplung eine wichtige Rolle.<br />
Die von der Bundesregierung beschlossene Neuausrichtung<br />
berührt aber nicht nur die Frage nach der Art der zukünftigen<br />
Energieversorgung. Auch hinsichtlich der Akzeptanz bei<br />
Bürgerinnen und Bürgern sowie der Strategie der Umsetzung<br />
und der Schwerpunktsetzung in einem zukünftigen Energiemix<br />
sind Fragen offen. Insgesamt, so der Eindruck des rbv, ist die<br />
Komplexität des Gesamtprojektes offenbar unterschätzt worden.<br />
Unstrittig ist, dass die Umsetzung der Energiewende eine<br />
von zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben ist, denen sich der<br />
Leitungsbau in Zukunft stellen muss. Und die sind nur mit gut<br />
ausgebildeten Mitarbeitern zu lösen. Qualifizierten Nachwuchs<br />
zu finden und für den Leitungsbau zu gewinnen, ist vor dem<br />
Hintergrund des demografischen Wandels eine der größten<br />
Herausforderungen für die Unternehmen der Branche.<br />
Wir verstehen eine funktionsfähige und betriebssichere Infrastruktur<br />
als einen Vermögensgegenstand, dessen Erhalt und<br />
Pflege auf Nachhaltigkeit und Verantwortung für nachfolgende<br />
Generationen basiert. Den berechtigten Stolz auf und<br />
die Begeisterung für unsere Arbeit rund um alle Aspekte der<br />
Leitungsinfrastruktur gilt es jungen Menschen überzeugend<br />
zu vermitteln: Hierin sehen wir eine der wichtigsten Aufgaben<br />
unserer Verbandsarbeit.<br />
Foto:rbv<br />
06 | 2014 13
NACHRICHTEN PERSONALIEN<br />
DMT-Geschäftsfeldleiter erhält Honorarprofessur<br />
Univ.-Prof. Dr. Wilfried Eichlseder (l.), Prof. Dr. Bodo Lehmann<br />
bei der Verleihung der Honorarprofessur<br />
Dr. Bodo Lehmann, Leiter der Geschäftsfeldes Exploration<br />
& Geosurvey der DMT GmbH & Co. KG, wurde an der<br />
Österreichischen Montanuniversität Leoben eine Honorarprofessur<br />
verliehen. Die feierliche Ehrung fand am 4. April<br />
2014 im Erzherzog Johann Auditorium der Universität statt.<br />
Bereits seit 1996 ist Lehmann Lehrbeauftragter an verschiedenen<br />
Universitäten, seit 2006 auch in Leoben. Als Privatdozent<br />
für Angewandte Geophysik an der Montanuniversität,<br />
wo Lehmann 2010 habilitierte, übernahm er in diesem Jahr<br />
auch die Pflichtvorlesung „Ingenieurgeophysik“.<br />
Lehmann kann auf eine mehr als 25-jährige Berufspraxis<br />
zurückgreifen. Auf Grund seiner bisherigen Forschungsund<br />
Berufserfahrung übernahm er 2009 die Leitung des<br />
Geschäftsfeldes Exploration & Geosurvey bei der DMT.<br />
Darüber hinaus ist er Geschäftsführer der tschechischen<br />
DMTGeosurvey spol. s r.o. und der DMT Petrologic GmbH<br />
in Hannover.<br />
Als Vorstandsmitglied der Deutschen Geophysikalischen<br />
Gesellschaft und als Mitglied zahlreicher internationaler<br />
Arbeitskreise ist es ihm von jeher ein Anliegen, geophysikalisches<br />
Wissen für die Rohstoff- und Baugrunderkundung<br />
zu erforschen, zu lehren und zur praktischen Anwendung<br />
zu bringen.<br />
Christof Ströter Business Director bei<br />
Seal for Life Industries<br />
„Seal for Life Industries“ ist das Unternehmen des Berry<br />
Plastics Konzerns, das sich im Kern mit dem Thema des<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>es befasst. Seit Juli 2012 sind unter<br />
diesem Dach namhafte Marken vereint: STOPAQ Viskoelastische<br />
Systeme, COVALENCE Schrumpfmanschetten,<br />
POLYKEN Butylkautschuk-Bandsysteme, POWERCRETE<br />
Flüssigbeschichtungen, ANODEFLEX Lineare Anodentechnik.<br />
Diese Produkte werden seit vielen Jahrzehnten zum<br />
Schutz vor Korrosion von metallischen Rohrleitungssystemen<br />
eingesetzt.<br />
Durch die Akquisition<br />
der STOPAQ BV<br />
im Juli 2012 erfolgte<br />
eine neue strategische<br />
Ausrichtung<br />
dieses speziellen<br />
Unternehmensbereiches<br />
innerhalb<br />
des Berry Plastics<br />
Konzerns.<br />
Ein Teil dieser strategischen<br />
Neuausrichtung<br />
ist der<br />
weitere Ausbau<br />
des Geschäftsfeldes<br />
auch in Europa und speziell in Deutschland. Hierfür<br />
konnte die Seal for Life Industries Christof Ströter<br />
gewinnen. Vor seinem Wechsel zu Seal for Life Industries<br />
war er bei der Denso GmbH mehr als sieben Jahre als<br />
Spartenleiter für den Geschäftsbereich <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
zuständig. „Die internationalen Branchenkenntnisse aus<br />
dieser Tätigkeit und seine entsprechende Erfahrungen aus<br />
dem Bereich der Armaturen für die Versorgungstechnik<br />
passen ideal zu unserer neuen Marktstrategie“, so Frits<br />
Doddema, Executive Vice President, Global GM & Managing<br />
Director, Seal For Life Industries. Christof Ströter<br />
wurden seit Januar 2014 als Business Director sowohl die<br />
Verantwortung für die Marke POLYKEN übertragen, als<br />
auch für weitere neue Produktbereiche. Daüber hinaus ist<br />
er auch noch als Schnittstellenkoordinator für Seal for Life<br />
Industries, speziell für den deutschsprachigen Raum tätig.<br />
Fragt man Christof Ströter nach dem Erfolgsweg, der langfristiges<br />
Wachstum ermöglicht, sagt er, dass „die Seal for<br />
Life Industries über den Tellerrand hinaus schaut, und<br />
dadurch neben den allgemeinen technischen Standards die<br />
wirklich innovativen Lösungen anbieten kann.“ Die Seal for<br />
Life Industries versteht sich dabei als Problemlöser für die<br />
Versorgungsunternehmen sowie den Rohrleitungsbau und<br />
kann hier aus dem vielfältigen Produktportfolio schöpfen.<br />
14 06 | 2014
PERSONALIEN NACHRICHTEN<br />
IKT-Förderverein Netzbetreiber:<br />
Neuer Mann an der Spitze<br />
Markerortungssystem mit<br />
integrierter Tiefenmessung<br />
GPS<br />
IKT-Geschäftsführer Roland W. Waniek, der neue Vorsitzende Hans-<br />
Joachim Bihs und sein direkter Vorgänger Joachim Schulte<br />
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Bihs ist der neue Vorsitzende des IKT-<br />
Fördervereins der Netzbetreiber e.V. Bihs ist Vorstand des Wirtschaftsbetriebs<br />
Hagen – WBH. Dem Förderverein gehören rund<br />
130 öffentliche Kanalnetzbetreiber aus ganz Deutschland und dem<br />
benachbarten Ausland an. Er hält zwei Drittel der Gesellschafteranteile<br />
an dem neutralen und unabhängigen Forschungs- und<br />
Prüfinstitut IKT gemeinnützige GmbH.<br />
Als Stellvertretender Vorsitzender des IKT-Fördervereins der Netzbetreiber<br />
e.V. wurde Dipl.-Ing. Jörg Henning Werker, Stadtentwässerungsbetriebe<br />
Köln, AöR, gewählt. Als Beisitzer wurden gewählt:<br />
Dipl.-Ing. Friedrich Jütting, Stadtentwässerung Göttingen; Dipl.-Ing.<br />
Thomas Lammering, Stadt Detmold; Dipl.-Ing. Christoph Ontyd, Gelsenwasser;<br />
Dr. Claus-Henning Rolfs, Stadtentwässerung Düsseldorf;<br />
Dipl.-Ing. Norbert Stratemeier, Emschergenossenschaft.<br />
vLocML2<br />
Modus zur gleichzeitigen<br />
Leitungs- und Markerortung<br />
Tiefenmessung von<br />
Leitungen und Markern<br />
Interner Datenspeicher<br />
für optionale GPS-Datenerfassung<br />
Mit großem Dank und lang anhaltendem Applaus wurde der langjährige<br />
Vorsitzende Dipl.-Ing. Joachim Schulte verabschiedet, der<br />
nach dem Ende seiner Dienstzeit als Geschäftsführer der Stadtentwässerung<br />
Schwerte GmbH in den Ruhestand getreten ist.<br />
Nach der Wahl fand eine gemeinsame Sitzung der beiden IKT-<br />
Fördervereine statt, dem Förderverein der Netzbetreiber und dem<br />
Förderverein der Wirtschaft. Prof. Dr.-Ing. Bert Bosseler und Dipl.-<br />
Ing. Serdar Ulutaş, MBA, erläuterten die laufenden Projekte in der<br />
IKT-Versuchshalle.<br />
Die Mitgliederlisten und weitere Informationen zu den beiden<br />
Fördervereinen sindzu finden unter: www.ikt.de/mitglieder<br />
SebaKMT<br />
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6<br />
96148 Baunach<br />
T +49 (0) 95 44 - 6 80<br />
F +49 (0) 95 44 - 22 73<br />
sales@sebakmt.com<br />
www.sebakmt.com<br />
06 | 2014 15
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Am 2. Juli 2014 veranstaltet die <strong>3R</strong> in Zusammenarbeit mit dem fkks Fachverband Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> e.V.<br />
bereits den „8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong>“, der auch in diesem Jahr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen stattfinden<br />
wird. Der Praxistag bietet allen Interessierten einen umfassenden und detaillierten Einblick in das Thema <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
und „versorgt“ die Branche einmal mehr mit spannenden Vorträgen von hochkarätigen Referenten. Dabei decken die<br />
Themen der Vorträge ein breites Spektrum rund um den <strong>Korrosionsschutz</strong> ab. Stets den state-of-the-art vor Augen, haben<br />
die Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, sich in produktiver und lockerer Atmosphäre auszutauschen oder bei einem<br />
der zahlreichen Aussteller auf dem Praxistag neue Produkte und Verfahren kennen zu lernen.<br />
Alles Wissenswerte über den Praxistag und Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Technik Jahrbuch <strong>Korrosionsschutz</strong> 2014<br />
Noch während der Vorbereitungen für den Praxistag stand<br />
für die Redaktion der <strong>3R</strong> und den gesamten Vulkan Verlag<br />
eine große Herausforderung an: der Umzug des Verlages<br />
an einen neuen Standort. Beim Ein- und Ausräumen der<br />
Redaktion wurde dabei so mancher längst in Vergessenheit<br />
geratener Schatz gehoben.<br />
Im Bereich des <strong>Korrosionsschutz</strong>es steht die <strong>3R</strong> seit über 50<br />
Jahren an der Seite der Branche und kann damit auf einen<br />
großen Erfahrungs- und Wissenspool zurückgreifen. Beim<br />
Stöbern im Archiv der Redaktion kamen so allein für das<br />
Themengebiet <strong>Korrosionsschutz</strong> über 300 Fachbeiträge ans<br />
Tageslicht; ein guter Grund mit einer ersten Rückschau zu<br />
beginnen. Daher liegt jetzt erstmalig das Technik Jahrbuch<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> in der <strong>3R</strong>-Editionsreihe vor.<br />
Portrait des Wissens<br />
Pünktlich zum Treffen der Branche auf dem 8. Praxistag<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> wurde eine Zusammenstellung wichtiger<br />
Schwerpunkte für den Leser vorbereitet. Zurückblickend auf<br />
die Fachbeiträge des letzten Jahres, wartet das Technik Jahrbuch<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> 2014 mit interessanten und hochaktuellen<br />
Themen rund um das Thema <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
im Rohrleitungsbau auf. Mit elf ausgewählten Fachartikeln<br />
und einem redaktionellen Marktspiegel zum Thema gibt<br />
dieses Buch im Format DIN A4 einen Überblick über Neu-<br />
Entwicklungen und Problemlösungen aus der Branche.<br />
Die unterschiedlichen Rubriken bestätigen die thematische<br />
Breite, die durch die Auswahl der Beiträge abgedeckt<br />
wird. Vom „aktiven <strong>Korrosionsschutz</strong>“ über den „passiven<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>“, die „Fernwirktechnik“, den „Schutz<br />
von Offshore-Anlagen“ und „Isolierflansche“ bis hin zur<br />
„Weiterbildung und Qualifikation“ spannt sich der Bogen<br />
Wenn Sie Interesse am oder Fragen zum Wissenspool aus<br />
50 Jahren <strong>Korrosionsschutz</strong> in <strong>3R</strong> haben, sprechen Sie uns<br />
gerne an: <strong>3R</strong>-redaktion@vulkan-verlag.de.<br />
Die Redaktion der <strong>3R</strong> wünscht Ihnen neue interessante<br />
Anregungen für Ihre Arbeit, viel Spaß auf dem 8. Praxistag<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> und einen besonderen praktischen Nutzen<br />
des Technik Jahrbuches <strong>Korrosionsschutz</strong> 2014.<br />
Das neue, aktuelle Kompendium<br />
zum Thema <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
16 06 | 2014
Vorträge, Referenten und Aussteller auf dem Praxistag<br />
Um sich schon mal auf den Praxistag einzustimmen, gibt es an<br />
dieser Stelle eine Übersicht der geplanten Vorträge und der<br />
ausstellenden Firmen, die in der Veltins-Arena dabei sein werden:<br />
»»<br />
Über die physikalisch-chemische Bedeutung des IR-freien<br />
Potentials und alternative Verfahren zum Nachweis der<br />
Wirksamkeit des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es<br />
Dr. M. Büchler, SGK Schweizerische Gesellschaft für <strong>Korrosionsschutz</strong>,<br />
Zürich<br />
»»<br />
Betrachtungen zum Risiko von Wasserstoffversprödung an<br />
Rohrleitungsstählen auf Grund von Kathodischem Überschutz<br />
Dr. H.-G. Schöneich, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
»»<br />
Smart KKS: Intelligente KKS-Schutzstromeinspeisung zum<br />
Schutz wechselspannungsbeeinflusster Rohrleitungen<br />
gegen Wechselstromkorrosion<br />
M. Wendling, M. Müller, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
»»<br />
Neue Technologien für die Überwachung, Steuerung und<br />
Wartung von Schutzanlagen und Messstellen beim KKS<br />
Th. Weilekes, Weilekes Elektronik GmbH, Gelsenkirchen<br />
»»<br />
Wechselstrombeeinflussung und deren Auswirkung auf die<br />
Planung und Ausführung von KKS-Anlagen am Beispiel der<br />
Südschiene Steiermark<br />
F. Mayrhofer, V&C Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Ges.m.b.H., Pressbaum (A)<br />
»»<br />
IFO-Messung vs. Intensivmessung<br />
T. Basten, M. Gemsa, Evonik Industries AG, Marl<br />
»»<br />
Qualitätssicherung im passiven <strong>Korrosionsschutz</strong> –<br />
der Coating Inspector<br />
H. Jansen, A. Graßmann, Open Grid Europe GmbH, Essen;<br />
Dr. Th. Löffler, Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co.<br />
KG, Herten-Westerholt<br />
»»<br />
Langzeiterfahrungen mit Nachumhüllungssystemen für<br />
Schweißnähte<br />
G. Friedel, Denso GmbH, Leverkusen<br />
»»<br />
Ein neues Umhüllungskonzept fur Mehrschichtumhüllungen<br />
von Stahlrohren,<br />
Dr. H.-J. Kocks, Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH,<br />
Siegen<br />
»»<br />
Einfluss von Flüssigböden zur Verfüllung von Rohrgräben<br />
auf den kathodischen Außenkorrosionsschutz von Stahlrohrleitungen,<br />
M. Houban, Westnetz GmbH, Dortmund<br />
» » Streustrombeeinflussung von Stahlrohrleitungen durch<br />
Gleichstrom-Nahverkehrsbahnen<br />
U. Bette, Technische Akademie Wuppertal (TAW)<br />
06 | 2014 17
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Sanierung, des grabenlosen Leitungsbaus, der Pipelinetechnik<br />
und des <strong>Korrosionsschutz</strong>es.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
25% ersten Bezugsjahr<br />
Rabatt im<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen und im ersten Bezugsjahr 25 % sparen.<br />
Bitte schicken Sie mir das Fachmagazin für zunächst ein Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 210,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 210,-<br />
als Heft + ePaper für € 297,-<br />
inkl. Versand (Deutschland) / € 301,- (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 105,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 105,-<br />
als Heft + ePaper für € 160,50 inkl. Versand<br />
(Deutschland) / € 164,50 (Ausland).<br />
Alle Preise sind Jahrespreise und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen<br />
vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug zu regulären Konditionen um ein Jahr.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden,<br />
dass ich vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Branchentreff Rohrvortrieb in Nürnberg<br />
Der TÜV Rheinland veranstaltete in Nürnberg den 9. Informations-<br />
und Erfahrungsaustausch zum Rohrvortrieb. Über 150<br />
Teilnehmer aus ganz Deutschland informierten sich über die<br />
neuesten Techniken und Erfahrungen im Rohrvortrieb und<br />
besuchten die begleitende Fachausstellung mit 30 Ausstellern.<br />
Der Obmann der Arbeitsgruppe ES 5.6 der DWA, Prof. Albert<br />
Hoch (TÜV Rheinland), verkündete zu Beginn der Veranstaltung,<br />
dass nach jahrelanger Arbeit nun Anfang März das<br />
Arbeitsblatt A 161 für den Rohrvortrieb im Weißdruck erschienen<br />
ist. Dr. Ulrich Bohle (Steinzeug-Keramo GmbH) informierte<br />
über die neuen Anforderungen bei Vortriebsrohren, die Gleisanlagen<br />
der Deutschen Bahn queren. Die Anpassung an die<br />
Eurocodes sieht hier eine Erhöhung der Lastspiele auf nun 10 8<br />
vor, was einen entscheidenden Einfluss auf die Dauerfestigkeit<br />
der Rohre hat. Die Übertragung der Berechnungsgrundlagen<br />
des A 161 auf das HDD-Verfahren stellte Horst Dillinger (TÜV<br />
Rheinland – LGA Bautechnik GmbH) dar, da diese Technik<br />
einige Besonderheiten gegenüber dem „normalen“ Vortrieb<br />
aufweist. Ein besonderes Augenmerk ist u. a. auf die zulässigen<br />
Einzugskräfte zu richten, die durch Spannungen aus<br />
der vorgekrümmten Trasse überlagert werden. Auch ist der<br />
dauerhafte Flüssigkeitsdruck der Bohrspülung (zeitabhängig)<br />
als kritische Einwirkung auf PE-Rohre zu sehen. Über die<br />
neuesten Informationen zur Berechnung der hydraulischen<br />
Fuge berichtete Dr. Stefan Trümpi-Althaus (Jackcontrol AG)<br />
aus der Schweiz. Er stellte ein ganzheitliches System von der<br />
Krafteinleitung, über die Rohrfügung bis zum Nachweis des<br />
gesamten Rohres/Vortriebs vor, das bereits über 38 km Erfahrungswerte<br />
aufweist. Die Verteilung der Kräfte gegenüber<br />
einem klassischen Holz-Druckübertragungsring ist bei dem<br />
flüssigkeitsgefüllten Schlauch wesentlich besser.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung war die Qualitätssicherung<br />
bei Vortriebsbaustellen. Christian Röhrig (VMT<br />
GmbH) stellte ein Navigations-, Monitoring- und Datenmanagementsystem<br />
vor, das eine Vortriebsmaßnahme vollständig<br />
begleitet und dokumentiert. In seinem Vortrag über die<br />
Herstellung und den Rückbau von Start- und Zielbaugruben<br />
ging Stephan Tolkmitt (Güteschutz Kanalbau) vor allem auf<br />
die sicherheitstechnischen Aspekte ein, die beachtet werden<br />
müssen. Insbesondere die Ausführung der Widerlager und das<br />
Verhindern des Eindringens von Bodenmaterial bzw. Stützflüssigkeit<br />
wurden veranschaulicht.<br />
Patrick Himmel (Himmel & Hennig Bauunternehmungen<br />
GmbH) berichtete über die Grundlagen für die Vortriebspraxis<br />
mit seiner Vorstellung des Tübbing-Vortriebes als Alternative<br />
zum „klassischen“ Vortrieb. Durch den Einbau von siebenteiligen,<br />
vorgefertigten Tübbingen aus Stahlfaserbeton kann in<br />
einem kurzen Zeitraum ein setzungsfreier Stollen vorgetrieben<br />
werden, der nach Einbau der Produktenrohre wieder verfüllt<br />
wird. Sollten Rohrvortriebe in setzungsempfindlichen Geologien<br />
geplant werden, so ist der Einsatz eines Mixschildes nach<br />
Meinung von Gunnar Biesenbach (Herrenknecht AG) die beste<br />
Alternative. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch eine exakte<br />
geologische Vorerkundung – nur dann können die Vorteile der<br />
Trennung von Spülkreislauf und Stützdruckregelung zu einer<br />
Minimierung der Druckschwankungen führen. Angel Corona-<br />
Guzman (Stadtwerke Ansbach)referierte über die Planungen,<br />
die Ausschreibung und auch die Ausführung eines größeren<br />
Rohrvortriebs in der Stadt Ansbach. Bei diesem Projekt waren<br />
StB-Rohre DN 2500 über eine Länge von ca. 600 m und einer<br />
S-Kurve voranzutreiben.<br />
Einen Ausblick gab abschließend noch Dr. Robert Stein (S & P<br />
Consult GmbH), der zukünftige Einsatzgebiete des Rohrvortriebs<br />
skizzierte. Mit den Schlagworten „PowerTubes“ und<br />
„CargoCap“ wurden zwei Möglichkeiten dargestellt, Strom<br />
bzw. Waren unterirdisch zu transportieren. Ob diese Vision<br />
jemals Realität wird ist noch nicht absehbar – im Zeitalter<br />
immer dichter belasteter Verkehrswege könnte sich hier eine<br />
Alternative ergeben.<br />
Aufgrund der positiven Resonanz plant Veranstalter TÜV<br />
Rheinland auch im kommenden Jahr eine Neuauflage des<br />
Branchentreffs. Der 10. Informations- und Erfahrungsaustausch<br />
zum Rohrvortrieb wird dann am 19. März 2015 in<br />
Nürnberg stattfinden.<br />
06 | 2014 19
INTERVIEW<br />
9. Symposium grabenloser Leitungsbau<br />
und 10. Hands on days<br />
Theorie und Praxis trifft sich in Lennestadt<br />
Über die vielen technischen Vorteile des grabenlosen Verfahrens bei Sanierung und Leitungserneuerung berichtet <strong>3R</strong><br />
regelmäßig. Wie aber sieht der große Trend in Sachen grabenloser Leitungsbau aus? Auf welchem Abschnitt des Weges<br />
befindet sich die Branche rund um das kostengünstige Verfahren? <strong>3R</strong> sprach darüber mit Univ.-Prof. Dr.-Ing. Horst<br />
Görg von der Universität Siegen, Dep. Bauingenieurwesen und Günter Naujoks, Geschäftsführer der Profundis Presse<br />
Media Service GmbH. Beide engagieren sich seit Jahren für das „Symposium grabenloser Leitungsbau“ zusammen mit<br />
den ideellen Partnern DVGW, RSV, GSTT, <strong>3R</strong>, BWK und dem Güteschutz Kanalbau. Die Tracto-Technik ist Mitinitiator<br />
und Sponsor der Veranstaltung, die durch die Ingenieurkammer-Bau NRW als „Seminar gem. §3 Abs. 2 der Fort- und<br />
Weiterbildungsordnung“ anerkannt wird.<br />
<strong>3R</strong>: Herr Prof. Görg, Sie veranstalten seit vielen Jahren<br />
das Symposium für grabenlose Leitungserneuerung SgL.<br />
Wie sieht die Zukunft der grabenlosen Verfahren und die<br />
Zukunft des SgL-Symposiums aus?<br />
Prof. Horst Görg: Erst einmal vielen Dank an <strong>3R</strong> für die<br />
spannenden Berichte rund ums Rohr mit der hohen Aktualität.<br />
Liest man die letzten Ausgaben Ihrer Zeitschrift sieht<br />
man die aktuellen Trends der Branche. Ich denke, dass es<br />
um die Zukunft des Leitungsbaus und im Speziellen der der<br />
grabenlosen Verfahren gut bestellt ist.<br />
<strong>3R</strong>: Können Sie das konkretisieren.<br />
Prof. Horst Görg: In vielen Bereichen haben die Diskussionen<br />
der letzten Jahre für Unsicherheit der Betroffenen<br />
geführt. Nehmen Sie das leidige Thema um die Dichtheitsprüfung,<br />
die aufgrund der politischen Entscheidungen in<br />
NRW für viel Unmut unter den Fachleuten gesorgt hat. Prinzipiell<br />
gilt ähnliches im Energiesektor, wenn über die großen<br />
Stromautobahnen für „grünen“ Strom diskutiert wird. Leidtragender<br />
ist zwangsläufig auch die Leitungsbaubranche.<br />
Die Techniken, die der Leitungsbau zu bieten hat sind sehr<br />
gut, ob es nun um die Medien Abwasser, Trinkwasser, Erdgas<br />
oder Strom geht. Besonders die grabenlosen Verfahren,<br />
die mit ihren besonderen Vorteilen aufwarten, gilt es in den<br />
Vordergrund zu stellen. Hohe Bürgerfreundlichkeit durch<br />
kleine Baustellen, nachhaltiger Umweltschutz durch sehr<br />
geringe Emissionen und eine häufig höhere Wirtschaftlichkeit<br />
sind herausragende Argumente für die Anwendung<br />
grabenloser Bauweisen.<br />
<strong>3R</strong>: Dennoch scheint es weiteren Gesprächsbedarf<br />
hinsichtlich neuer Verfahren zu geben?<br />
Prof. Horst Görg: Das ist richtig. Verglichen mit der traditionellen<br />
offenen Bauweise, sind grabenlose Verfahren äußerst<br />
komplex. Zwar haben sich grabenlose Verfahren seit Jahren<br />
etabliert, doch sind für deren sachgerechte Durchführung<br />
gut ausgebildetes Personal und hohes Ingenieur-Know-<br />
How erforderlich - für uns als Hochschule gute Gründe,<br />
den Fachleuten der Praxis eine Weiterbildung anzubieten.<br />
<strong>3R</strong>: Wie ist das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in<br />
der Weiterbildung?<br />
Tracto Technik GmbH<br />
Prof. Horst Görg: Ohne Praxis geht gar nichts, weder in<br />
der Aus- noch in der Weiterbildung. Diese These war seit<br />
jeher Grundidee des SgL-Konzeptes. Zwar muss der Planer<br />
genauso wie der Anwender die Theorie kennen, doch führen<br />
fehlende praktische Fachkenntnisse allerdings zwangsläufig<br />
zu Fehlern. Hier wollen wir mit dem Sgl ansetzen, um<br />
eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Bei<br />
früheren SgL-Symposien haben wir sehr gute Erfahrungen<br />
mit Muster-Baustellen gemacht, die von den Teilnehmern<br />
immer rege angenommen wurden.<br />
20 06 | 2014
INTERVIEW<br />
<strong>3R</strong>: Welche Schwerpunkte behandelt das SgL im Jahr 2014<br />
und welche Besonderheiten sind geplant?<br />
Prof. Horst Görg: Um die Praxis einzubinden geht SgL<br />
2014 on-tour, d.h. wir gehen diesmal raus aus der Hochschule<br />
und rein in die Praxis. Am 22.09.2014 richten wir das<br />
nunmehr 9. SgL als SgL-On-tour in Lennestadt, ca. 60 km<br />
von Siegen, aus. Wir werden morgens einen Vortragsteil<br />
und nachmittags einen Praxisteil anbieten.<br />
<strong>3R</strong>: Welcher Mehrwert ergibt sich durch diesen Ablauf für<br />
die Teilnehmer?<br />
Prof. Horst Görg: Durch diesen Ablauf können wir den<br />
Teilnehmern ein breites Spektrum vom Spezialwissen bis<br />
hin zu praktischen Anwendungstipps geben. Für die fundierten<br />
Vorträge zu aktuellen Themen haben wir kompetente<br />
Referenten gewinnen können. Der Veranstaltungsort<br />
„Sauerland-Pyramiden“ liefert sicherlich einen geeigneten<br />
Rahmen für ein attraktives und kurzweiliges Programm.<br />
Zwischen den interessanten Vorträgen können die Teilnehmer<br />
unterschiedliche Show-Pyramiden besuchen und<br />
sich zu verschiedenen Technikthemen – auch rund um das<br />
grabenlose Bauen - als Rahmenprogramm informieren.<br />
<strong>3R</strong>: Inwiefern stellt das einen besonderen Ansatz aus der<br />
Praxis dar?<br />
Prof. Horst Görg: Hier kommt die Firma Tracto-Technik aus<br />
Lennestadt ins Spiel. Durch die Wahl des Veranstaltungsortes<br />
können wir an den „Hands on days“ des Unternehmens<br />
partizipieren, die vom 16. bis zum 23. September stattfinden.<br />
Eine große Fachmesse mit führenden Firmen aus der<br />
Leitungsbaubranche wird den Teilnehmern das für die Praxis<br />
notwendige Rüstzeug mit auf den Weg geben. Dazu gehören<br />
auch Maschinenvorführungen auf dem Testgelände, so<br />
dass wir dieses Mal nicht eine Musterbaustelle sondern vier<br />
bis fünf verschiedene haben werden. Vom Großbohrgerät<br />
über die Berstmaschine, bis hin zur Erdrakete ist alles für die<br />
Verlegung und Erneuerung von Leitungen dabei.<br />
<strong>3R</strong>: Herr Naujoks, Sie sind für die Organisation und<br />
Durchführung der „Hands on Days“ verantwortlich. Wie<br />
muss man sich die „Hands on Days“ vorstellen?<br />
Günter Naujoks: Die „Hands on Days“ oder zu deutsch<br />
„Vorführtage“ werden bereits zum 10. Mal durchgeführt.<br />
Sie haben sich bewährt, um unseren Besuchern in geballter<br />
Form die grabenlosen Techniken für Verlegung und<br />
Erneuerung im praktischen Einsatz zu zeigen und näher zu<br />
bringen. In der begleitenden umfangreichen Fachausstellung<br />
und in den ergänzenden Fachvorträgen wird zusätzlich das<br />
komplette System an Techniken, Verfahren und Produkten<br />
vorgestellt, das insgesamt für die grabenlose Verlegung und<br />
Erneuerung von Leitungen erforderlich ist. Die Palette reicht<br />
Messen und Tagungen<br />
8. Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
02.07.2014 in Gelsenkirchen;<br />
b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
DIAM Deutsche Industriearmaturen Messe<br />
17./18.09.2014 in München; info@diam.de,<br />
www.diam.de<br />
Kraftwerke 2014<br />
17./18.09.2014 in Hamburg; marthe.molz@vgb.org,<br />
www.vgb-org.de<br />
wat 2014<br />
29./30.09.2014 in Karlsruhe; www.wat-dvgw.de<br />
gat 2014<br />
29.09.-01.10.2014 in Karlsruhe; www.gat-dvgw.de<br />
2. Deutscher Kanalnetzbewirtschaftungstag<br />
01.10.2014 in Geisingen; info@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
4. Praxistag Wasserversorgungsnetze<br />
05.11.2014 in Rheine<br />
dabei von ungesteuerten und gesteuerten Bohrtechniken<br />
bis hin zum Saugbagger und Kabelpflug.<br />
<strong>3R</strong>: Was erhoffen Sie sich durch die gemeinsame<br />
Veranstaltung? Wie passen die „Hands on Days“ zum SgL?<br />
Günter Naujoks: Durch die Verbindung beider Veranstaltungen<br />
miteinander können wir den Besuchern den<br />
vollen Überblick bieten, der sich eben aus Theorie und<br />
Praxis zusammensetzt. Das Thema grabenloser Leitungsbau<br />
wird im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung der „Hands<br />
on Days“ und des SgL das in diesem Jahr mit ihrer „On-<br />
Tour-Veranstaltung“ in Lennestadt Station macht, in seiner<br />
Bedeutung aufgewertet und einem breiten Publikum<br />
bekannt gemacht. Dass sich bei solchen Veranstaltungen<br />
auch neue Ideen und Kontakte ergeben ist sozusagen das<br />
i-Tüpfelchen auf einem ansonsten informativen und erlebnisreichen<br />
Tag.<br />
Weitere Information zur Veranstaltung sind zu erhalten<br />
unter: krueger@bauwesen.uni-siegen.de.<br />
06 | 2014 21
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Abrasionsresistente Emails –<br />
technische Lösungen in der Förderund<br />
Prozesstechnik<br />
Bei der Förderung pulverförmiger, granulierter oder feststoffhaltiger Medien können je nach Betriebsbedingungen extreme<br />
Verschleißraten auftreten. Düker bietet mit den Emailqualitäten emailABR60 und emailABR80 zwei erprobte Emails mit<br />
hohen Abrasionsbeständigkeiten zur Verschleißreduzierung in entsprechenden Rohrsystemen an.<br />
Foto: Tretbar, Asse GmbH<br />
Technisches Email<br />
Technisches Email ist in der Chemie- und Pharmaindustrie<br />
seit langem als Standard-Oberflächenwerkstoff etabliert. Mit<br />
seinem breiten Funktionsprofil ist technisches Email prädestiniert<br />
für den Einsatz in vielen Bereichen der Technik. Je nach<br />
Anforderungsprofil lässt es sich auf unterschiedlichste Einsatzbereiche<br />
hin optimieren. Ob nun in der Trinkwasserversorgung,<br />
in der Wirkstoffchemie, ob in der Abwasserbehandlung, in der<br />
Pharmazie unter GMP-Bedingungen oder mit Hygienic-Design-<br />
Vorgaben – vielfältige Anforderungen mit unterschiedlichen<br />
Schwerpunkten werden durch die Verbindung der Strukturwerkstoffe<br />
mit den oberflächenbestimmenden Emailqualitäten<br />
erfüllt.<br />
Rohre, Fittings, Kolonnen, Behälter und Reaktoren sowie<br />
Wärmetauscher werden typischerweise in hochsäurefest<br />
emaillierter Qualität<br />
hergestellt und eingesetzt.<br />
Die werkstofftypischen<br />
Eigenschaften<br />
der Emaillierung sind<br />
bekannt. Unterstützt<br />
werden sie durch<br />
angepasste konstruktive<br />
Gestaltungen, die<br />
die positiven Eigenschaften<br />
möglichst<br />
unterstützen, bestehende<br />
Einschränkungen<br />
nach Möglichkeit<br />
ausschließen.<br />
Bild 1: Innenansicht des Bogens nach längerer<br />
Betriebszeit unter abrasiver Belastung. Der<br />
Innenradius des Bogens ist mit Resten des<br />
Mediums belegt, der Außenradius weist die<br />
typischen welligen Verschleißspuren auf<br />
Nur in Einzelfällen<br />
werden bisher die<br />
verschleißreduzierenden<br />
Eigenschaften<br />
des Werkstoffsystems<br />
Stahl-Email genutzt.<br />
In den vergangenen<br />
Jahren wurde jedoch<br />
von Kundenseite<br />
zunehmend häufiger<br />
Anfragen zur Verschleißfestigkeit<br />
von Technischem Email gestellt. Hintergrund<br />
sind und waren in der Regel Probleme der Kunden mit hohen<br />
Verschleißschäden in unterschiedlichsten Anlagen und bei<br />
verschiedenen Produktionsverfahren. Insbesondere bei der<br />
Förderung feststoff- bzw. partikelhaltiger Medien erfüllen die<br />
eingesetzten Werkstoffe – Kohlenstoff- und Chrom-Nickel-<br />
Stähle, glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK, gummiausgekleidete<br />
Systeme – häufig die Erwartungen der Betreiber nicht.<br />
Die Folgen der hohen Verschleißraten sind Anlagenausfälle,<br />
Reparaturen und Austausch von Leitungskomponenten, verbunden<br />
mit entsprechend hohem technischen Aufwand und<br />
wirtschaftlichen Schaden.<br />
Verschleiß, Abrasion<br />
Verschleiß ist definiert als fortschreitender Materialverlust<br />
der Oberfläche eines festen Körpers, hervorgerufen durch<br />
mechanische Ursachen, d.h. Kontakt und Relativbewegung<br />
eines festen, flüssigen oder gasförmigen Gegenkörpers. Er<br />
äußert sich im Auftreten von losgelösten kleinen Teilchen<br />
(Verschleißpartikeln) sowie in Stoff- und Formänderungen der<br />
tribologisch beanspruchten Oberfläche [DIN 50 320, zurückgezogen:<br />
Verschleiß, Begriffe, Systemanalyse von Verschleißvorgängen,<br />
Gliederung des Verschleißgebietes].<br />
Technische Systeme, in denen Reibungs- und Verschleißprozesse<br />
ablaufen, werden als Tribosysteme bezeichnet. Sie sind<br />
durch Grund- und Gegenkörper, Zwischenstoff und Umgebungsmedium<br />
bestimmt. Bei Auskleidungen in der mechanischen<br />
Förder-, Aufbereitungs- und Prozesstechnik liegen fast<br />
immer sogenannte offene Tribosysteme vor. Nur der Grundkörper<br />
kann hier konstruktiv, verfahrens- und werkstofftechnisch<br />
an seine Funktionsumgebung angepasst werden. Als<br />
Gegenkörper wirkt das Prozessmedium.<br />
Die beim Verschleißvorgang ablaufenden physikalischen und<br />
chemischen Prozesse werden als Verschleißmechanismen<br />
bezeichnet: Adhäsion, Abrasion, Oberflächenzerrüttung und<br />
tribochemische Reaktion.<br />
Der Verschleißmechanismus Abrasion wird durch die Beanspruchung<br />
eines Grundkörpers, z.B. eines Rohres, durch im<br />
Medium mitgeführte Partikel durch sogenanntes Mikropflügen<br />
und Mikrospanen hervorgerufen. In die Oberfläche von Bau-<br />
22 06 | 2014
PRODUKTE & VERFAHREN FACHBERICHT<br />
Bild 2: ABR80, Abrasionsresitentes Email mit extremer Härte<br />
Bild 3: ABR60, Abrasionsresistentes Email mit hoher<br />
Korrosionsbeständigkeit<br />
teilen werden durch die strömenden Partikel Kratzer, Riefen,<br />
Mulden und Wellen eingebracht – es kommt im Laufe der Zeit<br />
zu kontinuierlichem Materialabtrag.<br />
Abrasionsresistente Emails<br />
Für die hochabrasiv wirkende Förderung von Stäuben, Schlämmen<br />
und verschiedenen Betonqualitäten sowie anderer Festkörper<br />
hat Düker spezielle Emails zur Auskleidung von Rohrsystemen<br />
entwickelt. Diese neuentwickelten Emails wurden<br />
anlässlich der Messe ACHEMA 2012 in Frankfurt vorgestellt.<br />
Im Laufe der Entwicklung wurden in enger Zusammenarbeit<br />
mit potentiellen Kunden und Institutionen die Anforderungen<br />
an diese Emailqualitäten festgelegt. So sollten beispielsweise<br />
die unterschiedlichen abrasionsresistenten Emails auf<br />
der einen Seite gegen rein mechanisch wirkenden Verschleiß<br />
(ohne wesentlichen Einfluss chemischen Angriffs) und auf der<br />
anderen Seite gegen die kombinierte Belastung mechanisch/<br />
chemisch wirksam sein.<br />
Düker bietet seinen Kunden, quasi aus dem Baukasten, speziell<br />
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Emails – ob der Schwerpunkt<br />
nun im Bereich der chemischen oder der Abrasionsresistenz<br />
liegt, oder ob beide Aspekte gleichermaßen wichtig sind:<br />
»»<br />
Düker-Emails sind in verschiedenen Härten und daraus<br />
resultierend mit verschiedenen Abrasisonswiderständen<br />
lieferbar<br />
»»<br />
Die abrasionsresistenten Emails liegen je nach Einstellung<br />
der Eigenschaften zwischen 6 Mohs (email ABR60) und 8<br />
Mohs (email ABR80)<br />
»»<br />
Zum Vergleich: die Mohs-Skala wird durch Diamant mit<br />
Härte 10 begrenzt, die Härte handelsüblicher Emails liegt<br />
bei 4 Mohs, die von email 800 bei 5 Mohs.<br />
»»<br />
Email 800 weist die bekannt hohe chemische Resistenz<br />
auf (hochsäurefest)<br />
»»<br />
Alle auf Basis des Email 800 entwickelten abrasionsresistenten<br />
Emails haben einen verhältnismäßig hohen Korrosionswiderstand<br />
(chemische Resistenz) und sind porenfrei<br />
»»<br />
Die auf extreme Härte getrimmten Emails sind nicht porenfrei,<br />
chemische Resistenz wird hier nicht gefordert, sondern<br />
der Fokus liegt auf dem sehr hohen Abrasionswiderstand<br />
»»<br />
Die Schichtdicken aller Emailqualitäten sind einstellbar<br />
In einem ersten Anwendungsfall wurde bei ASSE-GmbH das<br />
hochharte Email mit einer Härte von 8 Mohs gegen vorherrschend<br />
mechanisch/abrasiven Verschleiß eingesetzt. Ein konventioneller<br />
Rohrbogen DN150/90°, Baulänge 500 mm, aus<br />
Spezialstahl (gehärtet, aufgepanzert) zur Förderung von Komponenten<br />
zur Herstellung von Sorelzement mit einer typischen<br />
Lebensdauer von 1000 t Förderleistung wurde durch einen<br />
emaillierten Bogen gleicher Geometrie ersetzt. Das Ergebnis<br />
ist nach nunmehr etwa dreijähriger Erfahrung durchgängig<br />
positiv. Nach längerer Betriebszeit, Ausbau und Untersuchung<br />
(Bild 1), dieses Bogens kann hier von einer etwa zehnfachen<br />
Lebensdauer ausgegangen werden.<br />
FRANZ-J. BEHLER<br />
Düker GmbH & Co. KGaA<br />
Tel.: +49 6093 87 261<br />
E-Mail: mrk@dueker.de<br />
AUTOR<br />
06 | 2014 23
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Grabenlose Close-fit Installationen<br />
in PE 100-RC-Qualität<br />
Das Compact Pipe ® System hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als grabenloses Close-fit-Verfahren für die Installation von<br />
Gas-, Trinkwasser- und Kanalrohren weltweit etabliert. Jetzt aktualisiert die Wavin GmbH das Lieferprogramm für Compact<br />
Pipe ® Rohre durch die Verwendung von PE 100-RC (Resistant to Crack) Werkstoffen. Die Produkteinführung auf der IFAT 2014<br />
stieß bereits auf großes, internationales Interesse. Compact Pipe ® erfüllt die Spannungsrissprüfung gemäß PAS 1075 und ist<br />
vom DIN Certco nach der Prüfgrundlage ZP 14.23.39 zertifiziert.<br />
Möglichkeiten für neue Bemessungsgrundlagen<br />
Bisher wurden Compact Pipe ® Druckrohre aus PE 100 Materialien<br />
gefertigt. Immer mehr Anfragen gab es jedoch, ob<br />
Compact Pipe ® auch aus noch höherwertigen PE 100-RC<br />
Werkstoffen zu fertigen wäre. Denn PE 100-RC Werkstoffe<br />
zeichnen sich im Vergleich durch einen bis zu zehnfach höheren<br />
Widerstand gegen Rissfortplanzung (SCG- Slow crack<br />
growth) aus und überstehen dadurch auch langfristig härteste<br />
Bettungsverhältnisse mit Punktbelastungen [1].<br />
Compact Pipe ® Druckrohre werden werkseitig vorverformt<br />
(M-Stage), als Trommelware geliefert und C-förmig (Bild 2)<br />
in vorhandene Stahl-, Guss-, ZM oder STB Rohrleitungen eingezogen.<br />
Durch eine Temperaturbeaufschlagung wird der<br />
C-Querschnitt in ein kreisrundes Rohr rückverformt (I-Stage).<br />
Das schadhafte Altrohr fungiert dabei als Schalung.<br />
Close-fit, eng anliegend, ist das Compact Pipe ® im Altrohr<br />
anschießend eingebettet und bietet Qualitäten und Betriebssicherheiten<br />
wie ein erdverlegtes PE 100 Standardrohr. Außerhalb<br />
des Altrohres freiliegende End- und Zwischenbereiche mit<br />
Längsverbindungen / Hausanschlüssen werden eingesandet.<br />
Korrodieren oder brechen die schadhaften Altrohre, so können<br />
sich die Bettungsverhältnisse durch Setzungen, Grundwasser<br />
und Verkehrsbelastungen verändern. Drucklose PE Rohre<br />
reagieren auf diese Belastungen als biegeweiche, thermoplastische<br />
Kunststoffe durch Verformungen, ohne dass sie Schaden<br />
nehmen. Der Gewölbeeffekt hat zur Folge, dass langzeitig<br />
betrachtet, Spannungen bzw. Dehnungen in der Rohrwandung<br />
bei konstanter Belastung relaxieren können (Abbau<br />
der Spannungen). Druckrohre sind durch den permanenten<br />
Innendruck nicht in der Lage zu deformieren, dadurch sind<br />
diese Rohre empfindlicher für Spannungsrisse.<br />
Nachweise für Betriebssicherheiten von 100 Jahren<br />
Für diese erhöhten Belastungen ist durch 2NCT-Prüfungen<br />
bei der Hessel Ingenieurtechnik nachgewiesen, dass die neu<br />
auf der IFAT vorgestellten Compact Pipe PE 100-RC Rohre<br />
die Spannungsrissprüfung der PAS 1075 erfüllen. Die zertifizierten<br />
PE 100-RC Werkstoffe sind für eine Lebensdauer von<br />
mindestens 100 Jahren bei 20 °C ausgelegt.<br />
Diese zusätzlichen Anforderungen und dafür notwendige<br />
Qualitäten sind erstmalig in der PAS 1075 beschrieben [2].<br />
Diese PAS (Publicly Available Specification – Öffentlich verfügbare<br />
Spezifikation) ist seit 2009 über den Beuth-Verlag<br />
erhältlich. Die PAS 1075 trägt den Titel „Rohre aus Polyethylen<br />
für alternative Verlegetechniken – Abmessungen, technischen<br />
Anforderungen und Prüfungen“.<br />
Die neuen Compact Pipe ® PE 100-RC Rohre werden als Vollwandrohre<br />
in den Farben orangegelb (für Gas) und königsblau<br />
(für Trinkwasser) angeboten. Äußere Beschädigungen und<br />
langfristig wirkende Punktbelastungen werden durch das RC<br />
Bild 1: Verfahrensprinzip Bild 2: Compact Pipe ® PE 100-RC Bild 3: Compact Pipe ® PE 100-RC Rohre<br />
24 06 | 2014
PRODUKTE & VERFAHREN FACHBERICHT<br />
Rohr aufgenommen. Compact Pipe ® PE 100-RC kann daher<br />
unabhängig vom Zustand des Altrohres und unabhängig von<br />
Baugrubenverfüllungen mit sandbettfreiem Aushubmaterial<br />
verwendet werden.<br />
Nachweise der Hessel Ingenieurtechnik an<br />
installierten (I-stage) Compact Pipe ® Rohren<br />
Die grundsätzliche Eignung von PE 100-RC Material für PE Verformungsverfahren<br />
war fraglich. Seit 1990 reagiert die Wavin<br />
GmbH mit unterschiedlichen PE 80 und PE 100 Materialien<br />
auf weltweite Anfragen für das Produkt Compact Pipe. Doch<br />
wie würde das hochmoderne PE 100-RC auf Stauchungs- und<br />
Dehnungsbereiche im Querschnitt reagieren? Welche Beeinflussungen<br />
würden sich bei der Installation bemerkbar machen?<br />
Wie gut ist das Close-fit installierte PE 100-RC Rohr wirklich?<br />
Nach der auf die Materialien abgestimmten Produktion, wurden<br />
Compact Pipe ® PE 100-RC Rohre als Trommelware in<br />
vier Strecken a 50 m Länge eingezogen und mit Heißdampf<br />
close-fit (eng anliegend) installiert. Proben in SDR 17, DN 150<br />
und DN 400 wurden herausgetrennt und an die Hessel Ingenieurtechnik<br />
in Roetgen versandt.<br />
Gegenstand der dortigen Untersuchungen waren Zeitstandzugprüfungen<br />
an gekerbten Proben aus dem installierten<br />
Compact Pipe ® zur Bestimmung des Widerstandes gegenüber<br />
langsamem Rissfortschritt im Two Notch Creep Test (2NCT)<br />
[3] im Hinblick auf die Anforderung an die Spannungsrissbeständigkeit<br />
von Rohren nach PAS 1075. Die Proben wurden<br />
einer ca. 50 m langen Installationslänge aus Edelstahlrohren<br />
entnommen (Bild 3).<br />
Aus dem Prüfmuster wurden in Rohrumfangsrichtung 10 mm<br />
breite Probenkörper mit parallelen Schnittflächen herausgearbeitet.<br />
Die Dicke der Probekörper entsprach mit ca. 10 mm<br />
der tatsächlichen Wanddicke des Rohres. Die Bilder 6 und 8<br />
zeigen die Entnahmestellen aus den stark verformten Bereichen<br />
„1“, „2a“ und „2b“ und aus dem nahezu unverformten<br />
Bereich der „Signatur S“ des Compact Pipe ® .<br />
Bild 4: Prüfmuster Trinkwasser<br />
[5] aus HDPE XSC Blue<br />
Bild 5: Prüfmuster Gas [6] aus HDPE<br />
XSC Orange<br />
Probenpräparation und Prüfbedingungen<br />
Die Probekörper aus den Rohrmustern wurden für die 2NCT-<br />
Prüfungen auf den parallelen Schnittflächen in radialer Richtung<br />
gekerbt. Die Kerbe wurde in die mit „1“, „2a“ und „2b“<br />
markierten Bereiche und in den nahezu unverformten Bereich<br />
der Signatur (Bild 7) eingebracht.<br />
Je drei gekerbte Proben wurden pro Prüfserie in Zeitstandzugversuchen<br />
bei (90 ± 0,5) ° C in einer wässrigen Lösung aus<br />
deionisiertem Wasser und 2 % Netzmittel (NM5) geprüft<br />
(ACT-Verfahren) [4]. Die Prüfspannung von 4,0 N/mm ² wurde<br />
auf den verbleibenden ungekerbten Restquerschnitt bezogen.<br />
Es wurden die Standzeiten der gekerbten Proben bis zum<br />
Bruch gemessen.<br />
Ergebnisse<br />
Alle Probekörper weisen spröde Bruchflächen mit einem<br />
Sprödbruchanteil > 30 % auf. Der Riss beginnt bei allen<br />
2NCT-Proben an der Kerbe nahe der Rohraußenseite. Aus<br />
der Überlagerung der relaxierenden Restspannungen 1)2)<br />
des Rohres nach der Rückverformung (Bild 6) und der<br />
Bild 6: Verformung und zusätzliche Spannungen 1)2) an der Rohraußenseite<br />
nach der Rückverformung [5][6]. Querschnitt gestrichelt: M-stage;<br />
Querschnitt Linie: I-stage<br />
Bild 7: Radiale Kerbung auf den parallelen Schnittflächen der 2NCT-<br />
Proben [5][6]<br />
06 | 2014 25
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN<br />
untersuchten Rohre keinen relevanten Einfluss auf die<br />
Spannungsrissbeständigkeit der untersuchten Compact<br />
Pipe ® Trinkwasser- und Gasrohre.<br />
Die durch Heißdampf gesteuerte Rückverformung sorgt<br />
für eine erneute umfassende Temperung des PE-Rohres,<br />
während es eng an der äußeren Schalung positioniert<br />
wird. Die anschließende Kühlung unter Innendruck<br />
schließt die Installation ab. Es verbleibt ein neuer stabiler,<br />
spannungsarmer PE 100-RC Rohrquerschnitt. Die<br />
Anforderung von 160 h im ACT [4] an die Spannungsrissbeständigkeit<br />
von Rohren nach PAS 1075 korreliert<br />
mit einem FNCT Nachweis über 3300 Stunden. Die Proben<br />
aus Compact Pipe ® , SDR 17 Installationen erreichen<br />
wesentlich mehr als die geforderten Standzeiten und<br />
erfüllen die Anforderungen der PAS 1075 für PE 100-RC<br />
Rohre um mehr als das Doppelte.<br />
Bild 8: Geometrische Mittelwerte und Streuband der<br />
Standzeiten im ACT in Abhängigkeit der Entnahmeposition aus<br />
dem Compact Pipe ® [5]<br />
Prüfspannung ergibt sich die höchste Zugspannung für<br />
2NCT-Proben an der rissbeginnenden Rohraußenseite aus<br />
dem Entnahmebereich „1“. Die niedrigste Zugspannung<br />
findet sich für 2NCT-Proben aus den Bereichen „2a“ und<br />
„2b“ an der Rohraußenseite. Das ACT-Verfahren detektiert<br />
die unterschiedlich belasteten Bereiche des Rohrquerschnittes<br />
eindeutig. Proben aus dem höher belasteten<br />
Bereich „1“ brechen geringfügig früher, Proben aus den<br />
niedriger belasteten Bereichen „2a“ und „2b“ später<br />
als Proben aus dem nahezu unverformten Bereich der<br />
„Signatur S“. 1)2)<br />
Fazit<br />
Der werkseitige Verformungsprozess (M-stage), die<br />
Lieferung als Trommelware und der bauseitige Einzugund<br />
Rückformprozess (I-Stage), haben demnach einen<br />
signifikanten, jedoch bei dem Spannungsrissniveau der<br />
1)<br />
Relaxierende Rest-Zug-Spannung an der Rohraußenseite nach der<br />
Rückverformung<br />
2)<br />
Relaxierende Rest-Druck-Spannung an der Rohraußenseite nach der<br />
Rückverformung<br />
Literatur<br />
[1] Hessel, J., Mindestlebensdauer von erdverlegten Rohren aus<br />
Polyethylen ohne Sandeinbettung; Teil 1: <strong>3R</strong> international Heft 4/<br />
2001, S. 178 – 184, Teil 2: <strong>3R</strong> international Heft 6/ 2001, S. 360 – 366<br />
[2] PAS 1075 2009-04, Rohre aus Polyethylen für alternative<br />
Verlegetechniken - Abmessungen, Technische Anforderungen und<br />
Prüfung<br />
[3] DIN EN 12814-3 2005-10, Prüfen von Schweißverbindungen aus<br />
thermoplastischen Kunststoffen - Teil 3: Zeitstand-Zugversuch<br />
Anhang A.2 (informativ): Zeitstandversuch an Proben mit zwei<br />
Kerben (2NCT)<br />
[4] PA ACT 2.1-9 2005-09, Accelerated Creep Test (ACT) – Beschleunigtes<br />
Prüfverfahren mit Validierungsnachweis zur Bestimmung der<br />
Zeitstandfestigkeit von Polyolefinen.<br />
[5] Grieser, J., Untersuchungen an einem Wavin Compact Pipe DN<br />
150 SDR 17 aus Total etrochemicals HDPE XSC 50 Blue, Bericht<br />
R14022580-A der HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen vom<br />
16.04.2014<br />
[6] Grieser, J., Untersuchungen an einem Wavin Compact Pipe DN 150<br />
SDR 17 aus Total Petrochemicals HDPE XSC 50 Orange, Bericht<br />
R1402580-C der HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen vom<br />
17.04.2014<br />
Dipl.-Ing. (FH) RALF GLANERT<br />
Wavin GmbH, Twist<br />
Tel.: +49 (0) 5936-12-428<br />
E-Mail: Ralf.Glanert@wavin.de<br />
www.wavin.com<br />
Dipl.-Ing. (FH) JOHANNES GRIESER<br />
HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen<br />
Tel.: +49 (0)2471-920 22-14<br />
E-Mail: johannes.grieser@hessel-ingtech.de<br />
www.hessel-ingtech.de<br />
AUTOREN<br />
26 06 | 2014
PRODUKT-SPECIAL<br />
Innendichtendes Kunststoff-Presssystem<br />
für erdverlegte Rohrleitungen<br />
Für die schnelle und sichere Installation erdverlegter Rohrleitungen<br />
zur Trinkwasser- und Gasversorgung gibt es jetzt die<br />
neuen, aus hochfestem Kunststoff hergestellten „Geopress<br />
K“-Verbinder in den Nennweiten d 25 bis d 63 mm, die innen<br />
abdichtend sind. Dadurch kann die Presstechnik auch bei PE-<br />
Rohren mit beschädigter Oberfläche eingesetzt werden. Das<br />
Vorbehandeln verkratzter PE-Rohre ist nicht mehr notwendig.<br />
Im Gegensatz zum herkömmlichen PE-Schweißen ist diese<br />
Technik witterungsunabhängig einsetzbar und deutlich schneller<br />
in der Verarbeitung. Die aus hoch belastbarem Kunststoff<br />
hergestellten Verbinder haben keine Dichtelemente, sondern<br />
eine innenliegende Dichtfläche. Dadurch lassen sich jetzt Rohre<br />
mit beschädigter Oberfläche ohne Vorbereitung verarbeiten.<br />
Bisher mussten Kratzer oder Riefen sorgfältig entfernt werden,<br />
um eine zuverlässig dichte Verbindung herzustellen. Dank der<br />
Innenabdichtung lassen sich jetzt Rohre mit Beschädigungen<br />
bis zu zehn Prozent der Rohrwandstärke verpressen.<br />
Ein spezieller Klemmring im Verbinder sorgt nach der Verpressung<br />
für einen so längskraftschlüssigen Sitz, dass die<br />
Rohrverbindung selbst massive Zugbelastungen unbeschadet<br />
übersteht.<br />
Ob die Verpressung korrekt ausgeführt wurde, kann dabei<br />
auf einen Blick an der signal-grünen Verpresskennzeichnung<br />
überprüft werden. Außerdem<br />
verfügen die „Geopress<br />
K“-Verbinder über die Viegatypische<br />
SC-Contur. An der<br />
tritt bei versehentlich vergessenen<br />
Verpressungen schon<br />
bei der Dichtheitsprüfung<br />
deutlich sichtbar Wasser aus. Die Verbindung kann also noch<br />
rechtzeitig fachgerecht verpresst werden, so dass es nicht zu<br />
Schäden nach der Inbetriebnahme kommt.<br />
„Geopress K“ steht als DVGW-zertifiziertes Komplettsystem<br />
für Gas- und Wasserinstallationen mit PE-80-, PE-100-, PE-RCund<br />
PE-X-Rohren in d 25 bis d 63 mm zur Verfügung: Neben<br />
Kupplungen und Bögen gehören dazu T-Stücke, Reparaturund<br />
Reduzierkupplungen, Anschlussbögen, Übergangsbögen<br />
und Übergangsstücke mit Gewinde sowie Anschlussstücke für<br />
die bekannten Anbohrarmaturen des Herstellers. Das System<br />
ist geprüft gemäß GW 335-B3 und G 5600-1.<br />
Alle Komponenten des Systems „Geopress K“ verfügen serienmäßig<br />
über einen Traceability-Code nach ISO 12176-4. Damit<br />
ist auch noch nach Jahren eine lückenlose Nachverfolgung<br />
aller verbauten Viega-Produkte möglich.<br />
KONTAKT: Viega GmbH & Co. KG, 57428 Attendorn<br />
Produkt-Update in der Mess- und Fernüberwachungstechnik<br />
beim Kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Auch in diesem Jahr stellt Steffel wieder eine Neuentwicklung<br />
für den Kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong> vor. Auf dem<br />
Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong> in Gelsenkirchen am 02.07.2014<br />
kann Steffel seine KKS-Fernwirktechnik mit einer zweigleisigen<br />
Produktpalette vorstellen (Station / autarke Messstellen).<br />
Der iTS Pfahlsensor ersetzt mit neuen Funktionen und<br />
neuesten technischen Raffinessen seinen seit acht Jahren<br />
bewährten Vorgänger im Bereich „autarke Messstellen“. Die<br />
Erhöhung der Flexibilität in der Erreichbarkeit, der Aufnahme<br />
und Übermittlung von Messwerten und Informationen zu<br />
Grenzwertverletzungen, standen ebenso im Vordergrund,<br />
wie eine verbesserte Messtechnik. Alles vereint in einem<br />
stabilen kleinen Gehäuse mit IP67-Schutzklasse. Im neuen<br />
iTS sind neben dem Kommunikationsmodem auch die nötigen<br />
Antennen für GPS und Mobilfunk bereits integriert. Der<br />
iTS bietet einen vielseitigen Funktionsumfang, der es sogar<br />
ermöglicht, wie bei seinem großen Bruder ISM aus dem Stationsbereich,<br />
Messdaten an Fremdsysteme zu senden. Selbst<br />
eine einfache denkbare Anwendung, wie zum Beispiel eine<br />
regelmäßige Messdatenerfassung ohne Übermittlung an<br />
eine Zentrale, aber mit einer internen Grenzwertprüfung<br />
und Rückmeldungen ausschließlich im<br />
Fehlerfall, ist parametrierbar.<br />
Als besonderes Highlight wartet das<br />
extrem kompakte Gerät standardmäßig<br />
mit einer integrierten Datenloggerfunktion<br />
mit bis zu 2 kHz auf.<br />
Eine volle Integration nach GW 16,<br />
Fernparametrierung sowie eine Ferntaktung<br />
bietet der iTS in Verbindung<br />
mit dem bekannten KKS-Managementsystem<br />
MS2010. Zur Erreichung<br />
eines idealen Energiemanagements<br />
wurden im iTS - im Gegensatz zum<br />
immer erreichbaren Stations-Messmodul<br />
ISM - Mess- und Erreichbarkeitszeiten<br />
von bis zu 24 pro Tag<br />
vorgesehen.<br />
KONTAKT: Steffel KKS GmbH, 29331 Lachendorf<br />
Tel.: +49 (0) 5145-9891-200<br />
www.kks.de<br />
Auf dem Praxistag in Gelsenkirchen<br />
kann der neue iTS live getestet<br />
werden<br />
06 | 2014 27
PRODUKT-SPECIAL<br />
Lecksuche mit System<br />
Die Gütersloher Unternehmensgruppe SEWERIN stellt aktuell<br />
ein neues System von Loggern vor. Das System SePem ® besteht<br />
aus dem Empfänger SePem ® 01 Master sowie einer beliebig<br />
großen Anzahl von Geräuschloggern. Je nach Anwendungsfall<br />
sind die Logger SePem ® 100 für den mobilen und SePem ® 150<br />
für den permanenten Einsatz konzipiert. Sie werden magnetisch<br />
an Schlüsselstangen von Schiebern, an Hydranten oder<br />
anderen Armaturen im Rohrnetz aufgesetzt. Das integrierte<br />
Mikrofon des Loggers wandelt den Körperschall der Leitung in<br />
ein Geräuschsignal. Dieses wird während der verbrauchsarmen<br />
Zeiten, üblicherweise nachts zwischen etwa 2:00 und 4:00<br />
Uhr, zyklisch aufgezeichnet. In dieser Zeit fallen keine oder nur<br />
wenige Störgeräusche in der Umgebung an. An einer Leitung<br />
ohne Leckstelle ist in dieser Zeit der gemessene Geräuschpegel<br />
nahe Null. Ist jedoch eine Leckage vorhanden, so misst der<br />
Geräuschlogger Werte, die deutlich von Null verschieden sind<br />
und erkennt so das Leck.<br />
SePem ® 100: Datenlogger für den mobilen Einsatz<br />
Für den mobilen Einsatz im Wasserrohrnetz ist der Datenlogger<br />
SePem ® 100 mit integrierter Antenne optimal geeignet. In<br />
einem definierten Netzabschnitt wird eine festgelegte Anzahl<br />
Logger an Messpunkten auf Armaturen gesetzt und zeichnet<br />
während der Nacht innerhalb einer programmierbaren Zeitspanne<br />
– üblicherweise eine halbe Stunde – den Pegel auf. Am<br />
nächsten Tag werden die Logger eingesammelt. Die Messdaten<br />
werden per Funk an den SePem ® 01 Master übermittelt.<br />
Auffällig hohe Messwerte, die auf ein Leck hinweisen, werden<br />
sofort durch ein akustisches Signal angezeigt, vorhandene<br />
Leckagen sicher erkannt. Im Anschluss werden die Datenlogger<br />
sukzessive in weiteren Netzabschnitten eingesetzt, bis das<br />
ganze Netz überprüft ist.<br />
SePem ® 150: Sicherheit durch permanente<br />
Überwachung<br />
Der Datenlogger SePem ® 150 ist für die stationäre Überwachung<br />
von Wasserversorgungsnetzen konzipiert. Die Logger<br />
verfügen über eine externe Antenne und werden an Armaturen<br />
stationär angebracht. Sie zeichnen in jeder Nacht während<br />
einer programmierbaren Zeitspanne die Minimalpegel auf.<br />
Die Standorte werden periodisch abgefahren, zum Beispiel<br />
täglich oder wöchentlich. Die Geräuschlogger schicken dann<br />
ihre Datentelegramme an den SePem ® 01 Master. Anders als<br />
beim mobilen Einsatz werden nicht die absoluten Pegelhöhen<br />
zweier Messpunkte verglichen, sondern die relative Pegeländerung<br />
an einem Messpunkt lässt das Entstehen eines neuen<br />
Lecks sehr schnell erkennen.<br />
Der bidirektionale Funk erlaubt das einfache Auslesen der<br />
Daten von beiden Loggertypen. Bei den permanent installierten<br />
Loggern SePem ® 150 müssen dafür sogar keine Kappen<br />
geöffnet werden. Die Daten werden während der Passierfahrt<br />
an den SePem ® 01 Master übermittelt. Das übermittelte Telegramm<br />
enthält neben dem Minimalpegel auch die Breite und<br />
die Frequenz des Geräuschs und wird auf dem Display des<br />
SePem ® 01 Master übersichtlich angezeigt.<br />
Auf Tastendruck kann während der Patrouille aus jedem Logger<br />
SePem ® 150 zusätzlich zum Datentelegramm auch ein<br />
vollständiger Datensatz abgerufen werden. Dieser enthält<br />
dann die Messkurve der letzten Messung. Auch für diese<br />
vollständigen Daten ist es nicht erforderlich, die Straßenkappe<br />
zu öffnen. Ein kurzer Stopp in Funkreichweite des SePem ®<br />
150 ist bereits ausreichend. Die Datenlogger SePem ® 100 und<br />
SePem ® 150 verfügen über hochempfindliche Piezomikrofone,<br />
die speziell für die Lecksuche optimiert sind und Geräusche<br />
über sehr große Entfernungen registrieren.<br />
SePem ® Software für die komfortable Auswertung<br />
Mit der SePem ® Software steht für die Auswertung der Daten<br />
ein komfortables Werkzeug zur Verfügung. Die Daten der<br />
Geräuschlogger werden vom SePem ® 01 Master über eine<br />
USB-Schnittstelle auf den PC übertragen. Dort können die<br />
Logger per drag&drop in einer Karte positioniert werden.<br />
Dazu ist eine Internetverbindung notwendig. Alle erfassten<br />
Messwerte werden dann diesem Messpunkt zugewiesen. Darüber<br />
hinaus stehen umfangreiche Funktionen zur Verfügung,<br />
um die Anforderungen sowohl an mobile als auch stationäre<br />
Applikationen professionell abzubilden. Besteht keine Internetverbindung,<br />
werden die Messdaten wie gewohnt in der<br />
tabellarischen Form der Exploreransicht dargestellt<br />
SePem ® Master Communicator für die Datensicherung<br />
und Visualisierung<br />
Die Software SePem ® Master Communicator ist eine Freeware,<br />
die die Datenverwaltung auf dem SePem ® 01 Master direkt<br />
am PC abbildet. Die Patrouillenlisten werden sofort nach der<br />
Verbindung übertragen und in einer Datenbank gespeichert.<br />
In Loggerlisten können die Messergebnisse der einzelnen<br />
SePem ® -Geräuschlogger abgerufen und komfortabel verwaltet<br />
werden.<br />
Das Video zum Produkt ist auf der SEWERIN-Homepage oder<br />
bei YouTube zu finden.<br />
KONTAKT: Hermann Sewerin GmbH, 33334 Gütersloh<br />
Tel.: +49 (0) 5241 934-0<br />
E-Mail: info@sewerin.com<br />
www.sewerin.com<br />
28 06 | 2014
PRODUKT-SPECIAL<br />
Grenzen der Wasserleckortung neu definiert<br />
Die Esders GmbH präsentierte auf der Weltleitmesse für<br />
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT<br />
zwei neue Systeme: Das neue Korrelationssystem Eureka3<br />
erreicht in Verbindung mit Hydrofonen die mehrfache Reichweite<br />
gegenüber Kontakt-Schall-Mikrofonen. Das Spürgerät<br />
Hunter H2 ortet kleinste Leckstellen, bei denen elektroakustische<br />
Lecksuche oder Korrelation an ihre Grenzen<br />
stoßen, mittels Spürgas.<br />
Das Korrelationssystem Eureka3 besteht aus zwei Funksendern,<br />
der Software Enigma, einem Kopfhörer und der<br />
zentralen Bedieneinheit Touch ME mit Touchscreen sowie<br />
internen Mikrofonen. „Das ist sozusagen ein Tablet-PC im<br />
Offroad-Gewand“, verdeutlicht Bernd Esders. Denn der<br />
Touch ME ist mit robustem Kantenschutz, sich automatisch<br />
anpassender Hintergrundbeleuchtung und einem Touchscreen,<br />
der sich sogar mit Handschuhen bedienen lässt,<br />
optimal für den rauen Außeneinsatz gewappnet. Ein stabiler<br />
Transportkoffer mit eingebautem Ladegerät, ein Netzteil<br />
sowie ein Fahrzeugladekabel runden das System ab.<br />
Ein stromsparender Dual-Core-Prozessor beschleunigt die<br />
rechenaufwändige Frequenzanalyse, Filterung und Korrelation<br />
der Leckgeräusche, sodass die 16-bit Berechnung<br />
praktisch verzögerungsfrei dargestellt wird.<br />
Eureka3 ist um externe Mikrofone und insbesondere Hydrofone<br />
erweiterbar: Indem die empfindlichen Sensoren in die<br />
unter Betriebsdruck stehende Wassersäule eingebaut werden,<br />
erreicht der Schall diese mit maximaler Intensität. Das<br />
verlängert die Ortungsreichweite bei PVC- und PE-Leitungen<br />
enorm, beziehungsweise macht kleinere Leckagen mit niedriger<br />
Geräuschentwicklung erst messbar. Zudem wurde auf<br />
der IFAT als Messeneuheit<br />
erstmals<br />
die Ergänzung des<br />
Eureka3 mit einem<br />
Funk-Bodenmikrofon<br />
vorgestellt.<br />
Bei kleinsten Leckstellen<br />
kommt<br />
der neue Esders<br />
Hunter H2 zum<br />
Einsatz. In die entleerte<br />
Leitung wird<br />
ein aus 95 Vol. %<br />
Stickstoff und<br />
5 Vol. % Wasserstoff<br />
bestehendes<br />
Spürgas eingebracht.<br />
Wasserstoff<br />
hat als kleinstes<br />
und leichtestes<br />
Element die Eigenschaft, durch jede noch so kleine Fehlstelle<br />
auszutreten, es durchdringt auch poröse Baustoffe wie<br />
Estrich oder Beton. So kann das nach oben wandernde<br />
Gas oberhalb der Leckstelle durch die Sonde des Hunter H2<br />
geortet werden. Über die Konzentrationsanzeige ist leicht<br />
feststellbar, wo sich die stärkste Wasserstoffanreicherung<br />
befindet.<br />
KONTAKT: Esders GmbH, 49740 Haselünne<br />
Tel.: +49 (0) 59 61-95 65-0<br />
E-Mail: info@esders.de<br />
Flexibilität durch mehrlagige Schellenmontage<br />
Bei Stauff ACT Schellen handelt es sich um eine neu entwickelte<br />
Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen in Bereichen,<br />
in denen ein effizienter Schutz vor Korrosion unerlässlich ist.<br />
Das Entstehen von Spaltkorrosion an Rohrleitungen – ein seit<br />
Jahren insbesondere in der Öl- und Gasindustrie beobachtetes<br />
und dokumentiertes Problem – kann nachhaltig verhindert<br />
werden. Langfristig können mit der Lösung enorme Einsparpotenziale<br />
dank verlängerter Wartungs- und Austauschintervalle<br />
generiert werden.<br />
Konstrukteure und Anwender profitieren durch die höhere<br />
Flexibilität bei der Planung und Auslegung von Rohrleitungssystemen,<br />
da mehrere, eng beieinander verlaufende<br />
Rohrleitungen nun nicht mehr zwingend nebeneinander<br />
verlegt werden müssen. Wie alle zur Verwendung mit ACT<br />
Schellen empfohlenen Metallteile<br />
werden auch Sicherungsplatten<br />
und Aufbauschrauben aus<br />
den Werkstoffen 1.4401 bzw.<br />
1.4571 gefertigt. Im Gegensatz<br />
zu regulären Edelstahl-Komponenten<br />
wird jedoch die Verunreinigung<br />
durch metallische und<br />
nicht-metallische Partikel während<br />
der Produktion, Verarbeitung<br />
und Lagerung bei Stauff,<br />
welche die Materialeigenschaften<br />
negativ beeinflussen können,<br />
praktisch ausgeschlossen.<br />
Werksbild: Stauff<br />
06 | 2014 29
PRODUKT-SPECIAL<br />
Wellrohre sicher abdichten mit Curaflex Nova ® Senso<br />
Der neue Dichtungseinsatz<br />
Curaflex Nova ® Senso ist<br />
besonders für die Abdichtung<br />
oberflächenstrukturierter<br />
und empfindlicher<br />
Rohre geeignet. Mit dem<br />
neuen STS (Soft Tight<br />
System) wird es möglich.<br />
Schnell, schonend und<br />
effektiv werden jetzt z. B.<br />
Kunststoffmantelrohre,<br />
flexibel vorisolierte Kunststoffrohre<br />
und flexible<br />
Kabelschutzrohre zuverlässig abgedichtet.<br />
Der Curaflex Nova ® Senso ist für jeden Lastfall (drückendes<br />
und nichtdrückendes Wasser) gerüstet. Der Dichtungseinsatz<br />
ist wartungsfrei, d. h. dauerhaft dicht ohne Nachspannen.<br />
STS - Soft, schonend, sicher<br />
STS (Soft Tight System) löst das Abdicht-Problem bei stark<br />
strukturierten Rohroberflächen mit Bravour. Das weiche Butylband<br />
von Curaflex Nova ® Senso greift bis tief in die Rillen der<br />
Rohroberfläche und dichtet dort dauerhaft ab. Der schonende<br />
Anpressdruck auf die Medienleitung ist jederzeit gewährleistet,<br />
denn bei diesem Dichtungseinsatz ist das bewährte<br />
DPS-System integriert.<br />
ITL - immer sicher verspannt<br />
ITL (Integrated Torque Limiter) garantiert beim Verspannen<br />
immer das richtige Drehmoment. Spezialwerkzeuge sind überflüssig.<br />
Und alles ist dicht. Das innovative ITL macht es möglich.<br />
Speziell für diesen Zweck entwickelte Muttern trennen sich<br />
bei einem definierten Drehmoment schnell und zuverlässig<br />
ab. Das erhöht die Einbausicherheit extrem.<br />
Die DOYMA GmbH & Co mit Sitz in Oyten konstruiert und<br />
fertigt Dichtungssysteme zur Abdichtung von Ver- und Entsorgungsleitungen,<br />
die durch Wände und Decken geführt werden<br />
sowie Brandschutzsysteme zur Abschottungen für Rohre und<br />
Kabel für den vorbeugenden baulichen Brandschutz.<br />
KONTAKT: DOYMA GmbH & Co, 28876 Oyten<br />
Tel.: +49 (0)4207-9166-270<br />
E-Mail: benedikt.schuetz@doyma.de<br />
www.doyma.de<br />
Radiodetection präsentiert die nächste Generation<br />
von Präzisions-Marker-Suchsystemen<br />
Die neue Serie der Präzisionssuchsysteme von Radiodetection<br />
erweitert die hohe Leistung und Ergonomie der RD7000 +<br />
und RD8000 Plattformen und bietet nun die Möglichkeit,<br />
RF-Marker für Versorgungsleitungen, sowie elektronische<br />
Markersysteme (Electronic Marker System - EMS) und Omnimarker,<br />
zu erfassen. Mit der automatischen Marker-Tiefenmessung,<br />
durch die sich ein manuelles Zweischritt-Verfahren<br />
erübrigt, und ihr kombinierter Versorgungsleitungs- und Marker-Suchmodus<br />
ermöglichen diese neuen Marker-Empfänger<br />
schnellere und genauere Ortungsergebnisse.<br />
Verbindungen mit Karten und GIS-Systemen werden durch<br />
internationale GPS-Funktionen und praktische Bluetooth- und<br />
USB-Konnektivität erleichtert. Die optionale interne GPS-Funktion<br />
der RD8000-Systeme ermöglichen es Ortungsexperten,<br />
ihre Messungen durch zweckdienliche Positionsdaten zu<br />
erweitern, ohne zusätzliche Geräte mitführen zu müssen. Der<br />
USB-Port dient als schnelle, einfache Schnittstelle für Mappingund<br />
GIS-Systeme. Die RD-Manager -Software ermöglicht das<br />
Exportieren von Daten in geläufige Dateiformate wie z. B.<br />
KML für Google Earth.<br />
Alle Präzisions-Marker-Empfänger verfügen über eine Bluetooth-Funktion<br />
für eine automatische Übertragung von Messwerten<br />
an externe Geräte, einschließlich jener, die weiteren<br />
GPS-Support bieten. Die automatische Datenaufzeichnung<br />
einiger Modelle bietet Nutzungsüberwachung für einen Nachweis<br />
der Arbeitsleistung und die Verbesserung laufender Prozesse.<br />
Jede Sekunde werden Hauptortungsparameter auf der<br />
internen Festplatte der Einheit gespeichert, die später über<br />
die USB-Verbindung und den RD-Manager abgerufen und<br />
analysiert werden können.<br />
Weitere Vorteile sind die gleichzeitige Anzeige von Strom- und<br />
Tiefenwerten bei den RD8000-Modellen, der dynamische<br />
Überlastungsschutz, der in Bereichen mit starken elektrischen<br />
Störfeldern Interferenzen herausfiltert, und serienmäßig eingebaute,<br />
wiederaufladbare Li-Ion-Batterien für längere Nutzungsdauer<br />
und kostenwirksamen Einsatz. Anwender, die<br />
bereits mit den führenden RD8000- und RD7000+-Präzisions-<br />
Suchsystemen von Radiodetection vertraut sind, benötigen nur<br />
minimales Training. Zur zusätzlichen Absicherung und ohne<br />
Zusatzkosten wird eine dreijährige Garantie bei Produktregistrierung<br />
angeboten.<br />
KONTAKT: Radiodetection CE, Emmerich am Rhein<br />
Tel.: +49 2851-9237-20<br />
E-Mail: marion.giesbers@spx.com<br />
www.radiodetection.de<br />
30 06 | 2014
PRODUKT-SPECIAL<br />
Ortung von erdverlegten Versorgungsleitungen<br />
Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> (KKS) wird weltweit genutzt<br />
um Leitungen vor Korrosion zu schützen, die durch Defekte am<br />
Schutzmantel verursacht wird. Die Herausforderung besteht<br />
darin, die Größe und Anzahl der Mantelschäden zu reduzieren,<br />
um somit die Wirksamkeit des kathodischen Schutzes zu<br />
maximieren und den Leckstrom (Streustrom) zu minimieren.<br />
Das vLocDM2-Ortungssystem von Vivax-Metrotech wurde<br />
entwickelt, um eine exakte Ortung zu ermöglichen und die<br />
gefundenen Schäden auszuwerten.<br />
Anwendung moderner Ortungstechnik<br />
Dass Gasleitungen aus Stahl heutzutage mittels kathodischen<br />
Schutzpotentials vor Korrosion geschützt werden, ist gängige<br />
und auch bewährte Praxis. Bei Beschädigungen an der<br />
Umhüllungsschicht fließt ein erhöhter Schutzstrom und das<br />
Schutzpotential sinkt ab, wodurch die Gefahr lokaler Korrosionsstellen<br />
entsteht. Diese Fehlstellen exakt zu lokalisieren und<br />
zu beseitigen, ist meist schwierig und aufwändig. Durch die<br />
Wahl des richtigen Ortungssystems wird dies aber deutlich<br />
vereinfacht.<br />
Technik des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es<br />
Ist die Umhüllungsschicht an einer Rohrleitung mechanisch<br />
beschädigt, so kommt es durch eine chemische Reaktion zu<br />
Korrosion, die Leitung rostet. Diese chemische Reaktion wird<br />
durch das Anlegen eines Schutzpotentials – dem kathodischen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> – verhindert. Damit wird eine Korrosion an<br />
den Schadstellen verhindert. Die Fehlstellen müssen aber trotzdem<br />
aufgespürt und beseitigt werden, weil das Schutzsystem<br />
nur einen begrenzten Schutzstrom bereitstellen und bei einer<br />
Vielzahl von parallelen Fehlstellen den <strong>Korrosionsschutz</strong> nicht<br />
aufrecht erhalten kann.<br />
Die bei dieser Art von Fehlstellenortung eingesetzten Systeme<br />
unterscheiden sich vom Grundaufbau her nicht von der herkömmlichen<br />
Ortungstechnik. Das System vLocDM2 besteht aus<br />
einem Hochleistungssender und einem Empfänger. Im Detail<br />
betrachtet, ist hier allerdings ein deutlicher Unterschied erkennbar.<br />
Der Hochleistungssender dieser Messsysteme ermöglicht<br />
die Ortung und Fehlersuche an der Leitungstrasse über große<br />
Distanzen. So kann z. B. mit einem 150-Watt-Sender eine<br />
Trasse von 40 km und mehr geortet werden.<br />
Ein weiterer Unterschied beim Sender gegenüber „einfachen“<br />
Systemen ist die Auswahl und Anzahl der Frequenzen. Um die<br />
Fehlstellen an der Rohrumhüllung, z. B. von Gastransportleitungen<br />
zuverlässig orten zu können, ist eine sehr niedrige<br />
Frequenz notwendig. Hier wird eine Frequenz von 4 Hz eingesetzt,<br />
durch welche nur sehr geringe kapazitive Signale erzeugt<br />
werden und der Leckstrom an Fehlstellen deutlich erkennbar<br />
wird. Der Empfänger ist zusätzlich zu den Spulen im Gehäuse<br />
noch mit einem zusätzlichen Magnetometer ausgestattet. Nur<br />
dadurch sind die zuverlässige Ortung der extrem niedrigen Frequenz<br />
und eine empfindliche Fehlerstromerfassung möglich.<br />
Durch die Weiterverarbeitung im Empfänger können dann<br />
die Signalstärke und deren Verlauf ausgewertet werden. Als<br />
weitere Komponente bei vLocDM2 kommt ein so genannter<br />
A-Rahmen, eine Schrittspannungssonde, zum Einsatz. Dieser<br />
ermöglicht während der Ortung die punktgenaue Bestimmung<br />
des Fehlers im Erdreich.<br />
Das System kann an jedem Einspeisepunkt des kathodischen<br />
Schutzes angeschlossen werden. Die Messung erfolgt mit dem<br />
vLocDM2-Empfänger.<br />
Die Ergebnisse in Form von Daten oder Diagrammen erscheinen<br />
in Echtzeit auf dem vLocDM2-Display oder auf einem<br />
über Bluetooth angeschlossenem externen Datenlogger mit<br />
GPS-Postition.<br />
KONTAKT: Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik GmbH, 96148 Baunach<br />
Tel.: +49 (0) 9544 68-0<br />
E-Mail: klar.r@sebakmt.com<br />
www.sebakmt.com<br />
vLocDM2-Set mit Empfänger, Sender und A-Rahmen<br />
vLocDM2 im Einsatz<br />
06 | 2014 31
PRODUKT-SPECIAL<br />
Neuer begehbarer Schacht DN 1000<br />
Der von der Funke Kunststoffe GmbH auf der<br />
IFAT 2014 vorgestellte neue begehbare Schacht<br />
DN 1000 kombiniert die Vorzüge verschiedener<br />
Werkstoffe zu einem System mit vielen<br />
Vorteilen. Das Schachtunterteil aus Beton verleiht<br />
dem Bauwerk Sicherheit gegen Auftrieb,<br />
während die korrosions- und abriebsichere PU-<br />
Auskleidung für optimale hydraulische Verhältnisse<br />
sorgt. Die Schachtmuffen sind mit dem<br />
CI ® -Dichtsystem ausgestattet und erlauben den<br />
einwandfreien Anschluss von SN 8-, SN 12- und<br />
SN 16-Rohren aus dem HS ® - und CONNEX-<br />
Kanalrohrsystem. Das auf dem Unterteil sitzende<br />
Steigrohr ist aus PVC-U gefertigt. Es wird in<br />
der gewünschten Baulänge auf die Baustelle<br />
geliefert und kann vor Ort noch problemlos<br />
gekürzt werden; die maximale Länge liegt bei<br />
5 m. Aufgrund der monolithischen Fertigung<br />
entfallen die für herkömmliche Schachtbauwerke typischen<br />
Fugen. Den Abschluss des Bauwerks bildet der Funke Schachtkonus,<br />
der ebenfalls mit PU ausgekleidet ist.<br />
Dank der speziellen Konstruktionsweise des Konus erfolgt die<br />
Lastabtragung nicht über das Steigrohr, sondern in das umliegende<br />
Erdreich. Der Konus ist wahlweise für Abdeckungen<br />
von 625 mm bzw. 800 mm lieferbar. An Schachtunterteil und<br />
Konus werkseitig angebrachte Seilschlaufen sorgen für denkbar<br />
einfache Handhabung an der Einbaustelle und erleichtern<br />
die Montage des Schachtes. Das Bauteil eignet sich für die<br />
Gestaltung unterschiedlicher Varianten mit Abwinklungen<br />
oder Seitenzuläufen, bietet eine optimale Lösung für Gerinne<br />
mit Nennweiten- und Höhensprüngen und ist bei unterschiedlichen<br />
Gefällen (Standard: 1 %) einsetzbar.<br />
Nachträgliche Anschlussmontage möglich<br />
Mit dem FABEKUN ® -Sattelstück DN/OD 160 von Funke kann<br />
zudem jederzeit und an jeder beliebigen Stelle im Steigrohr ein<br />
Anschluss geschaffen werden, um einen Höhenversatz in der<br />
Kanalisation zu überbrücken; optional lässt sich der Anschluss<br />
außerdem mit einem innenliegenden Absturz kombinieren.<br />
Dieser ermöglicht eine problemose Revision und Reinigung,<br />
und dank des geringen Platzbedarfs bleibt der Schacht begehbar.<br />
Eine auf der Berme angebrachte Rutschsicherung sorgt für<br />
festen Stand, auf Wunsch wird der Schacht ab Werk mit einer<br />
Leiter ausgeliefert. Ebenfalls optional ist eine Einstieghilfe für<br />
die Montage im Schachtkonus lieferbar. Eine hierfür nötige<br />
Tragplatte ist werkseitig vormontiert.<br />
KONTAKT: Funke Kunststoffe GmbH, 59071 Hamm<br />
Tel.: +49 (0) 2388 3071-0<br />
E-Mail: info@funkegruppe.de<br />
www.funkegruppe.de<br />
Mineralische Beschichtung gegen aggressives<br />
Abwasser und biogene Schwefelsäurekorrosion<br />
Die octopus stellt ihr neues Verfahren zur Aushärtung der hydraulischen<br />
abbindenden Beschichtung für Abwasserschächte,<br />
Bauwerkskammern und Behälter durch Heißdampf vor.<br />
Nach der Untergrundvorbereitung mit Wasserhochdruck oder<br />
mit festen Strahlmitteln wird der Schachtraum mit Heißdampf<br />
>100 °C bedampft. Der Heißdampf wird vom Heißdampferzeuger<br />
über einen Schlauch bis zur Mitte des Schachtraumes<br />
geführt und von dort gleichmäßig im Bauwerksraum verteilt.<br />
Die Bedampfungszeit hängt zum einen von der Raumgröße<br />
des Bauwerkes und zum anderen von der Menge des<br />
Heißdampfvolumens kg/h. ab. Durch die Kombination von<br />
ausgesuchten, natürlichen Mineralien und einer hochwertigen<br />
reaktiven Flüssigkomponente entsteht die Fertigmischung<br />
PNEUCON.<br />
Durch das Bedampfen mit Heißdampf ist die Reaktionsgeschwindigkeit<br />
des Hydratationsprozesses der Beschichtung<br />
so hoch, dass das zementöse Material sofort in die sog.<br />
Klinkerphase (Härte und Dichte) tritt. Unter normalen Bedingungen<br />
(Umgebungstemperatur ~ 20 °C) tritt diese Phase<br />
frühestens nach 7 bis 28 Tagen ein. Die Inbetriebnahme<br />
des Bauwerkes kann sofort nach der Bedampfung erfolgen.<br />
Die Produkteigenschaften sind:<br />
»»<br />
hohe Beständigkeit gegen biogene<br />
Schwefelsäurekorrosion<br />
»»<br />
Säuren- und Laugenbeständigkeit von pH 3 bis pH 14<br />
»»<br />
homogene Verbindung zu allen mineralischen<br />
Untergründen<br />
»»<br />
Temperaturbeständig bis 95 °C<br />
»»<br />
druckwasserdicht bei gleichzeitiger<br />
Wasserdampfoffenheit<br />
»»<br />
Verarbeitung auf mattfeuchten Untergründen<br />
»»<br />
Verarbeitung auf tragfähigen rostigen<br />
Stahloberflächen<br />
»»<br />
keine Unterwanderung durch Rost<br />
»»<br />
Langzeitkorrosionsschutz<br />
»»<br />
lastwechselbeständig<br />
»»<br />
umweltfreundlich, lösemittelfrei, schadstoffarm<br />
KONTAKT: octopus coating GmbH, 30851 Langenhagen<br />
32 06 | 2014
PRODUKT-SPECIAL<br />
Komplette Systemlösung: KERAPORT Schächte<br />
Das neue Schachtprogramm KeraPort ergänzt und komplettiert<br />
die hochwertigen Systemlösungen von Steinzeug-Keramo.<br />
Auch in der senkrechten Dimension bietet Steinzeug-Keramo<br />
damit die umfassenden Vorteile, die Steinzeugrohre und -formstücke<br />
auf der waagerechten Ebene auszeichnen. Zuverlässige<br />
Abwassersysteme verlangen durchgehend ein Höchstmaß an<br />
Korrosionssicherheit und Dichtheit. Weil ein System nur so<br />
zuverlässig arbeiten kann wie jedes einzelne seiner Glieder,<br />
rücken auch Abwasserschächte mehr und mehr in den Fokus<br />
der Entscheidungen.<br />
Gut zugänglich für vielfältige Aufgaben<br />
Schächte ermöglichen das Betreten bzw. das Be- und Entlüften<br />
unterirdischer Abwasseranlagen, Kanalisationen,<br />
Schiebekammern usw. und zeichnen sich durch eine Einsteigevorrichtung<br />
und eine verkehrssichere Abdeckung aus.<br />
Aufgrund ihrer großen Nennweiten von DN 600 über DN<br />
800 bis zu DN 1000 (DN 1200 und DN 1400 auf Anfrage<br />
erhältlich) lassen sich in den Komplett- und Kombischächten<br />
mühelos alle gängigen Prüf-, Inspektions- und Reinigungsgeräte<br />
einbringen.<br />
durch undichte Abwasserschächte ist unbedingt zu vermeiden.<br />
Dieses Anforderungsprofil erfüllt Steinzeug-Keramo mit<br />
dem Schachtprogramm KeraPort in idealer Weise. Wie kein<br />
anderer steht der Werkstoff Steinzeug für Korrosionssicherheit<br />
und Dichtheit beim Abwassertransport. Jeder Steinzeugschacht<br />
wird nach individuellen Vorgaben gefertigt.<br />
KONTAKT: Steinzeug-Keramo GmbH, 50226 Frechen<br />
Tel.: +49 (0) 2234 507 201<br />
E-Mail: M.Khazdouzian@steinzeug-keramo.com<br />
www.steinzeug-keramo.com<br />
Extrem korrosionssicher und dicht<br />
Für Schächte gilt wie für jedes andere Segment im gesamten<br />
Abwassersystem: Die Anforderungen wachsen. Abwässer<br />
sind heute deutlich aggressiver als noch vor wenigen Jahren<br />
– aus vielfältigen Ursachen. Auch eintretendes Fremdwasser<br />
Molchen leicht gemacht: QUICK-PIG-Station<br />
für PE-Rohrsysteme<br />
Auf der IFAT 2014 in München hat REINERT-RITZ erstmals<br />
ein neues, innovatives Konzept zum Einbringen und Herausnehmen<br />
von Molchen vorgestellt.<br />
Im Gegensatz zur gängigen Praxis werden mit der QUICK-<br />
PIG Station keine platzraubenden und kostspieligen<br />
Schächte mehr benötigt, um den Molch in das Rohrsystem<br />
einzufügen.<br />
Die Bedienung der Molchschleuse erfolgt nach Entfernung<br />
des Straßendeckels von oben. Dadurch werden nicht nur<br />
Installationskosten reduziert, sondern es entfallen auch viele<br />
sicherheitstechnische Vorkehrungen, wie Gaswarngeräte,<br />
Sicherheitsdreibock, Höhensicherungsgerät, Rettungshubeinrichtung<br />
usw.<br />
Die „Arbeit in Schächten“ wird grundsätzlich als Tätigkeit<br />
mit besonderen Gefahren eingestuft. Mit der QUICK-PIG-<br />
Station werden zukünftig lebensgefährdende Risiken von<br />
Monteuren abgewendet. Die Station macht das Molchen<br />
sicherer, einfacher und kostengünstiger.<br />
KONTAKT: REINERT-RITZ GmbH, 48531 Nordhorn<br />
E-Mail: kontakt@reinert-ritz.de<br />
www.reinert-ritz.com<br />
06 | 2014 33
PRODUKT-SPECIAL<br />
Die neue Premium-Line von Wavin: Großes Interesse<br />
auf der IFAT 2014<br />
Auf der IFAT in München<br />
präsentierte Wavin erstmals<br />
seine neue Premium-<br />
Produktlinie für die Abwasserentsorgung.<br />
Unter dem<br />
Namen TERRA GRAVITY<br />
werden in Zukunft hochwertige<br />
Kanalrohre und<br />
Schächte für anspruchsvollste<br />
Anwendungen<br />
angeboten. Das Interesse<br />
am Wavin Messestand<br />
war groß. Zum neuen<br />
Konzept gehören auch<br />
umfangreiche Serviceleistungen<br />
wie zum Beispiel<br />
ein neues Online-Tool für<br />
den Tiefbau.<br />
Neu im Wavin-Sortiment: Das Vollwandrohrsystem<br />
Acaro PP SN 12 und der für homogene<br />
Premium-Produkte<br />
Großraumschacht Tegra 1250 aus PE sind Kanalsysteme<br />
Teil der TERRA GRAVITY Premium Line „Mit TERRA GRAVITY richten<br />
wir uns an Kommunen,<br />
Planer und Tiefbauunternehmen,<br />
die in der drucklosen Entwässerung besonderen<br />
Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Service legen“, erklärt<br />
Günter Brümmer, Produktmanager bei Wavin, die Strategie.<br />
Das umfangreiche Produktsortiment beinhaltet unter anderem<br />
die Tegra Premium-Schächte, hergestellt aus PE oder PP,<br />
in den Dimensionen von DN 425 bis DN 1250. Gleich drei<br />
neue Premium-Schächte wurden zur Einführung von TERRA<br />
GRAVITY ins Lieferprogramm aufgenommen. Auf der IFAT<br />
in München weckte vor allem ein neuer Großraumschacht<br />
aus Polyethylen das Interesse der Besucher. Der Tegra 1250<br />
bietet viel Platz für Armaturen und große Anschlüsse. Als<br />
Baukastensystem mit schweißbaren Komponenten ist er<br />
ideal für anspruchsvolle Aufgaben in der Entwässerung.<br />
Entsprechend der Kundenbedürfnisse wird der PE-Schacht<br />
individuell gefertigt und anwendungsbezogen ausgestattet.<br />
Neben hochwertigen und langlebigen Schächten bietet der<br />
Marktführer für Kunststoffrohrsysteme in Europa aber auch<br />
ein Komplettprogramm an Rohren und Verbindungssystemen,<br />
mit denen sich materialgleiche und bei Bedarf auch<br />
vollverschweißte Kanäle herstellen lassen. So finden sich<br />
spezielle Rohre für den Regenwassertransport, Vollwandrohre<br />
aus PE-HD oder rippenverstärkte PP-Rohre im TERRA<br />
GRAVITY-Sortiment. Neu ist das Vollwandrohrsystem Acaro<br />
PP SN 12 aus hochwertigem Polypropylen, das mit einem<br />
speziellen Dichtsystem ausgestattet ist. „Durch die einfache<br />
Kombination unserer Premium-Rohre und -Schächte lassen<br />
sich homogene Kanalsysteme herstellen, die besonders<br />
langlebig und sicher sind“, bringt Brümmer die wesentlichen<br />
Vorteile auf den Punkt.<br />
Premium-Service<br />
Auch das ist neu: Neben den umfangreichen Serviceleistungen,<br />
die bei Wavin selbstverständlich sind, profitieren<br />
Terra Gravity-Kunden in Zukunft von einem erweiterten<br />
Serviceangebot. Mit dem neuen Online Tool Tiefbau können<br />
Kunden jetzt neben der bewährten Regenwasserbewirtschaftung-Berechnung<br />
auch ihr Abwassernetz hydraulisch<br />
berechnen und planen. Mit einem kompletten Report alle<br />
wichtiger Daten, inklusive einem Massenauszug, der sowohl<br />
im PDF-Format oder auch als GAEB-Datei zur Verfügung<br />
gestellt wird. Zum Premium-Service gehören auch die projektbezogene<br />
Konzeption und Projektierung, die auftragsbezogene<br />
Fertigung sowie die Projektbegleitung durch<br />
einen Wavin-Techniker vor Ort. „Von der Planung, über<br />
die Einweisung auf der Baustelle bis hin zur Fertigstellung<br />
des Projektes stehen wir an der Seite unserer Kunden“, so<br />
Brümmer.<br />
KONTAKT: Wavin GmbH, 49767 Twist<br />
Tel.: +49 (0) 5936 12-0<br />
www.wavin.de<br />
INFO<br />
Der Newsletter für<br />
die Rohrleitungsbranche<br />
Anmelden unter www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU<br />
34 06 | 2014
4. Praxistag am 05. November 2014 in Rheine<br />
Wasserversorgungsnetze<br />
NEU<br />
Begleitende<br />
Ausstellung und<br />
Vorführungen<br />
Programm<br />
Moderation: Prof. Th. Wegener,<br />
iro Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg<br />
Wann und Wo?<br />
Block 1: Netzbetrieb - Analysieren und Optimieren<br />
Optimale fahrweise von Pumpen und Turbinen<br />
Dr. Gebhardt, aquatune, Aarbergen; Dr. Wolters, 3S Consult, München<br />
Rahmenbedingungen einer Zielnetzplanung<br />
Dr. Esad Osmancevic, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
ISO 55 000 – Der Standard für das Asset Management<br />
Mike Beck, Fichtner Water & Transportation GmbH, Berlin<br />
Block 2: Strategien zur Netzspülung<br />
Reinigung einer Rohwasserleitung mit dem Impulsspülverfahren<br />
Carsten Utke, Berliner Wasserbetriebe, Berlin<br />
Auswahlkriterien für Spül- und Reinigungsverfahren<br />
Dominik Nottarp-Heim, Hessenwasser, Groß-Gerau;<br />
Dr. Christian Sorge, IWW, Biebesheim am Rhein<br />
Block 3: Armaturenwechsel und -instandhaltung<br />
Wechsel von Anbohrarmaturen bei Betriebsdruck<br />
N. N., Flintab GmbH, Brüsewitz<br />
Im Fokus: Armatureninstandhaltung<br />
Axel Sacharowitz, 3S Antriebe, Berlin<br />
Block 4: Druckprüfung von Rohrleitungen<br />
Fehlerhafte Druckprüfungen bei Wasserleitungen<br />
René Stangl, Hamm<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 Druckprüfung von neu verlegten<br />
Rohrleitungen - Grundlagen, Verfahren, Anforderungen<br />
Bernd Nienhaus, Esders GmbH, Haselünne<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, iro<br />
Termin: Mittwoch, 05.11.2014,<br />
9:00 Uhr – 16:45 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Rheine<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken<br />
und Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich<br />
Netzplanung, -inspektion und<br />
-wartung<br />
Teilnahmegebühr*:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 410,- €<br />
Nichtabonnenten: 450,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen<br />
wird ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen<br />
Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet<br />
möglich) sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine<br />
schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn<br />
zu begleichen ist. Bei Absagen nach dem 24.<br />
Oktober 2014 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise<br />
verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Block 5: Netzbetrieb - Überwachung<br />
Schallgeschwindigkeit im Rohrnetz<br />
Dirk Becker, Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh<br />
Online Netzüberwachungssysteme zur Versorgungssicherheit<br />
Stefan Neuhorn, Hinni AG, Biel-Benken (CH)<br />
Erhöhte Rohrleitungsschwingungen in einem Wasserwerk<br />
Dr. Christian Jansen, KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Betreiberhaftung bei Rohrleitungsschäden<br />
Der Stofftransport durch Rohrleitungen ist im Vergleich zu anderen Transfermethoden sehr sicher. Dennoch kann es<br />
in seltenen Fällen zum Austreten transportierter Medien in die Umgebung kommen. Außer der Umwelt können dabei<br />
auch unbeteiligte Privatpersonen geschädigt werden, etwa durch Verschmutzungen ihres Grundeigentums. In der<br />
Akutsituation richten sich die zu treffenden Maßnahmen regelmäßig in erster Linie darauf, die Gefahr einzudämmen<br />
und den nachvollziehbaren Sorgen Betroffener angemessen zu begegnen. Wenn sich die Lage beruhigt hat, geht<br />
es um den Ausgleich entstandener Schäden. Zu den damit verbundenen rechtlichen Fragen gibt der vorliegende<br />
Beitrag einen Überblick.<br />
Grundlagen<br />
Die Haftung eines Rohrleitungsbetreibers gegenüber einem<br />
Grundstückseigentümer kann prinzipiell in einem individuellen<br />
Vertrag über die Gestattung der Grundstücksnutzung<br />
für die Leitung geregelt sein. Dies muss im jeweiligen Einzelfall<br />
anhand der konkret abgeschlossenen Vereinbarungen<br />
geklärt werden, weil solche speziellen Regelungen von<br />
gesetzlichen abweichen können. Beim Fehlen einer vertraglichen<br />
Schadensersatzbestimmung haften Rohrleitungsbetreiber<br />
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Haftpflichtgesetzes (HPflG)<br />
und – in bestimmten besonderen Fällen, auf die hier aus<br />
Platzgründen nicht weiter einzugehen ist [1] – nach weiteren<br />
gesetzlichen Spezialvorschriften. § 2 Abs. 1 Satz 1 HPflG<br />
lautet:<br />
„Wird durch die Wirkungen von Elektrizität, Gasen,<br />
Dämpfen oder Flüssigkeiten, die von einer Stromleitungsoder<br />
Rohrleitungsanlage oder einer Anlage zur Abgabe der<br />
bezeichneten Energien oder Stoffe ausgehen, ein Mensch<br />
getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen<br />
verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Inhaber der<br />
Anlage verpflichtet, den daraus entstehenden Schaden zu<br />
ersetzen.“<br />
Diese Regelung gehört mit einigen anderen zu einer Gruppe<br />
von Schadensersatzbestimmungen, die sich von den<br />
„normalen“ Haftungsvorschriften des deutschen Rechts<br />
dadurch unterscheiden, dass sie eine Verpflichtung zum<br />
Schadensersatz ohne Verschulden des Leitungsbetreibers<br />
aussprechen. Es kommt nicht darauf an, ob ein Rohrleitungsbetreiber<br />
fahrlässig gehandelt hat. Bestimmungen<br />
wie § 2 Abs. 1 HPflG statuieren eine so genannte Gefährdungshaftung:<br />
Der Gesetzgeber entscheidet, dass selbst das<br />
absolut sorgfältige Betreiben bestimmter Einrichtungen ein<br />
immanentes Risiko mit sich bringt, das potentiell betroffenen<br />
Dritten nicht ohne Ausgleich im Schadensfall zuzumuten<br />
ist. Ein bekanntes Beispiel ist die verschuldensunabhängige<br />
Haftung für das Betriebsrisiko von Kraftfahrzeugen, die im<br />
Straßenverkehrsgesetz geregelt ist.<br />
Zu solchen Einrichtungen gehören auch die im oben wiedergegebenen<br />
Gesetzestext genannten Rohrleitungsanlagen,<br />
wenn in ihnen Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten transportiert<br />
werden. Das betrifft unter anderem Rohrleitungen zum<br />
Transport von Erdöl, Ethylen, Wasserstoff, Druckluft oder<br />
Chemikalien [2], aber darauf beschränkt sich die Vorschrift<br />
nicht. Auch ob eine Leitung ober- oder unterirdisch verlegt<br />
ist, spielt für die Haftung nach dieser Regelung grundsätzlich<br />
keine Rolle. Die wesentliche Haftungsvoraussetzung<br />
besteht bei § 2 Abs. 1 Satz 1 HPflG in der Ursächlichkeit<br />
eines unplanmäßigen Stoffaustritts (das muss nicht zwingend<br />
ein plötzliches Ereignis im Sinne eines Unfalls sein) für<br />
einen Schaden. Diese Kausalität drückt der Gesetzgeber<br />
mit dem Wort „durch“ am Anfang des oben genannten<br />
Tatbestandes aus.<br />
Juristen prüfen an dieser Stelle bei allen Gefährdungshaftungen<br />
im Wesentlichen zwei Fragen. Erstens, ob ein<br />
Stoffaustritt in einem quasi-naturwissenschaftlichen Sinn<br />
zu einem Schaden geführt hat, also conditio sine qua non<br />
für diesen ist. Entsteht ein Schaden unabhängig von einem<br />
Stoffaustritt, gibt es keine Rechtfertigung für eine Haftung<br />
des Rohrleitungsbetreibers. Diese Voraussetzung kann im<br />
konkreten Fall leicht zu klären sein (zum Beispiel bei einer<br />
Bodenverunreinigung durch austretendes Öl), aber auch<br />
schwer (fiktives Beispiel: unter Überdruck austretendes Gas<br />
reißt Erdbrocken in die Luft, einige Dutzend Meter entfernt<br />
zerbirst eine Fensterscheibe).<br />
Die zweite Prüffrage lautet, ob ein auf der ersten Stufe<br />
erfasster Schaden vom Sinn der Gefährdungshaftung<br />
erfasst wird, also auf die spezifischen Risiken des Transports<br />
– nicht des Stoffes an sich – durch eine Rohrleitungsanlage<br />
zurückgeht (Schutzzweckzusammenhang). Auch<br />
die Frage nach dem Schutzzweckzusammenhang kann<br />
im Einzelfall zu schwierigen Bewertungsfragen führen<br />
(z. B. Haftung für das Entstehen giftiger Dämpfe infolge<br />
des Zusammenfließens verschiedener Stoffe in einer<br />
kommunalen Abwasseranlage? [3] Für Schäden durch<br />
Asphaltbrocken, die infolge bergbaubedingten Versagens<br />
einer Wasserversorgungsleitung herumgeschleudert<br />
werden? [4]).<br />
Klärungsbedürftig ist schließlich auch, ob Mitursachen<br />
existieren (zum Beispiel mangelhafte Ausführung betroffener<br />
Bauwerke, die niemand je bemerkt hat, die sich<br />
36 06 | 2014
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
aber schadensträchtig auswirken). Diese mindern ggf.<br />
die Haftung von Rohrleitungsbetreibern.<br />
Diese vorstehend erläuterte Wirkungshaftung hängt nicht<br />
vom Zustand der Anlage ab [5], denn ihr Grund liegt<br />
allein in den Gefahren, die vom leitungsgebundenen<br />
Stofftransport ausgehen. Entsprechend der gesetzgeberischen<br />
Absicht, das Betriebsrisiko auszugleichen, ist<br />
für diese Haftung irrelevant, ob eine Anlage intakt oder<br />
defekt ist [6]. Anders ist es mit einer weiteren Haftung,<br />
der so genannten Zustandshaftung, die im zweiten Satz<br />
des § 2 Abs. 1 HPflG geregelt ist. § 2 Abs. 1 Satz 2 HPflG<br />
lautet:<br />
„Das gleiche gilt, wenn der Schaden, ohne auf den<br />
Wirkungen der Elektrizität, der Gase, Dämpfe oder<br />
Flüssigkeiten zu beruhen, auf das Vorhandensein<br />
einer solchen Anlage zurückzuführen ist, es sei denn,<br />
dass sich diese zur Zeit der Schadensverursachung in<br />
ordnungsmäßigem Zustand befand. Ordnungsmäßig ist eine<br />
Anlage, solange sie den anerkannten Regeln der Technik<br />
entspricht und unversehrt ist.“<br />
Dabei geht es um Schäden, die auf die Existenz einer<br />
Anlage zurückzuführen sind, aber nicht auf transportierte<br />
Stoffe. Dies ist der Grund dafür, dass die Haftung hier<br />
an einen regelwidrigen Zustand der Anlage anknüpft.<br />
Nachfolgend bleibt diese Regelung angesichts des Aufsatzthemas<br />
außer Acht. Gleiches gilt für die Haftung bei<br />
verschuldeten, also mindestens fahrlässig verursachten,<br />
Stoffaustritten. Für diese gelten abweichende Eingangsvoraussetzungen;<br />
die nachfolgenden Ausführungen zum<br />
Inhalt der ggf. eingreifenden Haftung gelten aber jedenfalls<br />
prinzipiell sinngemäß (es gibt allerdings im Detail<br />
Unterschiede).<br />
Was ist zu ersetzen?<br />
Zum Inhalt der Haftung führt das HPflG nichts Konkretes<br />
aus, es beschränkt sich auf die Wendung, der Inhaber einer<br />
Leitung habe „den entstehenden Schaden zu ersetzen“.<br />
Aus juristischer Sicht liegt darin aber nicht etwa eine Lücke,<br />
sondern eine sparsame Gesetzgebungstechnik, die Wiederholungen<br />
vermeidet. Es gibt nämlich allgemeine Regeln über<br />
den Schadensersatz in den §§ 249 ff. BGB, die im Bereich<br />
des HPflG anwendbar sind [7]. Die Kernaussage findet sich<br />
in § 249 Abs. 1 BGB:<br />
„Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand<br />
herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz<br />
verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.“<br />
Diese Vorschrift formuliert die Grundidee einer vollständigen<br />
Wiederherstellung des Zustandes vor der<br />
Beschädigung in Natur (Naturalrestitution). Aus dieser<br />
Grundidee leitet sich ab, dass ein Rohrleitungsbetreiber<br />
ggf. alle Schäden beseitigen muss, die aus der durch die<br />
ausgetretenen Stoffe verursachten Sachbeschädigung<br />
resultieren. Gemeint ist damit aber kein bis ins Detail<br />
identischer Zustand, sondern ein wirtschaftlich gleichwertiger<br />
(schadensfreier), was etwa bei einer unvermeidbaren<br />
geringfügigen optischen Beeinträchtigung wie dem<br />
Austausch beschädigter Klinkersteine durch nicht exakt<br />
übereinstimmende einen bedeutsamen Kostenunterschied<br />
machen kann.<br />
Von dem Grundsatz, dass der Schädiger den Schaden<br />
selbst beseitigen soll, lässt § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB für<br />
die beiden bei weitem wichtigsten Schadensarten eine<br />
praktisch sehr wichtige Ausnahme zu:<br />
„Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen<br />
Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten,<br />
so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu<br />
erforderlichen Geldbetrag verlangen.“<br />
Das Gesetz mutet also niemandem zu, sich zur Reparatur<br />
gerade an denjenigen zu wenden, der einen Schaden überhaupt<br />
erst herbeigeführt hat (und der vielleicht gar nicht<br />
die Fähigkeiten besitzt, um ihn zu beseitigen).<br />
Gleichgültig, ob Betroffene sich für Naturalrestitution oder<br />
für Geldersatz entscheiden, müssen Schädiger sämtliche Folgen<br />
eines Schadensereignisses tragen, also auch mittelbare<br />
wie Betriebsstörungen oder zu einem späteren Zeitpunkt<br />
erforderliche Kontrollanalysen [8]. Aus der anwaltlichen<br />
Praxis lässt sich darüber hinaus berichten, dass gelegentlich<br />
(etwa im Bereich der Landwirtschaft) Imageeinbußen und<br />
Verluste von Zertifizierungen geltend gemacht werden.<br />
Ebenfalls zum zu ersetzenden wirtschaftlichen Schaden<br />
gehören beispielsweise Auf-wendungen zur Feststellung<br />
und Durchsetzung eines Ersatzanspruches, also vor allem<br />
Kosten für Sachverständige und anwaltliche Beratung (in<br />
der Regel nur in Höhe gesetzlicher Gebühren, nicht darüber<br />
hinausgehender besonders vereinbarter Vergütung). Im<br />
Fall einer Körperverletzung kommt Schmerzensgeld hinzu<br />
(§ 6 Satz 2 HPflG).<br />
Auf der anderen Seite schließt die Grundidee des deutschen<br />
Schadensrechts es aus, dass Betroffene am Ende<br />
besser dastehen als ohne Stoffaustritt aus einer Rohrleitung.<br />
Daraus folgt insbesondere, dass sie sich Verbesserungen<br />
oder Wertsteigerungen anrechnen lassen<br />
müssen, die im Zuge einer Reparatur entstehen. Ein<br />
typisches Beispiel ist die Beschädigung eines gealterten<br />
Bauwerks, das im Zuge einer Instandsetzung auf aktuellen<br />
Stand gebracht und dessen technische Lebensdauer<br />
verlängert wird (so genannter Abzug neu für alt). Der<br />
ursprüngliche Zustand – ohne Schadensereignis – lässt<br />
sich in solchen Fällen oft nicht wiederherstellen, und<br />
das wäre auch meist unsinnig. Trotzdem soll der Verursacher<br />
eines Schadens nicht sozusagen „draufzahlen“<br />
und dem Betroffenen etwas geben, was dieser vor der<br />
Beschädigung auch nicht hatte. Dies alles folgt aus dem<br />
§ 249 Abs. 1 BGB, denn zu dem hypothetischen schadensfreien<br />
Zustand gehören eben auch keine Gewinne<br />
infolge von Reparaturmaßnahmen.<br />
Prinzipiell kennt das deutsche Schadensrecht keine absolute<br />
Obergrenze für die Haftung. Das HPflG weicht davon aller-<br />
06 | 2014 37
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
dings ab: Gemäß seinem § 9 sind Ansprüche wegen Tötung<br />
oder Verletzung eines Menschen für jede Person auf einen<br />
Kapitalbetrag von 600.000 Euro oder auf einen Rentenbetrag<br />
von jährlich 36.000 Euro begrenzt. Bei Sachschäden regelt<br />
§ 10 HPflG eine Haftungsgrenze von 300.000 Euro für alle<br />
beschädigten Sachen; davon sind allerdings Grundstücke ausgenommen,<br />
für deren Beschädigung in unbegrenzter Höhe<br />
gehaftet werden muss. Wichtig ist, dass diese Haftungsgrenzen<br />
nur für die Gefährdungshaftung nach dem HPflG gelten.<br />
Falls also ein Rohrleitungsbetreiber aufgrund Fahrlässigkeit<br />
beim Betrieb der Leitung auch aufgrund anderer gesetzlicher<br />
Vorschriften haftet, gelten die Grenzen nicht.<br />
Da Grundstücksschäden von der Haftungsbegrenzung ausgenommen<br />
sind, kann je nach konkretem Fall eine Regelung<br />
aus dem allgemeinen Schadensrecht relevant werden, die<br />
in § 251 Abs. 2 BGB enthalten ist. Diese Vorschrift besagt<br />
im Ergebnis, dass Betroffene auf Wertersatz – anstelle von<br />
Wiederherstellung oder dem dafür erforderlichen Geldbetrag<br />
– beschränkt sind, wenn die Naturalrestitution unverhältnismäßig<br />
teuer wäre. Der vielfach bekannte Anwendungsfall dieser<br />
Regel ist die 130 %-Grenze, die sich bei der Beschädigung<br />
von Kraftfahrzeugen etabliert hat: Wenn die Reparaturkosten<br />
den Wert des Fahrzeugs um mehr als 30 % übersteigen, kann<br />
der geschädigte Eigentümer sie nicht verlangen, sondern muss<br />
sich mit dem Ersatz des Zeitwertes zufriedengeben. Völlig<br />
unwirtschaftliche Aufwendungen verlangt das Schadensrecht<br />
nicht. Allerdings gibt es nur bei Kfz-Schäden eine solche feste<br />
Grenze, was sich schlicht aus der Masse an Kraftfahrzeugen<br />
und Unfällen im Straßenverkehr und daraus folgenden Marktmechanismen<br />
und Nivellierungen erklärt. Grundstücke sind<br />
weit weniger abstrakt vergleichbar, zu ihrer Bewertung sind<br />
außerdem regelmäßig Verkaufs- und Abschreibungswerte<br />
heranzuziehen. Letztlich kommt es deshalb auf einen individuellen<br />
Vergleich des Verkehrswerts vor der Beschädigung<br />
mit den Wiederherstellungskosten an (wobei letztere ggf. um<br />
einen Abzug neu für alt zu bereinigen sind).<br />
Wer muss was beweisen?<br />
Kommt es zum Streit, ist die Beweislastverteilung von<br />
Bedeutung, also die Frage, ob der Geschädigte oder der<br />
Rohrleitungsbetreiber einen bestimmten Umstand belegen<br />
muss. Diesbezüglich gilt: Jede Partei muss prinzipiell (Abweichungen<br />
sind in Spezialfällen möglich) das beweisen, was<br />
ihr günstig ist, die Umstände, aus denen sie selbst etwas<br />
herleitet. Dementsprechend müssen Betroffene zum Beispiel<br />
den Kausalzusammenhang zwischen einem Ereignis<br />
an der Rohrleitung und einem Schaden nachweisen, und<br />
auch für die Schadenshöhe liegt die Beweislast bei ihnen.<br />
Auf der anderen Seite tragen Leitungsbetreiber etwa die<br />
Beweislast dafür, dass ein Betroffener aufgrund des Schadensereignisses<br />
Wertsteigerungen erzielt hat, die er sich<br />
anrechnen lassen muss.<br />
Schwierige Ermittlung: Entgangener Gewinn<br />
Auch entgangener Gewinn gehört zu den zu ersetzenden<br />
Schäden. Dies ergibt sich aus § 249 Abs. 1 BGB, denn<br />
zu dem schadensfreien Zustand gehören auch Werte,<br />
die dem Geschädigten ohne das Schadensereignis zugeflossen<br />
wären. Der Ersatz entgangenen Gewinns wirft<br />
allerdings gegenüber dem oben Behandelten eine Besonderheit<br />
auf: Es geht nicht um – zum Unfallzeitpunkt –<br />
existierende Güter, sondern um hypothetische zukünftige.<br />
Dadurch entsteht für Geschädigte ein Beweisproblem,<br />
denn sie können nicht auf einen zweifelsfrei vorhandenen<br />
Güterbestand verweisen, der infolge eines Ereignisses<br />
verringert wurde. Der Gesetzgeber nimmt Betroffenen<br />
dieses (unverschuldete) Problem durch eine Beweiserleichterung<br />
ab: Gemäß § 252 Satz 2 BGB gilt der Gewinn<br />
als entgangen,<br />
„welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder<br />
nach den besonderen Umständen, insbesondere nach<br />
den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit<br />
Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte“.<br />
Welches Maß an Wahrscheinlichkeit erforderlich ist, lässt<br />
dieser Wortlaut offen. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung<br />
heißt es, es müsse „nach den Umständen des<br />
Falls wahrscheinlicher [sein], dass der Gewinn ohne das<br />
haftungsbegründende Ereignis erzielt worden wäre, als<br />
dass er ausgeblieben wäre“ [9], wobei „eine Differenzierung<br />
zwischen „gewisser” oder „überwiegender”<br />
Wahrscheinlichkeit nicht ohne weiteres weiter“ führe [10].<br />
In einer neueren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof<br />
dagegen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit verlangt<br />
[11]. Diese vergleichsweise unscharfen Formulierungen<br />
zeigen, wie komplex es ist, in einem konkreten Fall zu<br />
beurteilen, was als entgangener Gewinn zu ersetzen<br />
ist. Jedenfalls bloße Gewinnchancen begründen keine<br />
hinreichend gefestigte Erwartung. Ein Ansatzpunkt<br />
zur Beurteilung konkreter Fälle kann darin liegen, die<br />
Gewinn- und Verlustrechnung betroffener Betriebe als<br />
Grundlage heranzuziehen. Diese geben auch hinsichtlich<br />
der Anrechnung ersparter Betriebsausgaben Aufschluss<br />
(solche Ersparnisse müssen Geschädigte sich entgegenhalten<br />
lassen, weil sie sonst am Ende wirtschaftlich besser<br />
dastünden als ohne das Schadensereignis – siehe dazu<br />
schon oben).<br />
Nicht lösen lässt sich mit diesen und vergleichbaren<br />
Unterlagen ein Problem, das zum Beispiel beim Austreten<br />
von Stoffen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen<br />
auftreten kann: Wenn nicht mit hinreichender Sicherheit<br />
feststellbar ist, ob und wann betroffene Flächen wieder<br />
für den Anbau zur Verfügung stehen, muss auch eine<br />
Zeitspanne bestimmt werden, für welche die betriebswirtschaftlichen<br />
Daten aus der Vergangenheit in die Zukunft<br />
projiziert wer-den. Stehen Flächen langfristig nicht zur<br />
Verfügung (weil sie nicht saniert werden können), bedeutet<br />
dies einerseits, dass sie auf unabsehbare Zukunft<br />
nicht die Einnahmen aus der Vergangenheit generieren<br />
werden. Auf der anderen Seite steigt mit zunehmender<br />
Länge des betrachteten Zeitraums die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass das Betriebsergebnis aus anderen Gründen<br />
als dem Schadensereignis sinken würde: Zu denken ist<br />
38 06 | 2014
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
hier beispielsweise an natürliche Ein-flüsse, denen jede<br />
landwirtschaftliche Tätigkeit unterliegt. Andere Abschwächungen<br />
könnten – im Lauf der Zeit mit zunehmender<br />
Wahrscheinlichkeit – durch unternehmerische Konkurrenz<br />
oder durch einen Preisverfall für die in der Vergangenheit<br />
produzierten Früchte eintreten. Derartige allgemeine<br />
Betriebsrisiken gehen nicht auf das Austreten von Stoffen<br />
aus der Rohrleitung zurück und sind daher auch nicht<br />
zu ersetzen.<br />
§ 252 BGB Satz 2 BGB ist im Übrigen eine Beweiserleichterung<br />
für Geschädigte, aber keine Sperre für den<br />
Nachweis höherer Gewinneinbußen. Betroffene haben<br />
auch Anspruch auf den Ersatz eines ungewöhnlich hohen<br />
entgangenen Gewinns, aber insoweit erleichtert ihnen<br />
das Recht nicht die Beweisführung.<br />
Ratschläge<br />
Unplanmäßiges Austreten von Transportmedien aus<br />
Rohrleitungsanlagen kann Betreiber vor eine Mehrzahl<br />
schwieriger Aufgaben stellen. Mitarbeitern wird dann in<br />
kurzer Zeit viel abverlangt, um mit möglichen Gefahren<br />
und verständlicher Besorgnis von Anwohnern effektiv<br />
und sachlich umzugehen. Oberstes Gebot muss dabei<br />
sein, akut eine Verschlechterung der Lage zu verhindern.<br />
Später – bei nachträglicher Betrachtung ohne Zeitdruck<br />
– kann sich herausstellen, dass eine Situation weniger<br />
eindeutig ist als ursprünglich gedacht. Deshalb sollte man<br />
sich in Akutsituationen nicht zu vorschnellen Erklärungen<br />
über die Ursache eines Schadens hinreißen lassen, hinter<br />
die unter Umständen sowohl juristisch als auch in der<br />
öffentlichen Wahrnehmung selbst bei besserem Wissen<br />
nicht mehr zurückgelangt werden kann.<br />
Dies schließt aber nicht aus, auf Betroffene zuzugehen,<br />
deren Ärger und deren Ängste ernst zu nehmen und alles<br />
in die Wege zu leiten, um die Situation möglichst rasch<br />
zu klären: Aus rechtlicher Sicht gibt es bei Schadensfällen<br />
keinen Grund zu absichtlicher Verzögerung, auch wenn<br />
ein solcher Vorwurf gegenüber Unternehmen und deren<br />
Anwälte immer wieder einmal erhoben wird. Beispielsweise<br />
können bei erheblicher Betroffenheit und jedenfalls<br />
grundsätzlich feststehender Schädigung Abschlagszahlungen<br />
auf eine spätere endgültige Schadensregulierung<br />
erbracht werden. Juristisch lässt sich dies je nach Wunsch<br />
der Beteiligten auch so gestalten, dass damit kein Schuldanerkenntnis<br />
verbunden ist.<br />
Von wesentlicher Bedeutung kann – bei größeren Schadensfällen<br />
– die interne Koordination der zu treffenden<br />
Maßnahmen sein. Wegen der unvermeidbaren Außenwirkung<br />
und Kommunikation unter mehreren Betroffenen<br />
muss deren Gleichbehandlung sichergestellt werden;<br />
Abweichungen lassen sich typischerweise nur durch (für<br />
die Betroffenen nachvollziehbare) sachliche Unterschiede<br />
begründen. Zugleich treten bei größeren Ereignissen<br />
regelmäßig Überwachungs- und unter Umständen auch<br />
Strafverfolgungsbehörden auf den Plan. Auch gegenüber<br />
diesen müssen die juristischen Maßnahmen abgestimmt<br />
werden, um unnötige Zusatzbelastungen zu vermeiden.<br />
Diese Aufgabe obliegt allerdings weniger den technischen<br />
Mitarbeitern als der Rechtsabteilung, für deren Tätigkeit<br />
in außergewöhnlichen Situationen sich die Vorbereitung<br />
von Handlungsanweisungen für die Akutreaktion unter<br />
hohem zeitlichem und psychologischem Druck bewährt<br />
hat.<br />
Literatur:<br />
[1] Zu nennen ist insoweit vor allem § 89 Abs.2 des<br />
Wasserhaushaltsgesetzes, der Schäden infolge nachteiliger<br />
Veränderung von Gewässern (dazu gehört nach den<br />
gesetzlichen Regelungen auch das Grundwasser) betrifft.<br />
[2] Schulze, Die Gefährdungshaftung der Betreiber von<br />
Rohrleitungen, insbesondere von gemeindlichen Ver- und<br />
Entsorgungsleitungen, VersR 2000, 1337 (1338)<br />
[3] Siehe dazu BGH, Beschl. v. 30. 4. 2008 - III ZR 5/07, NVwZ<br />
2008, 1157<br />
[4] OLG Hamm, Urt. v. 29.11.1988, 10 U 73/88, ZfB 130 (1989),<br />
228; Sachverhalt abgedruckt in der Vorentscheidung des LG<br />
Dortmund, Urt. v. 25.02.1988, 2 O 621/87, ZfB 130 (1989), 231<br />
[5] BGH, Urt. v. 05.10.1989, III ZR 66/88, NJW 1990, 1167 (1168);<br />
BGH, Urt. v. 13.10.2005, III ZR 346/04, NJW 2006, 223 (224);<br />
Kaufmann, in: Geigel, Haftpflichtprozess, 26. Aufl. 2011, Kap.<br />
26 Rn. 72<br />
[6] Filthaut, Zur Wirkungshaftung nach § 2 I 1 HPflG, NJW 1983,<br />
2687<br />
[7] OLG Hamm, Urt. v. 19.11.2009, 6 U 129/09, BeckRS 2011,<br />
06510; AG Mannheim, Urt. v. 16.07.2009, 31 C 1/08, NJOZ<br />
2010, 2252 (2254)<br />
[8] So zum Beispiel OLG Rostock, Urt. v. 20.07.2006, 7 U 117/04,<br />
NJW 2006, 3650 (3653)<br />
[9] BGH, Urt. v. 27.09.2001, IX ZR 281/00, NJW 2002, 825 (826)<br />
[10] BGH, Urt. v. 26.07.2005, X ZR 134/04, NJW 2005, 3348 (3349)<br />
[11] BGH, Urt. v. 09.11.2010, VI ZR 300/08, NJW 2011, 1145 (1147<br />
in Rz. 23)<br />
RA Dr. MICHAEL NEUPERT<br />
Partner der Kanzlei Kümmerlein Simon &<br />
Partner Rechtsanwälte mbB, Essen<br />
AUTOR<br />
Tel: +49 (0) 201 1756-624 (Sekretariat Frau<br />
Bieck)<br />
E-Mail: Michael.Neupert@kuemmerlein.de<br />
06 | 2014 39
DWA RECHT & REGELWERK<br />
Regelwerk<br />
Entwurf Merkblatt M 149-3 „Zustandserfassung und –beurteilung<br />
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 3:<br />
Zustandsklassifizierung und –bewertung“<br />
AUFRUF ZUR<br />
STELLUNGNAHME<br />
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e. V. (DWA) hat den Entwurf eines Merkblatts<br />
vorgelegt, das die gleichnamige Publikation von 2007<br />
ersetzt. Die Neufassung wurde notwendig, da sich durch die<br />
Überarbeitung der europäischen Normung - insbesondere<br />
DIN EN 13508-2:2011 in Verbindung mit Merkblatt DWA-M<br />
149-2:2013 - die Grundlagen für die Zustandsbeurteilung<br />
verändert haben. Das Anwendungsbeispiel in Anhang A<br />
wurde fortgeschrieben.<br />
DWA-M 149-3 gewährleistet auf der Grundlage des Kodiersystems<br />
einen abgestimmten Arbeitsablauf zur Zustandserfassung<br />
und -beurteilung. Es berücksichtigt weiterhin eine<br />
sinnvolle Einordnung der Teilaufgabe „Zustandsbeurteilung“<br />
in den Gesamtarbeitsablauf zur Sanierung von Entwässerungssystemen,<br />
wie er in DIN EN 752 beschrieben ist.<br />
Das Merkblatt ist aufgegliedert in einen allgemeinen Teil<br />
und ein Anwendungsbeispiel im Anhang. Der allgemeine<br />
Teil stellt grundsätzliche Anforderungen an die Zustandsklassifizierung<br />
und -bewertung, die unabhängig vom Beurteilungsmodell<br />
im Sinne einer Vergleichbarkeit eingehalten<br />
werden sollten. Im Anhang wird ein mögliches Verfahren<br />
zur Umsetzung der Anforderungen aufgezeigt. Andere<br />
Beurteilungsmodelle können, soweit diese die grundsätzlichen<br />
Anforderungen erfüllen, ebenfalls angewandt werden.<br />
Das Merkblatt richtet sich an alle im Bereich der Zustandserfassung<br />
und -beurteilung von Entwässerungssystemen<br />
planenden, betreibenden sowie Aufsicht führenden Institutionen<br />
und Firmen.<br />
Frist zur Stellungnahme: Hinweise und Anregungen zu<br />
dieser Thematik nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
entgegen. Das Merkblatt DWA-M 149-3 wird bis zum 15.<br />
Juli 2014 öffentlich zur Diskussion gestellt. Stellungnahmen<br />
bitte schriftlich, möglichst in digitaler Form, an:<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
Dipl.-Ing. Christian Berger<br />
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef<br />
Tel: 02242/872 126, E-Mail: berger@dwa.de<br />
Ausgabe: April 2014, 69 Seiten, EUR 52,80 für DWA-Mitglieder, EUR 66 Euro für Nicht-Mitglieder<br />
Merkblatt M 190 „Anforderungen an die Qualifikation von Unternehmen<br />
für Herstellung, baulichen Unterhalt, Sanierung und Prüfung von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen“<br />
AUFRUF ZUR<br />
STELLUNGNAHME<br />
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e. V. (DWA) hat ein neues Merkblatt vorgelegt,<br />
das einheitliche Anforderungen an die Qualifikation von<br />
Unternehmen beschreibt, die mit der Herstellung, dem<br />
baulichen Unterhalt, der Prüfung und der Sanierung von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen befasst sind.<br />
Ein differenzierter Anforderungskatalog zur Feststellung<br />
der Qualifikation von hier tätigen Unternehmen existiert<br />
derzeit nicht. In den Satzungen deutscher Städte und<br />
Gemeinden finden sich zumeist nur allgemein gehaltene<br />
qualitätsorientierte Anmerkungen zu Herstellung, Erweiterung<br />
und Unterhalt von Anschlusskanälen und Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
mit der Folge, dass viele<br />
Anlagen saniert werden müssen. Eine mangelhafte Ausführung<br />
durch fachlich nicht geeignete Unternehmen oder<br />
nicht qualifiziertes Personal sowie eine fehlende Überwachung<br />
der Arbeiten sind hierfür zumeist ursächlich.<br />
Durch undichte Anschlusskanäle und Grundleitungen tritt<br />
jedoch insbesondere bei Rückstau Abwasser aus und kann<br />
den Boden oder das Grundwasser verunreinigen. Durch<br />
Infiltration von Grundwasser sowie durch Fehlanschlüsse<br />
gelangen zudem erhebliche Fremdwassermengen in die<br />
Abwasseranlage.<br />
DWA-M 190 behandelt unter anderem die Ausführungsbereiche<br />
der Grundstücksentwässerungsanlagen und die<br />
Prinzipien der Eigenüberwachung. Der Nachweis der geforderten<br />
Qualifikation ist nicht Gegenstand des Merkblatts.<br />
Das Merkblatt soll öffentliche wie private Bauherren – hier<br />
vor allem Architekten – dafür sensibilisieren, bei der Beauftragung<br />
von Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
nur fachlich qualifizierte Unternehmen auszuwählen.<br />
Den Kommunen werden darüber hinaus Empfehlungen zur<br />
Einführung und zum Vollzug einer Fachunternehmerpflicht<br />
auf Satzungsbasis gegeben.<br />
Ausgabe: April 2014, EUR 30,40 für DWA-Mitglieder, EUR 38 Euro für Nicht-Mitglieder<br />
40 06 | 2014
RSV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten Rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RECHT www.vulkan-verlag.de<br />
& REGELWERK DVGW<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in Entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlussleitungen –<br />
Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Erneuerung von Entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RSV Information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die Erhaltung und<br />
Erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
Jetzt bestellen!<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | Fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin RSV-Mitglied und erhalte 20 % Rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
___ Ex. RSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen.<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher 04-05 Industrieverlag | 2014 oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
41<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XFRSVM2014
FACHBERICHT SPEZIAL: BODENMANAGEMENT<br />
Anforderungen an Böden und<br />
Verfüllstoffe im Bereich unterirdischer<br />
Infrastruktur<br />
Im Untergrund unserer Städte wird es eng. Ver- und Entsorgungsleitungen mit Netzlängen von über 2,7 Million Kilometer [1]<br />
sind in Deutschland verlegt. Unter den Straßen und Gehwegen finden sich Kanäle, Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen<br />
sowie Kabel für Strom und Telekommunikation (vgl. [2] und [3]) (vgl. Bild 1). Hinzu kommen höhere Anforderungen an die<br />
Versickerung von Regenwasser (vgl. [4]) und auch Straßenbäume und anderes Grün fordern Raum im Untergrund für ein<br />
gesundes Wurzel- und Pflanzenwachstum (vgl. [5-8]). Jede Nutzung fordert entsprechende Umgebungsbedingungen. Dies<br />
betrifft die bautechnischen und vegetationstechnischen Eigenschaften der eingesetzten Böden und Verfüllstoffe ebenso wie<br />
die natürlichen Funktionen des Bodens. In der Praxis kann dies dazu führen, dass eine Überforderung des Untergrunds mit<br />
erheblichen Konflikten und Entwicklungsengpässen entsteht. In Planung und Bautechnik sind angemessene Lösungen gefragt.<br />
Nachfolgend werden wesentliche Argumentationslinien und Entwicklungen für den deutschsprachigen Raum dargestellt.<br />
Einsatzbereiche und Regelwerke<br />
Der Boden mit seinen natürlichen Funktionen ist ein endliches<br />
Gut. Dies spiegelt sich in den aktuellen Gesetzen und<br />
den Regelwerken zum Bodenschutz wider. Eine europäisch<br />
einheitliche Regelung ist noch nicht verabschiedet, liegt<br />
aber im Entwurf bereits vor [9]. Bis zur Verabschiedung und<br />
Ratifizierung wird der Bodenschutz weiter auf nationaler<br />
Ebene geregelt. In Deutschland hat der Bodenschutz 1998<br />
mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und der<br />
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)<br />
eine einheitliche Grundlage erhalten. Diese wird durch<br />
vorrangige Rechtsvorschriften wie das Kreislaufwirtschaftsgesetz,<br />
das Wasserhaushaltsgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz<br />
erweitert. In der Schweiz ist der Bodenschutz<br />
zum Beispiel im Umweltschutzgesetz in Ergänzung mit der<br />
Verordnung über Belastung des Bodens (VBBo) geregelt.<br />
Zu den natürlichen Bodenfunktionen, die den Boden zu<br />
einem endlichen Gut machen, lassen sich nach dem Bundesbodenschutzgesetz<br />
[10] folgende Eigenschaften zählen:<br />
Bild 1: Der unterirdische Raum mit seinen vielfältigen Nutzungen im<br />
urbanen Bereich<br />
»»<br />
Natürliche Funktionen als: Lebensgrundlage und Lebensraum<br />
für Menschen, Tiere, Pflanzen, Bodenorganismen;<br />
Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere<br />
mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen; Abbau-,<br />
Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen<br />
auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften,<br />
insbesondere auch zum Schutz des<br />
Grundwassers;<br />
»»<br />
Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte<br />
sowie<br />
»»<br />
Nutzungsfunktionen als: Rohstofflagerstätte; Fläche<br />
für Siedlung und Erholung; Standort für die land- und<br />
forstwirtschaftliche Nutzung; Standort für sonstige<br />
wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr,<br />
Ver- und Entsorgung.<br />
Neben den natürlichen Bodenfunktionen spielen die technischen<br />
Eigenschaften von Böden und Verfüllstoffen für<br />
die unterirdische Infrastruktur eine wichtige Rolle. So werden<br />
diese u.a. in zahlreichen Regelwerken angesprochen,<br />
dies betrifft insbesondere folgende Einsatzbereiche und<br />
Nutzungen:<br />
»»<br />
Gründungen und Fundamente, insbesondere standfester<br />
Untergrund, siehe z. B. DIN 1054-1 [11], DIN 1536 [12]<br />
und DIN EN 1997-1 [13]<br />
»»<br />
Straßenbau, insbesondere Untergrund und Planum,<br />
siehe z. B. RASt 06 [14], DIN 4301 [15] und DIN EN<br />
13286 [16]<br />
»»<br />
Kanal- und Leitungsbau, insbesondere Bettungswirkung<br />
und Belastung aus Hauptverfüllung, siehe z. B. ATV-<br />
DVWK A 127 [17], DIN 4124 [18] und DIN EN 1610 [19]<br />
»»<br />
Regenwasserbewirtschaftung, insbesondere Versickerungsfähigkeit<br />
und Wasserspeicherung, siehe z. B. DWA<br />
A 138 [4], DIN 1989-1 [20], BWK-Fachinformationen<br />
1/2013 [21] und Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen<br />
[22]<br />
42 06 | 2014
SPEZIAL: BODENMANAGEMENT FACHBERICHT<br />
»»<br />
Wärmegewinnung aus Abwasser, siehe z. B. DWA M<br />
114 [23]<br />
»»<br />
Wärmespeicherung, siehe z. B. Forschungsbericht der<br />
ITW [24]<br />
»»<br />
Neutrassierung von Hochspannungsleitungen, vermehrt<br />
als Erdkabel, siehe z. B. dena [25], 26. BImSchV [26] und<br />
BGV B11 [27]<br />
»»<br />
Pipelines (Gas, Wasser, Öl), insbesondere Bettung und<br />
Korrosionseigenschaften (Schutz, Aggressivität), siehe<br />
z. B. DIN 30675-1[28], DIN 50929-3:1985-09 [29],<br />
DVGW GW 9 [30] und ÖWAV-Arbeitsbehelf 39 [31]<br />
»»<br />
Fernwärmeleitungen, insbesondere Reibungsverhalten,<br />
siehe z. B. FW 401 Teil 1-18 [32] und FW 420 Teil 5 [33]<br />
»»<br />
Grünflächen, insbesondere Substrateigenschaften, siehe<br />
z. B. DIN 19731 [34], FLL - Empfehlungen für Baumpflanzungen<br />
[7] und RAS-LP4 [35]<br />
Konfliktpotenziale und Trends<br />
In dichtgedrängten Ballungsräumen überlagern sich die<br />
vorgenannten Einsatzbereiche häufig, so dass ein und derselbe<br />
Bodenkörper mehrere der o.a. Funktionen gleichzeitig<br />
erfüllen muss. Typische Beispiele sind:<br />
»»<br />
Versickerung und Speicherung von Regenwasser im<br />
unterirdischen Pflanzraum von Bäumen<br />
»»<br />
Bettung und Grabenverfüllung im Leitungsbau als Unterbau<br />
für die Straße und gleichzeitig als Schutzhülle gegen<br />
Interaktionen mit Vegetation<br />
»»<br />
Schaffung von Retentionsraum zur Abmilderung von<br />
Abflussspitzen bei Starkregenereignissen zum Einstauschutz<br />
des Straßenraumes.<br />
Eine verstärkte Nutzung des Untergrundes ist auch mit<br />
Blick auf aktuelle Entwicklungen zu erwarten, z. B.<br />
»»<br />
im Zuge der Energiewende die Erweiterung und der<br />
Ausbau der Fernwärmenetze, die Erdverlegung von<br />
Stromkabeln und die Gasnetzerweiterungen und<br />
-umbauten durch Power-to-gas-Entwicklungen zur<br />
Zwischenspeicherung und Transport von regenerativ<br />
hergestelltem Gas (vgl. [36], [37])<br />
»»<br />
aus Folgen eines Klimawandels herrührende Maßnahmen<br />
zum Umgang mit Überflutungsereignissen und<br />
verstärkte Ableitung von Niederschlagswasser in den<br />
und durch den Untergrund (vgl. [21])<br />
»»<br />
zur Steigerung der Lebensqualität in Städten herrührende<br />
Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas<br />
durch Begrünung und Beschattung, und damit erhöhte<br />
Anforderungen an Pflanzraum und Substratqualität<br />
(vgl. [38])<br />
»»<br />
der Ausbau der Breitbandinfrastruktur und die Verlegung<br />
in (halb-)offener und geschlossener Bauweise<br />
(vgl. [39], [40])<br />
»»<br />
Anlagen zur Grundwasserregulierung in Gebieten ehemaliger<br />
Bergbautätigkeit und erhöhten Grundwasserständen.<br />
(vgl. [41], [42]).<br />
Die vorgenannten Entwicklungen lassen Konflikte erwarten.<br />
Diese Konflikte als Chance für eine zukunftsweisende<br />
Bodennutzung zu begreifen, wird eine zentrale Aufgabe<br />
der nächsten Jahre sein.<br />
Chancen und Herausforderungen<br />
Besondere Perspektiven bieten sich für eine langfristige<br />
Raumplanung und -koordination. Dies betrifft produktseitig<br />
den Einsatz innovativer Böden und Verfüllstoffe im<br />
Untergrund unserer Städte [43] und bei der Planung die<br />
konstruktive Ausführung und das Management. Anforderungen<br />
an den Raumbedarf und Einsatz von Böden leiten<br />
sich bisher aus der oberirdischen Nutzung ab (vgl. [8], [6])<br />
oder sie werden branchenspezifisch definiert, ohne andere<br />
Nutzungen überhaupt zu berücksichtigen. Typische Beispiele<br />
finden sich in der DIN 1998 [2] mit allgemeinem Bezug zu<br />
den Leitungsnetzen, DIN EN 1610 [19] für die offene Bauweise<br />
von Kanälen und Leitungen, FGSV RAL [44] für den<br />
Straßenraum, DVGW GW 9 [31] mit Blick auf die Bettung<br />
von Versorgungsleitungen für Gas- und Wasser, AGFW<br />
FW 401 [33] als Regelwerk für Fernwärmeleitungen sowie<br />
DWA A 138 [4] in der Regenwasserbewirtschaftung sowie<br />
FLL-Empfehlungen [7] als Vorgaben für Pflanzsubstrate.<br />
Zum Teil werden auch Mindestabstände zu anderen Trägern<br />
definiert (vgl. [45], [5]) und die Planer damit vor Randbedingungen<br />
und Zielkonflikte gestellt, die in dicht besiedelten<br />
Ballungsräumen kaum mehr zu lösen sind.<br />
Vielfältige Nutzungen wurden in der Vergangenheit aber auch<br />
realisiert, wenn die vorgenannten normativen Randbedingungen<br />
gar nicht eingehalten werden konnten. Die Herausforderung<br />
liegt dann darin, die Situation realistisch einzuschätzen,<br />
zu akzeptieren und Verantwortung so zu organisieren, dass sie<br />
von allen Trägern auch angenommen werden kann. Akzeptanz<br />
lässt sich insbesondere erhöhen, wenn als treibende Kraft für<br />
koordinierte Maßnahmen z. B. der Kanalbau herangezogen<br />
wird (vgl. Göttingen [46]). Der offenen Bauweise und der<br />
Wahl der eingesetzten Böden kommt dann eine besondere<br />
Rolle zu, denn erst durch die klare räumliche Zuordnung der<br />
Bodenfunktionen für Fundamente, Leitungstrassen, Pflanzräume<br />
und weitere Nutzungen lassen sich Zielkonflikte, z. B.<br />
aus pauschalen Mindestabständen, lösen.<br />
Weitere Chancen bieten sich, wenn Lebenszyklusanalysen<br />
infrastrukturübergreifend aufeinander abgestimmt werden.<br />
Dies betrifft die eingebauten Rohre und Bauteile, ebenso<br />
wie den Boden und die Verfüllstoffe, denn auch diese sind<br />
als Teil des Bauwerks anzusehen [47]. Insbesondere der<br />
Porenraum und die Wasserdurchlässigkeit spielen dabei eine<br />
besondere Rolle, wenn z. B. einerseits örtliche Barrieren,<br />
z. B. als Wurzelschutz [48], die Dauerhaftigkeit sichern sollen<br />
und anderseits großräumig die Wasserdurchlässigkeit hydrogeologisch<br />
gefordert ist, um langfristige wasserwirtschaftliche<br />
Ziele zu erreichen. Auch statische Wechselwirkungen<br />
des Rohr-Boden-Systems mit angrenzenden Maßnahmen,<br />
z. B. durch Lastumlagerungen, sind zu berücksichtigen. Die<br />
Bewertung vorhandener Bodensysteme, die Entwicklung<br />
neuer Böden und Verfüllstoffe sowie Bautechniken und der<br />
Einsatz innovativer Planungsinstrumente [49] kann helfen,<br />
die Robustheit des Systems über den gesamten Lebenszyklus<br />
zu erhöhen. Mit Blick auf kleine Grabentiefen, dauerhaft<br />
06 | 2014 43
FACHBERICHT SPEZIAL: BODENMANAGEMENT<br />
stabile Bettungsbedingungen und definierte Lösbarkeit bei<br />
späteren Aufgrabungen ist der Einsatz zeitweise fließfähiger<br />
Verfüllböden exemplarisch zu nennen (vgl. [44]).<br />
Literatur<br />
[1] IKT: Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur, Destatis<br />
und Umweltbundesamt, eigene Berechnung, Gelsenkirchen,<br />
01/2014 (unveröffentlicht)<br />
[2] DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen und Anlagen in<br />
öffentlichen Flächen, Richtlinien für die Planung“ (1978-05)<br />
[3] FGSV „Allgemeine Technische Bestimmungen für die Benutzung<br />
von Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien“,<br />
ATB-BeStra, Köln, 2008<br />
[4] DWA-Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und Betrieb von<br />
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (2005-04)<br />
[5] DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz<br />
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei<br />
Baumaßnahmen“ (2002-08)<br />
[6] FLL-Empfehlung „Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil<br />
1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege“, Bonn, 2005<br />
[7] FLL-Empfehlung „Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil<br />
2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben<br />
und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“, Bonn,<br />
2010<br />
[8] DWA-Merkblatt M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und<br />
Kanäle“ (2013-02)<br />
[9] Directive of the European Parliament and of the Council<br />
establishing a framework for the protection of soil<br />
(„Bodenschutzrichtlinie”) vom 22. September 2006 (2004/35/<br />
EC/* COM/2006/0232)<br />
[10] BBodSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen<br />
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-<br />
Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502)<br />
[11] DIN 1054-1 „Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und<br />
Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1“<br />
(2009-09)<br />
[12] DIN 1536 „Betonpfähle“ (2010-12)<br />
[13] DIN EN 1997-1 „Entwurf, Berechnung und Bemessung in der<br />
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln“ (2009-09)<br />
[14] FGSV „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“, RASt 06,<br />
Köln, 2007<br />
[15] DIN 4301 „Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im<br />
Bauwesen“ (2009-06)<br />
[16] DIN EN 13286 „Ungebundene und hydraulisch gebundene<br />
Gemische“ (2013-02)<br />
[17] DWA-ATV-DVWK-A 127 „Statische Berechnung von<br />
Abwasserkanälen und- leitungen“ (2000-08)<br />
[18] DIN 4124 „Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau,<br />
Arbeitsraumbreiten“ (2012-01)<br />
[19] DIN EN 1610 „Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen<br />
und –kanälen“(2010-01)<br />
[20] DIN 1989-1 „Regenwassernutzungsanlagen - Teil 1: Planung,<br />
Ausführung, Betrieb und Wartung“ (2002-04)<br />
[21] Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft<br />
und Kulturbau e.V. (BWK): BWK-Fachinformationen 1/2013:<br />
„Starkregen und urbane Sturzfluten – Praxisleitfaden zur<br />
Überflutungsvorsorge“<br />
[22] FGSV-Merkblatt „Merkblatt für Versickerungsfähige<br />
Verkehrsflächen“, FGSV-Nr. 947, Köln, 2013<br />
[23] DWA-Merkblatt M 114 „Energie aus Abwasser - Wärme- und<br />
Lageenergie“ (2009-06)<br />
[24] Seiwald, H.; Kübler, R. et al.: Saisonale Wärmespeicherung mit<br />
vertikalen Erdsonden im Temperaturbereich von 40 bis 80 °C,<br />
Forschungsbericht, ITW, Universität Stuttgart, 1995<br />
[25] Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena): dena-Netzstudie<br />
II“, Berlin, 2010<br />
[26] Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des<br />
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über<br />
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV): Verordnung über<br />
elektromagnetische Felder in der Fassung der Bekanntmachung<br />
vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3266)<br />
[27] Berufsgenossenschaften: Berufsgenossenschaftliche<br />
Vorschriften - BGV B11: Elektromagnetische Felder“, Carl<br />
Heymanns Verlag, Köln, 2005<br />
[28] DIN 30675-1 „Äußerer <strong>Korrosionsschutz</strong> von erdverlegten<br />
Rohrleitungen aus Stahl -Schutzmaßnahmen und<br />
Einsatzbereiche“ (1992-02)<br />
[29] DIN 50929-3:1985-09 „Korrosion der Metalle;<br />
Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei<br />
äußerer Korrosionsbelastung; Rohrleitungen und Bauteile in<br />
Böden und Wässern“ (1985-09)<br />
[30] DVGW GW 9 „Beurteilung der Korrosionsbelastungen von<br />
erdüberdeckenden Rohrleitungen und Behältern aus unlegierten<br />
und niedrig legierten Eisenwerkstoffen in Böden“ (2011-05)<br />
[31] Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband<br />
(ÖWAV): ÖWAV-Arbeitsbehelf 39 „Korrosion im Wasser- und<br />
Abwasserfach“, Wien, 2010<br />
[32] AGFW-FW 401 Teil 1-18 „Verlegung und Statik von<br />
Kunststoffmantelrohren (KMR) für Fernwärmenetze“ (2007-12)<br />
[33] AGFW-FW 420 Teil 5 „Fernwärmeleitungen aus flexiblen<br />
Rohrsystemen: Planung, Bau und Montage, Betrieb“ (2011-12)<br />
[34] DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (1998-05)<br />
[35] FGSV-RAS-LP4 „Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil<br />
4: Landschaftspflege“, Köln, 1993<br />
[36] Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU): VKU-<br />
Information „Power to gas“, Köln, Dezember 2012.<br />
[37] Jarass, L.; Obermair, G. M.: Welchen Netzumbau erfordert die<br />
Energiewende?, Münster, 2012<br />
[38] Kuttler, W.; Dütemeyer, D. et al.: Handlungsleitfaden –<br />
Steuerungswerkzeuge zur städtebaulichen Anpassung an<br />
thermische Belastungen im Klimawandel, dynaklim-Publikation<br />
Nr. 34 / Februar 2013, Duisburg, 2013<br />
[39] Breitbandbüro des Bundes: Infoblatt: „Mitnutzung alternativer<br />
Infrastrukturen, Synergien im Breitbandausbau“, Berlin, Oktober<br />
2013<br />
[40] Verband der Anbieter von Telekommunikations- und<br />
Mehrwertdiensten (VATM): Glasfasernetze: Heute die<br />
Voraussetzungen für morgen schaffen. Leitfaden für<br />
Kommunen und Landkreise, Köln<br />
[41] Emschergenossenschaft: Sachstandsbericht, Grundwasserbewirtschaftung<br />
im Emschergebiet, Essen, 2012<br />
[42] Kaiser, H.-J.; Uibrig H.: Maßnahmen gegen Gefahren<br />
durch Grundwasserwiederanstieg im Sanierungsbereich<br />
Lausitz, Vortrag von der 5. Fachkonferenz am<br />
44 06 | 2014
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
1.3.2011: Wasserwirtschaftliche Maßnahmen in der<br />
Bergbaufolgelandschaft<br />
[43] Ruhr-Universität Bochum und IKT: Einsatz von Bettungsund<br />
Verfüllmaterialien im Rohrleitungsbau. Endbericht zum<br />
Forschungsvorhaben, gefördert durch das MUNLV NRW,<br />
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Grundbau und<br />
Bodenmechanik und IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur,<br />
Bochum Gelsenkirchen, 2006<br />
[44] FGSV-RAL - Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, FGSV-<br />
Nr. 201 (R1), Köln, 2012<br />
[45] DVGW G 463 „Gasleitungen aus Stahlrohren für einen<br />
Betriebsdruck größer als 16 bar – Errichtung“, Entwurf<br />
(2009-07)<br />
[46] IKT: International Webinar „Asset Management of Underground<br />
Infrastructure“ (AM 10/13-01/14), Teil 1/8 „Experience<br />
from Germany“: 21.10.2013, http://www.youtube.com/<br />
watch?v=YC49yOW2JMs, Zugriff am 27.1.2014<br />
[47] IKT: Gut gebettet liegen Rohre länger. IKT-Ergebnisheft 01/2007,<br />
IKT-Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen, 2007<br />
[48] Ruhr-Universität Bochum und IKT: Wurzeleinwuchs<br />
in Abwasserleitungen und Kanäle. Endbericht zum<br />
Forschungsvorhaben, gefördert durch das MUNLV NRW,<br />
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Spezielle Botanik<br />
und Botanischer Garten und IKT - Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur, Bochum Gelsenkirchen, 07/2004<br />
[49] IKT: Lehrgang „Sachkundiger für Vegetation und unterirdischer<br />
Infrastruktur“, Vortrag von Dirk Zimmermann: „Interaktionen<br />
zwischen Leitungen und Baumwurzeln – Ansätze zur<br />
Risikoeinschätzung mit innovativen GIS-Systemen“,<br />
Gelsenkirchen, 11. bis 13. September 2013<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
AUTOREN<br />
Prof. Dr.-Ing. BERT BOSSELER<br />
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur<br />
gGmbH, Gelsenkirchen<br />
Tel.: +49 (0)209 17806-0<br />
E-Mail: info@ikt.de<br />
MARCEL GOERKE, M.Sc.<br />
IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur<br />
gGmbH, Gelsenkirchen<br />
Tel.: +49 (0)209 17806-34<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45128 Essen<br />
06 | 2014 45
FACHBERICHT SPECIAL: BODENMANAGEMENT<br />
In Hannover klar geregelt:<br />
Bestandsbäume auf Versorgungstrassen<br />
Der Netzbetreiber enercity Netz und die Landeshauptstadt Hannover haben ein Konzept entwickelt, wie mit vorhandenen<br />
Bäumen im Bereich von Versorgungsleitungen umzugehen ist. Bestandteil der Vereinbarung ist eine Gefährdungsanalyse<br />
bei rund 44.000 Stadtbäumen im öffentlichen Raum. Festgelegt sind das Vorgehen, die Entscheidungswege und wer die<br />
Kosten der Maßnahmen trägt. Hannover war damit die erste Großstadt in Deutschland, die vertragliche Regelung für<br />
Bestandsbäume hat – das entwickelte Verfahren hat sich nach Einschätzung aller Beteiligten bewährt.<br />
INFO · INFO · INFO · INFO<br />
Die Gefahr für Netzbetreiber lauert überall<br />
Bei neuen Pflanzungen oder neuen Trassen gibt das DVGW-<br />
Merkblatt GW 125 seit Februar 2013 die Richtung vor. Doch<br />
vorhandene Bäume auf bestehenden Trassen sind von dem<br />
Regelwerk nicht erfasst (siehe Infokasten). Gerade hier schlummern<br />
jedoch große Gefahren in der Erde – und die Verkehrssicherungspflicht<br />
liegt beim Netzbetreiber. Auch ist das Entfernen<br />
des Baumes häufig nicht die erst beste Lösung. Die<br />
Beurteilung eines einzelnen Standortes ist für Experten im<br />
Prinzip keine Herausforderung: Mit einem Saugbagger wird<br />
der Wurzelbereich freigelegt; anschließend kann die Versorgungsleitung<br />
auf Schäden untersucht und die Gefährdung<br />
durch den Baum eingeschätzt werden. Drei Faktoren machen<br />
die Bestandsbäume auf Trassen jedoch zum Problem:<br />
»»<br />
große Anzahl – als Ausgangslage waren in Hannover rund<br />
44.000 Bäume im öffentlichen Raum zu bearbeiten,<br />
»»<br />
Naturschutz und Stadtbild – unabhängig von den versorgungstechnischen<br />
Erfordernissen sind weitere Aspekte zu<br />
berücksichtigen,<br />
»»<br />
Kosten – sowohl die systematische Untersuchung als auch<br />
die erforderlichen Maßnahmen gehen ins Geld.<br />
Die Verantwortung bleibt bei den Parteien vor Ort<br />
„Gleichwohl gilt das Merkblatt exakt „nur“ für die gemeinsame<br />
Nutzung des unterirdischen Raums bei Neupflanzung<br />
von Bäumen bzw. Neubau von unterirdischen Leitungen<br />
sowie Änderungen im Bestand. Das Merkblatt beantwortet<br />
also nicht die möglicherweise ebenso drängende Frage,<br />
ob der gegebene Bestand an Bäumen und Leitungen,<br />
unabhängig von irgendwelchen geplanten Eingriffen,<br />
aus Risikoerwägungen heraus angefasst werden muss.<br />
Die Auseinandersetzung damit bleibt weiterhin allein in<br />
der Verantwortung der Parteien vor Ort, auch wenn das<br />
Merkblatt zweifellos auch hier inhaltliche Unterstützung<br />
bieten kann.“<br />
Hinweis des DVGW bei Erscheinung der Neufassung des<br />
DVGW-Merkblatts GW 125, Februar 2013<br />
Quelle: http://www.dvgw.de/regelwerknews-de/archiv-rw-news/dvgwregelwerknews-nr-213/<br />
Nur wenige Netzbetreiber haben systematische Lösungen<br />
entwickelt; manche rüttelten erst Unfälle auf. Das von der<br />
enercity Netzgesellschaft, die in Hannover die Strom-, Erdgas-,<br />
Trinkwasser- und Fernwärme-Netze betreibt, gemeinsam<br />
mit der Landeshauptstadt Hannover entwickelte Vorgehen<br />
könnte daher für viele Netzbetreiber eine hilfreiche<br />
Blaupause sein. Es berücksichtigt die Gefahrenabwehr, die<br />
Kosten sowie den Naturschutz und enthält Workflows,<br />
mit denen die große Zahl an Straßenbäumen angemessen<br />
abgearbeitet werden kann. Seit Februar 2013 ist der Vertrag<br />
zwischen Kommune und Netzbetreiber unterschrieben und<br />
hat sich bewährt.<br />
Bei Gas ist der Handlungsbedarf hoch<br />
Die Gefährdungseinschätzung bei den vier Sparten Erdgas,<br />
Wasser, Strom und Fernwärme war der erste Schritt in Hannover.<br />
In Zusammenarbeit mit Sachverständigen entschied<br />
sich enercity Netz den Fokus auf die Gasleitungen zu legen.<br />
Hierzu führte unter anderem die Erkenntnis, dass bei Wasser-<br />
und Stromtrassen keine akute Personengefährdung zu<br />
erwarten ist und beschädigte Fernwärme-Leitungen in der<br />
Regel durch die Überwachungssysteme frühzeitig erkannt<br />
werden könnten. Die potenzielle Gefahr bei Gasleitungen<br />
besteht nach Ansicht der Fachleute im Niederdrucknetz<br />
ebenso wie bei Hochdruck und Mitteldruck.<br />
Ein digitaler Abgleich der Katasterkarte der städtischen<br />
Bäume mit den Trassenplänen verringerte die Anzahl der zu<br />
untersuchenden Standorte von 44.000 auf 15.918. Davon<br />
standen 710 Bäume im Bereich von Hochdruckleitungen,<br />
4.140 Bäume bei Mitteldruckleitungen und 11.068 entlang<br />
des Niederdrucknetzes. Aufgrund der Erfahrungen aus der<br />
Praxis und in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt G 466-1<br />
sowie den Aussagen von Experten wurde definiert, dass<br />
von Gasleitungen, die weiter als 20 m von Gebäuden entfernt<br />
sind in erster Näherung keine akute Gefährdung ausgeht.<br />
Gleiches gilt für Trassen, bei denen der Abstand vom<br />
Baumstamm (Borke) zur Leitung (außen) mehr als 150 cm<br />
beträgt. Durch diese und weitere Filter – die ebenfalls digital<br />
angewandt werden konnten – , wie Baumart, Vitalität oder<br />
Verlegetiefe der Leitung verringerte sich die Anzahl der zu<br />
untersuchenden Standorte auf 1.760 Bäume, die für eine<br />
Ortbegehung relevant waren.<br />
46 06 | 2014
SPECIAL: BODENMANAGEMENT FACHBERICHT<br />
Prozessablauf: Bäume auf Leitungen, Priorität 1<br />
16.01.2013<br />
Abgleich:<br />
Baumkataster &<br />
Leitungsbestand<br />
Priorität 1 bedeutet:<br />
- Gasversorgungsleitungen und Gashausanschlüsse<br />
- Fernwärmeleitungen<br />
- Stromleitungen 110kV<br />
- Abstand Borke zur Leitung ≤ 1,5 m<br />
Randbedingungen:<br />
- 20 m Abstand zu Gebäuden<br />
- Bäume im Schutzstreifen bis 2,50 m<br />
- nicht für Neupflanzungen, nicht für Leitungsneuverlegungen,<br />
nicht im Störungsfall<br />
Vitalität des<br />
Baumes 1/2?<br />
nein<br />
ja<br />
Kritische<br />
Baumart?<br />
nein<br />
ja<br />
Leitungstiefe<br />
< 2,0 m?<br />
nein<br />
ja<br />
Leitungsstilllegung<br />
geplant?<br />
ja<br />
nein<br />
Straßenumbau<br />
geplant?<br />
ja<br />
nein<br />
Kontrolle der<br />
Wurzelanläufe,<br />
Handschachtung<br />
Kritische<br />
Wurzelanläufe?<br />
nein<br />
ja<br />
Aufgrabung mit<br />
Saugbagger<br />
Besteht<br />
Gefahr für die<br />
Leitung?<br />
nein<br />
ja<br />
Wurzelentfernung<br />
möglich?<br />
ja<br />
Wurzel entfernen,<br />
Einbau Leitungsschutz<br />
aus Ton<br />
nein<br />
Muss<br />
der Baum<br />
bleiben?<br />
ja<br />
Leitung weicht<br />
nein<br />
Kostenträger<br />
entscheidet über<br />
die Maßnahme<br />
Baumbewertung:<br />
ökologische Funkt.<br />
ästhetische Funktion<br />
Zustand<br />
Potential<br />
Baumschutzsatzung<br />
Naturdenkmal<br />
kein weiterer<br />
Handlungsbedarf<br />
Bild 1: Systematisches Vorgehen bis zur Entscheidung, ob ein Baum entfernt wird oder die Leitung umzulegen ist<br />
06 | 2014 47
FACHBERICHT SPECIAL: BODENMANAGEMENT<br />
Prozessablauf<br />
Gesamt: 44.000<br />
Digitaler<br />
Abgleich<br />
Filter<br />
Begehung<br />
15.918 (100%) 1760 (11%) 691 (4%)<br />
Saugbagger<br />
Baumentfernung<br />
Leitungs-<br />
umlegung<br />
116 (0,7%) ca. 60/60<br />
Kostenregelung<br />
Wertausgleich<br />
Bild 2: Rund 44.000 Stadtbäume gibt es in Hannover – dieser Prozessablauf<br />
zeigt, wie die Standorte systematisch abgearbeitet wurden<br />
Bild 4: Druckstempel durch die Wurzel einer Eiche - nach<br />
Freilegen der Gasleitung mit einem Saugbagger wird geprüft,<br />
ob die Wurzel entfernt werden kann<br />
Leitungswert in %<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
Nach Begehung bleiben 4 %<br />
Bei der Besichtigung vor Ort beurteilte der Sachverständige<br />
besonders den Wurzelanlauf. Im Rahmen der mehrjährigen<br />
Verfahrensentwicklung in Hannover und aufgrund von<br />
Erfahrungen bei anderen Netzbetreibern verdichteten die<br />
Fachleute die Erkenntnisse, wann aus dem Übergangsbereich<br />
zwischen Stamm und Wurzel auf eine Gefährdung<br />
der Leitung geschlossen werden kann und wann diese<br />
unwahrscheinlich ist. Bei mehr als der Hälfte der Standorte<br />
war danach klar, dass weitere Untersuchungen aktuell nicht<br />
erforderlich sind. Von den knapp 16.000 Stadtbäumen,<br />
mit denen enercity Netz nach dem Abgleich der digitalen<br />
Wertermittlung einer Leitung<br />
Überlebensfunktion der St KKS-Leitung<br />
Wertverlust einer Leitung nach<br />
Vorstellung der LHH<br />
Kompromiss<br />
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200<br />
Leitungsalter in Jahren<br />
Bild 3: Leitungsalter in Jahren – Für den Wertausgleich beim Umlegen von Leitungen fanden<br />
die beiden Parteien einen tragfähigen Kompromiss<br />
Karten die ortsbezogene Untersuchung startet, blieben so<br />
691 übrig (rund 4 %).<br />
Der Einsatz eines Saugbaggers war an diesen Standorten<br />
der nächste Schritt. Das Freilegen der Wurzeln ermöglicht<br />
dreierlei:<br />
»»<br />
Wurzeln und Leitungen können eindeutig begutachtet<br />
werden,<br />
»»<br />
jeder Standort wird dokumentiert (einschließlich Fotos),<br />
»»<br />
Maßnahmen zum Schutz der Gasleitung können unmittelbar<br />
ergriffen werden.<br />
Sofern nötig und möglich wurden Wurzeln entfernt, die<br />
Leitung nachumhüllt und mit Dernoton oder Geotextil<br />
einem erneuten Einwurzeln in den Leitungsbereich<br />
vorgebeugt. Bei 116 Standorten<br />
reichten diese Maßnahmen jedoch<br />
nicht aus. Hier war die Entscheidung<br />
erforderlich, ob der Baum entfernt werden<br />
kann, darf und soll oder die Leitung<br />
umzulegen ist.<br />
Die ökologische Bedeutung und die Ästhetik<br />
waren bei dieser Abwägung ebenso<br />
zu berücksichtigen wie der Zustand des<br />
Baumes und die kommunale Baumschutzsatzung.<br />
Einige der betroffenen Bäume<br />
waren darüber hinaus als Naturdenkmal<br />
eingestuft. Bei rund der Hälfte der Standorte<br />
entschieden die Landeshauptstadt<br />
Hannover und enercity Netz die Bäume<br />
zu entfernen, in rund 60 Fällen wurde die<br />
Leitung umgelegt. Dabei betrachtete enercity<br />
Netz die einzelnen Standorte jedoch<br />
nicht isoliert: So war es beispielsweise bei<br />
Alleen sinnvoll, die Leitung nicht nur bei<br />
einzelnen Bäumen zu verlegen, sondern<br />
die Trasse insgesamt neu zu planen.<br />
48 06 | 2014
SPECIAL: BODENMANAGEMENT FACHBERICHT<br />
Bild 5: Starkwurzel einer Platane mit Kontakt zur Rohrleitung – ist<br />
die Wurzel für die Standsicherheit des Baumes notwendig, ist zu<br />
entscheiden, ob der Baum entfernt oder die Leitung umgelegt wird<br />
Bild 6: Zugschlingenbildung in der Rohrsohle - die<br />
Wurzelentnahme war hier nicht möglich<br />
Wer zuletzt kommt, zahlt<br />
Die Kostenfrage hatte zwei Dimensionen, die die Landeshauptstadt<br />
Hannover und enercity Netz einvernehmlich<br />
mit dem Vertrag regelten. Einerseits ist festgelegt, wer<br />
für die Kosten aufkommt. Andererseits musste vereinbart<br />
werden, welche Kosten zum Ansatz gebracht werden.<br />
Bei den Kosten gilt der Grundsatz, dass die Kommune<br />
die Kosten zu übernehmen hat, wenn die Leitung schon<br />
in der Erde lag, als der Baum gepflanzt wurde. Ist die<br />
Leitung verlegt worden, als der Baum bereits vorhanden<br />
war, trägt enercity Netz die Kosten für die erforderlichen<br />
Maßnahmen. Wenn Verlegejahr und Pflanzjahr gleich sind,<br />
teilen sich die beiden Parteien die Kosten. Ist das Pflanzjahr<br />
des Baumes nicht bekannt, wird es über eine Wachstumstabelle<br />
abgeschätzt. Musste ein Baum – zum Beispiel als<br />
Lückenschluss in einer Allee – nachgepflanzt werden, gilt<br />
als Pflanzjahr das Jahr, in dem der ursprüngliche Baum an<br />
dieser Stelle gepflanzt wurde.<br />
Intensiveren Gesprächsbedarf gab es zwischen der Landeshauptstadt<br />
Hannover und enercity Netz bezüglich<br />
des Wertausgleichs beim Umlegen einer Leitung. Muss<br />
eine Leitung umgelegt werden und ist die Kommune der<br />
Kostenträger, hätte der Netzbetreiber einen Wertvorteil,<br />
da er nun an dieser Stelle über eine neuwertige Leitung<br />
verfügt. Entscheidend für enercity Netz war hierbei, dass<br />
eine Leitung für den Netzbetreiber die ersten zehn Jahre<br />
nach Verlegung neuwertig ist. Der zweite Grundsatz für<br />
enercity Netz war, dass auch eine Leitung, die die erwartete<br />
technische Nutzungsdauer bereits erreicht hat, für den<br />
Netzbetreiber weiterhin einen Wert hat (Überlebensfunktion).<br />
Die Einigung unter Berücksichtigung dieser Basisannahmen<br />
erleichterte der rechnerische Vergleich der drei<br />
Varianten mit konkreten Beispielen. Der Kompromiss mit<br />
einem linear fallenden Zeitwert ab dem zehnten Jahr und<br />
einem Auslaufen bei der erwarteten Nutzungsdauer der<br />
jeweiligen Leitung mit einem konstanten Restwert von<br />
10 % führt zu tragbaren Lasten für beide Parteien.<br />
Positives Fazit<br />
„Die Rahmenvereinbarung zur Kostenregelung haben wir<br />
zwar erst Ende Januar 2013 unterschrieben – doch bereits<br />
seit Mitte 2010 haben wir mit den Arbeiten entsprechend<br />
des Sonderprogramms begonnen“, hebt Heiko Weduwen<br />
hervor. Aus Sicht des Geschäftsführers des hannöverschen<br />
Netzbetreibers enercity Netz konnten so die Erkenntnisse<br />
aus der Praxis kontinuierlich in die Arbeiten zur Regelung<br />
zwischen der Landeshauptstadt Hannover und enercity Netz<br />
einfließen. „Auch konnten wir die getroffenen Annahmen<br />
zeitnah überprüfen und gegebenenfalls die Filter anders<br />
definieren“, erklärt Weduwen.<br />
Für den Netzbetreiber habe die Regelung den Vorteil, dass<br />
ein definiertes Mengengerüst über Bäume an Versorgungsleitungen<br />
vorhanden und so eine systematische Bearbeitung<br />
der potenziellen Gefahrenstellen möglich ist. Außerdem<br />
besteht durch das einvernehmliche und mit einem Gutachter<br />
abgestimmte Vorgehensmodell ein klarer Handlungsrahmen.<br />
Die getroffene Kostenregelung ermögliche darüber<br />
hinaus eine einfache Abwicklung, da nicht jeder Einzelfall<br />
diskutiert werden muss.<br />
JENS VOSHAGE<br />
Hannover<br />
Tel. +49 (0)511 261399-39<br />
E-Mail: journalist@voshage.org<br />
AUTOR<br />
06 | 2014 49
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Der Nachweis der Wirksamkeit des KKS:<br />
Das IR-freie Potential und alternative<br />
Methoden<br />
Das IR-freie Potential ist aufgrund der aktuellen Regeln der Technik das primäre Kriterium für den Nachweis der Wirksamkeit<br />
des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es. Verschiedene Arbeiten zur Wechselstromkorrosion haben in den letzten Jahren<br />
zu einem verbesserten Verständnis der an der Stahloberfläche ablaufenden Prozesse geführt. Zudem werden aufgrund<br />
der Vorgaben der EN 15280 zur Verringerung des Wechselstromkorrosionsrisikos in vielen Fällen vergleichsweise positive<br />
Einschaltpotentiale erforderlich. Dies hat zur Folge, dass es zunehmend schwieriger wird die Vorgaben in Bezug auf das<br />
IR-freie Potential einzuhalten. Mit Hilfe eines numerischen Berechnungsmodells wird die physikalisch chemische Bedeutung<br />
des IR-freien Potentials aufgezeigt. Die daraus resultierenden Konsequenzen für die Beurteilung der Wirksamkeit des<br />
KKS werden dargelegt und ein alternatives Beurteilungsverfahren basierend auf einer pH-Wert-Messung vorgestellt.<br />
Einleitung<br />
In den letzten Jahren wurden verschiedene umfangreiche<br />
Untersuchungen zum Korrosionsverhalten von Rohrleitungen<br />
unter Wechselstrombeeinflussungen durchgeführt. Dabei zeigte<br />
sich, dass selbst bei Einschaltpotentialen positiver als -1,2 V CSE<br />
keine Korrosion an Probeblechen aufgetreten ist. Insbesondere<br />
wurde festgestellt, dass der kathodische <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
(KKS) wirksam war, sobald das Einschaltpotential negativer als<br />
-0,85 V CSE<br />
war [1, 2]. Diese Beobachtung ist im Widerspruch<br />
zu den in der Vergangenheit beobachteten Korrosionsangriffen<br />
an Rohrleitungen, deren Einschaltpotentiale im Bereich<br />
zwischen -1,2 und -0,85 V CSE<br />
lagen. Diese hatten damals zur<br />
Folge, dass der KKS in Europa generell deutlich negativer eingestellt<br />
wurde, um dieser Problematik zu begegnen. zudem<br />
wurde im Zuge dieser Maßnahme das IR-freie Potential als<br />
Schutzkriterium eingeführt. Bis heute ist dieses das relevante<br />
Schutzkriterium in den Regelwerken. Diese Verschiebung des<br />
Einschaltpotentials erhöhte die Beeinflussung von Drittstrukturen<br />
und gemäß neusten Erkenntnissen auch das Risiko von<br />
Wechselstromkorrosion. Bevor das Einschaltpotential zur Verringerung<br />
dieser Problematik nun wieder in positive Richtung<br />
verschoben werden darf, ist es erforderlich die Gründe für die<br />
damals aufgetretenen Schäden zu ermitteln. Basierend auf den<br />
neusten Erkenntnissen zum KKS werden daher im Folgenden<br />
die möglichen Ursachen für die in der Vergangenheit beobachteten<br />
Korrosionsprobleme ermittelt.<br />
Die Wirkungsweise des KKS<br />
Die beim kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong> ablaufenden Effekte<br />
sollen im Folgenden anhand eines neu entwickelten<br />
Berechnungsmodells [3] unter Einbezug der kinetischen<br />
und thermodynamischen Daten [4] sowie der Stofftransportprozesse<br />
[5-7] diskutiert werden.<br />
Der kathodische Schutz im Erdboden<br />
Die Berechnungen wurden für eine Fehlstellenfläche<br />
von 10 cm 2 durchgeführt. Wenn nicht anders vermerkt,<br />
beträgt der Sauerstoffgrenzstrom 0,1 A/m 2 . In Bild 1<br />
ist die Situation von Stahl in einem leicht sauren Boden<br />
mit 50 Ωm bei einem Einschaltpotential von -0,82 V CSE<br />
dargestellt. Aufgrund der Stromdichte-Potentialkurven<br />
und der Potential- und pH-Werte im Pourbaixdiagramm<br />
kann geschlossen werden, dass sich der pH-Wert unter<br />
Einwirkung des kathodischen Schutzstroms von deutlich<br />
weniger als 1 mA/m 2 in den Bereich von 8 erhöht hat.<br />
Dieses Einschaltpotential und der Schutzstrom sind somit<br />
nicht ausreichend, um die Korrosion von Stahl zu unterbinden,<br />
da sowohl die Verringerung des Potentials als<br />
auch die Erhöhung des pH-Werts nicht ausreichen, um<br />
Passivität oder Immunität des Stahls zu erreichen. Unter<br />
diesen Bedingungen wird das Potential des Stahls durch<br />
die Wasserstoffentwicklung bestimmt.<br />
Die weitere Verschiebung des Einschaltpotentials auf<br />
-0,84 V CSE<br />
führt zu einer signifikanten Veränderung der<br />
Situation (Bild 2). Die Erhöhung des pH-Werts ist so<br />
groß, dass sich ein Passivfilm bildet, wodurch die Korrosion<br />
wirksam gestoppt wird. Es zeigt sich, dass der<br />
Schutzstrom durch die geringfügige Absenkung des Einschaltpotentials<br />
um 20 mV in den Bereich von 0,1 A/m 2<br />
angestiegen ist. Die detaillierte Prüfung dieser Beobachtung<br />
ergibt, dass dieser Schutzstrom nicht die Ursache<br />
des <strong>Korrosionsschutz</strong>es, sondern vielmehr dessen Folge<br />
ist. Das heißt, die geringfügige Erhöhung des Schutzstroms<br />
führt zu einer weiteren Erhöhung des pH-Werts,<br />
welche aber ausreichend groß ist, um die Bildung einer<br />
Passivschicht zu ermöglichen. Diese Passivierung wiederum<br />
bewirkt, dass der Schutzstrom nun durch den<br />
Sauerstoffgrenzstrom bestimmt wird.<br />
Diese Beobachtung ist für die aktuelle Diskussion von zentraler<br />
Bedeutung. Der sich einstellende Schutzstrom ist eine<br />
Folge der Passivität, des Ausbreitungswiderstands, des Sauerstoffgrenzstroms<br />
und des Einschaltpotentials. Dies erklärt,<br />
weshalb bis heute in der Literatur unterschiedlichste Werte<br />
für erforderliche Schutzstromdichten berichtet werden.<br />
50 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
a)<br />
b)<br />
Bild 1: IR-freies Potential und pH-Wert<br />
berechnet für einen Bodenwiderstand<br />
von 50 Ωm bei einem Einschaltpotential<br />
von -0,82 V CSE<br />
.<br />
1a: Pourbaixdiagramm mit den<br />
berechneten Werten dargestellt als<br />
roten Punkt. Die gestrichelte Linie stellt<br />
das Schutzkriterium von -0,85 V CSE<br />
gemäß EN 12954 und durchgezogene<br />
Linie Einschaltpotential von -0,82 V CSE<br />
dar. 1b: Stromdichte-Potential Kurven<br />
der anodischen Reaktionen (rot) und<br />
kathodischen Reaktionen (blau) auf<br />
Stahl beim entsprechenden pH-Wert.<br />
Die Länge der grünen Linie zeigt die<br />
Größe des Schutzstroms an.<br />
a)<br />
b)<br />
Bild 2: IR-freies Potential und<br />
pH-Wert berechnet für einen<br />
Bodenwiderstand von 50 Ωm<br />
bei einem Einschaltpotential<br />
von -0,84 V CSE<br />
. Details zur<br />
Darstellung sind in der Legende<br />
von Bild 1 aufgeführt.<br />
a)<br />
b)<br />
Bild 3: IR-freies Potential und<br />
pH-Wert berechnet für einen<br />
Bodenwiderstand von 50 Ωm<br />
bei einem Einschaltpotential<br />
von -1,3 V CSE<br />
. Details zur<br />
Darstellung sind in der Legende<br />
von Bild 1 aufgeführt.<br />
06 | 2014 51
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Die für die Passivierung der Stahloberfläche erforderliche<br />
Schutzstromdichte ist gemäß den aktuellen Berechnungen<br />
im Boden kleiner als 1 mA/m 2 . Diese Beobachtung wird<br />
gestützt durch die Ergebnisse in [1, 2]. Selbst bei sehr geringen<br />
kathodischen Stromdichten im Bereich von 1 mA/m 2<br />
tritt in keinem Fall Korrosion auf. Erst bei Einschaltpotentialen<br />
positiver als -0,85 V CSE<br />
kam es zu anodischen Strömen<br />
und zu Korrosion. Die vorliegenden Berechnungen bestätigen<br />
somit die experimentell ermittelten Werte.<br />
Eine Verschiebung des Einschaltpotentials auf -1,3 V CSE<br />
führt<br />
zu einer weiteren Erhöhung des Schutzstroms und des<br />
pH-Werts, wie aus Bild 3 hervorgeht. In diesem Fall wird<br />
der Schutzstrom von ca. 1 A/m 2 durch die Wasserstoffentwicklung<br />
kontrolliert. Das Potential der Stahloberfläche liegt<br />
aber noch immer im Bereich der Passivität.<br />
Gemäß der vorliegenden Betrachtung wird die Schlussfolgerung<br />
bestätigt, dass das Schutzkriterium von -0,85 V CSE<br />
durch den Schnittpunkt der Gleichgewichtslinie für Wasserstoffentwicklung<br />
mit der Grenzlinie zwischen Passivität und<br />
Korrosion im Pourbaixdiagramm bestimmt wird [5, 8, 9].<br />
Wenn das IR-freie Potential negativer als -0,85 V CSE<br />
ist,<br />
muss der pH-Wert zwangsläufig so hoch sein, dass Passivität<br />
vorliegt.<br />
Die EN 12954 beinhaltet noch weitere Schutzkriterien,<br />
welche experimentell für Fehlstellen mit einer Fläche von<br />
10 cm 2 ermittelt wurden [10]. Es stellt sich somit auch die<br />
Frage nach deren physikalisch-chemischen Bedeutung. In<br />
Bild 4 ist das IR-freie Potential bei einem Einschaltpotential<br />
von -1,3 V CSE<br />
in einem hochohmigen gut belüfteten<br />
Boden mit einem Widerstand von 5000 Ωm und einem<br />
Sauerstoffgrenzstrom von 1 A/m 2 dargestellt. Es zeigt sich,<br />
dass das IR-freie Potential von -0,7 V CSE<br />
in diesem Fall durch<br />
die ladungsdurchtrittskontrollierte Sauerstoffreduktion<br />
bestimmt ist. Aus der Berechnung ergibt sich, dass keine<br />
Korrosion auftritt, da die Passivität durch den hohen pH-<br />
Wert sichergestellt ist. Dies ist in Einklang mit der EN 12954,<br />
welche in gut belüftetem Boden mit hohem Widerstand ein<br />
Schutzkriterium von -0,65 V CSE<br />
angibt.<br />
Die Berechnung des Verhaltens in einem gut belüfteten<br />
Boden mit einem Widerstand von 500 Ωm ergibt ein IRfreies<br />
Potential von -0,8 V CSE<br />
. Auch in diesem Fall ist der<br />
Wert negativer als das Schutzkriterium der EN 12954 von<br />
-0,75 V CSE<br />
und es ist gemäß der Berechnung nicht mit Korrosion<br />
zu rechnen.<br />
Die durchgeführten Betrachtungen zeigen deutlich, dass das<br />
Schutzkriterium von -0,85 V CSE<br />
in jenen Fällen herangezogen<br />
werden kann, wo das IR-freie Potential des Stahls durch die<br />
Wasserstoffentwicklung oder den Sauerstoffgrenzstrom<br />
bestimmt ist. Wenn das IR-freie Potential durch die ladungsdurchtrittskontrollierte<br />
Sauerstoffreduktion bestimmt wird,<br />
sind die positiveren Werte für hochohmigen gut belüfteten<br />
Boden heranzuziehen. Weiterführende Berechnungen<br />
haben gezeigt, dass bei Fehlstellen größer als 10 cm 2 oder<br />
unter noch hochohmigeren Bedingungen durchaus auch<br />
positivere IR-freie Potentiale toleriert werden können, ohne<br />
dass Korrosion auftritt. Dies steht basierend auf der vorliegenden<br />
Betrachtung nicht im Widerspruch zur EN 12954<br />
und zur zugrundeliegenden Untersuchung [10], da deren<br />
Schutzkriterien für 10 cm 2 und für Bodenwiderstände von<br />
100 und 1000 Ωm ermittelt wurden. Gemäß den aktuellen<br />
Berechnungen führen selbst sehr positive IR-freie Potentiale<br />
nicht zu Korrosion, sofern der pH-Wert an der Stahloberfläche<br />
ausreichend hoch ist, um Passivität zu gewährleisten.<br />
Dies wird durch die Ergebnisse in Feldversuchen [1, 2] bestätigt,<br />
wo IR-freie Potentiale positiver als -0,6 V CSE<br />
vorlagen<br />
und keine Korrosion auftrat.<br />
Berechnungen mit dem vorliegenden Modell bei unterschiedlichsten<br />
Randbedingungen haben zudem gezeigt,<br />
dass die Passivität und damit auch der <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
immer dann gewährleistet sind, wenn das Einschaltpotential<br />
negativer als -0,85 V CSE<br />
sind. Dieses Resultat ist in<br />
guter Übereinstimmung mit dem von Robert Kuhn [11, 12]<br />
festgestellten Schutzkriterium für das Einschaltpotential von<br />
-0,85 V CSE<br />
und den Ergebnissen in [1, 2].<br />
Kathodischer Schutz in Wasser<br />
Basierend auf diesen Berechnungen ist es möglich einen<br />
Betrieb des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es bei Einschaltpotentialen<br />
im Bereich von -1,2 bis -0,85 V CSE<br />
zu rechtfertigen.<br />
Es ist aber nicht möglich die in der Vergangenheit in<br />
diesem Potentialbereich beobachteten Korrosionsschäden<br />
zu erklären. Dazu ist eine weiterführende Betrachtung der<br />
Randbedingungen erforderlich. Die Berechnungen basieren<br />
auf der Annahme, dass die Fehlstelle in Boden gebettet ist.<br />
Unter diesen Umständen führt bereits ein geringer Schutzstrom<br />
von weniger als 1 mA/m 2 zum Anstieg des pH-Werts<br />
an der Stahloberfläche, da die Konvektion von Wasser durch<br />
den hohen Feststoffanteil wirksam unterbunden wird. Aus<br />
der Diskussion geht klar hervor, dass der kathodische Schutz<br />
und die Kriterien in der EN 12954 auf der Erhöhung des<br />
pH-Werts und der Bildung einer Passivschicht beruhen.<br />
Wenn nun die Bedingungen für die Erhöhung des pH-Werts<br />
nicht gegeben sind, wird der kathodische <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
erschwert. Diese Problematik wird in der Folge diskutiert.<br />
In Bild 5 ist das IR-freie Potential einer Stahloberfläche in<br />
Wasser gezeigt, wo aufgrund von Konvektion oder Strömung<br />
die Erhöhung des pH-Werts an der Stahloberfläche<br />
auf 8 begrenzt ist. Das Einschaltpotential beträgt -1,3 V CSE<br />
und der Wasserwiderstand ist 50 Ωm. Das IR-freie Potential<br />
ist unter diesen Bedingungen zwar negativer als -0,85 V CSE<br />
,<br />
aus der Berechnung geht aber hervor, dass mit Korrosion<br />
zu rechnen ist. Unter analogen Bedingungen im Boden,<br />
welche einen Anstieg des pH-Werts ermöglichen, ist gemäß<br />
Bild 3 mit Passivität zu rechnen. Damit unter den vorliegenden<br />
Bedingungen in Wasser ein <strong>Korrosionsschutz</strong> erreicht<br />
werden kann, muss aufgrund des Berechnungsmodells ein<br />
Einschaltpotential von -3,2 V CSE<br />
aufgebracht werden. Unter<br />
diesen Bedingungen fließt ein Schutzstrom von mehr als<br />
3 A/m 2 und gemäß den thermodynamischen Berechnungen<br />
muss das IR-freie Potential negativer als -0,95 V CSE<br />
sein. In<br />
diesem Fall wird der <strong>Korrosionsschutz</strong> nicht durch Passivität,<br />
sondern durch Immunität erreicht. Der Wert von -0,95 V CSE<br />
findet sich ebenfalls in der EN 12954, allerdings für den Fall<br />
52 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Bild 4: IR-freies Potential<br />
und pH-Wert berechnet<br />
für einen Bodenwiderstand<br />
von 5000 Ωm und einem<br />
Sauerstoffgrenzstrom von<br />
1 A/m 2 bei einem<br />
Einschaltpotential von<br />
-1,3 V CSE<br />
. Details zur<br />
Darstellung sind in der<br />
Legende von Bild 1<br />
aufgeführt.<br />
Bild 5: IR-freies Potential<br />
für einen Wasserwiderstand<br />
von 50 Ωm bei einem<br />
Einschaltpotential von -1,3 V CSE<br />
für den Fall, dass der pH-Wert<br />
nicht über 8 ansteigen kann.<br />
Details zur Darstellung sind<br />
in der Legende von Bild 1<br />
aufgeführt.<br />
von anaeroben Bedingungen. Unter anaeroben Bedingungen<br />
ist mit sulfatreduzierenden Bakterien zu rechnen, welche<br />
ebenso wie die Konvektion zu einem begrenzten Anstieg<br />
des pH-Werts führen. Folglich kann mit Hilfe des Modells<br />
auch dieses Schutzkriterium der Norm erklärt werden. Die<br />
berechneten hohen Stromdichten sind außerdem in guter<br />
Übereinstimmung mit Versuchen in Wasser, wo der Anstieg<br />
des pH-Werts durch Konvektion verhindert wird [13, 14].<br />
Schlussfolgerung<br />
Basierend auf den Berechnungen können die Schutzkriterien<br />
der EN 12954 und die Grenzwerte gemäß [10] erklärt<br />
werden. Es kann geschlossen werden, dass der <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
sowohl durch Passivität, als auch durch Immunität<br />
erreicht werden kann. Unter typischen Bedingungen im<br />
Boden können an verschiedenen Fehlstellen einer Leitung,<br />
abhängig vom Bodenwiderstand, vom Sauerstoffgehalt,<br />
von der Konvektion und von der Fehlstellengröße, sowohl<br />
Passivität als auch Immunität vorliegen. Das IR-freie Potential<br />
kann dabei durch die Wasserstoffentwicklung, den Sauerstoffgrenzstrom<br />
oder die ladungsdurchtrittskontrollierte<br />
Sauerstoffreduktion bestimmt sein.<br />
Aus der Diskussion geht deutlich hervor, dass die Stofftransportbedingungen<br />
an der Fehlstellenoberfläche und somit<br />
die Bodenbeschaffenheiten einen entscheidenden Einfluss<br />
auf das Korrosionsverhalten haben.<br />
In Böden, welche eine Erhöhung des pH-Werts an der<br />
Stahloberfläche ermöglichen, ist das IR-freie Potential eine<br />
gemischte pH-Wert und Sauerstoffmessung. Ein IR-freies<br />
Potential negativer als -0,85 V CSE<br />
zeigt eine Erhöhung des<br />
pH-Werts an, welche für die Bildung eines Passivfilms ausreichend<br />
ist. Die dafür erforderliche Stromdichte ist kleiner<br />
als 1 mA/m 2 . Die sich in der Folge der Passivierung einstellenden<br />
Schutzstromdichten liegen im Bereich von 0,005<br />
bis 1 A/m 2 . Die Bildung einer schützenden Passivschicht ist<br />
dann zu erwarten, wenn das Einschaltpotential negativer als<br />
-0,85 V CSE<br />
ist, wie sowohl durch die Literatur, die Messungen<br />
und die Berechnungen gezeigt wird.<br />
In jenen Fällen, wo die Erhöhung des pH-Werts nicht möglich<br />
ist, da die sich bildenden Hydroxidionen durch strömen-<br />
06 | 2014 53
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
des Wasser und Konvektion abgeführt oder durch Bakterien<br />
neutralisiert werden, sind IR-freie Potentiale negativer<br />
als -0,95 V CSE<br />
erforderlich. Unter diesen Bedingungen sind<br />
Schutzstromdichten von mehr als 1 A/m 2 und deutlich negativere<br />
Einschaltpotentiale erforderlich. In der Folge ist das<br />
IR-freie Potential nicht ein Indikator für einen ausreichend<br />
hohen pH-Wert sondern für die Erreichung der Immunität.<br />
Demzufolge ist ein Betrieb des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es<br />
bei Einschaltpotentialen zwischen -1,2 und<br />
-0,85 V CSE<br />
nur dann gerechtfertigt, wenn davon ausgegangen<br />
werden kann, dass alle Fehlstellen in Boden oder Sand<br />
gebettet sind. Allenfalls wasserberührte Fehlstellen müssen<br />
durch Kalkablagerungen bedeckt sein, die sich unter Einwirkung<br />
des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es bilden können<br />
und ebenfalls eine Begrenzung der Konvektion bewirken<br />
und somit einen Anstieg des pH-Werts begünstigen.<br />
Wenn demgegenüber nicht mit Verkalkungen gerechnet<br />
werden kann und Fehlstellen mit begrenztem Anstieg des<br />
pH-Werts zu erwarten sind, müssen deutlich negativere<br />
Einschaltpotentiale angewendet werden. Derartige Stellen<br />
sind gemäß den vorliegenden Informationen in erster Linie<br />
an folgenden Stellen zu erwarten:<br />
»»<br />
Wassergefüllte Hohlstellen unter Umhüllungsfehlstellen,<br />
wie sie beispielsweise in 6-Uhr-Position unter Rohrleitungen<br />
auftreten können.<br />
»»<br />
Fehlstellen, welche in strömendem Wasser liegen, wie<br />
sie beispielsweise in Rohrgraben auftreten, die mit grobem<br />
Material verfüllt wurden<br />
»»<br />
Fehlstellen in Wasser, die nicht durch Schlick oder durch<br />
Kalkschichten bedeckt werden.<br />
Diese Ausführungen zeigen deutlich, dass der Nachweis<br />
der Wirksamkeit des KKS mit Hilfe einer Intensivmessung<br />
möglich ist. Wenn sämtliche IR-freien Potentiale negativer<br />
als -0,95 V CSE<br />
sind, ist die Korrosion entweder durch Passivierung<br />
aufgrund von Erhöhung des pH-Werts oder durch<br />
Immunität wirksam unterbunden. Allerdings zeigen die<br />
Berechnungen, dass auch Fehlstellen mit IR-freien Potentialen<br />
positiver als -0,95 V CSE<br />
nicht zwingend Korrosion aufweisen<br />
müssen. In diesen Fällen wird der <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
durch die Erhöhung des pH-Werts und die Bildung einer<br />
Passivschicht bewirkt, sofern nicht die oben genannten<br />
Bedingungen vorliegen.<br />
Bild 6: Versuchsaufbau für die Ermittlung des Spannungsfalls als Funktion<br />
des Einschaltpotentials.<br />
Alternativer Wirkungsnachweis<br />
Die Diskussion zeigt deutlich, dass grundsätzlich ein Einschaltpotential<br />
von -0,85 V CSE<br />
ausreichend ist, um die<br />
Wirksamkeit des KKS nachzuweisen. Dies trifft aber nur in<br />
jenen Fällen zu, wo an sämtlichen Fehlstellen ein Anstieg<br />
des pH-Werts möglich ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss<br />
ein IR-freies Potential von -0,95 V CSE<br />
als Schutzkriterium<br />
angewendet werden. An gewissen Fehlstellen kann dieses<br />
nur mit hohen Schutzströmen sichergestellt werden. Diese<br />
wiederum ergeben nebst hohen Installationskosten auch<br />
verstärkte Beeinflussungen von Drittstrukturen und eine<br />
Erhöhung der Wechselstromkorrosionsgefährdung. Daraus<br />
folgt, dass es von zentraler Bedeutung ist die entsprechenden<br />
Fehlstellen zu identifizieren und instand zu setzen. Ein<br />
entsprechendes Verfahren wird im Folgenden vorgestellt.<br />
Theoretischer Hintergrund<br />
In der Diskussion der Wirkungsweise des KKS wurde<br />
deutlich, dass das Potenzial in Bezug auf die Wirksamkeit<br />
von untergeordneter Bedeutung ist. Nur wenn der<br />
pH-Wert an der Stahloberfläche nicht ansteigen kann,<br />
muss das IR-freie Potential negativer als -0,95 V CSE<br />
sein.<br />
Im Falle von positiveren IR-freien Potentialen muss aber<br />
keineswegs zwingend auf Korrosion geschlossen werden.<br />
Die Erfahrung von Betreibern zeigt vielmehr, dass bei der<br />
Freilegung von Fehlstellen mit positiveren IR-freien Potentialen,<br />
die im Rahmen von Intensivmessungen identifiziert<br />
wurden, oft keine signifikante Korrosion gefunden wird.<br />
Diese Beobachtung bestätigt die Modellberechnungen.<br />
Basierend auf den Ausführungen zum IR-freien Potential<br />
kann eine weiterführende Beurteilung nur durch die<br />
Messung des pH-Werts oder durch den Nachweis der<br />
Passivität erfolgen. Für Probebleche wurden entsprechende<br />
Verfahren bereits vorgestellt [5]. Diese wurden<br />
in den letzten zehn Jahren in der Schweiz systematisch<br />
angewendet. Deutlich schwieriger ist die Erfassung des<br />
pH-Werts oder der Nachweis der Passivität an Fehlstellen<br />
der Rohrleitung von der Erdoberfläche aus. Das Problem<br />
wurde durch Berechnung mit dem eingangs vorgestellten<br />
numerischen Modell untersucht. Dazu wurde die<br />
Abhängigkeit der Stromdichte vom Einschaltpotential<br />
bei unterschiedlichen Bodenwiderständen und Sauerstoffgrenzströmen<br />
berechnet [15]. Es zeigte sich, dass<br />
für unterschiedliche pH-Werte deutliche Unterschiede im<br />
Stromdichte-Potentialverlauf auftreten. Diese sind eine<br />
Folge der Abhängigkeit der elektrochemischen Reaktionen<br />
vom pH-Wert. Weiter wurde festgestellt, dass<br />
bei tiefen pH-Werten ein weitgehend linearer Verlauf<br />
auftritt, während bei den höheren pH-Werten eine deutliche<br />
Abweichung von der Linearität beobachtet wird.<br />
Diese Abweichung von der Linearität ist auf die Bildung<br />
54 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
der Passivschicht zurückzuführen, die das Auftreten von<br />
anodischen Strömen weitgehend verhindert.<br />
Die Veränderung des Einschaltpotenzials und die gleichzeitige<br />
Erfassung der Stromdichte erlauben somit grundsätzlich<br />
die Berechnung des pH-Werts und die Bewertung<br />
der Passivität der Stahloberfläche. Die Stromdichte kann<br />
zwar an Fehlstellen in der Rohrleitungsumhüllung nicht<br />
direkt erfasst werden, da der Absolutwert aber nicht<br />
relevant ist, kann stattdessen der ohmsche Spannungsfall<br />
zwischen zwei Bezugselektroden gemäß Bild 6 ermittelt<br />
werden. Dieser ist proportional zur Stromdichte in der<br />
Fehlstelle und für die Auswertung ausreichend. Damit<br />
eine Bewertung der Passivität möglich wird, muss zwingend<br />
eine anodische Polarisation der Fehlstelle erfolgen.<br />
Aufgrund der Diskussion der Wirkungsweise des KKS<br />
wird deutlich, dass diese unproblematisch ist, solange<br />
Passivität vorliegt. Durch eine geeignete Steuerung des<br />
Messablaufs kann zudem das Ausmaß an Korrosion während<br />
der anodischen Polarisation minimiert werden.<br />
Experimentelle Vorgehensweise<br />
Im Rahmen von Laborversuchen konnte die Richtigkeit der<br />
Modellrechnung demonstriert werden. Um die Anwendbarkeit<br />
der Methode in der Feldmessung nachzuweisen,<br />
wurden verschiedene Probebleche mit einer Rohrleitung<br />
verbunden. Die Fehlstellenfläche betrug 600 cm ² . Die Fläche<br />
wurde in Ihrer Größe den erwarteten Fehlstellen an<br />
der Rohrleitung angepasst. Eines der Probebleche wurde<br />
kurz vor der Messung direkt in den nahegelegenen Fluss<br />
gelegt. Dadurch sollte erreicht werden, dass sich keine<br />
Kalkschicht auf der Stahloberfläche bilden kann und der<br />
pH-Wert aufgrund der Verdünnung durch das Flusswasser<br />
nicht ansteigen kann. Ein weiteres Probeblech wurde eingegraben<br />
und ein drittes wurde vorgängig einbetoniert und<br />
anschließend ebenfalls vergraben. Diese beiden Probebleche<br />
wurden während mehr als zwei Wochen mit der Rohrleitung<br />
verbunden, sodass es zu einer gewissen Erhöhung des pH-<br />
Werts kommen konnte.<br />
Für die Messung wurde sowohl der Stromfluss im Probeblech<br />
als auch der Spannungstrichter als Funktion des<br />
Einschaltpotentials erfasst. Für die Anpassung des Einschaltpotentials<br />
wurde der in [15] beschriebene Versuchsaufbau<br />
erstellt. Für sämtliche Mess- und Schaltfunktionen wurden<br />
Minilog 2 von Weilekes Elektronik verwendet.<br />
Resultate und Diskussion<br />
Die Ergebnisse der Messung sind in Bild 7 dargestellt. Es<br />
zeigt sich, dass im Falle des Probeblechs im Wasser ein<br />
nahezu lineares Verhalten auftritt, wie es für Stahl bei tiefen<br />
Bild 7: Strom-Potentialcharakteristik ermittelt für die drei<br />
unterschiedlich gebetteten Probebleche.<br />
pH-Werten erwartet wird. Demgegenüber tritt beim Probeblech<br />
im Beton eine deutliche Abweichung vom linearen<br />
Verlauf auf, wie es für ein passives System typisch ist. Im<br />
Falle des Probeblechs im Boden tritt eine deutliche Abweichung<br />
vom linearen Verlauf auf, diese ist aber geringer als<br />
im Fall des einbetonierten Probeblechs. Die vorliegenden<br />
Daten zeigen, dass qualitativ das erwartete Verhalten auftritt<br />
und dass eine eindeutige Identifizierung der passiven<br />
Stahloberflächen möglich ist.<br />
Die Auswertung der Daten mit Hilfe des numerischen<br />
Modells erlaubt zusätzliche Rückschlüsse in Bezug auf die<br />
Zustände an der Stahloberfläche. Diese sind in Tabelle 1<br />
dargestellt. Die pH-Werte sind im plausiblen Bereich. Für<br />
Beton wird aufgrund der hohen Alkalinität der Porenlösung<br />
ein Wert von 13,5 erwartet. Beim Probeblech im Boden<br />
haben offensichtlich die zwei Wochen Polarisation bei einem<br />
Einschaltpotential von -1,3 V CSE<br />
ausgereicht, um den pH-<br />
Wert auf 12,6 ansteigen zu lassen. Dieser Wert ist basierend<br />
auf den Berechnungen in Bild 3 plausibel. Demgegenüber<br />
ist der pH-Wert nach kurzer Polarisationsdauer im Wasser<br />
im neutralen Bereich. Interessanterweise sind die IR-freien<br />
Potentiale für die passiven Oberflächen positiver als für die<br />
korrodierende. Dieser Effekt wird auch durch die Berechnungen<br />
bestätigt, wie aus dem Vergleich von Bild 1 und<br />
Bild 4 hervorgeht.<br />
Bei der Bewertung von Fehlstellen an Rohrleitungen ist<br />
eine direkte Strommessung nicht möglich. Vielmehr muss<br />
in diesem Fall die Berechnung der erwarteten Korrosionssituation<br />
mit Hilfe der Spannungstrichter erfolgen. Dies<br />
Probeblech im Wasser Probeblech im Boden Probeblech im Beton<br />
pH-Wert [-] 6,0 12,6 13,8<br />
IR-freies Potential [V CSE<br />
] -0,67 -0,58 -0,55<br />
Gradient-Potentialcharakteristik aktiv passiv passiv<br />
Tabelle 1: Bewertung des Korrosionszustands der Probebleche mit Hilfe der Ströme.<br />
06 | 2014 55
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Probeblech im Wasser Probeblech im Boden Probeblech im Beton<br />
pH-Wert [-] 5,1 >10 >10<br />
IR-freies Potential [V CSE<br />
] -0,61 -0,44 -0,43<br />
Gradient-Potentialcharakteristik aktiv passiv passiv<br />
Tabelle 2: Bewertung des Korrosionszustands der Probebleche mit Hilfe der Gradienten.<br />
führte zu sehr ähnlichen Ergebnissen wie in Bild 7. Die<br />
daraus berechneten Werte sind in Tabelle 2 aufgeführt. Es<br />
zeigt sich, dass qualitativ vergleichbare Ergebnisse ermittelt<br />
werden können. Die Werte für den pH-Wert und das IR-freie<br />
Potential werden aber bereits durch geringfügige Spannungsdifferenzen<br />
zwischen den Bezugselektroden beeinflusst.<br />
Diese Problematik ist bereits aus der Ermittlung der<br />
IR-freien Potentiale hinreichend bekannt. Bei nicht linearen<br />
Fremdgradienten und bei kleinen Spannungstrichtern führt<br />
die Intensivmessung oft zu fehlerbehafteten Ergebnissen.<br />
Dasselbe trifft bei dem hier vorgestellten Messaufbau in<br />
Bezug auf die Ermittlung des pH-Werts zu. Der zentrale Vorteil<br />
der Messmethodik besteht aber im Falle der Auswertung<br />
der Gradienten-Potentialcharakteristik in der Bewertung<br />
der Linearität. Diese ist unabhängig vom Absolutwert des<br />
Gradienten. Damit ist zu erwarten, dass die Bewertung der<br />
Fehlstellen in Bezug auf Korrosion respektive Passivität selbst<br />
bei kleinen Spannungstrichtern in Gegenwart von größeren<br />
Fremdspannungstrichtern möglich wird.<br />
Schlussfolgerung<br />
Die Messungen zeigen, dass das Messverfahren prinzipiell<br />
in der Lage ist den Korrosionszustand der Stahloberfläche<br />
zu ermitteln. Unter idealen Bedingungen ist es sogar möglich<br />
den pH-Wert an der Stahloberfläche zu ermitteln. Im<br />
Gegensatz zu bisherigen Methoden zur Beurteilung des<br />
Korrosionszustands beruht die Bewertung nicht auf dem<br />
Absolutwert des Gradienten. Damit ist zu erwarten, dass<br />
die Zuverlässigkeit der Messung deutlich erhöht wird. Im<br />
vorliegenden Fall hätte eine Beurteilung der Korrosionssituation<br />
der Probebleche aufgrund des IR-freien Potentials<br />
zu fehlerhaften Schlussfolgerungen geführt.<br />
Beurteilung<br />
Das vorgestellte Modell ist in der Lage die Bedeutung des<br />
Einschaltpotentials für den Wirkungsnachweis des KKS zu<br />
erklären. Die positiven Erfahrungen mit diesem Kriterium<br />
können somit rechnerisch bestätigt werden. Die vorliegende<br />
Diskussion macht aber auch deutlich, weshalb ein<br />
Wirkungsnachweis mit Hilfe des Einschaltpotentials das<br />
Auftreten von Korrosion nicht ausschließen kann. In jenen<br />
Fällen, wo der pH-Wert an der Stahloberfläche aufgrund<br />
von Konvektion oder bakterieller Aktivität nicht ansteigen<br />
kann, wäre für den Wirkungsnachweis ein IR-freies Potential<br />
negativer als -0,95 V CSE<br />
erforderlich. Diese Forderung der EN<br />
12954 ist somit korrekt. Im Gegensatz dazu kann aber die<br />
Einhaltung der Kriterien von -0,85, -0,75 oder -0,65 V CSE<br />
für<br />
das IR-freie Potential das Auftreten von Korrosion ebenfalls<br />
nicht ausschließen, da diese basierend auf der vorliegenden<br />
Diskussion ebenfalls implizit einen Anstieg des pH-Werts<br />
erfordern. Dies erklärt das Auftreten von Korrosion trotz<br />
Einhaltung dieser Kriterien. Diese Schlussfolgerung wird<br />
zusätzlich durch den Umstand bestärkt, dass diese Grenzwerte<br />
empirisch in einer Sandbettung ermittelt wurden,<br />
welche die Erhöhung des pH-Werts und die Bildung eines<br />
Passivfilms ermöglichten [10].<br />
Die weiterführende Analyse der vorliegenden Berechnungen<br />
zeigt, dass die Immunität in offenem Wasser nur bei<br />
stark erhöhten Stromdichten möglich ist, welche deutlich<br />
größer als 1 A/m 2 sind. Da in der Literatur und den Normen<br />
üblicherweise kleinere Stromdichten für das Design des KKS<br />
aufgeführt werden, wird implizit ebenfalls ein Anstieg des<br />
pH-Werts und der Passivierung angenommen. Das berechnete<br />
Einschaltpotential von -3,2 V CSE<br />
, das für den Schutz<br />
einer moderaten Fehlstellengröße von 10 cm 2 in einem gut<br />
leitfähigen Boden erforderlich wäre, bestätigt die Schlussfolgerung,<br />
dass der <strong>Korrosionsschutz</strong> im Normalfall durch<br />
Passivierung erfolgt. Dies wiederum erklärt die schlechte<br />
Korrelation zwischen der Korrosionssituation an Fehlstellen<br />
und deren IR-freiem Potential, da das IR-freie Potential für<br />
die Bewertung des Korrosionszustands einer kathodisch<br />
polarisierten passiven Stahloberfläche irrelevant ist.<br />
Diese Analyse liefert eine mögliche Erklärung für die widersprüchlichen<br />
Kriterien, welche in verschiedenen Ländern<br />
verwendet werden. Während ein Großteil Europas das IRfreie<br />
Potential verwendet, verlassen sich Holland und die<br />
USA meist auf das Einschaltpotential. Dieser scheinbare<br />
Widerspruch spiegelt sich auch in der europäischen Normung,<br />
da die EN 12954 ein Schutzkriterium basierend auf<br />
dem IR-freien Potential definiert, während die EN 14505<br />
ein Schutzkriterium basierend auf dem Einschaltpotential<br />
beschreibt. Aufgrund der vorliegenden Modellberechnungen<br />
sind beide Ansätze vergleichbar, da beide implizit den<br />
Anstieg des pH-Werts und die Bildung einer Passivschicht<br />
erfordern. Beide Ansätze sind folglich nicht in der Lage<br />
das Auftreten von Korrosion auszuschließen, wenn diese<br />
Randbedingungen nicht erfüllt sind. Dies ist nur möglich,<br />
wenn ein IR-freies Potential negativer als -0,95 V CSE<br />
an jeder<br />
einzelnen Fehlstelle nachgewiesen wird. Damit kann die<br />
Wirksamkeit des KKS unabhängig von den Stofftransportbedingungen<br />
an der Stahloberfläche nachgewiesen werden.<br />
Diese Bedingung kann aber nur erfüllt werden, wenn deutlich<br />
erhöhte Stromdichten aufgebracht werden, was teurere<br />
Installationen, ein erhöhtes Risiko von Wechselstromkorrosion<br />
und eine verstärkte Beeinflussung von Drittstrukturen<br />
mit sich bringt. Es ist daher nicht überraschend, dass<br />
die ersten Schäden durch Wechselstromkorrosion in jenen<br />
56 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Ländern auftraten, die ein IR-freies Potential von -0,95 V CSE<br />
angestrebt haben.<br />
Eine mögliche Lösung für die beschriebene Problematik ist<br />
die Messung des pH-Werts oder der passivierenden Bedingungen<br />
an der Stahloberfläche von Fehlstellen. Dies ist ein<br />
direkter Nachweis der Wirksamkeit des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es.<br />
Damit wird es möglich die wenigen Fehlstellen<br />
zu identifizieren, die nur durch Immunität geschützt<br />
werden können. Diese können freigelegt werden oder die<br />
Stofftransportbedingungen können durch geeignete Maßnahmen,<br />
wie z. B. Zement-injektionen, modifiziert werden.<br />
Die vorgestellte Methodologie ermöglicht prinzipiell die<br />
Bestimmung der passivierenden Bedingungen an Fehlstellen<br />
von der Erdoberfläche aus. Basierend auf den zurzeit<br />
verfügbaren Daten ist es möglich die kritischen Fehlstellen<br />
zu identifizieren. Damit Erfahrungen mit diesem Ansatz<br />
gewonnen werden können, werden Betreiber und Fachfirmen<br />
durch die SGK geschult, damit diese vor Freilegungen<br />
die entsprechenden Messungen ausführen. Die Daten werden<br />
durch die SGK ausgewertet und in eine anonymisierte<br />
Datenbank übertragen, um weltweit Erfahrungen mit dieser<br />
Methodologie zu sammeln. Dies sollte es ermöglichen die<br />
kritischen Grenzwerte zu identifizieren und damit die Basis<br />
für einen ökonomischeren und sichereren KKS zu schaffen.<br />
Dank<br />
Diese Arbeit wurde durch die großzügige Unterstützung<br />
durch den DVGW, Open Grid Europe GmbH, Swissgas AG,<br />
SBB AG, BFE, BAV, ERI, Transitgas AG und Westnetz GmbH<br />
ermöglicht. Ein spezieller Dank geht an Hanns-Georg Schöneich<br />
und Jürgen Barthel für die Diskussion der Ergebnisse<br />
und die wesentlichen Ergänzungen.<br />
Literatur<br />
[1] Büchler, M.; Joos, D.: Minimierung der Wechselstromkorrosionsgefährdung<br />
mit aktivem kathodischen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>, DVGW - energie/wasser-praxis 13 (2013)<br />
[2] Büchler, M.; Joos, D.; Voûte, C.-H.: Feldversuche zur<br />
Wechselstromkorrosion, DVGW - energie/wasser-praxis 8 (2010)<br />
[3] Büchler, M.: Beurteilung der Wechselstromkorrosionsgefährdung<br />
von Rohrleitungen mit Probeblechen: Relevante Einflussgrössen<br />
für der Bewertung der ermittelten Korrosionsgeschwindigkeit“, <strong>3R</strong><br />
International 36 (2013)<br />
[4] Pourbaix, M.: Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions,<br />
NACE, Houston, TX, 1974<br />
[5] Büchler, M.; Schöneich, H.-G.: Investigation of Alternating Current<br />
Corrosion of Cathodically Protected Pipelines: Development of<br />
a Detection Method, Mitigation Measures, and a Model for the<br />
Mechanism, Corrosion 65 (2009)<br />
[6] Büchler, M.; Schmuki, P.; Böhni, H.: Formation and Dissolution of<br />
the Passive Film on Iron studied by a Light Reflectance Technique, J.<br />
Electrochem. Soc. 144 (1997)<br />
[7] Büchler, M.; Schmuki, P.; Böhni, H.: Iron Passivity in Borate Buffer:<br />
Formation of a Deposit Layer and its Influence on the Semiconducting<br />
Properties, J. Electrochem. Soc. 145 (1998)<br />
[8] Büchler, M.: Alternating current corrosion of cathodically protected<br />
pipelines: Discussion of the involved processes and their consequences<br />
on the critical interference values, Materials and Corrosion 63 (2012)<br />
[9] Büchler, M.: Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong>: Diskussion der<br />
grundsätzlichen Mechanismen und deren Auswirkung auf<br />
Grenzwerte, <strong>3R</strong> International 49 (2010)<br />
[10] Funk, D.; Hildebrand, H.; Prinz, W.; Schwenk, W.: Korrosion und<br />
kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> von unlegiertem Stahl in Sandböden,<br />
Werkstoffe und Korrosion 38 (1987)<br />
[11] Kuhn, R. J.: Galvanic current on cast iron pipes, Bureau of Standards,<br />
Washington, Soil Corrosion Conference, 73 (1928)<br />
[12] Kuhn, R. J.: The Early History of Cathodic Protection in the United<br />
States-Some Recollections”, Corrosion Prevention & Control April,<br />
46 (1958)<br />
[13] Joos, D.; Büchler, M.: <strong>Korrosionsschutz</strong> in Wasseranlagen<br />
Möglichkeiten und Grenzen des kathodischen Schutzes in<br />
Wasseranlagen, Aqua & Gas 93 (2013)<br />
[14] Leeds, S. S.; Cottis, R. A.: Paper Nr. 09548: The influence of<br />
cathodically generated surface films on corrosion and the currently<br />
accepted criteria for cathodic protection, in Conference & Exposition,<br />
Corrosion Nacexpo 2009<br />
[15] Büchler, M.: Physical-chemical significance of the IR-free potential<br />
and methods for assessing the effectiveness of cathodic protection,<br />
<strong>3R</strong> special 1 (2014)<br />
DR. MARKUS BÜCHLER<br />
SGK Schweizerische Gesellschaft für<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>, Zürich (CH)<br />
Tel. +41 44213 1590<br />
E-Mail: markus.buechler@sgk.ch<br />
AUTOR<br />
Gutachten Studien Planung Intensivmessung<br />
Zustandsbewertung Untersuchungen<br />
bei Wechselspannungsbeeinflussung<br />
Gerätebau Anlagenbau Überwachungsmessung<br />
LKS-Anlagen Streustromuntersuchungen<br />
martin-gmbh.de<br />
06 | 2014 57
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
IFO- oder Intensivmessung:<br />
Was ist die bessere Methode?<br />
Zu Zeiten, als es noch keine PE-umhüllten Leitungen gab, führte man zur Integritätsprüfung der Leitungen auf<br />
Umhüllungsschäden in der Regel Intensivmessungen durch. Nachdem sich dann die Umhüllungsqualität ständig verbessert<br />
hatte und fast ausschließlich PE-umhüllte Systeme eingesetzt worden waren, wurde nach und nach die IFO-Messung<br />
immer populärer.<br />
Zwischenzeitlich stellt sich manch einer die Frage, welches<br />
eigentlich das bessere Prüfverfahren ist. Die Pipelinebetreiber<br />
verfahren bei der Suche nach einer Antwort nach<br />
unterschiedlichen Philosophien.<br />
Beim Fernleitungsbetrieb der Evonik Industries AG hat<br />
sich trotz der verschiedenen Betriebsbereiche mittlerweile<br />
eine doch recht einheitliche Vorgehensweise eingespielt.<br />
Beim Bau einer Leitung wird bereits auf einen<br />
sorgsamen Umgang mit den Rohren auf dem Lagerplatz,<br />
beim Hantieren, Ausfahren und Vorstrecken sowie beim<br />
Nachumhüllen, Absenken und insbesondere beim Verfüllen<br />
geachtet. Denn bereits hier kann es zu einer Unzahl<br />
von kleinsten Umhüllungsschäden kommen, die oftmals<br />
auch beim Isotest nicht auffallen (wie z. B. Einschnitte<br />
durch ein Cuttermesser oder ein abgebrochener Draht<br />
einer Rundbürste). Daher ist eine penible Bauüberwachung<br />
von großem Vorteil.<br />
Wenn im Zuge einer Polarisationsstrommessung, i. d. R.<br />
eines Druckprüfungsabschnittes ein spezifischer Umhüllungswiderstand<br />
von mind. 10 8 Ωm ² (Mindestwert für<br />
Fehlstellenfreiheit) gemessen wird, ist zuerst mal das<br />
Wichtigste erledigt. Wird dieser Wert nicht erreicht, ist es<br />
ratsam, trotz evtl. mangelnder Erdfühligkeit, direkt eine<br />
IFO-Messung durchzuführen. Der Rohr- und Tiefbauer ist<br />
mit seinen Geräten noch vor Ort um gefundene Fehlstellen<br />
zu beseitigen. Damit wird auch die Korrosionsgefahr<br />
reduziert, da Rohrleitungsabschnitte in der Bauzeit nicht<br />
immer sofort kathodisch geschützt werden und ggf.<br />
Maßnahmen gegen eine Hochspannungsbeeinflussung<br />
noch nicht betriebsbereit sind.<br />
Je länger jedoch das Rohr ohne wirksamen KKS im<br />
Boden lag und je besser die Umhüllung ansonsten war,<br />
umso größer kann der Schaden gerade bei einer kleinen<br />
Fehlstelle sein, da doch die gesamte Potenzialdifferenz<br />
zwischen Rohrkörper und Erdreich auf diese kleine Fehlstellenfläche<br />
wirkte (Bilder 3 und 6).<br />
Wenn bereits kurz nach Verlegung der KKS in Betrieb<br />
genommen wurde und evtl. Hochspannungsbeeinflussun-<br />
Bild 1: 70 m lange Rohrleitung, Grenzwert von<br />
10 8 Ωm ² unterschritten: Bestimmung der Fehlstelle unter<br />
Anwendung einer IFO-Messung. Ursache: Ein im Bereich<br />
einer Nachumhüllung eingewickelter Strohhalm, dessen<br />
Ende aus der Isolation 1 mm herausragte<br />
Bild 2: Auswertung hinsichtlich der Lage von 41 Isolationsfehlstellen einer<br />
40 km langen Rohrleitung, die mit einer IFO-Messung bestimmt wurden<br />
58 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
gen, nach DIN EN 15280, in Abhängigkeit vom Einschaltpotential,<br />
durch entsprechende Erdungsmaßnahmen auf<br />
ein vertretbares Maß reduziert wurden, sollte dies für den<br />
Rohrkörper jedoch kein wirkliches Problem mehr darstellen.<br />
Optimal ist, dass diese Messung noch vor der eigentlichen<br />
Inbetriebnahme und Befüllung der Leitung mit<br />
Produkt erfolgen und dann auch als Abnahmekriterium<br />
für den Rohrbauer dienen kann. Die Durchführung<br />
einer IFO-Messung ist auch bei vorhandener Wechselspannungsbeeinflussung<br />
und noch nicht aktivem KKS<br />
möglich. Durch Absenken des Schutzpotenzials können<br />
hierbei auch kleinste Fehlstellen festgestellt und exakt<br />
lokalisiert werden.<br />
Hat die Leitung dann ein Mindestmaß an Erdfühligkeit<br />
(mind. eine Winterperiode, besser jedoch ein Jahr nach<br />
Verlegung) erreicht, wird eine IFO-Messung über die<br />
gesamte Leitung durchgeführt. Hierbei werden, trotz<br />
der Sorgsamkeit bei der Verlegung der Leitung, häufig<br />
kleinere Umhüllungsfehlstellen gefunden.<br />
Diese werden natürlich umgehend behoben. Dabei werden<br />
weitere Untersuchungen durchgeführt. Art, Lage und<br />
Größe der<br />
F e h l s t e l l e<br />
wird dokumentiert.<br />
Der pH-<br />
Wert an der<br />
Umhüllungsfehlstelle<br />
und vom<br />
umgebenen<br />
Erdreich<br />
wird aufgenommen.<br />
Der Rohrkörper<br />
wird auf<br />
Korrosion<br />
oder andere<br />
Schäden untersucht.<br />
LEISTUNGEN<br />
Gepr. Mitglied des Fachverbandes<br />
Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> e.V.<br />
KATHODISCHER KORROSIONSSCHUTZ<br />
für<br />
ERDÖL-/ERDGAS-PIPELINES • INDUSTRIEANLAGEN<br />
TANKANLAGEN • OFFSHORE • CASING • STAHLBETONBAUWERKE<br />
● Beratung<br />
● Planung (Neubau, Erweiterung)<br />
● Wartungsmessungen<br />
● Fehlereinmessungen (Ortsnetze, Stadtnetze)<br />
● Intensivmessungen (verschiedene Ausführungen)<br />
● sämtliche Installationsarbeiten<br />
● photovoltaische Stromversorgungssysteme<br />
● Bau von Feststoffelektroden Cu/Cu SO 4<br />
● Erdungs- und Blitzschutzarbeiten<br />
● AC-Untersuchung<br />
● Stahlbetonbauwerke (Parkhaus, Brücken, Tunnel)<br />
Fachfirma geprüft<br />
vom DVGW nach GW 11<br />
Bei Dükern und HDDs unterhalb von Gewässern erfolgt<br />
häufig keine Messung – mit dem Argument, die Leitung<br />
sei vor dem Einzug doch bereits „abgefunkt“ worden,<br />
Fachbetrieb nach § 19l WHG<br />
KORUPP GmbH · Max-Planck-Straße 1 · D - 49767 TWIST<br />
Telefon +49 (0) 59 36 - 9 23 31 - 0 · Telefax 9 23 31 - 20 · www-korupp-kks.de<br />
Bild 3: Äußerer Materialfehler drei Jahre nach Verlegung,<br />
davon das erste Jahr ohne wirksamen KKS<br />
Bild 4: Fehlstelle 12 m neben der von Bild 3. Da diese jedoch<br />
wesentlich größer war, kam es zu keiner nennenswerten Korrosion<br />
Bild 5: Bei Rohrgrabenverfüllung mit Bagger herbeigeführte<br />
Beschädigung der GFK-Umhüllung<br />
Bild 6: Äußerer Materialfehler sechs Monate nach Verlegung<br />
ohne wirksamen KKS<br />
06 | 2014 59
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 7: Aufwändige Behebung einer Fehlstelle mit<br />
Spundwandkasten und Unterwasserbeton 4 m unterhalb des<br />
Wasserspiegels eines großen Fließgewässers. Nach Freilegung<br />
stellte sich heraus, dass sich die Nachumhüllung einer Schweißnaht<br />
bei Einzug des Dükers um eine Kurve um 12 cm innerhalb<br />
des Betonmantels verschoben hatte.<br />
Bild 8: GNSS-Empfänger für die GIS-Datenerfassung in<br />
Verbindung mit IFO- und Intensivmessungen<br />
was solle da schon sein. Doch auch hier können Fehlstellen<br />
genauso vorhanden sein. In Bild 7 ist die Behebung<br />
einer mittels IFO-Messung festgestellten Fehlstelle, 4 m<br />
unterhalb des Wasserspiegels eines großen Gewässers,<br />
dargestellt.<br />
Spätestens fünf Jahre nach Bau und Abnahme der Leitung,<br />
jedoch vor Ablauf der Verjährungsfrist, wird eine<br />
erneute IFO-Messung durchgeführt, um evtl. Umhüllungsschäden<br />
noch im Rahmen der Gewährleistung durch<br />
den Rohrbauer beheben zu lassen.<br />
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Anzahl der dann<br />
gefundenen Fehlstellen zwar sehr gering, jedoch immer<br />
noch ca. 10 % der bei Abnahme festgestellten Umhüllungsschäden<br />
liegt. Dies sind häufig nicht fachgerecht<br />
ausgeführte Nachumhüllungen, resultierend beispielsweise<br />
aus der ersten Schadensbehebung sowie Steine<br />
oder andere Festkörper, welche sich über die Zeit durch<br />
Setzung des Erdreiches durch die Umhüllung gedrückt<br />
haben. Während der weiteren Betriebsphase werden<br />
bei Verdacht einer Beschädigung (i. d. R. durch Eingriff<br />
Dritter) punktuell, ansonsten im Schnitt alle zehn Jahre,<br />
Wiederholungsmessungen über den gesamten Leitungsverlauf<br />
durchgeführt.<br />
Oftmals stellt sich die Frage, ob tatsächlich eine Fehlstelle<br />
vorliegt. Werden mehr als 1 mV bei auf 25 V abgesenkter<br />
Einspeisung gemessen, wird der Messpunkt als<br />
Fehlstelle definiert. Bis heute wurde noch keine Stelle<br />
freigelegt, welche sich als „blinder Alarm“ herausstellte.<br />
Die IFO-Messung ist somit ein sehr sicheres Verfahren<br />
zur Verifizierung der Umhüllungsqualität einer Leitung.<br />
Hat man eine Fehlstelle lokalisiert, die nur unter unverhältnismäßigen<br />
Umständen zu verifizieren und zu beheben<br />
wäre, wird eine Intensivmessung im Betriebszustand<br />
der KKS-Anlage durchgeführt, um die Wirksamkeit des<br />
KKS zu prüfen. Dieses Messverfahren kann jedoch bei<br />
Wechselspannungsbeeinflussungen, die den Einsatz<br />
von Abgrenzeinheiten und Erdungsanlagen erforderlich<br />
machen, problematisch sein. Ist diese durchführbar,<br />
bekommt man eine Aussage darüber, ob evtl. vorhandene<br />
Fehlstellen ausreichend kathodisch geschützt sind<br />
und somit ein Entscheidungskriterium, ob die Fehlstelle<br />
freigelegt werden muss. Ist die Wirksamkeit des KKS<br />
gegeben und die gemessene Wechselspannungsbeeinflussung<br />
liegt < 2 V, kann durchaus auch das Belassen<br />
der Fehlstelle vertreten werden.<br />
Je älter und schlechter die Umhüllung einer Leitung ist,<br />
desto eher stellt sich die Frage, anstatt einer IFO-Messung<br />
gleich eine Intensivmessung durchzuführen. Bezogen auf<br />
die Länge der Leitung kostet eine IFO-Messung rund halb<br />
so viel wie eine Intensivmessung. Ist jedoch zu befürchten,<br />
dass die Anzahl der gefundenen Fehlstellen so hoch<br />
ist, dass die Nachmessung dieser Stellen zur Überprüfung<br />
der Wirksamkeit des KKS mittels Intensivmessung höher<br />
wird als die Ersparnis, wird gleich eine Intensivmessung<br />
durchgeführt. Die Auswertung von IFO- und Intensivmessungen<br />
ergab, dass dies ab fünf Fehlstellen pro Leitungskilometer<br />
der Fall ist. Da die Anzahl der Fehlstellen<br />
erst nach der Messung bekannt ist, wurde der spezifische<br />
Umhüllungswiderstand von 105 Wm 2 als Kriterium für die<br />
Wahl der Methode festgelegt. Grundsätzlich kann über<br />
den spezifischen Umhüllungswiderstand nicht die Anzahl<br />
der Fehlstellen in der Leitungsumhüllung bestimmt werden,<br />
da er nicht nur von der Anzahl sondern u. a. auch<br />
von der Größe der Fehlstellen abhängig ist. Das Kriterium<br />
60 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
von 10 5 Wm 2 basiert auf der Auswertung<br />
vergangener Messungen.<br />
Doch gerade bei sehr gut umhüllten<br />
Leitungen ist die IFO-Messung<br />
die empfindlichere und somit<br />
genauere aber auch die günstigere<br />
Messmethode.<br />
Vorgehensweise der EVONIK<br />
Industries AG bei der Durchführung<br />
der Messung<br />
Intensivmessung<br />
Ziel der Messung ist es, eine Aussage<br />
über die Wirksamkeit des kathodischen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>es wie auch<br />
über die Umhüllungsqualität der<br />
gesamten Leitung zu bekommen.<br />
Die Messung wird in der Regel nach<br />
dem Zwei-Elektroden-Verfahren<br />
durchgeführt (siehe Infobox). Die<br />
Rohrleitung wird mit einem Rohrsuchgerät<br />
geortet. Eine Bezugselektrode<br />
wird über der Rohrleitung aufgestellt.<br />
Mit dieser Elektrode wird<br />
das Rohr/Bodenpotential gemessen.<br />
Dazu ist ein Anschluss an die Rohrleitung<br />
über eine Kabelverbindung<br />
herzustellen. Der Spannungsgradient<br />
wird im Normalfall gegen eine 10 m<br />
entfernt aufgestellte Bezugselektrode<br />
gemessen.<br />
Die Messwerte werden bei eingeschaltetem<br />
Schutzstrom, sowie bei<br />
kurzzeitig ausgeschaltetem Schutzstrom<br />
im Abstand von 5 m mit<br />
einem Datenerfassungsgerät aufgezeichnet.<br />
Der Messabstand wird<br />
in Bereichen, mit einem Spannungsgradienten<br />
größer 100 mV auf 1 m<br />
verkürzt. Um die Messwerte örtlich<br />
zuordnen zu können werden, an<br />
jedem Messpunkt zudem die GPS-<br />
Koordinaten aufgenommen. Dies<br />
geschieht mit einem GNSS-Empfänger<br />
der unter Nutzung von Korrekturdaten<br />
mit einer Genauigkeit von<br />
±10 cm arbeitet. Wenn genaue geografische<br />
Daten der Fernleitungen<br />
vorliegen (Shape-Dateien), können<br />
diese in den GNSS-Empfänger eingelesen<br />
werden. Die Ortung der Leitung<br />
mit Rohrsuchgerät kann dann<br />
entfallen und stattdessen mit dem<br />
GNSS-Empfänger erfolgen.<br />
Im Rahmen der Auswertung, werden<br />
die Messwerte in ein Geografi-<br />
Bild 9: Darstellung der Ergebnisse einer Intensivmessung im GIS-System. Zum Vergleich sind unten<br />
der Potenzialverlauf und die Spannungsgradienten in üblicher Form dargestellt.<br />
Bild 10: Gegenüberstellung der Ergebnisse einer Intensivmessung mit Ergebnissen einer intelligenten<br />
Molchung<br />
06 | 2014 61
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 11: Messaufbau einer IFO-Messung<br />
Bild 12: Messaufbau einer Intensivmessung<br />
Messwerte werden bei eingeschaltetem<br />
Schutzstrom wie auch bei kurzzeitig<br />
ausgeschaltetem Schutzstrom<br />
aufgenommen. Um sicherzustellen,<br />
dass auch kleinste Fehlstellen bestimmt<br />
werden, wird während der Messung<br />
der Schutzstrom im Zeitfenster der Einschaltpotenzialmessung<br />
erhöht, sodass<br />
sich Einschaltpotentiale von Eon= min.<br />
25 V einstellen. Wenn unter diesen<br />
Bedingungen kein Spannungsgradient<br />
messbar ist, ist nach AFK 11 keine Isolationsfehlstelle<br />
zu erwarten.<br />
Bei Messung einer Fehlstelle wird diese<br />
punktgenau eingemessen und die GPS-<br />
Koordinaten (10 cm-Genauigkeit) aufgenommen.<br />
An Isolationsfehlstellen,<br />
die nicht beseitigt werden, wird im<br />
Anschluss punktuell eine Intensivmessung<br />
zur Beurteilung der Wirksamkeit<br />
des KKS durchgeführt.<br />
Übersicht zu den Umhüllungswiderständen<br />
bei neuen Leitungen:<br />
»»<br />
unter Laborbedingungen bis zu<br />
10 10 Ωm 2 möglich<br />
»»<br />
akzeptierter Grenzwert für die Fehlstellenfreiheit<br />
10 8 Ωm 2<br />
»»<br />
ab 10 7 Ωm 2 und schlechter ist ein<br />
Umhüllungsschaden wahrscheinlich<br />
»»<br />
ab 10 5 Ωm 2 wird bei Bestandsleitungen<br />
eine Intensivmessung anstatt<br />
einer IFO-Messung angeraten<br />
sches Informationssystem eingelesen und dort ortsbezogen<br />
dargestellt. Die genauen GPS-Koordinaten ermöglichen<br />
zudem einen Abgleich mit Ergebnissen aus intelligenten<br />
Molchungen. Mit Hilfe der Ergebnisse werden<br />
Referenzwerte für zukünftige Überwachungsmessungen<br />
festgelegt. Im Fall eines unzureichenden kathodischen<br />
Schutzes werden weitere Maßnahmen zur Optimierung<br />
der Situation eingeleitet.<br />
IFO-Messung<br />
An Fernleitungen mit einem spezifischen Umhüllungswiderstand<br />
größer 10 5 Wm 2 führen wir IFO-Messungen<br />
durch. Die Ortung der Leitung erfolgt analog der Intensivmessung.<br />
Mit zwei Bezugselektroden, die in einem<br />
Abstand von 5 m über der Rohrleitung aufgestellt werden,<br />
wird der Spannungsgradient aufgenommen. Die<br />
AUTOREN<br />
MICHAEL GEMSA, Evonik Industries AG,<br />
Fernleitungsbetrieb, Marl<br />
Tel.: +49 (0)2365 49-9173<br />
E-Mail: michael.gemsa@evonik.com<br />
THOMAS BASTEN, Evonik Industries AG, Leiter<br />
Fernleitungsbetrieb, Marl<br />
Tel.: +49 (0) 2365 49-6766<br />
E-Mail: thomas.basten@evonik.com<br />
62 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Smart KKS: Intelligente Schutzstromeinspeisung<br />
zum Schutz wechselspannungs-beeinflusster<br />
Rohrleitungen<br />
Um einen zuverlässigen Schutz vor Außenkorrosion von im Erdreich verlegten Gashochdruckleitungen zu gewährleisten,<br />
ist nach DVGW G 466-1 bei allen erdverlegten Gashochdruckleitungen ab einem Betriebsdruck von über 5 bar, die<br />
Einrichtung eines kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es (KKS) erforderlich. Die Errichtung, Inbetriebnahme und Überwachung<br />
des KKS ist dabei in den DVGW-Regelwerken GW 10, GW 12 und GW 16 geregelt [1, 2, 3]. Unterliegt die Rohrleitung<br />
einer Wechselspannungsbeeinflussung, z. B. auf Grund von Parallelführungen mit Bahn- und/oder Hochspannungstrassen,<br />
so ergibt sich eine Gefährdung durch Wechselstromkorrosion, die mit einem nach GW 10 bzw. GW 16 überwachten KKS<br />
nicht verhindert werden kann. Aus diesem Grund wurde das erste DVGW-Forschungsvorhaben Wechselstromkorrosion<br />
initiiert [5], das die Ursache und den Mechanismus der Wechselstromkorrosion darlegte. Die wesentlichen Erkenntnisse<br />
dieses Forschungsvorhabens finden sich in der aktuellen Version der AfK-Empfehlung Nr. 11 wieder [4]. Das zweite DVGW-<br />
Forschungsvorhaben „Wechselstromkorrosion“ [6], welches Ende letzten Jahres abgeschlossen wurde, überprüfte die<br />
Möglichkeiten des Schutzes wechselstrombeeinflusster Rohrleitungen gegen Wechselstromkorrosion durch intelligente<br />
Schutzstromeinspeisung. Der folgende Artikel behandelt nun Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung der dort<br />
beschriebenen Vorgehensweise.<br />
Theoretische Grundlagen<br />
Die wesentliche Ursache für die Wechselstromkorrosion<br />
ergibt sich gemäß dem ersten Forschungsvorhaben aus<br />
der Höhe der anliegenden Wechselspannung einerseits<br />
und der Einstellung des KKS andererseits. Dies bedeutet<br />
also im Umkehrschluss, dass die Einstellung des KKS<br />
entscheidend dazu beiträgt, ob und in welcher Stärke<br />
Wechselstromkorrosion an einer Rohrleitung stattfinden<br />
kann. Bild 1 zeigt die prinzipielle Vorgehensweise, nach<br />
der eine derartige Steuerung vollzogen werden kann.<br />
Allerdings haben Messergebnisse im Rahmen des 2. Forschungsvorhaben<br />
gezeigt, dass diese Kurve zu wenig spezifisch<br />
ist und der Einfluss des Bodenwiderstands stärker<br />
berücksichtigt werden muss [4,6].<br />
Bild 2 macht deutlich, dass die potentielle Wechselstromkorrosionsgefährdung<br />
bei vergleichsweise hochohmigen<br />
Böden sehr viel geringer ist als in AfK 11 beschrieben,<br />
während sie bei eher niederohmigen Böden höher ist.<br />
Insofern können die Kurven aus Bild 2 als ideale Grundlage<br />
für einen Steueralgorithmus dienen. Dabei sollten<br />
die Mittelwerte des Einschaltpotentials immer in dem in<br />
Abhängigkeit der anliegenden Wechselspannung und<br />
des Bodenwiderstandes definierten unkritischen Bereich<br />
liegen.<br />
Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der<br />
Umsetzung dieser Vorgaben in die Praxis.<br />
Prinzipieller Aufbau<br />
Zur Realisierung des oben beschriebenen Konzepts sind<br />
bestimmte Fernüberwachungs- und Regelungssysteme<br />
vor allem bei zeitlich variierender Wechselspannungsbeeinflussung<br />
notwendig. Bild 3 zeigt den prinzipiellen<br />
Aufbau des Konzeptes einer intelligenten Steuerung.<br />
Zur technischen Umsetzung müssen entlang der Rohrleitung<br />
an den Bereichen mit erhöhter Wechsel- und<br />
Gleichstrombeeinflussung fernüberwachungsfähige<br />
Messsensoren installiert werden. Diese Messsensoren<br />
ermitteln permanent an den entsprechenden Beeinflussungsbereichen<br />
Messwerte wie Ein- und Ausschaltpo-<br />
Bild 1: Bereich der Wechselstrom-Korrosionsgefahr in<br />
Abhängigkeit von der Wechselspannung Rohr – Erde und dem<br />
Einschaltpotential [4]<br />
06 | 2014 63
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 2: Abhängigkeit der Grenzwertkurve bei<br />
verschiedenen Bodenwiderständen und einer<br />
Fehlstellenfläche von 1 cm 2 [6]<br />
Bild 3: Schematische Darstellung für die Umsetzung von Smart KKS<br />
tentiale, Schutzstrom und Wechselspannungswerte,<br />
die in festgelegten Intervallen fernwirktechnisch an das<br />
Schutzstromgerät übertragen werden. Anhand der übertragenen<br />
Messdaten entscheidet das Schutzstromgerät<br />
über eine bedarfsangepasste Schutzstromeinspeisung<br />
und ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen<br />
Betriebsbedingungen, um einen optimalen Schutz der<br />
Rohrleitung zu gewährleisten.<br />
Anforderung an die Hardware<br />
Zur Realisierung einer derartigen intelligenten Einspeisung<br />
muss eine permanente Datenerfassung aller relevanten<br />
Rohrleitungsdaten an allen fernüberwachten Messstellen<br />
und eine entsprechend zeitnahe Auswertung dieser<br />
Fernüberwachungsdaten erfolgen, damit dann eine automatische<br />
Berechnung der erforderlichen Schutzstromeinspeisung<br />
realisiert werden kann.<br />
Derzeitige KKS-Fernüberwachungstechnologien können<br />
maximal alle 5 Minuten Messdaten erfassen. Zur<br />
Realisierung der intelligenten Schutzstromeinspeisung<br />
ist dieses Messintervall jedoch nicht ausreichend. Es<br />
bedarf einer zeitkontinuierlichen Messdatenerhebung<br />
und Messdatenauswertung an der kathodisch geschützten<br />
Rohrleitung. Nur dies ermöglicht eine rechtzeitige<br />
Erkennung von Grenzwertunterschreitungen und eine<br />
präzisere Steuerung der Schutzstromeinspeisung. Es ist<br />
also eine Messtechnik notwendig, die eine permanente<br />
Messung ermöglicht. Außerdem muss sowohl auf die<br />
Schutzstromgeräte als auch auf die Fernüberwachungssensoren<br />
jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus<br />
zugegriffen werden können, um Messdaten und Steuerungsparameter<br />
zeitnah abzugreifen oder zu verändern.<br />
Fazit<br />
Mit der aktuellen zur Verfügung stehenden Fernüberwachungstechnik<br />
kann in Verbindung mit den aktuell auf<br />
dem Markt befindlichen fernsteuerbaren Schutzstromgeräten<br />
keine zeitnahe Anpassung der Schutzstromeinspeisung<br />
erfolgen, da zum einen die Messzyklen der<br />
Fernüberwachung zu gering sind und zum Anderen die<br />
Kommunikation zwischen Schutzstromgerät und Fernüberwachung<br />
dies auch nicht erlaubt.<br />
Zur vollständigen Ausschöpfung der Möglichkeiten einer<br />
solchen intelligenten Schutzstromeinspeisung ist deshalb<br />
eine entsprechend leistungsfähige Steuer-, Mess- und<br />
Kommunikationseinheit notwendig. Smart KKS ermöglicht<br />
die Kommunikation zwischen Fernüberwachung,<br />
Fernsteuerung und intelligenten Regelkreisen. Das System<br />
ermittelt die Abweichungen der Messdaten von den<br />
definierten Grenzwerten und berechnet einen Korrekturwert,<br />
anhand dessen das Einschaltpotential entsprechend<br />
automatisch angepasst wird. Smart KKS vereint also die<br />
Funktionen des Steuerungs- und Messinstruments. Das<br />
System verfügt über ein neues intelligentes Schutzstromgerät,<br />
welches in der Lage ist, durch Verknüpfung mit<br />
einem KKS-Fernüberwachungssensor eine automatische<br />
bedarfsangepasste Schutzstromregelung zu ermöglichen.<br />
Die Datenübertragung von der Zentrale zum Schutzstromgerät<br />
kann dabei über GSM, GPRS oder Kabel erfolgen.<br />
Zu jeder Zeit kann von der Zentrale aus auf das Schutzstromgerät<br />
zugegriffen und entsprechende Parameter<br />
verändert werden [7].<br />
Im Endeffekt bedeutet das nun, dass in Kürze die entsprechende<br />
Technik real zur Verfügung stehen wird, mit<br />
deren Hilfe eine solche intelligente Schutzstromeinspei-<br />
64 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
sung auf wechselspannungsbeeinflusste Rohrleitungen,<br />
wie sie im 2. Forschungsvorhaben beschrieben worden<br />
ist, auch realisiert werden kann.<br />
Literatur:<br />
[1] DVGW-Arbeitsblatt GW 10 „Arbeitsblatt für den Kathodischen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> (KKS) erdverlegter Lagerbehälter und<br />
Stahlrohrleitungen aus Stahl – Inbetriebnahme und<br />
Überwachung“, (2008).<br />
[2] DVGW-Arbeitsblatt GW 12 „Planung und Errichtung des<br />
kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es (KKS) für erdverlegte<br />
Lagerbehälter und Stahlrohrleitungen“, (2010).<br />
[3] DVGW-Arbeitsblatt GW 16 „Arbeitsblatt für den Kathodischen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> (KKS) erdverlegter Lagerbehälter und<br />
Stahlrohrleitungen aus Stahl – Fernüberwachung“, (2008).<br />
[4] DVGW Afk-Empfehlung Nr. 11 „Beurteilung der<br />
Korrosionsgefährdung durch Wechselstrom bei kathodisch<br />
geschützten Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen“,<br />
(2012).<br />
[5] M. Büchler, C.-H. Voûte, „DVGW-Forschungsprojekt G 2/01/08:<br />
Feldversuche zur Prüfung des Einflusses von Wechselspannung<br />
und Einschaltpotential auf die Wechselstromkorrosion“,<br />
Schweizerische Gesellschaft für <strong>Korrosionsschutz</strong>, (2010).<br />
[6] M. Büchler, „Beurteilung der Wechselstromkorrosionsgefährdung<br />
von Rohrleitungen mit Probeblechen: Relevante Einflussgrössen<br />
für die Bewertung der ermittelten Korrosionsgeschwindigkeit“,<br />
<strong>3R</strong> International, 36 (2013).<br />
[7] M. Mueller, R. Deiss, „Smart KKS: Von der KKS-Fern- zur KKS-<br />
Online-Überwachung“, <strong>3R</strong> International, 86, (2013).<br />
Dipl.-Phys. RAINER DEISS<br />
Netze BW GmbH, Stuttgart<br />
Tel.: +49 (0)711289-47414<br />
E-Mail: r.deiss@netze-bw.de<br />
Dipl.-Ing. (FH) MARKUS WENDLING<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel.: +49 (0)711289-46527<br />
E-Mail: m.wendling@rbs-wave.de<br />
AUTOREN<br />
06 | 2014 65
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Qualitätssicherung bei HDD-Stahlrohrverlegungen<br />
durch den KKS – ein Praxisbeispiel<br />
Der kathodische <strong>Korrosionsschutz</strong> stellt eine wichtige Maßnahme zur Qualitätssicherung bei der Stahlrohrleitungsverlegung<br />
dar. An Hand eines Praxisbeispiels wird beschrieben, welche Möglichkeiten die Messtechnik des kathodischen<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>es auch unter erschwerten Bedingungen bietet. Dabei wird aufgezeigt, dass es trotz der vorhandenen<br />
hohen Aussagekraft der Messmethoden Grenzen gibt, die bei der Interpretation der Messwerte beachtet werden müssen.<br />
Allgemeines<br />
Der kathodische <strong>Korrosionsschutz</strong> (KKS) von erdverlegten<br />
Stahlrohrleitungen ist ein seit vielen Jahren etabliertes<br />
Verfahren. Bereits vor mehr als 100 Jahren wurde es<br />
erstmalig angewandt und ist in Deutschland seit über 50<br />
Jahren verbreitet. Mit Hilfe des KKS kann die Betriebs- und<br />
Versorgungssicherheit von Rohrleitungen erhöht, sowie ein<br />
wichtiger Beitrag zum Werterhalt und zur Investitionsplanung<br />
geleistet werden. In den letzten Jahren hat auch die<br />
Bedeutung des KKS als Qualitätssicherungsverfahren beim<br />
Rohrleitungsbau zugenommen. Im aktuellen Regelwerk des<br />
DVGW wird eine möglichst fehlstellenfreie Umhüllung als<br />
wichtiges Ziel bei der Rohrverlegung genannt [1,2], und in<br />
Sonderfällen auch gefordert [3]. Hintergrund dieser Forderung<br />
ist unter anderem die Erkenntnis, dass im Zusammenhang<br />
mit der Wechselstromkorrosion gerade kleine und<br />
kleinste Fehlstellen besonders korrosionsgefährdet sind. Eine<br />
ausführliche Diskussion der Aussagen des Regelwerks ist<br />
durch die Verfasser bereits in der Vergangenheit erfolgt [4].<br />
Bild 1: GFK-umhüllte Rohrleitung in der Zielgrube<br />
Die Messtechnik des KKS ist eine wichtige und größtenteils<br />
auch die einzige Möglichkeit, eine fehlstellenfreie Verlegung<br />
zu überprüfen und Umhüllungsfehlstellen zur Sanierung<br />
zu orten.<br />
Durch den Fortschritt der Messtechnik können mittlerweile<br />
selbst unter Baustellenbedingungen mit Hilfe der<br />
Messverfahren des kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es kleine<br />
und kleinste Umhüllungsfehlstellen festgestellt und mit<br />
hoher Genauigkeit in der Örtlichkeit bestimmt werden.<br />
Zur Realisierung einer praktisch umhüllungsfehlstellenfreien<br />
Rohrleitung, d.h. bei einem Umhüllungswiderstand<br />
R CO<br />
> 10 8 Ωm ² , besteht mittlerweile die Herausforderung<br />
darin, Umhüllungsfehler mit Strömen von teilweise wenigen<br />
Mikroampere punktgenau zu orten. In der Vergangenheit<br />
lag die Größenordnung der zu suchenden Fehler noch bei<br />
Stromstärken im Milliamperebereich.<br />
Im vorliegenden Artikel zeigen die Autoren an Hand eines<br />
Praxisbeispiels, wie der kathodische <strong>Korrosionsschutz</strong> einen<br />
wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung beim Neubau von<br />
Rohrleitungen leisten kann. Sie zeigen aber auch<br />
auf, dass es trotz der Fortschritte der Messtechnik<br />
unter realen Bedingungen Grenzen der Messtechnik<br />
gibt, die bei der Interpretation der Ergebnisse<br />
berücksichtigt werden müssen.<br />
Projektbeschreibung<br />
Das im Folgenden beschriebene Projekt wurde<br />
durch die Entscheidung der zuständigen Behörde<br />
ausgelöst, am Rand eines Flusses ein Wasserrückhaltebecken<br />
zu errichten. Im Bereich des geplanten<br />
Beckens verlief eine Gashochdruckleitung aus<br />
dem Jahr 1942. Die Leitung der Dimension DN 300<br />
besaß eine Umhüllung aus Wollfilzpappe mit entsprechend<br />
geringem Umhüllungswiderstand. Im<br />
Bereich des geplanten Beckens sollte die Rohrleitung<br />
umgelegt werden. Dazu wurde auf einer<br />
Länge von etwa 200 m eine HDD-Bohrung in einer<br />
Tiefe von 10 m durchgeführt, so dass die Leitung<br />
unterhalb des Beckens verlaufen wird.<br />
Durch den Bau des Rückhaltebeckens wird die neu<br />
verlegte Rohrleitung in Zukunft ohne erheblichen<br />
66 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Aufwand nicht mehr zugänglich sein. Infolgedessen wurde<br />
in Übereinstimmung mit den Aussagen des Regelwerks<br />
bei der Verlegung besonderer Wert darauf gelegt, die<br />
Leitung fehlstellenfrei zu bauen. Zusätzlich zu der üblichen<br />
PE-Umhüllung wurde bei der Rohrverlegung eine<br />
GFK-Umhüllung auf die Leitung aufgebracht (Bild 1). Die<br />
Verarbeitung des GFK-Materials erfolgte durch Fachkräfte<br />
des Herstellers. Auf diese Weise sollten Fehler bei der<br />
Verarbeitung des GFK-Materials ausgeschlossen werden.<br />
Die Firma Maurmann GmbH wurde durch den Bauherren<br />
beauftragt, nach Verlegung der Rohrleitung die Umhüllungsqualität<br />
zu kontrollieren. Bei offenen Verlegeweisen<br />
wird davon ausgegangen, dass evtl. vorhandene Umhüllungsfehlstellen<br />
erst nach einer Winterperiode mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit in Kontakt mit einem Elektrolyten stehen.<br />
Dies gilt insbesondere in vergleichsweise trockenen<br />
Böden. Im Gegensatz dazu können bei HDD-Verfahren<br />
durch die vorhandene Bohrspülung auch kleinere Umhüllungsfehlstellen<br />
häufig bereits unmittelbar nach dem Einzug<br />
messtechnisch erkannt werden, sofern das eingezogene<br />
Rohr vollumfänglich von der Bohrspülung umgeben ist. Die<br />
Verfasser weisen jedoch darauf hin, dass dies nicht in jedem<br />
Fall möglich sein wird. Bei dem beschriebenen Projekt wurde<br />
unmittelbar nach dem Einzug eine Polarisationsstrommessung<br />
zur Qualitätsüberprüfung durchgeführt.<br />
Die Untersuchung zeigte, dass die Rohrleitung trotz der<br />
doppelten Umhüllung nicht fehlstellenfrei war. Der gemessene<br />
Strom lag bei einem Einschaltpotential von -1,49 V CSE<br />
bei 0,38 mA. Damit lag der spezifische Umhüllungswiderstand<br />
unter der Grenze von R CO<br />
> 10 8 Ωm ² . Aus den<br />
Messwerten ließ sich unter Berücksichtigung des niedrigen<br />
spezifischen Widerstandes der Bohrspülung die Größenordung<br />
der Fläche des Rohrleitungsstahls im Kontakt<br />
mit dem Elektrolyten mit etwa 1 - 2 cm ² grob abschätzen.<br />
Freiliegende Stahloberflächen dieser Größenordnung sind<br />
üblicherweise kathodisch schützbar, wenn keine erhöhte<br />
Wechselstromkorrosionsgefahr besteht. Dementsprechend<br />
lag auch der Grenzwert der Polarisationsstrommessung um<br />
eine Größenordnung höher bei 3,3 mA.<br />
Zur Ortung der Umhüllungsfehlstellen wurde im Anschluss<br />
an die Polarisationsstrommessung eine Intensive Fehlstellenortung<br />
(IFO) durchgeführt. Durch diese Messung wurde<br />
ein Leitungsbereich identifiziert, in dem sich eine Fehlstelle<br />
befand. Anschließend wurde mit dem DCVG-Verfahren<br />
das Zentrum der Äquipotentiallinien an der Erdoberfläche<br />
bestimmt. Dieses sogenannte „Einmessen des negativsten<br />
Punktes“ wurde dabei durch den großen vertikalen<br />
Abstand von der Fehlstelle erschwert. Die durchschnittliche<br />
Verlegetiefe der Rohrleitung lag bei 10 m, im Bereich<br />
der Fehlstelle betrug die Überdeckung etwa 7 m. Bei der<br />
klassischen Intensivmessung entsprechen zum Vergleich<br />
10 m der Entfernung, mit der Spannungstrichter an einer<br />
Fehlstelle aufgenommen werden. Bei der Verlegetiefe der<br />
Rohrleitung wurde hier also unter Bedingungen gemessen,<br />
unter denen sich die Auswirkungen einer kleinen Fehlstelle<br />
schon nahezu vollständig abgebaut haben können. Dementsprechend<br />
waren die resultierenden Potentialgradienten<br />
an der Oberfläche bei kleineren Elektrodenabständen sehr<br />
gering und das gesuchte Zentrum der Äquipotentiallinien<br />
konnte nur mit einer Genauigkeit von ca. ±1,5 m bestimmt<br />
werden.<br />
Nach der Bestimmung dieses Punktes, oder besser dieses<br />
Bereiches, an der Erdoberfläche stellte sich die Frage, welcher<br />
örtliche Zusammenhang mit der Fehlstelle bestand.<br />
Normalerweise wird davon ausgegangen, dass sich nach<br />
der Einmessung die Fehlstelle lotrecht unterhalb des angegebenen<br />
Punktes befindet. Diese Annahme beruht auf<br />
der vereinfachenden Modellvorstellung eines homogenen<br />
Bodens, bei dem sich die Äquipotentiallinien konzentrisch an<br />
der Erdoberfläche anordnen. Diese Annahme ist jedoch in<br />
der Praxis nahezu nie erfüllt. Die Potentiallinien sind verzerrt<br />
und die Fehlstelle befindet sich nicht lotrecht unterhalb des<br />
negativsten Punktes. Üblicherweise - d.h. bei Verlegetiefen<br />
mit Deckungen von 1 - 2 m - kann dies jedoch vernachlässigt<br />
werden. Wird eine Umhüllungsfehlstelle beseitigt, so<br />
öffnet man aus arbeitstechnischen Gründen in der Regel<br />
eine Baugrube mit einer Länge von etwa 1,5 m oder mehr.<br />
Innerhalb dieser Baugrube befindet sich dann der Fehler.<br />
Die Größe der Baugrube reicht aus, um die Abweichungen<br />
der Lage zu kompensieren.<br />
Im vorliegenden Fall konnten die Verzerrungen der Äquipotentiallinien<br />
jedoch nicht mehr vernachlässigt werden.<br />
Zum einen war die Deckung der Leitung wesentlich höher<br />
und zum anderen lagen starke Inhomogenitäten des Erdbodens<br />
vor. Wie bereits beschrieben verlief die Leitungstrasse<br />
unmittelbar neben einem Fluss. Im Bereich der Fehlstelle<br />
wurde dieser Fluss von einer Brücke gekreuzt. Der Fluss und<br />
die Gasleitung wurden ebenfalls von einem eingesandeten<br />
Abwasserkanal gekreuzt. Neben der neu verlegten Leitung<br />
lag die alte Gasleitung mit der bekannten, sehr schlechten<br />
Umhüllungsqualität im Boden. Erschwerend kam hinzu, dass<br />
bei einer HDD-Bohrung die Bohrspülung einen wesentlich<br />
geringeren spezifischen elektrischen Widerstand als der<br />
Erdboden hat und damit die Bohrung eine Art „Stromkanal“<br />
bildet, in dem der Strom bevorzugt zur Fehlstelle fließt. Aus<br />
den genannten Gründen wurde bei der Beschreibung der<br />
Fehlerposition kein genauer Punkt angegeben, sondern<br />
lediglich ein Bereich, in dem sich die Umhüllungsfehlstelle<br />
befinden sollte. Zusätzlich wurde empfohlen, eine eventuelle<br />
Beseitigung des Fehlers unter der Begleitung eines<br />
KKS-Messtechnikers durchzuführen, um ggf. die eingemessene<br />
Lage zu korrigieren. Bei der Freilegung der Fehlstelle<br />
verschob sich das Zentrum der Äquipotentiallinien mit<br />
zunehmender Tiefe tatsächlich kontinuierlich in Richtung<br />
der Fehlstelle. Es zeigte sich später, dass das an der Erdoberfläche<br />
bestimmte Zentrum um einige Meter von dem<br />
Ort der Fehlstelle abwich.<br />
Die Anzeige einer Umhüllungsfehlstelle wurde in Anbetracht<br />
der doppelten Umhüllung vom Bauherren zunächst mit einer<br />
gewissen Skepsis aufgenommen, da eine Beschädigung der<br />
GFK-Umhüllung schwer vorstellbar war. Dennoch wurde<br />
umgehend versucht, die Umhüllungsfehlstelle zu beseitigen.<br />
Es war aufgrund der zu geringen Kraft der Zugmaschine<br />
nicht mehr möglich, die Leitung weiter aus dem Boden<br />
06 | 2014 67
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 2: Brunnen zur Absenkung des Grundwasserstands<br />
Bild 3: Baugrube zur Freilegung der Umhüllungsfehlstelle<br />
herauszuziehen. Aus diesem Grund wurde entschieden,<br />
die Fehlstelle freizulegen. Der erste Versuch dazu wurde<br />
zeitnah unternommen. Bei einer Tiefe von etwa 4 - 5 m<br />
wurde dieser Versuch jedoch abgebrochen. Die vorhandenen<br />
Pumpen reichten nicht aus, um die Baugrube trocken zu<br />
halten. Die Gefahr eines Einsturzes wurde zu hoch, dennoch<br />
konnte über diesen Freilegungsversuch die Position der<br />
Umhüllungsfehlstelle wesentlich genauer bestimmt werden.<br />
Im Verlaufe des Freilegungsversuches wurde eine Spundwand<br />
in den Boden getrieben, die auf die Leitung traf. Die<br />
Leitung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingebunden.<br />
Es wurde deshalb umgehend ein weiterer Einspeiseversuch<br />
vorgenommen um festzustellen, ob dabei der Rohrleitungsstahl<br />
freigelegt worden war, bzw. ob die Spundwand Kontakt<br />
mit dem Rohrleitungsstahl besaß. Die Messung zeigte<br />
keine Veränderung des eingespeisten Stromes und des<br />
Umhüllungswiderstandes. Es gab somit keine Hinweise auf<br />
einen Kontakt zwischen dem Rohrleitungsstahl und der<br />
Spundwand oder einer Freilegung der Rohrleitungsoberfläche.<br />
Später sollte sich zeigen, dass trotz des sich nicht<br />
verändernden Ausbreitungswiderstandes der Rohrleitung<br />
die Umhüllung an dieser Stelle wesentlich beschädigt worden<br />
war, so dass eine neue Fehlstelle entstand.<br />
Aus Gründen des Baufortschrittes wurde die ausgehobene<br />
Baugrube zunächst geschlossen und der neu verlegte Rohrleitungsabschnitt<br />
in die bestehende Leitung eingebunden.<br />
Es wurde diskutiert, ob die Freilegung der Fehlstelle in<br />
Anbetracht der zu erwartenden Kosten gerechtfertigt war.<br />
Zur Öffnung der entsprechenden Baugrube wäre die Bohrung<br />
mehrerer Brunnen und die großflächige Absenkung<br />
des Grundwasserstandes erforderlich gewesen (Bild 2 und<br />
Bild 3). In Kombination mit den Sicherungsmaßnahmen der<br />
Baustelle wurden damit Kosten im sechsstelligen Bereich<br />
erwartet. Aus Sicht des kathodischen Korrosionschutzes<br />
war die Fehlstelle wie beschrieben zunächst schützbar,<br />
es bestand allerdings die Frage, ob im Laufe der Zeit eine<br />
Unterwanderung weiterer Bereiche der Umhüllung erfolgen<br />
würde. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen zur Wechselstromkorrosion,<br />
dass unter bestimmten Bedingungen<br />
auch bei kleineren Fehlstellen trotz kathodischem Schutz<br />
Korrosionserscheinungen auftreten können. Erschwerend<br />
kam hinzu, dass nach Errichtung des Rückhaltebeckens die<br />
Rohrleitung nicht mehr für Sanierungsmaßnahmen zugänglich<br />
gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde prinzipiell<br />
vom Betreiber eine Sanierung der Rohrleitungsumhüllung<br />
geplant. In den folgenden Monaten wurde die Umhüllungsfehlstelle<br />
beobachtet. Innerhalb von drei Monaten wurde<br />
dabei eine erhebliche Erhöhung der Potentialgradientendifferenz<br />
an der Erdoberfläche gemessen. Sie stieg von einem<br />
Wert von 150 µV im Juli 2012 auf einen Wert von 825 µV<br />
im Oktober 2012. Übertragen auf den ursprünglich bei der<br />
Polarisationsstrommessung bestimmten Strom bedeutete<br />
diese Steigerung, dass der in die Fehlstelle eintretende<br />
Strom von 0,38 mA auf etwa 2 mA angestiegen war. Dieser<br />
abgeschätzte Wert lag zwar immer noch unterhalb<br />
des Stromgrenzwertes von 3,3 mA, befand sich jedoch<br />
bereits in der gleichen Größenordnung. Bei einer möglichen<br />
weiteren Steigerung in der Zukunft wäre durchaus<br />
eine Überschreitung des Grenzwertes möglich gewesen.<br />
Damit wäre selbst ohne eine erhöhte Wechselstromkorrosionsgefährdung<br />
die Wirksamkeit des KKS nicht mehr<br />
eindeutig belegt gewesen.<br />
Mit dem oben skizzierten Aufwand wurde die Fehlstelle<br />
im April 2013 freigelegt (Bild 4). Dabei zeigte sich, dass<br />
sich die Fläche des Rohrleitungsstahls im Kontakt mit dem<br />
Elektrolyten im Vergleich zu der ersten Messung unmittelbar<br />
nach dem Einzug der Rohrleitung deutlich erhöht<br />
hatte. Anscheinend besaß anfänglich trotz des vorhandenen<br />
Grundwassers und der niederohmigen Bohrspülung nur<br />
ein kleiner Teil der Fehlstelle Kontakt zum Elektrolyten. Im<br />
Bereich des Rammschadens durch die Spundwand war zum<br />
Zeitpunkt der Freilegung ebenfalls ein elektrischer Kontakt<br />
des Rohrleitungsstahls zum umgebenden Elektrolyten vorhanden<br />
(Bild 5). Bei der Messung unmittelbar nach dem<br />
68 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Bild 4: Umhüllungsfehlstelle<br />
Kontakt zwischen der Rohrleitung und der Spundwand war<br />
dieser Kontakt noch nicht vorhanden.<br />
Fazit<br />
Bei der Verlegung wurde die Umhüllung der Rohrleitung<br />
mit einer zweiten Umhüllung aus GFK-Material verstärkt.<br />
Das GFK-Material wurde durch geschulte Fachkräfte aufgebracht.<br />
Dennoch war nach dem Einzug der Rohrleitung<br />
eine Fehlstelle vorhanden. Das Beispiel zeigt, dass trotz eines<br />
erheblichen Aufwandes zur Verstärkung der Rohrleitungsumhüllung<br />
das Auftreten von Fehlstellen nicht ausgeschlossen<br />
werden kann. Die Begleitung und Überprüfung derartiger<br />
Maßnahmen durch die KKS-Messtechnik ist aus unserer<br />
Sicht deshalb sinnvoll und kann nicht ersetzt werden.<br />
Bei der Aufgrabung der Rohleitung wurde festgestellt, dass<br />
sich die Fläche der freiliegenden Stahloberfläche in Kontakt<br />
mit dem Elektrolyten im Vergleich zur ersten Abschätzung<br />
vergrößert hatte. Die Fehlstelle durch den Rammschaden<br />
war zunächst nicht messbar gewesen. Später hatte sich<br />
anscheinend das Messsignal mit dem der ursprünglichen<br />
Fehlstelle überlagert. Der Abstand der beiden Fehlstellen<br />
betrug etwa 3 m voneinander. Die beobachteten Phänomene<br />
illustrieren erneut, dass selbst in einem sehr feuchten<br />
Boden unmittelbar nach der Verlegung durch die durchgeführten<br />
Messungen nur sehr begrenzt dauerhafte Aussagen<br />
über die Größe von Umhüllungsfehlstellen getroffen werden<br />
können. Insbesondere in Situationen wie der geschilderten,<br />
in denen die Rohrleitung später unzugänglich sein wird,<br />
lohnt es sich deshalb unserer Ansicht nach, auch Fehlstellen<br />
mit einer geringen Stromaufnahme zu sanieren.<br />
Die Einmessung der Fehlstelle an der Erdoberfläche führte<br />
zu Ortsbestimmungen, die um mehrere Meter von der<br />
anschließenden Fehlstelle abwichen. Diese Abweichungen<br />
waren nicht auf fehlerhafte Messungen, sondern auf physikalische<br />
Gegebenheiten zurückzuführen. Insbesondere bei<br />
sehr kleinen Fehlstellen muss damit gerechnet werden, dass<br />
gewisse Messunsicherheiten auftreten. Dies gilt vor allem,<br />
ren Fehlstellen eindeutig lagemäßig bestimmt werden. Als Resultat<br />
wurden etwa 70 % der Leitung freigelegt. Dabei zeigte<br />
sich, dass die Stromaufnahme der Leitung kontinuierlich sank,<br />
je weiter die Leitung freigelegt wurde. An dieser Stelle lag also<br />
keine einzelne Umhüllungsfehlstelle vor, sondern die Qualität<br />
der Baustellenumhüllung war insgesamt unzureichend.<br />
Als Konsequenz wurde der entsprechende Bereich vollständig<br />
nachisoliert. Die abschließende Schutzstromaufnahme lag<br />
bei 0,13 µA, was einem spezifischen Umhüllungswiderstand<br />
von mehr als r CO<br />
= 10 9 Ωm² entspricht.<br />
Die genannten Beispiele zeigen, dass eine frühzeitige Einbindung<br />
Bild 5: des Rammschaden KKS in den Bau einer Rohrleitung und die messtechnische<br />
Kontrolle der Umhüllungsqualität sinnvoll ist. Auch<br />
bei einer nicht optimalen Qualität der Verlegung kann mit geringen<br />
Kosten während der Bauphase die Fehlstellenfreiheit<br />
hergestellt wenn zusätzliche werden. Besonderheiten wie die hier beschriebene<br />
Verlegetiefe vorliegen. Zur Vermeidung zusätzlicher Kosten<br />
sollte gerade in diesen Fällen eine konstante Begleitung der<br />
zuSAMMeNfASSuNG<br />
Baumaßnahme durch die KKS-Messtechnik erfolgen. Wäre<br />
Zusammenfassend im beschriebenen kann Projekt gesagt die werden, Baugrube dass um das das aktuell zunächst gültige<br />
eingemessene Regelwerk die Zentrum fehlstellenfreie der Äquipotentiallinien Verlegung einer Rohrleitung<br />
worden, eindeutig so wäre empfiehlt, die Umhüllungsfehlstelle da dies in vielen Fällen zu verfehlt einem Si-<br />
und<br />
errichtet<br />
cherheitsgewinn eine zweite Baugrube für den Betrieb erforderlich Rohrleitung geworden. führt. Durch Die die<br />
Verfasser vorgenommene halten es Abstimmung deshalb für sinnvoll, der Maßnahmen grundsätzlich konnte eine im<br />
fehlstellenfreie Laufe der Zeit Rohrleitungsverlegung die Fehlstelle genauer zu lokalisiert fordern und die am<br />
Baumaßnahmen Ende beseitigt durch werden. Auf KKS diese messtechnisch Weise wurden zu begleiten. mögliche<br />
In Folgeschäden vielen Fällen können vermieden, auf diese einen Weise noch Umhüllungsfehlstellen<br />
erheblich höheren<br />
noch Aufwand während hätten der Bauphase erfordern kostengünstig können. beseitigt werden.<br />
Wenn dies nicht möglich ist, empfehlen die Verfasser in einer<br />
Einzelfallbetrachtung Literatur zu prüfen, inwieweit die im Regelwerk<br />
genannten [1] DVGW Gründe GW 12 Arbeitsblatt, für das Anstreben Ausgabe einer Oktober fehlstellenfreien<br />
2012<br />
Umhüllung [2] DVGW auf GW die 28 betreffende Arbeitsblatt, Ausgabe Leitung Februar zutreffen 2014und davon<br />
ausgehend [3] DVGW eine GW 20 Entscheidung Arbeitsblatt, zu Ausgabe treffen. Februar 2014<br />
[4] Jörg Maurmann, Oliver Hohage, <strong>3R</strong> 09/2012, S. 698ff<br />
autoren<br />
JÖRG JörG MAURMANN MAurMANN<br />
Maurmann GmbH, Sprockhövel<br />
Maurmann GmbH, Sprockhövel<br />
Tel.: +49 2324 900003<br />
Tel.: E-Mail: +49 j.maurmann@maurmann.com<br />
(0)2324 90 00 03<br />
E-Mail: www.maurmann.com<br />
info@maurmann.com<br />
Dr. OLIVER HOHAGE<br />
Maurmann GmbH, Sprockhövel<br />
Tel.: +49 (0)2324 90 00 03<br />
E-Mail: o.hohage@maurmann.com<br />
AUTOREN<br />
06 | 2014 69<br />
Bild 8: Umhü<br />
Bild 9: Nachu<br />
Besuchen Sie uns im Interne<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Untersuchungen von Flüssigböden hinsichtlich<br />
ihres Einflusses auf den KKS<br />
von Stahlrohrleitungen<br />
Die zentrale Perspektive dieser Versuchsreihe richtete sich darauf, empirisch zu überprüfen, wie sich unterschiedliche<br />
flüssige Verfüllstoffe auf kathodisch geschützte Stahlrohrleitungen sowohl unter Laborbedingungen als auch unter den<br />
Bedingungen der Freibewitterung auswirken. Die Zielsetzung und die Vorgehensweise sind also darauf ausgerichtet,<br />
die Eigenschaften bestimmter Verfüllstoffe zu untersuchen, und anhand dieser die Tauglichkeit für den Einsatz an<br />
kathodisch geschützten Stahlrohrleitungen zu überprüfen. Dazu wurden anhand von ER-Coupons der Firma MetriCorr<br />
ApS die Flüssigböden TerraFlow und füma ® boden sowie Bentonit, das zumeist Anwendung als Bohrlochspülung (bei<br />
HDD Bohrungen) findet, unter identischen Bedingungen untersucht. Die Messwerte, die im Rahmen der Versuchsreihe<br />
untersucht wurden, waren der pH-Wert und der spezifische Widerstand der Verfüllstoffe, das Ruhepotential, der<br />
Ausbreitungswiderstand der Fehlstellen, die Ein- und Ausschaltpotentiale sowie der erforderliche Schutzstrom bzw. die<br />
erforderliche Schutzstromdichte für einen wirksamen kathodischen Schutz.<br />
Versuchsaufbau<br />
Der Versuchsaufbau unter Laborbedingungen wurde<br />
gemäß Bild 1 realisiert. Der Versuchsaufbau unter den<br />
Bedingungen der Freibewitterung ist Bild 2 und Bild 3 zu<br />
entnehmen.<br />
Ergebnisse<br />
Voruntersuchungen<br />
Vor dem Aushärten der Verfüllstoffe wurden der pH-Wert<br />
und der spezifische Widerstand ermittelt. Die Messergebnisse<br />
ergaben, dass<br />
»»<br />
Bentonit einen pH-Wert von 9,<br />
»»<br />
füma ® boden einen pH-Wert von etwa 12 und<br />
»»<br />
TerraFlow einen pH-Wert von ca. 13 aufzeigte.<br />
Die Messungen zeigten, dass die pH-Werte mit jenen Werten<br />
übereinstimmen, die von den Herstellern angegeben<br />
wurden. Die Flüssigböden TerraFlow und füma ® boden sind<br />
als sehr alkalisch zu interpretieren. In diesen Medien ist die<br />
Ausbildung einer (spontanen) Passivschicht möglich. Bentonit<br />
weist einen geringeren pH-Wert auf, der ebenfalls im<br />
alkalischen Bereich liegt. Damit wäre auch hier die Ausbildung<br />
einer Passivschicht möglich. Aus Sicht des <strong>Korrosionsschutz</strong>es<br />
sind die ermittelten pH-Werte positiv zu bewerten.<br />
Im flüssigen Zustand wurde für TerraFlow ein spezifischer<br />
Widerstand von ρ = 658 Ωcm ermittelt. Für füma ® boden<br />
wurde ein spezifischer Widerstand von ρ = 1064 Ωcm<br />
gemessen. Letztlich war bei Bentonit ein spezifischer Bodenwiderstand<br />
von ρ = 977 Ωcm zu konstatieren.<br />
Bild 1: Versuchsaufbau eines ER-Coupons unter<br />
Laborbedingungen mit einer CSE-Elektrode<br />
Bild 2: Versuchsaufbau eines ER-Coupons unter Freibewitterung<br />
70 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Bedingungen<br />
Labor<br />
Freibewitterung<br />
Medium<br />
Ruhepotential U CSE,R<br />
[mV]<br />
TerraFlow -240<br />
füma ® boden -450<br />
Bentonit -790<br />
TerraFlow -540<br />
füma ® boden -200<br />
Bentonit -810<br />
Tabelle 1: Ruhepotentiale der ER-Coupons<br />
Darüber hinaus wurde vor der Inbetriebnahme der kathodischen<br />
Schutzanlagen das Ruhepotential der ER-Coupons<br />
registriert. Tabelle 1 fasst die Ruhepotentiale der einzelnen<br />
ER-Coupons zusammen.<br />
Versuchsauswertung und Bewertung der<br />
Messergebnisse<br />
Im Folgenden werden die Messergebnisse der insgesamt<br />
zwölfwöchigen Messreihe unter Laborbedingungen und<br />
unter den Bedingungen der Freibewitterung dargestellt.<br />
Darüber hinaus werden einige Erklärungen zu den ermittelten<br />
Messwerten unter besonderer Berücksichtigung des<br />
kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong>es formuliert.<br />
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde das Einschaltpotential<br />
sukzessiv von -1,2 V bis -2,0 V in 100 mV Schritten<br />
herabgesetzt. Dabei wurden die relevanten Größen<br />
für jede Potentialstufe erfasst.<br />
Bild 4 zeigt den Verlauf des Ausbreitungswiderstandes<br />
abhängig vom Einschaltpotential. Aus dem Bild geht<br />
hervor, dass die Widerstandsverläufe aller Proben näherungsweise<br />
einer parabelförmigen Gesetzmäßigkeit folgen.<br />
Des Weiteren ist vor allem bei der Bentonit-Probe<br />
ab einem Einschaltpotential von -1,8 V eine Art Stagnation<br />
festzustellen. Der im Vorfeld erwartete Widerstandsrückgang<br />
wurde durch alle Laborproben bestätigt.<br />
Unterschiede lassen sich in dem Widerstandsniveau auf-<br />
Bild 3: Prinzipieller Versuchsaufbau unter Freibewitterung<br />
Bild 4: Ausbreitungswiderstandsverläufe der ER-Coupons unter<br />
Laborbedingungen<br />
Bild 5: Ausbreitungswiderstandsverläufe der ER-Coupons unter Freibewitterung<br />
06 | 2014 71
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
grund der spezifischen Zusammensetzungen der jeweiligen<br />
Medien feststellen. Dabei liegt das Widerstandsniveau der<br />
füma ® boden-Laborprobe deutlich über dem der beiden<br />
anderen Proben. Ferner ist zu erkennen, dass mit einem<br />
negativeren Einschaltpotential eine Annäherung der Kurven<br />
zu konstatieren ist.<br />
Bild 5 stellt die Widerstandsverläufe der Proben unter den<br />
Bedingungen der Freibewitterung vergleichend gegenüber.<br />
Aus der Graphik geht hervor, dass die beiden Flüssigböden<br />
TerraFlow und füma ® boden einen eindeutigen Trend des<br />
Widerstandsanstiegs aufweisen. Jedoch sind die Ursachen<br />
gemäß der bisherigen Erläuterungen unterschiedlicher<br />
Natur. Ein potentieller Grund für einen derartigen Widerstandsanstieg<br />
mit zunehmendem Einschaltpotential könnte<br />
demnach eine Deckschichtbildung sein. Offenbar wandern<br />
deckschichtbildende Stoffe aus dem gewachsenen Boden<br />
durch das Verfüllmaterial zur Fehlstelle hin und lagern sich<br />
dort ab. Des Weiteren sind bei der TerraFlow-Probe starke<br />
Schwankungen des Ausbreitungswiderstandes zu konstatieren.<br />
Ein möglicher Grund für ein derartiges Verhalten<br />
könnte demnach eine Art Wasserstoffpolster zwischen der<br />
Fehlstelle und dem umgebenden Medium sein. Lediglich das<br />
Bentonit bestätigt in seiner Gestalt den parabelförmigen<br />
abfallenden Widerstandstrend, der zuvor bei allen anderen<br />
Laborproben festzustellen war.<br />
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Verläufe<br />
der Schutzstromdichten aller Laborproben tendenziell den<br />
Gesetzmäßigkeiten einer quadratischen Funktion folgen<br />
(siehe Bild 6). Differenzen sind lediglich in der Steigung<br />
festzustellen, die durch den Ausbreitungswiderstand des<br />
jeweiligen Mediums bedingt sind. Im Hinblick auf die Wechselstromkorrosion<br />
kann die Aussage getroffen werden, dass<br />
alle Proben unter Laborbedingungen für Einschaltpotentiale<br />
≥ -1,2 V die kritische Schutzstromdichte von 1 A/m 2 nicht<br />
überschreiten.<br />
Aus Bild 7 lässt sich ablesen, dass die Schutzstromdichte<br />
des Bentonits unter Freibewitterung prinzipiell den gleichen<br />
Gesetzmäßigkeiten folgt, wie unter Laborbedingungen.<br />
Jedoch ist hier festzuhalten, dass die Schutzstromdichte<br />
unter Laborbedingungen ca. 100 % über der Schutzstromdichte<br />
unter der Freibewitterung liegt. Die Kurvenverläufe<br />
der beiden Flüssigböden füma ® boden und TerraFlow<br />
liegen signifikant unter jener der Bentonit-Probe. Dieser<br />
Umstand war im Vorfeld bereits zu antizipieren, da die<br />
Ausbreitungswiderstände der Flüssigböden signifikant<br />
stiegen. Die Schutzstromdichte der füma ® boden-Probe<br />
zeigt ein lineares Verhalten auf. Die TerraFlow-Probe zeigt<br />
für Einschaltpotentiale zwischen -1,2 V und -1,5 V einen<br />
ansteigenden Schutzstromdichtenverlauf auf. Für Einschaltpotentiale<br />
< -1,5 V stagniert die Schutzstromdichte bei etwa<br />
1 A/m 2 ±0,5 A/m 2 . Die Schwankungen der Schutzstromdichte<br />
sind bedingt durch die festgestellten Schwankungen<br />
des Ausbreitungswiderstandes der Probe.<br />
Schlussbetrachtung und Fazit<br />
Die Untersuchungen hatten zum Ziel, die Einflüsse ausgewählter<br />
Verfüllstoffe auf den kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
von Stahlrohrleitungen empirisch zu untersuchen<br />
und theoretisch zu reflektieren. Als der maßgebliche<br />
Ertrag der Untersuchungen und Reflexionen ist abschließend<br />
zu sagen, dass Stahlrohrleitungen bzw. Stahl in<br />
den Medien, die im Rahmen dieses Projektes untersucht<br />
wurden, polarisiert werden können.<br />
So ist grundsätzlich festzuhalten, dass alle ER-Coupons<br />
sowohl unter Laborbedingungen als auch unter den<br />
Bedingungen der Freibewitterung kathodisch geschützt<br />
werden können. Korrosionsreaktionen konnten nicht<br />
festgestellt werden. Dieses galt auch für TerraFlow und<br />
füma ® boden für einen kurzen Zeitraum ohne den kathodischen<br />
Schutz.<br />
Zu den wissenschaftlich relevanten Erträgen gehört in jedem<br />
Fall die Feststellung, dass die Ergebnisse der Laboruntersuchungen<br />
und jene Resultate der Untersuchungen unter den<br />
Bedingungen der Freibewitterung voneinander abweichen.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kathodische<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> aller Messproben durch die Freilegung<br />
der ER-Coupons bestätigt wurde. Die gegensätzlichen<br />
Verläufe der Ausbreitungswiderstände der TerraFlow-<br />
Bild 6: Gegenüberstellung der Schutzstromdichten der Laborproben<br />
Bild 7: Gegenüberstellung der Schutzstromdichten unter Freibewitterung<br />
72 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Laborprobe und der TerraFlow-Probe unter den Bedingungen<br />
der Freibewitterung und die dazu getroffenen<br />
Annahmen, lassen sich nach der Freilegung der ER-Coupons<br />
annähernd zweifelsfrei klären. Bei der TerraFlow-<br />
Probe unter den Bedingungen der Freibewitterung lagen<br />
die ermittelten Widerstandswerte nach dem Abschalten<br />
der Schutzanlage weit unter jenen als die kathodische<br />
Schutzanlage noch in Betrieb war. Der Ausbreitungswiderstandsverlauf<br />
der Probe zeigte nach dem Abschalten<br />
der Schutzanlage eindeutig konstante Werte auf, so dass<br />
demzufolge die Annahme eines Wasserstoffpolsters zwischen<br />
der Stahloberfläche und dem umgebenden Milieu<br />
als erhärtet gelten kann. Ferner konnte nach Freilegung<br />
des ER-Coupons auf der Stahloberfläche keine Deckschichtbildung<br />
diagnostiziert werden. Dadurch kann bei<br />
der TerraFlow-Probe die Deckschichtbildung als Ursache<br />
für den Anstieg des Ausbreitungswiderstandes ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Bei der füma ® boden-Probe unter den Bedingungen der<br />
Freibewitterung kann hingegen die Annahme bezüglich<br />
der Deckschichtbildung bestätigt werden, da auch nach<br />
Abschaltung der kathodischen Schutzanlage der Ausbreitungswiderstand<br />
auf dem hohen Widerstandsniveau<br />
verharrte. Darüber hinaus konnte nach Freilegung des<br />
ER-Coupons eine weiße Schicht auf der Stahloberfläche<br />
registriert werden, die wahrscheinlich die Ursache für den<br />
Widerstandsanstieg ist. Aufgrund dieser Untersuchungen<br />
kann hier die Annahme einer Deckschichtbildung als<br />
erhärtet gelten.<br />
Es ist grundlegend festzuhalten, dass bei den ER-Coupons<br />
unter den Bedingungen der Freibewitterung das umgebende<br />
Erdreich einen maßgeblichen Einfluss aufweist.<br />
Vergleicht man die Messergebnisse des Feldversuches mit<br />
jenen des Laborversuches, so ist festzustellen, dass diese<br />
in einem deutlichen Gegensatz zueinander stehen. Vor<br />
allem bei den Flüssigböden TerraFlow und füma ® boden<br />
wird der Gegensatz unverkennbar.<br />
Es ist davon auszugehen, dass sich mit Fortdauer der<br />
Untersuchungen eine Angleichung der Flüssigböden an<br />
das umgebende Erdreich aufgrund von Diffusion von<br />
Bodeninhaltsstoffen in das Bettungsmaterial vollzieht.<br />
Die Bentonit-Proben standen hingegen nicht in einem<br />
derartigen Kontrast zueinander, so dass hier ein vergleichsweiser<br />
geringer Einfluss des umgebenden Erdreichs<br />
zu vermuten ist.<br />
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass Stahl in Bentonit<br />
ein relativ negatives Ruhepotential aufweist. Im<br />
Kontext mit Stahlrohrleitungen in Bentonit und in normalen<br />
(gewachsenen) Böden besteht hier die Gefahr,<br />
dass sich ein galvanisches Element zwischen dem Teil<br />
der Rohrleitung im Bentonit und dem Teil im Erdboden<br />
ausbildet. Dabei würde sich die anodische Teilreaktion<br />
an den Fehlstellen der Rohraußenumhüllung im Bentonit<br />
vollziehen. Diese Erkenntnis gilt es bei der Verwendung<br />
von Bentonit zu berücksichtigen.<br />
Weiterhin ist festzustellen, dass bei Einschaltpotentialen<br />
≥ -1,2 V keine Gefährdung durch Wechselstromkorrosion<br />
zu erwarten ist, da die ermittelten Schutzstromdichten<br />
aller Proben sowohl unter Laborbedingungen als auch<br />
unter den Bedingungen der Freibewitterung unter der<br />
kritischen Schutzstromdichte von 1 A/m 2 liegen.<br />
Ausblick<br />
Mit Blick auf weitere Forschungsaktivitäten lässt sich ein<br />
weitreichender Bedarf an empirischer Forschung und theoretischer<br />
Reflexion begründen: Durch eine Reihe weiterer<br />
Proben kann festgestellt werden, ob die Verfüllstoffe eine<br />
ausgeprägte Neigung haben, sich so zu verhalten, wie dies<br />
die hier vorliegende Untersuchung gezeigt hat, und ob<br />
die ermittelten Ergebnisse generalisierbar sind.<br />
Des Weiteren wären Proben unter den Bedingungen der<br />
Freibewitterung ohne den kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
unter identischen oder teilidentischen Bedingungen zu<br />
untersuchen, um zu überprüfen, wie intensiv die Ladungsträgeranreicherung<br />
bzw. der Stofftransport faktisch den<br />
Widerstandswert bedingt hat, und um darüber hinaus<br />
einen konkreten Referenzwert zu generieren. Hinsichtlich<br />
der praktischen Anwendung ist in diesem Kontext an<br />
die aktuelle Diskussion um den Netzausbau zu erinnern.<br />
Hier rückt die Thematik der Wechselstromkorrosion verstärkt<br />
in den Fokus der Forschung und der angewandten<br />
Forschung von <strong>Korrosionsschutz</strong>technologien. Daher ist<br />
abschließend zu betonen, dass auch in Zukunft weiterführende<br />
Untersuchungen der Verfüllstoffe im Kontext<br />
mit dem kathodischen <strong>Korrosionsschutz</strong> durchzuführen<br />
sind, und um den Einfluss der Wechselstromkorrosion zu<br />
erweitern sind.<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. THOMAS LAIER<br />
Westnetz GmbH, Dortmund, Spezialservice<br />
Gas, Pipeline Integrity Management<br />
Tel. +49 231 438-6247<br />
E-Mail: thomas.laier@westnetz.de<br />
Dipl.-Ing. ULRICH BETTE<br />
TAW Technische Akademie Wuppertal e.V.,<br />
Wuppertal, Labor für <strong>Korrosionsschutz</strong> und<br />
Elektrotechnik<br />
Tel. +49 202-7495-637<br />
E-Mail: ulrich.bette@taw.de<br />
B.Eng. MOHAMED HOUBAN<br />
Westnetz GmbH, Dortmund, Spezialservice<br />
Gas, Pipeline Integrity Management<br />
Tel. +49 231 438 6412<br />
E-Mail: mohamed.houban@westnetz.de<br />
06 | 2014 73
PROJEKT KURZ BELEUCHTET KORROSIONSSCHUTZ<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong>maßnahmen an einem<br />
Düker unter dem Hafen in Emden<br />
Dass Korrosion als Thema ein ständiger und langjähriger Begleiter der Rohrleitungsbranche ist, zeigt sich einmal<br />
mehr, als es um die Überprüfung der <strong>Korrosionsschutz</strong>maßnahmen zweier Gashochdruckleitungen und eines<br />
Fernmeldekabels ging, die seit über 30 Jahren in einem 900 m langen Düker unter dem Hafen Emden liegen.<br />
Bei der Erneuerung des <strong>Korrosionsschutz</strong>es und einer detailierten Zustandserfassung nutzten die Fachleute auch<br />
die Möglichkeit, neue und effiziente Messtechnik zu installieren, so dass in Zukunft eine lückenlose und sichere<br />
Überwachung der Rohre, z. B. bei der Potentialüberwachung, möglich ist.<br />
Ausgangslage<br />
Vor über dreißig Jahren wurde unter dem Hafen in Emden<br />
ein Düker gebaut, der zwei 24-Zoll-Erdgasleitungen<br />
und ein Fernmeldekabel aufnehmen sollte. Mit diesem<br />
Bauwerk sollte die weiträumige Umgehung des Hafens<br />
eingespart werden. Es war geplant, die Stahl-Betonrohre,<br />
die auch eine Begehung des Dükers ermöglichen würden,<br />
unter dem Hafen durchzupressen.<br />
Die Stahl-Betonrohre des 1979 in Betrieb genommenen<br />
Dükers mit einem Durchmesser von rund 2,5 m wurden<br />
damals unter dem Hafen durchgepresst, da sich dieses<br />
Verfahren schon bei vielen Projekten als preiswerte<br />
und sichere Lösung bewährt hatte. Nach ca. 300 m versperrte<br />
ein großer Findling die geplante Trasse. Damit<br />
wurde ein Weiterpressen unmöglich. Zudem bestand die<br />
Gefahr,dass die bereits verpressten Rohre seitlich abknicken<br />
und dadurch undicht werden. Die Verantwortlichen<br />
entschlossen sich, eine Druckschleuse einzubauen und<br />
die restliche Strecke im Schildvortrieb fertig zustellen. Der<br />
Schacht wurde mit Linerplats (Stahlsegmente) ausgekleidet.<br />
Die Segmente wurden mit Dichtungen einzeln verschraubt,<br />
um das Eindringen von Wasser zu minimieren.<br />
Konzepte für erfolgreichen <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Nach Fertigstellung der gesamten Strecke wurde der<br />
untere Teil des Dükers mit Beton ausgegossen. Auf dem<br />
Beton wurden die Stützen für die Rohrleitungen befestigt.<br />
Die Stützen dienten gleichzeitig als Auftriebssicherung,<br />
denn der Düker sollte nach Fertigstellung mit Süßwasser<br />
geflutet werden. Am tiefsten Punkt des Dükers wurden<br />
Pumpen installiert, um das Wasser im Düker umzuwälzen<br />
und den Düker für Inspektionen entleeren zu können.<br />
Als <strong>Korrosionsschutz</strong> sollte der pH-Wert auf einen Wert<br />
von >10 angehoben werden. Bei diesem pH-Wert ist<br />
nicht mehr mit Korrosion zu rechnen. Nach ca. einem Jahr<br />
Bild 1: Al-Anode angeschlossen an die Linerplates<br />
Bild 2: Referenzelektroden für die Überwachung des KKS<br />
74 06 | 2014
KORROSIONSSCHUTZ PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Zudosierung, wurde der erforderliche pH-Wert aber nicht<br />
mehr erreicht. Es stellte sich heraus, dass die Linerplats<br />
nicht vollständig dicht waren. Der Wasserspiegel im Düker<br />
schwankte mit der Tide. Das gesamte Bauwerk wurde<br />
daraufhin leer gepumpt und von innen untersucht.<br />
Nach Abwägung aller technischen Möglichkeiten wurde<br />
dann entschieden, den Düker, der bereits von außen mit<br />
zwei Fremdstromanlagen kathodisch geschützt wurde,<br />
auch von innen kathodisch zu schützen, was allerdings<br />
nicht möglich war, da durch den Chloridgehalt im Wasser<br />
mit der Entstehung von Chlorgas gerechnet werden<br />
musste. Zusätzlich bestand die Gefahr, dass sich an dem<br />
Stahl der Linerplats, Chlorhyperoxyd bildet, was zu extremer<br />
Korrosion führt. Chlorhyperoxyd entsteht durch<br />
den erhöhten pH-Wert (>10) an der Kathode (Linerplats),<br />
verursacht durch den KKS und das an den Fremdstromanoden<br />
entstehende Chlor.<br />
Eingebaut wurde letztendlich ein KKS-System mit galvanischen<br />
Anoden (Al-Anoden) für eine Betriebszeit > 20<br />
Jahre. Mit einer Chlorgasentwicklung muss bei dieser<br />
Schutzart nicht gerechnet werden, da die Treibspannung<br />
von Al-Anoden unter der kritischen Spannung für die<br />
Chlorbildung liegt. Für die Sicherstellung der Längsleitfähigkeit<br />
der Linerplats wurden die Stahlsegmente auf<br />
allen vier Seiten mit ca. 3 cm langen Schweißnähten<br />
verbunden. Die Stahlarmierung der Betonrohre auf den<br />
ersten 300 m wurde an jeder Stoßstelle elektrisch verbunden,<br />
um die Interferenzströme von dem KKS der<br />
Außenseite gezielt abzuleiten. Zusätzlich wurden Coupons<br />
mit kleinen Spalten eingebaut, um zu überprüfen,<br />
in wieweit es an den Verschraubungen der Stahlsegmente<br />
zu Spaltkorrrosion kommen kann.<br />
INGENIEURBAU FÜR VERFAHRENSTECHNIK<br />
Mitglied im NACE, DVGW, VDI<br />
ISO-Flansche für den KKS<br />
● bis PN 500 für Flansche API 10000<br />
● auch Einzelteile für die Nachrüstung<br />
● Bolzenisolierung 2 mm, Glasflies und Kunstharz<br />
gewickelt<br />
● Spezialkonstruktionen für alle Dichtflächen<br />
● Fachbetrieb nach § 19 l WHG<br />
● Zertifiziert nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG<br />
Ingenieurbau für Itagstraße 20 Telefon: 0 51 41/2 11 25<br />
Verfahrenstechnik 29221 Celle Telefax: 0 51 41/2 88 75<br />
e-mail: info@suckut-vdi.de<br />
www.suckut-vdi.de<br />
Aussteller auf dem 8.Praxistag <strong>Korrosionsschutz</strong> am 02.07.14 in Gelsenkirchen<br />
Erneuerung des <strong>Korrosionsschutz</strong>es nach 30 Jahren<br />
Nach einer Betriebszeit von über 30 Jahren wurde der<br />
Düker komplett entleert und die restlichen Anoden und<br />
alle Bezugssonden für die Überwachung entsorgt. Die<br />
Linerplats waren in einem guten Zustand.<br />
Der Düker wurde dann komplett mit neuen Al-Anoden<br />
ausgerüstet. Die Potentialüberwachung wurde ebenfalls<br />
erneuert und nach einem neuen System ausgerichtet.<br />
Das Schutzpotential der zwei Gasleitungen und der Dükerinnenseite<br />
kann nun auf der gesamten Länge lückenlos<br />
gemessen werden. Zusätzlich wurden am Anfang und<br />
Ende auf beiden Rohrleitungen Strommessstellen installiert,<br />
um eventuelle Beeinflussungen durch den Außenschutz<br />
des Dükers und die im Bereich des Hafens liegende<br />
Fremdleitungen erfassen zu können.<br />
AUTOR<br />
WALDEMAR KORUPP<br />
KORUPP GmbH, Twist<br />
Tel.: +49 (0) 5936 - 92 33 1-0<br />
E-Mail: info@korupp-kks.de<br />
www.korupp-kks.de<br />
06 | 2014 75
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG<br />
Abwasserwärmenutzung:<br />
Stand in Europa und in Deutschland<br />
Mit Hilfe einer Internet- und Literaturrecherche sowie einer Befragung in Deutschland wurden Projekte in Europa und in<br />
Deutschland recherchiert. Insbesondere haben sich Anlagen in den skandinavischen Ländern und der Schweiz seit vielen<br />
Jahren etabliert. Auch in Deutschland hat die Anzahl der Projekte und Anlagen deutlich zugenommen.<br />
Tabelle 1 beinhaltet die europäischen Projekte, aufgeteilt<br />
in die jeweiligen Länder, die Projektanzahl und die Herkunft<br />
der Wärmeenergie. Im skandinavischen Raum liegt dabei<br />
die Besonderheit darin, dass tlw. die Wärme entweder in<br />
Kombination mit Abwasser oder vereinzelt vollständig dem<br />
Meerwasser entzogen wird. Ebenso sind hier Großanlagen<br />
installiert, die ganze Bezirke versorgen. Die Großanlagen ab<br />
10 MW bzw. ab 100 MW Wärmepumpenleistung werden<br />
ergänzend aufgeführt. Die Schweiz betreibt die Abwasserwärmenutzung<br />
bereits seit über 20 Jahren. Hier liegen<br />
entsprechende Erfahrungen bei den Beteiligten vor.<br />
In Norwegen werden im Bereich von Oslo mehrere Anlagen<br />
betrieben. Zwei Anlagen beziehen die Wärme dabei<br />
alternativ aus dem Meereswasser. In Kopenhagen wurden<br />
im Jahr 2011 zwei Wärmetauscheranlagen der Fa. Uhrig<br />
Kanaltechnik GmbH installiert. Mit Hilfe der Wärmetauscher<br />
wird Wärmeenergie zum Beheizen von Betriebsgebäuden in<br />
Sjællensbroen und Ingerslevsgade gewonnen. In Schweden<br />
werden mehrere Anlagen betrieben. Eine Großanlage in<br />
Stockholm entzieht dabei ausschließlich dem Meerwasser<br />
die Energie. Die Heizwärme für die Stadt Helsinki wird teilweise<br />
über eine Heizanlage sichergestellt, die die größte der<br />
Welt darstellt und als Energiequelle gereinigtes Abwasser<br />
zusammen mit Meereswasser nutzt. Die Anlage ging im<br />
Herbst 2006 in Betrieb.<br />
Die recherchierten Projekte in Deutschland werden in<br />
Akteursbereiche unterteilt. Somit können die Initiatoren<br />
der Projekte und Anwendungsfälle unterschieden werden.<br />
Folgende Kategorien wurden definiert:<br />
»»<br />
öffentliche Wohnungsgesellschaften<br />
»»<br />
öffentliche/kirchliche Einrichtungen wie Schulen, Kinderhort,<br />
Rathaus, Feuerwache<br />
»»<br />
öffentliche Schwimmbäder<br />
»»<br />
privater Handel / private Wohnbauprojekte<br />
In Bild 1 ist die Auswertung zu den jeweiligen Kategorien<br />
in einer Karte zusammengefasst.<br />
Zusätzlich wurden bisher etliche Studien und Planungen auf<br />
den Weg gebracht. In Bild 2 sind die Standorte markiert<br />
und den verschiedenen Bereichen zugeordnet.<br />
Werden die realisierten Projekte statistisch ausgewertet<br />
ergibt sich folgende Häufigkeitsverteilung in Bezug auf die<br />
Akteuersbereiche:<br />
Anzahl realisierter Projekte<br />
Häufigkeit<br />
öffentl. Wohnungsgesellschaft 13,33%<br />
öffentl./kirchliche Einrichtungen 70,00%<br />
öffentl. Schwimmbäder 6,67%<br />
privater Handel/Wohnen 10,00%<br />
Summe 100,00%<br />
Tabelle 2: Anzahl und Typen realisierter Projekte in<br />
Deutschland<br />
Schweiz Österreich Frankreich Finnland Schweden Norwegen Dänemark<br />
realisierte Projekte >80 3 7 1 6 3 2<br />
Herkunft Wärmeenergie:<br />
aus Kanal x x x x 1 x<br />
aus Kläranlage x x x x<br />
Meerwasser und Abwasser 1 2<br />
nur Meerwasser 1 2<br />
gewerbliches Abwasser x x<br />
Grundlagen<br />
Wärmepumpe:<br />
> 10 MW 1 1<br />
> 100 MW 2<br />
Tabelle 1: Anzahl und Typen recherchierter, realisierter Projekte in Europa (ohne Deutschland)<br />
Die bisherige Projektrealisierung geht<br />
demnach überwiegend von öffentlichen<br />
Einrichtungen aus. Dies kann<br />
damit begründet werden, dass ein<br />
kommunaler Verbund der verantwortlichen<br />
Akteure zum einen bei<br />
den kommunalen Beteiligungen an<br />
den Entwässerungsbetrieben und<br />
zum anderen bei den städtischen<br />
Liegenschaften zum Projekteinstieg<br />
und zur Projektumsetzung beitragen.<br />
Ebenso ist von einer einfacheren Vertragsgestaltung<br />
bzw. Vertragsanwendung<br />
der Beteiligten zwischen den<br />
kommunalen Einrichtungen und<br />
Beteiligungen auszugehen. Dass die<br />
initiierenden Akteure hauptsächlich<br />
76 06 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG FACHBERICHT<br />
Bild 1: Realisierte Projekte mit Abwasserwärmenutzung in<br />
Deutschland<br />
Bild 2: Studien/Planungen mit Abwasserwärmenutzung in<br />
Deustchland<br />
im kommunalen Bereich zu finden sind, kann auch mit<br />
der grundsätzlichen Zuständigkeit hinsichtlich Abwassertechnik<br />
begründet werden. Die kaufmännische Entscheidung<br />
der Verantwortlichen auf der Verwaltungsebene<br />
wird weiterhin durch die Bearbeitung von Anträgen und<br />
Personalressourcen zu Fördermitteln unterstützt. Bei privaten<br />
Initiatoren bzw. Bauherren muss daher noch mehr<br />
Aufklärungsarbeit für die technische und wirtschaftliche<br />
Möglichkeit zur Energierückgewinnung aus Abwasser<br />
und zu Fördermitteln geleistet werden. Hier können die<br />
Kommunen einen entsprechenden Beitrag leisten. Bild 3<br />
ist zu entnehmen, dass die überwiegende Mehrheit der<br />
bisher installierten Anlagen eine Jahreswärmeenergie bis<br />
600.000 kWh/a erzeugt.<br />
Der Deckungsanteil aus Abwasserwärme bei konkret umgesetzten<br />
Projekten mit Wärmetauschern im Kanalbereich<br />
oder auf der Kläranlage ist gemessen am erforderlichen<br />
Wärmebedarf sehr hoch. Bild 4 zeigt, dass die Anlagen<br />
überwiegend einen Deckungsanteil von 60 % bis 80 %<br />
erzeugen. Im Bereich der Kläranlagen steht entsprechend<br />
viel Abwasser zur Verfügung, so dass hier der Deckungsanteil<br />
bis zu 100 % beträgt.<br />
Häufigkeit <br />
14 <br />
Histogramm für jährliche Wärmeenergie in 1000kWh/a <br />
Häufigkeit <br />
12 <br />
Histogramm für Deckungsanteil <br />
12 <br />
10 <br />
8 <br />
6 <br />
10 <br />
8 <br />
6 <br />
4 <br />
2 <br />
1000kWh/a <br />
4 <br />
2 <br />
0 <br />
0 <br />
150 450 750 1050 1350 1750 2050 2250 2600 <br />
10 30 50 70 90 <br />
% <br />
Bild 3: Histogramm zur jährlichen Wärmeenergie in 1000 kWh/a Bild 4: Histogramm zum Deckungsanteil in %<br />
06 | 2014 77
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG<br />
Theoretisches Potenzial<br />
aus der Befragung und<br />
in Deutschland in GWh/a<br />
bisher genutztes Potenzial<br />
aus Befragung und in<br />
Deutschland in GWh/a<br />
Anteil bisher genutztes<br />
Potenzial in %<br />
Jahresabwassermenge aus<br />
Befragung in m 3 /a<br />
Jahresabwassermenge in<br />
Deutschland in m 3 /a<br />
Anteil erreichte Jahresabwassermenge<br />
durch Befragung in %<br />
2.000.000.000 6.208 11 0,18%<br />
9.400.000.000 29.175 22 0,08%<br />
21,3%<br />
Tabelle 3: Bisher genutztes Wärmepotenzial aus öffentlichem Abwasser<br />
Mit Hilfe der Befragung wurde ergänzend das bisher realisierte<br />
Potenzial abgeschätzt. Bei der Befragung wurden<br />
im Wesentlichen große Abwassernetzbetreiber ausgewählt.<br />
Diese Betreiber verfügen über entsprechende Abwassermengen,<br />
so dass hier einerseits Anlagen zur Abwasserwärmenutzung<br />
zu vermuten waren und andererseits ein<br />
Vergleich zum theoretischen Potenzial und zum bisher realisierten<br />
Potenzial durchgeführt werden konnte. Die Betreiber<br />
waren in Köln, Bremen, Braunschweig, Hannover, Hamburg,<br />
Berlin, Dresden, München, Karlsruhe, Frankfurt, Speyer,<br />
Saarbrücken und Mainz ansässig. Zusätzlich erstreckte sich<br />
die Befragung auf Emschergenossenschaft / Lippeverband,<br />
Ruhrverband, Koblenz, Bad Kreuznach, Straubing, Fürth,<br />
Bingen, Verbandsgemeinde Simmern und Rengsdorf. Generell<br />
fallen in Deutschland im kommunalen bzw. öffentlichen<br />
Bereich im Jahr ca. 9.400 Mio. m 3 Abwasser an. Das theoretische<br />
Wärmepotenzial hieraus liegt bei ca. 30 TWh/a.<br />
Die Befragung hat im Einzugsgebiet der zuständigen<br />
öffentlichen Betreiber eine Jahresabwassermenge von rund<br />
2,0 Mrd. m 3 ergeben. Die bisher realisierte, summierte Wärmemenge<br />
aus der Abwasserwärmenutzung im Bereich<br />
der Befragten wurde mit rund 11 GWh/a ermittelt. Für alle<br />
recherchierten Projekte konnte eine Jahreswärmeenergie<br />
von rund 22 GWh/a festgestellt werden. Das theoretische<br />
Potenzial aus der ermittelten Abwassermenge auf Grund<br />
der durchgeführten Befragung im öffentlichen Bereich kann<br />
mit 4.656 GWh/a angegeben werden. Wird eine Jahresarbeitszahl<br />
von 4 bei Elektro-Abwasserwärmepumpen<br />
berücksichtigt, kann eine Nutzwärme aus dem Abwasser<br />
im Bereich der Befragten von 6.208 GWh/a gewonnen werden.<br />
Tabelle 3 stellt das theoretische und bisher realisierte<br />
Potenzial für Deutschland und für den Bereich der befragten<br />
Abwasserbetreiber/Akteure gegenüber.<br />
Das bisher genutzte Wärmepotenzial bei den Befragten<br />
fällt mit ca. 11 GWh/a noch sehr gering aus. Der Anteil<br />
am theoretischen Potenzial im Zuständigkeitsbereich der<br />
Befragten beträgt damit bisher nur ca. 0,2 %. Für Deutschland<br />
ist insgesamt festzustellen, dass bisher nur ca. 0,1 %<br />
des theoretischen Wärmepotenzials aus Abwasser genutzt<br />
wird. Dies zeigt, dass noch sehr viel Potenzial erschlossen<br />
werden kann bis das Erwartungspotenzial ausgeschöpft ist.<br />
Bezogen auf die öffentlichen Abwasseranlagenbetreiber<br />
gemäß Befragung, die rund 21 % der deutschen Jahresabwassermengen<br />
abdecken, konnte ein Anteil des bisher<br />
genutzten bundesweiten Potenzials von 50 % festgestellt<br />
werden. Mit der Befragung konnte demnach ein großer<br />
Teil der bisher verantwortlichen Akteure für den Bereich<br />
der Abwasserwärmenutzung erreicht werden.<br />
Zusammenfassung zum Stand der<br />
Abwasserwärmenutzung:<br />
Insgesamt wurden realisierte Projekte in sieben europäischen<br />
Ländern aufgezeigt. Zusätzlich wurde der aktuelle<br />
Stand in Deutschland aufbereitet und ergänzend geplante<br />
Maßnahmen aufgeführt. Bisher wurden rund 90 % der<br />
Projekte im öffentlichen Bereich realisiert. Der Schwerpunkt<br />
lag bei Anlagen bis 600.000 kWh/a und einem Wärmedeckungsanteil<br />
von 60 % bis 80 %. Für das Jahr 2011 konnte<br />
ein erreichtes Potenzial von lediglich ca. 0,1 %, bezogen auf<br />
das theoretische Potenzial, abgeschätzt werden. Bis zum<br />
Erreichen des wirtschaftlichen Erwartungspotenzials können<br />
daher noch sehr viele Projekte realisiert werden und zum<br />
nachhaltigen Bauen in Deutschland beitragen.<br />
Literatur<br />
Hamann Achim, Nachhaltige Immobilienwirtschaft am Beispiel der<br />
Abwasserwärmenutzung<br />
Technische Grundlagen, Sachstand in Deutschland und wirtschaftliche<br />
Vergleiche unter Berücksichtigung der Anforderungen des<br />
EEWärmeG´s und der EnEV, Oldenbourg Industrieverlag München,<br />
2012<br />
Dipl.-Ing. M.Sc. M.Sc ACHIM HAMANN,<br />
RS-Plan AG, Bad Kreuznach,<br />
Tel. +49 (0)671/483386-39<br />
AUTOR<br />
78 06 | 2014
Edition<br />
Regenwasserbewirtschaftung –<br />
Stormwater Management<br />
Tagungsband zum Symposium<br />
Die lange geübte Praxis, Regenwasser als Abwasser zu behandeln und der Kanalisation<br />
zuzuführen, steht aus ökologischer und ökonomischer Sicht in Frage. Für den Umwelt- und<br />
Gewässerschutz, aber auch zur Vorbeugung gegen Hochwasserkatastrophen ist stattdessen<br />
eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung unabdingbar. Über den Paradigmenwechsel<br />
im Umgang mit Niederschlägen, Stand der Forschung, Eingang der gewonnenen Erkenntnisse<br />
in die DIN-Normung und in das technische Regelwerk sowie über anschauliche Beispiele<br />
aus der Praxis referierten anerkannte Kapazitäten auf dem Gebiet der Siedlungswasserwirtschaft<br />
und der Stadt- und Landschaftsplanung anlässlich des Symposiums „Regenwasserbewirtschaftung<br />
– Stormwater Management“ während der Wasser Berlin International 2013.<br />
Hrsg.: DIN, gwf-Wasser |Abwasser, BWK<br />
1. Auflage 2013<br />
140 Seiten, vierfarbig, DIN A4, Broschur<br />
ISBN: 978-3-8356-3475-6<br />
Preis: € 78,–<br />
www.di-verlag.de<br />
DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Jetzt bestellen!<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Bestellung per Fax: +49 201 / 820 Deutscher 02-34 Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | Fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
Firma/Institution<br />
___Ex.<br />
Regenwasserbewirtschaftung - Stormwater Management<br />
1. Auflage 2013 – ISBN: 978-3-8356-3475-6<br />
für € 78,– (zzgl. Versand)<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen.<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PARBSM2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Dauerhafte DN 600 Abwasserleitung –<br />
Perfect Pipe im Einbau<br />
In der Börnecker Straße in Blankenburg am Harz wird 2014 der Abwasser-Hauptsammler erneuert. Basierend auf<br />
Erfahrungen mit unterschiedlichen Rohrmaterialien sollte nun eine Rohrleitung eingebaut werden, in der ein durchgängiger<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong> dauerhaft gegeben ist. Nach ausführlicher Prüfung mehrerer Rohrsysteme fiel die Wahl in Abstimmung<br />
von Zweckverband und verantwortlichem Ingenieurbüro auf das Beton-Kunststoff-Verbundrohr Perfect Pipe. Damit setzt<br />
sich die 2013 gestartete Markteinführung dieses neuen Abwasserrohres quer durch Deutschland fort. Nach den zu Beginn<br />
in den Nennweiten DN 250 bis DN 600 gefertigten Rohren liefert der Hersteller Beton Müller ab 2014 auch Fußrohre<br />
der Nennweiten DN 800 bis DN 1200. Zahlreiche Projekte in Deutschland und darüber hinaus in den Nachbarstaaten<br />
Frankreich, Schweiz und Österreich werden im laufenden Jahr realisiert.<br />
Die geforderte dauerhafte Belastbarkeit einer neuen<br />
Rohrleitung in mehrfacher Hinsicht – hydraulisch, statisch,<br />
chemisch – war es, die die Projektverantwortlichen<br />
veranlasste, bei der Ausschreibung dieser Maßnahme den<br />
Weg des Altbekannten zu verlassen und gezielt neue Produkte<br />
auf deren Anwendbarkeit zu prüfen. Nachdem die<br />
bestehende Rohrleitung den gestellten Anforderungen<br />
nicht mehr genügte, wurde man beim Trink- und Abwasserzweckverband<br />
Blankenburg und Umgebung von einem<br />
langjährigen Partner, der Firma Kimm Baustoffe, auf ein<br />
neues Abwasserrohrsystem aufmerksam gemacht. Zahlreiche<br />
technische Lösungen wurden in der Planungsphase<br />
im Jahr 2013 geprüft um letztlich das neue Beton-Kunststoff-Verbundsystem<br />
Perfect Pipe als zulässige Variante<br />
in der Ausschreibung zu berücksichtigen.<br />
Burkhard Happel, Vertriebs- und Marketingleiter bei<br />
Kimm Baustoffe, dem Hersteller der Schachtbauteile in<br />
diesem Projekt, fasst die zahlreichen Gespräche während<br />
der Planungsphase zusammen: „Es war motivierend und<br />
somit sehr positiv, sowohl beim Bauträger als natürlich<br />
auch beim verantwortlichen Planungsbüro auf eine derart<br />
ausgeprägte technische Kompetenz zu stoßen. Alle<br />
offenen und durchaus kritischen Fragen, die naturgemäß<br />
mit einem neuen Produkt verbunden sind, konnten im<br />
laufenden Austausch aller an der Planung Beteiligten mit<br />
dem Hersteller von Perfect Pipe, der Fa. Beton Müller,<br />
zufriedenstellend beantwortet werden.“ Die federführenden,<br />
an dieser Projektplanung Beteiligten sind die Ingenieure<br />
Jürgen Klink und Dieter Strauch vom Trink- und<br />
Abwasserverband Blankenburg in ihrer Zuständigkeit als<br />
Bild 3: Das Fußrohr Perfect Pipe wird in den Graben eingehoben<br />
Bild 4: Schachtunterteile mit GFK-Boden, gefertigt von<br />
Fa. Kimm Baustoffe<br />
80 06 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Bild 5: Beton-Kunststoff-Verbund-<br />
Adapter zur Anbindung Perfect Pipe an die<br />
bestehende Leitung in Blankenburg<br />
Bild 6: Die für Planung und Ausführung verantwortlichen Projektbeteiligten vom<br />
Ingenieurbüro PROWA, dem Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung,<br />
STRABAG, Kimm Baustoffe und Beton Müller<br />
Technischer Leiter bzw. Fachbereichsleiter Investitionen<br />
sowie Dietmar Heinemann von Ingenieurbüro Prowa aus<br />
Blankenburg.<br />
Der erste Bauabschnitt dieser Sanierungsmaßnahme<br />
in der historischen Stadt Blankenburg umfasst mehr<br />
als 400 m Beton-Kunststoff-Verbundrohr Perfect Pipe<br />
DN 600 sowie zahlreiche Beton-Fertigteilschächte mit<br />
werksseitig eingebauten GFK-Böden. Die Durchgängigkeit<br />
und Zuverlässigkeit des <strong>Korrosionsschutz</strong>es war unter<br />
anderem ausschlaggebend für die Wahl des Rohrmaterials.<br />
Während der HDPE-Liner im Rohr dauerhaft im<br />
schalungserhärtend gefertigten Betonrohr eingebunden<br />
ist, werden die Rohre mit Kunststoff-Connectoren<br />
zusammengefügt. So entsteht eine flexible und durch<br />
den Einsatz von zwei KLP-Dichtungen pro Connector bis<br />
zu einem Druck von 2,5 bar geprüfte, dichte Rohrverbindung.<br />
Mit der nachgewiesenen Dichtheit unter Druck ist<br />
Perfect Pipe auch für den Einsatz in Wassergewinnungsgebieten<br />
zugelassen.<br />
Eine weitere Eigenschaft, die in der wiederholten Konsultation<br />
mit dem Hersteller Beton Müller mit Hauptsitz<br />
in Achern, Baden-Württemberg, zunehmend an Gewicht<br />
in der Bewertung der Alternativen gewonnen hat, ist die<br />
der hohen statischen Belastbarkeit. Die Fußrohrgeometrie<br />
führt zu einer Ableitung einwirkender Kräfte über<br />
die beiden Aufstandsflächen, was insbesondere bei der<br />
Anwendung in Verkehrsflächen einen Vorteil gegenüber<br />
biegeweichen und kreisrunden Rohren bedeutet. Häufig<br />
erst längerfristig auftretende Schäden durch mangelhafte<br />
Zwickelverdichtung können erst gar nicht entstehen, da<br />
es keinen zu verdichtenden Zwickelraum gibt. Unterbögen<br />
werden weitestgehend durch das biegesteife Rohr,<br />
das keinen Aushub wie bei Glockenmuffen erfordert,<br />
vermieden.<br />
Für den Einbau reicht – auch bei einem minimalen Gefälleverlauf<br />
mit geringen Toleranzen – ein einfach verdichtetes<br />
Planum. Die Grabenverfüllung und Verdichtung erlaubt<br />
häufig die Verwendung des Aushubmaterials und damit<br />
reduzierte Kosten und Belastungen für Materialtransporte.<br />
Eine Reihe von Eigenschaften, die auch beim<br />
ausführenden Unternehmen, der Strabag AG, Standort<br />
Halberstadt, sofort auf Anklang stieß. Und in der Einbaupraxis<br />
bewährte sich zudem die Lagestabilität des<br />
Fußrohres bereits ab dem Einheben in den Graben: „Die<br />
Rohre werden ausgerichtet und bleiben liegen – eine<br />
ordentliche Lösung für die Baufirma“, so der verantwortlicher<br />
Polier seitens Strabag. Von Herstellerseite weist der<br />
Geschäftsführer, Joachim Strack, explizit darauf hin, „dass<br />
mit Perfect Pipe zwei wesentliche Eigenschaften von<br />
Abwasserrohrleitungen zuverlässig kombiniert werden.<br />
Und zwar die dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und<br />
die günstigen statischen Eigenschaften auch bei geringst<br />
möglicher Überdeckung.“<br />
KONTAKT: Betonwerk Müller GmbH, Achern, Joachim Strack,<br />
Tel. +49 (0) 7841 204 0, E-Mail: joachim.strack@beton-mueller.de<br />
Kimm Baustoffe, Wabern-Uttershausen, Burkhard H. Happel<br />
Tel. +49 (0) 5683 508 528, E-Mail: b.h.happel@kimm-baustoffe.de<br />
06 | 2014 81
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Hochleistungs-Stahlbeton rohre mit integrierter<br />
Trockenwetter-Rinne<br />
Im „Schmelztiegel Ruhrgebiet“ befindet sich derzeit Europas größte Wasserbaustelle: die Umgestaltung der Emscher<br />
mit ihren zahlreichen Nebenflüssen. Ein weit verzweigtes Kanalnetz stellt nicht nur eine einmalige „Sanierungsaufgabe“<br />
dar, sondern wird den zweieinhalb Millionen Menschen in der gesamten Region zwischen Holzwickede und Dinslaken<br />
neue Lebensqualität vermitteln – eine technische und ökologische Großtat! Gigantisch sind die Leistungen, die mit<br />
einem Aufwand von rund 4,5 Mrd. Euro bis zum Jahre 2020 zu erbringen sind. Ein zusammenhängendes unterirdisches<br />
Kanalnetz mit rund 400 km Länge und einem stetigen Gefälle von anfangs 8 m bis zu 40 m unter Geländeoberkante<br />
ist europaweit noch nie geplant, geschweige realisiert worden.<br />
Emscher-Projekt beflügelt den Fortschritt<br />
im Kanalbau<br />
Dieses kühne Tiefbau-Projekt befindet sich in guten<br />
Händen. Die Emschergenossenschaft Essen hat sich als<br />
Bauherrin in ihrer mehr als 100jährigen Geschichte schon<br />
oft mit wegweisenden Innovationen als technologischer<br />
Schrittmacher bei der Abwasserbeseitigung weit über die<br />
Grenzen des Ruhrgebietes hinaus erwiesen.<br />
Jüngstes Beispiel: der Umbau sowie die ökologische<br />
Verbesserung des Abwassersystems Sellmannsbach in<br />
Gelsenkirchen. Ein Herzstück der Baumaßnahme ist die<br />
Errichtung eines leistungsfähigen Stauraumkanals mit<br />
unten liegender Entastung (SKU) sowie den dazugehörigen<br />
Schachtbauwerken. Erstmalig hatte man dafür Hochleistungs-Stahlbetonrohre<br />
mit einem Innendurchmesser<br />
von 3600 mm, einem Außendurchmesser von 4320 mm<br />
sowie einer Baulänge von 3,00 m vorgesehen. In enger<br />
Zusammenarbeit des Bauherrn mit dem Auftragnehmer,<br />
der Kramer Bauunternehmung sowie dem Rohrhersteller,<br />
dem DW-Werk Dormagen der Berding Beton GmbH,<br />
wurde für diese Rohre eine Rezeptur entwickelt, die die<br />
hohen chemischen aber auch statischen Anforderungen<br />
über eine lange Nutzungsdauer erfüllen soll. Das Ergebnis:<br />
ein Beton mit erhöhtem Säurewiderstand (SWB ® )<br />
und den daraus resultierenden, weitergehenden Anforderungen<br />
wie u.a. die Erfüllung der Ex-positionsklasse<br />
XA 3 gemäß DIN EN 206-1 auf Basis der Zusätzlichen<br />
Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) der Emschergenossenschaft<br />
„Herstellung und Lieferung von Abwasserrohren<br />
aus Beton und Stahlbeton“.<br />
Bild 1: Schweres Gerät wurde eingesetzt, um das großkalibrige<br />
Stahlbetonrohr der BERDING BETON GmbH nach dem Antransport mit<br />
einer speziellen Verankerung in die horizontale Verlegeposition zu bringen<br />
Bild 2: Eine gleichmäßig dichte und glatte<br />
Betonoberfläche sorgt für die erhöhte<br />
Fließgeschwindigkeit in den Abwasserkanälen,<br />
82 06 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Zur Sicherstellung höchstmöglicher Qualität wurden in<br />
Gelsenkirchen Rohre dieser Dimension mit bereits im<br />
Betonwerk der Berding Beton GmbH hergestellter monolithischer<br />
Trockenwetterrinne (Querschnitt 1000 mm)<br />
ausgestattet. TWR-Rohre sind immer dann sinnvoll,<br />
wenn geringe Trockenwetterabflüsse vorliegen bzw.<br />
sich Fließgeschwindigkeiten im Trockenwetterfall über<br />
das hydraulisch zumutbare Maß verringern. Der kontinuierlich<br />
sinkende Wasserverbrauch erfordert reduzierte<br />
Fließquerschnitte zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit<br />
in unseren Abwasserkanälen, die immer öfter durch Trockenwetterrinnen<br />
und Sonderquerschnitte ermöglicht<br />
werden. Ansonsten besteht die Gefahr von biogener<br />
Schwefelsäure-Korrosion infolge herabgesetzter Schleppspannung.<br />
Durch den Einsatz von Trockenwetterrinnen<br />
kann die Fließgeschwindigkeit zwar deutlich erhöht werden,<br />
setzt jedoch eine passgenaue, glatte und gleichmäßig<br />
dichte Oberfläche der Rinnenausbildung voraus. Die<br />
bisher vor Ort meist händisch hergestellten Lösungen<br />
führten oft nicht zu einem solchen Ergebnis, abgesehen<br />
von dem gegenüber bereits im Werk integrierten Rinnen<br />
erhöhten Zeitaufwand vor Ort.<br />
Die Montage der schwergewichtigen Fertigteile, die<br />
immerhin gut 38 t auf die Waage brachten, war, wie<br />
Bauleiter Robin Golchin zu berichten weiß, selbst für<br />
ein eigespieltes Kanalbauer-Team keine alltägliche Aufgabe<br />
und - eine logistische Herausforderung. Bereits der<br />
Transport der Rohre zur Baustelle erforderte Millimeterarbeit.<br />
Da viele Brücken lediglich eine Durchfahrtshöhe von<br />
maximal 4,00 m zulassen, mussten die Rohre senkrecht<br />
transportiert werden. Um sie anschließend wieder in ihre<br />
Verlege-Position zu drehen, wurde ein spezieller Anker<br />
auf dem Rohrscheitel angebracht. Neben dem für die<br />
Verlegung eingesetzten 250 t-Kran war beim Entladen für<br />
den Drehvorgang der Rohre noch ein 34 t-Kettenbagger<br />
erforderlich, eine Lösung, die ein zügiges und sicheres<br />
Arbeiten ermöglicht hat.<br />
Der Einbau der Rohre für den rd. 320 m langen Kanal<br />
erfolgte durchweg im offenen Rohrgraben mit Überdeckungshöhen<br />
von 1,50 m bis 6,60 m über Rohrscheitel für<br />
Verkehrslasten SLW 60 und LM 71 (unter mehrgleisiger<br />
Bild 3: Millimeterarbeit ist beim Absenken in den offenen<br />
Rohrgraben erforderlich, um eine hohe Passgenauigkeit der<br />
zu montierenden Rohre zu gewährleisten,<br />
Bahnanlage). Bauleiter Golchin ist fest davon überzeugt,<br />
dass nach sorgfältiger Montage mit entsprechend präziser<br />
Justierung der tonnenschweren Elemente ein Kanal<br />
entstanden ist, der den bekannt hohen Erwartungen<br />
des Bauherrn gerecht wird, sprich mindestens 100 Jahre<br />
schadlos überleben kann.<br />
KONTAKT: BERDING BETON GmbH, Steinfeld<br />
E-Mail: info@berdingbeton.de<br />
Bildquellen: Berding Beton<br />
INFO<br />
Der Newsletter für<br />
die Rohrleitungsbranche<br />
Anmelden unter www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU<br />
06 | 2014 83
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Heppenheim setzt auf Nachhaltigkeit<br />
Neuer Sammler aus HS ® -Kanalrohren SN 16<br />
Ziel der rund 630.000 Euro teuren Neugestaltung des Heppenheimer<br />
„Grabens“ ist es, den Übergang zwischen Altstadt<br />
und Fußgängerzone durch Asphaltierung, Pflasterung,<br />
Neupflanzungen sowie eine verbesserte Straßenbeleuchtung<br />
ansprechender zu gestalten. Bei der Kosmetik bleibt es dabei<br />
aber nicht: Die Stadtwerke Heppenheim haben die Verschönerungsarbeiten<br />
zum Anlass genommen, die unterirdische<br />
Infrastruktur gleich mit „auf Vordermann“ zu bringen. Für<br />
die neuen Sammler und die Hausanschlussleitungen hat der<br />
Auftraggeber zusammen mit den Planern von der Kolb &<br />
Küllmer Ingenieurgesellschaft mbH das HS ® -Kanalrohrsystem<br />
der Funke Kunststoffe GmbH ausgewählt. Die auftragnehmende<br />
Claus Schaab GmbH verbaut für die Trennkanalisation<br />
blaue und braune Rohre in den Nennweiten von DN/OD 160<br />
bis 800. Die farbliche Unterscheidung ist aber nur einer der<br />
Vorteile der Funke-Produkte. Neben technischen Parametern<br />
und Produktionsbedingungen spielte der Systemcharakter des<br />
Kanalrohrsystems bei der Auswahl eine wichtige Rolle. Funke<br />
bietet ein komplettes Programm vom Hausanschluss bis zum<br />
Sammler. Hinzu kommt das „Plus an Sicherheit“: Rohre und<br />
Formstücke verfügen gleichermaßen über erhöhte Wanddicken<br />
und sind deshalb deutlich belastbarer als herkömmliche<br />
Rohrsysteme – ein wichtiges Kriterium für Auftraggeber und<br />
Planer, die auch bei Tiefbaumaßnahmen gezielt auf Nachhaltigkeitsaspekte<br />
setzen.<br />
Die Untersuchungen im Rahmen des Generalentwässerungsplans<br />
im hessischen Heppenheim hatten es<br />
ans Tageslicht gebracht: Die bestehende Regenwasserkanalisation<br />
ist bei Starkregen kapazitiv überlastet. „Da aufgrund<br />
der äußerst komplizierten Baugrundverhältnisse ein Wechsel<br />
mit Erweiterung der Nenngröße nicht möglich war, bestand<br />
die einzig mögliche Alternative in der Erstellung eines Bypasses,<br />
der sich händisch verlegen lässt und der der einen oder<br />
anderen Bewegung im Untergrund nachgibt, ohne Fremdwasser<br />
eintreten zu lassen“, erläutert Dr.-Ing. Volker Hettler,<br />
Technischer Betriebsleiter bei den Stadtwerken Heppenheim.<br />
Gleichzeitig wiesen Teile der Schmutzwasserkanalisation Schadensbilder<br />
auf, bei der eine Inliner-Sanierung keine nachhaltige<br />
Verbesserung gebracht hätte. Auch hier entschied<br />
man sich konsequent zur Anwendung von „Funke-Rohren“,<br />
weil die Übergänge zum Bestand problemlos händisch und<br />
mit verfügbaren Formstücken gemeistert werden konnten.<br />
Dass die Stadtwerke so konsequent auf die Schadensberichte<br />
reagierten, unterstreicht, wie wichtig die Beteiligten ihre<br />
Verantwortung für einen nachhaltigen Kanalbau nehmen,<br />
gleichzeitig aber auch wirtschaftliche Aspekte im Blick haben.<br />
Da der Graben städtebaulich ohnehin umgestaltet werden<br />
sollte – inklusive neuem Straßenbelag und Gehwegen – entschied<br />
man sich, die Sammler im Zuge der Baumaßnahmen<br />
gleich mit zu erneuern. „Wir wollten die Synergieeffekte nutzen.<br />
Indem wir die Kanalisation und die Straße<br />
in einem Zuge auswechseln, sind sowohl der<br />
finanzielle Aufwand als auch die Belastung für<br />
die Anwohner und die Geschäftsleute vor Ort<br />
geringer“, so Hettler.<br />
Bild 1: Baubesprechung vor Ort (von links): Dr.-Ing. Volker Hettler,<br />
Technischer Betriebsleiter der Stadtwerke Heppenheim, Auftragnehmer<br />
Claus Schaab von der gleichnamigen Bauunternehmung, Planer Gianfranco<br />
Capone von der Kolb & Küllmer Ingenieurgesellschaft mbH und Funke-<br />
Fachberater Ralph Mayer.<br />
An die nächste Generation denken<br />
Weitsicht bewies der Auftraggeber auch bei<br />
der Auswahl der Rohre. Bereits bei vorangegangenen<br />
Tiefbaumaßnahmen hatte man<br />
gute Erfahrungen mit dem Werkstoff PVC-U<br />
gemacht. Dass man sich für die Produktpalette<br />
von Funke entschied, lag nicht zuletzt an der<br />
hohen Sicherheit, die der Kunststoffrohrhersteller<br />
auf Wunsch liefert. „Wir haben das HS ® -<br />
Kanalrohrsystem mit einer besonders hohen<br />
Ringsteifigkeit von SN 16 ausgewählt. Die<br />
Ringsteifigkeit gibt an, wie widerstandsfähig ein<br />
Rohr gegen Verformung durch eine senkrecht<br />
einwirkende Kraft ist. Eine robuste Lösung war<br />
uns wichtig. Schließlich wird der Kanal ja nicht<br />
nur für ein paar Jahre gebaut, sondern auch für<br />
die nächste Generation“, unterstreicht Hettler<br />
die Bedeutung der Nachhaltigkeit im Kanalbau.<br />
Dieser Meinung schließt sich auch Planer Dipl.-<br />
Ing. Gianfranco Capone von der Kolb & Küllmer<br />
Ingenieurgesellschaft mbH an: „Wir müssen<br />
84 06 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
langfristig denken und planen.<br />
Wer bei einer so wichtigen<br />
Sache wie der Kanalinfrastruktur<br />
spart, spart am falschen Ende<br />
und schmeißt im Grunde das<br />
Geld mit der Schaufel weg.“ Die<br />
SN 16-Rohre werden in Baulängen<br />
von drei Metern produziert<br />
und sind mit allen Formteilen aus<br />
dem HS ® -Kanalrohrprogramm<br />
kombinierbar.<br />
Fotos: Funke Kunststoffe GmbH<br />
Qualität zahlt sich aus<br />
Verbaut wurden für die<br />
neue Trennkanalisation HS ® -<br />
Kanalrohre in den Nennweiten<br />
DN/OD 250, 315, 400, 500, 630<br />
und 800. Da, wo es notwendig<br />
war, sind auch die Hausanschlüsse<br />
gegen HS ® -Rohre DN/OD 160<br />
ausgetauscht worden. Dabei<br />
kam den Tiefbauern der Systemcharakter<br />
der Produkte sehr<br />
gelegen. Deutlich beschleunigt<br />
hat zum Beispiel der CONNEX-<br />
Anschluss den Baufortschritt.<br />
Funke-Fachberater Ralph Mayer:<br />
„Mit diesem Bauteil lassen sich<br />
Hausanschlussleitungen und Seitenzuläufe<br />
schnell, einfach und<br />
wirtschaftlich einbinden. Dank<br />
integriertem Kugelgelenk sind die angeschlossenen Rohre in<br />
einem Bereich von 0° bis 11° schwenkbar. Dadurch können<br />
die Anschlussleitungen Bewegungen aufnehmen. Höhere Flexibilität<br />
und Gelenkigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer.“<br />
Flexibler Einbau<br />
Claus Schaab, der Chef der ausführenden gleichnamigen Bauunternehmung<br />
ist von der Qualität der Produkte überzeugt,<br />
denn auch die Montage dieses Bauteils geht denkbar einfach:<br />
Die Einbaustelle auf dem Kunststoffrohr wird vorgebohrt und<br />
dann mit einer Bohrkrone im 90°-Winkel zur Rohrachse hergestellt<br />
und entgratet. Jetzt kann das Unterteil des CONNEX-<br />
Anschlusses in das Hauptrohr gedrückt und so platziert werden,<br />
dass die Halteclips ausklappen und der Anschluss fixiert<br />
ist. Im nächsten Schritt muss der rotbraune Distanzring auf die<br />
Führungsnut des Unterteils aufgesetzt werden. Hierauf kommt<br />
das mit dem dazugehörigen Gleitmittel bestrichene graue<br />
Gewinderad. Nachdem die Tiefbauer den korrekten Sitz des<br />
Anschlussunterteils im Hauptrohr überprüft haben, bestreichen<br />
sie den O-Ring und das Gewinde des Anschlussoberteils mit<br />
dem mitgelieferten Gleitmittel. Nun wird das Oberteil gerade<br />
in die Vorrichtung gedrückt und eingedreht. Mit dem Gewinderadschlüssel<br />
wird das Anschlussoberteil bis zum Anschlag<br />
fest angezogen. Ein letztes Mal prüfen – und schon können<br />
Hausanschlussleitungen und Seitenzuläufe in den Sammler<br />
eingebunden werden.<br />
Bild 2: Die Situation vor Ort mit schlechtem Boden und<br />
sensibler Bausubstanz im Umfeld stellte die Experten<br />
vor eine Herausforderung. Umso willkommener waren<br />
den Tiefbauern das leichte Handling und die sichere<br />
Verlegbarkeit der HS ® -Rohre.<br />
Sensibles Baufeld<br />
Besonders auf der Baustelle im Graben war den Tiefbauern<br />
jede Erleichterung bei der Arbeit willkommen, denn die örtlichen<br />
Rahmenbedingungen stellten selbst die Experten vor<br />
eine Herausforderung. Schaab: „In puncto Tiefbau war das<br />
ein regelrechter Abenteuerspielplatz. Wir mussten auf denkmalgeschützte<br />
Gebäude mit empfindlichen Fundamenten<br />
Rücksicht nehmen. Hinzu kamen viele querende Leitungen<br />
und zahlreiche Fehlanschlüsse.“ Auch der Baugrund war in<br />
schlechtem Zustand. Um die sensible Bausubstanz der Häuser<br />
im Baufeld nicht zu gefährden, mussten die Tiefbauer die Baugrube<br />
mit Flüssigboden verfüllen, da ein Verdichten auf herkömmliche<br />
Weise zu starke Erschütterungen bedeutet hätte.<br />
Noch vor Beginn der Kanalbaumaßnahme hatten Experten<br />
zur Sicherheit den Ist-Zustand der Häuser dokumentiert und<br />
dort Messgeräte installiert.<br />
Da kam es den Tiefbauern gerade recht, dass sie sich auf<br />
das zu verbauende Material verlassen konnten. Schaab: „Die<br />
Produkte sind durchdacht und ermöglichen flexibles Arbeiten.<br />
Aufgrund des geringen Eigengewichts lassen sich die Rohre<br />
und Formteile gut handhaben. Aber auch Details, wie zum<br />
Beispiel die integrierte FE-Dichtung, die Verlegefehler minimiert,<br />
überzeugen.“<br />
KONTAKT: Funke Kunststoffe GmbH F, 59071 Hamm<br />
info@funkegruppe.de<br />
Bild 3: So wird das Verlegen einfach: Die<br />
FE-Dichtung ist nur ein Merkmal, das den<br />
Tiefbauern die Arbeit erleichtert. Fest im HS ® -Rohr<br />
integriert, macht sie ein Verschieben oder gar<br />
Vergessen bei der Montage unmöglich.<br />
06 | 2014 85
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
„Hoffnungslos“ gibt es nicht mehr<br />
Das Fräs-Strahl-Verfahren rettet Bauprojekte mit verfüllten Abwasserleitungen<br />
Die Festsetzung von Beton oder anderen Baustoffen in Entwässerungsleitungen während der Bauphase ist der Albtraum eines<br />
jeden Planers bei Hoch- oder Tiefbau-Projekten. Fallen diese Leitungen aus, ist meist der Betrieb des gesamten Projektes in<br />
Gefahr und es drohen Versicherungs-Schäden in manchmal gigantischer Größenordnung. Jürgen Herm aus Rheinzabern hat<br />
schon viele solcher Problemfälle gesehen – weil er sie nämlich regelmäßig löst. Seine Lösung ist das von ihm entwickelte, zum<br />
internationalen Patent angemeldete Fräs-Strahl-Verfahren mit dem die „HERM effektive Rohrreinigung und Sanierungstechnik“<br />
schon ausgehärteten Bunker-Beton aus vollständig verfüllten Kunststoffrohren entfernt hat, ohne diese selbst zu beschädigen.<br />
Regelmäßig sind mit dieser Technik auch private Immobilien zu retten, in deren Abwasserrohren aufgrund verhärteter<br />
Ablagerungen unterschiedlichen Ursprungs nichts mehr (ab)läuft.<br />
Ein U-Bahnhof „auf der Kippe“<br />
Ungefähr so sieht der „worst case“ jedes Bauunternehmens<br />
aus, das gerade dabei ist, ein Millionen-Projekt zu<br />
realisieren: Bei Verfüllung einer Deckenschalung mit Beton<br />
kommt es zum punktuellen Bruch der zuvor installierten<br />
Abwasserleitung und diese füllt sich auf mehrere Meter<br />
Länge - vorerst unbemerkt - mit extrem harten „Blauen<br />
Beton“. Absolut kein theoretisches Szenario, wie Jürgen<br />
Herm weiß – denn mit genau diesem Fall wurde er jüngst<br />
beim U-Bahn-Bau in einer deutschen Landeshauptstadt<br />
konfrontiert. Tief in der 4 m dicken Decke eines neuen<br />
U-Bahnhofs hatte sich das Kondensat-Ablaufrohr eines<br />
Abluftschachtes ca. 2 m weit mit Bunkerbeton C 50 gefüllt<br />
und stellte die Betriebsfähigkeit des Entlüftungssystems des<br />
Bahnhofs in Frage. Das Projekt stand auf der Kippe.<br />
Versicherungsexperten bezifferten die Schadenhöhe für<br />
den Fall eines Austausches des „Infarkt-Rohrs“ bei Teilrückbau<br />
des Stahl-armierten Bauwerks auf deutlich über<br />
13 Millionen Euro: Ein bemerkenswerter Betrag zwar, aber<br />
doch keine Größenordnung, die Jürgen Herm erschreckt.<br />
In seiner Praxis steht er nämlich immer wieder vor Fällen<br />
mit dem Schadenpotential „nicht bezifferbar“.<br />
Trockenlegung eines Einkaufszentrums<br />
So stand 2010 ein Einkaufszentrum in Süddeutschland mit<br />
U-Bahn-Anschluss bereits nach drei Betriebsjahren vor dem<br />
Aus, weil das Abwassersystem aus KG 2000-Rohren DN 125<br />
in der Bauphase auf 2 m Länge mit Beton C 30/37 geflutet<br />
worden war, inklusive eines Anschlussabzweigs DN 125/45°<br />
und eines 45°-Bogens. Wiederholte Überschwemmungen<br />
infolge der verstopften, zudem betriebsbedingt hoch mit Fett<br />
belasteten Abwasseranlage, hatten bis dahin schon 300.000<br />
Euro Schaden erzeugt. Die 40.000 Euro, die die Lösung des<br />
Problems mit dem Fräs-Strahl-Verfahren durch Herm kostete,<br />
muteten vor diesem Hintergrund beinahe vernachlässigbar an.<br />
Das Problem dieser Verstopfungen bestehe vor allem in der-<br />
Mischung aus Urinstein und Rohrreiniger, die dem zugesetzt<br />
sind: Ein „teuflisch hartnäckiges Gemisch“, so Herm, das er<br />
aber schon in Schichtstärken bis 100 mm Rohr-schonend<br />
entfernt hat - auch aus Kunststoff-Leitungen, deren Material<br />
deutlich empfindlicher ist als die Ablagerungen selbst. Eben<br />
hierin liegt auch das Faszinierende des Fräs-Strahl-Verfahrens,<br />
das Jürgen Herm inzwischen zum Internationalen Patent angemeldet<br />
hat. Es trennt Materialien äußerst unterschiedlicher<br />
Widerstandsfähigkeit, so dass der notwendige Zerstörungs-<br />
Bild 1: Tunnel-Retter im Einsatz<br />
Bild 2: Mobiles Equipment macht den Einsatz auch in derart<br />
beengter Örtlichkeit problemlos möglich<br />
86 06 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
prozess ausschließlich zu Lasten der härteren Komponente,<br />
also der Verstopfung geht.<br />
Rotierender Wasserstrahl voraus statt<br />
Rückstoß-Spülen<br />
Das Fräs-Strahlverfahren ist grundsätzlich ein hydraulisches<br />
Reinigungsverfahren und damit eine prinzipielle Alternative<br />
zu mechanischen Lösungen wie der klassischen Spirale oder<br />
Fräsrobotern. Andererseits ist das Verfahren nicht mit Hochdruck-Spültechniken<br />
in der Rohrreinigung zu verwechseln. Von<br />
diesem unterscheidet es sich schon im technischen Ansatz<br />
klar - und erst recht in den Ergebnissen. Eine gewöhnliche<br />
Hochdruckspüldüse spült sich nach dem Rückstoßprinzip in<br />
die Leitung ein und entfernt Ablagerungen und Krusten mit<br />
dem gegen die Laufrichtung gewandten Wasserstrahl. Herms<br />
Fräs-Strahl-Verfahren funktioniert dagegen nach dem Prinzip<br />
eines Höchstdruckreinigers mit einem voraus gerichteten,<br />
extrem fokussierten Wasserstrahl hoher Aufprallenergie. Die<br />
spezielle Geometrie des jeweiligen Düsenkopfes versetzt diesen<br />
in eine rotierende Bewegung, so dass der austretende<br />
Wasserstrahl die Rohrwand in spitzem Winkel überstreicht. Die<br />
Austrittsdrücke an der Düse betragen dabei, je nach Variante,<br />
zwischen 100 und 500 bar. Dass das System an einem versteiften<br />
Glasfaserstab eingeschoben anstatt eingespült wird,<br />
bietet entscheidende Vorteile:<br />
»»<br />
es ist auch bei einer 100 mm hohen Füllung des Rohrs<br />
frontal einsetzbar. Ein Fall bei der eine Rückstoßdüse<br />
an der Verschmutzung schon gar nicht mehr vorbei<br />
kommen würde.<br />
»»<br />
es wird keine Energie / kein Wasser benötigt, um die<br />
Düse bzw. den Schlauch einzuziehen, beides kommt<br />
uneingeschränkt dem Reinigungsvorgang zugute<br />
»»<br />
es wird in Fließrichtung gereinigt, da kein Spülschwall<br />
zur Förderung des gelösten und hoch zerkleinerten<br />
Reinigungsgutes nötig ist<br />
»»<br />
der Verbrauch an Wasser ist im Vergleich zu anderen<br />
Verfahren deutlich geringer, das System somit ökologisch<br />
vorteilhafter<br />
Die Ausrüstung ist dabei in allen Komponenten so flexibel konzipiert,<br />
dass die Fräs-Strahl-Technik praktisch uneingeschränkt<br />
(bis 87°) bogengängig ist; im Frässtrahl-Betrieb versteift sich<br />
die Schiebetechnik, so dass sie nicht vom Rückstoß im Rohr<br />
zurück getrieben wird. Der Einsatzbereich reicht von DN 70<br />
bis DN 150 (modifiziert auch DN 200) und deckt damit die<br />
gesamte Haus- und Grundstücksentwässerung einschließlich<br />
der Fallrohre ab.<br />
Geballtes Know-How in unscheinbarer Gestalt<br />
Alle Systemkomponenten wurden von Jürgen Herm seit 2000<br />
entwickelt und in langen, kostspieligen Versuchsreihen optimiert<br />
– oft zur Lösung individueller Problemstellungen. Das<br />
entscheidende Argument für die Fräs-Strahl-Technik ist aber die<br />
Rohr-schonende Arbeitsweise. Das Versprechen, das Rohr zu<br />
schonen, hält Jürgen Herm aber nicht nur in Bezug auf Betonund<br />
Steinzeugrohre - selbst wenn sie Vorschäden aufweisen -<br />
sondern auch bei Kunststoffrohren. Das vermeintliche Wunder,<br />
dass Beton oder Urinstein zerstört werden, Kunststoffrohre<br />
Bild 3: Schrittweise wird ein Beton-Pfropfen in der Leitung mit FST<br />
entfernt; rechts erkennt man im Rohrscheitel einen Bruch, der für die<br />
Flutung des Rohrs mit Beton mit ursächlich war<br />
aber nicht, beruht auf Geometrie und Bewegungs-Charakteristika<br />
von Düsen und Wasserstrahl. So sind die Düsen für hohe<br />
Drücke derart konzipiert, dass der schneidende Wasserstrahl<br />
entweder sehr langsam in der Leitung rotiert oder aber sehr<br />
schnell - je nachdem, welcher Stoff entfernt werden soll.<br />
Besonders wichtig für den Anwendungsbereich der Technik<br />
ist die hohe Mobilität der Ausrüstung. Sie wurde ja für den<br />
Einsatz in Gebäuden entwickelt. Das bedeutet, dass man die<br />
Fräs-Strahl-Technik in allen schwer zugänglichen Örtlichkeiten<br />
problemlos einsetzen kann. Im Umfeld von Liegenschafts-<br />
Entwässerungen hoher Komplexität ist das fast immer von<br />
Bedeutung.<br />
Rettung eines Tunnels<br />
Trotz einer gewissen Gewöhnung an extreme Einsatzorte<br />
hatte der Einsatz in einem neuen Verkehrstunnel im Sommer<br />
2009 echten „Highlight-Charakter“. Hier waren zehn Tunnel-<br />
Querungen aus PE-Spiralrohren DN 90 (gedacht als Kabel-<br />
Leerrohre) mit WU-Beton C30/37 gefüllt worden, der sechs<br />
Jahre Zeit zum Aushärten hatte. Bis zu 4,5 km tief musste die<br />
Fahrzeugeinheit der HERM Rohrreinigung in den Tunnel einfahren,<br />
um ihren Einsatzort zu erreichen. Eine Besonderheit lag<br />
in diesem Fall nicht nur darin, dass das PE-Rohr sehr weich und<br />
somit weit empfindlicher als der Beton ist, sondern vor allem<br />
darin, dass in allen Fällen 180°-Bögen mit einem Radius von<br />
nur ca. 10 m zu reinigen waren. Diese Rahmenbedingungen<br />
(Kombination von Nennweite, Bögen und Material) schlossen<br />
den Einsatz mechanischer Systeme bzw. eines Roboters von<br />
vornherein aus. Mit dem Fräs-Strahl-Verfahren konnte aber<br />
auch diese tief unterirdische Herausforderung vollständig und<br />
ohne Beschädigungen der Rohre im Sinne des Auftraggebers<br />
bewältigt werden.<br />
Den überraschend guten Zustand der befreiten Rohre nach<br />
Einsatz von einigen 100 bar Wasserdruck bezeichneten schon<br />
viele Auftraggeber als bemerkenswert. Daher ist Herm mit der<br />
Spezial-Dienstleistung zwischen Ostsee und Alpen bundesweit<br />
im Einsatz. Anfragen nach Problemlösungen kommen inzwischen<br />
sogar aus aller Welt.<br />
KONTAKT: Jürgen Herm, HERM effektive Rohrreinigung und Sanierungstechnik,<br />
Rheinzaber, Tel.: +49 7272-7776093<br />
06 | 2014 87
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Kanalsanierung in der Mineralölindustrie<br />
Systemlösung an der Grenze des technisch Machbaren<br />
Die Sanierung von Kanälen und Schächten im Entwässerungs-System eines Mineralölkonzerns erforderte vom<br />
Ingenieurbüro ISAS aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen ein hohes Maß an Fachwissen und Flexibilität. Gemäß<br />
Eigenüberwachung hatte der Mineralölbetrieb mit Sitz in Bayern seine Kanäle auf Dichtheit überprüft. Ergebnis: Ein Teil<br />
des Industrieabwassernetzes – insgesamt zwölf Haltungen der Durchmesser DN 400 bis DN 1200 und 14 Schächte –<br />
erwiesen sich als sanierungsbedürftig.<br />
Spezielle Objektrandbedingungen<br />
Eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der bestgeeigneten<br />
Sanierungstechnik spielten dabei die speziellen<br />
Objekt-Randbedingungen, die sich im Abwassersystem<br />
eines Mineralöl-Konzerns stellen: Die Abwasserzusammensetzung<br />
(chemische Inhaltsstoffe, pH-Wert, usw.) musste<br />
berücksichtigt werden, ebenso die Abwassertemperatur,<br />
die im Betriebszustand bis zu 90 Grad Celsius betragen<br />
kann und enorme Schwankungen aufweist. Eine große<br />
Rolle spielte auch die Forderung nach der Ableitfähigkeit<br />
der verwendeten Materialien, da in den Kanälen ausnahmsweise<br />
auch Mineralöl-haltiges Abwasser in sehr<br />
hoher Konzentration anfallen kann – Die Gefahr einer<br />
elektrostatischen Aufladung, Funkenbildung und dadurch<br />
möglichen Verpuffung im Kanal muss unter allen Umständen<br />
verhindert werden.<br />
Neben diesen materiellen Anforderungen stellten auch<br />
die äußeren Umstände das Ingenieurbüro ISAS vor große<br />
Herausforderungen: Das Projekt musste unter hohem<br />
Zeitdruck realisiert werden und die Projektumsetzung<br />
ebenso kurzfristig erfolgen, da auf dem Gelände direkt<br />
im Anschluss weitere große Baumaßnahmen stattfinden<br />
sollten. Schlussendlich galten für die Fachplaner von ISAS<br />
und die ausführenden Firmen natürlich auch die enorm<br />
hohen Sicherheitsbestimmungen des Auftraggebers: So<br />
wurde beispielsweise jede Bautätigkeit täglich erneut vom<br />
Auftraggeber freigegeben, vor dem Einstieg in die Kanäle<br />
wurde die Kanal-Atmosphäre frei gemessen, schriftliche<br />
Arbeitsgenehmigungen waren erforderlich, spezielle<br />
Schutzausrüstung und Schutzkleidung für die Arbeit innerhalb<br />
von Raffinerien sind obligatorisch.<br />
Wegen der notwendigen Abwasserfreiheit während der<br />
Sanierungsarbeiten wurde das Gesamtprojekt in drei große<br />
Abwasserhaltungsabschnitte eingeteilt. In den jeweiligen<br />
Abschnitten wurde das Abwasser während der Sanierung<br />
über mehrere Kilometer Ersatzleitungen umgepumpt. Eine<br />
Kanalwache sorgte rund um die Uhr dafür, dass bei einem<br />
Pumpenversagen sofort eingegriffen und eine Sicherheitsgefährdung<br />
somit ausgeschlossen werden konnte.<br />
Unter Berücksichtigung all dieser Vorgaben wurden ver-<br />
Bild 1: Projektbesprechung in der Örtlichkeit<br />
Bild 2: Liner-Einbau mit Höhenbegrenzung<br />
88 06 | 2014
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
schiedene Sanierungsvarianten im Rahmen der Objektplanung<br />
untersucht und hieraus ein Leitverfahren ermittelt.<br />
In Erwägung gezogen wurde unter anderem auch eine<br />
offene Sanierung. Aufgrund der Spartenlagen und diverser<br />
parallel laufender Baumaßnahmen wurde eine offene<br />
Erneuerung jedoch als zu aufwendig und daher als nicht<br />
realisierbar eingestuft.<br />
Projektrealisierung<br />
Um den hohen fachübergreifenden Anforderungen<br />
gerecht zu werden, wurden die ISAS-Ingenieure sowohl<br />
von einem Gutachter für die Bewertung des Sanierungsmaterials<br />
als auch zum Thema „Ableitfähigkeit“ unterstützt.<br />
Gemeinsam entwarf das Projektteam nun ein Sanierungskonzept,<br />
das weltweit bisher so noch nicht ausgeführt<br />
wurde: Eine Medien-resistente Schlauchlinersanierung<br />
der Kanäle und Schächte bei vollständiger Ableitfähigkeit<br />
der verwendeten Materialien. Es wurde ein spezieller<br />
GFK-Inliner eingesetzt. Das gewählte Vinylesterharz ist<br />
aufgrund der chemischen Resistenz gegenüber der Abwasserzusammensetzung<br />
sowie der Formbeständigkeit bei<br />
den vorherrschenden Temperaturen ideal. Die Schächte<br />
wurden mit einer gleichwertigen GFK-Auskleidung saniert.<br />
Somit handelte es sich sowohl im Schacht als auch in der<br />
Haltung um einen einheitlichen Werkstoff. Um elektrische<br />
Spannungen abzuleiten, wurde in den Schächten außerdem<br />
eine aus Stahlplatten und Stahlbändern bestehende<br />
Ableitkonstruktion eingebaut und an den Ring-Erder der<br />
Raffinerie angeschlossen. Im Nachgang wurden schließlich<br />
sämtliche Liner und Schächte mit einer ableitfähigen<br />
Beschichtung versehen.<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
Für die Schacht- und Kanalsanierung wurde die Firma<br />
Swietelsky-Faber GmbH vom Auftraggeber nach Ausschreibung<br />
der Leistungen beauftragt. Die Abwasserhaltungsmaßnahmen,<br />
Tiefbauarbeiten und Beschichtungsarbeiten<br />
zur Erlangung der elektrischen Ableitfähigkeit wurden<br />
separat über den Auftraggeber vergeben.<br />
So gelang es dem Projektteam aus Auftraggeber, ausführenden<br />
Firmen und den Planern von Isas, alle Arbeiten<br />
fristgerecht fertig zu stellen. Die Ableitfähigkeit wurde<br />
gemessen und gutachterlich bestätigt, alle sanierten<br />
Schächte und Haltungen als dicht nachgewiesen. Aufgrund<br />
des sehr guten Verlaufs wurde die Sanierung bereits während<br />
der Bauphase auf sieben bisher im Sanierungsplan<br />
nicht vorgesehene Haltungen ausgedehnt. Bis Juni 2014<br />
werden weitere vier Haltungen mit der beschriebenen<br />
Sanierungslösung saniert.<br />
KONTAKT: ISAS GmbH, Füssen, Tel. +49 8362-91660<br />
E-Mail: info@kanalsanierung.com, www.kanalsanierung.com<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45128 Essen<br />
06 | 2014 89
Verbindung Titel.indd 1 09.01.14 11:09<br />
SERVICES BUCHBESPRECHUNG<br />
Fachbuch zu dichter Verbindungstechnik bei enercity vorgestellt<br />
INFOS:<br />
Herausgeber: Harald Krüssmann, 2014<br />
Aufgrund häufiger Leckagen in der Hochdruckeinspritzung<br />
wird in Kraftwerken seit 2008 das<br />
international patentierte ‚System Schlemenat’<br />
eingesetzt. Der Vorteil dieses Systmes ist, dass<br />
Schrauben an der Übertragung von extrem wechselnden<br />
Betriebsbelastungen nicht mehr beteiligt<br />
sind. Damit konnten Undichtigkeiten und Anlagenstillstand<br />
bisher vollständig ausgeschlossen<br />
werden. Die von enercity seit 2010 im Gemeinschaftskraftwerk<br />
Hannover (GKH) erfolgreich<br />
getestete und eingesetzte kraft- und formschlüssige<br />
Flansch-Verbindungstechnik des Hertener Ingenieurs<br />
Alfred W. Schlemenat ist nun in einem<br />
Fachbuch dargestellt. Das im Essener Fachverlag<br />
PP PUBLICO Publications erschienene Werk<br />
präsentierten der Autor und der Verleger Harald<br />
Krüssmann am 1. April 2014 im GKH der<br />
Fachöffentlichkeit.<br />
Im Anschluss an die Vorstellung der Grundprinzipien<br />
und Einsatzmöglichkeit der „Schlemenat“-<br />
Verbindung vermittelte enercity-Ingenieur Karl<br />
Burmann auch die Erfahrungen im GKH und zeigte<br />
den Fachgästen Bilder vom konkreten Einsatzort<br />
an der Hochdruckeinspritzung im Kraftwerk.<br />
Das nun erschienene Fachbuch zeigt mit seiner<br />
Dokumentation revolutionärer Testergebnisse<br />
und Anwendungsbeispiele, dass es eine komplett<br />
dichte (Flansch-)Verbindung basierend auf klassischen<br />
Dichtungssystemen, entgegen weitläufiger<br />
Meinung, eben doch gibt.<br />
Herausgeber:<br />
Alfred Schlemenat<br />
consysAS -<br />
Verbindungstechnologie<br />
Kraft- und formschlüssige<br />
(Flansch-)<br />
Verbindungstechnik<br />
verspannen –<br />
statt konventionell schrauben<br />
Kraft- und formschlüssige (Flansch-)Verbindungstechnik - Formschlüssig verspannen statt<br />
konventionell schrauben<br />
INFOS:<br />
Alfred Schlemenat, 2014, 88 Seiten mit zahlr. Abbildungen u. Tabellen, Soft Cover € 68, ISBN 3-934736-25-4<br />
PP PUBLICO Publications<br />
In dieser Veröffentlichung wird vertiefend über<br />
eine bereits in nahezu allen Industriebereichen<br />
industriell genutzte lösbare kraft- und formschlüssige<br />
Verbindungstechnologie berichtet,<br />
die infolge eines bisher unerreicht günstigen<br />
Kraftflusses zu kompakten Bauteilen, zu minimalen<br />
Stülpverformungen und somit zu optimalen<br />
Dichtheitsvoraussetzungen sowohl bei<br />
Neuanwendungen als auch durch Umbaumaßnahmen<br />
an vorhandenen Verbindungen, u.a.<br />
zur Beseitigung von Undichtigkeiten bzw. zum<br />
Erreichen von Montagevereinfachungen führt.<br />
Unabhängig vom Ø der Verbindung und der Betriebszeit<br />
werden höchste<br />
Belastungen (Druck, Temperatur, Kräfte, Momente)<br />
dauerhaft und sicher übertragen.<br />
Höre! Rede! Siege! Leitfaden für erfolgreiches Verhandeln<br />
INFOS:<br />
Ulrike Manhart, 2014, 288 Seiten, Soft Cover € 19,90, Linde Verlag, ISBN 978-3-7093-0542-3<br />
Sich vom Gesprächspartner nicht verstanden zu<br />
fühlen, in Verhandlungen die besseren Argumente<br />
zu haben und sich dennoch nicht durchzusetzen,<br />
in Gesprächen über den Tisch gezogen zu werden<br />
– all das muss nicht sein! Ulrike Manhart stellt in<br />
ihrem Buch zahlreiche Techniken und Taktiken vor,<br />
wie man sein Gegenüber von seinen Ansichten<br />
überzeugt und Verhandlungen erfolgreich führt.<br />
Auch wenn man die gleiche Sprache spricht, erzielen<br />
Worte beim Gesprächspartner oft nicht den<br />
gewünschten Erfolg und man redet aneinander<br />
vorbei. Wer Gespräche und Verhandlungen erfolgreich<br />
führen will, muss sich verschiedene Verhandlungstaktiken<br />
zu Nutze machen und sollte<br />
über die Kniffe und Tricks gelungener Verhandlungsführung<br />
Bescheid wissen. Neben den theoretischen<br />
Grundlagen zu Verhandlungsführung,<br />
Einflussnahme, Fragetechniken und Gesprächsstrategien<br />
vermittelt dieses Buch zudem, wie man<br />
Reden unter Einsatz aller rhetorischer Stilmittel<br />
wirkungsvoll gestalten kann, um Botschaften in<br />
den Köpfen der Zuhörer nachhaltig zu verankern<br />
und das Publikum mit Worten zu berühren und zu<br />
begeistern.<br />
90 06 | 2014
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFEND<br />
Grundlagenschulungen<br />
Stecken, Pressen und Klemmen von<br />
Kunststoffrohren<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Baustellenabsicherung und<br />
Verkehrssicherung – RSA/ZTV-SA – 1 Tag<br />
02.10.2014 Augsburg<br />
Baustellenabsicherung und<br />
Verkehrssicherung – RSA/ZTV-SA – 2 Tage<br />
10./11.11.2014 Hannover<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Praxis der Tiefbauarbeiten bei<br />
Leitungsverlegungen – DIN 4124/ZTV A-StB,<br />
2012<br />
21./22.10.2014 Hannover<br />
Arbeitsvorbereitung und Kostenkontrolle im<br />
Rohrleitungsbau<br />
28.10.2014 Hannover<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren –<br />
Weiterbildungsveranstaltung nach GW 329<br />
09.12.2014 Kassel<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen<br />
21.10.2014 Leipzig<br />
20.11.2014 Hannover<br />
GAS/WASSER<br />
Grundlagenschulungen<br />
Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
25.08.2014 – 20.03.2015 Köln<br />
Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
25.08.2014 – 20.03.2015 Berlin, Dresden,<br />
Köln<br />
Zusatzqualifikation Netzingenieur/in –<br />
Modul Wasser<br />
15.09.–17.10.2014 Steinfurt und<br />
Oldenburg<br />
Vermessungsarbeiten an Gas- und<br />
Wasserrohrnetzen nach DVGW Hinweis GW<br />
128 – Grundkurs<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Vermessungsarbeiten an Gas- und<br />
Wasserrohrnetzen nach DVGW Hinweis GW<br />
128 – Nachschulung<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von<br />
Versorgungsleitungen – Schulung nach GW<br />
129/S129 – 3 Jahre Gültigkeit<br />
08.08.2014 Rostock<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
17 Termine ab 02.06.2014 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerungskurs<br />
42 Termine ab 02.06.2014 bundesweit<br />
Fachkraft für die Instandsetzung<br />
von Trinkwasserbehältern – DVGW-<br />
Arbeitsblätter W 316-2<br />
22.-26.09.2014 Frankfurt/Main<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Sachkundiger Gas bis 5 bar<br />
14.10.2014 Leipzig<br />
25.11.2014 Münster<br />
Sachkundiger Wasser<br />
15.10.2014 Leipzig<br />
26.11.2014 Münster<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500 Kap.<br />
2.31<br />
11.11.2014 Bad Zwischenahn<br />
Bau von Gas- und Wasserohrleitungen<br />
28./29.10.2014 Paderborn<br />
Bau von Wasserohrleitungen<br />
25./26.11.2014 Herzogenaurach<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
12./13.11.2014 Bad Zwischenahn<br />
Bau von Gasrohrnetzen über 16 bar<br />
09./10.12.2014 Köln<br />
Grabenlose Bauweisen – anerkannte<br />
Fortbildung nach GW 302-R2/GW 320-1<br />
12.11.2014 Berlin<br />
Reinigung und Desinfektion von<br />
Wasserverteilungsanlagen<br />
29.10.2014 Hannover<br />
18.11.2014 Frankfurt/Main<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301<br />
– Qualitätsanforderungen für<br />
Rohrleitungsbauunternehmen<br />
07.10.2014 Augsburg<br />
Praxisseminare<br />
DVS 2202-1 Beurteilung von<br />
Kunststoffschweißverbindungen<br />
05.11.2014 Leipzig<br />
Fachaufsicht <strong>Korrosionsschutz</strong> für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
04.11.2014 Frankfurt/Main<br />
11.12.2014 Bad Zwischenahn<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331 inkl. DVS-<br />
Abschluss 2212-1<br />
23./24.10.2014 Dortmund<br />
27./28.11.2014 Dortmund<br />
Druckprüfung von Gas- und Wasserleitungen<br />
21./22.10.2014 Essen<br />
Druckprüfung von Gasrohrleitungen<br />
02.12.2014 Hannover<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
03.12.2014 Hannover<br />
FERNWÄRME<br />
Grundlagenschulungen<br />
Geprüfter Netzmeister Fernwärme –<br />
Blocklehrgang<br />
Sept. 2014 – März 2015<br />
Hamburg, Gera,<br />
Nürnberg<br />
Muffenmonteur im Fernwärmeleitungsbau,<br />
geprüft nach AGFW FW 603 – Verlängerung<br />
ganzjährig<br />
Halle, Hamburg<br />
92 06 | 2014
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
Informationsveranstaltungen<br />
20.11.2014 Hannover<br />
22.09.2014 Bayreuth<br />
Bau und Sanierung von Nah- und<br />
Fernwärmeleitungen<br />
22./23.10.2014 Würzburg<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
02.12.2014 Kerpen<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter Fernwärme<br />
10.-14.11.2014 Kerpen<br />
Technische Grundlagen der Nah- und<br />
Fernwärme<br />
02.-07.11.2014 Weimar<br />
Qualifikationen im Fernwärmeleitungsbau<br />
18.11.2014 Hannover<br />
Rohrstatische Auslegung von<br />
Kunststoffmantelrohren<br />
04./05.11.2014 Hamburg<br />
Planung und Bau von Fernwärmeversorgung<br />
mit Dampf<br />
21.11.2014 Hannover<br />
Mantelrohrsysteme im<br />
Fernwärmeleitungsbau<br />
16./17.09.2014 Hamburg<br />
Schweißen und Prüfen von<br />
Fernwärmeleitungen – FW 446<br />
19.11.2014 Hannover<br />
Stahlmantelrohre im Fernwärmeleitungsbau<br />
ABWASSER<br />
Grundlagenschulungen<br />
Dichtheitsprüfung von<br />
Entwässerungsanlagen außerhalb von<br />
Gebäuden<br />
08.-12.09.2014 Soltau<br />
Sachkunde Dichtheitsprüfung von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen -<br />
Neueinsteigerkurs<br />
22.-26.09.2014 Dresden<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen<br />
und –kanälen, Arbeitsblatt DWA-A139<br />
17.09.2014 Kassel<br />
Explosionsschutz in abwassertechnischen<br />
Anlagen<br />
18.11.2014 Bad Wildungen<br />
Fachkurs für Planer: Einbau und Sanierung<br />
von Schachtabdeckungen<br />
08./09.10.2014 Leipzig<br />
Ki-Seminar für Inspekteure –<br />
Schachtinspektionen<br />
23.09.2014 Bayreuth<br />
Ki-Seminar für Inspekteure von sanierten<br />
Kanälen<br />
Ki-Seminar für Ingenieure: Durchführung<br />
und Beurteilungen von Kanalinspektionen<br />
06./07.11.2014 Leipzig<br />
INDUSTRIEROHRLEITUNGSBAU<br />
Grundlagenschulungen<br />
Kunststoffschweißer nach DVS 2281 mit<br />
Prüfung nach DVS 2212-1<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Wiederholungsprüfungen nach DVS 2212-1<br />
(Prüfgruppe I)<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Kunststoffschweißer nach DVS 2282 mit<br />
Prüfung nach DVS 2212-1 (Prüfgruppe II)<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Wiederholungsprüfungen nach DVS 2212-1<br />
(Prüfgruppe II)<br />
ganzjährig<br />
Seminare<br />
GWI Essen<br />
bundesweit<br />
Arbeiten an Gasleitungen bei<br />
unkontrollierter Gasausströmung - Schulung<br />
nach BGR 500 (BGV A1/BGI 560)<br />
28.08.2014 Essen<br />
09.12.2014 Essen<br />
KONTAKTADRESSEN<br />
brbv - Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
Kurt Rhode, Tel. 0221/37668-44, Fax 0221/37668-62,<br />
E-Mail: rhode@brbv.de, www.brbv.de<br />
TAE - Technische Akademie Esslingen<br />
Heike Baier, Tel. 0711/34008-23, Fax 0711/34008-27,<br />
Heike.Baier@tae.de, www.tae.de<br />
GWI - Gas- und Wärmeinstitut Essen e.V.,<br />
Barbara Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146, E-Mail: hohnhorst@gwi-essen.de, www.gwi-essen.de<br />
TAH - Technische Akademie Hannover<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30, Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
HdT - Haus der Technik<br />
Essen, Tel. 0201/1803-1, E-Mail: hdt@hdt-essen.de,<br />
www.hdt-essen.de<br />
TAW - Technische Akademie Wuppertal<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
SAG-Akademie<br />
Anja Kratt, Tel. 06151/10155-111, Fax 06151/10155-155, Kratt@SAG-<br />
Akademie.de, www.SAG-Akademie.de<br />
RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.,<br />
Tel.: 05963/9810877, Fax 05963/9810878, rsv-ev@t-online.de,<br />
www.rsv-ev.de<br />
06 | 2014 93
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
Grundlagen der Gas-Druckregelung<br />
09./10.09.2014 Essen<br />
Erfahrungsaustausch und Weiterbildung der<br />
Sachkundigen für Odorieranlagen<br />
11.-12.09.2014 Essen<br />
Weiterbildung der Sachkundigen gemäß<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 685<br />
15./16.09.2014 Essen<br />
11./12.12.2014 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gas-Druckregel- und<br />
-Messanlagen im Netzbetrieb und in der<br />
Industrie<br />
15.-17.09.2014 Essen<br />
08.-10.12.2014 Essen<br />
Arbeiten an freiverlegten Gasrohrleitungen<br />
auf Werksgelände und im Bereich<br />
17.09.2014 Essen<br />
Sicherheitstraining bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen –<br />
BALSibau - GW 129<br />
14.11.2014 Essen<br />
12.12.2014 Essen<br />
Einführung in die Gasabrechnung<br />
10.12.2014 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gasabrechnung<br />
gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685<br />
19./21.11.2014 Essen<br />
Auslegung und Dimensionierung von Gas-<br />
Druckregelanlagen<br />
29./30.10.2014 Essen<br />
Grundlagen, Praxis und Fachkunde von Gas-<br />
Druckregelanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 491, G 495 und G 459-2<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Seminare<br />
HDT<br />
Planung und Auslegung von Rohrleitungen<br />
04./05.09.2014 Essen<br />
02./03.12.2014 Essen<br />
Rohrleitungen nach EN 13480 - Allgemeine<br />
Anforderungen, Werkstoffe, Fertigung und<br />
Prüfung<br />
17.09.2014 Bremerhaven<br />
Sicherheit beim Bau und Betrieb<br />
hochspannungsbeeinflusster Pipeline-Netze<br />
18.09.2014 Berlin<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
22./23.09.2014 Kochel<br />
05./06.11.2014 Karlstein<br />
01./02.12.2014 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und<br />
technischem Personal für Klärgas- und<br />
Biogasanlagen<br />
18./19.09.2014 Essen<br />
Gas-Druckregel- und Messanlagen –<br />
Praxisseminar<br />
29./30.09.2014 Essen<br />
Praxis der Gastechnik für Nichttechniker und<br />
spartenfremde Mitarbeiter<br />
09./10.12.2014 Essen<br />
Instandhaltung von Gasleitungen aus<br />
Stahlrohren größer 5 bar gem. G 466-1<br />
21./22.10.2014 Essen<br />
Gasspüren und<br />
Gaskonzentrationsmessungen<br />
27./28.10.2014 Essen<br />
Organisation des Betriebs und Fachkunde<br />
für Erdgasanlagen auf Werksgelände und im<br />
Bereich industrieller Gasverwendung<br />
05./06.11.2014 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und<br />
technischen Führungskräften im Bereich von<br />
Gas-Druckregel- und –Messanlagen<br />
27./28.10.2014 Essen<br />
Projektierung, Prüfung, Dokumentationen<br />
und Abnahmen von Gas-Druckregelanlagen<br />
bis 5 bar für Sachkundige und<br />
Anlagenplaner<br />
24./25.11.2014 Essen<br />
Einstellungen, Normalbetrieb<br />
und Störungsbeseitigung an Gas-<br />
Druckregelanlagen .<br />
03./04.11.2014 Essen<br />
Praxis der Prüfung von Gas-Messanlagen<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt G 492<br />
03./04.09.2014 Essen<br />
Sachkundigenschulung - Druckbehälter<br />
und Durchleitungsdruckbehälter einschl.<br />
Erdgas-Vorwärmanlagen nach DVGW-<br />
Arbeitsblättern 498 und G 499<br />
25./26.11.2014 Essen<br />
Verfahren zur Montage und Demontage von<br />
Dichtverbindungen an Rohrleitungen und<br />
Apparaten<br />
29.09.2014 Essen<br />
25.11.2014 Berlin<br />
Dichtungen - Schrauben - Flansche<br />
30.09.2014 Essen<br />
26.11.2014 Berlin<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
23.10.2014 Essen<br />
Instandhaltung von Rohrleitungen<br />
10./11.11..2014 Essen<br />
Kraftwerkstechnik- Basiswissen und<br />
Komponenten<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Arbeitsschutz im Rohrleitungsbau<br />
13.11..2014 Essen<br />
Arbeitsschutz im Rohrleitungsbau<br />
13.11..2014 Essen<br />
Sachkundige für Odorieranlagen – DVGW<br />
G 280<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Druckbehälter und<br />
Durchleitungsdruckbehälter Praxis-<br />
Vertiefungsseminar/Weiterbildung der<br />
Sachkundigen nach G 498<br />
15./16.12.2014 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
18./19.11.2014 Essen<br />
Forum Molchtechnik<br />
27./28.11.2014 Essen<br />
94 06 | 2014
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
Rohrleitungen nach EN 13480 - Allgemeine<br />
Anforderungen, Werkstoffe, Fertigung und<br />
Prüfung<br />
09./10.12.2014 München<br />
Workhops<br />
IKT<br />
Betriebsführungssysteme Kanaldatenbanken<br />
30.07.2014 Stuttgart<br />
Kanalreparatur in Theorie und Praxis<br />
21./22.10.2014 Gelsenkirchen<br />
Rückstau, Hydraulik, Überflutung,<br />
Regenrückhaltung<br />
19./20.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Bedarfsorientierte Kanalreinigung<br />
25./26.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Seminare<br />
Neue DIN 1986-30<br />
13./14.08.2014 Gelsenkirchen<br />
DIN EN 1610<br />
15./16.10.2014 Gelsenkirchen<br />
Umgang mit Dränagewasser von privaten<br />
Grundstücken<br />
11./12.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Kanalreinigung nach DIN<br />
27.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Kanal- und Leitungsbau<br />
17./18.12.2014 Gelsenkirchen<br />
Lehrgänge<br />
Zertifizierter Berater<br />
Grundstücksentwässerung<br />
27.-29.08.2014 Gelsenkirchen<br />
04.-12.12.2014 Gelsenkirchen<br />
Kanalbetrieb<br />
28.-30.10.2014 Gelsenkirchen<br />
Workshop<br />
iro<br />
Qualitätssicherung bei<br />
Gashochdruckleitungen<br />
02.-04.12.2014 Dresden<br />
RSV<br />
ZKS ZERTIFIZIERTER KANALSANIERUNGSBE-<br />
RATER - Lehrgänge<br />
Modulare Schulung 2014<br />
Hamburg/Kiel<br />
06.10. – 11.10.2014 Hamburg<br />
10.11. – 15.11.2014 Hamburg<br />
24.11. – 28.11.2014 Hamburg<br />
08.12. – 13.12.2014 Kiel<br />
SAG<br />
Grundkurs Kanalinspektion für Inspekteure<br />
nach europäischer Norm<br />
25.08.2014 Kiel<br />
06.10.2014 Darmstadt<br />
10.11.2014 Lauingen<br />
24.11.2014 Lünen<br />
01.12.2014 Kiel<br />
19.01.2015 Darmstadt<br />
16.02.2015 Kiel<br />
23.02.2015 Lauingen<br />
02.03.2015 Lünen<br />
06.04.2015 Darmstadt<br />
18.05.2015 Kiel<br />
08.06.2015 Lauingen<br />
06.07.2015 Darmstadt<br />
17.08.2015 Lünen<br />
21.09.2015 Kiel<br />
05.10.2015 Darmstadt<br />
23.11.2015 Lauingen<br />
14.12.2015 Lünen<br />
Grundlagen der Kanalsanierung privater<br />
Abwasserleitungen, Bewertung von<br />
Schadensbildern mit Zustandsklassifizierung<br />
10.09.2014 Lünen<br />
08.12.2014 Darmstadt<br />
07.01.2015 Lünen<br />
09.02.2015 Kiel<br />
23.03.2015 Darmstadt<br />
17.06.2015 Lauingen<br />
20.07.2015 Lünen<br />
04.11.2015 Darmstadt<br />
Inspektion von sanierten Kanälen und zur<br />
Abnahme von Bauleistungen (Neubau/<br />
Gewährleistung)<br />
15.09.2014 Wolfseck<br />
01.10.2014 Lauingen<br />
11.12.2014 Darmstadt<br />
15.01.2015 Kiel<br />
04.02.2015 Darmstadt<br />
18.03.2015 Lauingen<br />
22.04.2015 Lünen<br />
01.07.2015 Kiel<br />
10.09.2015 Darmstadt<br />
21.10.2015 Lauingen<br />
19.11.2015 Lünen<br />
Rezertifizierung Kanalreinigung für Sachund<br />
Fachkundige zur Zertifikatsverlängerung<br />
16.09.2014 Kiel<br />
26.09.2014 Darmstadt<br />
22.10.2014 Lünen<br />
17.11.2014 Darmstadt<br />
01.12.2014 Lauingen<br />
17.12.2014 Lünen<br />
19.01.2015 Kiel<br />
24.02.2015 Darmstadt<br />
10.06.2015 Lünen<br />
Kanalsanierung und Sanierungsplanung<br />
privater Abwasserleitungen mit<br />
Zustandsbeurteilung<br />
10.09.2014 Lünen<br />
08.12.2014 Darmstadt<br />
Aufbaukurs Zustandsbewertung nach<br />
DWA-M 149-3<br />
12.09.2014 Lünen<br />
10.12.2014 Darmstadt<br />
Grundlagen Kanalreinigung<br />
23.09.2014 Lauingen<br />
16.12.2014 Lünen<br />
23.02.2015 Darmstadt<br />
08.06.2015 Lünen<br />
15.09.2015 Darmstadt<br />
08.12.2015 Lünen<br />
Fahrzeug- und Gerätetechnik im Bereich<br />
Kanalreinigung<br />
25.09.2014 Darmstadt<br />
18.12.2014 Lünen<br />
06 | 2014 95
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
25.02.2015 Darmstadt<br />
10.06.2015 Lünen<br />
17.09.2015 Darmstadt<br />
10.12.2015 Lünen<br />
Hochspannungsbeeinflussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
28.01.2015 Ostfildern<br />
Aufbaukurs:<br />
17.09.2014 Berlin<br />
24.09.2014 Stuttgart<br />
Grundlagen der Inspektion von<br />
Grundstücksentwässerungsleitungengen<br />
nach europäischer Norm<br />
08.10.2014 Darmstadt<br />
06.04.2015 Darmstadt<br />
18.05.2015 Kiel<br />
08.06.2015 Lauingen<br />
05.10.2015 Darmstadt<br />
Seminare<br />
TAE<br />
Instandsetzen von Abwasserkanälen und<br />
–bauwerken<br />
05./06.11.2014 Ostfildern<br />
Seminare<br />
TAH<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater 2014<br />
ab 15.09.2014<br />
Heidelberg<br />
ab 13.10.2014<br />
Weimar<br />
Schlauchliner-Workshop<br />
08.10.2014 München<br />
09.10.2014 Stuttgart<br />
26.11.2014 Mainz<br />
Kanalnetzberechnung I und II<br />
Grundkurs:<br />
16.09.2014 Berlin<br />
23.09.2014 Stuttgart<br />
Seminare<br />
TAW<br />
Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong> (KKS)<br />
unterirdischer Anlagen: Messtechnisches<br />
Praktikum<br />
23.-26.09.2014 Bochum<br />
KKS-Seminar für Fortgeschrittene - Teil 1<br />
24.-26.11.2014 Wuppertal<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
DENSO GmbH, Leverkusen 9<br />
Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG, Herten 3<br />
G.A. Kettner GmbH, Villmar 5<br />
Korupp GmbH Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong>, Twist 59<br />
Martin GmbH Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong>, Hattingen 57<br />
RBS Wave GmbH, Stuttgart 65<br />
Rössing & Bornemann KG, Nordhorn 7<br />
SebaKMT, Baunach 15<br />
Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh 11<br />
Steffel KKS GmbH, Lachendorf<br />
4. Umschlagseite<br />
Waldemar Suckut VDI, Celle 75<br />
Vitalis KKS & Elektrotechnik Service GmbH, Meppen 19<br />
Weilekes Elektronik GmbH, Gelsenkirchen<br />
Titelseite<br />
Marktübersicht 97 - 103<br />
96 06 | 2014
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
06 | 2014<br />
MARKTÜBERSICHT<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ<br />
Fordern Sie Ihre Bestellunterlagen an unter:<br />
Tel.: 0201 82 002-35 oder h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
04-05| 2014 97
Marktübersicht<br />
MARKTÜBERSICHT<br />
rohre + koMponenten<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Anbohrarmaturen<br />
Armaturen<br />
Rohre<br />
Rohrdurchführungen<br />
Schutzmantelrohre<br />
Formstücke<br />
Dichtungen<br />
Kunststoff<br />
Ihr „Draht“<br />
zur Anzeigenabteilung<br />
von <strong>3R</strong><br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201-82002-35<br />
Fax 0201-82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
98 04-05| 2014
Maschinen & Geräte / <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
Kathodischer<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Horizontalbohrtechnik<br />
04-05| 2014 99
Marktübersicht MARKTÜBERSICHT <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Kathodischer<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
100 04-05| 2014
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
marktübersicht<br />
<strong>Korrosionsschutz</strong><br />
Ihr „Draht“<br />
zur Anzeigenabteilung<br />
von <strong>3R</strong><br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201-82002-35<br />
Fax 0201-82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
04-05| 2014 101
Marktübersicht<br />
MARKTÜBERSICHT<br />
sanierunG / institute + Verbände<br />
Sanierung<br />
Institute<br />
Verbände<br />
Sanierung<br />
Ihr „Draht“<br />
zur Anzeigenabteilung<br />
von <strong>3R</strong><br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201-82002-35<br />
Fax 0201-82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
102 04-05| 2014
institute + Verbände<br />
marktübersicht<br />
04-05| 2014 103
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Sanierung, des grabenlosen Leitungsbaus, der Pipelinetechnik<br />
und des <strong>Korrosionsschutz</strong>es.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
25% ersten Bezugsjahr<br />
Rabatt im<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen und im ersten Bezugsjahr 25 % sparen.<br />
Bitte schicken Sie mir das Fachmagazin für zunächst ein Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 210,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 210,-<br />
als Heft + ePaper für € 297,-<br />
inkl. Versand (Deutschland) / € 301,- (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 105,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 105,-<br />
als Heft + ePaper für € 160,50 inkl. Versand<br />
(Deutschland) / € 164,50 (Ausland).<br />
Alle Preise sind Jahrespreise und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen<br />
vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug zu regulären Konditionen um ein Jahr.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden,<br />
dass ich vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-0, Fax -40<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-33, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Simon Meyer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-32, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: s.meyer@vulkan-verlag.de<br />
Barbara Pflamm, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-28, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-66, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer,<br />
Vulkan-Verlag/DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Telefon +49 89-203 53 66-16, Fax +49 89-203 53 66-66,<br />
E-Mail: mittermayer@di-verlag.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong>,<br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg,<br />
Telefon +49 931-4170-459, Fax +49 931-4170-494,<br />
E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Herstellung<br />
Dipl.-Des. Nilofar Mokhtarzada, Vulkan-Verlag GmbH<br />
E-Mail: n.mokhtarzada@vulkan-verlag.de<br />
Druck<br />
Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September<br />
Bezugspreise:<br />
Abonnement (Deutschland): € 304,-<br />
Abonnement (Ausland): € 308,-<br />
Einzelheft (Deutschland): € 43,-<br />
Einzelheft (Ausland): € 43,50<br />
Einzelheft als ePaper: € 40,-<br />
Jahresabonnement Print und ePaper (Deutschland): € 388,-<br />
Jahresabonnement Print und ePaper (Ausland): € 392,-<br />
Studenten: 50 % Ermäßigung auf den Heftbezugspreis gegen<br />
Nachweis<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für alle übrigen Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede Buchhandlung<br />
möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen<br />
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des<br />
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Auch die Rechte<br />
der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung, im Magnettonverfahren<br />
oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung<br />
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der<br />
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung<br />
der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer <strong>Korrosionsschutz</strong><br />
e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V., Köln · Rohrleitungsbauverband<br />
e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband e.V., Essen<br />
· Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten, Gasmeßund<br />
Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld, Vorsitzender<br />
des Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-Gesellschaft<br />
Verfahrenstechnik und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) Dipl.-Volksw.<br />
H. Zech, Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes e.V., Lingen<br />
(Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln Rechtsanwalt<br />
C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing. Th. Grage,<br />
Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen Dr.-Ing. A. Hilgenstock,<br />
E.ON New Build & Technology GmbH, Gelsen kirchen (Gastechnologie<br />
und Handelsunterstützung) Dipl.-Ing. D. Homann, IKT Institut für<br />
Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen · Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-<br />
Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, Westnetz, Dortmund · Dipl.-Ing.<br />
J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe<br />
GmbH, Mülheim · J. Roloff, TÜV SÜD, Köln · Dr. rer. nat. J. Sebastian,<br />
Geschäftsführer der SBKS GmbH & Co. KG, St. Wendel · Dr. H.-C. Sorge,<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim ·<br />
Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter des<br />
IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen · W. Burchard,<br />
Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im VDMA, Frankfurt · Bauassessor<br />
Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Köln ·<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren ·<br />
Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes<br />
e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn, BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing.<br />
B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure GmbH, München · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff,<br />
Geschäftsführer des Kunststoffrohrverbands e.V., Bonn · Dr.-Ing.<br />
R. Maaß, Mitglied des Vorstandes, FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter-<br />
und Rohrleitungsbau e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve,<br />
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer<br />
der Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · I. Posch,<br />
Geschäftsführerin der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.,<br />
Berlin · Dipl.‐Berging. H. W. Richter, GAWACON, Essen · H. Roloff, Open<br />
Grid Europe GmbH, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer der ARKIL<br />
INPIPE GmbH, Hannover · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener, Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg · Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.<br />
B. Wielage, Technische Universität Chemnitz, Institut für Werkstoffwissenschaft<br />
und Werkstofftechnik · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer Geschäftsführer<br />
der Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
und<br />
sind Unternehmen der