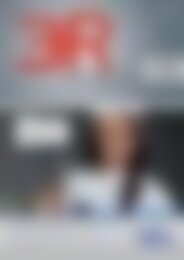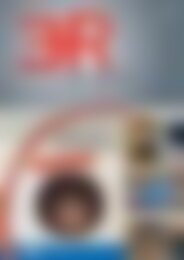3R Wasserversorgung, Abwasserentsorgung (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10-11 | 2014<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:<br />
<strong>Wasserversorgung</strong><br />
<strong>Abwasserentsorgung</strong><br />
Nachhaltig bauen –<br />
Vermögen erhalten<br />
Stadtentwässerungsbetrieb<br />
Düsseldorf setzt auf<br />
Gütesicherung<br />
Kanalbau<br />
RAL-GZ 961<br />
Dr. Claus Henning Rolfs<br />
Techn. Leiter Stadtentwässerungsbetrieb<br />
www.kanalbau.com<br />
neutral – fair – zuverlässig<br />
Gütesicherung Kanalbau steht<br />
für eine objektive Bewertung<br />
nach einheitlichem Maßstab
4. Praxistag am 05. November 2014 in Rheine<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>snetze<br />
NEU<br />
Begleitende<br />
Ausstellung und<br />
Vorführungen<br />
Programm<br />
Moderation: Dr. Hans-Christian Sorge,<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für<br />
Wasser, Mülheim an der Ruhr<br />
Block 1: Netzbetrieb - Analysieren und Optimieren<br />
Optimale Fahrweise von Pumpen und Turbinen<br />
Dr. Gebhardt, aquatune, Aarbergen; Dr. Wolters, 3S Consult, München<br />
Rahmenbedingungen einer Zielnetzplanung<br />
Dr. Esad Osmancevic, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
ISO 55 000 – Der Standard für das Asset Management<br />
Mike Beck, Fichtner Water & Transportation GmbH, Berlin<br />
Block 2: Strategien zur Netzspülung<br />
Reinigung einer Rohwasserleitung mit dem<br />
Impulsspülverfahren<br />
Carsten Utke, Berliner Wasserbetriebe, Berlin<br />
Auswahlkriterien für Spül- und Reinigungsverfahren<br />
Dominik Nottarp-Heim, Hessenwasser, Groß-Gerau;<br />
Dr. Christian Sorge, IWW, Biebesheim am Rhein<br />
Block 3: Armaturenwechsel und -instandhaltung<br />
Wechsel von Anbohrarmaturen bei Betriebsdruck<br />
Steffen Geldmacher, Plasson GmbH, Wesel<br />
Im Fokus: Armatureninstandhaltung<br />
Axel Sacharowitz, 3S Antriebe, Berlin<br />
Block 4: Druckprüfung von Rohrleitungen<br />
Fehlerhafte Druckprüfungen bei Wasserleitungen<br />
René Stangl, Hamm<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 Druckprüfung von neu verlegten<br />
Rohrleitungen - Grundlagen, Verfahren, Anforderungen<br />
Bernd Nienhaus, Esders GmbH, Haselünne<br />
Block 5: Netzbetrieb - Überwachung<br />
Leckortung im Trinkwasserrohrnetz mittels Korrelation –<br />
Schallgeschwindigkeit als eine mögliche Fehlerquelle<br />
Dirk Becker, Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh<br />
Online Netzüberwachungssysteme zur Versorgungssicherheit<br />
Stefan Neuhorn, Hinni AG, Biel-Benken (CH)<br />
Erhöhte Rohrleitungsschwingungen in einem Wasserwerk<br />
Dr. Christian Jansen, KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG<br />
Wann und Wo?<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, iro<br />
Termin: Mittwoch, 05.11.2014,<br />
9:00 Uhr – 16:45 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Rheine<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken<br />
und <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen,<br />
Dienstleister im Bereich<br />
Netzplanung, -inspektion und<br />
-wartung<br />
Teilnahmegebühr*:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und iro-Mitglieder: 410,- €<br />
Nichtabonnenten: 450,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen<br />
wird ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen<br />
Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen<br />
sowie das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet<br />
möglich) sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine<br />
schriftliche Bestätigung sowie die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn<br />
zu begleichen ist. Bei Absagen nach dem 24.<br />
Oktober 2014 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise<br />
verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin iro-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein iro-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
Investieren oder sparen –<br />
geht auch beides?<br />
Verfolgt man derzeit die internationale Presse, so scheint<br />
den Deutschen etwas abhanden gekommen zu sein: die<br />
Fähigkeit, Geld auszugeben. Stoisch hockt unser Finanzminister<br />
auf seiner Geldtruhe, die schwarze Null fest im<br />
Blick. Die Forderungen anderer europäischer Länder,<br />
Deutschland möge seine Sparpolitik aufgeben und deutlich<br />
investieren, werden zwar gehört, aber bislang führten<br />
sie zu keiner Änderung der haushaltspolitischen Grundausrichtung<br />
der Bundesregierung – man bleibt eisern.<br />
Ein Konjunkturprogramm wie die seinerzeit initiierte<br />
„Abwrackprämie“ steht nicht an. Aufgabenfelder gäbe es<br />
reichlich, angefangen von der viel besprochenen Energiewende<br />
über den Erhalt unserer Infrastruktur bis hin zum<br />
Ausbau eines modernen, auf Glasfaserkabel basierenden<br />
Kommunikationsnetzes.<br />
Investieren und gleichzeitig Geld sparen muss kein<br />
Gegensatz sein. Dass beides möglich ist, wird auf dem<br />
„4. Praxistag <strong>Wasserversorgung</strong>snetze“ deutlich. Die Veranstaltung<br />
findet am 5. November 2014 in Rheine statt<br />
und wird von der <strong>3R</strong> und dem Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V. ausgerichtet.<br />
Behandelt werden Fragen rund um die Erneuerung und<br />
Anpassung von <strong>Wasserversorgung</strong>snetzen, über neueste<br />
Verfahren und Erkenntnisse zur Wasserverlustmessung,<br />
zur Spülung von Rohrleitungen und zur Instandhaltung<br />
von Armaturen. Interessant werden ebenso die Ausführungen<br />
über eine optimale Fahrweise von Pumpen und<br />
Turbinen, die dazu beitragen soll, die Energiekosten von<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen deutlich zu senken. Die<br />
Fachbeiträge in dieser Ausgabe widmen sich ab Seite 26<br />
diesen Themen.<br />
Nico Hülsdau<br />
Chefredakteur<br />
10-11 | 2014 1
INHALT<br />
HAUPTTHEMEN<br />
48 Volldampf voraus – Sanierung mit Close-Fit-Lining 44 Rohr frei – Kriterien für Spüll- und Reinigungsmaßnahmen<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
26 Leckortung im Trinkwasserrohrnetz mittels Korrelation –<br />
Schallgeschwindigkeit als eine mögliche Fehlerquelle<br />
Dirk Becker<br />
33 Lastverschiebungspotenziale in der <strong>Wasserversorgung</strong><br />
Fabian Janotte, Dr. Gerald Gangl, Simeon Siegele<br />
38 Rahmenbedingungen einer Ziel-Netzplanung<br />
Dr. Esad Osmancevic<br />
44 Auswahlkriterien für Spül- und Reinigungs maßnahmen in Trinkwasserleitungen<br />
Dr. Hans-Christian Sorge, Dominik Nottarp-Heim<br />
48 Wertvoller Baumbestand bewahrt – Trinkwasserleitung mit Close-Fit-Lining erneuert<br />
49 Sanierung beendet enormen Wasserverlust in Nordspaniens wichtigster Wasserleitung<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
50 GFK-Kanalsanierung unter Fahrrad-Highway<br />
52 Flughafen Düsseldorf startet mit neuer Regenwasserbehandlung in Richtung Zukunft<br />
54 Wirtschaftliche Alternative für die Regenwasserbehandlung von Straßenabflüssen<br />
56 CoJack erreicht Halbzeit bei Europas größtem Abwasserkanal<br />
57 PE für schnelle und sichere Sanierung<br />
1 Editorial<br />
Investieren oder sparen –<br />
geht auch beides?<br />
2 10-11 | 2014
Kompetenz, die<br />
verbindet<br />
53 Neue Wege bei der Regenwasserbehandlung am<br />
Flughafen Düsseldorf<br />
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
17 Neue Plombierschellen von Kettner<br />
18 Infrastruktur-Software für den<br />
Rohrleitungsbau<br />
18 Schnelle Verbindung von Gas- und<br />
Trinkwasserrohrleitungen<br />
19 Multikorrelator für präzise Leckageortung<br />
19 Lösungen für Nah- und Fernwärme<br />
20 RD Marker-Suchsysteme<br />
20 Curaflex Nova ® Senso Produkt des Jahres<br />
21 MGC – smarte Netzdatenauskunft und mehr<br />
RECHT & REGELWERK<br />
22 DVGW-Regelwerk / DWA-Regelwerk /<br />
DIN-Regelwerk<br />
4. TÜV NORD<br />
Pipelinesymposium<br />
5. und 6. Mai 2015 · Hamburg<br />
www.tuev-nord.de/pipeline-symposium<br />
TÜV NORD begleitet Sie<br />
über den gesamten Lebenszyklus<br />
Ihrer Pipelines<br />
Planung und Konstruktion<br />
Fertigung, Montage und Inbetriebnahme<br />
Betriebsbegleitung<br />
Rückbau und Stilllegung<br />
Ihr Nutzen:<br />
Einhaltung hoher Sicherheitsstandards<br />
Reduzierung von Betriebsstörungen<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
Reduzierung der Ausfall- und<br />
Reparaturkosten<br />
Kontakt: pipeline@tuev-nord.de<br />
www.tuev-nord.de<br />
10-11 | 2014 3
INHALT<br />
NACHRICHTEN<br />
8 Der Güteschutz Kanalbau stellt neu überarbeiteten Leitfaden vor 15 Heiß: Fern- und Nahwärmenetze auf dem 29.<br />
Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
5 Stellantriebshersteller feierte 50-jähriges<br />
Jubiläum<br />
6 6.580 Armaturen für Kraftwerk in Indien<br />
6 Neue Möglichkeiten zur Rohrextrusion<br />
am SKZ<br />
7 Einigung auf temperaturabhängig feste<br />
Transportkapazitäten für Speicher Haidach<br />
VERBÄNDE<br />
8 Arbeitshilfe zur optischen Abnahmeprüfung<br />
PERSONALIEN<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
10 IKT-Praxistage und International Conference<br />
10 ExpertenForum Fernwärme 2015<br />
11 „Grabenlose Technik, die begeistert“<br />
11 Botschaftertag von Wasser Berlin International<br />
12 Goldener Kanaldeckel verliehen<br />
13 Netzbetreiber im Zukunfts-Workshop<br />
13 3. Fachtagung „Schwerer Korrosionsschutz“<br />
14 29. Oldenburger Rohrleitungsforum 2015<br />
16 Der Einfluss von Korrosion auf die Bewertung<br />
des Anlagenzustands von Versorgungssystemen<br />
9 Neue Technische Leitung bei MC-Bauchemie<br />
9 Neuer Vizepräsident für Forschung und<br />
Technologietransfer an der Jade Hochschule<br />
SERVICES<br />
10 Messen | Tagungen<br />
58 Buchbesprechung<br />
60 Seminare<br />
63 Inserentenverzeichnis<br />
65 Marktübersicht<br />
73 Impressum<br />
4 10-11 | 2014
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT NACHRICHTEN<br />
Stellantriebshersteller<br />
feierte 50-jähriges Jubiläum<br />
Foto: Auma<br />
Über 400 Kunden und Lieferanten nahmen am feierlichen Festakt<br />
am 12. September teil<br />
Mit fast 7000 Gästen hat der Stellantriebshersteller AUMA<br />
im September 2014 sein 50-jähriges Jubiläum am Firmensitz<br />
im badischen Müllheim gefeiert. An drei Tagen (12.09-<br />
14.09) erlebten Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und deren<br />
Familien ein spannendes Programm mit Fachvorträgen,<br />
Ausstellungen und Unterhaltung.<br />
1964 als Zwei-Mann-Betrieb gegründet hat sich Auma bis<br />
heute zu einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe<br />
mit über 2300 Mitarbeitern entwickelt.<br />
„In 50 Jahren haben wir Fundamente geschaffen, auf die<br />
wir vertrauen und auf denen wir aufbauen können“ erklärte<br />
der kaufmännische Geschäftsführer Matthias Dinse, der<br />
die Zukunft der Unternehmensgruppe positiv sieht. „Wir<br />
wollen unseren internationalen Verbund weiter stärken<br />
und die geschätzte AUMA-Qualität in allen Winkeln der<br />
Erde anbieten.“<br />
Alle 1350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschen<br />
Standorte sowie der Tochterunternehmen GFC, SIPOS,<br />
Haselhofer und DREHMO waren eingeladen, gemeinsam<br />
zu feiern. Mit dabei waren auch Delegationen der über 70<br />
ausländischen AUMA-Gesellschaften und Vertretungen.<br />
Abgerundet wurden die Feierlichkeiten durch einen „Entdecke<br />
AUMA“-Tag, an dem auch Freunde und Verwandte<br />
an einem vielfältigen Programm teilnehmen konnten.<br />
Das Oldenburger Rohrleitungsforum als Treffpunkt<br />
der Wirtschaft und der Wissenschaft, als Marktplatz<br />
von Know-how und dem Neuesten aus der Rohrleitungswelt.<br />
29. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
19./20. Februar 2015<br />
über 3.000 Besucher aus Versorgungswirtschaft,<br />
Behörden, Ingenieurbüros, Bauunternehmen und<br />
Rohr- und Zubehörherstellern<br />
ca. 100 Fachvorträge in fünf parallelen Vortragsveranstaltungen<br />
vermitteln Wissen für die Praxis und<br />
bringen Impulse in die Hochschule<br />
über 350 internationale Aussteller mit dem Neuesten<br />
aus ihren Entwicklungsabteilungen<br />
in den Pausen: Kommunikation pur in den Gängen,<br />
auf dem Gelände und auf den Abendveranstaltungen<br />
Anmeldungen und weitere Informationen:<br />
Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18 / 26121 Oldenburg<br />
Frau Ina Kleist<br />
Tel. 0441 361039-0 / Fax 0441 361039-10<br />
E-mail ina.kleist@iro-online.de / www.iro-online.de<br />
10-11 | 2014 5
NACHRICHTEN INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
KURZ INFORMIERT<br />
∎ Wintershall fördert Öl in Libyen<br />
Seit November 2013 wurde durch Winterschall kein<br />
Öl mehr dort gefördert. Nun rollt die Produktion<br />
wieder an. Eine Tagesproduktion von rund 35.000<br />
Barrel wird angestrebt.<br />
∎ Druckprüfanlage für drei Rohre<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe hat vom Spiralrohrhersteller<br />
PWS eine Hydro Testing Machine in<br />
Betrieb genommen. Mit der Anlage können zeitgleich<br />
bis zu drei Rohre unterschiedlicher Länge auf<br />
drei Prüfständen mit einer Gesamtzyklusdauer von<br />
48 s getestet werden. Zeitersparnis: 30 %.<br />
∎ 20 Jahre MC-Bauchemie Ungarn<br />
Als eines der ersten westeuropäischen Unternehmen<br />
engagierte sich MC-Bauchemie nach dem Fall<br />
des Eisernen Vorhangs in Ungarn. 1994 erwarb MC<br />
die Novomix GmbH und gründete die MC-Bauchemie<br />
Ungarn. Jetzt blickt die Geschäftsführung auf<br />
20 erfolgreiche Jahre zurück.<br />
∎ Neue Konzessionen in Ägypten<br />
RWE Dea hat in Ägypten im Rahmen der internationalen<br />
Ausschreibungsrunde der Egyptian General<br />
Petroleum Corporation (EGPC) 2013 zwei neue<br />
Offshore-Konzessionen als Betriebsführer erhalten.<br />
Die Konzessionen liegen im Golf von Suez.<br />
∎ Studie zum europäischen Rohrmarkt<br />
Das Marktforschungsinstitut Ceresana hat den<br />
europäischen Markt für Rohre unter die Lupe<br />
genommen: Ceresana erwartet, dass die Nachfrage<br />
für Rohre bis zum Jahr 2021 auf über 5 Millionen t<br />
wachsen wird. www.ceresana.com<br />
∎ Großauftrag über Spiralrohranlage<br />
Tuberías Procarsa, ein lateinamerikanischer Herstellern<br />
von Stahlrohren ordert für Mexiko ein komplettes<br />
Rohrwerk bei Schuler. Die Produktion von<br />
Tuberías Procarsa erhöht sich durch die Anlage um<br />
220.000 t im Jahr.<br />
∎ HIMA ändert Rechtsform<br />
HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG ist jetzt<br />
eine GmbH. Gesellschafter bleiben weiterhin ausschließlich<br />
Mitglieder der Familie Philipp.<br />
∎ NORMA übernimmt NDS<br />
NORMA Group SE übernimmt sämtliche Anteile<br />
an National Diversified Sales. NDS ist einer der führenden<br />
US-amerikanischen Anbieter von Regenwassermanagement<br />
und Verbindungskomponenten<br />
für Infrastruktur im Wasserbereich.<br />
6.580 Armaturen für Kraftwerk<br />
in Indien<br />
Neue Möglichkeiten zur<br />
Rohrextrusion am SKZ<br />
Das Süddeutsche Kunststoff Zentrum<br />
(SKZ) in Würzburg bietet Rohrherstellern<br />
viele Möglichkeiten neue Rezepturen zu<br />
testen und innovative Herstellungsverfahren<br />
sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen<br />
zu entwickeln. Das SKZ erweitert<br />
zu diesem Zweck seine Ausstattung<br />
um eine weitere Rohrlinie sowie um verschiedene<br />
Rohrdimensionen. Jetzt steht<br />
zusätzlich eine Rohrextrusionslinie mit<br />
einem Einschneckenextruder mit einem<br />
Wendelverteiler-Werkzeug für Monound<br />
Coextrusion oder alternativ mit bis<br />
zu vier Streifen in den Durchmessern 32,<br />
50, 75, 110 und 160 mm zur Verfügung.<br />
Die passende Peripherie (Kalibriertank,<br />
Kühltank, Abzug, Sägeautomat und<br />
Abwurfrinne) ermöglicht die Herstellung<br />
von Rohren aus PE, PP, PVDF und ABS<br />
sowie PA. Ein Rohrkopf für 3-Schicht-<br />
Rohre mit 32 mm Durchmesser, z. B.<br />
für Barriereschichten, kann ebenfalls zur<br />
Für den Neubau eines indischen<br />
Dampfkraftwerks in Barh im Bundesstaat<br />
Bihar lieferte die KSB-<br />
Gruppe bis April 2014 Armaturen<br />
in zweistelliger Millionenhöhe. Der<br />
Gesamtauftrag umfasste 6.580 Schieber,<br />
Ventile und Rückschlagarmaturen<br />
sowie weitere Armaturen. Von diesen<br />
wird etwa ein Drittel im deutschen<br />
KSB-Werk in Pegnitz gefertigt. Ein<br />
erheblicher Anteil des Lieferumfanges<br />
kommt aus dem KSB-Armaturenwerk<br />
in Indien. In Barh baut der indische<br />
Energiekonzern „National Thermal<br />
Power Corporation“ (NTPC) ein hochmodernes<br />
Kohlekraftwerk mit drei<br />
660-MW-Blöcken. Es handelt sich<br />
um ein sogenanntes „Überkritisches<br />
Dampfkraftwerk“. Dieser Anlagentyp<br />
erreicht einen überdurchschnittlichen<br />
Wirkungsgrad und stellt auf Grund<br />
des hohen Dampfdruckes und der<br />
Betriebstemperaturen extreme Anforderungen<br />
an die Konstruktion und<br />
die Werkstoffe der Armaturen.<br />
Schieber der Baureihe ZTS, wie sie in<br />
dem indischen Kraftwerksneubau in Barh<br />
zum Einsatz kommen werden<br />
Entwicklung und Produktion genutzt<br />
werden. Vor kurzem wurde ergänzend<br />
eine neue Rohrlinie mit einem konischen<br />
Dopppelschneckenextruder mit einem<br />
Stegdornhalterwerkzeug für PVC-Rohre<br />
mit Durchmessern von 16 und 32 mm<br />
installiert.<br />
Umfangreiche Erweiterung der<br />
Rohrextrusionslinien<br />
Foto: KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal<br />
6 10-11 | 2014
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT NACHRICHTEN<br />
Einigung auf temperaturabhängig<br />
feste Transportkapazitäten für den<br />
Speicher Haidach<br />
Open Grid Europe GmbH (OGE)<br />
und astora GmbH & Co. KG (astora)<br />
haben sich über die Bereitstellung<br />
fester Transportkapazitäten für den<br />
Erdgasspeicher Haidach in Österreich<br />
geeinigt.<br />
Der Einigung vorausgegangen war<br />
ein 2013 eingeleitetes Missbrauchsverfahren<br />
der astora gegen OGE, um<br />
einen Anspruch auf Bereitstellung fester<br />
Transportkapazitäten gegenüber<br />
OGE durchzusetzen. Die Bundesnetzagentur<br />
hatte daraufhin entschieden,<br />
dass astora grundsätzlich zwar<br />
Anspruch auf feste Transportkapazitäten<br />
für den Speicher Haidach hat,<br />
diese jedoch mit nicht näher definierten<br />
Auflagen belegt werden können.<br />
OGE und astora legten jeweils Rechtsmittel<br />
gegen den Bescheid der Bundesnetzagentur<br />
beim Oberlandesgericht<br />
Düsseldorf ein. Mit der jetzt<br />
erzielten außergerichtlichen Einigung<br />
ist eine Beendigung des vor dem OLG<br />
Düsseldorf anhängigen Verfahrens<br />
verbunden.<br />
Kern der Einigung ist seitens OGE<br />
die Verpflichtung zur Bereitstellung<br />
temperaturabhängig fester Transportkapazitäten<br />
(TaK) für den Speicher<br />
Haidach ab 2020 auf Basis einer zuvor<br />
durch astora getätigten längerfristigen<br />
Buchung von TaK-Kapazitäten.<br />
Die außergerichtliche Einigung ist<br />
eine effiziente und marktgerechte<br />
Lösung für den Speicher Haidach<br />
und berücksichtigt die saisonal unterschiedliche<br />
Speichernutzung - sowohl<br />
im Sommer (Befüllung) als auch im<br />
Winter (Ausspeicherung) - und trägt<br />
damit zur Erhöhung der Versorgungssicherheit<br />
bei.<br />
Qualität<br />
fordern<br />
Maßstäbe<br />
setzen<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung<br />
der<br />
Fachkunde,<br />
technischen<br />
Leistungsfähigkeit,<br />
technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen.<br />
Erdgasspeicher Haidach<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
RAL-GZ 961<br />
www.kanalbau.com<br />
10-11 | 2014 7
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
KURZ INFORMIERT<br />
∎ Kosten Biogaseinspeisung 2015<br />
Für 2015 gilt bundesweit ein einheitlicher Biogaswälzungsbetrag<br />
von 0,60194 Euro pro Kilowattstunde<br />
pro Stunde pro Jahr. Die Kosten für<br />
Netzanschluss und Einspeisung von Biogas werden<br />
auf die Netzentgelte der Fernleitungsnetzbetreiber<br />
in Deutschland gleichermaßen verteilt.<br />
www.fnb-gas.de<br />
∎ CETA schützt <strong>Wasserversorgung</strong> nicht?<br />
Die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft<br />
AöW fordert klare Reglungen zum Ausschluss<br />
von Privatisierung der Wasserwirtschaft im<br />
kanadisch-europäischen Freihandelsabkommen<br />
(CETA). Die AöW sieht trotz Aussagen der EU weiter<br />
die Gefahr, dass über Freihandelsabkommen<br />
in die kommunale Selbstverwaltung eingegriffen<br />
wird. www.aoew.de<br />
∎ IT-Sicherheit in der Versorgungsbranche<br />
Der DVGW richtet ein spartenübergreifendes<br />
Gremium zur IT-Sicherheit ein und bereitet ein<br />
IT-Modul zur Selbsteinschätzung von Unternehmen<br />
vor. Damit soll vor allem die Forderungen<br />
nach Harmonisierung von Sicherheitsstandards,<br />
die Einführung einer Meldepflicht für IT-sicherheitsrelevante<br />
Vorfälle sowie die Schaffung einer<br />
zentralen Meldestelle unterstützt werden.<br />
∎ Neue Handlungsempfehlung für<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
Der Verband zertifizierter Sanierungsberater (VSB)<br />
gibt eine neue Handlungsempfehlung Nr. 17 „Einbeziehung<br />
der Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
(GEA) in eine ganzheitliche Sanierungsstrategie“<br />
heraus. Die Broschüre stellt ein wichtiges Hilfsmittel<br />
dar, das Wege aufzeigt, gemeinsam mit den<br />
Bürgern das Problem der undichten Leitungen<br />
anzugehen.<br />
∎ ZAI 0.3 HOAI 2013 aktualisiert<br />
Die Neufassung bzw. Anpassung der ZAI 0.3<br />
„Honorierung von Ingenieurleistungen der<br />
Kanalsanierung an die HOAI 2013“ liegt nun wieder<br />
als praxisorientierte Arbeitshilfe vor. Die neue<br />
ZAI 0.3 HOAI 2013 ist als eigenständiges Werk<br />
ergänzend zu der Vorgängerfassung konzipiert.<br />
Die neue ZAI 0.3 HOAI 2013 wird vom Verband<br />
Zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme<br />
(VSB) herausgegeben.<br />
Arbeitshilfe zur optischen<br />
Abnahmeprüfung<br />
Abwasserleitungen und -kanäle einschließlich<br />
zugehöriger Bauwerke müssen<br />
so errichtet und betrieben werden,<br />
dass sie funktionsfähig, betriebssicher<br />
und dicht sind. Gleiches gilt für den Zeitpunkt<br />
nach einer Sanierung. Um den<br />
gewünschten Zustand sicherzustellen,<br />
sind die Anlagen vor Inbetriebnahme<br />
zu prüfen. Bei diesem Vorgang, der in<br />
Normen und Merkblättern geregelt ist,<br />
kommt es in der Praxis immer wieder<br />
zu Unstimmigkeiten zwischen den Vertragsparteien.<br />
Ausgangspunkt sind die<br />
Feststellungen der optischen Inspektion,<br />
die häufig zu unterschiedlichen Bewertungen<br />
durch die Beteiligten führen. Mit<br />
der „Arbeitshilfe zur optischen Abnahmeprüfung“<br />
bietet die Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau Fachleuten deshalb<br />
einen Leitfaden zu „Auffälligkeiten und<br />
zugehörigen Festlegungen im Regelwerk“<br />
an, in dem den Feststellungen<br />
der optischen Inspektion die entsprechenden<br />
Hinweise und Festlegungen<br />
im technischen Regelwerk und anderen<br />
Quellen zugeordnet werden.<br />
Die Broschüre, die sich als Arbeitshilfe bei<br />
Auftraggebern und Auftragnehmern etabliert<br />
hat, wurde von der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau neu strukturiert, inhaltlich<br />
überarbeitet und erweitert. Darüber<br />
sind die in der Arbeitshilfe enthaltenen<br />
Feststellungen und Auffälligkeiten den<br />
Kodierungen zugeordnet entsprechend<br />
DIN EN 13508-2 „ Untersuchung und<br />
Beurteilung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden – Teil 2: Kodiersystem<br />
für die optische Inspektion“ und<br />
DWA-M 149-2 „ Zustandserfassung und<br />
-beurteilung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden - Teil 5:<br />
Optische Inspektion“. So wird das Arbeiten<br />
mit der Unterlage für Fachleute noch<br />
einfacher und effizienter.<br />
Die umfangreichen Erfahrungen der für<br />
die Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ<br />
961 tätigen Prüfingenieure sind in die<br />
Neuauflage der Arbeitshilfe eingeflossen.<br />
„Davon profitieren Auftraggeber und<br />
Auftragnehmer gleichermaßen, wenn<br />
sie in die Diskussion einsteigen“, ist<br />
Dipl.-Ing. Hans-Christian Möser von der<br />
Gütegemeinschaft Kanalbau überzeugt.<br />
Gleichzeitig macht er deutlich, dass die<br />
Bewertung, ob ein Mangel vorliegt, nicht<br />
Gegenstand der Arbeitshilfe ist.<br />
Dies ist vielmehr ein Ergebnis der Bewertung<br />
von Abweichungen zwischen dem<br />
Ist-Zustand und den Sollwert-Festlegungen<br />
im Bauvertrag. Falls die ausschreibende<br />
Stelle keine bauvertragliche<br />
Festlegung getroffen hat, ergibt sich<br />
die Bewertung, ob ein Mangel vorliegt,<br />
in der Regel aus einer Bewertung der<br />
Gebrauchstauglichkeit des erstellten<br />
Werkes unter Berücksichtigung der allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik.<br />
Die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit<br />
ist bei neu erstellten und renovierten<br />
Abwasserleitungen und -kanälen in<br />
der Regel mit den Fragen verknüpft, ob<br />
sichergestellt ist: (a) der Nachweis der<br />
Dichtheit, (b) ein störungsfreier und<br />
wirtschaftlicher Kanalbetrieb und (c) die<br />
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit.<br />
Verantwortlichkeiten klar geregelt<br />
Die Abnahme gehört zu den Hauptpflichten<br />
des Auftraggebers. Der<br />
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber<br />
seine Leistung zum Zeitpunkt<br />
der Abnahme frei von Sachmängeln<br />
zu verschaffen. Dies ist der Fall, wenn<br />
die Leistung zur Zeit der Abnahme die<br />
vereinbarte Beschaffenheit hat und<br />
den anerkannten Regeln der Technik<br />
entspricht. Mit der Abnahme geht die<br />
Gefahr auf den Auftraggeber über.<br />
Bei neu erstellten und renovierten<br />
Abwasserleitungen und -kanälen ist die<br />
Feststellung der Mängelfreiheit im Allgemeinen<br />
nur mit Hilfe einer optischen<br />
Inspektion möglich. Der Auftraggeber<br />
definiert Zweck und Ziel der durchzuführenden<br />
Inspektion. Hieraus ergeben<br />
sich in der Regel Umfang und Inhalt der<br />
notwendigen Dokumentation (DWA-M<br />
149-5, Abschnitt 7.1).<br />
Die Beurteilung des festgestellten<br />
Zustandes ist generell nicht die Aufgabe<br />
des Inspekteurs oder gar dessen Software.<br />
Zustandsbeurteilung und Feststellung<br />
der Mängelfreiheit sind grundsätzlich<br />
in einem weiteren Arbeitsschritt<br />
8 10-11 | 2014
PERSONALIEN NACHRICHTEN<br />
und durch dafür qualifiziertes Personal<br />
durchzuführen, dem die vertraglich vereinbarten<br />
Anforderungen bekannt sind<br />
(DWA-M 149-5, Abschnitt 7.1).<br />
„Damit sind zwar die formalen Rahmenbedingungen<br />
klar umrissen, doch<br />
im Baustellenalltag treffen die unterschiedlichen<br />
Auffassungen der Vertragspartner<br />
bei der Interpretation<br />
möglicher Mängel immer wieder aufeinander“,<br />
weiß Möser. Was ist überhaupt<br />
ein Mangel? Die Beantwortung<br />
dieser Frage setzt Fachwissen und<br />
Erfahrung voraus. Zum Beispiel ist nicht<br />
jede Falte bei einem neu eingezogenen<br />
Schlauchliner ein baulicher Mangel, der<br />
das Sanierungsergebnis in Frage stellt<br />
und Nachbesserungen oder finanzielle<br />
Ansprüche nach sich zieht.<br />
Schadensfälle und Regelwerk<br />
verknüpft<br />
Die „Arbeitshilfe zur optischen<br />
Abnahmeprüfung“ greift Beispiele<br />
wie diese auf und verknüpft die im<br />
Abnahmeprotokoll gebräuchlichen<br />
Kodierungen mit den entsprechenden<br />
Regelwerken und Normen. Hat sich<br />
beispielsweise der Rohrquerschnitt<br />
gegenüber der Ursprungsform verändert,<br />
wird das bei biegeweichen Rohren<br />
mit der Kodierung BAA kenntlich<br />
gemacht. Doch wo sind solche Fälle<br />
geregelt?<br />
Aufschluss gibt die Broschüre zu dieser<br />
Frage mit den Verweisen auf die<br />
„DIN EN 1610 Abschnitt 12.3.2 Rohrverformung“<br />
sowie die Arbeitsblätter<br />
„DWA-A 139 Abschnitt 12.3.2 Rohrverformung“<br />
und „ATV-DVWK-A 127<br />
Abschnitt 9.4 Verformungsnachweis“:<br />
Bei biegeweichen Rohren ist die Verformung<br />
auf Übereinstimmung mit<br />
der statischen Berechnung zu prüfen.<br />
Die Durchmesserveränderung darf den<br />
in der Statik ausgewiesenen Wert der<br />
Kurz- sowie Langzeitverformung (siehe<br />
ATV-DVWK-A 127) nicht überschreiten.<br />
Abnahmekriterium ist der aus der statischen<br />
Berechnung ermittelte zulässige<br />
Wert der Kurzzeitverformung.<br />
Aus dem Gebrauch der Arbeitshilfe<br />
resultiert ein Nutzen für Kommunen,<br />
Ingenieurbüros und ausführende<br />
Unternehmen. Durch die praxisbezogene<br />
Verknüpfung von Feststellungen<br />
bei der optischen Inspektion<br />
und diesbezüglichen Vorgaben des<br />
Regelwerkes sollen einvernehmliche<br />
und sachorientierte Bewertungen der<br />
Vertragspartner unterstützt werden.<br />
Die neu erschienene Arbeitshilfe der<br />
Gütegemeinschaft Kanalbau steht<br />
unter www.kanalbau.com als kostenloser<br />
Download bereit. Mitglieder der<br />
Gütegemeinschaft können darüber<br />
hinaus die gedruckte Version bequem<br />
über den Login-Bereich (Infoschriften)<br />
oder per mail an info@kanalbau.com<br />
unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer<br />
bestellen.<br />
Neue Technische Leitung bei MC-Bauchemie<br />
Dr. Joachim Käppler<br />
kehrt nach 13<br />
Jahren zur<br />
MC-Bauchemie<br />
Müller GmbH<br />
& Co. KG zurück<br />
und übernahm<br />
zum 1. Oktober 2014 die technische<br />
Leitung im Fachbereich Protection<br />
Technologies.<br />
Joachim Käppler (51) ist seit 22<br />
Jahren in der Bauchemie tätig und<br />
war von 1992 bis 2001 bereits für<br />
die MC-Bauchemie unter anderem als<br />
Produktmanager für Industrieböden<br />
und Kunstharzbeschichtungen<br />
beschäftigt. Zu seinen Hauptaufgaben<br />
als Technischer Leiter<br />
gehören die Entwicklung neuer<br />
Produkte und Systemlösungen<br />
sowie deren Markteinführung, die<br />
Begleitung interner und externer<br />
Weiterbildungs veranstaltungen<br />
sowie der Know-how-Transfer in die<br />
Länder, in denen MC tätig ist.<br />
Neuer Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer<br />
an der Jade Hochschule<br />
Für die kommende<br />
Amtsperiode<br />
von drei<br />
Jahren haben<br />
der Senat und<br />
der Hochschulrat<br />
der Jade<br />
Hochschule Vizepräsident<br />
Prof. Dr.<br />
Uwe Weithöner<br />
im<br />
Amt bestätigt. Zum neuen Vizepräsidenten<br />
für Forschung und Technologietransfer<br />
wurde Prof. Thomas Wegener<br />
gewählt. Die Wahl wurde vom zuständigen<br />
niedersächsischen Ministerium<br />
für Wissenschaft und Kultur bestätigt.<br />
Thomas Wegener wurde im Frühjahr<br />
1999 zum Professor für Baubetrieb<br />
an die ehemalige Fachhochschule<br />
Oldenburg in den Fachbereich Bauingenieurwesen<br />
berufen; seitdem vertritt<br />
er an der Hochschule das Fachgebiet<br />
„Rohrleitungsbau“. Seit September<br />
2001 ist Wegener Geschäftsführer<br />
der iro GmbH Oldenburg und seit<br />
Juni 2003 im Vorstand des Instituts<br />
für Rohrleitungsbau (iro) e.V. Im Jahr<br />
2012 wurde er zum ersten Leiter des<br />
In-Instituts IRT gewählt. Als Vizepräsident<br />
vertritt er die Ressorts Forschung,<br />
Technologietransfer, Gleichstellung<br />
und Weiterbildung.<br />
10-11 | 2014 9
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
Messen und Tagungen<br />
4. Praxistag <strong>Wasserversorgung</strong>snetze<br />
05.11.2014 in Essen; b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.praxistag-wasserversorgungsnetze.de<br />
Schwerer Korrosionsschutz – Schutz und Werterhaltung<br />
industrieller Anlagen<br />
26./27.11.2014 Fachtagung und Fachausstellung in München;<br />
nicole.hall@tuev-sued.de, www.tuev-sued.de/<br />
akademie<br />
EnergyDecentral 2014<br />
11.-14.11.2014 Internationale Fachmesse für innovative<br />
Energieversorgung in Hannover; m.vagt@dlg.org,<br />
www.energy-decentral.com<br />
Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
19./20.02.2015 kleist@iro-online.de, www.iro-online.de<br />
Wasser Berlin<br />
24.-27.03.2015 wasser@messe-berlin.de,<br />
www.wasser-berlin.de<br />
ACHEMA<br />
15.-19.06.2015 in Frankfurt/Main; visitor@achema.de,<br />
www.achema.de<br />
9. Praxistag Korrosionsschutz<br />
24.06.2015 in Gelsenkirchen; b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
10. Forum Industriearmaturen<br />
30.09.2015 in Essen; b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
IKT-Praxistage und<br />
International Conference<br />
Renovierung und Reparatur –<br />
Widerspruch oder Einklang?<br />
Diese Frage schwebte über den<br />
IKT-Praxistagen „Kanalsanierung<br />
und Kanalreparatur“ vom 17.9 bis<br />
18.9.2014. Sie spiegelte sich in<br />
den Vorträgen, den Diskussionen,<br />
in der Fachausstellung und den<br />
Praxisvorführungen wider. Das<br />
Vortragsprogramm war vielfältig<br />
und bot für jeden der mehr<br />
als 300 Gäste etwas. Reparaturund<br />
Sanierungsverfahren wurden<br />
unter den Aspekten Qualität,<br />
Haltbarkeit und Kosten von<br />
allen Seiten beleuchtet. Etwas<br />
zum Anschauen und Anfassen<br />
boten Hersteller und Anwender<br />
auf dem IKT-Gelände; hier stellten<br />
sie ihre Reparatur- und Renovierungsverfahren<br />
vor. Einen Liner<br />
am Schacht einbinden, einen<br />
Anschluss auf einen Sammler<br />
aufschweißen, ein Wickelrohr einbauen,<br />
mit dem MAC-System die<br />
Stabilität des Rohr-Boden-Systems<br />
messen – alles, was sonst unter<br />
der Erde oder in der Baugrube<br />
passiert, wurde gut sichtbar in<br />
Aktion gezeigt. Am Ende der<br />
Veranstaltung wurde deutlich,<br />
dass Sanierung und Reparatur<br />
Hand in Hand gehen müssen.<br />
Und Prof. Dr.-Ing. Bert Bosseler,<br />
Wissenschaftlicher Leiter des IKT,<br />
findet: „Reparatur oder Renovierung,<br />
einzeln oder in Kombination<br />
– der Zustand entscheidet.“<br />
Internationale Konferenz zum<br />
Thema Asset Management<br />
Die parallel zu den IKT-Praxistagen<br />
laufende International Conference<br />
„Infrastructure Knowledge<br />
and Technology“ brachte<br />
Fachleute aus der ganzen Welt<br />
zum Thema Asset Management<br />
zusammen. Teilnehmer aus<br />
Algerien, Belgien, Deutschland,<br />
Großbritannien, Frankreich,<br />
Griechenland, Indien, aus den<br />
Niederlanden, dem Oman, aus<br />
Österreich, Schweden und den<br />
USA machten Gelsenkirchen<br />
für drei Tage zum Treffpunkt<br />
der Leitungsinfrastruktur-Welt.<br />
Dabei standen am ersten Tag<br />
landesspezifische Herausforderungen<br />
und Herangehensweisen<br />
im Vordergrund. Am<br />
Beispiel des Themas „Vegetation<br />
und Infrastruktur“ wurden<br />
im Nachmittags-Workshop die<br />
Wechselwirkungen zweier klassischer<br />
Assets durchdekliniert.<br />
Das Symposium am zweiten und<br />
dritten Tag griff internationale<br />
Trends des Asset Managements<br />
auf und verschaffte den Teilnehmern<br />
einen aktuellen Überblick<br />
über verschiedene unterirdische<br />
Infrastrukturen.<br />
ExpertenForum Fernwärme 2015<br />
Basierend auf über zehn Jahren Erfahrung<br />
in der Durchführung der bekannten<br />
Bundesverband Fernwärme e.V.<br />
(BFW) Vortragsreihe werden 2015 die<br />
bewährten Experten-Vortragsteile und<br />
die Best-Practice-Vorführungen durch<br />
ein dynamisches Diskussions-Element<br />
erweitert. Es entsteht so ein spezielles<br />
„Experten Forum Fernwärme“. Mit<br />
dem neuen ExpertenForum Fernwärme<br />
richtet sich der BFW an verantwortliche<br />
Fachkräfte in der Planung, der Montage,<br />
im Betrieb und der Wartung von<br />
Nah- und Fernwärmeanlagen, sowie<br />
an Mitarbeiter im Bereich Fernwärme in<br />
Stadtwerken, bei Energieversorgern und<br />
ausführenden Montageunternehmen im<br />
Rohrleitungsbau.<br />
Das ExpertenFoum Fernwärme findet<br />
bei den Stadtwerken Magdeburg am<br />
10. Februar 2015, bei der EVL Energieversorgung<br />
Leverkusen am 24. Februar<br />
2015 und bei C.A.R.M.E.N Straubing am<br />
4. März 2015 statt.<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
unter: www.bfwev.de<br />
10 10-11 | 2014
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
„Grabenlose Technik, die begeistert“<br />
Unter diesem Motto fanden zum<br />
zehnten Mal die „Hands on Days“ bei<br />
Saalhausen statt. Zu diesen beliebten,<br />
international ausgerichteten Vorführtagen<br />
reisten über 600 Teilnehmer aus<br />
Europa, Australien, Asien und Afrika<br />
zum Stammsitz der Tracto-Technik an.<br />
Das Programm sah für Frühaufsteher<br />
eine Werksbesichtigung vor. Je nach<br />
Interesse konnten die Fachbesucher<br />
an zwei Tagen zwischen 30 sehr gut<br />
besuchten Fach vorträgen aus wählen.<br />
Danach blieb ausreichend Zeit, mit<br />
den rund 20 Fachausstellern über<br />
ihre systembezogenen Produkte zu<br />
fachsimpeln. An zwölf Stationen im<br />
Testgelände wurden aktuelle Entwicklungen<br />
der Nodig-Techniken live vorgeführt.<br />
Hier konnten die Praktiker<br />
die Maschinen selbst ausprobieren<br />
und ihre Erfahrungen untereinander<br />
austauschen. Bemerkenswert war<br />
die starke Präsenz von Besuchern aus<br />
dem osteuropäischen Raum, weil dort<br />
Gut besuchte Live-Vorführung grabenloser Techniken<br />
ein großer Bedarf für den Aufbau der<br />
Leitungsinfrastruktur besteht.<br />
Die Abendveranstaltung im ungewöhnlichen<br />
Ambiente der Sauerlandpyramiden<br />
kam bei den Besuchern<br />
ebenfalls gut an. Die „10. Hands on<br />
Days“ konnten einmal mehr zeigen,<br />
dass grabenlose Techniken auf großes<br />
Interesse stoßen und der Markt<br />
auf diesem Gebiet mit seinen ständigen<br />
technischen Fortschritten große<br />
Wachstumspotenziale bietet.<br />
Foto: TRACTO-TECHNIK<br />
Botschaftertag von Wasser Berlin International<br />
Zum ersten Mal lud das Projektteam<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
zusammen mit den Berliner Wasserbetrieben<br />
am 16. September 2014 zum<br />
Botschaftertag auf das Messegelände,<br />
in das Klärwerk Ruhleben und den International<br />
Club Berlin. Die Veranstaltung<br />
fand als „Vorspiel“ für die große Messe<br />
im Frühjahr 2015 statt. Ingrid Maaß,<br />
Geschäftsführerin der Messe Berlin<br />
GmbH, begrüßte dabei 50 hochrangige<br />
Repräsentanten von Botschaften<br />
aus 31 Ländern. Hier waren vor allem<br />
afrikanische, europäische und asiatische<br />
Länder vertreten, aber auch amerikanische<br />
Länder. Im Anschluss an den<br />
Empfang der Botschafter fand eine<br />
Besichtigung des Klärwerks Ruhleben<br />
(Berlin) – der größten „Wasserwaschmaschine“<br />
Deutschlands – statt.<br />
„Die rege Teilnahme am Botschaftertag<br />
unterstreicht, dass Wasser eine globale<br />
Aufgabe ist und in jedem Land der Welt<br />
von höchster Relevanz ist.“ so Maaß.<br />
„Schon jetzt, ein halbes Jahr vor Wasser<br />
Berlin International 2015, haben wir<br />
Anmeldungen von Ausstellern aus 36<br />
Ländern“ sagt Maaß. China, Dänemark,<br />
die Niederlande und die USA werden<br />
nächstes Jahr mit eigenen Länderpavillons<br />
vertreten sein.<br />
Vom 24. bis zum 27. März 2015 wird<br />
Berlin vier Tage lang Treffpunkt der<br />
internationalen Wasserwirtschaft sein.<br />
Teilnehmergruppe des Botschaftertages auf dem Gelände des Klärwerks Ruhleben<br />
10-11 | 2014 11
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
Goldener Kanaldeckel verliehen<br />
NRW-Umweltminister Johannes Remmel<br />
hat zusammen mit IKT-Geschäftsführer<br />
Roland W. Waniek den „Goldenen<br />
Kanaldeckel“ verliehen. Der „Oscar“<br />
der Kanalbranche geht in diesem Jahr<br />
an drei Mitarbeiter von Stadtentwässerungen<br />
aus Nordrhein-Westfalen,<br />
Niedersachsen und Sachsen. Die Projekte,<br />
die die Jury überzeugt haben,<br />
umfassen die Themen Arbeitssicherheit,<br />
Qualitätsmanagement im Kanalbau und<br />
Schachtabdeckungen. Mit dem goldenen<br />
Kanaldeckel zeichnet das Institut für<br />
Unterirdische Infrastruktur Mitarbeiter<br />
von Kanalnetzbetreibern für herausragende<br />
Leistungen bei Neubau, Sanierung<br />
oder Betrieb einer modernen und<br />
zukunftsweisenden Kanalinfrastruktur<br />
aus.<br />
Platz 1 „Entwicklung eines<br />
Arbeits- und Rettungssystems<br />
(MobiK) für einen neuen<br />
Hauptsammler“<br />
Beim Bau eines neuen 4 km langen<br />
Hauptsammlers DN 1800 bis DN 2400<br />
in Solingen können vorgeschriebene<br />
Kontrollschächte aus baulichen und<br />
topographischen Gründen nicht gebaut<br />
werden. MobiK ist ein mobiles Windensystem,<br />
das die Bewirtschaftung begehbarer<br />
Kanälen mit sehr großen Schachtabständen<br />
ermöglicht. Es besteht aus<br />
einem LKW und einem Anhänger<br />
zwischen denen ein Seil gespannt ist,<br />
das in den Kanal eingelassen wird.<br />
Das Seil bewegt ein Spezialgefährt im<br />
Kanal über längere Strecken schnell und<br />
zuverlässig. Damit können in überlangen<br />
Haltungen Arbeitsgeräte und Material<br />
transportiert werden. Und in Gefahrensituationen<br />
gewährleistet das Gefährt<br />
einen schnellen und sicheren Rückzug<br />
der Mitarbeiter aus dem Kanal. Der<br />
neue Hauptsammler „Viehbachtal“<br />
kann in Solingen gebaut werden, ohne<br />
dass ein zu starker Eingriff in die Landschaft<br />
erfolgt. Auf zahlreiche ansonsten<br />
notwendige Zwischenschächte kann<br />
verzichtet werden. Dadurch werden<br />
Baukosten in Höhe von 5,1 Mio. EUR<br />
eingespart.<br />
Preisträger: Dipl.-Ing. Stefan Grotzki,<br />
Technische Betriebe Solingen<br />
Platz 2 „Osnabrücker Modell zur<br />
Qualitätssicherung der am Bau<br />
Beteiligten“<br />
Daniela Fiege ist die Leiterin Bauüberwachung<br />
Entwässerungsnetze. Sie hat<br />
die internen Prozesse beim Kanalbau<br />
restrukturiert und optimiert. Dazu<br />
hat sie zunächst die internen Prozesse<br />
unter den Aspekten Qualität und<br />
Definition der Anforderung analysiert.<br />
Dabei fiel ihr ein wesentliches Verbesserungspotenzial<br />
auf, vor allem bei den<br />
Bauabläufen. Sie entwickelte ein QM-<br />
System, das alle Beteiligten einschließt<br />
(Auftraggeber, Ingenieurbüro, Baufirma,<br />
Bürger). Es legt großen Wert auf<br />
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und<br />
Ausgezeichnetes Engagement: Stefan Grotzki, Daniela Fiege, Thomas Würfel und<br />
Daniel Kalweit (von links), eingerahmt von NRW-Umweltminister Johannes Remmel<br />
(links) und IKT-Geschäftsführer Roland W. Waniek (rechts)<br />
Schulung der Auftragnehmer. Aber<br />
auch die Kommunikation und enge<br />
Abstimmungen mit anderen städtischen<br />
Stellen, vor allem dem Straßenbau,<br />
ist wichtig. Das Projekt läuft<br />
seit dem Jahr 2011. Qualitätsverbesserungen,<br />
wie z. B. Termintreue und<br />
Bürgerfreundlichkeit, konnten bereits<br />
nachvollzogen werden.<br />
Preisträgerin: Dipl.-Ing. (FH) Daniela<br />
Fiege, Stadtwerke Osnabrück<br />
Platz 3 „Schachtabdeckung Typ<br />
Dresden“<br />
Herkömmliche Schachtabdeckungen<br />
weisen vor allem in städtischen<br />
Hauptstraßen einen hohen und wiederkehrenden<br />
Reparaturaufwand<br />
auf. Dadurch entsteht ein erhebliches<br />
Gefahrenpotenzial für die Verkehrsteilnehmer.<br />
Den Kommunen entstehen<br />
hohe Kosten. Die Ursachen sehen<br />
die Preisträger in der mangelhaften<br />
Ausbildung in den Tiefbauberufen<br />
in Hinblick auf Schachtabdeckungen.<br />
Heutige Schachtabdeckungen<br />
mit Kreiskonussen haben eine<br />
kurze Lebensdauer. Den Preisträgern<br />
ist jedoch aufgefallen, dass ältere<br />
Schachtabdeckungen mit konischer<br />
Form keinerlei Schäden aufweisen,<br />
obwohl sie teilweise 100 Jahre alt<br />
sind. Allerdings wird diese Bauart<br />
nicht mehr hergestellt, weil sie modernen<br />
Normen widerspricht. Der letzte<br />
Hersteller dieses Typs ging 2013 in<br />
die Insolvenz. Thomas Würfel und<br />
Daniel Kalweit arbeiteten jedoch an<br />
der Anpassung des Konustyps an<br />
moderne Schachtabmessungen weiter,<br />
ebenso an einer Reihe von technischen<br />
Verbesserungen. Erst im Frühjahr<br />
2014 konnten sie einen Hersteller<br />
herkömmlicher Schachtabdeckungen<br />
von den Vorteilen ihres verbesserten<br />
Konustyps überzeugen. Daher werden<br />
nun in Dresden wieder Schachtabdeckungen<br />
im Konusformat eingebaut,<br />
so wie sie vor 100 Jahren hergestellt<br />
wurden, aber an moderne Schachtkörper<br />
angepasst.<br />
Preisträger: Dipl.-Ing. Thomas Würfel<br />
und Dipl.-Ing. Daniel Kalweit, Stadtentwässerung<br />
Dresden.<br />
12 10-11 | 2014
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Netzbetreiber im Zukunfts-Workshop<br />
Gruppenbild der Workshop-Teilnehmer<br />
Nicht wenige Netzbetreiber beschäftigen<br />
sich heute mit der Frage: Was sind<br />
die wesentlichen zukünftigen Herausforderungen<br />
im Asset-Management<br />
und wie kann man diesen Herausforderungen<br />
nachhaltig und strukturiert<br />
begegnen? Im Rahmen eines eintägigen<br />
Workshops im Münchener Technologiezentrum<br />
(MTZ) haben Organisationsgestalter<br />
von Energie- und<br />
Wasserversorgern in den Funktionen<br />
IT-Manager, Asset Manager, Prozessmanager<br />
und Anforderungsmanager<br />
zusammen mit der Mettenmeier<br />
GmbH aus Paderborn und dem Institut<br />
OFFIS aus Oldenburg einen Blick in die<br />
Zukunft gerichtet: Im gemeinsamen<br />
Austausch wurden relevante Themen<br />
zur Entwicklung einer notwendigen<br />
Veränderungsfähigkeit im Asset-<br />
Management benannt, diskutiert und<br />
priorisiert. Gemeinsamer Tenor: Um<br />
dem Wettbewerb einen Schritt voraus<br />
zu sein, muss das Zusammenspiel von<br />
Prozessen, Informationstechnologien<br />
und Kompetenzen im Unternehmen<br />
in einem Gesamtkontext mit dem sich<br />
ändernden Branchenumfeld optimiert<br />
werden.<br />
Ein intensiver, bis zuletzt spannend<br />
gestalteter Workshop-Tag förderte<br />
vier Themenbereiche zutage, die in den<br />
nächsten Jahren im Asset Management<br />
an Bedeutung gewinnen werden. Sie<br />
haben einen wesentlichen Einfluss auf<br />
die Veränderungsfähigkeit und müssen<br />
somit hinsichtlich der Gestaltung<br />
der Organisation und der Koordination<br />
technischer und personeller Ressourcen<br />
adressiert werden. Diese sind: Prozessorientierung,<br />
Veränderungskompetenzen,<br />
Informationsmanagement und<br />
Datenkomplexität.<br />
3. Fachtagung „Schwerer Korrosionsschutz“<br />
Wirkungsvoller Korrosionsschutz ist<br />
eine entscheidende Voraussetzung, um<br />
Industrieanlagen sicher, wirtschaftlich<br />
und mit hoher Verfügbarkeit betreiben<br />
zu können. Am 26. und 27. November<br />
2014 lädt TÜV SÜD bereits zum dritten<br />
Mal zur Fachtagung „Schwerer Korrosionsschutz“<br />
nach München ein.<br />
Für Experten aus aller Welt bietet die<br />
Veranstaltung den idealen Rahmen<br />
zum Erfahrungsaustausch.<br />
„Der Schutz und Werterhalt industrieller<br />
Anlagen hängt entscheidend<br />
davon ab, dass die Systeme für den<br />
Korrosionsschutz fachgerecht geplant<br />
und ausgeführt werden,“ sagt Marcus<br />
Demetz, Leiter des Instituts für<br />
Kunststoffe der TÜV SÜD Industrie<br />
Service GmbH und Mitglied im Fachkomitee<br />
der Tagung „Schwerer Korrosionsschutz“.<br />
„Dafür ist es sinnvoll,<br />
regelmäßig aktuelle Entwicklungen<br />
und Betriebserfahrungen im Expertenkreis<br />
zu diskutieren.“ Kunststoffe<br />
für Auskleidungs- und Beschichtungssysteme<br />
sind wieder Kernthema der<br />
Tagung mit Fachausstellung rund um<br />
den Korrosionsschutz. Im Zentrum<br />
der zweitägigen Veranstaltung stehen<br />
neben Fluorpolymeren, Dichtungen,<br />
thermoplastischen Auskleidungen<br />
und Gummierungen zudem Ausmauerungen<br />
sowie metallische Werkstoffe.<br />
In Vorträgen und Praxisberichten<br />
stellen renommierte Unternehmen<br />
und Experten neue<br />
Verfahren, Trends<br />
und Anwender-News<br />
vor.<br />
Die zweitägige Veranstaltung<br />
richtet<br />
sich nicht nur an<br />
Anlagenplaner und<br />
Anlagenbauer, Ingenieure,<br />
Konstrukteure<br />
und Planungsbüros.<br />
Auch Hersteller<br />
von Rohstoffen und<br />
Halbzeugen sowie<br />
Betreiber von Anlagen<br />
in der Chemieund<br />
Mineralölindustrie<br />
und der Energieversorgung<br />
werden angesprochen. Vertreter<br />
von Behörden und Verbänden sowie<br />
die Forschung und Entwicklung sind<br />
darüber hinaus vertreten. Begleitet<br />
wird das Tagungsprogramm von einer<br />
Fachausstellung, in der Unternehmen<br />
ihre Produkte und Leistungen<br />
vorstellen.<br />
10-11 | 2014 13
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
29. Oldenburger Rohrleitungsforum:<br />
„Rohrleitungen im Wärme- und Energietransport“<br />
Eigentlich wird es wie immer sein: Auch<br />
am 19. und 20. Februar 2015 wird sich<br />
ein Großteil der in der Rohrleitungsbranche<br />
tätigen Fachleute in Oldenburg<br />
auf dem Gelände und in den Gebäuden<br />
der Jade Hochschule treffen, um<br />
sich auf dem 29. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
über die neuesten Entwicklungen<br />
der Branche auszutauschen<br />
und einen Blick auf das zu werfen, was<br />
in den restlichen zehn Monaten des<br />
Jahres noch auf Hersteller, ausführende<br />
Unternehmen, Versorger, Kommunen<br />
und Bürger zukommen könnte. Erstmals<br />
wird dabei das Thema Fern- und<br />
Nahwärme in den Mittelpunkt gerückt,<br />
ein Umstand, aus dem sich folgerichtig<br />
auch das Motto ableitet, das 2015<br />
„Rohrleitungen im Wärme- und Energietransport“<br />
heißt. Kann die Fernwärme<br />
ein wichtiger Baustein im diversifizierten<br />
Energieversorgungsgeschäft<br />
sein – das ist nur eine Fragestellung,<br />
die sich hieraus ableiten lässt. Unterteilt<br />
in fünf thematische Handlungsstränge<br />
bietet das Forum wieder jede Menge<br />
Themen, mit denen sich die Gäste aus<br />
dem Wasser- und Abwasserbereich<br />
ebenso identifizieren können wie aus<br />
dem Gas- und Ölsegment. Neben den<br />
Vortragsblöcken zum Thema Wärme<br />
gibt es Neues aus dem Bereich der<br />
Gashochdruckleitungen, aus der Sanierungstechnik<br />
und von den Herstellern<br />
Jade Hochschule, Institut für Rohrleitungsbau, Oldenburg<br />
der unterschiedlichsten Rohrleitungsmaterialien;<br />
Schweißtechnik, EDV und<br />
Vorträge aus den Verbänden komplettieren<br />
ein Programm, das von der „Diskussion<br />
im Cafe“ und dem „Ollnburger<br />
Gröönkohlabend“ abgerundet wird.<br />
Ausbau von Fern- und<br />
Nahwärmenetzen<br />
Die Umgestaltung der Energieversorgung<br />
wird auch im kommenden Jahr<br />
das beherrschende Thema des Oldenburger<br />
Rohrleitungsforums sein. Unter<br />
dem Stichwort Hybridnetze wurde<br />
dieser Umbau bereits auf den vergangenen<br />
beiden Veranstaltungen<br />
diskutiert und neue Techniken und<br />
Entwicklungen vorgestellt, etwa die<br />
Initiative Power-to-Gas oder die Möglichkeit<br />
der Abwasserwärmenutzung.<br />
Allerdings wird die Energiedebatte fast<br />
ausschließlich mit dem Blick auf den<br />
Strom geführt. Dass ein großer Anteil<br />
der benötigten Energie in den Wärmemarkt<br />
geht, scheint in der öffentlichen<br />
Diskussion kaum Beachtung zu finden.<br />
Laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanz<br />
wurde im Jahr 2011 rund 49 % der<br />
Endenergie als Prozess- und Raumwärme<br />
verbraucht, 22 % als elektrischer<br />
Strom und 29 % als Kraftstoff. Ein<br />
Kernelement einer nachhaltigen Energieversorgung<br />
ist nicht ohne Grund<br />
die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).<br />
Dabei wird die bei<br />
der Verbrennung entstehende<br />
Abwärme<br />
in Kraftwerken oder<br />
Blockheizkraftwerken<br />
in einem Sekundärkreislauf<br />
als Wärme<br />
anderen Verbrauchern<br />
zu Heizzwecken zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Von den so in Deutschland<br />
produzierten<br />
135 Mrd. kWh Wärme<br />
gehen rund 56 %<br />
in die Industrie und<br />
41 % in die Haushalte.<br />
Insgesamt werden<br />
so 4,9 Mio. Haushalte<br />
mit Wärme versorgt. Der Ausbau der<br />
KWK führte in den letzten zehn Jahren<br />
zu einem Anstieg der Trassenlänge<br />
von rund 18.000 km in 2001 auf etwa<br />
23.400 km in 2011, die sich auf 410<br />
Fernwärmenetzbetreiber aufteilen. Ein<br />
weiteres Phänomen der letzten Jahre<br />
ist, dass Stadtwerke und Kommunen<br />
vermehrt selbst als Strom- und Wärmeproduzenten<br />
auftreten aber auch<br />
private Anlagenbetreiber. Direkt damit<br />
verbunden ist der weitere Ausbau des<br />
Fern- und Nahwärmenetzes. Letzteres<br />
wird bei kleineren KWK-Anlagen für<br />
den Wärmetransport installiert, um die<br />
im Umfeld der Anlage stehenden Endabnehmer<br />
mit Wärme zu versorgen.<br />
„Die Fakten zeigen, dass die Fernwärme<br />
bei der Gestaltung der zukünftigen,<br />
sicheren Energieversorgung eine<br />
bedeutende Rolle einnehmen wird“, ist<br />
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, Vorstandsmitglied<br />
des Instituts für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule<br />
Oldenburg e.V. und Geschäftsführer<br />
der iro GmbH Oldenburg, überzeugt.<br />
Grund genug, diesem Themenkomplex<br />
auf dem Forum in 2015 drei Vortragsblöcke<br />
zu widmen und sich mit den<br />
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen<br />
sowie aktuellen technischen<br />
Entwicklungen und der Baupraxis<br />
intensiv auseinander zu setzen. Ein<br />
weiteres Anwendungsfeld der Fernwärme<br />
ist der Kältetransport. Aufgrund<br />
der hervorragenden Dämmwirkung<br />
von Fernwärmeleitungen werden diese<br />
immer häufiger auch zur Erstellung von<br />
Fernkältenetzen eingesetzt. Ein aktuelles<br />
Forschungsvorhaben setzt sich mit<br />
der Fragestellung auseinander, wie<br />
man Fernwärme mit Geothermie koppeln<br />
kann. In den drei Vortragsblöcken<br />
„Chancen der Wärmenetze im energiepolitischen<br />
Aufbruch“, „Moderne<br />
Wärmenetze, Systembauteile, Regelwerke“<br />
und „Fernwärmenetze im<br />
Ausbau – Praxisbeispiele“ werden die<br />
aktuellen technischen Aspekte beim<br />
Bau und Betrieb von Fernwärmeleitungen<br />
vorgestellt.<br />
14 10-11 | 2014
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Klassiker-Themen kommen zu<br />
ihrem Recht<br />
Dass das bei weitem noch nicht alles<br />
ist, werden die Besucher des 29.<br />
Oldenburger Rohrleitungsforums<br />
hautnah erfahren. Selbstverständlich<br />
wird auch den klassischen Themenfeldern<br />
wie „Rohrwerkstoffe“ und<br />
„Horizontal Directional Drilling (HDD)“<br />
oder Themen aus den Bereichen<br />
Schweißtechnik, Recht oder EDV der<br />
ihnen zustehende Platz eingeräumt.<br />
Und die branchenspezifischen Verbände<br />
kommen zu Wort, die in Vorträgen<br />
oder mit Ausstellungsständen ihr<br />
Leistungsspektrum vorstellen können.<br />
Ihren festen Platz werden wiederum<br />
ausgewählte Absolventen der Jade<br />
Hochschule einnehmen und eine Reihe<br />
an druckfrischen Abschlussarbeiten<br />
präsentieren. „Die Ergebnisse aus dem<br />
Bereich des Rohrleitungsbaus oder des<br />
allgemeinen Baubetriebes zeigen die<br />
große Praxisnähe und die hohe fachliche,<br />
kompetente Auseinandersetzung<br />
der Studenten mit aktuellen Fragestellungen<br />
aus der Rohrleitungspraxis“,<br />
sagt Prof. Wegener.<br />
Auf diese Weise wird das Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum auch in seiner<br />
29. Auflage das bleiben, was es schon<br />
immer war: Dreh- und Angelpunkt<br />
für den fachlichen Austausch der<br />
gesamten Rohrleitungsbranche. „Hier<br />
findet jeder etwas Interessantes für<br />
seine berufliche Praxis – egal ob der<br />
Besucher aus dem Gas-, Öl-, Wasser-,<br />
Abwasser oder Fernwärmebereich<br />
kommt“, ist Wegener überzeugt.<br />
Dementsprechend wünscht er sich<br />
auch für 2015 spannende und interessante<br />
Diskussionen, wobei sich immer<br />
wieder auch der Blick über den Tellerrand<br />
lohnt. Die Chance hierzu gibt<br />
es unter anderem bei der „Diskussion<br />
im Cafe“, bei der über „Widersprüche<br />
im Regelwerk – Sprengsatz für die<br />
Baupraxis?“ gestritten werden darf.<br />
Rohrverschweißung an der WEDAL :<br />
20.000 Schweißnähte für 320 km Leitung<br />
Anmeldungen und KONTAKT:<br />
Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg (iro)<br />
Ina Kleist<br />
26121 Oldenburg<br />
Tel.: +49 441/361039 0<br />
kleist@iro-online.de<br />
www.iro-online.de<br />
Foto: GASCADE Gastransport GmbH<br />
Multisensorik – direkt<br />
in der Leitung<br />
PHYSIK<br />
• Temperatur<br />
• Durchfl uss<br />
• Druck<br />
• Leitfähigkeit<br />
OPTIK<br />
• Trübung<br />
• Farbe<br />
Vertrieb durch:<br />
Düker GmbH & Co. KGaA<br />
Hauptstrasse 39–41<br />
D-63846 Laufach<br />
Tel. +49 6093 87 555<br />
www.dueker.de<br />
multisensorik@dueker.de<br />
CHEMIE<br />
• Freies Chlor<br />
• Mono Chloride<br />
• Sauerstoff gelöst<br />
• pH-Wert<br />
• ORP (Redox)<br />
• ISE:<br />
- Ammonium oder<br />
- Fluoride oder<br />
- Nitrate<br />
DATENÜBERTRAGUNG<br />
• LAN / Internet<br />
• GPRS<br />
• Modbus / SCADA<br />
• Analog<br />
Nehmen Sie teil am<br />
4. Praxistag <strong>Wasserversorgung</strong>snetze<br />
in Rheine am 5.11.2014<br />
und erleben Sie<br />
unseren Fachbeitrag<br />
Hinni – sicher innovativ<br />
10-11 | 2014 Hinni AG, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken (BL),Tel. +41 61 726 66 00, www.hinni.ch, info@hinni.ch 15
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
Bildquelle: <strong>Wasserversorgung</strong> Zürich /Hunziker Betatech AG<br />
Der Einfluss von Korrosion auf die Bewertung des<br />
Anlagenzustands von Versorgungssystemen<br />
Experten aus 14 Ländern diskutierten<br />
auf der diesjährigen CEOCOR-Konferenz<br />
Mitte des Jahres in Weimar<br />
über den Einfluss der Korrosion auf<br />
Infrastruktursysteme und gaben Ausblicke<br />
auf künftige problematische<br />
Entwicklungen zur Substanzerhaltung<br />
der unterirdischen Infrastrukturanlagen.<br />
<strong>3R</strong> berichtete bereits in Ausgabe<br />
6/2014 darüber. Im Folgenden wird<br />
ein kurzer Rückblick auf die Themen<br />
aus dem Bereich „Asset Management<br />
in der Trinkwasserversorgung“<br />
gegeben:<br />
Die risiko- und zustandsorientierte<br />
Erneuerung und Optimierung der<br />
Gas- und Wasserverteilnetze mit<br />
optimierter Zielnetzplanung wurden<br />
an praktischen Beispielen aus der<br />
Schweiz im Rahmen eines übergeordneten<br />
Asset Management Systems<br />
dargestellt. Die Rahmenbedingungen<br />
können durch die ISO 5000- Familie<br />
abgeleitet werden. Schwerpunkte<br />
für die strategische Planung und<br />
der Dringlichkeit der Erneuerung sind<br />
neben den Bestandsdaten aus dem<br />
GIS, im Wesentlichen der Zustand der<br />
Leitungssysteme und die Definition<br />
der möglichen Risiken. Zur Ermittlung<br />
der Erneuerungsprioritäten und<br />
Erneuerungsumfang wurden Rechenmodelle<br />
und statistische Programme<br />
aus der ROKA-Serie eingesetzt, die<br />
ein Optimum an Investitionskosten,<br />
hydraulischen Bedingungen und<br />
Instandhaltungsaufwand erlauben<br />
auszugeben. Im Weiteren können<br />
koordinierte Baumaßnahmen anderer<br />
Sparten mit berücksichtigt werden.<br />
Aus Zürich wurde zur Früherkennung<br />
möglicher Schäden und Qualitätsveränderungen<br />
des Trinkwassers in Leitungssystemen<br />
ein Pilotprojekt vorgestellt.<br />
Multi Parameter Sensoren zur<br />
Erfassung verschiedener technischer,<br />
hydraulischer und qualitativer Parameter<br />
sollen an selektiven Positionen<br />
installiert und online ausgewertet<br />
werden. Mit diesem Monitoring System<br />
sollen künftig Einflüsse auf die<br />
Trinkwasserqualität, Fließveränderungen<br />
und eine Früherkennung von<br />
Schäden und Störungen erkannt und<br />
Schlusskontrolle einer mit Zementmörtel neu ausgekleideten Hauptleitung aus Stahl<br />
(DN 1200, Baujahr 1959) zur Nutzungsverlängerung<br />
abgewendet werden. Erste Testinstallationen,<br />
mit im Rohrnetz eingebauten<br />
Sensoren, sind in einem typischen<br />
Klappen- und Kontrollschacht seit<br />
über einem Jahr in Betrieb.<br />
Die Korrosionsbewertung von Trinkwasser-Transportleitungen<br />
ist Grundlage<br />
zur Bestimmung der Restlebensdauer.<br />
Aus diesen Ergebnissen und<br />
weiteren Einflussfaktoren werden im<br />
Programm PIMS die Instandhaltungsstrategien<br />
zur Unterstützung der Versorgungssicherheit<br />
abgeleitet. Durch<br />
einen Integritätsnachweis wird der Nutzungsvorrat<br />
ermittelt, der Grundlage<br />
für die Sanierungsmaßnahmen und<br />
dessen Zeitpunkt ist.<br />
Duktile Gussleitungen werden in der<br />
Trinkwasserversorgung sehr verbreitet<br />
eingesetzt und die Entwicklung der<br />
Korrosionseinwirkungen von außen<br />
und innen wurden aufgezeigt. Die<br />
Zementmörtelauskleidung ist ein wirksames<br />
System zur Gewährleistung der<br />
Trinkwasserhygiene, dessen Nachhaltigkeit<br />
vorgestellt wurde.<br />
Korrosionsauswirkungen an der Innenwandung<br />
der Leitungen von Transportund<br />
Verteilsystemen sowie Hausinstallationen<br />
werden im Wesentlichen vom<br />
Leitungsmaterial und dem eingebrachten<br />
Wasser beeinflusst. Das Leitungsmaterial<br />
bzw. deren Auskleidungen sind<br />
daher auf die Qualität des Trinkwassers<br />
durch korrekte Planungsvorgaben abzustimmen.<br />
Bei bereits bestehenden Verteilungssystemen<br />
und Hausinstallationen,<br />
bei denen ein Austausch der Rohre<br />
und Komponenten nicht oder nur mit<br />
großem Kostenaufwand möglich ist,<br />
kann versucht werden, das Ausmaß der<br />
Korrosion durch eine Änderung der vorliegenden<br />
Trinkwasserbeschaffenheit<br />
zu verringern. Die Auswahl geeigneter<br />
Aufbereitungsverfahren und die Auslegung<br />
sowie der Betrieb der Anlagen<br />
erfordern entsprechende Erfahrung.<br />
Zudem sollten die Auswirkungen einer<br />
gewählten Aufbereitungsmaßnahme<br />
bereits vor der Umstellung mit experimentellen<br />
Modellversuchen überprüft<br />
werden.<br />
16 10-11 | 2014
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Ein aktuelles Problem entsteht<br />
durch den Einfluss der Klimaerwärmung<br />
und der damit einhergehende<br />
Anstieg der Trinkwassertemperaturen.<br />
Bereits laufende Untersuchungen<br />
an verschiedenen Leitungsmaterialien<br />
durch ein wissenschaftliches Institut<br />
in Schweden zeigen diese Problematik<br />
der Innenkorrosion durch lange<br />
Verweildauern des Wassers im Leitungsrohr<br />
auf.<br />
In der <strong>Abwasserentsorgung</strong> treten<br />
verschiedene bekannte Korrosionsvorgänge<br />
auf, wie kathodische Korrosion,<br />
Sauerstoffkorrosion, aber auch “mikrobiell<br />
unterstützte Korrosion“. Hier<br />
handelt es sich um eine Biokorrosion<br />
an Materialien, die durch mikrobielle<br />
Einflüsse an allen Materialien bei Leitungen,<br />
Einbauten und Maschinen<br />
sichtbar ist. Diese „nicht klassische Korrosion“<br />
beeinflusst den Zustand und<br />
die Funktion der Abwassersysteme und<br />
verringert die Anlagensubstanz. Von<br />
besonderer Bedeutung ist hierbei die<br />
biogene Schwefel.<br />
Zur Erhaltung der Anlagensubstanz<br />
von Energie-, Wasser- und Entwässerungssystemen<br />
ist eine übergreifende<br />
Betrachtung des Anlagen- und<br />
Leitungszustands erforderlich und<br />
im Rahmen einer Zielnetzplanung<br />
ein systematisches Erneuerungsprogramm<br />
zu entwickeln. Der jetzige<br />
Anlagenwert gilt als Basis für die<br />
künftigen Investitionen. Im Bereich<br />
der Leitungssysteme muss die<br />
Gesamtheit der im Straßenkörper verlegten<br />
Systeme inklusive des Straßenzustands<br />
und deren künftige Entwicklung<br />
berücksichtigt werden. Durch<br />
eine Mehrspartenbetrachtung und<br />
deren Umsetzung im Rahmen eines<br />
Sanierungsprojektes können optimale<br />
Synergien in Planung, Bau und Kosten<br />
erwartet werden. Die Priorisierung<br />
der zu erneuernden Leitungsabschnitte<br />
erfolgt über ein gewichtetes<br />
Priorisierungsmodell basierend<br />
auf Alterungs- und Zustandsmodellierung,<br />
äußeren Einflüssen, Zukunftsprognosen<br />
und Risikoüberlegungen.<br />
Die priorisierten Leitungsabschnitte<br />
werden mit Kosten für verschiedene<br />
Sanierungsverfahren hinterlegt und in<br />
die Zukunft prognostiziert. Das vorgestellte<br />
Forschungsprogramm REHAB<br />
deckt alle Ver- und Entsorgungssparten<br />
mit Straßenbau im Rahmen der<br />
strategischen Zielsetzungen ab.<br />
Die nächste CEOCOR-Konferenz findet<br />
vom 2. bis zum 4. Juni 2015 in Stockholm<br />
statt. Interessenten können sich<br />
wenden an: Max Hammerer, Präsident<br />
der CEOCOR Kommision 1, max@hammerer.cc<br />
oder www.ceocor.eu.<br />
Neue Plombierschellen von Kettner<br />
Schraubverbindungen von Wasser- und<br />
Gasarmaturen sind durch geeignete<br />
Maßnahmen gegen unbefugte Manipulation<br />
zu sichern. Diese Maßnahmen<br />
sollen beabsichtigte Manipulationen<br />
erschweren und bereits erfolgte Manipulation<br />
sichtbar machen. Vor dem<br />
Hintergrund dieser Anforderungen<br />
entwickelte Kettner eine neue Plombierschelle.<br />
Im Fokus steht dabei eine<br />
praxisgerechte, wirtschaftliche und<br />
einfach zu handhabende Lösung.<br />
Die Plombierschelle mit der Typenbezeichnung<br />
Kett-Seal SC besteht aus zwei<br />
Halbschalen aus stabilem Kunststoff.<br />
Die beiden Hälften der Plombierschelle<br />
werden um die zu sichernde<br />
Schraubverbindung gelegt und einfach<br />
von Hand oder mit Hilfe einer handelsüblichen<br />
Flachzange miteinander<br />
verbunden. Zur Montage ist keinerlei<br />
Spezialwerkzeug erforderlich. Durch<br />
den integrierten Rastverschluss rasten<br />
beide Hälften dauerhaft ineinander<br />
ein. Ein gewaltsames Auseinanderreißen<br />
beider Hälften hat die Zerstörung<br />
der Plombierschelle zur Folge.<br />
Somit wird zuverlässig der Versuch<br />
einer Manipulation oder die erfolgte<br />
Manipulation an der Schraubverbindung<br />
angezeigt. Dem Ruf zahlreicher<br />
Netzbetreiber folgend, bietet die Plombierschelle<br />
zahlreiche Möglichkeiten<br />
der Personalisierung. Neben dem<br />
Einbringen kundenspezifischer Logos<br />
oder von Hinweistexten, ist optional<br />
ein Beschriftungsfeld z. B. zur Darstellung<br />
eines vorgegebenen Nummernkreises<br />
erhältlich. Neben den beiden<br />
klassischen Farben für gelb für Gas und<br />
blau für Wasser sind auch kundenspezifische<br />
Farben realisierbar.<br />
KONTAKT: G.A. Kettner GmbH, Villmar<br />
Tel.: +49 6482/9131-0<br />
info@kettnergmbh.de<br />
www.kettnergmbh.de<br />
10-11 | 2014 17
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Neue Infrastruktur-Software für den Rohrleitungsbau<br />
Die Stuttgarter RIB Software AG führt<br />
das Programm iTWO civil in der neuen<br />
Version 2015 in den Markt ein. Die<br />
Softwarelösung für ein durchgängig<br />
modellbasiertes Arbeiten in allen Projektphasen<br />
ist mit neuen Funktionalitäten<br />
für den Rohrleitungsbau ausgestattet.<br />
Erweitert um eine intelligente<br />
Rohrgrabenabrechnung über Querprofile<br />
macht iTWO civil eine schnelle und<br />
nachvollziehbare Mengenberechnung<br />
möglich: Die verschiedensten Typen<br />
von Mengen für Aufgaben in diesem<br />
Segment – von Aushub über Verfüllung<br />
oder bebaute Fläche bis hin zu<br />
Stücklisten von Schachtringen oder<br />
Ausgleichsringen – berechnet die Softwarelösung<br />
vollkommen automatisch.<br />
Sämtliche Herstellervorgaben für die<br />
unterschiedlichen Mengentypen sind<br />
Bestandteil der relationalen Datenbank<br />
von iTWO civil. Änderungen von Sohl-,<br />
Deckel- oder Geländehöhe passt das<br />
System somit stets innerhalb der Mengenberechnung<br />
an.<br />
Die Möglichkeit einer Abrechnung<br />
nach verschiedenen Tiefenstufen, die<br />
das System aus dem Gelände oder<br />
der Situation heraus ebenfalls automatisiert<br />
ermittelt, bringt weiteren<br />
Komfort in der Bauabrechnung. Alle<br />
Mengen und Daten werden stets<br />
dynamisch aktualisiert. Alternativ<br />
kann auch eine Abrechnung anhand<br />
geologischer Bodenschichtmodelle<br />
– je nach Planvorgabe – erfolgen.<br />
Durch integrierte Querprofile in<br />
iTWO civil lässt sich die Abrechnung<br />
im Rohrleitungsbau direkt mit den<br />
Berechnungen im Straßenbau kombinieren,<br />
wodurch wiederum Arbeitsschritte<br />
eingespart werden können.<br />
iTWO civil erlaubt die Definition von<br />
Rohrleitungen mit unterschiedlichen<br />
Profilen und ist an aktuelle Standards<br />
angepasst. So berücksichtigt die<br />
Lösung die DIN EN 1610, die DIN 4124<br />
für die Dimensionierung von Bauteilen<br />
sowie die DIN 18300 zur Berechnung<br />
von Aushub, Verfüllung und den Verbau<br />
von Rohrlängen.<br />
Im Juli 2014 hat das Unternehmen<br />
das End-to-End-Projektsteuerungssystem<br />
iTWO civil für modellorientierte<br />
Bauplanung- und -ausführung<br />
im Straßen-, Tief- und Infrastrukturbau<br />
in den Markt eingeführt. Die<br />
ersten Bauunternehmen und Öffentlichen<br />
Verwaltungen haben die produktive<br />
Arbeit mit dem durchgängig<br />
integrierten Softwaresystem entlang<br />
der gesamten Prozesskette bereits<br />
mit Erfolg gestartet.<br />
KONTAKT:<br />
RIB Deutschland GmbH, Stuttgart<br />
Schnelle Verbindung von Gas- und<br />
Trinkwasserrohrleitungen<br />
In vielen Teilen der Automobilindustrie,<br />
im Flugzeugbau und Offshorebereich<br />
werden dort wo hohe Anforderungen<br />
an Materialien gestellt<br />
werden technische Werkstoffe verwendet.<br />
Der ISIFLO-Sprint Fitting in<br />
den Dimensionen von 20 mm bis<br />
63 mm aus technischem Polyamid<br />
vereint jetzt die Stärke und Sicherheit<br />
einer traditionellen mechanischen<br />
Kupplung mit der Nutzerfreundlichkeit<br />
eines Steckfittings. Die Vorteile<br />
dieses Materials werden gerade im<br />
Gewindebereich besonders deutlich.<br />
Die Verbindung zwischen PE-Rohr<br />
und Fitting wird durch ein einfaches<br />
Einstecken des Rohres in den Verbinder<br />
erreicht. Geräte oder zusätzliche<br />
Werkzeuge sind nicht notwendig. Es<br />
kann jederzeit und völlig unabhängig<br />
von Witterungsbedingungen gearbeitet<br />
werden. Durch ein patentiertes<br />
Klemm- und Dichtsystem wird bei<br />
der Montage die Dichtung automatisch<br />
so auf das Rohr gedrückt, dass<br />
die Verbindung auch unter Niederdruckbedingungen<br />
dicht und auszugsicher<br />
ist. Diese Eigenschaften<br />
werden durch eine DVGW-Zulassung<br />
für den Wasser- und Gasbereich<br />
bestätigt.<br />
ISIFLO-Sprint ist ein norwegisches Qualitätsprodukt.<br />
Das Programm besteht<br />
aus Kupplungen, Winkel, Anschlussfittings,<br />
Endkappen und T-Stücke.<br />
KONTAKT:<br />
Raufoss Metall GmbH, Hemer<br />
Tel.: +49 2372/919764<br />
weiche@raufoss-metall.de<br />
www.isiflo.de<br />
18 10-11 | 2014
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
Multikorrelator für präzise Leckageortung<br />
Multikorrelatoren, auch korrelierende<br />
Logger genannt, sind eine relativ<br />
junge Generation von Korrelatoren, die<br />
verstärkt zur präzisen Leckageortung<br />
eingesetzt werden. Der Sebalog Corr<br />
von Seb KMT ist ein Hybrid zwischen<br />
einem Feldkorrelator und einem Set<br />
von Geräuschpegelloggern, und kombiniert<br />
die selbstständige Arbeitsweise<br />
der Logger mit der Fähigkeit des<br />
Korrelators, Leckagen punktgenau zu<br />
orten. So können Anwender selbst<br />
schwer zu ortende Leckagen effizient<br />
und kostengünstig finden. Die<br />
Sensoren des Sebalog Corr messen<br />
selbstständig und werden nach der<br />
Messung ausgelesen. Durch die hohe<br />
Anzahl an Sensoren wird mit einer<br />
einzelnen Messung bereits ein großer<br />
Leitungsabschnitt überprüft. So kann<br />
die Rohrnetzüberprüfung sehr schnell<br />
und effizient durchgeführt werden.<br />
Auch das Erkennen von mehreren<br />
Leckagen ist durch eine einzige Messung<br />
möglich. Mit dem System möchte<br />
SebaKMT neue Maßstäbe für Multikorrelatoren<br />
setzen. Eigenschaften wie<br />
der Punktortungsmodus, die Funkverbindung<br />
zu den Sensoren, und einem<br />
GPS-gestützten Leck-Navigator sind<br />
nur einige der Funktionen des Sebalog<br />
Corr. Eine der außergewöhnlichsten<br />
Funktionen des Sebalog Corr ist der<br />
Leck-Navigator, der den Anwender<br />
mittels GPS wie ein Navigationssystem<br />
direkt zum Ort der korrelierten<br />
Leckage führt. Der Anwender kann<br />
dabei auf dem Display sehen, wo er<br />
sich im Moment befindet und wohin er<br />
sich bewegen muss, um die Leckstelle<br />
zu erreichen.<br />
Die Punktortungsfunktion des Sebalog<br />
Corr ermöglicht die Verwendung<br />
der Sensoren als Bodenmikrofone. Die<br />
Sensoren werden um die zuvor korrelierte<br />
Position aufgestellt und senden<br />
dem Anwender per Funk die Position<br />
der Leckage zu. Durch die Punktortung<br />
werden keine zusätzlichen Geräte<br />
benötigt, um die Leckage direkt vor<br />
Ort zu bestätigen und zu lokalisieren.<br />
KONTAKT:<br />
SebaKMT Seba Dynatronic ® Mess- und Ortungstechnik<br />
GmbH, Baunach<br />
Tel.: +49 9544-680<br />
www.sebakmt.com<br />
Korrelationsprinzip<br />
Lösungen für Nah- und Fernwärme<br />
Vom 11. bis zum 14. November präsentiert<br />
sich Rehau auf der EnergyDecentral<br />
in Hannover. Hier stehen innovative<br />
Technologien für die Erzeugung von<br />
Energie aus regenerativen Energiequellen,<br />
die Anlageneffizienz sowie<br />
die Speicherung und Verteilung der<br />
erzeugten Energie im Mittelpunkt.<br />
Für die Nah- und Fernwärmeversorgung<br />
bietet das Unternehmen zwei vorgedämmte<br />
Rohrsysteme. RAUVITHERM<br />
ist eine Lösung für die Wärmeverteilung<br />
im Gebäudebestand, für kleinere<br />
Wärmenetze und die Anbindung einzelner<br />
Anschlussnehmer. Dank mehrerer<br />
weicher Dämmschaumlagen und des<br />
gewellten, besonders widerstandsfähigen<br />
Außenmantels ermöglicht das<br />
Hybridrohrsystem höchste Flexibilität<br />
bei gleichzeitig sehr großer Robustheit.<br />
Hierdurch lassen sich sowohl außerordentlich<br />
komplexe Anbindungen in<br />
Wärmenetzen als auch Installationen<br />
unter beengten Platzverhältnissen<br />
realisieren. Für die Wärmeverteilung<br />
in großen Nahwärmenetzen oder bei<br />
großen Abständen zu einzelnen Wärmeabnehmern<br />
bietet das Unternehmen<br />
das System RAUTHERMEX an. Das<br />
Rohrsystem verfügt dank einer Polyurethan-Schaumdämmung<br />
über besonders<br />
hohe Wärmedämmeigenschaften. So<br />
werden die Verluste beim Wärmetransport<br />
besonders gering gehalten.<br />
Neben den Rohrsystemen stellt Rehau<br />
auch seine Verlegehilfe STRAITA vor.<br />
Durch die Wicklung der Rohre auf<br />
Ringbunde sind sie im abgewickelten<br />
Zustand an den Enden stark gebogen.<br />
Durch dieses Phänomen werden insbesondere<br />
bei Verbindung großer Dimensionen<br />
schwere Hebezeuge benötigt,<br />
um die Rohre gerade zusammenzuführen.<br />
Mit STRAITA können gebogene<br />
Rohrenden ohne großen Kraftaufwand<br />
einfach begradigt werden, um<br />
eine optimale Positionierung für die<br />
Installation der Verbindungstechnik zu<br />
erreichen. Der Vorgang erfolgt mittels<br />
eines stabilen Zwei-Beins mit speziellen<br />
Rohraufnahmen und einem handelsüblichen<br />
Kettenzug, der die vorgedämmten<br />
Rohre einfach, sicher und stufenlos<br />
in eine gerade Position bringt.<br />
KONTAKT:<br />
REHAU AG + Co, Rehau<br />
Tel.: +49 9283 77-0<br />
info@rehau.com<br />
10-11 | 2014 19
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
RD Marker-Suchsysteme<br />
Die neue Serie der Präzisionssuchsysteme<br />
von Radiodetection erweitert<br />
die Hochleistung und Ergonomie der<br />
RD7000 TM + und RD8000 TM Plattformen<br />
und wurde speziell für Ortungsexperten<br />
und Versorgungsunternehmen<br />
entwickelt,<br />
die Funkfrequenz-Marker für Versorgungsleitungen<br />
entlang der unterirdischen<br />
Infrastruktur orten müssen.<br />
Mit TruDepth TM , dem automatischen<br />
Tiefenmesssystem von Radiodetection,<br />
und dem kombinierten Versorgungsleitungs-<br />
und Marker-Suchmodus ermöglichen<br />
die Marker-Suchsysteme schnellere<br />
und genauere Untersuchungen.<br />
Verbindungen mit Karten und GIS-<br />
Systemen werden durch interne GPS-<br />
Funktionen und praktische Bluetoothund<br />
USB-Konnektivität erleichtert.<br />
Die eingebaute GPS-Option erlaubt<br />
es Anwendern, die Untersuchungsmessungen<br />
durch zweckdienliche<br />
Positionsdaten zu erweitern, ohne<br />
zusätzliche Geräte mitführen zu<br />
müssen. Alternativ sind alle Einheiten<br />
mit Bluetooth ausgestattet, sodass<br />
Messungen automatisch an externe<br />
Geräte übertragen werden können.<br />
RD8000 Modelle ermöglichen ein<br />
leichtes Abrufen gespeicherter Messwerte<br />
über USB und das Exportieren<br />
in geläufige Dateiformate wie KML<br />
für Google Earth.<br />
Die Überwachung der Nutzung, Verbesserung<br />
der besten Praktiken und<br />
Nachweis der Arbeitsleistung erfolgen<br />
bei einigen Modellen über die automatische<br />
Datenaufzeichnung. Jede<br />
Sekunde werden Hauptortungsparameter<br />
auf der internen Festplatte der<br />
Einheit gespeichert.<br />
Über einen Zeitraum von bis zu einem<br />
Jahr gespeicherte Daten können über<br />
die praktische, zuverlässige USB-Verbindung<br />
und den RD-Manager, dem<br />
PC-Kompagnon der Marker-Suchsystemserie,<br />
abgerufen und analysiert<br />
werden. GPS-Modelle bieten darüber<br />
hinaus den Vorteil, Untersuchungsorte<br />
nachweisen zu können.<br />
Die Einführung der Radiodetection<br />
Serie ist unkompliziert: Sie nutzt dieselben<br />
Bildschirme und Abläufe wie<br />
die bewährten RD7000+ und RD8000-<br />
Serien und können mit ihrem gesamten<br />
Zubehör und allen Sendern eingesetzt<br />
werden.<br />
KONTAKT:<br />
Radiodetection, Emmerich am Rhein<br />
Tel. +49 28 51923720<br />
marion.giesbers@spx.com<br />
Curaflex Nova ® Senso Produkt des Jahres<br />
Das Dichtungssystem Curaflex Nova ®<br />
Senso von DOYMA ist zum „Besten<br />
Produkt des Jahres 2014“ (Kategorie<br />
„Heizung + Klima“) beim Plus X Award<br />
gewählt worden. Die unabhängige<br />
Fachjury bestätigte die Produktleistung<br />
mit Gütesiegeln für Innovation, High<br />
Quality und Funktionalität.<br />
Die Ringraumdichtung des Curaflex<br />
Nova ® Senso ist mit einem innenliegenden,<br />
spezialangefertigten Butylband<br />
ausgekleidet. Das Material ist besonders<br />
weich und kann sich tief in die<br />
Rillen schmiegen. Dadurch dichtet es<br />
auf der Rohroberfläche dauerhaft und<br />
schonend ab. Ein weiteres, technisches<br />
Feature garantiert beim Verspannen<br />
immer das richtige Drehmoment: ITL<br />
(Integrated Torque Limiter). Speziell für<br />
diesen Zweck entwickelte Muttern trennen<br />
sich bei einem definierten Drehmoment<br />
schnell und zuverlässig ab. Das<br />
System ist im Handumdrehen dicht.<br />
Auch dieser Dichtungseinsatz ist mit<br />
dem bewährten DPS-System (Double<br />
Profile System) ausgestattet. Dadurch<br />
wird der schonende Anpressdruck auf<br />
die Medienleitung gewährleistet, der<br />
gerade bei leicht verformbaren Rohrarten<br />
von großer Wichtigkeit ist.<br />
Das System kann ideal bei Kunststoffmantelrohren,<br />
flexibel vorisolierten<br />
Kunststoffrohren sowie flexiblen<br />
Kabelschutzrohren eingesetzt<br />
werden.<br />
KONTAKT.<br />
DOYMA GmbH & Co., Oyten,<br />
Tel.: +49 4207 9166-270<br />
www.doyma.de<br />
20 10-11 | 2014
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
MGC – smarte Netzdatenauskunft und mehr<br />
Mit dem MGC von Mettenmeier heißt<br />
es für Betreiber von Ver- und Entsorgungsnetzen:<br />
Einfach einschalten<br />
und loslegen – und zwar mit einem<br />
modernen und benutzerfreundlichen<br />
Standard. Diese Web-GIS-Lösung<br />
macht die Navigation im Netz kinderleicht.<br />
Ver- und Entsorgungsunternehmen<br />
können ihre Betriebsmitteldaten<br />
und ihr Planwerk online und<br />
offline visualisieren und bearbeiten.<br />
MGC kommt dabei am Büroarbeitsplatz<br />
und als Touch-Variante auch auf<br />
modernen Tablets zum Einsatz. Der<br />
Fokus liegt auf einer äußerst einfachen<br />
Bedienung.<br />
Die Intelligenz der Lösung liegt in<br />
ihrem Kern: Das MGC Warehouse<br />
verarbeitet Daten aus verschiedensten<br />
Quellen und stellt diese in Form von<br />
leicht zu bedienenden APPs für spezielle<br />
Einsatzzwecke der Netzwirtschaft<br />
zur Verfügung. Damit können eigene<br />
Karten mit allen Betriebsmitteldaten<br />
auch auf einem iPad oder Android-<br />
Tablet mitgenommen werden, sei es<br />
aus dem Smallworld GIS oder auch aus<br />
anderen Systemen. Unterwegs kann<br />
man sich interaktiv in der GIS-Karte<br />
bewegen, Objektattribute anzeigen<br />
lassen und aktuelle Position per GPS<br />
verfolgen. Zur einfachen Identifikation<br />
lassen sich Betriebsmittel auch einfach<br />
per QR-Code-Scan erfassen.<br />
Apps-Konzept<br />
MGC bietet ein flexibles Apps-Konzept:<br />
Kleine, fokussierte Anwendungen<br />
stehen für die speziellen Einsatzzwecke<br />
der Netzwirtschaft zur Verfügung.<br />
Der Web-Client kann je nach<br />
Anforderung des Kunden individuell<br />
ausgeprägt werden. Beispiele sind<br />
MGC Hydrantenauskunft für die Feuerwehr,<br />
MGC Leuchtenauftrag für die<br />
Monteure, MGC Konzession zur GIS-<br />
Auskunft bis zur Gemeindegrenze oder<br />
MGC Planauskunft zur Auskunft für<br />
externe Dienstleister gemäß GW 118<br />
und S 118.<br />
Zur Unterstützung der<br />
Instandhaltungsarbeiten<br />
oder zur Durchführung<br />
spontaner Arbeitsaufträge<br />
lassen sich mit<br />
MGC Task die Aufgaben<br />
und die Ressourcen des<br />
Außendienstes planen<br />
und disponieren. Auf<br />
Betriebsmittel-ebene<br />
lassen sich Terminmuster<br />
für wiederkehrende<br />
Tätigkeiten definieren<br />
und automatisiert als<br />
Terminvorschläge planen.<br />
Vor Ort können die<br />
Aufgaben dann strukturiert im Kontext<br />
des Auftrags dokumentiert werden.<br />
Um die mobilen Prozesse zu optimieren<br />
und um möglichst unabhängig<br />
von einzelnen Systemanbietern oder<br />
gekapselten Anwendungen zu sein,<br />
wurde MGC mit einem offenen IT-<br />
Ansatz konzipiert, der Standards wie<br />
WMS, WFS oder SOA unterstützt. Es<br />
spielt demnach keine Rolle, welches<br />
GIS die Netzdaten liefert, welche Kartendienste<br />
genutzt werden, welches<br />
ERP-System angebunden werden<br />
soll und welches Betriebssystem der<br />
mobile Nutzer im Einsatz hat. Damit<br />
bietet der MGC bereits heute genau<br />
die Flexibilität, die auch künftig von<br />
Netzbetreibern verlangt wird.<br />
Beispielanwendung „MGC Planauskunft“<br />
KONTAKT:<br />
Mettenmeier GmbH Utility Solutions, Paderborn<br />
<strong>3R</strong>_10-10_KGS-TK-Flon_182-62_Layout 1 04.03.14 19:58 Seite 1<br />
KLINGER ® KGS/TK-Flon<br />
TrinkwV<br />
2014<br />
GEPRÜFT<br />
Das Label für zukunftssichere<br />
Dichtungen<br />
KLINGER ® KGS aus EPDM – mit allen aktuellen<br />
Zertifikaten und Zeugnissen für den Trinkwasserbereich<br />
(nach Elastomerleitlinie und<br />
DVGW- W270). Neu: KLINGER ® KGS-Flon mit<br />
FDA-konformer PTFE-Hülle.<br />
KLINGER GmbH<br />
Postfach 1370, D-65503 Idstein<br />
Tel 06126 4016-0, Fax 06126 4016-11/-22<br />
mail@klinger.de, www.klinger.de<br />
10-11 | 2014 21
DVGW RECHT & REGELWERK<br />
Regelwerk<br />
Überarbeitet und aktualisiert:<br />
DVGW-Regelwerk Online Plus<br />
Die Webseite des DVGW-Regelwerks Plus ist jetzt mit neuen<br />
Funktionen und noch mehr Komfort für den Nutzer erreichbar:<br />
So erleichtern z. B. verschiedene Suchmöglichkeiten die<br />
Suche nach Normen und Regeln.<br />
Dabei punktet die neue Seite nicht nur mit einem aufgeräumten<br />
und klaren Layout, besserer Lesbarkeit und ihrer<br />
Optimierung für mobile Anwendungen, sondern auch mit<br />
besonderem Mehrwert: So kann der Nutzer z. B. wählen,<br />
ob er nur in Regeln aus seinem Abo oder in allen Regeln<br />
suchen will. Mit einem Klick auf die Kapitelüberschrift im<br />
Inhaltsverzeichnis der aufgerufenen Regel kommt man<br />
sofort ins gewünschte Kapitel. Suchfilter machen die Suchfunktionen<br />
effizienter und komfortabler. Im Regelwerk-<br />
Archiv sind alle zurückgezogenen bzw. nicht mehr gültigen<br />
DVGW-Regelwerke (Arbeitsblätter, Merkblätter, Hinweise,<br />
Prüfgrundlagen usw.) seit 1950 aufgeführt. Jetzt kann<br />
man sehen, welche Regelwerke anstelle der zurückgezogenen<br />
gültig sind. Das DVGW-Regelwerkarchiv steht für<br />
die Abonnenten der Großmodule des DVGW-Regelwerk<br />
Online Plus (Gesamt, nur Gas, nur Wasser) als kostenloser<br />
Bonus zur Verfügung.<br />
Einen Testzugang und weitere Informationen gibt es unter<br />
www.dvgw.de.<br />
Merkblatt G 692 „Technische Abgrenzung<br />
des Messstellenbetriebes“<br />
Dieses Merkblatt dient als Empfehlung zur technischen<br />
Abgrenzung des Messstellenbetriebs für Messeinrichtungen<br />
im Geltungsbereich der DVGW-Arbeitsblätter G 600<br />
„Technische Regel für Gasinstallationen“ sowie G 492<br />
„Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich<br />
100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme,<br />
Betrieb und Instandhaltung“. Dieses Merkblatt<br />
ist eine Empfehlung zur Umsetzung der sicherheitstechnischen<br />
und eichrechtlichen Anforderungen im Rahmen<br />
des Messstellenbetriebs. Die exakte Abgrenzung zwischen<br />
Messstellenbetreiber, Anlagenbetreiber und Netzbetreiber,<br />
besonders im Bereich der Gasdruckregel- und Messanlagen<br />
(GDRM), ist eine Voraussetzung für eindeutige sicherheitstechnische<br />
und eichrechtliche Verantwortlichkeiten und<br />
damit für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb.<br />
Das Merkblatt gilt in Ergänzung zum DVGW-Regelwerk<br />
G 689 „Technische Mindestanforderungen an den Messstellenbetrieb<br />
Gas“ und zeigt eine mögliche Abgrenzung<br />
der Verantwortlichkeiten zwischen Messstellenbetrieb,<br />
Anlagenbetrieb und Netzbetrieb in Gasinstallationen nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 600 und Gas-Messanlagen nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 492 auf.<br />
Ausgabe 09/2014, EUR 17,61 für DVGW-Mitglieder, EUR 23,49 für<br />
Nicht-Mitglied<br />
Merkblatt GW 17 „Kathodischer<br />
Korrosionsschutz (KKS) - Praxishinweise<br />
zum Umgang mit Referenzwerten“<br />
Dieses Merkblatt wurde vom Projektkreis „Praxishinweise<br />
Referenzwerte“ im Technischen Komitee „Außenkorrosion“<br />
erarbeitet. Es dient als Grundlage für die Ermittlung von<br />
Referenzwerten nach DVGW GW 10 (A). Bisher gestaltet<br />
sich die Ermittlung von Referenzwerten in der Praxis gerade<br />
für ältere Leitungen als schwierig. Im DVGW GW 10 (A)<br />
fehlen bislang Hinweise, wie Referenzwerte einheitlich und<br />
sicher ermittelt werden können. Das Merkblatt schließt<br />
diese Lücke und gibt dem Anwender konkrete Hinweise.<br />
Ausgabe 09/2014, EUR 30,46 für DVGW-Mitglieder, EUR 40,62 für<br />
Nicht-Mitglieder<br />
Merkblatt GW 117 „Kopplung von GISund<br />
ERP-Systemen“<br />
Das DVGW-Merkblatt GW 117 beschreibt die bei einer<br />
Kopplung von GIS- und ERP-Systemen zu berücksichtigenden<br />
Anforderungen und Standards. Sie liefert Beispiele<br />
und Vorgehensweisen aus der Praxis. Das Merkblatt gilt<br />
für die Kopplung von GIS- und ERP-Systemen durch eine<br />
IT-Schnittstelle.<br />
Ausgabe 09/14, EUR 22,71 für DVGW-Mitglieder, EUR 30,29 für<br />
Nicht-Mitglieder<br />
22 10-11 | 2014
RECHT & REGELWERK DVGW / DWA<br />
Entwurf Arbeitsblatt W 225 „Ozon in der<br />
Wasseraufbereitung“<br />
Das Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Oxidation“ im Technischen<br />
Komitee „Wasseraufbereitungsverfahren“ überarbeitet.<br />
Es dient als Grundlage für die Anwendung von Ozon<br />
zum Zweck der Oxidation und Desinfektion in der zentralen<br />
Wasseraufbereitung. Es macht Angaben zu den Reaktionsmechanismen<br />
des Ozons mit organischen und anorganischen<br />
Wasserinhaltsstoffen, zu den Einsatzgebieten Oxidation, Desinfektion,<br />
Mikroflockung und gibt Hinweise zur Auslegung<br />
und Einbindung der Ozonung in die Wasseraufbereitung.<br />
Gegenüber dem Merkblatt aus dem Jahr 2002 wurden die<br />
Angaben zur Abbaubarkeit von Schadstoffen erweitert sowie<br />
ein Kapitel zu den Reaktionsprodukten und ein Bilanzierungsmodel<br />
ergänzt. Zur Erzeugung und Dosierung von Ozon wird<br />
auf das DVGW-Merkblatt W 625 verwiesen.<br />
Ausgabe 09/14, EUR 17,61 für DVGW-Mitglieder, EUR 23,49 für Nicht-<br />
Mitglieder, Einspruchsfrist: 30.11.2014<br />
Merkblatt W 316 „Qualifikationsanforderungen<br />
an Fachunternehmen für<br />
Planung, Bau Instandsetzung und Verbesserung von<br />
Trinkwasserbehältern“<br />
Die Erhaltung der Trinkwasserbeschaffenheit in chemischer,<br />
physikalischer und mikrobiologischer Hinsicht hat innerhalb<br />
eines <strong>Wasserversorgung</strong>ssystems entscheidende Bedeutung.<br />
In diesem System übernimmt die Wasserspeicherung eine<br />
wichtige Funktion. Die regelgerechte Instandhaltung der Wasserbehälter<br />
ist Grundlage für eine einwandfreie Wasserqualität<br />
und einen störungsfreien Betrieb. Die <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen<br />
können den ihnen, insbesondere in der Trinkwasserverordnung<br />
und der DIN 2000 „Zentrale Trinkwasserversorgung:<br />
Leitsätze für Anforderungen an Trinkwasser; Planung,<br />
Bau, Betrieb und Instandhaltung der Versorgungsanlagen”,<br />
gestellten Aufgaben sowie den in DVGW-Arbeitsblatt W 1000<br />
„Anforderungen an Trinkwasserversorgungsunternehmen”<br />
vorgegebenen Strukturen nur gerecht werden, wenn bei<br />
Instandsetzungsarbeiten Mitarbeiter oder Unternehmen eingesetzt<br />
werden, die über die erforderlichen Qualifikationen verfügen.<br />
Im DVGW-Arbeitsblatt W 316 werden die dem Stand<br />
der Technik angepassten Qualifikationsanforderungen und<br />
Qualifikationskriterien an Fachunternehmen festgelegt, welche<br />
im Bereich Planung, Bau und Instandsetzung von Trinkwasserbehältern<br />
tätig sind. Dieses Arbeitsblatt ersetzt die DVGW-<br />
Arbeitsblätter W 316-1:2004-03 und W 316-2:2004-03.<br />
an die Dokumentation von Versorgungsnetzen wurden<br />
in den letzten Jahren stetig gesteigert. Neben den<br />
Standardanwendungen, wie z. B. der Visualisierung der<br />
Netzdaten, stehen heutzutage jedoch vielfältige und<br />
umfangreiche Analysen der Netzstrukturen im Vordergrund.<br />
Erst durch den Einsatz moderner Geoinformationssysteme<br />
(GIS) und insbesondere durch einen qualitätsgesicherten<br />
Datenbestand können zeitnah belastbare<br />
Ergebnisse bereitgestellt werden. Im DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 120 ist festgelegt, dass eine geeignete dokumentierte<br />
Qualitätssicherung sowie deren Nachverfolgung<br />
und Analyse sicherzustellen ist. Hierdurch ist zu gewährleisten,<br />
dass die Netzdaten vollständig, lesbar, richtig<br />
und aktuell erfasst bzw. verwaltet werden. Weitere Hinweise<br />
zu Qualitätsansprüchen und -merkmalen in der<br />
Netzdokumentation finden sich in den unter Abschnitt<br />
2 aufgeführten DVGW-Regeln. Mit dem vorliegenden<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 130 steht für diese Thematik<br />
erstmals ein eigenes Arbeitsblatt zur Verfügung. Es soll<br />
ein Leitfaden zur praktischen Umsetzung der Qualitätssicherung<br />
in der Netzdokumentation sein.<br />
Ausgabe 07/14, EUR 27,35 für DVGW-Mitglieder, EUR 35,47 für<br />
Nicht-Mitglieder<br />
Merkblatt 149-8 „Zustandserfassung<br />
und -beurteilung von<br />
Entwässerungssystemen außerhalb<br />
von Gebäuden - Teil 8: Zusätzliche<br />
technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Optische<br />
Inspektion“ plus Digitales Vertragsformular<br />
ZTV-OI (Kombipaket)<br />
Das digitale Vertragsformular enthält eine Kurzanleitung,<br />
Abschnitt 1-11 des Merkblattes DWA-M 149-8 im<br />
PDF-Format, Abschnitt 12 zur individuellen Anpassbarkeit<br />
als WORD-Vorlage und ein Anwendungsbeispiel.<br />
Dieses Merkblatt liefert ein strukturiertes, Auftraggeber<br />
übergreifendes Anforderungsprofil für die Ausführung<br />
der beauftragten optischen Inspektionen. Die Zusätzliche<br />
Technische Vertragsbedingungen (ZTV) enthalten dazu feste<br />
unveränderliche Texte mit eindeutigen Formulierungen,<br />
die durch Auswahlfelder und/oder zusätzliche<br />
auftraggeberspezifische Texteingaben ergänzt und<br />
angepasst werden können. Die ZTV lassen eine Anwendung<br />
im Vertrag nach VOL und VOB zu. Das digitale Formular<br />
wird nach der Bestellung erstellt und per E-Mail zugeschickt.<br />
Ausgabe 09/2014, EUR 39,37 für DVGW-Mitglieder, EUR 52,49 für<br />
Nicht-Mitglieder<br />
Entwurf Arbeitsblatt GW 130 „Qualitätssicherung<br />
der Netzdokumentation“<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis W-PK-2-5-1<br />
„GW 130“ im Technischen Komitee „Technische Geoinformationssysteme<br />
(GIS) erarbeitet. Die Anforderungen<br />
Ausgabe 9/14, EUR 135<br />
Entwurf DWA-Arbeitsblatt A 160 „Fräsund<br />
Pflugverfahren für den Einbau von<br />
Abwasserleitungen und -kanälen“<br />
Fräs- und Pflugverfahren haben sich beim Bau von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen etabliert. Sie werden vor allem in<br />
ländlich strukturierten Gebieten und außerhalb von Verkehrs-<br />
10-11 | 2014 23
DVGW RECHT & REGELWERK<br />
flächen eingesetzt. Da diese Technik mittlerweile als allgemein<br />
anerkanntes Verfahren gilt, hat die Deutsche Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) die bisher<br />
als Merkblatt veröffentlichte DWA-Regel nun überarbeitet und<br />
als Arbeitsblatt vorgelegt. DWA-A 160 enthält Hinweise zu<br />
Planung und Bau von Abwasserleitungen und -kanälen aus<br />
vorgefertigten Rohren mit Kreisquerschnitt im Fräs- und Pflugverfahren.<br />
Darunter werden Verfahren zusammengefasst, bei<br />
denen Rohrleitungen durch Lösen bzw. Verdrängen des Erdreichs<br />
in nicht betretbaren Gräben eingefräst oder in Schlitzen<br />
eingepflügt bzw. eingezogen werden. Änderungen in Gesetzen,<br />
Verordnungen, DIN-Normen und im DWA-Regelwerk<br />
wurden in das Arbeitsblatt einbezogen. Abweichungen zum<br />
Rohreinbau nach DIN EN 1610 „Verlegung und Prüfung von<br />
Abwasserleitungen und -kanälen“ und DWA-Arbeitsblatt A<br />
139 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“<br />
sowie zu DIN EN 12889 und zum DWA-Arbeitsblatt A<br />
125 werden aufgezeigt.<br />
Ausgabe 9/14, fördernde DWA-Mitglieder: Euro 29,20, Ladenpreis:<br />
Euro 36,50; Einspruchsfrist: 15.12.2014<br />
DIN EN ISO 15112 „Erdgas - Bestimmung<br />
von Energiemengen“<br />
Der Text von ISO 15112:2011 wurde vom Technischen<br />
Komitee ISO/TC 193 „Natural gas“ der Internationalen<br />
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO<br />
15112:2014 übernommen. Der Text von ISO 15112:2011 wurde<br />
vom CEN als EN ISO 15112:2014 ohne jedwede Änderung<br />
genehmigt. Diese Internationale Norm sieht Maßnahmen vor<br />
zur Ermittlung von Energiemengen von Erdgas durch Messung<br />
oder Berechnung und beschreibt die dabei erforderlichen<br />
anzuwendenden Techniken und Maßnahmen. Die Berechnung<br />
von thermischer Energie beruht auf der gesonderten<br />
Messung der Gasmenge, entweder als Masse oder Volumen<br />
des (an Schnittstellen) übertragenen Gases und auf seinem<br />
gemessenen oder berechneten Brennwert. Allgemeine Maßnahmen<br />
zur Berechnung von Unsicherheiten sind ebenfalls<br />
angegeben. Diese Internationale Norm gilt für alle Gasmessanlagen<br />
von Endkunden im privaten Bereich bis hin zu sehr<br />
großen Hochdrucktransportanlagen.<br />
Ausgabe 9/14, Ladenpreis: Euro 159,70<br />
Wege zum Trinkwassernetz 2030<br />
Zielnetzentwicklung von Trinkwassernetzen<br />
Die <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen sehen sich aufgrund des zu beobachtenden<br />
Bevölkerungsrückgangs, technologischer Entwicklungen und ähnlichen<br />
Faktoren mit einem rückläufigen Trinkwasserverbrauch konfrontiert. Die Auslegung<br />
der Trinkwassernetze basiert aus heutiger Sicht auf überhöhten Bevölkerungs-<br />
und Verbrauchsprognosen. Dies hat zur Folge, dass bisherige Spitzenbedarfswerte,<br />
auf denen die Dimensionierung des Rohrnetzes basiert, nicht mehr<br />
erreicht werden. Auf Grundlage der genannten Gründe sind Überlegungen zu<br />
einer möglichen zukünftigen Netzumgestaltung vorzunehmen. Vor dem Hintergrund<br />
dieser Problematik werden mögliche bauliche Umstrukturierungen<br />
und betriebliche Maßnahmen erarbeitet, die zu einer nennenswerten Verbesserung<br />
von möglichen Stagnationsbereichen führen. Werden bauliche und<br />
betriebliche Anpassungsmaßnahmen nicht verfolgt, kann eine Beeinträchtigung<br />
der Trinkwasserqualität durch auftretende Stagnationsbereiche im Trinkwassernetz<br />
eintreten.<br />
Bestellung unter:<br />
Tel.: +49 201 82002-14<br />
Fax: +49 201 82002-34<br />
bestellung@vulkan-verlag.de<br />
Hrsg.: Thomas Wegener<br />
1. Auflage 2014, 176 Seiten in Farbe,<br />
Broschur, DIN A5<br />
ISBN: 978-3-8027-5422-7<br />
Preis: € 44,80
RSV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten Rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in Entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlussleitungen –<br />
Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Erneuerung von Entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RSV Information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die Erhaltung und<br />
Erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | Fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin RSV-Mitglied und erhalte 20 % Rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
___ Ex. RSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen.<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XFRSVM2014
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Leckortung im Trinkwasserrohrnetz<br />
mittels Korrelation<br />
Schallgeschwindigkeit als eine mögliche Fehlerquelle<br />
Der Einsatz von Korrelatoren bei der Wasserlecksuche ist<br />
seit langer Zeit Standard. Dabei werden die Geräusche einer<br />
Leckstelle zeitgleich von zwei Mikrofonen aufgenommen<br />
und die Laufzeitdifferenz (Δt) wird berechnet. Auf dieses<br />
Rechenergebnis hat der Anwender nur sehr begrenzt Einfluss.<br />
Für die Ermittlung des Abstands der Leckage von den<br />
beiden Messpunkten sind neben Δt auch die Rohrleitungslänge<br />
(L) und die Schallgeschwindigkeit (n) von erheblicher<br />
Bedeutung.<br />
Bild 1 zeigt den Zusammenhang der relevanten Größen.<br />
Ist der Wert für Δt bekannt, so ergibt sich der Abstand der<br />
Leckage vom ersten Messpunkt:<br />
Die Rohrleitungslänge wird im praktischen Einsatz meist mit<br />
einem Messrad hinlänglich genau bestimmt. Die Schallgeschwindigkeit,<br />
mit der sich das Leckgeräusch in einer Leitung<br />
ausbreitet, wird bei allen Korrelatoren heute in Tabellen<br />
hinterlegt. Der Anwender wählt daraus entsprechend der<br />
Leitungsnennweite und dem Leitungsmaterial einen Wert<br />
für die Berechnung aus. Im Einsatz an einer echten Leckage<br />
gibt es keine einfache Möglichkeit, den Tabellenwert zu<br />
prüfen. Wenn es bei einer Korrelation zu einer Fehlmessung<br />
kommt, wird der Einfluss der Schallgeschwindigkeit oft<br />
unterschätzt, oder gar nicht erst als mögliche Ursache in<br />
Betracht gezogen – ein guter Grund für eine nähere Untersuchung<br />
des realen Einflusses der Schallgeschwindigkeit auf<br />
das Ergebnis einer Korrelationsmessung.<br />
Zuerst wurden verschiedene Schallgeschwindigkeitstabellen<br />
einiger am Markt etablierten Korrelatoren miteinander verglichen.<br />
Da seit vielen Jahren in der <strong>Wasserversorgung</strong> mehr<br />
und mehr Kunststoffleitungen verlegt werden, wurde die<br />
Betrachtung auf die beiden häufig verwendeten Materialien<br />
PE und PVC fokussiert. Die Werte aus den Schallgeschwindigkeitstabellen<br />
wurden grafisch umgesetzt (Bilder 2 und 3).<br />
Bild 2 und 3 zeigen, dass sich die Schallgeschwindigkeiten<br />
bei identischem Nominaldurchmesser für ein und dasselbe<br />
Material von Hersteller zu Hersteller teilweise deutlich<br />
unterscheiden. Selbst bei gleichem Hersteller können die<br />
Angaben in zwei Tabellen unterschiedlich sein. So schwankt<br />
zum Beispiel bei PE-Rohr die angegebene Schallgeschwindigkeit<br />
für eine Leitung DN 100 zwischen ca. 260 m/s und<br />
380 m/s. Bei einem PVC-Rohr gleicher Nennweite stehen<br />
Werte zwischen ca. 415 m/s und 450 m/s zur Auswahl.<br />
Die Hersteller beschreiben die Daten in ihren Tabellen oft<br />
als „Erfahrungswerte“ und spezifizieren deren Herkunft<br />
nicht näher.<br />
Im nächsten Schritt wurde überlegt, wie die Schallgeschwindigkeit<br />
in Rohren mathematisch bestimmt werden kann.<br />
In Anlehnung an die Veröffentlichung „Einführung in die<br />
Korrelations-Meßtechnik; aus: ELEKTRONIK, H. 2, 1971“<br />
von P. SCHÖLTZEL gilt Gleichung (2):<br />
M1: Messpunkt 1<br />
M2: Messpunkt 2<br />
L: Länge der Rohrleitung<br />
d: Abstand der Leckage vom Messpunkt 1<br />
Δt: Laufzeitdifferenz<br />
Bild 1: Schallausbreitung an einer Leckstelle<br />
26 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Bild 2: Schallgeschwindigkeiten in PE-Rohren über dem Nominaldurchmesser DN des Rohres – Grafische<br />
Darstellung von Tabellenwerten<br />
Bild 3: Schallgeschwindigkeiten in PVC-Rohren über dem Nominaldurchmesser DN des Rohres – Grafische<br />
Darstellung von Tabellenwerten<br />
10-11 | 2014 27
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Bild 4: Berechnete Schallgeschwindigkeiten in PE- und PVC-Rohren<br />
Aus Gleichung (2) wird ersichtlich, dass in erster Linie der<br />
Durchmesser, die Wandstärke und das Elastizitätsmodul<br />
einen Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit haben. Dichte<br />
und Kompressibilität der Flüssigkeit werden in Trinkwasserleitungen<br />
als konstant unter Betriebsbedingungen angenommen<br />
und hängen nicht vom Rohr ab. Die Beschränkung<br />
auf Material und Durchmesser, die in den Tabellen<br />
von Korrelatoren hinterlegt sind, scheint nicht ausreichend<br />
zu sein. Eine genauere Spezifikation des Rohrmaterials ist<br />
erforderlich. Die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit<br />
von D/s weist darauf hin, dass die SDR-Reihe des Rohres<br />
in die Berechnung einfließt und damit die Nenndruckstufe<br />
des Rohres.<br />
Für üblicherweise verwendete Rohre aus PVC-U in den<br />
Nenndruckstufen PN 6, PN 10 und PN 16 sowie die zugehörigen<br />
Wandstärken und Elastizitätsmodule wurden die<br />
Schallgeschwindigkeiten berechnet. Die materialabhängigen<br />
Parameter wurden im Internet in den technischen Datenblättern<br />
der Rohrhersteller recherchiert.<br />
Die Berechnung der Schallgeschwindigkeiten für PE-Rohre<br />
war aufwändiger, da mittlerweile in Rohrnetzen unterschiedliche<br />
PE-Rohre vorhanden sind. Von praktischer<br />
Bedeutung sind Rohre aus PE80, PE100 und in zunehmendem<br />
Maße auch aus PE-X. Die drei Materialien unterscheiden<br />
sich wesentlich in ihrem Elastizitätsmodul. Eine<br />
Einteilung in „weich“ und „hart“ ist dabei für die Praxis<br />
nicht ausreichend. Darüber hinaus werden Rohre aus PE<br />
auch in unterschiedlichen Nenndruckstufen – und damit<br />
SDR-Reihen – eingesetzt.<br />
Die Schallgeschwindigkeiten für Rohre aus PVC-U und<br />
unterschiedlichen PE-Materialien sind in Bild 4 grafisch<br />
dargestellt.<br />
Bild 4 zeigt, dass die berechneten Schallgeschwindigkeiten<br />
vom Rohrdurchmesser unabhängig sind. Unabhängig von<br />
der Nennweite bleibt innerhalb einer SDR-Reihe das Verhältnis<br />
von Durchmesser zu Wandstärke konstant und damit<br />
auch die Schallgeschwindigkeit über den Durchmesser.<br />
Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zu den Tabellen, die<br />
zu jedem Korrelator verfügbar sind.<br />
Bei Rohren aus PE80 oder PE100 sind die Schallgeschwindigkeiten<br />
innerhalb einer Nenndruckstufe sehr ähnlich.<br />
Die Schallgeschwindigkeit in PE-X-Rohren ist etwa um den<br />
Faktor 3 höher.<br />
Bei PVC-Rohren hingegen ist die Nenndruckstufe maßgeblich<br />
für den Wert der Schallgeschwindigkeit verantwortlich.<br />
Die Abweichung zwischen den einzelnen Druckstufen ist<br />
mit ca. ±25 % sehr deutlich.<br />
28 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Bild 5: Anzahl der Messungen je<br />
Material-Durchmesser-Kombination<br />
Bild 6: Aufbau zur Schallgeschwindigkeitsmessung<br />
Die gravierenden Unterschiede zwischen den Schallgeschwindigkeitswerten<br />
in Tabellen und denen aus den<br />
Berechnungen waren Anlass, unter realistischen Bedingungen<br />
Messreihen im Wasserrohrnetz aufzunehmen.<br />
Ziel der Messungen war es, verlässliche Aussagen zu<br />
erhalten, ob es beim Einsatz eines Korrelators ausreicht,<br />
sich auf Tabellenwerte zu verlassen, oder ob die berechneten<br />
Werte die Verhältnisse in der Rohrleitung besser<br />
abbilden.<br />
Dazu wurde mit freundlicher Unterstützung eines Netzbetreibers<br />
eine sechswöchige Kampagne gestartet. In dieser Zeit<br />
wurden in einem Versorgungsnetz an 242 Messstrecken die<br />
Schallgeschwindigkeiten mittels künstlicher Leckagen ermittelt.<br />
Die Leitungslängen lagen zwischen ca. 3 m und 104 m.<br />
Bild 5 zeigt eine Übersicht der im<br />
Rohrnetz vorgefundenen Materialien<br />
und der Anzahl der Messungen,<br />
die an den jeweiligen Materialund<br />
Durchmesserkombinationen<br />
durchgeführt wurden. Die Auswertungen<br />
wurden später auf PVC-U<br />
DN 100 und PE80 d110 beschränkt,<br />
weil nur für diese Material-Durchmesser-Kombinationen<br />
eine für<br />
statistische Auswertungen hinreichende<br />
Anzahl von Messungen<br />
durchgeführt wurde (Bild 6).<br />
Die eigentlichen Messungen der Schallgeschwindigkeit wurden<br />
wie folgt realisiert: Für jede Messung wurde durch<br />
Öffnen eines Hydranten außerhalb der Messstrecke eine<br />
künstliche Leckage erzeugt; das auslaufende Wasser wurde<br />
zielgerichtet abgeleitet.<br />
Es kamen ausschließlich Körperschallmikrofone zum Einsatz.<br />
Auf den Einsatz von Hydrophonen wurde wegen des zu<br />
erwartenden Einflusses des Versorgungsdrucks verzichtet.<br />
Alle Messungen wurden nur auf homogenen Streckenabschnitten<br />
durchgeführt, deren Rohrmaterial eindeutig<br />
bekannt war. Strecken mit wechselnden Materialien und/<br />
oder Durchmessern wurden nicht untersucht.<br />
Bei der Auswertung wurden die Messungen so gefiltert,<br />
dass sich ein eindeutiges Korrelationsergebnis ergab. Die<br />
Filter wurden so gesetzt, dass nur eindeutig kohärente<br />
Signale verarbeitet wurden. Störgeräusche, wie sie in Bild 7<br />
In mehreren Vorversuchen wurde<br />
festgestellt, dass weder die Lage<br />
des geöffneten Hydranten relativ<br />
zur Messstrecke noch die Auslaufmenge<br />
einen Einfluss auf das<br />
Messergebnis haben. Auch das<br />
Alter der Rohrabschnitte beeinflusst<br />
die Messergebnisse nicht.<br />
Bild 7: Ergebnis einer Schallgeschwindigkeitsmessung. Der ausgewählte Frequenzbereich ist grau hinterlegt<br />
10-11 | 2014 29
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
berechneten theoretischen Schallgeschwindigkeiten ergibt,<br />
dass es eine einziggültige Schallgeschwindigkeit pro Material<br />
und Durchmesser nicht zu geben scheint und dass weder<br />
die theoretische Berechnung noch die Tabellenwerte die tatsächlichen<br />
Bedingungen im Rohrnetz korrekt erfassen. Auch<br />
die Annahme, dass Leitungen aus PE den Schall langsamer<br />
fortleiten, als Rohre aus PVC ließ sich nicht nachweisen.<br />
Als mögliche Einflussgröße auf die Schallgeschwindigkeit<br />
wird vielfach die Leitungslänge vermutet. Daher wurden die<br />
Messergebnisse auch über die Streckenlängen aufgetragen<br />
(Bild 10 und 11).<br />
Bild 8: Verteilung der Schallgeschwindigkeiten über verschiedene<br />
Schallgeschwindigkeitsklassen für PE80 d110<br />
Bild 10 und 11 zeigen, dass bei sehr kurzen Messstrecken<br />
(
Bild 10: Schallgeschwindigkeit über der Länge der Messstrecke<br />
für PE80 d110<br />
Bild 11: Schallgeschwindigkeit über der Länge der Messstrecke<br />
für PVC-U DN 100<br />
Bild 12: Schallgeschwindigkeit über der Frequenzfür PE80 d110<br />
Bild 13: Schallgeschwindigkeit über der Frequenz für PVC-U<br />
DN 100<br />
Was bedeuten diese Erkenntnisse für den praktischen<br />
Einsatz von Korrelatoren im Rohrnetz?<br />
Um diese Frage zu beantworten, müssen die potenziellen<br />
Fehlerquellen betrachtet werden.<br />
Aus Gleichung (1) wird deutlich, dass ein Fehler bei der<br />
Ermittlung der Länge direkt zur Hälfte in das Ergebnis einfließt.<br />
Anders ist das bei der Schallgeschwindigkeit. Eine<br />
mögliche Ungenauigkeit geht immer als Produkt aus n · Dt in<br />
das Ergebnis ein. Was das im praktischen Einsatz bedeutet,<br />
zeigt folgendes Rechenbeispiel:<br />
Es wird angenommen, dass ein Korrelator auf einer Leitung<br />
aus PVC-U DN 100 mit einer Länge von 100 m eine<br />
Zeitverzögerung von 160 ms berechnet hat. Die Schallgeschwindigkeit<br />
liegt bei dieser Rohrleitung sehr wahrscheinlich<br />
zwischen 350 m/s und 500 m/s (vgl. Bild 9). Wenn<br />
die Grenzgeschwindigkeiten in Gleichung (1) eingesetzt<br />
werden, erhält man:<br />
Die berechnete Position des Lecks unterscheidet sich<br />
für die beiden Grenzgeschwindigkeiten um 12 m. In der<br />
Praxis soll die Korrelation aber eine möglichst punktgenaue<br />
Ortung liefern und nicht einen vermuteten Bereich<br />
von 12 m Länge.<br />
In diesem ersten Beispiel liegt das Korrelationsergebnis,<br />
das der Leckposition entspricht, weit außerhalb der Mitte<br />
der Messstrecke (Dt ist groß). Wenn es gelingt, zwei Messpunkte<br />
so zu wählen, dass das Leck in der Mitte liegt,<br />
und damit Dt klein wird, sollte die Positionsberechnung<br />
weniger unterschiedlich sein.<br />
Betrieb und Instandhaltung von Rohrnetzen<br />
Auslegen / Berechnen / Analysieren / Optimieren / Zusammenhänge<br />
Fahrweisen / Regelungen / Dynamik / Druckstoß / Energieeffizienz<br />
Asset-Strategien / Spülplanung / Zielnetzplanung / Inspektionsplanung<br />
3S Consult GmbH — mehr als 25 Jahre Engineering und Software — www.3sconsult.de
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Im zweiten Beispiel wird einer der Messpunkte so versetzt,<br />
dass sich eine neue Länge von 25 m ergibt. Der Korrelator<br />
berechnet nun beispielsweise ein Dt von 5 ms. Hierfür sieht<br />
dann die Positionsberechnung so aus:<br />
Die Ergebnisdifferenz beträgt nur noch 0,3 m und das,<br />
obwohl die wirkliche Schallgeschwindigkeit auch hier wahrscheinlich<br />
zwischen 350 m/s und 500 m/s liegt.<br />
Die beiden Rechenbeispiele zeigen, dass eine präzise Lokalisation<br />
also möglich ist, und zwar fast unabhängig von<br />
der Schallgeschwindigkeit, wenn es im praktischen Einsatz<br />
gelingt, die Messstrecke so aufzubauen, dass die berechnete<br />
Leckposition sehr nah an der Mitte der Messstrecke liegt.<br />
Es gibt allerdings auch Messstrecken, die ein Versetzen der<br />
Messpunkte nicht erlauben, weil es nur wenige Ankopplungspunkte<br />
auf der Leitung gibt oder es sich zum Beispiel<br />
um einen Endstrang handelt. In solchen Fällen bietet es<br />
sich an, die reale Schallgeschwindigkeit zu messen. Dazu<br />
wird zusätzlich zu dem vorhandenen Geräusch eine weitere<br />
Schallquelle an einer bekannten Position benötigt. Idealerweise<br />
liegt diese außerhalb der eigentlichen Messstrecke.<br />
Wichtig ist, dass es dem Korrelator möglich ist, einen<br />
zweiten Peak zu messen, der der „künstlichen Leckstelle“<br />
entspricht. Dazu muss meist die Geräuschintensität der<br />
zusätzlichen Geräuschquelle verändert werden können,<br />
wofür sich Hydranten oder gedrosselte Schieber besonders<br />
gut eignen.<br />
Darüber hinaus bieten viele Korrelatoren auch die Möglichkeit<br />
einer Mehr-Punkt-Messung. Einige verwenden dazu<br />
drei oder mehr reale Messpunkte, andere nutzen das systematische<br />
Versetzen eines Messpunkts und kommen daher<br />
ohne zusätzliche Funksender aus. Wenn die Geräuschquelle<br />
jeweils innerhalb der Messstrecken liegt, wird die<br />
Leckposition unabhängig von der Schallgeschwindigkeit<br />
berechnet. Die mathematischen Verfahren wurden bereits<br />
in den 1980er Jahren publiziert und in der Korrelationsmesstechnik<br />
implementiert, finden allerdings heute nur<br />
sehr wenig Beachtung. Dabei sind gerade diese Verfahren<br />
sehr leicht zu handhaben, benötigen keine zusätzlichen<br />
Geräuschquellen und nutzen das in der Praxis ohnehin oft<br />
praktizierte Umsetzen der Messpunkte.<br />
Grenzen für die Messung der Schallgeschwindigkeit sowie<br />
der Mehr-Punkt-Korrelation setzt in der Praxis die nur ungenaue<br />
Kenntnis über das Rohrnetz. Sinnvolle Ergebnisse<br />
erhält man bei beiden Verfahren nur dann, wenn der Leitungsabschnitt,<br />
auf dem gemessen werden soll, einheitlich<br />
ist. Das bedeutet, dass sich Material und/oder Durchmesser<br />
nicht ändern. Gibt es aber zum Beispiel auf dem zu<br />
messenden Leitungsabschnitt eine alte Reparaturstelle, ist<br />
der Leitungsabschnitt nicht mehr einheitlich. Wenn nicht<br />
ermittelt werden kann, auf welchem Teilstück die Inhomogenität<br />
auftritt, muss die errechnete Leckposition durch ein<br />
anderes Verfahren bestätigt werden; am besten mit einem<br />
elektroakustischen Ortungsverfahren.<br />
Die theoretischen und praktischen Untersuchungen haben<br />
gezeigt, dass die alleinige Nutzung von Schallgeschwindigkeitstabellen<br />
beim Korrelieren immer mit einem erheblichen<br />
Fehlerpotential verbunden ist. Die Frage, welche Schallgeschwindigkeit<br />
für jede einzelne Leitung denn die richtige<br />
sei, ist rein hypothetisch. Selbst detaillierte Kenntnis der<br />
Materialdaten und eine anschließende Berechnung der<br />
Schallgeschwindigkeit wird der Praxis nicht gerecht. Einfache<br />
Vorgehensweisen, wie das Umsetzen der Messpunkte, die<br />
Messung der realen Schallgeschwindigkeit oder auch die<br />
Mehr-Punkt-Messung ermöglichen es jedoch, die Ortungsgenauigkeit<br />
deutlich zu verbessern.<br />
Dipl.-Ing. DIRK BECKER<br />
Hermann Sewerin GmbH Gütersloh<br />
Tel. +49 5241 934220<br />
E-Mail: dirk.becker@sewerin.com<br />
AUTOR<br />
32 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Lastverschiebungspotenziale in der<br />
<strong>Wasserversorgung</strong><br />
Im Forschungsprojekt werden energieintensive Bereiche der <strong>Wasserversorgung</strong> auf mögliche Lastverschiebungspotenziale<br />
untersucht. Dabei soll anhand von zehn <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen unterschiedlicher Größe und Struktur in Baden-<br />
Württemberg analysiert werden, welches Lastverschiebungspotenzial theoretisch zur Verfügung steht und ob dieses auch<br />
wirtschaftlich nutzbar ist. Es werden wichtige Rahmenbedingungen zur Teilnahme am Lastmanagement herausgestellt und<br />
die technische Anbindung beim Versorger sowie die Übertragung und Umsetzung von Börsensignalen über ein virtuelles<br />
Kraftwerk bis hin zur entsprechenden Förderanlage betrachtet.<br />
Im Normalbetrieb werden Hochbehälter in einer <strong>Wasserversorgung</strong><br />
pegelabhängig befüllt. In der Regel erfolgt dies in<br />
den Nachtstunden, um einen evtl. vorhandenen Nachttarif<br />
zu nutzen und, um den Einfluss auf die Versorgungsstruktur<br />
des Ortsnetzes so gering wie möglich zu halten.<br />
In Zeiten von fluktuierender Einspeisung von Energie aus<br />
erneuerbaren Energiequellen (hauptsächlich Wind und<br />
Photovoltaik) liegt die Idee nahe, die energieintensiven<br />
Bereiche einer <strong>Wasserversorgung</strong> (Befüllung von Hochbehältern,<br />
Wasseraufbereitung, usw.) zeitlich möglichst optimal<br />
auf die zur Verfügung stehende Energie abzustimmen.<br />
Durch ein intelligentes Pumpmanagement (Lastmanagement)<br />
würde einem Wasserversorger eine ähnliche Position<br />
wie einem Pumpspeicherkraftwerk zukommen (dezentrale<br />
Pumpspeicher). In Zeiträumen mit Stromüberangebot<br />
wird Energie verbraucht und Wasser in den Hochbehälter<br />
gepumpt und gespeichert um damit Pumpzeiten in Bereichen<br />
mit Stromengpässen zu vermeiden. Dabei wird der<br />
Einfluss dieser energieoptimierten Fahrweise der Pumpen<br />
auf die Struktur des <strong>Wasserversorgung</strong>ssystems und<br />
auf die Anlagen selbst analysiert. Im Ergebnis wird ein<br />
betriebswirtschaftlich optimiertes Speichermanagement<br />
erwartet.<br />
In der Untersuchung wird zwischen verschiedenen Versorgungssystemen<br />
unterschieden. Diese können z. B.<br />
Druckerhöhungsanlagen (Saugbetrieb aus dem Behälter<br />
oder Saugbetrieb aus dem Netz), Tiefbrunnenpumpen zur<br />
Wassergewinnung, Wasserwerke und -aufbereitungsanlagen<br />
und Netzpumpen sein.<br />
Im Durchschnitt kann man davon ausgehen, dass in<br />
Deutschland rund 80 % des Strombedarfs einer <strong>Wasserversorgung</strong><br />
für Pumpenergie verwendet wird. In Baden-<br />
Württemberg gibt es rund 1.300 Wasserversorger, überwiegend<br />
kommunale Eigenbetriebe und Zweckverbände<br />
[1]. Die in diesem Projekt erarbeiteten Ergebnisse können<br />
auf eine Betrachtung auf Baden-Württemberg als Bundesland<br />
erweitert/angewandt werden und eine Aussage<br />
für Gesamtdeutschland getroffen werden. Das Projekt<br />
wird von insgesamt zehn <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen<br />
unterschiedlicher Größe und Struktur auf Landesebene<br />
in Baden-Württemberg unterstützt und von der EnBW<br />
Holding finanziert.<br />
Prozessuale Herangehensweise<br />
Im Folgenden werden im Detail die Herangehensweise<br />
und unterschiedliche Versorgungsstrukturen vorgestellt.<br />
Um verschiedene <strong>Wasserversorgung</strong>ssysteme zu bewerten<br />
und miteinander vergleichen zu können, werden<br />
diverse Betriebssysteme definiert und untersucht.<br />
Herangehensweise:<br />
»»<br />
Im ersten Schritt erfolgt eine allgemeine Überprüfung<br />
der Fördersysteme in Bezug auf die optimale Auslegung.<br />
Dabei erfolgt eine Bewertung der aktuellen Situation<br />
ohne Berücksichtigung des Themas Lastmanagement.<br />
Daraus ergeben sich möglicherweise erste Optimierungspotenziale<br />
der Förderanlagen selbst wie z. B. eine<br />
Nachrüstung mit Drehzahlregelung.<br />
»»<br />
Im zweiten Schritt wird speziell auf die Lastmanagement-Thematik<br />
eingegangen. Dabei werden die erforderlichen<br />
Daten erhoben.<br />
»»<br />
Am Ende sollen die Ergebnisse als Basis für eine energetische<br />
und betriebswirtschaftliche Optimierung des<br />
Systems dienen.<br />
Da allein aufgrund dem seit Jahren fallendem Pro-Kopf-<br />
Verbrauch an Trinkwasser in der BRD der Großteil der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
nicht mehr optimal ausgelegt sind,<br />
wird der wirtschaftliche Nutzen des Lastmanagements in<br />
Relation zum Nutzen einer angepassten Auslegung bei den<br />
meisten Versorgern eher als gering erwartet.<br />
Unterschiedliche Versorgungsstrukturen<br />
Im Folgenden sind verschiedene Versorgungsstrukturen<br />
definiert worden, von denen jeweils im durchgeführten<br />
Projekt mindestens zwei bei <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen<br />
untersucht werden.<br />
System A (Bild 1) zeigt einen Tiefbrunnen, von dem Grundwasser<br />
in einen Hochbehälter oder Reinwasserbehälter<br />
gefördert wird. Die benötigte Pumpenergie hängt maßgebend<br />
von der Förderhöhe und dem Förderstrom ab. Der<br />
Zeitraum, in dem die Pumpe in Betrieb ist, wird zum einen<br />
durch das Wasserdargebot bzw. Wasserrecht im Brunnen<br />
und zum anderen vom Füllstand des Behälters begrenzt.<br />
Beim System B (Bild 2) werden Förderanlagen im Wasserwerksbereich<br />
analysiert. Entscheidend sind die Aufbe-<br />
10-11 | 2014 33
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Bild 3: System C, Versorgungsstruktur C (Quelle: RBS wave)<br />
Bild 1: System A, Versorgungsstruktur A (Quelle: RBS wave)<br />
Bild 2: System B, Versorgungsstruktur B (Quelle: RBS wave)<br />
Bild 4: System D, Versorgungsstruktur D (Quelle: RBS wave)<br />
Bild 5: System E, Versorgungsstruktur E (Quelle RBS wave)<br />
Bild 6: System F, Versorgungsstruktur F (Quelle: RBS wave)<br />
reitungsleistung des Wasserwerks, das Rohwasserdargebot,<br />
der Wasserspiegel im Reinwasserbehälter, sowie der<br />
Gesamtverbrauch in der Versorgungszone.<br />
Bei System C werden Druckerhöhungsanlagen betrachtet.<br />
Dabei wird zwischen direktem und indirektem Anschluss<br />
der Anlagen unterschieden. Solch eine Betriebsweise lässt<br />
vermutlich keine sinnvoll nutzbaren Lastverschiebungspotenziale<br />
zu, da zur Aufrechterhaltung des Netzdruckes die<br />
Pumpen meist durchgehend in Betrieb sind (drehzahlgeregelt).<br />
Bei kleinen Versorgungszonen besteht eventuell<br />
die Möglichkeit, Druckspeicher wie Druckwindkessel oder<br />
Membranausdehnungsgefäße zu nutzen (Bild 3).<br />
Im System D wird Grundwasser bzw. Quellwasser bei<br />
Bedarf aufbereitet und durch eine Versorgungszone in einen<br />
Hochbehälter gefördert. Die erforderliche Pumpleistung<br />
ergibt sich aus dem geodätischen Höhenunterschied den<br />
Druckverlusten und der Menge, die gefördert werden soll.<br />
Die Randbedingungen sind die Netzverbräuche und -drücke,<br />
die Behälterfüllstände, sowie die eventuell vorhandene<br />
Aufbereitungsleistung im Wasserwerk (Bild 4).<br />
34 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Bild 7: Durchschnittlich mittlerer Preis von Januar bis Ende Juli 2014 über 24 h aufgetragen (Quelle: Netze BW)<br />
System E zeigt eine Versorgung über einen Wasserturm.<br />
Dieser wird über einen Hochbehälter und ein Pumpwerk<br />
befüllt. Abhängig vom Wasserspiegel kann das Pumpwerk<br />
in Betrieb sein. Da der Nutzinhalt des Wasserturms meist<br />
kleiner ist als der des Hochbehälters oder Reinwasserbehälters,<br />
von dem der Turm befüllt wird, ist hier bei<br />
der Ermittlung von Potenzialen zur Lastverschiebung der<br />
Netzverbrauch entscheidend (Bild 5).<br />
Im System F wird ausgehend von einem Hochbehälter<br />
ein weiterer Hochbehälter über ein dazwischenliegendes<br />
Netz befüllt. Um den geodätischen Höhenunterschied zu<br />
überwinden und um Druckverluste auszugleichen, wird<br />
die vorhergesehene Menge gepumpt. Hierbei spielt die<br />
Hydraulik des Netzes eine entscheidende Rolle.<br />
Der Zeitraum, in dem das Pumpwerk in Betrieb ist, wird<br />
zum einen durch die Füllstände der beiden Behälter<br />
beschränkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist der aktuelle<br />
Netzverbrauch und die sich einstellenden Fließdrücke im<br />
Netz (Bild 6).<br />
Strommarktübersicht<br />
Lastmanagement beschreibt die Anpassung des Stromverbrauchs<br />
an das Stromangebot. In der <strong>Wasserversorgung</strong><br />
bedeutet das, die Hochbehälter dann zu füllen wenn es<br />
aus Sicht der Energiemärkte vorteilhaft ist. An dieser Stelle<br />
werden für das Forschungsvorhaben die Energiehandelsmärkte<br />
Spot Day Ahead und Intraday sowie die Regelenergieprodukte<br />
Sekundärregelenergie und Minutenreserve<br />
untersucht. Diese Märkte weisen Preisspannen auf, welche<br />
durch Lastmanagement ausgenutzt werden können, um<br />
damit zusätzliche Erlöse zu erwirtschaften.<br />
EPEX SPOT ist die Börse für Stromspotmärkte für Frankreich,<br />
Deutschland, Österreich und Schweiz. Das Unternehmen<br />
wurde 2008 durch den Zusammenschluss der<br />
Stromspotaktivitäten der Energiebörsen Powernext SA aus<br />
Frankreich und der EEX AG in Deutschland aus der Taufe<br />
gehoben [2]. Über EPEX SPOT werden Spot Day Ahead<br />
und Intraday-Auktionen abgewickelt.<br />
Der Basiswert in der Day-Ahead-Auktion ist der zur<br />
Lieferung am nächsten Tag in 24-Stunden-Intervallen<br />
gehandelter Strom. Der Basiswert im Intraday-Markt<br />
ist der gehandelte Strom für Einzelstundenkontrakte,<br />
15-Minuten-Perioden oder Blockkontrakte zur Lieferung<br />
am gleichen oder nächsten Tag. Jeder Einzelstundenkontrakt,<br />
15-Minuten-Kontrakt oder Blockkontrakt kann bis<br />
zu 45 Minuten vor Lieferbeginn gehandelt werden [2].<br />
In Bild 7 ist ein durchschnittlicher Preis über einen Tag<br />
gemittelt aus dem Zeitraum Januar bis Ende Juli 2014<br />
über 24 h aufgetragen. Dies zeigt beim Intraday-Markt<br />
einen volatileren Preis mit größeren Preisdifferenzen als<br />
beim Spot Day Ahead.<br />
Die Energiehandelsmärkte Spot Day Ahead und Intraday<br />
eignen sich zum Beispiel für kurzfristige Optimierungen im<br />
Strombezug sowie zum Ausgleich von Fahrplan- und Prognoseabweichungen.<br />
Beim Spot Day Ahead findet der Handel mit<br />
einer Auktion am Tag vor der physikalischen Lieferung statt.<br />
Da die Preisdifferenzen entscheidenden Einfluss auf das<br />
Erlöspotenzial haben ist davon auszugehen, dass beim Intraday-Markt<br />
der größere Erlös erzielt werden kann. Trotzdem<br />
sind beide Märkte hinsichtlich des Lastmanagements in der<br />
<strong>Wasserversorgung</strong> interessant und werden in die Untersuchungen<br />
mit einbezogen.<br />
Der Regelenergiemarkt dient zur Frequenzhaltung des Stromnetzes.<br />
Dies ist wichtig, da Stromangebot und Nachfrage<br />
immer im Gleichgewicht sein müssen. Wenn das Stromangebot<br />
im Netz größer ist als die Nachfrage, gibt es negative<br />
10-11 | 2014 35
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Regelleistung, die Strom aus dem Stromnetz entnimmt. Wenn<br />
die Stromnachfrage größer ist als das Angebot, gibt es positive<br />
Regelleistung, die Strom in das Stromnetz einspeist. Die<br />
Regelenergie kann von einem Stromerzeuger erbracht werden,<br />
indem die Einspeiseleistung erhöht beziehungsweise gedrosselt<br />
wird oder von einem Stromverbraucher, der den Strombezug<br />
erhöht beziehungsweise verringert.<br />
Das Lastmanagement regelt die Last und somit den Stromverbraucher.<br />
Hier kann die positive Regelenergie durch das<br />
Abschalten einer Last und die negative Regelenergie durch<br />
das Zuschalten einer Last erbracht werden. Damit sind die<br />
Grundvoraussetzungen für die Erbringung von Regelenergie<br />
durch Lastmanagement gegeben. Generell gibt es die drei<br />
Regelenergiearten: Primärregelleistung, Sekundärregelleistung<br />
und Minutenreserveleistung. Diese werden zeitlich nacheinander<br />
abgerufen und lösen sich damit gegenseitig ab. Die<br />
Primärregelleistung wird als erstes sekundenschnell abgerufen.<br />
Diese Anforderung, innerhalb Sekunden den Lastgang<br />
der Pumpen zu ändern, kann durch Lastmanagement in der<br />
<strong>Wasserversorgung</strong> nicht erfüllt werden. Dadurch kann keine<br />
Primärregelleistung angeboten werden. Dagegen werden die<br />
Sekundärregelleistung und Minutenreserveleistung nach fünf<br />
beziehungsweise 15 Minuten abgerufen. Diese Zeitvorgaben<br />
können beim Lastmanagement in der <strong>Wasserversorgung</strong> erfüllt<br />
werden. Demnach müssen die Pumpen bei positiver Regelenergie<br />
im angebotenen Zeitraum und mit der angebotenen<br />
Leistung in Betrieb sein. Bei Abruf der Regelenergie müssen<br />
die Pumpen in der vorgeschriebenen Zeit abgeschaltet oder<br />
um die entsprechende Leistung gedrosselt werden. Bei negativer<br />
Regelenergie ist es genau umgekehrt. Die angebotene<br />
Leistung darf im angebotenen Zeitraum nicht bezogen werden<br />
und muss bei Abruf um die entsprechende Pumpleistung<br />
erhöht werden. Der Zeitraum, in der die entsprechende<br />
Regelenergie angeboten wird, wird mit einem Leistungspreis<br />
vergütet. Bei entsprechendem Abruf der Regelenergie, wird<br />
der Arbeitspreis bei positiver Regelenergie vergütet und bei<br />
negativer bezahlt.<br />
Dementsprechend wird der Zusatzerlös mit Lastmanagement<br />
am Energiehandelsmarkt durch einen preisgünstigeren Strombezug<br />
und beim Regelenergiemarkt im<br />
Wesentlichen durch den Leistungspreis<br />
der angebotenen Regelenergie erzielt.<br />
Bild 8: Durchschnittliches tägliches Lastmanagementpotenzial (Quelle: Netze BW)<br />
Analyse und Erhebung von<br />
Potenzialen<br />
Einer der zehn Wasserversorger die am<br />
Projekt teilnehmen ist ein mittelgroßer<br />
Wasserversorger in Baden-Württemberg,<br />
der eine Stadt mit ca. 30.000<br />
Einwohnern versorgt. Bei diesem Wasserversorger<br />
liegen bereits erste Ergebnisse<br />
vor. Zielstellung ist es, die Erlöse,<br />
die durch die Vermarktung erzielt werden<br />
können der Größenordnung nach<br />
zu ermitteln.<br />
Voraussetzung für flexible Lasten ist<br />
ein Speicher vor und ein Speicher nach<br />
der Pumpstation. Dadurch wird es ermöglicht, den zweiten<br />
Speicher mit maximaler Pumpleistung über einen bestimmten<br />
Zeitraum am Tag zu füllen. Es muss sichergestellt sein,<br />
dass der tägliche Wasserabsatz in den Behälter gepumpt<br />
wird und die Versorgungssicherheit des Netzes zu jeder<br />
Zeit gewährleistet ist. Unter Beachtung dieser Restriktionen<br />
kann die Förderpumpe zeitlich flexibel den Behälter füllen.<br />
Diese zeitliche Flexibilität der Stromlast und aller technischen<br />
Restriktionen gilt es bei der mittelgroßen <strong>Wasserversorgung</strong><br />
zu ermitteln. Dafür wird das Versorgungsschema<br />
in die Versorgungsstrukturen A‐F wie im vorigen Kapitel<br />
beschrieben unterteilt und jede Struktur einzeln untersucht.<br />
Durch diese Vorgehensweise ergibt sich der Vorteil, ein<br />
komplexes Versorgungsschema mit vielen Abhängigkeiten<br />
in die relevanten Systeme einzuteilen und somit eine übersichtliche<br />
Darstellung zu erhalten. Mit einem hydraulischen<br />
Rechennetzmodell werden die technischen Restriktionen<br />
wie die maximale Pumpleistung und die Fließdrücke bei der<br />
Tagesspitze ermittelt und simuliert. Unter Beachtung dieser<br />
Restriktionen kann bei dem mittelgroßen Wasserversorger<br />
ein Lastmanagementpotenzial von circa 1000 kWh pro Tag<br />
erhoben werden. Dieses unterteilt sich in drei Behälter, die<br />
alle von einem zentralen Pumpwerk aus befüllt werden und<br />
unterschiedliche Befüllzeiten haben.<br />
In Bild 8 ist das Lastmanagementpotenzial exemplarisch<br />
an einem Tag dargestellt. Die Behälter müssen mit Wasser<br />
durch diese Pump-Energiemenge am Tag gefüllt werden.<br />
Die drei farbigen Balken stellen jene Pumpenergie dar, die<br />
zur Befüllung der jeweiligen Behälter erforderlich ist. Es ist<br />
jedoch aus Sicht der <strong>Wasserversorgung</strong> nicht relevant, zu<br />
welcher Zeit am Tag das Wasser gepumpt wird, sofern den<br />
Kunden ausreichend Wasser über das vorhandene Speichervolumen<br />
zur Verfügung gestellt werden kann. Deshalb ist<br />
es möglich, die Blöcke am Stück oder unterteilt in kleinere<br />
Böcke innerhalb eines Tages zu verschieben. Diese zeitliche<br />
Flexibilität der Förderpumpen kann an dieser Stelle gegen<br />
den Energiemarkt optimiert werden, indem die Vermarktung<br />
als Regelenergie oder ein optimierter Strombezug am<br />
Energiehandelsmarkt erfolgt.<br />
36 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Erste Ergebnisse des Forschungsprojekts<br />
Mit dem erhobenen Lastmanagementpotenzial wurden<br />
Erlösmodelle entwickelt, mit denen die Vermarktung des<br />
Potenzials gegenüber den Energiemärkten untersucht und<br />
auf Wirtschaftlichkeit geprüft wird. Eine notwendige Voraussetzung<br />
für die Vermarktung von Potenzialen in dieser<br />
Größenordnung ist die Anbindung des Wasserversorgers<br />
an das „Virtuelles Kraftwerk“ der EnBW. Im Bereich von<br />
Lastmanagement bündelt dieses die Flexibilität einzelner<br />
Systeme und vermarktet sie gegenüber den Energiemärkten.<br />
Dadurch ist eine Erschließung der Marktoportunitäten auch<br />
von verhältnismäßig kleinen Anbietern möglich. Zum Beispiel<br />
gibt es bei der Sekundärregelenergie eine Mindestangebotsgröße<br />
von 5 MW die seitens der Bundesnetzagentur<br />
seit 2011 festgelegt ist [3].<br />
Durch mehrere Wasserversorger kann diese Voraussetzung<br />
über einen Pooling in einem Virtuellen Kraftwerk realisiert<br />
werden. Ein weiterer Vorteil eines Virtuellen Kraftwerks<br />
ist die automatische Ansteuerung der Pumpen der Wasserversorger,<br />
um zusätzliche Betriebskosten einzusparen.<br />
Ziel der EnBW ist es, die Flexibilität bei Wasserversorgern<br />
zu quantifizieren, zu qualifizieren und bei entsprechenden<br />
Voraussetzungen in das Virtuelle Kraftwerk aufzunehmen.<br />
Eine Präqualifikation der <strong>Wasserversorgung</strong> durch den Übertragungsnetzbetreiber<br />
ist dabei zusätzliche Voraussetzung<br />
für die Teilnahme an den Regelenergiemärkten. Dabei wird<br />
die Zuverlässigkeit der Anlagen und somit das Erbringen der<br />
Regelenergie geprüft.<br />
Es werden die Regelenergiemärkte Sekundärregelleistung<br />
und Minutenreserve sowie die Energiehandelsmärkte<br />
Spot Day Ahead und Intraday untersucht. Für jedes Vermarktungsmodell<br />
wird ein geeigneter Fahrplan der Pumpen<br />
hinsichtlich des maximalen Erlöspotenzials erstellt und die<br />
Erlöse den Kosten gegenübergestellt.<br />
Die Ergebnisse dieser ersten Untersuchungen zeigen, dass<br />
ein wirtschaftliches Betreiben von Lastmanagement in der<br />
<strong>Wasserversorgung</strong> bereits möglich ist. Die Vermarktung von<br />
negativer Regelenergie erzielt dabei die größten Erlöse. Aber<br />
auch am Intraday-Markt kann das Potenzial wirtschaftlich<br />
vermarktet werden. Dagegen sind die Preisdifferenzen am<br />
Spot Day Ahead zu gering, um die anfallenden Kosten bei<br />
dem beispielhaften Wasserversorger zu decken.<br />
Ausblick<br />
Auf folgende offenen Punkte und Fragestellungen wird<br />
in der weitergehenden Untersuchung im Verlauf des Forschungsprojekts<br />
eingegangen:<br />
»»<br />
Der Betreiber eines virtuellen Kraftwerks kauft Strom<br />
an der Börse und dieser muss von den Teilnehmern am<br />
virtuellen Kraftwerk abgenommen werden. Was sind<br />
die Folgen, wenn dies aus irgendeinem Grund nicht<br />
geschehen kann?<br />
»»<br />
Inwiefern ist eine Teilnahme am Lastmanagement für<br />
Versorger möglich, die längerfristige Stromlieferverträge<br />
besitzen.<br />
»»<br />
Wie genau muss die Übertragungstechnik gestaltet<br />
werden? Also der Weg vom Preissignal an der Börse,<br />
über das virtuelle Kraftwerk bis hin zur Förderanlage!<br />
Die Steuerungs- und Bedienphilosophie beim Versorger<br />
sollte beibehalten werden um so wenig wie möglich ins<br />
System einzugreifen.<br />
»»<br />
Eventuell kann bei Pumpwerken großer Leistung die<br />
Installation zusätzlicher Förderanlagen mit geringer Leistung<br />
wirtschaftlich sein, um das Lastverschiebungspotenzial<br />
ganz auszunutzen.<br />
Zusammenfassung<br />
Diese ersten Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt am<br />
Beispiel einer mittelgroßen <strong>Wasserversorgung</strong> sind vielversprechend.<br />
Die zeitlich verschiebbaren Stromlasten werden<br />
intelligent gesteuert und tragen damit zum einen zur Glättung<br />
der Einspeiseschwankungen und somit zur Integration<br />
der Erneuerbaren Energien bei. Zum anderen können in<br />
der <strong>Wasserversorgung</strong> zusätzliche Erlöse erwirtschaftet<br />
werden, die zur Reduzierung der Energiekosten des Wasserversorgers<br />
beitragen. Somit bietet das Lastmanagement<br />
Vorteile für die Energiemärkte und für die <strong>Wasserversorgung</strong>.<br />
Mit Abschluss des Projekts im Februar 2015 steht<br />
somit ein Verfahren zur Verfügung, um mit geringem<br />
Aufwand das mögliche Potential einer Lastverschiebung<br />
für ein <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen zu beschreiben<br />
und zu bewerten.<br />
Literatur<br />
[1] Büringer, H. (2006) Trinkwasserversorgung in Baden-<br />
Württemberg, Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg<br />
5/2006, S. 28-31<br />
[2] http://www.epexspot.com/de/produkte/<br />
[3] Bundesnetzagentur (2011) Pressemitteilung von 13.04.2011<br />
FABIAN JANOTTE<br />
AUTOREN<br />
Consulting / Projektleiter Netzmanagement<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel. +49 711 / 289 513-37<br />
f.janotte@rbs-wave.de<br />
Dr.-Ing. GERALD GANGL<br />
Consulting / Bereichsleiter<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel. +49 711 / 128 48414<br />
g.gangl@rbs-wave.de<br />
SIMEON SIEGELE<br />
DH-Studierender B.Eng. Maschinenbau<br />
Netze-BW GmbH, im Auftrag der EnBW<br />
Energie Baden-Württemberg AG, Stuttgart<br />
Tel. +49 711 / 289-87618<br />
s.siegele@enbw.com<br />
10-11 | 2014 37
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Rahmenbedingungen einer<br />
Ziel-Netzplanung<br />
In den Wasserrohrnetzen stecken unglaubliche Sparpotenziale, die bei Weitem noch nicht ausgereizt sind. Gerade bei<br />
hohen Netzbetriebskosten kann es sich also lohnen, einmal einen kritischen Blick in den Untergrund zu werfen, denn<br />
hier ist bekanntlich das meiste Geld „vergraben“. Aus diesem Grund ist es erforderlich die bestehenden Wasserrohrnetze<br />
zu optimieren. Das Optimierungspotenzial ist, neben den Gegebenheiten des Versorgungsgebietes, dem Zustand der<br />
Anlagen und der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Ist-Netzes, vor allem von den Optimierungsvorgaben abhängig.<br />
Im Rahmen der Ziel-Netzplanung ist es erforderlich, verschiedene Netzvarianten mit unterschiedlich angesetzten äußeren<br />
und inneren Rahmenbedingungen zu untersuchen.<br />
1. Einleitung<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>ssysteme sind komplexe Systeme, deren<br />
Aufbau, Unterhalt und Ausbau erhebliche Investitionen<br />
erfordern (vgl. Bild 1) und dabei auf eine lange Nutzungsdauer<br />
ausgerichtet sein müssen.<br />
Die <strong>Wasserversorgung</strong>ssysteme der Städte und Gemeinden<br />
wurden nicht als Gesamtsystem geplant, sondern sind in<br />
einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten durch einen fortwährenden<br />
Anlagenausbau entstanden. Es kann sein, dass<br />
die historisch gewachsene <strong>Wasserversorgung</strong>sstruktur unflexibel<br />
ist und einige Anlagen (besonders Rohrnetze) für heutige<br />
Bedürfnisse überdimensioniert bzw. nicht ausreichend<br />
ausgelastet sind. Der Grund hierfür sind oft die – bei der<br />
damaligen Planung – angesetzten Auslegungsparameter.<br />
Aus diesem Grund ist für eine betriebssichere <strong>Wasserversorgung</strong>,<br />
verbunden mit dem Einsparpotenzial von Betriebskosten,<br />
aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ein<br />
zukunftsorientiertes, langfristig gültiges Versorgungskonzept<br />
erforderlich. Um das bestehende Versorgungssystem<br />
technisch am sinnvollsten an die zukünftigen Gegebenheiten<br />
anzupassen, muss dieses ganzheitlich optimiert,<br />
d.h. als Ziel-System geplant werden. Das Wasserrohrnetz<br />
des Ziel-Systems muss ebenfalls, unter Berücksichtigung<br />
der Änderungen im Versorgungssystem, an die zukünftige<br />
Situation angepasst werden, d.h. als Ziel-Netz (unter<br />
Berücksichtigung von Druckverhältnissen, Strömungsverhältnissen,<br />
Netzüberwachung, Löschwasserversorgung,<br />
usw.) geplant werden.<br />
Bild 1: Kostenverhältnis in einem <strong>Wasserversorgung</strong>ssystem<br />
Die neu definierten Versorgungsgebiet(e), Auslegungsparameter<br />
und die Zustandsbewertung der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
in bautechnischer, verfahrenstechnischer und elektrotechnischer<br />
Hinsicht, stellen die Entscheidungsgrundlage<br />
für die zukünftige Struktur des <strong>Wasserversorgung</strong>ssystems<br />
dar. Es soll geklärt werden, ob die Möglichkeit besteht, auf<br />
einige Anlagen (wie Hochbehälter) zu verzichten, ohne dass<br />
die allgemeinen Anforderungen im <strong>Wasserversorgung</strong>sbereich<br />
(Beispiel: Versorgungssicherheit) gefährdet sind. Dazu<br />
sollen auch mögliche Schadens-/Ausfallszenarien (Risikomanagement<br />
im normalen Betrieb) unter Anwendung einer<br />
Rohrnetzanalyse und -berechnung betrachtet werden.<br />
Aus diesem Grund ist der Maßnahmenkatalog mit Priorisierung<br />
(Versorgungsrelevanz, Dringlichkeit, Reihenfolge,<br />
usw.) der vorgesehenen Maßnahmen, verbunden mit einer<br />
Kostenannahme, eine sehr wichtige Entscheidungsgrundlage<br />
für die systematische und sukzessive Optimierung<br />
der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen bzw. die Umsetzung einer<br />
„neuen“ <strong>Wasserversorgung</strong>sstruktur einer Stadt/Gemeinde.<br />
2. Anforderungen an <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
Grundsatz und Ziel des Betriebs der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
ist die Bereitstellung von Trinkwasser an jeder Stelle<br />
des Versorgungsgebietes<br />
»»<br />
in ausreichender Menge,<br />
»»<br />
mit ausreichendem Druck,<br />
»»<br />
in hygienisch einwandfreier Qualität,<br />
»»<br />
mit möglichst störungsfreier Wasserlieferung<br />
und, falls dies möglich ist, mit minimal möglichen Kosten [1].<br />
Im vorliegenden Fachartikel werden besonders folgende<br />
Anforderungen an Wasserrohrnetze berücksichtigt:<br />
2.1 Anforderungen an Wasserrohrnetze<br />
Grundsatz und Ziel der Planung und des Betriebs von Wasserrohrnetzen<br />
erfordert eine Reihe grundsätzlicher Überlegungen<br />
und Zielvorgaben:<br />
»»<br />
Festlegung des Planungszieles<br />
»»<br />
Abgrenzung des Versorgungsgebietes, unter Berücksichtigung<br />
des Flächennutzungsplanes (FNP)<br />
»»<br />
Ermittlung des Wasserbedarfs und der räumlichen<br />
Verteilung<br />
38 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
»»<br />
Berücksichtigung der Entwicklungsschwerpunkte<br />
»»<br />
Abschätzung der Auswirkung von möglichen Schwerpunktverschiebungen<br />
und Betriebsstörungen<br />
»»<br />
Erarbeitung verschiedener Lösungen<br />
»»<br />
Technischer und wirtschaftlicher Vergleich der verschiedenen<br />
Lösungsmöglichkeiten<br />
»»<br />
Planung in Ausbaustufen<br />
Innerhalb der ermittelten Lösungsansätze sind folgende<br />
Kriterien zu beachten:<br />
»»<br />
Hohe Versorgungssicherheit<br />
»»<br />
Gesamtwirtschaftlichkeit, d.h. Minimierung von Jahreskosten<br />
aus Kapitaldienst, Betrieb (z.B. Förderkosten)<br />
und Instandhaltung<br />
»»<br />
Einfache Erweiterungsmöglichkeiten<br />
»»<br />
Einfache Überwachung von Netzteilen<br />
»»<br />
Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung des Trinkwassers,<br />
z.B. durch Stagnation (Wasserqualität)<br />
Besondere Anforderungen bei der Planung und dem Betrieb<br />
von Wasserrohrnetzen werden an die Druckverhältnisse und<br />
Strömungsverhältnisse gestellt.<br />
2.1.1 Druckverhältnisse in Wasserrohrnetzen<br />
Wasserrohrnetze sind mindestens für einen MDP (höchster<br />
Systembetriebsdruck) von 10 bar zu planen. Der Systembetriebsdruck,<br />
ohne Druckstöße, sollte etwa 2 bar unter<br />
MDP liegen (unter dieser Voraussetzung steht in der Regel<br />
noch eine genügend große Reserve zur Aufnahme von<br />
Druckstößen zur Verfügung).<br />
Wasserrohrnetze mit größeren Höhenunterschieden sind<br />
in Druckzonen zu unterteilen. Als Ruhedruck im Schwerpunkt<br />
einer Druckzone sind 4 bis 6 bar am Hausanschluss<br />
empfehlenswert.<br />
Der erforderliche Versorgungsdruck im versorgungstechnischen<br />
Schwerpunkt einer Druckzone richtet sich nach<br />
der überwiegend ortsüblichen Geschosszahl der Bebauung<br />
dieser Zone [3]. Netze sind so zu bemessen, dass<br />
Versorgungsdrücke (Innendruck bei Nulldurchfluss in der<br />
Anschlussleitung an der Übergabestelle zum Verbraucher)<br />
in der Tabelle 1 nicht unterschritten werden.<br />
Diese anzustrebenden Versorgungsdrücke können bei Spitzenverbrauch<br />
an wenigen Stunden des Jahres kurzfristig<br />
um 0,5 bar verringert / unterschritten werden. Außerdem<br />
können wirtschaftliche Gründe gegen eine generelle Vorhaltung<br />
dieser Drücke bei historisch gewachsenen Versorgungsfällen<br />
sprechen [3].<br />
Grundsätzlich sollten bei Ruhedrücken (nach DIN EN 806-<br />
2) über 4,8 bar sämtliche Hausinstallationen mit einem<br />
Druckminderventil ausgestattet werden. In Netzteilen mit<br />
Ruhedrücken über 8 bar ist die Verwendung von Leitungen<br />
und Bauteilen auf 16 bar MDP zu erwägen.<br />
Für den Brandfall fordert das DVGW-Arbeitsblatt W 405,<br />
dass während der Löschwasserentnahme der Druck im<br />
Wasserrohrnetz an keiner Stelle unter 1,5 bar absinkt.<br />
2.1.2 Strömungsverhältnisse in Wasserrohrnetzen<br />
Die Fließgeschwindigkeit in Rohrleitungen beeinflusst nicht<br />
nur die Wirtschaftlichkeit eines Wasserrohrnetzes, sie hat<br />
auch großen Einfluss auf die Betriebssicherheit.<br />
Hohe Fließgeschwindigkeiten führen zu erheblichen Druckverlusten.<br />
Große Geschwindigkeitsänderungen verursachen<br />
hohe dynamische Druckänderungen und ggf. auch Wassertrübungen<br />
durch Aufwirbelungen.<br />
Geringe Fließgeschwindigkeiten haben lange Verweilzeiten<br />
zur Folge. Hier ist auf einen ausreichenden Wasseraustausch<br />
aus hygienischen Gründen (Wassertrübung, Verkeimung)<br />
zu achten. Leitungsabschnitte mit geringem Druckgefälle<br />
entlüften sich bei kleinen Fließgeschwindigkeiten häufig<br />
unzureichend. Vor allem bei langen Druckleitungen hat die<br />
Fließgeschwindigkeit einen entscheidenden Einfluss auf die<br />
Wirtschaftlichkeit der gesamten Versorgungsanlage.<br />
Für die Bemessung der Leitungen gelten nach DVGW W<br />
400-1 folgende Fließgeschwindigkeiten:<br />
»»<br />
Fallleitungen (Abgang Hochbehälter): 1,0 - 1,5 m/s<br />
»»<br />
Leitungen mit Druckerhöhung während der Höchstbelastung:<br />
< 2,0 m/s<br />
»»<br />
Hauptleitungen und Versorgungsleitungen in Verteilungsnetzen:<br />
< 1,0 m/s<br />
»»<br />
Anschlussleitungen: < 2,0 m/s<br />
Um die möglichen Folgen einer Stagnation des Trinkwassers<br />
bzgl.<br />
»»<br />
Trübung und Verfärbung,<br />
»»<br />
Geschmacksbeeinträchtigung,<br />
»»<br />
Ablagerung und<br />
»»<br />
Verkeimung<br />
zu vermeiden, sollten in Wasserrohrnetzen die Fließgeschwindigkeiten<br />
beim mittleren Stundendurchfluss (Durchfluss<br />
bei mittlerem Stundenbedarf) den Wert von 0,005 m/s<br />
(= 18 m/h = 432 m/d) nicht unterschreiten [3].<br />
3. Rahmenbedingungen einer Ziel-Netzplanung<br />
Die Voraussetzung, um ein Ziel-Netz („Wasserrohrnetz auf<br />
grüner Wiese“) entwickeln zu können, ist die Analyse der<br />
im bestehenden <strong>Wasserversorgung</strong>ssystem enthaltenen<br />
Tabelle 1: Erforderlicher min. Versorgungsdruck im Wasserrohrnetz<br />
Bebauungshöhe<br />
neue Netzte bzw.<br />
signifikante Erweiterung<br />
bestehender Netze<br />
bestehende Netze<br />
(1) (2) (3)<br />
für Gebäude mit EG 2,00 bar 2,00 bar<br />
für Gebäude mit EG und<br />
1 OG<br />
für Gebäude mit EG und<br />
2 OG<br />
für Gebäude mit EG und<br />
3 OG<br />
für Gebäude mit EG und<br />
4 OG<br />
2,50 bar 2,35 bar<br />
3,00 bar 2,70 bar<br />
3,50 bar 3,05 bar<br />
4,00 bar 3,40 bar<br />
10-11 | 2014 39
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
3.1 Ist-Zustands-Analyse der<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
Die Zustandsbewertung der vorhandenen <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
in bautechnischer, verfahrenstechnischer und<br />
elektrotechnischer Hinsicht, stellt die Entscheidungsgrundlage<br />
für die zukünftige Struktur des <strong>Wasserversorgung</strong>ssystems<br />
dar (vgl. Bild 2).<br />
Nach der Zustandsbewertung der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen,<br />
sind die Leistungsfähigkeit und Funktion der Anlagen<br />
im <strong>Wasserversorgung</strong>ssystem für die bestehende und<br />
zukünftige Situation zu überprüfen.<br />
Im Zuge der alternativen Versorgungskonzepte soll geklärt<br />
werden, ob die Möglichkeit besteht, auf einige Anlagen<br />
zu verzichten (einfacheres System und Reduzierung der<br />
Betriebskosten), ohne dass die allgemeinen Anforderungen<br />
im <strong>Wasserversorgung</strong>sbereich [1] gefährdet sind. Dazu sollte<br />
die Lage der Einspeisungen ins Netz für die zukünftige<br />
Situation festgelegt werden.<br />
Bild 2: Ablauf einer Ist-Zustands-Analyse der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen<br />
Komponenten, im Rahmen der möglichen Änderungen<br />
im Ziel-System gegenüber dem Ist-System. Hierbei werden<br />
»»<br />
die Ist-Zustands-Analyse der Versorgungsanlagen,<br />
»»<br />
die Lage der Einspeisungen ins Netz,<br />
»»<br />
der Zustand des Ist-Netzes,<br />
»»<br />
die Auslegungs-/Planungsparameter und<br />
»»<br />
die Spitzenverbräuche<br />
besonders analysiert.<br />
3.2 Lage der Einspeisungen ins Netz<br />
Das Wasserrohrnetz des Ziel-Systems muss ebenfalls, unter<br />
Berücksichtigung der Änderungen im Versorgungssystem,<br />
an die zukünftige Situation angepasst werden, d.h. als<br />
Ziel-Netz (unter Berücksichtigung von Druckverhältnissen,<br />
Strömungsverhältnissen, Netzüberwachung, Löschwasserversorgung,<br />
usw.) geplant werden.<br />
Auf der Basis einer Rohrnetzberechnung ist in erster Linie<br />
erforderlich, die Bezugsknoten (Einspeisungen ins Netz) in<br />
einem Rechennetzmodell festzulegen und dann die Druckund<br />
Strömungsverhältnisse für verschiedene Lastfälle und<br />
Betriebssituationen im Ziel-Netz zu simulieren.<br />
Wie in Bild 3 dargestellt, werden die bestehenden Hochbehälter<br />
HB 1, HB 2 und HB 3 auf Grund ihres schlechten<br />
Zustandes, der ungeeigneten Lage und der unzureichenden<br />
Speicherdeckung stillgelegt und ein neuer Hochbehälter<br />
gebaut. Diese Änderung der Struktur des <strong>Wasserversorgung</strong>ssystems<br />
soll im Rahmen der Ziel-Netzplanung<br />
mitberücksichtigt werden. In der bestehenden Situation<br />
wird über vier Hochbehälter, in der zukünftigen Situation<br />
über zwei Hochbehälter ins Netz eingespeist. Geänderte<br />
Einspeisungen ins Netz haben geänderte Druck- und<br />
Strömungsverhältnisse zur Folge.<br />
Bild 3: Neu definierte Einspeisungen im Wasserrohrnetz<br />
40 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Bild 4: Spitzenfaktoren nach DVGW W 410, in Abhängigkeit von der<br />
versorgten Einwohnerzahl<br />
Bild 5: Vom Ist-Netz zum Ziel-Netz<br />
3.3 Zustand des Ist-Netzes<br />
Für eine Ziel-Netzplanung ist es sehr wichtig, vorher<br />
»»<br />
den Zustand des Ist-Netzes in hydraulischer Hinsicht und<br />
»»<br />
den Zustand des Ist-Netzes im Hinblick auf die<br />
Rohrbruchhäufigkeit<br />
zu analysieren.<br />
Um eine Ist-Zustands-Analyse des Netzes in hydraulischer<br />
Hinsicht mit Hilfe einer geeigneten Berechnungssoftware<br />
durchführen zu können, ist ein Rechennetzmodell notwendig.<br />
Im Zuge der Kalibrierung des Rechennetzmodells<br />
wird die tatsächliche betriebliche Rauheit (u.a. Inkrustierungen/Ablagerungen,<br />
relevant für die Leistungsfähigkeit<br />
des Netzes) ermittelt. Mit dem kalibrierten Rechennetzmodell<br />
können die Druck- und Strömungsverhältnisse für<br />
die verschiedenen Betriebssituationen (wie Spitzenlastfall,<br />
Löschwasserversorgung und Stagnation) simuliert werden.<br />
Auf diese Weise lassen sich die Leitungsarten, Fall- und<br />
Ortsnetzleitungen bezüglich ihrer Größe und Wirksamkeit<br />
zuverlässig beurteilen [7].<br />
Die Netzrehabilitationsplanung unterstützt die Wasserversorger<br />
zusätzlich bei der Fragestellung, wo und wie sowie in<br />
welchem Umfang das Wasserrohrnetz rehabilitiert werden<br />
soll. Wird zu wenig investiert, sind mittelfristig erhöhte<br />
Ausfallraten und damit hohe Reparaturkosten unmittelbar<br />
verbunden. Wird zu viel oder an der falschen Stelle rehabilitiert,<br />
wirkt sich das negativ auf die Gebührenkalkulation aus.<br />
3.4 Auslegungsparameter<br />
Bei der Dimensionierung der Rohrleitungen in einem Wasserrohrnetz<br />
sind die im DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 vorgegebenen<br />
Richtwerte bezüglich der Fließgeschwindigkeiten<br />
sowie der Versorgungsdrücke einzuhalten. Neben der reinen<br />
Trinkwasserversorgung der angeschlossenen Verbraucher,<br />
soll oft bei der Dimensionierung der Rohrleitungen auch die<br />
Aufgabe der Bereitstellung von Löschwasser (Grundschutz)<br />
über das Wasserrohrnetz berücksichtigt werden. Grundlage<br />
für die Dimensionierung der Rohrleitungen zur Löschwasservorhaltung<br />
im Brandfall ist das DVGW-Arbeitsblatt W<br />
405 sowie Angaben der Stadt/Gemeinde.<br />
Grundsätzlich wird für eine Ziel-Netzplanung benötigt:<br />
»»<br />
der Trinkwasserverbrauch/-bedarf durch die Analyse<br />
››<br />
der Einwohnerentwicklung min. der letzten fünf bis<br />
zehn Jahre,<br />
››<br />
der Wasserverbrauchsentwicklung min. der letzten<br />
fünf bis zehn Jahre,<br />
››<br />
der Einwohnerentwicklungsprognose (Anpassung<br />
an FNP),<br />
››<br />
der Entwicklung der Gewerbe- und Industriegebiete<br />
im Versorgungsgebiet,<br />
››<br />
der Wasserbedarfsprognose für die nächste<br />
Zielperiode<br />
»»<br />
der Löschwasserbedarf (Grundschutz), in Abstimmung<br />
mit der zuständigen Feuerwehrbehörde;<br />
»»<br />
die zukünftige Baustruktur und Bauhöhe, die mit dem<br />
Stadtplaner festzulegen ist.<br />
3.5 Spitzenverbräuche<br />
Aus den Maximalwerten (Stundenspitzenverbrauch/-bedarf)<br />
ergibt sich die erforderliche Wasserbereitstellungsmenge pro<br />
Stunde, die auch für die Bemessung der Wasserrohrnetze<br />
die Grundlage bildet.<br />
Da die Faktoren zur Ermittlung des Tages- und<br />
Stundenspitzenverbrauchs/-bedarfs in der Praxis nicht oft<br />
über Messungen ermittelt werden, werden die Spitzenfaktoren<br />
nach DVGW W 410 in Abhängigkeit von der versorgten<br />
Einwohnerzahl gewählt (vgl. Bild 4).<br />
Bezogen auf ein Jahr, ist es erforderlich, in einem Versorgungsgebiet<br />
ca.<br />
10-11 | 2014 41
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
»»<br />
zwei bis drei Stunden jährlich die maximalen<br />
Stundenspitzenverbräuche,<br />
»»<br />
15 Tage jährlich die maximalen Tagesspitzenverbräuche<br />
und<br />
»»<br />
350 Tage jährlich den durchschnittlichen Tagesverbrauch<br />
bereitzustellen.<br />
»»<br />
Im Zuge einer Ziel-Netzplanung ist besonders die Auslastung<br />
des Netzes in Abhängigkeit vom Lastfall zu<br />
berücksichtigen.<br />
4. FAZIT<br />
Im Rahmen einer Ziel-Netzplanung („Wasserrohrnetz auf<br />
einer grünen Wiese“) ist es sinnvoll verschiedene Wasserrohrnetzvarianten<br />
unter unterschiedlich angesetzten<br />
Rahmenbedingungen zu untersuchen.<br />
Voraussetzung, um ein Ziel-Netz entwickeln zu können,<br />
ist die Analyse der möglichen Änderungen im Ziel-System<br />
gegenüber dem Ist-System (vgl. Bild 5).<br />
Hierbei sollten<br />
»»<br />
die äußeren Rahmenbedingungen (Zustand der <strong>Wasserversorgung</strong>sanlagen,<br />
Ist-System Ziel-System, Lage<br />
der Einspeisungen ins Wasserrohrnetz),<br />
»»<br />
die inneren Rahmenbedingungen (Versorgungsgebiet,<br />
Wasserbedarf und räumliche Verteilung) und<br />
»»<br />
die besonderen Anforderungen bei der Planung und dem<br />
Betrieb von Rohrnetzen (minimal erforderlicher Versorgungsdruck<br />
im Wasserrohrnetz, Vermeidung von Stagnation<br />
im Wasserrohrnetz - Fließgeschwindigkeit soll v ><br />
0,005 m/s besser > 0,3 m/s sein) mitberücksichtigt werden.<br />
Die o.g. Rahmenbedingungen und besonderen Anforderungen<br />
an Wasserrohrnetze, stellen die Entscheidungsgrundlage<br />
für das Ziel-Netz und die systematische und sukzessive<br />
Umsetzung (langfristiger Prozess) eines Ziel-Netzes dar.<br />
5. Literaturverzeichnis<br />
[1] DIN 2000 „Zentrale Trinkwasserversorgung Leitsätze für<br />
Anforderungen an Trinkwasser Planung, Bau und Betrieb der<br />
Anlagen“<br />
[2] DVGW GW 303-1 „Berechnung von Gas- und Wasserrohrnetzen<br />
- Teil 1: Hydraulische Grundlagen, Netzmodellisierung und<br />
Berechnung“ (2010-10)<br />
[3] DVGW W 400-1 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(TRWV) - Teil 1: Planung“ (2004-10)<br />
[4] DVGW W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die<br />
öffentliche Trinkwasserversorgung“ (2008-02)<br />
[5] BauNV „Baunutzungsverordnung“<br />
[6] DVGW W 410 „Wasserbedarf – Kennwerte und Einflussgrößen“<br />
(2007-09)<br />
[7] Osmancevic, E.; Kuhn, T.; Astfalk, M.: Durchmesseroptimierung<br />
im Rahmen einer Ziel-Netzplanung, <strong>3R</strong> (2014) Nr. 3, S. 54-61<br />
Dr.-Ing. ESAD OSMANCEVIC<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel. +49 711 289513-20<br />
E-Mail: e.osmancevic@rbs-wave.de<br />
AUTOR<br />
42 10-11 | 2014
www.vulkan-verlag.de<br />
Wege zum Trinkwassernetz 2030<br />
Jetzt bestellen!<br />
Zielnetzentwicklung von<br />
Trinkwassernetzen<br />
Die <strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen sehen sich aufgrund des zu beobachtenden<br />
Bevölkerungsrückgangs, technologischer Entwicklungen und ähnlichen<br />
Faktoren mit einem rückläufigen Trinkwasserverbrauch konfrontiert. Die Auslegung<br />
der Trinkwassernetze basiert aus heutiger Sicht auf überhöhten Bevölkerungs-<br />
und Verbrauchsprognosen. Dies hat zur Folge, dass bisherige Spitzenbedarfswerte,<br />
auf denen die Dimensionierung des Rohrnetzes basiert, nicht<br />
mehr erreicht werden. Auf Grundlage der genannten Gründe sind Überlegungen<br />
zu einer möglichen zukünftigen Netzumgestaltung vorzunehmen. Vor dem Hintergrund<br />
dieser Problematik werden mögliche bauliche Umstrukturierungen<br />
und betriebliche Maßnahmen erarbeitet, die zu einer nennenswerten Verbesserung<br />
von möglichen Stagnationsbereichen führen. Werden bauliche und<br />
betriebliche Anpassungsmaßnahmen nicht verfolgt, kann eine Beeinträchtigung<br />
der Trinkwasserqualität durch auftretende Stagnationsbereiche im Trinkwassernetz<br />
eintreten.<br />
Hrsg.: Thomas Wegener<br />
1. Auflage 2014, 176 Seiten in Farbe,<br />
Broschur, DIN A5<br />
ISBN: 978-3-8027-5422-7<br />
Preis: € 44,80<br />
Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Bestellung per Fax: +49 (0) 201 Deutscher / 82002-34 Industrieverlag GmbH oder | abtrennen Arnulfstr. 124 und | 80636 im Fensterumschlag München einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex. Wege zum Trinkwassernetz 2030<br />
1. Auflage 2014 – ISBN: 978-3-8027-5422-7<br />
für € 44,80 (zzgl. Versand)<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Friedrich-Ebert-Str. 55, 45127 Essen.<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PAWZTN2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Auswahlkriterien für Spül- und<br />
Reinigungs maßnahmen in Trinkwasserleitungen<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen beliefern uns rund um<br />
die Uhr mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser. Um<br />
trübungsverursachende Partikel aus den Trinkwasserleitungen<br />
zu entfernen oder um Trübungen sowie weitere<br />
qualitative Beeinträchtigungen des Trinkwassers zu vermeiden,<br />
werden die Trinkwasserleitungen meist regelmäßig<br />
gespült oder gereinigt. Hierzu können verschiedene<br />
Verfahren und Konzepte eingesetzt werden – angefangen<br />
von der konventionellen Wasserspülung bis hin zur<br />
vollständigen Leitungsreinigung mittels Gummischeiben,<br />
Kratzern oder Hochdruck-Reinigungsgeräten. Zur<br />
Auswahl effizienter und nachhaltiger Verfahren können<br />
Kenntnisse über die physikalischen Wirkungsmechanismen<br />
der verschiedenen Spül- und Reinigungsverfahren<br />
sehr hilfreich sein. Auch sollten technische Rahmenbedingungen<br />
wie die Hydraulik und der Zustand der Leitungen<br />
oder der Inkrustierung bei der Auswahl passender Verfahren<br />
beachtet werden. Der nachfolgende Beitrag gibt<br />
einen Einblick zur Wirksamkeit ausgewählter Spül- und<br />
Reinigungsverfahren und zeigt Ergebnisse aus einem<br />
praxisbezogenen Forschungsvorhaben zur Spülung von<br />
Leitungen mit größeren Durchmessern.<br />
Ursachen für Spül- und Reinigungsmaßnahmen<br />
Zur Bewertung der Wirksamkeit von Spül- und Reinigungsverfahren<br />
erwies es sich als sinnvoll, zunächst die übergeordneten<br />
Zielstellungen dieser Verfahren zu definieren. Vor<br />
dem Hintergrund einer sicheren Versorgung mit Trinkwasser<br />
wären diese Ziele:<br />
1. die Vermeidung oder Reduzierung von Beeinträchtigungen<br />
der Trinkwasserqualität, verursacht durch<br />
»»<br />
a. Trübungen<br />
»»<br />
b. Mikrobiologie<br />
2. die Vermeidung oder Reduzierung von Beeinträchtigungen<br />
der Rohrhydraulik mit Auswirkungen auf<br />
den energetischen Förderaufwand aufgrund erhöhter<br />
Reibungsverluste.<br />
Die Auswahl passender Spül- oder Reinigungsverfahren<br />
ist neben der Zielstellung zudem vom Zustand der inneren<br />
Leitungsoberfläche abhängig. Dieser Zustand kann in vier<br />
Grundformen eingeteilt werden (siehe Bild 1 bis Bild 4):<br />
»»<br />
Sedimente oder Ablagerungen an der Rohrsohle sowie<br />
mobilisierbare Partikel,<br />
»»<br />
Biofilme über den gesamten Rohrumfang (schleimige<br />
Konsistenz),<br />
»»<br />
haftende Ablagerungen über den gesamten Rohrumfang<br />
(weiche bis feste Konsistenz),<br />
»»<br />
Inkrustierungen wie z. B. Korrosionsprodukte mit weicher<br />
bis fester Konsistenz.<br />
Häufig können mehrere dieser vier genannten Grundformen<br />
auch gleichzeitig in Rohrleitungen vorkommen, wie<br />
z. B. Biofilme auf Inkrustierungen. Für jede Grundform des<br />
Quelle: Dominik Nottarp-Heim<br />
Quelle: IWW<br />
Bild 1: Lose Sedimente im Sohlenbereich einer<br />
Trinkwasserleitung<br />
Bild 2: Biofilm (hellbraune Schicht) auf der Innenoberfläche<br />
einer PE-Trinkwasserleitung<br />
44 10-11 | 2014
Quelle: Dominik Nottarp-Heim<br />
Quelle: IWW<br />
Bild 2: Feste An- und Ablagerungen auf der Innenoberfläche<br />
einer Trinkwasserleitung<br />
Bild 3: Feste Inkrustierungen auf der Innenoberfläche einer<br />
Trinkwasserleitung<br />
inneren Leitungszustandes sollten Spül- oder Reinigungsmaßnahmen<br />
auf das primäre Reinigungsziel abgestimmt<br />
werden (siehe Tabelle 1).<br />
Optisch auffällige und fest anhaftende anorganische Beläge,<br />
wie sie z. B. durch Eisen, Mangan und Carbonate<br />
gebildet werden, können in Form von Deckschichten oft<br />
korrosionsschützende Eigenschaften aufweisen. Deren<br />
teilweise bis vollständige Entfernung mit gleichzeitig<br />
freiliegender metallener Oberflächen kann Korrosionsprozesse<br />
(erneut) initiieren und kurz- bis mittelfristig<br />
nach der Spülmaßnahme zu neuen Trübungserscheinungen<br />
führen (Stichwort Ausbluten).<br />
Wirksamkeit von Spül- und Reinigungsverfahren<br />
Zur Auswahl stehen eine Reihe von Spül- und Reinigungsverfahren<br />
mit teils sehr unterschiedlichen Wirkmechanismen.<br />
Von diesen Wirkmechanismen sind wiederum die<br />
Effizienz und der Erfolg des ausgewählten Verfahrens<br />
abhängig. In Tabelle 2 sind die in Deutschland bekannten<br />
aber auch neuartigen Spül- bzw. Reinigungsverfahren<br />
dargestellt. Auf die Wirkweise der am häufigsten<br />
eingesetzten Spülverfahren wird im Folgenden weiter<br />
eingegangen.<br />
Zustand<br />
»»<br />
Erhöhung der Fließgeschwindigkeit,<br />
»»<br />
Erhöhung der Dichte des strömenden Fluides und<br />
»»<br />
Erhöhung der Viskosität des strömenden Fluides.<br />
Die Fließgeschwindigkeit in Rohrleitungen lässt sich nicht<br />
beliebig erhöhen, so dass vor allem zur vollständigen<br />
Tabelle 1: Vom inneren Leitungszustand abhängiges primäres<br />
Reinigungsziel von Spül- und Reinigungsmaßnahmen<br />
Reinigungsziel<br />
Reduzierung von Trübungserscheinungen<br />
Reduzierung der<br />
Aufkeimungsgefahr<br />
Erhöhung der<br />
hydraulischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Sedimente +++ (++) (++)<br />
Biofilme +++ (+)<br />
Fest haftende<br />
An-/Ablagerungen<br />
++ (+) (+)<br />
Inkrustierungen (++) (++) +++<br />
+++ primäres Reinigungsziel<br />
++ mögliches Reinigungsziel<br />
+ unter Umständen relevantes Reinigungsziel<br />
Tabelle 2: Wirkmechanismen verschiedener Spül- und Reinigungsverfahren<br />
Fließgeschwindigkeit und Schleppspannung<br />
Eine wichtige Kenngröße zur Beschreibung der Mobilisierbarkeit<br />
von Partikeln und Belägen ist die sogenannte<br />
Schleppspannung (auch Scherspannung). Schleppspannungen<br />
werden durch das strömende Wasser in der Leitung<br />
erzeugt. Erhöhte Schleppspannungen (im Vergleich<br />
zum Normalbetrieb) können durch Beschleunigung des<br />
Wassers (höhere Fließgeschwindigkeit) bei Anwendung<br />
von Spülverfahren wie Wasserspülungen (Spülung mit<br />
klarer Wasserfront), Luft-Wasser-Spülungen, Impulsspülungen<br />
oder Saugspülungen erzeugt werden. Damit<br />
Partikel oder Beläge gelöst und abtransportiert werden,<br />
muss die Schleppspannung deren Haftkraft bzw. Trägheit<br />
überwinden. Je größer die Haftkraft von Belägen und je<br />
schwerer Partikel sind, umso größer muss die Schleppspannung<br />
zur Mobilisierung sein. Die Schleppspannung<br />
lässt sich durch folgende Einflussgrößen erhöhen:<br />
Verfahren<br />
Wasserspülung<br />
Luft-Wasser-Spülung<br />
Impulsspülung<br />
Saugspülung<br />
Desinfektionen<br />
Molche aus Schaumstoff,<br />
Gummischeiben oder<br />
Stahlbürsten/-kratzer<br />
Hochdruck- und<br />
Höchstdruckreinigung<br />
Feststoffspülung<br />
Reinigung per Hand<br />
Eismolchung/Icepigging<br />
(+ NaOCl)<br />
Wirkungsweise<br />
Erhöhung der Fließgeschwindigkeit → Erhöhung der Schleppspannung<br />
bzw. Wandschubspannung → Mobilisier ung und<br />
Abtransport von losen bis teilweise fest haftenden Partikeln und<br />
Belägen<br />
Abtötung von Mikroorganismen<br />
Abrasion, Schwammwirkung → teilweise bis vollständige Ablösung<br />
und Abtransport von losen bis fest haftenden Partikeln und<br />
Belägen<br />
Abrasion, Prallkräfte → Ablösung und Abtransport von losen bis<br />
fest haftenden Partikeln und Belägen<br />
Abrasion, Prallkräfte → Ablösung und Abtransport von losen bis<br />
fest haftenden Partikeln und Belägen<br />
Abrasion → Entfernung von losen bis fest haftenden Partikeln<br />
und Belägen<br />
(Abrasion), Schwammwirkung, (Desinfektion) → Abtötung, Ablösung<br />
und Abtransport von Biofilmen; Abtransport loser Partikel<br />
und Beläge<br />
10-11 | 2014 45
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Quelle: IWW<br />
Auswahl von Spül- und<br />
Reinigungsverfahren<br />
Die meisten verfügbaren Spül- und Reinigungsverfahren<br />
haben in Abhängigkeit<br />
des Reinigungsziels klare Vorteile aber<br />
auch Einschränkungen. In Tabelle 3<br />
sind unter Beachtung der angestrebten<br />
Reinigungsziele die Verfahren mit dem<br />
in der Regel besten Kosten-Nutzen-<br />
Verhältnis aufgezeigt (Nutzen: Effizienz,<br />
Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeit,<br />
Realisierbarkeit).<br />
Bild 5: Unterschiede der Wirksamkeit von Schleppspannung und Wandschubspannung.<br />
Schleppspannungen in unmittelbarer Rohrwandnähe werden als Wandschubspannung<br />
bezeichnet<br />
Mobilisierung festhaftender Inkrustierungen die erzielbaren<br />
Schleppspannungen nicht ausreichen. Eine vollständige<br />
Entfernung von Inkrustierungen ist somit durch<br />
reine Spülverfahren oft nicht möglich. Eine teilweise Entfernung<br />
von Inkrustierungen sollte aufgrund der Gefahr<br />
des Ausblutens oder Initiierung neuer Korrosionsprozesse<br />
ebenfalls nicht angestrebt werden, sofern keine weiteren<br />
Maßnahmen zu deren Eindämmung in Folge der Spülung<br />
vorgesehen sind.<br />
Die Größe der Schleppspannung ist in Abhängigkeit von<br />
der Fließgeschwindigkeit nicht über den Rohrquerschnitt<br />
gleichverteilt, sondern nimmt in unmittelbarer Nähe zur<br />
Rohrinnenoberfläche stark ab. Daher ist hier die Mobilisierung<br />
feiner (gelartiger Sedimente) und dünnschichtiger<br />
Beläge (z. B. Biofilme) erschwert (siehe Bild 5). Somit sind<br />
etwa reine Spülverfahren zur Entfernung von Biofilmen mitunter<br />
nicht geeignet. In diesem Fall sollte eine Kombination<br />
aus geeignetem Spülverfahren und Desinfektionsverfahren<br />
zur Ablösung bzw. Teilentfernung und anschließender<br />
Abtötung von Biofilmen eingesetzt werden. Bei glatten<br />
Rohrinnenoberflächen wie z. B. bei Kunststoffleitungen<br />
oder mit Zementmörtel ausgekleideten Leitungen wurden<br />
die höchsten Biofilmentfernungsraten durch das sogenannte<br />
Ice-Pigging-Verfahren (Eismolchen) erzielt. Unter<br />
Umständen kann das Impulsspülverfahren mit einer fast<br />
annähernd gleichhohen Entfernungsrate eingesetzt werden<br />
[1]. Die vollständige Entfernung von Inkrustierungen<br />
und festhaftenden Ablagerungen ist nur mit mechanischen<br />
Reinigungsverfahren wie Molchung, mit Kratzern oder der<br />
Hochdruckreinigung möglich und erfordert bei metallenen<br />
Rohrleitungen üblicherweise Maßnahmen zur Nachbehandlung<br />
der blanken Rohrinnenoberfläche, um (erneute) Korrosionsprozesse,<br />
Inkrustierungen und Trübungserscheinungen<br />
zu unterbinden. Meist wird hierzu eine Zementmörtelauskleidung<br />
vorgenommen [2].<br />
Rahmenbedingungen<br />
Je mehr An- und Ablagerungen mit reinen<br />
Spülverfahren ausgetragen werden<br />
sollen, umso länger wird die Spüldauer<br />
und umso größer die benötigte Gesamtspülwassermenge.<br />
Vor allem bei der Spülung<br />
von Leitungen großer Nennweiten<br />
fallen dann erhebliche Mengen Spülwasser<br />
an, die abgeleitet werden müssen.<br />
Eine Grundvoraussetzung für die Spülung und Reinigung<br />
von Leitungen ist daher die Möglichkeit zum Auslassen des<br />
Spülwassers aus der Leitung und zur Einleitung in die Vorflut<br />
oder Ähnliches. Grundsätzlich sollten folgende Parameter<br />
geprüft werden:<br />
»»<br />
Existenz und Dimensionierung des Spülwasserauslasses,<br />
»»<br />
Möglichkeiten der Spülwasserentsorgung (z. B. Vorflut,<br />
Kanal, Tankwagen, Erdmulden, Retentionsräume, mobile<br />
Absetz- und Speichersysteme, Wasserbehälter),<br />
»»<br />
Spülwasserverfügbarkeit,<br />
»»<br />
Zugänglichkeit zur Leitung oder zum Einlass/Auslass,<br />
»»<br />
Art und Anzahl der Einbauten (Einbringen von Technik,<br />
Hindernisse für eingebrachte Technik).<br />
Wasserspülung<br />
Pauschalisierte Spülgeschwindigkeitsangaben für reine<br />
Wasserspülmaßnahmen, wie sie etwa bei Mutschmann<br />
und Stimmelmayr [3], Vreeburg und Boxall [4] oder in<br />
DVGW W 291 [5] angegeben sind, sollten nicht als Maßstab<br />
für die Wasserspülung von vor allem großen Nennweiten<br />
genutzt werden. Vor der Zielstellung, die Gefahr von Trübungen<br />
im Trinkwasser zu vermeiden oder zu reduzieren ist<br />
vielmehr das Verhältnis folgender Fließgeschwindigkeiten<br />
relevant:<br />
»»<br />
mittlere Fließgeschwindigkeit v m<br />
im Regelbetrieb<br />
(Tagesmittel),<br />
»»<br />
mittlere Spülgeschwindigkeit v Spül<br />
während der Spül- und<br />
Reinigungsmaßnahme,<br />
»»<br />
maximal beobachtete Fließgeschwindigkeit v max<br />
im<br />
Regelbetrieb während des Spitzenverbrauchs (z. B. in<br />
den Morgen- oder Abendstunden).<br />
Sofern das Verhältnis v m<br />
/v Spül<br />
kleiner ist als das Verhältnis v m<br />
/<br />
v max<br />
, kann eine ausreichende Mobilisierung und ein Austrag<br />
trübungsverursachender Partikel und loser Anlagerungen<br />
46 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
erwartet werden. Das bedeutet, dass auch<br />
durchaus mit der konventionellen Wasserspülung<br />
(Spülung mit klarer Wasserfront) und<br />
geringen Spülgeschwindigkeiten ausreichende<br />
Erfolge zur Reduzierung bzw. Vermeidung<br />
von Trübungserscheinungen erzielt werden<br />
können. Dies ist vor allem bei Haupt- oder<br />
Zubringerleitung (die meist auch größere<br />
Nennweiten aufweisen) zu erwarten, wodurch<br />
sich der Aufwand zu deren Spülung wesentlich<br />
reduzieren kann.<br />
Ice Pigging<br />
Das Ice-Pigging-Verfahren (Eismolchung) hat<br />
mit 1,5 bis maximal 2 Leitungsvolumen einen<br />
geringen Gesamtwasserverbrauch. Die langsame<br />
Reinigungsgeschwindigkeit ermöglicht<br />
auch in großen Nennweiten eine angemessene<br />
Ableitung des anfallenden Spülwassers.<br />
Zusätzlich ist fast die gesamte Schmutzfracht<br />
im Eismolch gebunden, so dass meistens nur<br />
15 bis 18 m³ an Schmutzwasserfracht behandelt<br />
werden müssen und etwa die Hälfte des<br />
Leitungsvolumens an Spülwasser mit leicht erhöhter Trübung<br />
im Nachgang der Reinigung anfallen. Die halbfeste Konsistenz<br />
des Eismolches erlaubt ein ständiges Anpassen an die Rohrtopographie<br />
bzw. an den Rohrquerschnitt und verhindert ein<br />
Steckenbleiben.<br />
Impulsspülverfahren<br />
Das Impulsspülverfahren hat einen zur Wasserspülung vergleichbaren<br />
Gesamt-Wasserverbrauch mit bis zum fünffachen<br />
des Leitungsvolumens. Die ersten Impulse lösen die zu mobilisierenden<br />
Partikel bzw. Ablagerung, die folgenden Impulse<br />
sorgen für den Austrag. Die erreichbaren Schleppspannungen<br />
an der Rohrwand (Wandschubspannungen) liegen im Mittel<br />
um das 10-fache höher im Vergleich zur konventionellen<br />
Wasserspülung bei 3 m/s, zeitweise kann lokal begrenzt das<br />
1.000-fache erreicht werden.<br />
Unter der Beachtung der hier dargestellten Erläuterungen<br />
und der Verwendung der Angaben aus Tabelle 3 können<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>sunternehmen das für ihren Anwendungszweck<br />
optimale Spül- oder Reinigungsverfahren auswählen.<br />
Mit vorlaufenden Analysen von Zusammensetzung und Größe<br />
der Sedimente/Partikel, Beläge und Inkrustierungen sowie<br />
mittels hydraulischen Messungen/Modellierungen können<br />
die notwendigen Informationen zur Bestimmung des inneren<br />
Leitungszustands gewonnen werden.<br />
Tabelle 3: Optimale Spül- und Reinigungsverfahren in Abhängigkeit der Zielstellungen<br />
Zielstellung(en)<br />
Reduzierung/Vermeidung<br />
Mikrobiologie<br />
Trübung<br />
Reibungsverluste<br />
NTU KBE Re l<br />
X<br />
Verfahren<br />
alle Wasserspülverfahren<br />
des BMBF-Forschungsvorhabens “STATuS II” (Fördernummer<br />
13N10626).<br />
[1] Sorge C.; Nottarp-Heim D. (2012): Entwicklung eines Spül- und<br />
Reinigungskonzepts für Trinkwasserleitungen größerer Nennweite<br />
(> DN 400) – vornehmlich Transport- und Fernwasserleitungen. IWW<br />
Zenrum Wasser, Biebesheim am Rhein, 119 S.<br />
[2] Zech H. (2014): Beurteilung des Zustands von<br />
Zementmörtelauskleidungen vor Ort: Durchführung der<br />
Auskleidung - relevante Wassergüteparameter. Konferenzbeitrag<br />
Zustandsbewertung und Sanierung von Trinkwasserleitungen;<br />
Biebesheim am Rhein am 18.09.2014.<br />
[3] Mutschmann J.; Stimmelmayr F. (2007): Taschenbuch der<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>. Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden, 926 S.<br />
[4] Vreeburg J.; Boxall J. B. (2007): Discolouration in Potable Water<br />
Distribution Systems: A Review. Water Research, 41, p. 519-529.<br />
[5] DVGW W 291 (2000): DVGW Arbeitsblatt W 291: Reinigung und<br />
Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen. Deutsche Vereinigung<br />
des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn, 36 S.<br />
DR. HANS-CHRISTIAN SORGE<br />
IWW, Biebesheim am Rhein<br />
Tel.: +49 69 25490-8020<br />
c.sorge@iww-online.de<br />
Hinweise<br />
v m<br />
/v Spül<br />
< v m<br />
/v max<br />
X (X) Eismolchung geringer Spülwasserbedarf, schützende<br />
Deckschichten werden i.d.R. nicht verletzt,<br />
kompakte Abfuhr der Schmutzfracht, kaum<br />
Anwendungserfahrung in Deutschland<br />
X (X) (X) Impulsspülverfahren<br />
X<br />
Eismolchung,<br />
Beaufschlagen<br />
der Leitung mit<br />
Gasen (z. B. CO 2<br />
)<br />
(X) (X) X Molchung mit<br />
Kratzern Hochdruckreinigung<br />
teilweise Entfernung von festen Inkrustierungen,<br />
Verletzung von schützenden Deckschichten<br />
möglich<br />
anschließende Auskleidung erforderlich<br />
AUTOREN<br />
Literatur<br />
Die hier vorgestellten Inhalte beruhen größtenteils auf Ergebnissen<br />
und Erkenntnissen der Forschungsvorhaben RWE „Entwicklung<br />
eines Spül- und Reinigungskonzepts für Trinkwasserleitungen<br />
größerer Nennweite (> DN 400) – vornehmlich Transport-<br />
und Fernwasserleitungen“ sowie „SecurEau“ innerhalb<br />
des 7. EU-Rahmenprogramms (Fördernummer 217976) und<br />
DOMINIK NOTTARP-HEIM<br />
Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau<br />
Tel.: +49 69 25490 3005<br />
dominik.nottarp-heim@hessenwasser.de<br />
10-11 | 2014 47
PROJEKT KURZ BELEUCHTET WASSERVERSORGUNG<br />
Wertvoller Baumbestand bewahrt –<br />
Trinkwasserleitung mit Close-Fit-Lining erneuert<br />
Bild 1: Über eine mobile Dampfanlage wird Heißdampf mit einer<br />
Temperatur von ca. 120 °C erzeugt, der nach dem Einzug in den<br />
Close-Fit-Liner eingeleitet wird<br />
nur wirtschaftlich ist und den Radverkehr möglichst wenig<br />
beeinträchtigt, sondern auch die alten Baumriesen schont.<br />
Die Close-Fit-Lining-Methode war wieder einmal die erste<br />
Wahl.<br />
Durch die grabenlose Methode mussten nur alle 130 bis<br />
160 m Baugruben ausgehoben werden, wodurch das Wurzelwerk<br />
weitgehend unversehrt blieb und der Radweg insgesamt<br />
nur für ca. vier Wochen gesperrt werden musste.<br />
Auch eine parallel zur Wasserleitung verlaufende Gasleitung<br />
wurde durch die Sanierung ohne Rohrgraben vor einer<br />
Beschädigung bewahrt. Insgesamt wurden zehn Baugruben<br />
zwischen 3,80 m und 7,60 m Länge, 1,50 m und 1,80 m<br />
Breite sowie 2,50 m und 2,80 m Tiefe ausgehoben.<br />
Um die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten,<br />
sanierte die Rohrbaufirma die alte PVC-Leitung DN 300 in<br />
zwei Bauabschnitten á 280 und 540 m. Die Ausmaße der<br />
Altleitung (Außendurchmesser da 315, Innendurchmesser<br />
di 285) erforderten eine Sonderlösung für den Liner, da das<br />
herkömmliche Faltrohr mit dem Außendurchmesser da 300<br />
nicht optimal in das alte Rohr passte und so die Gefahr<br />
bestand, dass es sich nicht nahtlos an das Altrohr anlegt.<br />
Der Linerhersteller egeplast international GmbH fertigte deshalb<br />
speziell für dieses Bauvorhaben ein Sonderrohr da 280.<br />
„Bevor wir den neuen Liner in Nordhorn einbauten, wurde<br />
er zunächst ausgiebig getestet“, sagt Markus Warmuth-<br />
Baron, Leiter Bereich Rohrsanierung bei Mennicke. „Bei<br />
einer Probebedampfung stellten wir sicher, dass seine<br />
Eigenschaften genauso optimal sind, wie die des Standard-Liners.“<br />
Die neue Leitung wurde anschließend mit<br />
Elektroschweißmuffen in das vorhandene Leitungssystem<br />
eingebunden. Nach erfolgreicher Druckprüfung und bakteriologischer<br />
Untersuchung konnten die Leitungsabschnitte<br />
wieder in Betrieb genommen werden.<br />
Bild 2: Der eingezogene Close-Fit-Liner vor und nach dem Aufdampfen<br />
Der Vechtesee in der niedersächsischen Grenzstadt Nordhorn<br />
ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch<br />
ein wichtiges ökologisches Gebiet. Das Seeufer im Bereich<br />
des Nordhorn-Almelo-Kanals wird von einem viel genutzten<br />
Radweg gesäumt, der durch eine Allee aus über 100<br />
Jahre alten Bäumen führt. Dort verläuft auch eine rund<br />
800 m lange Trinkwasserleitung aus dem Jahr 1970, die<br />
zunehmend Undichtigkeiten aufwies und deshalb saniert<br />
werden musste. Die Nordhorner Versorgungsbetriebe nvb<br />
beauftragten die Mennicke Rohrbau GmbH mit der Ausarbeitung<br />
eines geeigneten Sanierungskonzeptes, das nicht<br />
Bild 3: Die Einbindung in das vorhandene Rohrsystem erfolgte<br />
mit Schweißmuffenverbindungen<br />
KONTAKT:<br />
Mennicke Rohrbau GmbH, Nürnberg<br />
48 10-11 | 2014
WASSERVERSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Sanierung beendet enormen Wasserverlust in<br />
Nordspaniens wichtigster Wasserleitung<br />
Der spanische Wasserversorger Empresa Municipal de Aguas<br />
de Gijón (EMA) sah sich 2012 mit einem jährlichen Wasserverlust<br />
von 754.224 m 3 (das entspricht etwa 15 % des<br />
jährlich durchgeleiteten Gesamtvolumens) in einer seiner<br />
wichtigsten Hauptleitungen konfrontiert. Die gusseiserne<br />
Hauptwasserleitung (DN 500) wurde in den 1950ern gebaut<br />
und verläuft von La Camocha bis zur Wasseraufbereitungsanlage<br />
in Roces in Nordspanien. Auf einer Länge von insgesamt<br />
2.562 m bedurfte sie dringend einer Sanierung.<br />
Konventionelle Sanierungsmethoden hätten den Versorger<br />
dazu gezwungen, in einem langwierigen, mühsamen und<br />
kostspieligen Prozess Baugenehmigungen von den betroffenen<br />
Anliegern einzuholen. Zusätzlich hätten die ansässigen<br />
Hausbesitzer und Landwirte über einen längeren Zeitraum<br />
größere Beeinträchtigungen wie Verkehrsbehinderungen<br />
und Baulärm in Kauf nehmen müssen.<br />
Mit der grabenlosen Technologie Primus Line ® entschied<br />
sich EMA für eine Alternative, die durch geringfügigen<br />
Bodenaushub und große Installationslängen eine kurze<br />
Bauzeit ermöglicht. Auf diese Weise können Anwohner<br />
auch während der Sanierung fast ungestört ihrem Alltag<br />
nachgehen und haben schnell wieder Zugang zu ihrer<br />
<strong>Wasserversorgung</strong>.<br />
Ende Februar 2014 erhielt das Konsortium UTE Camocha,<br />
das sich aus den Unternehmen Comsa und Sardesa zusammensetzt,<br />
den Auftrag zur Sanierung der Hauptwasserleitung<br />
DN 500 mit einem Betriebsdruck von 10 bar. Der<br />
Einzug sollte hauptsächlich über vorhandene Wartungskammern<br />
entlang der Leitung stattfinden, um Zeit zu sparen und<br />
Belastungen für die Anwohner möglichst gering zu halten.<br />
Mit einer hohen Flexibilität und großen Einzugslängen von<br />
bis zu 2500 m am Stück ist das System Primus line ® für<br />
solche Einsatzgebiete gut geeignet.<br />
Für die fünf Installationsabschnitte mit Längen von 558,<br />
528, 305, 458 und 713 m wurde der Schlauch bereits in<br />
der Produktionshalle am Hauptsitz der Rädlinger primus line<br />
GmbH in Deutschland auftragsspezifisch zugeschnitten, vorgefaltet<br />
und auf fünf Transporttrommeln gewickelt. Anfang<br />
Mai erreichten die Trommeln die Baustelle in Nordspanien,<br />
wo die Inliner von dem auf grabenlose Rohrsanierung spezialisierten<br />
Unternehmen sinzaTEC mit einer Installationsgeschwindigkeit<br />
von bis zu 10 m/min eingezogen wurden.<br />
Da das Sanierungsverfahren als selbsttragendes System<br />
keiner Verklebung bedarf, war im Vorfeld nur eine grobe<br />
Reinigung der vorhandenen Leitung mit Kratzern und Gummischwabbern<br />
nötig.<br />
Die gesamte Installation der Inliner inklusive der zugehörigen<br />
Mitteldruckverbinder erfolgte in nur drei Wochen.<br />
Der Einsatz von Primus Line ® spart durch den geringen<br />
Maschinenbedarf vor Ort und die schnelle Durchführung<br />
im Vergleich zu herkömmlichen Rohrsanierungsmethoden<br />
signifikant Kosten und Zeit. Mit ihrer Korrosionsunempfindlichkeit<br />
und abriebfesten Außenbeschichtung sichert die<br />
flexible Druckleitung die Trinkwasserversorgung von Gijón<br />
mindestens für die nächsten 50 Jahre.<br />
KONTAKT:<br />
Rädlinger primus Line GmbH, Cham<br />
Bild 1: Einzug des vorgefalteten Inliners durch sinzaTEC mit bis zu<br />
10 m/min<br />
Bild 2: Verladung zweier Trommeln in der Produktion in Weiding<br />
10-11 | 2014 49
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
GFK-Kanalsanierung unter Fahrrad-Highway<br />
Die Stadt Wilhelmshaven bringt in diesen Tagen einiges<br />
ins Rollen, und das darf man ruhig wörtlich nehmen: Zu<br />
den großen Investitionsprojekten der Stadt am Jadebusen<br />
zählt ein umfassendes Konzept zur Verbesserung der<br />
Radverkehrsinfrastruktur. Unter anderem wird die 660 m<br />
lange Schellingstraße zur Fahrradstraße umgestaltet;<br />
dafür wird die in baulich schlechtem Zustand befindliche<br />
Straße grundlegend saniert. Die Schellingstraße dient als<br />
Zufahrtsstraße zum 2013 eröffneten Neuen Gymnasium<br />
Wilhelmshaven. Gerade diese Funktion spielte bei der<br />
Entscheidung für die vom Bund geförderte Verkehrsberuhigungsmaßnahme<br />
eine wichtige Rolle. Der Auftraggeber,<br />
die städtischen Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW),<br />
beschloss, im Zuge der notwendigen Umgestaltung auch<br />
die Kanalisation der Schellingstraße zu sanieren. Dabei<br />
sollte sowohl der Sammler als auch die Hausanschlüsse<br />
und Sinkkastenleitungen erneuert werden. Die Haltungen<br />
wurden ebenfalls hydraulisch neu berechnet, da der<br />
alte Sammler aus Steinzeug ungenügend dimensioniert<br />
war. Dies führte bei Starkregenereignissen immer wieder<br />
zu Überschwemmungen der Schellingstraße sowie der<br />
angrenzenden Straßenzüge. Für die Planung der Baumaßnahme<br />
zeichnete die Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH<br />
verantwortlich.<br />
Den Auftrag für die Erstellung des neuen Mischwasserkanal<br />
führte die Strabag AG, Direktion Nordwest, Bereich<br />
Weser-Ems/Gruppe Wilhelmshaven mit GFK-Wickelrohren<br />
der Amiantit Germany GmbH aus; ein 200 m langes Teilstück<br />
des 660 m langen Kanals sollte als Stauraumkanal<br />
dienen. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten<br />
von glasfaserverstärkten Kunststoffrohren war neben<br />
den hervorragenden Produkteigenschaften vor allem das<br />
problemlose Handling auf der Baustelle, mit dem das<br />
ausführende Unternehmen bereits bei anderen Tiefbau-<br />
Maßnahmen gute Erfahrungen gemacht hatte, zuletzt<br />
beim Bau einer Abwasserdruckleitung in Wilhelmshaven.<br />
Weichenstellung für noch mehr<br />
Fahrradfreundlichkeit<br />
Rund 1000 Schüler und Lehrer fahren das Neue Gymnasium<br />
Wilhelmshaven an Wochentagen an. Dementsprechend<br />
hoch ist das Verkehrsaufkommen. Nach Aussage<br />
von Auftraggeber und Planer war der Zustand der Fahrbahndecke<br />
zuletzt in so schlechtem Zustand, dass eine<br />
grundsätzliche Sanierung dringend nötig war.<br />
Die Stadt erstellte dann aber eine weitergehende umfangreiche<br />
Planung: Wenn man die Straße schon bis in 1 m<br />
Tiefe aufreißt, lohnt es sich, gleich noch ein Stück tiefer zu<br />
Fotos: STRABAG<br />
Bild 1: Neuer Kanal für die Schellingstraße: Ein 200 m langes Teilstück des<br />
660 m langen Kanals wird als Stauraumkanal dienen und mit FLOWTITE GFK-<br />
Wickelrohren DN 1200 ausgeführt<br />
Bild 2: Vorteile in der Bauausführung: Aufgrund<br />
der im Vergleich zu Betonrohren deutlich<br />
dünneren Rohrwandung von GFK-Rohren fällt<br />
auch deutlich weniger Aushub an<br />
50 10-11 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
gehen und auch die in die Jahre gekommene Kanalisation<br />
fit für die Zukunft machen, so die Überlegung. Besonders<br />
die inzwischen immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse<br />
hätten immer wieder zu Überschwemmungen<br />
geführt und deshalb eine angemessene Reaktion erfordert,<br />
hieß es auf Seiten des Auftraggebers TBW.<br />
Damit nicht genug: Sehr viele Wilhelmshavener nutzen<br />
das Fahrrad und die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung<br />
findet ihren Ausdruck auch im gut ausgebauten Radwegenetz<br />
von rund 140 km Länge. Zukünftig soll der<br />
Individualverkehr in Wilhelmshaven aber noch fahrradund<br />
damit auch umweltfreundlicher werden. Dafür hat<br />
die Stadt bereits im Jahr 2009 ein Radverkehrskonzept<br />
erstellen lassen, das auch die Schellingstraße betrachtete.<br />
Mit der Umwandlung in eine reine Fahrradstraße folgt die<br />
Stadt Wilhelmshaven nun den Empfehlungen des Konzeptes;<br />
bis zum Ende des Jahres sollen sämtliche baulichen<br />
Maßnahmen abgeschlossen sein. Die Chancen dafür,<br />
dass sich die veranschlagte Bauzeit von zehn Monaten<br />
einhalten lässt, stehen gut.<br />
Die wirtschaftlichste Lösung<br />
Dipl.-Ing. Hueseyin Akkurt, technischer Gruppenleiter bei<br />
der STRABAG AG, arbeitet nicht zum ersten Mal mit den<br />
FLOWTITE-Rohren. „Mit diesen GFK-Rohren haben wir<br />
in der Vergangenheit bereits mehrfach gute Erfahrungen<br />
gesammelt – zuletzt beim Bau einer Abwasserdruckwasserleitung<br />
DN 1200 zwischen dem Pumpwerk Süd und<br />
der Zentralkläranlage in Wilhelmshaven.“ Die Umsetzung<br />
des Projektes, im Zuge dessen rund 6 km Haltungen in<br />
Wilhelmshaven verlegt wurden, lief reibungslos. Bei der<br />
Sanierung der Schellingstraße empfahlen sich glasfaserverstärkte<br />
Kunststoffrohre aus mehreren Gründen. Laut<br />
des vom Planungsbüro Ingenieurgesellschaft Nordwest<br />
mbH erstellten Bodengutachtens besteht der Untergrund<br />
im Bauabschnitt aus Kleiboden mit Torfeinlagerungen,<br />
darunter befinden sich schluffige Sande. Die Verlegung<br />
von schweren Rohren – etwa aus Beton – hätte eine<br />
Gründung mit Bohrpfählen erfordert. „Dieses Verfahren<br />
hätte vergleichsweise hohe Kosten verursacht, den<br />
Zuschlag bekommen haben deshalb GFK-Rohre“, so<br />
Akkurt weiter. Die spielen aber noch einen weiteren<br />
produkttypischen Vorteil aus: „Aufgrund der im Vergleich<br />
zu Betonrohren deutlich dünneren Rohrwandung von<br />
GFK-Rohren fällt auch deutlich weniger Aushub an –<br />
folglich sinken auch die Kosten für den Bodenaustausch“,<br />
erläutert Akkurt. Nicht zuletzt sind die GFK-Rohre durch<br />
ihr geringeres Gewicht auf der Baustelle leichter zu handhaben<br />
als Rohre aus anderen Werkstoffen, sodass auch<br />
nur leichteres Baugerät erforderlich ist. In Wilhelmshaven<br />
verlegt wurden 460 m Rohre in DN 500, weitere 200 m<br />
der Leitung wurden zu DN 1200 aufdimensioniert und<br />
dienen zukünftig als Stauraumkanal. Da zahlreiche Leitungen<br />
queren und die Rohre dem eingesetzten Verbau<br />
angepasst werden sollten, wurde mit Rohren von 3 m<br />
Baulänge gearbeitet.<br />
Bild 3: AMITECH-GFK-Rohre sind korrosionsbeständig und<br />
zeichnen sich durch ihre Säurefestigkeit in Wasser- und<br />
Abwassersystemen aus. Die glatte Rohrinnenwand gestattet<br />
Fließgeschwindigkeiten von bis zu 8 m/s,<br />
Hervorragende Hydraulik, hohe chemische<br />
Beständigkeit<br />
GFK-Rohre haben natürlich nicht nur beim Einbau ihre<br />
Vorteile, sondern bewähren sich auch im täglichen Einsatz.<br />
„Statt eines festen Stahlzylinders bildet bei der<br />
Fertigung im Endlos-Wickelverfahren eine wandernde<br />
zylindrische Spirale den Stützkern, auf den sämtliche<br />
zur Produktion erforderlichen Materialien nacheinander<br />
aufgetragen werden“, erklärt Gebietsleiter Thomas Wede,<br />
Amiantit Germany GmbH. Das Ergebnis, so Wede, ist<br />
ein geprüftes Qualitätsprodukt, in dem sich hervorragende<br />
hydraulische Eigenschaften mit hoher chemischer<br />
Beständigkeit verbinden: „Unser GFK-Rohre sind korrosionsbeständig<br />
und zeichnen sich durch ihre Säurefestigkeit<br />
in Wasser- und Abwassersystemen aus. Die glatte<br />
Rohr-Innenwand gestattet Fließgeschwindigkeiten von<br />
bis zu 8 m/s – die Einsatzmöglichkeiten für FLOWTITE-<br />
Rohrsysteme sind praktisch unbegrenzt.“<br />
Im Bemühen darum, die Beeinträchtigungen für die Anwohner<br />
der Schellingstraße so gering wie möglich zu halten,<br />
haben die Technischen Betriebe Wilhelmshaven die Baumaßnahme<br />
in drei Abschnitte gegliedert. Mit den Arbeiten<br />
des ersten Bauabschnitts wurde im März begonnen, der<br />
dritte Bauabschnitt soll Ende des Jahres 2014 fertiggestellt<br />
sein. Die Zeichen stehen gut, dass die Planung eingehalten<br />
werden kann. Bislang jedenfalls gestalten sich die Abläufe<br />
auf der Baustelle reibungslos: „Die Zusammenarbeit der<br />
Baupartner ist vorbildlich“, lobt STRABAG-Gruppenleiter<br />
Akkurt.<br />
KONTAKT:<br />
Amiantit Germany GmbH, Mochau-Großsteinbach,<br />
Tel. +49 (0)3431 7182-10, schubert.s@amiantit.eu<br />
www.amiantit.eu<br />
Foto: Amitech Germany GmbH<br />
10-11 | 2014 51
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Flughafen Düsseldorf startet mit neuer<br />
Regenwasserbehandlung in Richtung Zukunft<br />
Die Flughafen Düsseldorf GmbH erweitert und saniert mit<br />
großem Aufwand ihre Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung.<br />
Im Zuge der Baumaßnahme „Regenwasserbehandlung<br />
Ost“ wurde insbesondere auch ein verschweißtes<br />
Abwassernetz aus Polyethylen (PE) verlegt. Die vielfach in<br />
der Praxis bewährten Elektroschweißformteile aus dem<br />
PLASSON-LightFit-Abwasserprogramm garantieren dabei<br />
dichte und langlebige Rohverbindungen sowie Schachtanschlüsse<br />
im Sinne eines vollverschweißten Kanalnetzes.<br />
Der Flughafen Düsseldorf ist der drittgrößte Flughafen<br />
Deutschlands und der größte in Nordrhein-Westfalen. Über<br />
20 Millionen Passagiere können mit bis zu 60 Fluggesellschaften<br />
über 180 nationale und internationale Ziele in ca.<br />
50 Ländern anfliegen. Damit stellt der Flughafen Düsseldorf<br />
für das Land Nordrhein-Westfalen das wichtigste internationale<br />
Drehkreuz dar. Die hohe Leistungsfähigkeit des Flughafen<br />
Düsseldorfs resultiert dabei aus einer perfekt funktionierenden<br />
und aufeinander abgestimmten Infrastruktur.<br />
Einen wichtigen Beitrag zur Leistungsfähigkeit übernimmt<br />
dabei insbesondere auch das vorhandene Kanalnetz mit den<br />
dazugehörigen Sonderbauwerken. Denn insbesondere bei<br />
Niederschlagsereignissen müssen die auf den versiegelten<br />
Flächen des Flughafens, wie z. B. Vorfeld, Start/Landebahn<br />
und Rollwegflächen anfallenden, teils enormen, Regenmengen<br />
schnell und zuverlässig abgeleitet werden, um den<br />
sicheren Flughafenbetrieb zu gewährleisten. Im Rahmen<br />
einer aktuellen Großbaumaßnahme erneuert und saniert<br />
die Flughafen Düsseldorf GmbH mit großem Aufwand ihre<br />
Anlagen zur Regenwasserbehandlung, um diese unter Einhaltung<br />
der EU-Wasserrahmenrichtlinie auf den neuesten<br />
Stand der Technik zu bringen. Mit dem Projekt „RKB Ost“<br />
wurde nun der Neubau eines 5400 Kubikmeter großen<br />
Rückhaltebeckens, zweier Regenklärbecken mit einer Kapazität<br />
von jeweils ca. 1500 Kubikmetern, einer Pumpstation,<br />
einem Leichtflüssigkeitsabscheider, einem Betriebsgebäude<br />
mit der Steuerungs- und Überwachungselektronik und insbesondere<br />
im Bereich der Regenbecken mehreren hundert<br />
Metern neuverlegten Abwasserkanälen aus verschweißbaren<br />
Kunststoffrohren aus Polyethylen sowie zahlreichen<br />
Betonschachtbauwerken erfolgreich umgesetzt. Einen wichtigen<br />
Beitrag leisten dabei die Elektroschweißformteile aus<br />
dem LightFit-Abwasserprogramm der PLASSON GmbH aus<br />
Wesel, mit denen sichere, wasserdichte und auf Nachhaltigkeit<br />
ausgelegte Rohrver- und Schachtanbindungen realisiert<br />
werden (Bild 1).<br />
Wasserdichtheit als Kriterium<br />
Kernstück der gewaltigen Gesamtbaumaßnahme ist der<br />
Bau der drei Regenbecken und der Pumpstation.<br />
Besonderes Augenmerk wurde jedoch auch dem Bau des<br />
damit erforderlichen Kanalsystems gewidmet, das die<br />
Regenbecken über entsprechende Schachtbauwerke mit<br />
der Pumpstation verbindet. Um sicherzustellen, dass keine<br />
Abwässer unkontrolliert in den Boden und in das Grundwasser<br />
gelangen bzw. Grundwasser nicht in die Abwasserkanäle<br />
infiltriert, entschieden sich die Verantwortlichen<br />
für den Einsatz eines vollverschweißten Abwassersystems<br />
aus Polyethylen. Dies auch vor dem Hintergrund der erforderlichen<br />
Tiefenlage der Abwasserkanäle von bis zu 9 m<br />
unterhalb der Geländeoberkante. Bei dieser Tiefenlage ist<br />
je nach Grundwasserstand und Jahreszeit ein Überstau<br />
des Rohrsystems möglich. Dementsprechend wurden alle<br />
Entleerungsleitungen der Regenbecken sowie die erforderlichen<br />
Verbindungsleitungen zwischen den Schachtbauwerken<br />
mit verschweißbaren Kunststoffrohren aus<br />
Polyethylen ausgeführt, um langfristig die Wasserdichtheit<br />
des Abwassersystems zu gewährleisten. Insgesamt wurden<br />
ca. 25 Haltungen mit Abwasserkanälen aus Polyethylen der<br />
Bild 1: Bau der neuen Regenwasserbehandlung „RKB Ost“<br />
durch die Flughafen Düsseldorf GmbH<br />
Bild 2: Rohrverbindungen und Schachtanschlüsse mit<br />
Komponenten aus dem PLASSON-LightFit-Abwasserprogramm<br />
52 10-11 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Bild 3: Werkseitig integrierter PLASSON-LightFit-<br />
Betonschachtadapter und Schachtanbindung<br />
Bild 4: Baustellenmontage der PLASSON-LightFit-<br />
Betonschachtadapter<br />
Nennweite d 560 mm verlegt und auf Basis des Heizwendelschweißverfahrens<br />
mit entsprechenden Elektroschweißmuffen<br />
verbunden. Alle Schweißarbeiten wurden dabei<br />
durch eine qualifizierte Fachfirma (WIDDIG Rohrleitungsbau<br />
GmbH, Troisdorf) durchgeführt, um die geforderte hohe<br />
Qualität der Schweißverbindungen sicherzustellen (Bild 2).<br />
Vollverschweißte Schachtanschluss-Systeme<br />
als Lösung<br />
Besonderes Augenmerk bei der Verlegung und Verarbeitung<br />
der Polyethylenrohre und -formteile galt der Anbindung der<br />
Abwasserkanäle an die Betonfertigteil- und Ortbetonschächte.<br />
Insbesondere Werkstoffübergänge bzw. Schachtanbindungen<br />
stellen in der Praxis unter dem Kriterium Dichtheit<br />
häufig die Schwachstellen eines Entwässerungssystems<br />
dar. Um eine zuverlässige, wasserdichte und langlebige<br />
Schachtanbindung sicherzustellen, fiel die Entscheidung auf<br />
ein vollverschweißtes Schachtanschluss-System.<br />
Mit dem Einsatz des LightFit-Betonschachtadapters steht für<br />
diesen Anwendungsfall ein von der Prüfstelle IKT (Gelsenkirchen)<br />
geprüftes Bauteil zur Verfügung, um Abwasserkanäle<br />
aus Polyethylen dauerhaft dicht und wurzelfest mit dem<br />
Betonschacht zu verbinden und dabei gleichzeitig auch<br />
der Forderung nach Gelenkigkeit des Schachtanschlusses<br />
zuverlässig nachzukommen. Durch die spezielle Konstruktion<br />
des LightFit-Betonschachtadapters in Kombination mit<br />
dem Werkstoff Polyethylen gewährleistet das Schachtanschluss-System<br />
eine nachgewiesene und geprüfte Abwinkelbarkeit<br />
von bis zu 62 mm/m bzw. 3,6° bei gleichzeitiger<br />
Außenwasserdichtheit. Das LightFit-Schachtanschluss-<br />
System besteht dabei aus einem Betonschachtadapter und<br />
einer dazugehörigen Elektroschweißmuffe. Der Einbau des<br />
Betonschachtadapters findet in der Regel bereits im Betonwerk<br />
statt, wo er fachgerecht in die Betonfertigteilschächte<br />
integriert wird. Auf der Baustelle wird schließlich der<br />
Schachtadapter mit der mitgelieferten Elektroschweißmuffe<br />
und dem Polyethylen-Rohr homogen verschweißt. Im Rahmen<br />
der Baumaßnahme auf dem Flughafen Düsseldorf<br />
wurden Betonfertigteilschachtkörper mit den integrierten<br />
LightFit-Betonschachtadaptern mit einem Gewicht von bis<br />
zu 28 t im Betonwerk gefertigt und zur Baustelle geliefert<br />
(Bild 3).<br />
Demgegenüber war es insbesondere bei den in Ortbetonbauweise<br />
errichteten Schachtbauwerken erforderlich,<br />
den Betonschachtadapter auf der Baustelle passgenau<br />
mit der Bewehrung zu verankern und einzuschalen. Dies<br />
nahm vergleichsweise mehr Zeit für die Verarbeitung in<br />
Anspruch und erforderte eine manuell hergestellte Schalung<br />
des Schachtadapters. Die Qualität des Einbaus konnte sich<br />
sehen lassen: Alle LightFit-Betonschachtadapter wurden<br />
fachgerecht und sicher in die Ortbetonschächte eingebunden<br />
(Bild 4).<br />
Im Zuge der Gesamtbaumaßnahme wurden ca. 500 m<br />
Kanalrohrsystem aus Polyethylen verlegt, 52 LightFit-<br />
Schachtanschluss-Systeme in Schachtbauwerken integriert<br />
sowie 75 PLASSON-Elektroschweißmuffen der Nennweite<br />
d 560 mm mit PE-Rohren verschweißt. Mit dem Bau der<br />
Regenwasserbehandlung „RKB Ost“ wird nun der neueste<br />
Stand der Technik erfüllt und die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie<br />
umgesetzt. Damit startet die Flughafen<br />
Düsseldorf GmbH sicher in die Zukunft. Einen wichtigen<br />
Beitrag zum Umweltschutz und zum nachhaltigen Einsatz<br />
von Werkstoffen leistet dabei auch das vollverschweißte<br />
Kanalsystem auf Polyethylen. In Kombination mit den<br />
Elektroschweißformteilen aus dem PLASSON-LightFit-Abwasserprogramm<br />
werden so dauerhaft dichte und langlebige<br />
Verbindungen geschaffen.<br />
KONTAKT:<br />
PLASSON GmbH, Wesel<br />
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Markus Engelberg<br />
Tel. +49 (0) 281 95272-46<br />
m.engelberg@plasson.de<br />
www.plasson.de<br />
10-11 | 2014 53
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Wirtschaftliche Alternative für die Regenwasserbehandlung<br />
von Straßenabflüssen<br />
Grundsätzlich gilt: Vor der Einleitung in ein Gewässer müssen<br />
verschmutzte Oberflächenwässer behandelt werden.<br />
Als besonders belastet gelten Straßenabflüsse von stark<br />
befahrenen Straßen. In Nordrhein-Westfalen regelt der<br />
sogenannte „Trennerlass“ den Umgang mit Straßenabflüssen.<br />
Diesen Erlass galt es auch bei der Fahrbahnsanierung<br />
der Ostenallee in Hamm zu berücksichtigen. Der bereits<br />
Mitte des 18. Jahrhunderts als vierreihige Allee angelegte<br />
Verkehrsweg zählt zu den Hauptverkehrsadern der Stadt<br />
Hamm und fungiert als direkte Verbindung zwischen dem<br />
in den 20er Jahren rund um den Kurpark entstandenen<br />
Stadtteil und dem Zentrum. Die vierspurige Straße ist stark<br />
befahren und dementsprechend hoch ist die Belastung des<br />
Regenwassers in diesem Bereich. Sanierungsbedürftig war<br />
nicht nur die Fahrbahndecke der Ostenallee, sondern auch<br />
die Straßenabläufe im westlichen Teil der Ostenallee. Sie<br />
entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.<br />
Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, musste über eine<br />
Lösung zur Regenwasserbehandlung nachgedacht werden.<br />
Nach eingehender Prüfung der Optionen erhielt schließlich<br />
das INNOLET ® -System von der Funke Kunststoffe GmbH<br />
den Zuschlag. Ausschlaggebend für die Entscheidung der<br />
Stadt Hamm zugunsten des Produktes war vor allem die<br />
hohe Wirtschaftlichkeit: Im Vergleich mit zentralen und<br />
dezentralen Behandlungsverfahren schnitt INNOLET ® als<br />
die wirtschaftlichste Lösung ab.<br />
Stadt prüfte mehrere Varianten<br />
22 Straßeneinläufe im westlichen Teil der Ostenallee<br />
waren an einen Regenwasserkanal angeschlossen, der<br />
die Niederschläge in die als Vorfluter genutzte Ahse einleitete.<br />
Die Erlaubnis, das Straßenwasser auch künftig in<br />
die Ahse einzuleiten, setzte jedoch eine entsprechende<br />
Behandlung voraus. „Unter den gängigen technischen<br />
Lösungen, die wir geprüft haben, waren sowohl zentrale<br />
als auch dezentrale Lösungen“, erläutert Dipl.-Ing.<br />
Daniela Asch, ABK-Gewässerschutzbeauftragte der Stadt<br />
Hamm. „Grundsätzlich in Frage gekommen wäre sowohl<br />
der Bau eines Regenklärbeckens als auch die Errichtung<br />
einer Pumpstation für den Anschluss des Abwasserkanals<br />
an die Mischwasserkanalisation“, so Asch. Mit Blick auf die<br />
zu erwartenden Bau- und Betriebskosten wurden allerdings<br />
auch dezentrale Lösungen verschiedener Anbieter in die<br />
Betrachtung einbezogen. „Lange Zeit war der Vergleich<br />
der in Frage kommenden dezentralen Systeme mit zentralen<br />
Behandlungsverfahren ziemlich aufwändig“, sagt<br />
Asch, „denn jeder Einzelfall musste im wasserrechtlichen<br />
Verfahren geprüft werden.“ Im Jahr 2012 ließ das Ministerium<br />
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und<br />
Verbraucherschutz NRW von den Kölner Stadtentwässerungsbetrieben<br />
sechs dezentrale Systeme prüfen und<br />
erkannte diese in der Folge als mit zentralen Systemen<br />
vergleichbar an.<br />
Foto: Funke Kunststoffe GmbH<br />
Bild 1: Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wurden die Straßeneinläufe in der Ostenallee mit dem INNOLET ® -System ausgestattet<br />
54 10-11 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Sieger im Kostenvergleich<br />
Mehrere dezentrale Systeme, die von der Stadt Hamm beurteilt<br />
worden sind, hätten sich nur mittels umfangreicher<br />
Baumaßnahmen in das vorhandene Entwässerungssystem<br />
integrieren lassen. Für die Beurteilung der verbliebenen<br />
Kandidaten stellte Asch eine Kostenvergleichsberechnung<br />
für eine Situation mit einer vergleichbaren Anzahl von Straßeneinläufen<br />
und ähnlichen angeschlossenen Flächen an.<br />
Das Ergebnis: Mit Blick auf Investitions- und Betriebskosten<br />
blieben nur wenige potenzielle Lösungen übrig; so<br />
bekam das INNOLET ® -System den Zuschlag. Die Einläufe<br />
im fraglichen Abschnitt der Ostenallee befinden sich nicht<br />
direkt im Fahrbahnbereich, sondern im Parkstreifen; daher<br />
war der Einsatz des neuen Systems für den Straßenverkehr<br />
vergleichsweise unproblematisch. „Trotzdem spielte<br />
für uns die Frage nach der Unterhaltungshäufigkeit eine<br />
wichtige Rolle, denn natürlich möchten wir die Eingriffe in<br />
den Verkehrsraum auch langfristig so gering wie möglich<br />
halten“, sagt Asch, die für den Vergleich der verschiedenen<br />
Systeme einen Betriebszeitraum von 20 Jahren zugrunde<br />
gelegt hatte.<br />
Bild 2: Der INNOLET ® -Straßenablauffilter lässt sich problemlos<br />
in bestehende Straßenabläufe nach DIN 4052 einsetzen.<br />
Besonderheit in Hamm: Zum Einsatz kam auch die Adapterplatte<br />
Quadrat als verbreiterte Auflage für tiefer liegende Eimerauflagen<br />
Foto: Funke Kunststoffe GmbH<br />
Problemloser Einbau und Betrieb<br />
„INNOLET ® reinigt Niederschlagsabflüsse mit einem Grobfilter<br />
und einer substratgefüllten Filterpatrone direkt vor<br />
Ort und noch vor der Einleitung in den Regenwasserkanal“,<br />
erläutert Funke-Fachberater Dipl.-Ing. Frank Recknagel<br />
das Funktionsprinzip. Durch die Kombination von<br />
Oberflächen- und Volumenfiltration mit Adsorption erzielt<br />
das System einen hohen Rückhalt von Schwermetallen<br />
(60-80 %), PAK (50 %) und AFS (50-80 %). Der aus<br />
einem Einsatz, einem Grobfilter und einer mit speziellem<br />
Substrat gefüllten Filterpatrone bestehende Nachrüstsatz<br />
lässt sich problemlos in bestehende Straßenabläufe nach<br />
DIN 4052 integrieren.<br />
Mit Bezug auf die Wartung gibt sich das System anspruchslos:<br />
„Wir empfehlen, das Substrat einmal im Jahr zu wechseln;<br />
das Abfallsubstrat kann dann ganz einfach als Straßenkehricht<br />
Zuordnungswert Z2 entsorgt werden“, rät<br />
Fachberater Recknagel.<br />
Erstes System mit Gütesiegel<br />
Dank der günstigen Prognose schlug die Stadt der Unteren<br />
Wasserbehörde das System Innolet vor. Die Behörde genehmigte<br />
und die Auftragserteilung an das mit der Bauausführung<br />
beauftragte Unternehmen erfolgte kurze Zeit später.<br />
Funke-Fachberater Recknagel ist sich sicher, dass die Stadt<br />
Hamm mit INNOLET ® von Funke eine gute Wahl getroffen<br />
hat: „Nicht nur die hohe Wirtschaftlichkeit des Systems<br />
spricht für sich – zwischenzeitlich hat das System deutschlandweit<br />
als erstes Produkt für die dezentrale Behandlung<br />
von Niederschlagswasser das vom IKT verliehene Gütesiegel<br />
‚IKT-geprüft gemäß Trennerlass’ erhalten“.<br />
KONTAKT:<br />
Funke Kunststoffe GmbH, Hamm-Uentrop<br />
Tel.: +49 2388/3071-0<br />
info@funkegruppe.de<br />
www.funkegruppe.de<br />
10-11 | 2014 55
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
CoJack erreicht Halbzeit bei Europas größtem<br />
Abwasserkanal<br />
Beim Bau von Europas größtem Abwasserprojekt war in<br />
diesem Sommer Halbzeit für CoJack, dem Online-Berechnungs-<br />
und Überwachungssystem für Rohrvortriebe der<br />
S & P Consult GmbH, Bochum.<br />
Auf über 80 km Länge wird mitten im größten Ballungsraum<br />
Europas ein Fluss zurückkehren, der 100 Jahre lang<br />
nur noch als offener Abwasserlauf existiert hat. Damit sich<br />
die Emscher wieder mit sauberem Wasser quer durchs<br />
Ruhrgebiet schlängeln kann, wird ein großer Sammelkanal<br />
in ca. 8 bis 40 m Tiefe realisiert. Alle Nebenflüsse, die heute<br />
noch als offene Abwasserkanäle durch die Emscherregion<br />
verlaufen, werden ebenfalls in Rohrleitungen verlegt und<br />
münden in den Hauptkanal, der das Abwasser zu den<br />
großen Kläranlagen führt. Die als Abwasserkanal Emscher<br />
(AKE) bezeichnete Rohrleitung beginnt in Dortmund unmittelbar<br />
unterhalb der Kläranlage Dortmund-Deusen und<br />
endet nach 51 km Streckenlänge am Klärwerk im Bereich<br />
der Emschermündung in Dinslaken.<br />
Dieses Bauprojekt ist eine planerische und technische<br />
Herausforderung und bedarf einer intensiven Qualitätskontrolle.<br />
Deshalb hat S & P Consult vom Bauherrn,<br />
der Emschgenossenschaft, den Auftrag für die Online-<br />
Überwachung und Qualitätssicherung für den gesamten<br />
Bauabschnitt 30 erhalten, der über eine Gesamtlänge<br />
von ca. 37 km vollständig im Rohrvortriebsverfahren<br />
hergestellt wird. Die 57 Vortriebsstrecken haben Nennweiten<br />
von DN 1600 bis DN 2800 und Vortriebslängen<br />
von 250 m bis 1150 m.<br />
Die mit CoJack realisierte Überwachung und Qualitätssicherung<br />
aller Vortriebstrecken beinhaltet:<br />
»»<br />
In Diagrammen grafisch aufbereitete Darstellung der<br />
Kräfte an den Pressstationen und der Abwinklungen<br />
zwischen den Rohren (Kurven) in Echtzeit für berechtigte<br />
Nutzer im Internet<br />
»»<br />
Statistik der Vortriebsleistung<br />
»»<br />
Kontinuierliche Kontrolle der statischen Beanspruchung<br />
aller Rohre infolge der Vortriebskräfte zu jedem beliebigen<br />
Zeitpunkt des Vortriebes<br />
»»<br />
kurzfristige Warnung aller Beteiligten bei der Gefahr<br />
von Überbeanspruchungen der Rohre<br />
»»<br />
Dokumentation der Rohrbeanspruchungen nach<br />
Abschluss des Vortriebs für jede Strecke in einem<br />
Endbericht<br />
Foto: S & P Consult GmbH<br />
Bei Bedarf ermöglicht CoJack darüber<br />
hinaus:<br />
»»<br />
Die sichere Fortsetzung des Vortriebes<br />
nach starken Steuerbewegungen<br />
und nach Überschreitungen<br />
der Vortriebskraft ohne<br />
Stillstand<br />
»»<br />
Die sichere Nutzung erhöhter<br />
Vortriebskräfte<br />
Die für CoJack erforderliche Messtechnik<br />
wird von der ILM Tunneltechnik<br />
GmbH, Stolberg geliefert<br />
und installiert. Aktuell sind 26 km<br />
Vortriebsstrecke von CoJack erfolgreich<br />
begleitet worden, 33 Vortriebstrecken<br />
haben bereits ihren<br />
Zielschacht erreicht. Im Jahre 2016<br />
soll die letzte Strecke aufgefahren<br />
und das Bauvorhaben abgeschlossen<br />
sein.<br />
KONTAKT:<br />
S & P Consult GmbH, Bochum<br />
56 10-11 | 2014
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
PE für schnelle und sichere Sanierung<br />
Die Stadt Heringen in Hessen, direkt an der Landesgrenze<br />
zu Thüringen gelegen, macht bereits seit über 30 Jahren<br />
positive Erfahrungen mit dem Rohrwerkstoff Polyethylen<br />
in der <strong>Abwasserentsorgung</strong>. Daher hat das Stadtparlament<br />
schon vor einigen Jahren entschieden, dass alle neuen Kanäle<br />
ausnahmslos in PE zu bauen sind.<br />
„In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über den gesamten<br />
Abschreibungszeitraum schneiden PE-Rohre am besten ab“,<br />
erklärt Bürgermeister Hans Ries. „Außerdem sind Schäden aus<br />
Wurzeleinwuchs und Undichtigkeiten im Steckmuffenbereich<br />
oder Scherbenbildung bei verschweißten PE-Rohrsystemen<br />
ausgeschlossen. Wir sind uns der Bedeutung eines dauerhaft<br />
dichten Kanalsystems – und auch dessen Wert – sowohl ökologisch<br />
als auch materiell bewusst“.<br />
Derzeit werden mehrere Stadtteile und Stadtviertel in einem<br />
Vollausbau saniert. Es war vorgesehen, das Pilotprojekt in<br />
der Peterstraße (OD 355) Projekt mit egefuse ® durchzuführen.<br />
Zunächst wurde das System dem Ingenieurbüro Bechtel<br />
vorgestellt und nach Rücksprache mit den Verantwortlichen<br />
der Stadt Heringen technisch freigegeben. Getreu dem Motto<br />
„stecken – schweißen – dicht“ wurde das egefuse ® -System<br />
von Vorarbeiter Uwe Trost und seinem Team eingebaut und<br />
bewertet. Nach den positiven Erfahrungen in der Peterstraße<br />
wurde beschlossen, einen zweiten Bauabschnitt in der Gartenstraße<br />
(OD 450) mit gleichem System zu sanieren. Auch hier<br />
konnte das System die Mannschaft von Thorsten Werner von<br />
der Praxistauglichkeit und Vorteilen in der Verlegegeschwindigkeit<br />
überzeugen.<br />
Mit dem egefuse ® -Rohrsystem werden Freigefälleleitungen<br />
und Verbindungstechnik gleichzeitig in einem Bauteil zur Baustelle<br />
geliefert, da Spitzende und das schweißbare Muffenende<br />
bereits integriert sind. Dadurch spart das Bauunternehmen die<br />
Zeit für die Schweißvorbereitungen, auch ist die Muffenverbindung<br />
nicht auftragend. Die Funktionsweise ist denkbar einfach:<br />
Projektdaten: Pilotbaustelle I.<br />
Bauabschnitt Peter straße,<br />
Heringen<br />
Verlegung:<br />
die Rohrenden im Graben ausrichten, die Verbindungsstellen<br />
reinigen, zusammenstecken ohne vorherige Bearbeitung der<br />
Rohroberfläche und mit handelsüblichen Geräten schweißen.<br />
Durch die helle, inspektionsfreundliche Innenschicht lässt sich<br />
das System einfach mit der Kamera befahren, um den Zustand<br />
zu bewerten.<br />
Aufgrund der positiven Erfahrungen als wirtschaftliche und<br />
technisch gute Lösung wurde auch im zweiten Bauabschnitt<br />
mit dem gleichen System eine neue Freispiegelleitung verlegt.<br />
Auch hier konnte das System aufgrund der hohen Verlegegeschwindigkeit<br />
überzeugen.<br />
KONTAKT:<br />
egeplast international GmbH<br />
Björn Miehe<br />
Tel: +49.2575.9710-240<br />
Bjoern.Miehe@egeplast.de<br />
Pilotbaustelle II.<br />
Bauabschnitt Gartenstraße,<br />
Heringen<br />
Verlegung von Polyethylenrohren mit integrierter<br />
Schweißtechnik<br />
Offene Verlegung im Sandbett<br />
Rohrsystem: egeplast egefuse ®<br />
Dimension OD 355 mm,<br />
SDR 17,6<br />
Längen: ca. 296 m in<br />
Baulängen à 6,40 m<br />
Projektbeschreibung:<br />
Projektbeteiligte:<br />
egeplast egefuse ®<br />
Dimension OD 450 mm &<br />
OD 355 mm, SDR 17,6<br />
Längen: ca. 227 m & 264 m<br />
in Baulängen à 6,40 m<br />
Auftraggeber: Stadt Heringen<br />
Bauunternehmer: Giebel Bau GmbH & Co. KG<br />
Planer: Bechtel GbR Ingenieurbüro<br />
Bild 1: Neuverlegung von Abwasser leitungen<br />
Bild 2: Die Schweißung erfolgt mit handelsüblichen Schweißautomaten<br />
10-11 | 2014 57
SERVICES BUCHBESPRECHUNG<br />
Regelungs- und Steuerungstechnik in der Versorgungstechnik<br />
Hrsg.: Arbeitskreis der Professoren für Regelungstechnik in der Versorgungstechnik, 2014, VDE-Verlag, 7. überarbeitete<br />
Auflage, 509 Seiten, A5, gebunden, Preis € 69,00, ISBN 978-3-800-73582-2 bestellbar unter www.vulkan-verlag.de<br />
Vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit und<br />
Minimierung der Betriebskosten hat die Regelungstechnik<br />
eine wichtige Bedeutung. Eine der<br />
Aufgaben in der Versorgungstechnik ist heute,<br />
Energieeinsparung und Komfortbedürfnisse<br />
optimal aufeinander abzustimmen, um so den<br />
bestmöglichen Betriebsablauf bei geringstem<br />
Energieverbrauch zu gewährleisten.<br />
Fundiertes Wissen um anlagen- und regelungstechnische<br />
Zusammenhänge ist unabdingbar für<br />
den Entwurf, die Inbetriebnahme und den Betrieb<br />
versorgungstechnischer Anlagen – auch wenn<br />
in den vergangenen Jahren das Bild der Branche<br />
„Gebäudeautomation“ durch die Diskussion über<br />
Datenübertragungsprotokolle geprägt wurde. Die<br />
inzwischen 7. Auflage des Lehrbuchs, das 1983<br />
zum ersten Mal erschienen ist, wurde in allen Kapiteln<br />
aktualisiert, überarbeitet und fehlerbereinigt.<br />
Qualitätssicherung und Dokumentation im Schweißbetrieb.<br />
Richtige Anwendung von EN ISO 3834 & Co<br />
Autor: Jürgen Bialek, 2014, WEKA Media Verlag, 148 Seiten, A5, Broschur, Preis € 95,23,<br />
ISBN 978-3-811-16885-5, bestellbar unter www.vulkan-verlag.de<br />
Hier erhält man eine kompakte Informationssammlung<br />
zur Sicherstellung qualitativer Anforderungen<br />
beim Schweißen und bei verwandten<br />
Verfahren sowie ergänzenden Prozessen.<br />
Sämtliche Inhalte wurden von einem anerkannten<br />
Experten mit großer Praxiserfahrung bei der<br />
DIN EN 1090 verfasst. Das Fachbuch hilft dem Leser<br />
dabei, effizient und praxisnah die Qualitätsprozesse<br />
im Schweißbetrieb sicherzustellen.<br />
55 Gründe, Ingenieur zu werden<br />
Autor: Ekkehard D. Schulz, 2010, Murmann Verlag, 253 Seiten, Klappenbroschur, Preis € 16,00,<br />
ISBN 978-3-86774-105-7, bestellbar unter www.vulkan-verlag.de<br />
Ohne Ingenieure wäre Deutschland nicht die Exportnation.<br />
Viele Entwicklungen wären ohne<br />
Leidenschaft für Technik nicht denkbar gewesen<br />
- Buchdruck, Autos und Computer sind das<br />
Resultat von Ingenieurskunst. In Deutschland erfährt<br />
der Ingenieurberuf aber oft nicht die größte<br />
Anerkennung. So betraf die Ingenieurslücke<br />
2010 schon knapp 50.000 Stellen. Das entspricht<br />
einem gesamten Absolventenjahrgang.<br />
Der erfahrene Unternehmenslenker Ekkehard<br />
D. Schulz und langjährige Vorstand der Thyssen<br />
Krupp AG hat sich ein Herz gefasst und ein Buch<br />
geschrieben, warum es erstens wichtig ist, Ingenieur<br />
zu werden, und zweitens - das ist noch<br />
viel wichtiger - warum der Ingenieursberuf der<br />
schönste Beruf der Welt ist. Die 55 wichtigsten<br />
Gründe dafür hat er aufgeschrieben – unterhaltsam,<br />
manchmal provokativ, immer lehrreich.<br />
Denn der einzige Rohstoff hierzulande sind unsere<br />
Ideen. Im Wort „Ingenieur“ steckt übrigens<br />
das Wort „Genie“. Davon brauchen wir in Zukunft<br />
noch viel mehr.<br />
58 10-11 | 2014
www.vulkan-verlag.de<br />
Praxis der Rohrleitungsund<br />
Apparatetechnik<br />
Jetzt vorbestellen!<br />
Grundlagen der Rohrleitungsund<br />
Apparatetechnik<br />
Das Buch ist eine knappe und anschauliche Einführung in das gesamte Themengebiet<br />
der Rohrleitungs- und Apparatetechnik für Studierende und Ingenieure<br />
verschiedenster technischer Fachrichtungen. Mit einer Fülle von wissenschaftlich<br />
fundierten Informationen, Beispielberechnungen, Verweisen auf weiterführende<br />
Literatur und die aktuelle Normung dient es gleichzeitig als komprimierte<br />
Einführung wie als übersichtliches Handbuch in der Praxis.<br />
Behandelt werden Funktionen, Werkstoffe und Elemente von Rohrleitungen und<br />
Apparaten sowie die wichtigsten Berechnungen. Die nun vorliegende 4. Auflage<br />
wurde um das Kapitel „Pumpen und Verdichter“ erweitert.<br />
Autor: Rolf Herz<br />
4. Auflage 2014, ca. 364 Seiten schwarz-weiß,<br />
Hardcover, DIN A5<br />
ISBN: 978-3-8027-2782-5<br />
Preis: € 64,80<br />
Erscheinungstermin: September 2014<br />
Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Bestellung per Fax: +49 (0) 201 Deutscher / 82002-34 Industrieverlag GmbH oder | abtrennen Arnulfstr. 124 und | 80636 im Fensterumschlag München einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex.<br />
Grundlagen der Rohrleitungs- und Apparatetechnik<br />
4. Auflage 2014 – ISBN: 978-3-8027-2782-5<br />
für € 64,80 (zzgl. Versand)<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Telefax<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Friedrich-Ebert-Str. 55, 45127 Essen.<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PAGRAT2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFEND<br />
Grundlagenschulungen<br />
Fachaufsicht (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
12.-16.01.2015 Celle<br />
12.-21.01.2015 Celle<br />
Bauleiter (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
12.-23.01.2015 Celle<br />
12.-30.01.2015 Celle<br />
Geräteführer (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
19.01.-03.02.2015 Celle<br />
19.01.-11.02.2015 Celle<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt W<br />
324 – Grundkurs<br />
20./21.11.2014 Gera<br />
27./28.11.2014 Rostock<br />
18./19.12.2014 Gera<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt W<br />
324 – Nachschulung<br />
26.11.2014 Rostock<br />
05.12.2014 Gera<br />
Stecken, Pressen und Klemmen von<br />
Kunststoffrohren<br />
19./20.11.2014 Koblenz<br />
Baustellenabsicherung und<br />
Verkehrssicherung – RSA/ZTV-SA – 1 Tag<br />
25.11.2014 Hamburg<br />
18.12.2014 Halle<br />
Baustellenabsicherung und<br />
Verkehrssicherung – RSA/ZTV-SA – 2 Tage<br />
10./11.11.2014 Hannover<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren –<br />
Weiterbildungsveranstaltung nach GW 329<br />
09.12.2014 Kassel<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen<br />
20.11.2014 Hannover<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Steuerbare horizontale Spülbohr verfahren –<br />
Weiterbildungs veranstaltung nach GW 329<br />
09.12.2014 Kassel<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen<br />
20.11.2014 Hannover<br />
GAS/WASSER<br />
Grundlagenschulungen<br />
Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von<br />
Versorgungsleitungen – Schulung nach GW<br />
129/S129 – 5 Jahre Gültigkeit<br />
14.11.2014 Essen<br />
18.11.2014 Berlin<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
24.-28.11.2014 Würzburg<br />
24.-28.11.2014 Leipzig<br />
08.-12.12.2014 Aachen<br />
08.-12.12.2014 Hannover<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
17.-19.11.2014 Gera<br />
18.-20.11.2014 Rostock<br />
01.-03.12.2014 Leipzig<br />
03.-05.12.2014 Rostock<br />
Kunststoffrohrleger Schwerpunkt PVC<br />
01.-03.12.2014 Gera<br />
Fachkraft für die Instandsetzung<br />
von Trinkwasserbehältern – DVGW-<br />
Arbeitsblätter W 316-2<br />
20.-24.04.2015 Frankfurt/Main<br />
05.-09.10.2015 Frankfurt/Main<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Aufbaulehrgänge Leitungsbau<br />
06.01.2015 Bad Zwischenahn<br />
07.01.2015 Rendsburg<br />
08.01.2015 Rostock<br />
13.01.2015 Magdeburg<br />
14.01.2015 Salzgitter<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und <strong>Wasserversorgung</strong><br />
– Verlängerung zur GW 331<br />
18.11.2014 Gladbeck<br />
16.12.2014 Fürth<br />
Bau von Gas- und Wasserrohrleitungen<br />
28./29.10.2014 Paderborn<br />
Sachkundiger Gas bis 5 bar<br />
25.11.2014 Münster<br />
Sachkundiger Wasser - Wasserverteilung<br />
26.11.2014 Münster<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500 Kap.<br />
2.31<br />
11.11.2014 Bad Zwischenahn<br />
02.12.2014 Gütersloh<br />
17.12.2014 Nürnberg<br />
Bau von Wasserohrleitungen<br />
25./26.11.2014 Herzogenaurach<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
12./13.11.2014 Bad Zwischenahn<br />
Bau von Gasrohrnetzen über 16 bar<br />
09./10.12.2014 Köln<br />
Grabenlose Bauweisen – anerkannte<br />
Fortbildung nach GW 302-R2/GW 320-1<br />
12.11.2014 Berlin<br />
Reinigung und Desinfektion von<br />
Wasserverteilungsanlagen<br />
18.11.2014 Frankfurt/Main<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301<br />
– Qualitätsanford erungen für<br />
Rohrleitungsbauunternehmen<br />
03.12.2014 Köln<br />
Sachkundiger Gas bis 5 bar<br />
25.11.2014 Münster<br />
Sachkundiger Gas bis 5 bar<br />
25.11.2014 Münster<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter im<br />
Rohrleitungsbau – Gas/Wasser<br />
24.-28.11.2014 Gera<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
03.12.2014 Wedemark<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BRG 500, Kap.<br />
2.31 – Fachaufsicht<br />
08.-12.12.2014 Gera<br />
19.-23.01.2015 Gera<br />
09.-13.02.2015 Gera<br />
Beurteilung von<br />
Kunststoffschweißverbindungen<br />
04.12.2014 Frankfurt/Main<br />
60 10-11 | 2014
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
11.12.2014 Bad Zwischenahn<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331 inkl. DVS-<br />
Abschluss 2212-1<br />
27./28.11.2014 Dortmund<br />
18./19.12.2014 Dortmund<br />
Geprüfter Netzmeister Fernwärme –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
02.-20.03.2015 Kerpen, Dresden<br />
Zusatzqualifikation Fernwärme<br />
02.-20.03.2015 Kerpen, Dresden<br />
Muffenmonteur im Fernwärmeleitungsbau,<br />
geprüft nach AGFW FW 603 - Grundkurs<br />
01.-05.12.2014 Hamburg<br />
Bau und Sanierung von Nah- und<br />
Fernwärmeleitungen<br />
24./25.11.2014 Würzburg<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
02.12.2014 Kerpen<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter Fernwärme<br />
10.-14.11.2014 Kerpen<br />
Qualifikationen im Fernwärmeleitungsbau<br />
18.11.2014 Hannover<br />
Planung und Bau von Fernwärmeversorgung<br />
mit Dampf<br />
21.11.2014 Hannover<br />
Schweißen und Prüfen von<br />
Fernwärmeleitungen – FW 446<br />
19.11.2014 Hannover<br />
Stahlmantelrohre im Fernleitungsbau<br />
20.11.2014 Hannover<br />
Praxisseminare<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
11.12.2014 Bad Zwischenahn<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331 inkl. DVS-<br />
Abschluss 2212-1<br />
27./28.11.2014 Dortmund<br />
Druckprüfung von Gasrohrleitungen<br />
02.12.2014 Hannover<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
03.12.2014 Hannover<br />
FERNWÄRME<br />
Grundlagenschulungen<br />
Geprüfter Netzmeister Fernwärme –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
02.02.-20.03.2015 Kerpen, Dresden<br />
Zusatzqualifikation Fernwärme<br />
02.02.-20.03.2015 Kerpen, Dresden<br />
Muffenmonteur im Fernwärmeleitungsbau,<br />
geprüft nach AGFW FW 603 – Grundkurs<br />
01.-05.12.2014 Hamburg<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
02.12.2014 Kerpen<br />
Qualifikationen im Fernwärmeleitungsbau<br />
18.11.2014 Hannover<br />
Planung und Bau von Fernwärmeversorgung<br />
mit Dampf<br />
21.11.2014 Hannover<br />
Schweißen und Prüfen von<br />
Fernwärmeleitungen – FW 446<br />
19.11.2014 Hannover<br />
Stahlmantelrohre im Fernwärmeleitungsbau<br />
20.11.2014 Hannover<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Bau und Sanierung von Nah- und<br />
Fernwärmeleitungen<br />
24./25.11.2014 Würzburg<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
02.12.2014 Kerpen<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter Fernwärme<br />
10.-14.11.2014 Kerpen<br />
Qualifikationen im Fernwärmeleitungsbau<br />
18.11.2014 Hannover<br />
Planung und Bau von Fernwärmeversorgung<br />
mit Dampf<br />
21.11.2014 Hannover<br />
Schweißen und Prüfen von<br />
Fernwärmeleitungen – FW 446<br />
19.11.2014 Hannover<br />
Stahlmantelrohre im Fernwärmeleitungsbau<br />
20.11.2014 Hannover<br />
ABWASSER<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Explosionsschutz in abwassertechnischen<br />
Anlagen<br />
18.11.2014 Bad Wildungen<br />
INDUSTRIEROHRLEITUNGSBAU<br />
Grundlagenschulungen<br />
Kunststoffschweißer nach DVS 2281 mit<br />
Prüfung nach DVS 2212-1<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Wiederholungsprüfungen nach DVS 2212-1<br />
(Prüfgruppe I)<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Kunststoffschweißer nach DVS 2282 mit<br />
Prüfung nach DVS 2212-1 (Prüfgruppe II)<br />
ganzjährig<br />
bundesweit<br />
Wiederholungsprüfungen nach DVS 2212-1<br />
(Prüfgruppe II)<br />
ganzjährig<br />
DVGW<br />
bundesweit<br />
Seminare<br />
Berechnung und Optimierung von<br />
Gasverteilungsnetzen<br />
25.-27.11.2014 Dortmund<br />
Planung und Berechnung von Gas-<br />
Druckregel- und Messanlagen<br />
26./27.11.2014 Göttingen<br />
Wassertransport und Wasserverteilung<br />
26.-28.11.2014 Kassel<br />
10-11 | 2014 61
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
GWI Essen<br />
Seminare<br />
Weiterbildung der Sachkundigen gemäß<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 685<br />
11./12.12.2014 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gas-Druckregel- und<br />
-Messanlagen im Netzbetrieb und in der<br />
Industrie<br />
08.-10.12.2014 Essen<br />
Praxis der Gastechnik für Nichttechniker und<br />
spartenfremde Mitarbeiter<br />
09./10.12.2014 Essen<br />
Sachkundige für Odorieranlagen – DVGW<br />
G 280<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Sicherheitstraining bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen –<br />
BALSibau - GW 129<br />
14.11.2014 Essen<br />
12.12.2014 Essen<br />
Einführung in die Gasabrechnung<br />
10.12.2014 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gasabrechnung<br />
gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685<br />
19./21.11.2014 Essen<br />
Grundlagen, Praxis und Fachkunde von Gas-<br />
Druckregelanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 491, G 495 und G 459-2<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Projektierung, Prüfung, Dokumentationen<br />
und Abnahmen von Gas-Druckregelanlagen<br />
bis 5 bar für Sachkundige und<br />
Anlagenplaner<br />
24./25.11.2014 Essen<br />
Sachkundigenschulung - Druckbehälter<br />
und Durchleitungsdruckbehälter einschl.<br />
Erdgas-Vorwärmanlagen nach DVGW-<br />
Arbeitsblättern 498 und G 499<br />
25./26.11.2014 Essen<br />
Arbeiten an Gasleitungen bei<br />
unkontrollierter Gasausströmung - Schulung<br />
nach BGR 500 (BGV A1/BGI 560)<br />
09.12.2014 Essen<br />
Druckbehälter und Durchleitungsdruckbehälter<br />
Praxis-Vertiefungsseminar/<br />
Weiterbildung der Sachkundigen nach G 498<br />
15./16.12.2014 Essen<br />
HDT<br />
Seminare<br />
Planung und Auslegung von Rohrleitungen<br />
02./03.12.2014 Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
05./06.11.2014 Karlstein<br />
01./02.12.2014 Essen<br />
Verfahren zur Montage und Demontage von<br />
Dichtverbindungen an Rohrleitungen und<br />
Apparaten<br />
25.11.2014 Berlin<br />
Dichtungen - Schrauben - Flansche<br />
26.11.2014 Berlin<br />
Instandhaltung von Rohrleitungen<br />
10./11.11.2014 Essen<br />
Kraftwerkstechnik- Basiswissen und<br />
Komponenten<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Arbeitsschutz im Rohrleitungsbau<br />
13.11.2014 Essen<br />
Arbeitsschutz im Rohrleitungsbau<br />
13.11.2014 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
18./19.11.2014 Essen<br />
Forum Molchtechnik<br />
27./28.11.2014 Essen<br />
Kontaktadressen<br />
brbv - Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
Kurt Rhode, Tel. 0221/37668-44, Fax 0221/37668-62,<br />
E-Mail: rhode@brbv.de, www.brbv.de<br />
SAG-Akademie<br />
Anja Kratt, Tel. 06151/10155-111, Fax 06151/10155-155,<br />
Kratt@SAG-Akademie.de, www.SAG-Akademie.de<br />
DVGW<br />
Silke Splittgerber, Tel. 0228/9188-607, Fax 0228/9188-92-607,<br />
splittgerber@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
TAH - Technische Akademie Hannover<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30, Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
GWI - Gas- und Wärmeinstitut Essen e.V.,<br />
Barbara Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146, E-Mail: hohnhorst@gwi-essen.de, www.gwi-essen.de<br />
TAE Technische Akademie Esslingen<br />
Heike Baier, Tel. 0711/34008-23, Fax 0711/34008-27, Heike.Baier@tae.<br />
de, www.tae.de<br />
HdT - Haus der Technik<br />
Essen, Tel. 0201/1803-1, E-Mail: hdt@hdt-essen.de,<br />
www.hdt-essen.de<br />
TAW - Technische Akademie Wuppertal<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
iro - Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg<br />
e. V.<br />
Dagmar Hots, hots@iro-online.de, www.iro-online.de<br />
TAW - Technische Akademie Wuppertal e.V.<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228, taw@taw.de,<br />
www.taw.de<br />
62 10-11 | 2014
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
Rohrleitungen nach EN 13480 - Allgemeine<br />
Anforderungen, Werkstoffe, Fertigung und<br />
Prüfung<br />
09./10.12.2014 München<br />
IKT<br />
Workhops<br />
Rückstau, Hydraulik, Überflutung,<br />
Regenrückhaltung<br />
19./20.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Bedarfsorientierte Kanalreinigung<br />
25./26.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Seminare<br />
Umgang mit Dränagewasser von privaten<br />
Grundstücken<br />
11./12.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Kanalreinigung nach DIN<br />
27.11.2014 Gelsenkirchen<br />
Kanal- und Leitungsbau<br />
17./18.12.2014 Gelsenkirchen<br />
iro<br />
Workshop<br />
Qualitätssicherung bei<br />
Gashochdruckleitungen<br />
02.-04.12.2014 Dresden<br />
RSV<br />
ZKS Zertifizierter Kanalsanierungsberater -<br />
Lehrgänge<br />
Modulare Schulung 2014<br />
Hamburg/Kiel<br />
10.11. – 15.11.2014 Hamburg<br />
24.11. – 28.11.2014 Hamburg<br />
08.12. – 13.12.2014 Kiel<br />
SAG<br />
Grundlagen Kanalreinigung<br />
16.12.2014 Lünen<br />
23.02.2015 Darmstadt<br />
08.06.2015 Lünen<br />
15.09.2015 Darmstadt<br />
08.12.2015 Lünen<br />
Fahrzeug- und Gerätetechnik im Bereich<br />
Kanalreinigung<br />
18.12.2014 Lünen<br />
25.02.2015 Darmstadt<br />
10.06.2015 Lünen<br />
17.09.2015 Darmstadt<br />
10.12.2015 Lünen<br />
Grundlagen der Inspektion von<br />
Grundstücksentwässerungsleitungengen<br />
nach europäischer Norm<br />
06.04.2015 Darmstadt<br />
18.05.2015 Kiel<br />
08.06.2015 Lauingen<br />
05.10.2015 Darmstadt<br />
TAE<br />
Seminare<br />
Hochspannungsbeeinflussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
28.01.2015 Ostfildern<br />
TAH<br />
Seminare<br />
Schlauchliner-Workshop<br />
26.11.2014 Mainz<br />
TAW<br />
Seminare<br />
KKS-Seminar für Fortgeschrittene - Teil 1<br />
24.-26.11.2014 Wuppertal<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
29. Oldenburger Rohrleitungsforum 2015, Oldenburg 5<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 31<br />
Esders GmbH, Haselünne<br />
4. Umschlagseite<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef Titelseite, 7<br />
Hinni AG, Biel-Benken, Schweiz 15<br />
KLINGER GmbH, Idstein 21<br />
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover 3<br />
Marktübersicht 65 - 72<br />
10-11 | 2014 63
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und <strong>Wasserversorgung</strong>, der <strong>Abwasserentsorgung</strong>,<br />
der Sanierung, des grabenlosen Leitungsbaus, der Pipelinetechnik<br />
und des Korrosionsschutzes.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
25% ersten Bezugsjahr<br />
Rabatt im<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen und im ersten Bezugsjahr 25 % sparen.<br />
Bitte schicken Sie mir das Fachmagazin für zunächst ein Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 210,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 210,-<br />
als Heft + ePaper für € 297,-<br />
inkl. Versand (Deutschland) / € 301,- (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 105,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 105,-<br />
als Heft + ePaper für € 160,50 inkl. Versand<br />
(Deutschland) / € 164,50 (Ausland).<br />
Alle Preise sind Jahrespreise und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen<br />
vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug zu regulären Konditionen um ein Jahr.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden,<br />
dass ich vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
MARKTÜBERSICHT<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ<br />
Fordern Sie Ihre Bestellunterlagen an unter:<br />
Tel.: 0201 82 002-35 oder h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
10-11 | 2014 65
Marktübersicht MARKTÜBERSICHT rohre + koMponenten<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Anbohrarmaturen<br />
Formstücke<br />
Armaturen<br />
Kunststoff<br />
Rohre<br />
Schutzmantelrohre<br />
Rohrdurchführungen<br />
Ihr „Draht“<br />
zur Anzeigenabteilung<br />
von <strong>3R</strong><br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201-82002-35<br />
Fax 0201-82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
66 10-11 | 2014
RohRe + Komponenten / maschinen & GeRäte / KoRRosionsschutz<br />
marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Horizontalbohrtechnik<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
Kathodischer<br />
Korrosionsschutz<br />
10-11 | 2014 67
Marktübersicht MARKTÜBERSICHT KoRRosionsschutz<br />
Kathodischer<br />
Korrosionsschutz<br />
68 10-11 | 2014
KoRRosionsschutz<br />
marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
10-11 | 2014 69
Marktübersicht MARKTÜBERSICHT KoRRosionsschutz / sanieRunG / institute + VeRbände<br />
Korrosionsschutz<br />
Verbände<br />
Institute<br />
Sanierung<br />
70 10-11 | 2014
institute + VeRbände<br />
marktübersicht<br />
10-11 | 2014 71
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und <strong>Wasserversorgung</strong>, der <strong>Abwasserentsorgung</strong>,<br />
der Sanierung, des grabenlosen Leitungsbaus, der Pipelinetechnik<br />
und des Korrosionsschutzes.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
25% ersten Bezugsjahr<br />
Rabatt im<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen und im ersten Bezugsjahr 25 % sparen.<br />
Bitte schicken Sie mir das Fachmagazin für zunächst ein Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 210,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 210,-<br />
als Heft + ePaper für € 297,-<br />
inkl. Versand (Deutschland) / € 301,- (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 105,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 105,-<br />
als Heft + ePaper für € 160,50 inkl. Versand<br />
(Deutschland) / € 164,50 (Ausland).<br />
Alle Preise sind Jahrespreise und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen<br />
vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug zu regulären Konditionen um ein Jahr.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN2014<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden,<br />
dass ich vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-0, Fax -40<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Friedrich-Ebert-Straße 55, 45127 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-33, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Simon Meyer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-32, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: s.meyer@vulkan-verlag.de<br />
Barbara Pflamm, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-28, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-66, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer,<br />
Vulkan-Verlag/DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Telefon +49 89-203 53 66-16, Fax +49 89-203 53 66-66,<br />
E-Mail: mittermayer@di-verlag.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong>,<br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg,<br />
Telefon +49 931-4170-459, Fax +49 931-4170-494,<br />
E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Herstellung<br />
Dipl.-Des. Nilofar Mokhtarzada, Vulkan-Verlag GmbH<br />
E-Mail: n.mokhtarzada@vulkan-verlag.de<br />
Satz<br />
Dipl.-Ing. (FH) Zahra Tabnak, Vulkan-Verlag GmbH<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September<br />
Bezugspreise:<br />
Abonnement (Deutschland): € 304,-<br />
Abonnement (Ausland): € 308,-<br />
Einzelheft (Deutschland): € 43,-<br />
Einzelheft (Ausland): € 43,50<br />
Einzelheft als ePaper: € 40,-<br />
Jahresabonnement Print und ePaper (Deutschland): € 388,-<br />
Jahresabonnement Print und ePaper (Ausland): € 392,-<br />
Studenten: 50 % Ermäßigung auf den Heftbezugspreis gegen<br />
Nachweis<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für alle übrigen Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede Buchhandlung<br />
möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen<br />
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des<br />
Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Auch die Rechte<br />
der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung, im Magnettonverfahren<br />
oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung<br />
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der<br />
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung<br />
der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Druck<br />
Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V., Köln · Rohrleitungsbauverband<br />
e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband e.V., Essen·<br />
Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten, Gasmeßund<br />
Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld, Vorsitzender des Fachausschusses<br />
„Rohrleitungstechnik“ der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik<br />
und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) Dipl.-Volksw. H. Zech, Geschäftsführer<br />
des Rohrleitungssanierungsverbandes e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln.<br />
Rechtsanwalt C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing.<br />
Th. Grage, Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen.<br />
Dr.-Ing. A. Hilgenstock, E.ON Technologies GmbH, Gelsen kirchen (Gastechnologie<br />
und Handelsunterstützung) Dipl.-Ing. D. Homann, IKT Institut<br />
für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen · Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag,<br />
Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, Westnetz GmbH, Dortmund · Dipl.-<br />
Ing. J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer,<br />
Europipe GmbH, Mülheim · J. Roloff, TÜV SÜD, Köln · Dr. rer. nat. J. Sebastian,<br />
Geschäftsführer der SBKS GmbH & Co. KG, St. Wendel · Dr. H.-C. Sorge,<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim ·<br />
Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter des<br />
IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen · W. Burchard,<br />
Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im VDMA, Frankfurt · Bauassessor<br />
Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Köln ·<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren ·<br />
Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes<br />
e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn, BASF AG, Ludwigshafen· Prof. Dr.-Ing.<br />
K. Körkemeyer, Technische Universität Kaiserslautern, Bauingenieurwesen,<br />
Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft. Dipl.-Ing. B. Lässer, ILF Beratende<br />
Ingenieure GmbH, München · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer<br />
des Kunststoffrohrverbands e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß,<br />
Mitglied des Vorstandes, FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD<br />
Systems GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der<br />
Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · I. Posch, Geschäftsführerin<br />
der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V., Berlin ·<br />
Dipl.‐Berging. H. W. Richter, GAWACON, Essen · H. Roloff, Open Grid Europe<br />
GmbH, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer der ARKIL IN-<br />
PIPE GmbH, Hannover · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener, Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg · Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. B.<br />
Wielage, Technische Universität Chemnitz, Institut für Werkstoffwissenschaft<br />
und Werkstofftechnik · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer Geschäftsführer<br />
der Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
und<br />
sind Unternehmen der