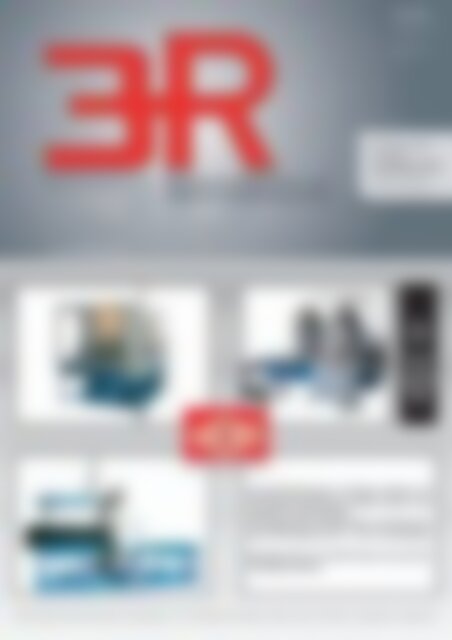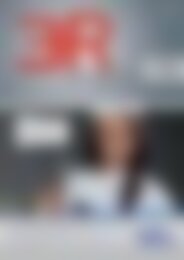3R ACHEMA 2012 (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5/<strong>2012</strong><br />
ISSN 2191-9798<br />
K 1252 E<br />
Vulkan-Verlag,<br />
Essen<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
<strong>3R</strong>-Sonderausgabe<br />
Anlagenbau<br />
<strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong><br />
18. bis 22. Juni <strong>2012</strong><br />
Halle 8.0, Stand K 95a<br />
<strong>3R</strong>_Titel_210 x 175 25.05.<strong>2012</strong> 11:46 Uhr Seite 1<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Die neue Generation Hydranten<br />
Bewährte Sicherheit im Rohrnetz Wir<br />
stellen<br />
aus:<br />
Achema<br />
<strong>2012</strong><br />
Frankfurt<br />
Halle 8.0<br />
Stand<br />
F38<br />
Kunststoffhalbzeuge, wie Rohre, Platten und<br />
Sonderkonstruktionen, perfekt trennen und<br />
dauerhaft verschweißen.<br />
Profimaschinen für Baustelle und Werkstatt.<br />
Besuchen Sie uns - wir freuen uns auf Sie!<br />
Neu: PE-Großrohre bis 2,5 m verarbeiten!<br />
Halle A4 - Stand Nr. 241/342<br />
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre<br />
Kontaktaufnahme.<br />
WIDOS · Wilhelm Dommer Söhne GmbH · Einsteinstraße 5 · D-71254 Ditzingen-Heimerdingen · Telefon +49 (0) 71 52 / 99 39-0 · info@widos.de · www.widos.de<br />
www.avkmittelmann.com
6. Praxistag<br />
mit neuem<br />
Internet auftritt:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Korrosionsschutz<br />
am 13. Juni <strong>2012</strong> in Gelsenkirchen<br />
Programm<br />
Moderation:<br />
U. Bette, Technische Akademie Wuppertal<br />
Strategien für die Optimierung des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes von Rohrleitungen unter Wechselspannungsbeeinflussung<br />
Dr. M. Büchler, SGK Schweizerische Gesellschaft<br />
für Korrosionsschutz, Zürich<br />
Neues Berechnungsverfahren für Erderspannungstrichter<br />
R. Watermann, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
Prof. Dr. R. Schröder, TFH Bochum, Bochum<br />
Wechselstromkorrosion – Ergebnisse von Messungen an<br />
ER-Coupons mit einem 16-Bit-Digital-Speicher-Oszilloskop<br />
U. Bette, Technische Akademie Wuppertal, Wuppertal<br />
MiniLog2: der Datenlogger für den KKS und<br />
Pfadfinder in die Cloud<br />
Th. Weilekes, Weilekes Elektronik GmbH, Gelsenkirchen<br />
Smart KKS: Integration von KKS-Messdaten in die<br />
bestehende Infrastruktur eines Netzbetreibers<br />
M. Müller, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Polyamidumhüllung als Verschleißschutz<br />
bei der Verlegung von Stahlleitungsrohren<br />
mittels grabenloser Verfahren<br />
Dr. H.-J. Kocks, Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
Nachumhüllung von Schweißnähten<br />
für besondere Einsatzfälle<br />
A. Drees, Kettler GmbH & Co. KG, Herten-Westerholt<br />
Ziehkopf zur Überwachung der Umhüllung während<br />
des Einzugs der Rohrleitung beim HDD-Verfahren<br />
H. Engelke, EWE Oldenburg<br />
Modul zur Korrosionskalkulation<br />
bei nicht molchbaren Leitungen<br />
Th. Laier, RWE – Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH,<br />
Dortmund<br />
Aktuelle Entwicklungen im Regelwerk<br />
H. Gaugler, SWM, München<br />
Wann und Wo?<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, fkks<br />
Termin: Mittwoch, 13.06.<strong>2012</strong>,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Veltinsarena, Gelsenkirchen,<br />
www.veltins-arena.de<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken,<br />
Energieversorgungs- und<br />
Korrosionsschutzfachunternehmen<br />
Teilnahmegebühr:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und fkks-Mitglieder: 365,- €<br />
Nichtabonnenten: 395,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-55 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin fkks-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein fkks-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
Editorial<br />
Chemie-Branche setzt<br />
weiterhin auf Investitionen<br />
Die meisten Chemie- und Kunststoff verarbeitenden Unternehmen beurteilen<br />
ihre Zukunftsaussichten optimistisch. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle<br />
weltweite Umfrage der Ceresana Research (siehe www.<strong>3R</strong>-Rohre.de). Hiernach<br />
erwarten über 42 % der befragten Unternehmen eine Verbesserung ihrer Geschäftslage<br />
in den kommenden sechs bis zwölf Monaten. Jedes dritte Unternehmen<br />
geht von einer Erhöhung seines Produktionsvolumens aus. Weitere Investitionen<br />
seien geplant, vor allem in Erweiterungen, Ersatz und Erneuerungen von<br />
Anlagen.<br />
Die deutsche Chemie-Industrie kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr<br />
2011 zurückblicken, konstatierte Dr. Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des<br />
Verbandes der Chemischen Industrie, auf der <strong>ACHEMA</strong>-Wirtschaftspressekonferenz<br />
am 16. April diesen Jahres. „Die Produktion legte um 2,2 % zu, der Branchenumsatz<br />
konnte um 7,7 % auf gut 184 Mrd. Euro gesteigert werden“.<br />
Aufgrund der deutlich schwächeren zweiten Jahreshälfte 2011 mit monatlich<br />
sinkender Produktion und der wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Eurozone<br />
verschlechterte sich allerdings die Stimmung in den Unternehmen.<br />
Seit Dezember 2011 zeigt das Branchenbarometer jedoch eine Trendwende,<br />
und die Geschäftslage hat sich in den ersten Monaten des Jahres weiter verbessert,<br />
so dass die Geschäftserwartungen mittlerweile wieder positiv bewertet werden. „Der<br />
Wendepunkt scheint also hinter uns zu liegen“, so Dr. Utz Tillmann. Insgesamt rechnet man in<br />
der Branche, dass die hohen Vorjahreszahlen bei der Chemieproduktion wieder erreicht werden<br />
und der Branchenumsatz um 1 % steigen wird.<br />
Die allgemeine positive Stimmung wird sich sicher während der kommenden, vom 18. bis<br />
zum 22. Juni stattfindenden Weltleitmesse für chemische Technik und Biotechnologie widerspiegeln:<br />
der <strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong>. Die Veranstalter rechnen mit Zuwächsen gegenüber der letzten<br />
<strong>ACHEMA</strong> 2009, bei der 3.767 Aussteller und über 173.000 Teilnehmer gezählt wurden.<br />
Dass dem verbindenden Element, der Rohrleitung, in der Chemie-Industrie und dem Anlagenbau<br />
eine nicht unbedeutende Rolle zukommt, versteht sich von selbst. Wie auch die Tatsache,<br />
dass es eine andauernde technische Weiterentwicklung der in Anlagen installierten<br />
Komponenten gibt. Über diese wollen wir Sie in der vorliegenden <strong>3R</strong>-Sonderausgabe zum<br />
Anlagenbau informieren.<br />
Allen Teilnehmern der <strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong> wünsche ich einen interessanten und erfolgreichen<br />
Messeaufenthalt. Besuchen Sie unseren Verlagsstand in Halle 8.0 (Stand K 95a), auf dem Sie<br />
neben unserer Schwesterzeitschrift Industriearmaturen ebenfalls die aktuelle <strong>3R</strong> finden.<br />
Dipl.-Ing. (FH) Nico Hülsdau<br />
<strong>3R</strong>-Chefredakteur<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 325
5/<strong>2012</strong><br />
Inhalt<br />
S. 330 S. 337<br />
Editorial<br />
325 Chemie-Branche setzt<br />
weiterhin auf<br />
Investitionen<br />
Nico Hülsdau<br />
Interview<br />
366 „GFK-Wickelrohr – ein<br />
Multitalent“<br />
Mario Frieben<br />
Faszination Technik<br />
364 Den Durchblick behalten<br />
Nachrichten<br />
Industrie und Wirtschaft<br />
329 SIMONA steigert Umsatz 2011 um mehr als 15 Prozent<br />
329 NORMA Group AG setzt Wachstumskurs im ersten Quartal <strong>2012</strong> fort<br />
330 CAD Schroer unterstützt Studenten mit kostenloser 3D-Anlagenbau-Software<br />
331 HIMA wächst weiter<br />
332 KSB gewinnt Industriepreis <strong>2012</strong> auf Hannover Messe<br />
332 Industriestandort Deutschland profitiert doppelt von Erneuerbaren Energien<br />
333 Siemens liefert erste Industriegasturbine nach Nordamerika<br />
334 Hochleistungspumpen für niederländisches Großkraftwerk<br />
334 WILO SE als „Top-Arbeitgeber für Ingenieure“ ausgezeichnet<br />
335 RWE Dea entdeckt Ölvorkommen in der norwegischen Nordsee<br />
336 Industrie-Dienstleister Bardenhagen gründet Niederlassung in Schwedt/Oder<br />
336 SCCP-Zertifikat für Applus RTD<br />
Verbände und Organisationen<br />
337 Rekordteilnahme bei 25. Mitglieder versammlung des GS Kanalbau in Kassel<br />
339 Fachleute diskutieren Umgang mit Niederschlagswasser<br />
339 Schlauchliningmaßnahmen richtig ausschreiben<br />
Veranstaltungen<br />
340 10. Deutscher Schlauchlinertag blickt auf 40 Jahre Schlauchlining zurück<br />
342 AHK Marokko und GWP organisieren Delegationsreise im Juni<br />
342 Delegationen aus 30 Nationen bei der ptc <strong>2012</strong><br />
343 Fachaustausch zu Effizienzpotenzialen in der türkischen Wasserwirtschaft<br />
344 IFAT <strong>2012</strong> bricht alle Rekorde<br />
344 Mehr Energieeffizienz und Sicherheit bei Anlagen und Pipelines<br />
345 Tube und wire mit neuem Ausstellerrekord<br />
346 <strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong> lockt Fachbesucher nach Frankfurt<br />
347 TÜV SÜD referiert über neue Anforderungen in der Chemie- und Prozessindustrie<br />
348 Expertengremium entwickelt aktuelle Leitthemen für K 2013<br />
348 10. Kunststoffrohr-Tagung Würzburg am 27. und 28. Juni<br />
326 5 / <strong>2012</strong>
S. 360<br />
Normen & Regelwerk<br />
349 DWA-Regelwerk<br />
352 DVGW-Regelwerk Gas<br />
352 DVGW-Regelwerk Wasser<br />
Leistung auf Dauer präzise<br />
AChema-Produktvorschau<br />
353 Zukunftsfähige Antriebe<br />
353 Hochflexibler und zweiwelliger Gummi-<br />
Kompensator Typ C-2<br />
354 Neue Absperrklappen für den Flüssiggastransport<br />
354 Softwarelösungen für Anlagenbauer und<br />
-betreiber<br />
355 Flexibel und hochbelastbar: Raci-Gleitkufen<br />
356 Korrosionsbeständige Fluorkunststoffe<br />
357 Lösungen im Anlagenbau: NORMACONNECT® FGR<br />
Rohrkupplungen<br />
Kraftvoll, präzise, korrosionsgeschützt<br />
AUMA produziert Antriebe für Armaturen mit wenigen Zentimetern<br />
Durchmessern bis hin zu metergroßen Schützen an Wehren. Kombiniert<br />
mit den modernen AUMA Steuerungskonzepten und ideal<br />
eingebunden in leistungsfähige Feldbus-Leitsysteme.<br />
■<br />
■<br />
■<br />
■<br />
Im modularen AUMA Konzept perfekt angepasst<br />
Intelligente Antriebslösungen entlasten das Leitsystem<br />
Perfekt angepasst an unterschiedlichste Armaturentypen<br />
und -größen<br />
Weltweite Erfahrung, globaler Service<br />
Stellantriebe für die Wasserwirtschaft<br />
358 Rohr- und Formteile aus High-Tech Kunststoff<br />
358 Anlagenplanungs-Werkzeug im Umbruch<br />
359 Schwingungs-Isolation für dynamische und<br />
thermische Rohrleitungssysteme<br />
360 Doppelrohrsysteme mit neuem Membranventil<br />
360 3D-Planung für Fabriken leicht gemacht<br />
361 Anlagenplanungs-Werkzeug von und für Ingenieure<br />
362 Tieftemperatur-Dämmsysteme für industrielle<br />
Prozessleitungen und Tanks<br />
Bitte besuchen Sie uns<br />
auf unserem Stand<br />
8.0 C23<br />
363 Neue Rohrverbindungslösungen<br />
363 Aseptischer Molch reinigt ressourcensparend<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG<br />
Postfach 1362 • 79373 Müllheim, Germany<br />
Tel. +49 7631 809-0 • riester@auma.com<br />
5 / <strong>2012</strong> www.auma.com 327
5/<strong>2012</strong><br />
Inhalt<br />
S. 388 S. 396 S. 414<br />
Gasversorgung & pipelinebau<br />
Fachbericht<br />
368 Beurteilung der Gefährdung von eingeerdeten Gashochdruckleitungen<br />
durch Erdbeben in deutschen Erdbebengebieten<br />
Von Christian Engel, Ulrich Marewski und Christoph Heep<br />
Fachbericht<br />
372 Korrosionsschutz durch speziell auf den Anwendungsbereich<br />
entwickelte Nachumhüllungen<br />
Von Alexander Fehr und Ralf Summ<br />
Services<br />
377 Marktübersicht<br />
418 Terminkalender<br />
3.US Impressum<br />
Anlagenbau<br />
Fachbericht<br />
388 Einfluss von Rohrleitungsstützen auf die Schwingungssituation an<br />
Rohrleitungen<br />
Von Robert Missal<br />
Fachbericht<br />
396 Schwingungen von Rohrleitungen aktiv mindern<br />
Von J. Engelhardt<br />
Fachbericht<br />
401 Schäden an PTFE-Kompensatoren<br />
Von Franz Hingott<br />
Fachbericht<br />
406 Verfahrensweisen bei Abweichungen von den DIBt-Zulassungskriterien<br />
von Thermoplastbehältern<br />
Von Frank Griebel und Kay Engel<br />
Fachbericht<br />
410 Besondere Anforderungen an ein Baustellenmanagementsystem im<br />
Anlagenbau<br />
Von Helmut Riff<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
414 GFK-Rohre versorgen das GDF SUEZ-Kraftwerk Wilhelmshaven mit<br />
Kühlwasser<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
416 Hebelösung gewährleistet sichere Montage auf Großbaustelle<br />
328 5 / <strong>2012</strong>
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
SIMONA steigert Umsatz 2011 um mehr als<br />
15 Prozent<br />
Der Simona-Konzern hat im Geschäftsjahr<br />
2011 den Umsatz nochmals deutlich gesteigert<br />
und ein gutes Ergebnis erzielt. Die<br />
Umsatzerlöse liegen mit 308,5 Mio. EUR<br />
15,4 % über dem Vorjahr. Damit ist nach<br />
nur zwei Jahren das Vorkrisenniveau bereits<br />
wieder übertroffen worden. Sehr zufrieden<br />
ist der Hersteller von Halbzeugen,<br />
Rohren, Form- und Fertigteilen aus Kunststoff<br />
mit der Ergebnisentwicklung. Das<br />
EBIT konnte auf 19,8 Mio. EUR verdoppelt<br />
werden, die EBIT-Marge liegt mit 6,4 %<br />
über Plan. Für <strong>2012</strong> strebt der Konzern in<br />
einem schwierigen konjunkturellen Umfeld<br />
wieder einen Umsatz von über 300 Mio.<br />
EUR und eine EBIT-Marge von über 5 % an.<br />
Im ersten Halbjahr 2011 profitierte Simona<br />
von guten konjunkturellen Rahmenbedingungen<br />
und einer nach wie vor dynamischen<br />
Investitionstätigkeit der wichtigen<br />
Kundengruppen Chemische Industrie,<br />
Maschinenbau und Solarindustrie. Im<br />
zweiten Halbjahr war die Wachstumsdynamik<br />
deutlich geringer, ausgelöst durch die<br />
Staatsfinanzenkrise in Europa. „Insgesamt<br />
ist uns ein sehr gutes Jahr gelungen“, so<br />
Wolfgang Moyses, Vorsitzender des Vorstandes<br />
der Simona AG, „wir sind deutlich<br />
stärker als die deutsche Wirtschaft, aber<br />
auch stärker als die Kunststoff verarbeitende<br />
Industrie gewachsen. Unsere globale<br />
Strategie mit einem Fokus auf sicherheits-<br />
und umweltrelevante Kunststoffanwendungen<br />
hat sich ausgezahlt.“<br />
In Deutschland sind die Umsatzerlöse<br />
vor allem aufgrund guter Geschäfte mit<br />
der exportorientierten chemischen Industrie<br />
um 15,5 % auf 104,6 Mio. EUR<br />
(2010: 90,6 Mio. EUR) gestiegen. Getrieben<br />
von einem überdurchschnittlichen<br />
Wachstum in Osteuropa haben sich<br />
die Umsatzerlöse in der Region „Europa<br />
und Afrika“ um 14,5 % auf 152,0 Mio. EUR<br />
(2010: 132,7 Mio. EUR) erhöht. In der Region<br />
„Asien, Amerika & Australien“ konnten<br />
vor allem in Asien und in Lateinamerika<br />
deutliche Zuwächse erzielt werden.<br />
Insgesamt sind die Umsatzerlöse in dieser<br />
Region um 16,6 % auf 51,9 Mio. EUR<br />
(2010: 44,5 Mio. EUR) gestiegen. „Wir<br />
streben in Wachstumsmärkten eine signifikante<br />
Marktposition an. Das ist uns in<br />
Osteuropa auch mit der Gründung einer<br />
russischen Tochtergesellschaft wie auch<br />
in Lateinamerika mit dem Aufbau eines<br />
Händlernetzes 2011 sehr gut gelungen“,<br />
so Wolfgang Moyses.<br />
Im Produktbereich Halbzeuge und<br />
Fertigteile wurden Umsatzerlöse von<br />
229,4 Mio. EUR erzielt. Das sind 16,6 %<br />
mehr als im Vorjahr. Hier konnte vor allem<br />
der Umsatz mit extrudierten Platten<br />
aus PE und PP deutlich erhöht werden.<br />
Auch der Umsatz mit Platten aus Sonderkunststoffen<br />
sowie mit Fertigteilen und<br />
Schweißdraht konnte überproportional<br />
gesteigert werden. Der Umsatz mit geschäumten<br />
PVC-Platten, die vor allem in<br />
der Werbetechnik, dem Messebau und im<br />
Hochbau eingesetzt werden, stagnierte.<br />
Die Umsätze im Produktbereich Rohre<br />
und Formteile sind um 12 % auf 79,1 Mio.<br />
EUR gestiegen. Die Position für industrielle<br />
Anwendungen im internationalen Projektgeschäft<br />
konnte ausgebaut und neue<br />
Kunden gewonnen werden. Dadurch sind<br />
die Umsätze mit Rohren und Formteilen<br />
aus PP und Fluorkunststoffen überdurchschnittlich<br />
gestiegen. Das eher lokal geprägte<br />
Geschäft mit PE-Rohren für Tiefbauanwendungen<br />
litt unter dem Rückgang<br />
im öffentlichen Bau in Deutschland.<br />
Auch <strong>2012</strong> will der Konzern einen<br />
Umsatz von mehr als 300 Mio. EUR erzielen.<br />
Die Investitionsbereitschaft und<br />
das Grundvertrauen der verarbeitenden<br />
Industrie sind jedoch weltweit zurückgegangen.<br />
Im ersten Quartal hat Simona<br />
einen Konzernumsatz von 72,7 Mio.<br />
EUR erzielt, das sind 5,5 % weniger als im<br />
sehr guten ersten Quartal 2011, aber 8 %<br />
mehr als im vierten Quartal 2011. Das Ergebnis<br />
vor Ertragsteuern beträgt im ersten<br />
Quartal 3,4 Mio. EUR (Q1 2011: 5,4<br />
Mio. EUR). Die Rohstoffpreise sind im ersten<br />
Quartal weiter gestiegen und belasten<br />
die Rohmarge. Wachstumsimpulse erwartet<br />
das Unternehmen insbesondere aus<br />
Osteuropa. „Wir gehen von einer weiterhin<br />
stabilen Entwicklung aus. Die Früchte<br />
hängen allerdings deutlich höher als noch<br />
vor einem Jahr“, so Wolfgang Moyses.<br />
NORMA Group AG setzt Wachstumskurs im<br />
ersten Quartal <strong>2012</strong> fort<br />
Die Norma Group AG, ein internationaler<br />
Markt- und Technologieführer für hochentwickelte<br />
Verbindungstechnik, verzeichnete<br />
im ersten Quartal <strong>2012</strong> steigende<br />
Umsätze und Ergebnisse und setzte<br />
seinen Wachstumskurs fort. In den ersten<br />
drei Monaten <strong>2012</strong> stieg der Konzernumsatz<br />
um 6,3 % auf 159,7 Millionen Euro<br />
(Vorjahr: 150,3 Millionen Euro). Besonders<br />
kräftig legte der Umsatz in den Regionen<br />
Amerika und Asien-Pazifik zu, in der Region<br />
EMEA (Europe, Middle East, Africa)<br />
blieben die Erlöse nahezu konstant.<br />
Das bereinigte betriebliche Ergebnis<br />
(EBITA) der Gruppe wuchs im ersten<br />
Quartal <strong>2012</strong> auf 29,2 Millionen Euro, ein<br />
Plus von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahreswert<br />
von 28,4 Millionen Euro. Insbesondere<br />
die Region Amerika hat zu dieser<br />
Verbesserung beigetragen. Die bereinigte<br />
EBITA-Marge erreichte in den ersten drei<br />
Monaten des laufenden Geschäftsjahres<br />
18,3 % (Vorjahr: 18,9 %).<br />
„Das stetige Wachstum zeigt, dass<br />
wir uns auf dem richtigen Kurs befinden<br />
und unser Geschäftsmodell sehr erfolgreich<br />
funktioniert. Wir werden auch künftig<br />
in unser Unternehmen investieren und<br />
Kapazitäten gezielt ausbauen, um weiter<br />
zu wachsen“, sagt Werner Deggim, Vor-<br />
5 / <strong>2012</strong> 329
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
standsvorsitzender der Norma Group.<br />
„Unsere Auftragsbücher sind gefüllt. Das<br />
ist eine stabile Basis für die Zukunft.“ Der<br />
Auftragsbestand lag zum 31. März <strong>2012</strong><br />
mit 227,7 Millionen Euro um 4,2 % über<br />
dem Vorquartalswert (31. Dezember<br />
2011: 218,6 Millionen Euro).<br />
Amerika und Asien-Pazifik als<br />
Wachstumstreiber<br />
In der Region EMEA blieben die Erlöse der<br />
Gruppe aufgrund der gesamtwirtschaftlichen<br />
Lage im ersten Quartal <strong>2012</strong> erwartungsgemäß<br />
stabil. Der Umsatz ging leicht<br />
um 0,6 % von 99,8 Millionen Euro im Vorjahr<br />
auf 99,2 Millionen Euro zurück. Wesentlicher<br />
Grund hierfür ist die wirtschaftliche<br />
Situation und die damit verbundene<br />
geringere Nachfrage vor allem in südeuropäischen<br />
Ländern. Die Region Amerika hat<br />
sich in den ersten drei Monaten <strong>2012</strong> als<br />
Wachstumstreiber erwiesen. Der Umsatz<br />
in dieser Region ist von 42,6 Millionen Euro<br />
im Vorjahr auf 50,2 Millionen Euro gestiegen.<br />
Dieser deutliche Zuwachs von 17,9 %<br />
ist hauptsächlich auf eine starke organische<br />
Entwicklung mit erheblichen Volumensteigerungen<br />
zurückzuführen.<br />
Die Entwicklung des Geschäfts in der<br />
Region Asien-Pazifik war unverändert<br />
positiv. Der Umsatz ist im ersten Quartal<br />
<strong>2012</strong> um 30,3 % auf 10,3 Millionen Euro<br />
gewachsen (Vorjahr: 7,9 Millionen Euro).<br />
Die Bedeutung dieser Region für das künftige<br />
Wachstum der Norma Group nimmt<br />
stetig zu. Aus diesem Grund wird das Vertriebsnetzwerk<br />
in dieser Region im Jahr<br />
<strong>2012</strong> weiter ausgebaut. In Vietnam, einem<br />
Land mit großem Wachstumspotenzial,<br />
hat das Unternehmen im Januar <strong>2012</strong><br />
eine Repräsentanz eröffnet. Im Mai <strong>2012</strong><br />
wurden weitere Niederlassungen in Manila<br />
(Philippinen) und in Jakarta (Indonesien)<br />
hinzukommen. „Mit der größeren Präsenz<br />
in Asien erschließen wir neue Märkte. Wir<br />
führen unsere Marken in diesen Ländern<br />
ein und bauen landesweite Vertriebspartnerschaften<br />
auf“, erklärt Deggim.<br />
Der im Geschäftsbericht 2011 formulierte<br />
Ausblick für <strong>2012</strong> besteht unverändert<br />
fort. Der Vorstand der Gruppe erwartet,<br />
dass der Konzernumsatz im Jahr<br />
<strong>2012</strong> zwischen 3 und 6 % wachsen wird.<br />
Konsolidierungsbedingt ergeben sich zusätzliche<br />
Umsätze von rund 10 Millionen<br />
Euro aus der Übernahme des Schweizer<br />
Unternehmens Connectors Verbindungstechnik<br />
AG, spezialisiert auf Verbindungssysteme<br />
für die Pharmazeutik und Biotechnologie.<br />
CAD Schroer unterstützt Studenten mit<br />
kostenloser 3D-Anlagenbau-Software<br />
Bild: MPDS4 Anlagenbausoftware: Kostenlos für Studenten<br />
CAD Schroer, weltweit tätiger Entwickler<br />
und Anbieter von Engineering-Lösungen,<br />
hat im Mai sein Förderprogramm für<br />
Universitäten und Hochschulen angekündigt:<br />
Die kostenlose Nutzung der bewährten<br />
3D-Anlagenbau-Software MPDS4 für<br />
wissenschaftliche Projekte und Lehrzwecke.<br />
MPDS4 ist eine datenbank- und katalogbasierte<br />
Engineering-Suite und beinhaltet<br />
verschiedene Module für alle Herausforderungen<br />
in der Anlagenplanung.<br />
Die Software ermöglicht eine 2D zu 3D<br />
Gebäude- und Layoutplanung sowie die<br />
intelligente 3D-Planung komplexer Rohrleitungssysteme<br />
mit R&I-Integration. Integrierte<br />
Kollisions- und Konsistenzprüfung,<br />
sowie das Auto-Routing für Rohrleitungen,<br />
Klimasysteme und Kabeltrassen<br />
ermöglichen die schnelle und hochqualitative<br />
Planung kompletter Anlagen. Parametrische<br />
Katalogkomponenten können interaktiv<br />
erstellt und Projektdaten jederzeit<br />
durch virtuelle Rundgänge betrachtet<br />
werden.<br />
„Die digitale Planung nachhaltiger,<br />
energieeffizienter und wandelbarer Anlagen<br />
steht bei vielen Lehrstühlen in Universitäten<br />
und Hochschulen an zentraler<br />
Stelle“, erklärt Geschäftsführer Michael<br />
Schroer. „Wir freuen uns darauf, mit<br />
kostenlosen MPDS4-Lizenzen innovative<br />
und zukunftsweisende Projekte zu fördern<br />
und dazu beizutragen, die Kenntnisse über<br />
die neuesten Entwicklungen im 3D-Planungsbereich<br />
zu stärken. Gleichzeitig ist<br />
uns auch das Feedback von Studenten und<br />
Lehrenden für zukünftige Entwicklungspläne<br />
sehr wichtig.“<br />
Die kostenlosen MPDS4 Lizenzen für<br />
Bildungs- und Forschungseinrichtungen<br />
haben keine Funktionseinschränkung im<br />
Vergleich zu der kommerziellen Version.<br />
Die Beantragung der kostenlosen Lizenzen<br />
erfolgt direkt über die CAD Schroer Website:<br />
http://www.cad-schroer.de/Unternehmen/Studenten/?pk_campaign=pr1205_<br />
mpds_unis.<br />
330 5 / <strong>2012</strong>
HIMA wächst weiter<br />
Im Geschäftsjahr 2010 erzielte die HIMA<br />
Paul Hildebrandt GmbH + Co KG, Spezialistin<br />
für sicherheitsgerichtete Automatisierungslösungen,<br />
einen Gesamtumsatz von<br />
75,7 Mio. Euro, der in 2011 um 15 % auf<br />
87,2 Mio. gesteigert werden konnte. Für<br />
<strong>2012</strong> ist ein Wachstum auf noch höherem<br />
Niveau geplant. Bereits im ersten Quartal<br />
<strong>2012</strong> wurde eine Rekordzahl im Auftragseingang<br />
erreicht, die mit 23 % über dem<br />
Vorjahreswert liegt.<br />
Mit über 60 neu geschaffenen Arbeitsplätzen<br />
in 2011 wurde die Mitarbeiterzahl<br />
um 10 % gesteigert. Mit den neu<br />
eingestellten Mitarbeitern im ersten Quartal<br />
<strong>2012</strong> sind heute weltweit 720 Mitarbeiter<br />
bei HIMA beschäftigt. Für das laufende<br />
Geschäftsjahr sind weitere Neueinstellungen<br />
geplant.<br />
Auch die weltweite Expansion schreitet<br />
kontinuierlich voran. Weltweit sind heute<br />
bereits über 30.000 HIMA-Systeme installiert.<br />
Im abgelaufenen Geschäftsjahr<br />
wurden 72 % des Gesamtumsatzes außerhalb<br />
Deutschlands und mehr als 46 %<br />
des Gesamtumsatzes außerhalb Europas<br />
generiert, was der weltweiten Aufstellung<br />
mit Gruppenunternehmen und Vertretungen<br />
in über 50 Ländern zu verdanken ist.<br />
2011 wurden neue Gruppenunternehmen<br />
im Oman und in Kolumbien gegründet. Ein<br />
Gruppenunternehmen in Brasilien befindet<br />
sich momentan im Aufbau. Ein weiterer<br />
Ausbau der Vertriebs- und Engineeringleistungen<br />
ist weltweit, vor allem im Mittleren<br />
Osten, geplant. Die Produkte werden<br />
jedoch weiterhin ausschließlich in Deutschland<br />
entwickelt, produziert und getestet.<br />
Ein Erfolgsfaktor für das Wachstum<br />
sind die vielfachen Entwicklungsaktivitäten<br />
und Produktinnovationen für die Prozessindustrie,<br />
Bahnindustrie sowie Maschinensicherheit.<br />
Am Hauptsitz in Brühl<br />
bei Mannheim ist jeder Dritte ausschließlich<br />
mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben<br />
befasst.<br />
Aber auch die Entwicklung ganzheitlicher<br />
Applikationslösungen, die die komplette<br />
Hard- und Software sowie Lifecycle<br />
Services umfassen, haben zu dem Erfolg<br />
beigetragen. Das 2008 eingeführte<br />
Sicherheitssystem HIMax ermöglicht diese<br />
Lösungen für Turbomaschinen und Kompressoren<br />
(FlexSILon TMC), Brennersteuerung<br />
und Kesselschutz (FlexSILon BCS)<br />
sowie für das Management von Gas- und<br />
Flüssig-Pipelines (FlexSILon PMC).<br />
Sicher mit System<br />
Kunststofflösungen für den<br />
chemischen behälter- und apparatebau<br />
Halle 8.0 Stand K37<br />
Ihre Kunden beauftragen Behälter und Apparate, die höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Dazu<br />
brauchen Sie einen Partner, der ein hochwertiges Halbzeug- und Rohrprogramm mit bester Widerstandsfähig -<br />
keit gegenüber aggressiven Medien und kompetente technische Beratung bietet. Dafür steht SIMONA als Systeman<br />
bieter thermoplastischer Kunststofflösungen. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns auf der<br />
<strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong> oder unter www.simona.de.<br />
Global Thermopl asTic soluTions<br />
5 / <strong>2012</strong> 331
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
KSB gewinnt Industriepreis <strong>2012</strong> auf<br />
Hannover Messe<br />
Auf der diesjährigen Hannover Messe war<br />
der SuPremE-Motor von KSB der Publikumsmagnet<br />
auf dem Stand des Frankenthaler<br />
Pumpen- und Armaturenherstellers.<br />
Eine besondere Auszeichnung<br />
erfuhr dieser am Ende des ersten Messetages,<br />
als er für dieses Produkt mit dem<br />
Industriepreis <strong>2012</strong> in der Kategorie Antriebs-<br />
und Fluidtechnik ausgezeichnet<br />
wurde. Stellvertretend für KSB nahmen<br />
Dr. Thomas Paulus und Daniel Gontermann<br />
die Auszeichnung aus den Händen<br />
von VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno<br />
O. Braun in Empfang. Eine 30-köpfige<br />
Expertenjury – bestehend aus Professoren<br />
und Fachjournalisten – sichtete über 500<br />
Bewerbungen und prämierte Produkte der<br />
besten und progressiv sten Industrieunternehmen<br />
Deutschlands.<br />
Das international agierende Unternehmen<br />
KSB mit Sitz im Frankenthal hat den<br />
prämierten Antrieb selbst entwickelt und<br />
produziert ihn mittlerweile in seinem Werk<br />
in Halle an der Saale in Serie. Dieses Alleinstellungsmerkmal<br />
war mit dafür verantwortlich,<br />
dass KSB diese Auszeichnung<br />
erhalten hat. Ebenso entscheidend dürfte<br />
gewesen sein,<br />
dass der neue<br />
Synchronmotor<br />
im Unterschied<br />
zu<br />
konventionellen<br />
Antrieben<br />
keine Magnetwerkstoffe,<br />
wie etwa<br />
Seltene Erden,<br />
benötigt.<br />
Diese sind als<br />
kritische Rohstoffe<br />
eingestuft,<br />
deren<br />
Gewinnung<br />
in den<br />
U r sprungs-<br />
Bild: Industriepreis <strong>2012</strong>-Sieger Antriebs- & Fluidtechnik: Dr. Thomas<br />
Paulus (KSB), Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. Braun (VDI), Daniel Gontermann<br />
(KSB) (v.l.n.r.)<br />
ländern große Umweltbelastungen verursacht.<br />
Außerdem kommen die neuen Antriebe<br />
ohne störanfällige Rotorlage-Sensoren<br />
aus. Sie sind deshalb genauso robust<br />
und zuverlässig wie geregelte Asynchronmotoren.<br />
Der Industriepreis wird seit 2006 jährlich<br />
von der Huber Verlag für Neue Medien<br />
GmbH auf der Hannover Messe verliehen.<br />
Er gehört heute in Deutschland zu den<br />
wichtigen Auszeichnungen für die Industrie.<br />
Bewerben können sich Firmen jeder<br />
Größe, die mit ihren Produkten einen hohen<br />
technologischen, ökonomischen, ökologischen<br />
oder gesellschaftlichen Nutzen<br />
aufweisen können.<br />
Bild: © Huber Verlag für Neue Medien<br />
Industriestandort Deutschland profitiert<br />
doppelt von Erneuerbaren Energien<br />
Deutschland ist bei den Erneuerbaren<br />
Energien gut aufgestellt – das bewies<br />
die Branche selbstbewusst auf der diesjährigen<br />
Hannover Messe. Vom 23. bis<br />
27. April zeigten die Aussteller ihr Knowhow,<br />
mit dem sie die Energiewende voranbringen<br />
und Deutschland zum Vorreiter<br />
einer Energieversorgung auf Basis<br />
Erneuerbarer Energien machen. Die weltweit<br />
größte Industriemesse machte deutlich,<br />
welche positive Entwicklung sich am<br />
Standort Deutschland vollzieht. „Hier in<br />
Hannover zeigte sich, dass das Industrieland<br />
Deutschland nicht trotz, sondern gerade<br />
wegen der Erneuerbaren Energien international<br />
überaus erfolgreich ist“, sagte<br />
Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare<br />
Energien, Philipp Vohrer. „Dabei profitieren<br />
die deutschen Industrieunternehmen<br />
gleich doppelt: Denn die Erneuerbaren<br />
Energien sorgen nicht nur für volle<br />
Auftragsbücher, etwa in der Grundstoffund<br />
Zulieferindustrie, sondern sie senken<br />
auch messbar den Strompreis an der Leipziger<br />
Strombörse“, betonte Vohrer. Wegen<br />
niedriger Grenzkosten verdrängt der Strom<br />
aus Wind, Sonne & Co. an der Strombörse<br />
zunehmend den teuer erzeugten konventionellen<br />
Strom („Merit-Order-Effekt“).<br />
Dadurch verbilligt sich der Strompreis im<br />
Großhandel um etwa 0,5 Cent pro Kilowattstunde.<br />
Die deutsche Industrie wurde<br />
allein durch diesen Effekt 2010 um rund<br />
1.175 Mio. Euro pro Jahr entlastet.<br />
Gleichzeitig ist eine steigende Anzahl<br />
stromintensiver Unternehmen von der so<br />
genannten EEG-Umlage teilbefreit. Dieser<br />
verbrauchsabhängige Beitrag der Stromkunden<br />
beträgt <strong>2012</strong> knapp 3,6 Cent pro<br />
Kilowattstunde. Während Privathaushalte<br />
und Mittelstand für den Ausbau der Erneuerbaren<br />
Energien diese Umlage in voller<br />
Höhe leisten müssen, zahlen viele stromintensive<br />
Unternehmen aufgrund der „Besonderen<br />
Ausgleichsregelung“ im Erneuerbare-<br />
Energien-Gesetz (EEG) lediglich ein Zehntel<br />
oder ein Hundertstel der Umlage. Damit hat<br />
der Gesetzgeber die Absicht, den Beitrag<br />
der energieintensiven Unternehmen für<br />
die Volkswirtschaft zu honorieren. Ein Beispiel:<br />
Ein Unternehmen, das aufgrund seines<br />
Stromverbrauchs von über 1.500 Gigawattstunden<br />
pro Jahr von der EEG-Umlage<br />
teilbefreit ist, wird über den Merit-Order-<br />
332 5 / <strong>2012</strong>
M<br />
O<br />
V<br />
I<br />
E<br />
N<br />
N<br />
O<br />
T<br />
V<br />
H<br />
A<br />
E<br />
T<br />
I<br />
W<br />
0<br />
O<br />
N<br />
R<br />
D<br />
L<br />
Effekt der Erneuerbaren Energien netto<br />
um mehr als 7 Mio. Euro entlastet.<br />
Neben dem preisdämpfenden Effekt<br />
haben die Erneuerbaren Energien weitere<br />
Vorteile. „Die Erneuerbaren Energien<br />
tragen auch direkt zu neuen Jobs und Exporterfolgen<br />
bei und haben eine eindeutig<br />
positive volkswirtschaftliche Gesamtbilanz“,<br />
bilanzierte Vohrer. Die deutsche<br />
Industrie zeigte sich deshalb nicht nur<br />
auf der Hannover Messe gut gerüstet,<br />
die Herausforderungen der Energiewende<br />
erfolgreich anzunehmen, so Vohrer.<br />
Die Agentur für Erneuerbare Energien<br />
erklärt wichtige Zusammenhänge<br />
und Details zu Industriestrompreisen in<br />
einem aktuell veröffentlichten Hintergrundpapier.<br />
TE TECHNISCHES - EMAIL<br />
Siemens liefert erste<br />
Industriegasturbine nach<br />
Nordamerika<br />
Siemens Energy hat den ersten Auftrag<br />
aus Nordamerika über die Lieferung einer<br />
Industriegasturbine des Typs SGT-<br />
750 für ein neues Gaskraftwerk mit kombinierter<br />
Strom- und Wärmeerzeugung<br />
erhalten. Auftraggeber ist Energía MK<br />
KF, eine Tochtergesellschaft des Textilherstellers<br />
Grupo Kaltex. Nach der Inbetriebnahme<br />
der Anlage im Oktober 2013<br />
wird die installierte Leistung von 36 Megawatt<br />
(MW) ausreichen, um die Textilfabriken<br />
der Grupo Kaltex in Mexiko mit<br />
Strom zu versorgen.<br />
Das Kraftwerk zur kombinierten<br />
Strom- und Wärmeerzeugung wird in<br />
Altamira im Bundesstaat Tamaulipas im<br />
Nordosten Mexikos errichtet und soll<br />
40 % des Strombedarfs von Kaltex Mexico<br />
abdecken. Die elektrische Leistung<br />
beträgt 36 MW. Ein Drittel dieser Leistung<br />
wird direkt für die Kaltex-Anlage<br />
vor Ort verwendet; zwei Drittel werden<br />
in das öffentliche Stromnetz eingespeist,<br />
um weitere Anlagen des Textilherstellers<br />
in Mexiko mit Strom zu versorgen. Die<br />
Abwärme der Gasturbine SGT-750 wird<br />
zudem zur Dampferzeugung genutzt und<br />
dient als Prozessdampf bei der Produktion<br />
von Kunstfasern. Siemens ist verantwortlich<br />
für Lieferung, Installation und<br />
Inbetriebnahme der SGT-750-Gasturbine<br />
einschließlich des Generators, des<br />
Abhitzedampferzeugers mit zusätzlicher<br />
Befeuerung sowie der entsprechenden<br />
Hilfssysteme.<br />
„Dieser Auftrag aus Mexiko zeigt,<br />
dass unsere SGT-750-Gasturbine auch<br />
für den 60-Hertz-Markt ein sehr attraktives<br />
Produkt ist“, sagte Markus Tacke,<br />
CEO der Business Unit Industrial Power<br />
von Siemens Energy. Die Gasturbine des<br />
Typs SGT-750 zeichnet sich besonders<br />
durch ihre Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig<br />
hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit<br />
aus. Der Gasgenerator der Turbine<br />
kann beispielsweise direkt vor Ort ausgetauscht<br />
werden. Die Ausfallzeiten für<br />
planmäßige Wartungsarbeiten können<br />
dadurch in einem Zeitraum von 17 Jahren<br />
auf nur 17 Tage reduziert werden. Die<br />
SGT-750 benötigt dank ihres modularen,<br />
servicefreundlichen Designkonzepts die<br />
geringsten Wartungszeiten in ihrer Leistungsklasse.<br />
Die Turbine erreicht einen<br />
elektrischen Wirkungsgrad von 38,7 %;<br />
beim Einsatz als mechanischer Antrieb<br />
beträgt der Wirkungsgrad 40 %. Die Industriegasturbine<br />
SGT-750 ist die neueste<br />
Entwicklung im Gasturbinen-Portfolio<br />
von Siemens. Die erste Maschine dieses<br />
Typs verkaufte Siemens 2011 an die<br />
deutsche WINGAS GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen<br />
der BASF-Tochter<br />
Wintershall und des russischen Gazprom-<br />
Konzerns. Diese Turbine wird in der deutschen<br />
Anlandestation der Nord-Stream-<br />
Pipeline in Lubmin zum Einsatz kommen.<br />
Der Siemens-Sektor Energy ist der<br />
weltweit führende Anbieter des kompletten<br />
Spektrums an Produkten, Dienstleistungen<br />
und Lösungen für die Stromerzeugung<br />
mit thermischen Kraftwerken<br />
und aus erneuerbaren Energiequellen sowie<br />
für die Stromübertragung in Netzen<br />
und für die Gewinnung, die Verarbeitung<br />
und den Transport von Öl und Gas.<br />
5 gute Gründe<br />
uns vom 18. bis 22. Juli <strong>2012</strong> auf der<br />
<strong>ACHEMA</strong> in Frankfurt zu besuchen.<br />
• Ein neues besonders widerstandsfähiges<br />
Email für abrassive Medien<br />
• Unser neues leitfähiges Email<br />
• Unser neues „Firesafe“ Bodenauslaufventil<br />
• Das neue totraumarme „Schauglas“<br />
• Und unser neues Email150light –<br />
die preisgünstige Email-Serie<br />
S<br />
Besuchen Sie uns<br />
auf der <strong>ACHEMA</strong><br />
in Frankfurt,<br />
Halle 5.1 Stand D89.<br />
Düker GmbH & Co. KGaA<br />
63846 Laufach · Tel +49 6093 87-244<br />
5 / <strong>2012</strong><br />
mtr@dueker.de · www.dueker.de<br />
333
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Hochleistungspumpen für niederländisches<br />
Großkraftwerk<br />
Bild: KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal<br />
Bis September <strong>2012</strong> wird die KSB Aktiengesellschaft<br />
den Neubau der Blöcke A<br />
und B des niederländischen Steinkohlekraftwerks<br />
Eemshaven mit Kesselspeisepumpen<br />
beliefern. Dort errichtet ein<br />
deutscher Stromversorger rund 30 km<br />
nordwestlich von Emden an der Emsmündung<br />
eine hochmoderne Anlage mit mehreren<br />
800-MW-Blöcken, um Strom für<br />
den niederländischen Markt zu erzeugen.<br />
Dieser Auftrag im Wert von mehreren<br />
Millionen Euro umfasst zwei Einheiten,<br />
bestehend aus je einer Turbospeisewasserhauptpumpe,<br />
einer Vorpumpe mit<br />
Getriebe sowie einer Mindestmengenanlage<br />
und Schallschutzhauben. Das Gesamtgewicht<br />
einer solchen Einheit wird<br />
bei über 60 t liegen. Angetrieben werden<br />
die Pumpen von regelbaren Dampfturbinen,<br />
deren Drehzahl man abhängig vom<br />
Bild: Sechsstufige Kesselspeisepumpe vom Typ CHTD ähnlich wie sie auch im niederländischen<br />
Eemshaven zum Einsatz kommen werden<br />
Speisewasserbedarf zwischen 2.400<br />
und 4.680 Umdrehungen variieren kann,<br />
kurzzeitig sogar bis 5.400 Umdrehungen.<br />
Die Antriebsleistung jeder Einheit beträgt<br />
je nach Betriebspunkt bis zu 38.265<br />
kW. Damit werden die Pumpen weltweit<br />
zu den leistungsstärksten Speisepumpen<br />
gehören, die jemals gebaut wurden.<br />
Die Fördermenge jeder Pumpe wird etwa<br />
2.500 Kubikmeter pro Stunde betragen.<br />
Der geplante Betriebsenddruck liegt bei<br />
rund 350 bar und die Fördermediumstemperatur<br />
wird rund 190 °C betragen.<br />
Bei den Pumpen handelt es sich um<br />
so genannte „100-Prozentpumpen“. Das<br />
bedeutet, dass es keine redundanten Einheiten<br />
geben wird und die Hauptpumpen<br />
mit Temperaturüberwachungs- sowie<br />
Schwingungssensoren ausgestattet sein<br />
werden. Diese werden den Betreiber immer<br />
über den Zustand der technisch relevanten<br />
Bauteile informieren.<br />
Das neue Kraftwerk kann teilweise<br />
auch mit Biomasse befeuert werden. Es<br />
soll mit einer Bruttoleistung von 1.600<br />
Megawatt ab 2013 ans Netz gehen und<br />
jährlich Strom für 3,2 Millionen Haushalte<br />
erzeugen. Der Frankenthaler Pumpenhersteller<br />
erhielt den Auftrag für dieses<br />
ambitionierte Projekt unter anderem,<br />
weil er für diesen Energieversorger schon<br />
zahlreiche Kraftwerke mit Pumpen und<br />
Armaturen ausgerüstet hat.<br />
WILO SE als „Top-Arbeitgeber für Ingenieure“<br />
ausgezeichnet<br />
<strong>2012</strong> wurde der Dortmunder Pumpenhersteller<br />
WILO SE erneut als „Top-Arbeitgeber<br />
für Ingenieure“ ausgezeichnet<br />
– bereits zum fünften Mal in Folge. Wilo<br />
ist einer der weltweit führenden Hersteller<br />
von Pumpen und Pumpensystemen für<br />
die Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik, die<br />
Wasserversorgung sowie die Abwasserbehandlung<br />
und -entsorgung. Die Auszeichnung<br />
verleiht das international tätige Researchunternehmen<br />
CRF Institute jährlich<br />
in Kooperation mit der Unternehmensberatung<br />
A.T. Kearney.<br />
Insgesamt 34 Unternehmen wurden<br />
<strong>2012</strong> ausgezeichnet. Untersuchungskriterien<br />
der Studie waren Primäre Benefits,<br />
Sekundäre Benefits und Work-Life-Balance,<br />
Training und Entwicklung, Karrieremöglichkeiten,<br />
Unternehmenskultur und<br />
Innovationsmanagement. In den Kriterien<br />
Primäre Benefits – Gehalt, Altersvorsorge<br />
und Aktienoptionen – sowie Innovationsmanagement<br />
schnitt die Wilo SE besonders<br />
gut ab. „Die Auszeichnung ‘Top-<br />
Arbeitgeber für Ingenieure’ zu erhalten,<br />
bestätigt unseren Kurs. Intensive Mitarbeiterförderung,<br />
kontinuierliche Verbes-<br />
334 5 / <strong>2012</strong>
Bild: WILO SE, Dortmund<br />
Bild: WILO SE wurde zum fünften Mal in Folge vom Researchunternehmen<br />
CRF Institute zum „Top-Arbeitgeber für Ingenieure“ ausgezeichnet<br />
serung der Prozesse, aber auch gemeinnütziges Engagement<br />
sind unter anderem Ansprüche des Unternehmens.<br />
Wir sind stolz darauf, bereits zum fünften<br />
Mal in Folge überzeugen zu können“, so Dr. Patrick<br />
Niehr, Leiter Human Resources DACH. Technische Innovationen<br />
prägen das Unternehmen, seit es 1872<br />
als Kupfer- und Messingwarenfabrik in Dortmund<br />
gegründet wurde. So erfand Wilo 1928 den ersten<br />
Umlaufbeschleuniger der Welt, der die Warmwasserheizung<br />
revolutionierte. 2001 brachte Wilo die erste<br />
Hocheffizienzpumpe für Heizungs-, Klima- und Kälteanwendungen<br />
auf den Markt und führte 2009 das<br />
weltweit erste Dezentrale Pumpensystem „Wilo-Geniax“<br />
ein. Rund 20 Patentanmeldungen pro Jahr machen<br />
Wilo zu einem der führenden Pumpenhersteller<br />
weltweit.<br />
RWE Dea entdeckt Ölvorkommen in der<br />
norwegischen Nordsee<br />
Im Lizenzgebiet PL 418 in der norwegischen<br />
Nordsee ist ein bedeutender Ölfund<br />
erzielt worden. RWE Dea Norge AS baut<br />
als Partner in der Lizenz PL 418 ihre Position<br />
in der nördlichen Nordsee weiter aus.<br />
In der Förderlizenz PL 418 in der nordöstlichen<br />
Nordsee steht der Betriebsführer<br />
Wintershall kurz vor Abschluss der<br />
Explorationsbohrung 35/9-7. Durchgeführt<br />
wurde die Bohrung von der Plattform<br />
„Songa Delta“ im Gebiet Skarfjell, das<br />
südlich des Feldes Titan (PL 420) und etwa<br />
14 km südwestlich des Feldes Gjøa liegt.<br />
Mit der Bohrung sollte vor allem Erdöl im<br />
Speichergestein des Oberen Jura nachgewiesen<br />
werden. Im Oberen Jura stieß die<br />
Bohrung auf einen mächtigen ölführenden<br />
Horizont aus Speichersanden sehr hoher<br />
Qualität, die Leichtöl enthalten. Vorläufigen<br />
Schätzungen zufolge könnte die Lagerstätte<br />
Ressourcen in einem Umfang<br />
von 10 bis 25 Millionen Kubikmetern an<br />
gewinnbarem Erdöl enthalten. Die Bohrung<br />
wurde in einer Wassertiefe von 368 m auf<br />
eine Tiefe von 2.976 m unter dem Meeresspiegel<br />
niedergebracht und endete in<br />
der Rannoch-Formation der Brent-Gruppe<br />
im Mitteljura.<br />
RWE Dea hält eine Beteiligung von<br />
10 % an der Förderlizenz PL 418. „Wir sind<br />
Anfang des Jahres über ein Farm-in-Abkommen<br />
in diese Lizenz eingestiegen und<br />
folgten damit der Strategie unsere Position<br />
in ausgewählten<br />
Kernregionen weiter zu<br />
verstärken“ sagte Hans-<br />
Joachim Polk, Managing<br />
Director von RWE Dea<br />
Norge. „RWE Dea ist<br />
Betriebsführer in der<br />
angrenzenden Lizenz<br />
PL 420, wo 2010 vielversprechende<br />
Öl- und<br />
Gasfunde im Feld Titan<br />
zu verzeichnen waren.<br />
Es freut mich sehr, dass<br />
die aktuelle Bohrung so<br />
erfolgreich war“, so Polk<br />
weiter.<br />
RWE Dea verfügt<br />
in Norwegen über ein<br />
großes Portfolio an Lizenzen,<br />
zu denen u.a.<br />
die Felder Titan in der<br />
Nordsee und Zidane in<br />
der Norwegischen See<br />
gehören, bei denen<br />
RWE Dea Operator ist.<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> sind RWE<br />
Dea Norge sieben neue Lizenzen, zwei davon<br />
mit Betriebsführerschaft, zugesprochen<br />
worden. RWE Dea ist an Förderanlagen<br />
und Gewinnungsberechtigungen in<br />
Deutschland, Großbritannien, Norwegen,<br />
Dänemark und Ägypten beteiligt und verfügt<br />
über Explorationserlaubnisse in Algerien,<br />
Irland, Libyen, Mauretanien, Polen,<br />
Trinidad und Tobago und Turkmenistan. In<br />
Deutschland betreibt RWE Dea darüber hinaus<br />
große unterirdische Erdgasspeicher.<br />
RWE Dea gehört zur RWE-Gruppe, einem<br />
der größten Energieversorgungsunternehmen<br />
Europas.<br />
5 / <strong>2012</strong> 335
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Industrie-Dienstleister Bardenhagen gründet<br />
Niederlassung in Schwedt/Oder<br />
Die Bardenhagen-Gruppe hat im März<br />
am Standort Schwedt/Oder auf dem Gelände<br />
der PCK Raffinerie eine Niederlassung<br />
gegründet. Die neue Bardenhagen<br />
Maschinenbau Oder GmbH offeriert mit<br />
30 erfahrenen Mitarbeitern Industrie-<br />
Dienstleistungen für Auftraggeber aus der<br />
Chemie und Petrochemie, Raffinerien und<br />
der Kraftwerkstechnik.<br />
Als Betriebsleiter für die Vor-Ort-Services<br />
konnte Frank Uhlig gewonnen werden,<br />
Michael Nemetz ist der Betriebsleiter<br />
für Armaturenrevisionen. Beide sind<br />
Spezialisten mit profunden Kenntnissen<br />
im Bereich der Technischen Dienstleistungen.<br />
Schwerpunkt der Aktivitäten sind die<br />
Leckabdichtung im laufenden Betrieb mit<br />
den Zusatzleistungen Rohrfrosten, Hot<br />
Tapping (Anbohren von Rohrleitungen<br />
unter Druck/Temperatur) und Line Stop<br />
(Rohrverschluss) sowie die mechanische<br />
Vor-Ort-Bearbeitung und Armaturenservices.<br />
Die Niederlassung ist direkt auf<br />
dem Gelände der PCK in gemieteten Gebäuden<br />
untergebracht; für Werkstätten,<br />
Büros und Sozialräume stehen 1.400 m 2<br />
Fläche zur Verfügung. Die Investitionen in<br />
Maschinen und Geräte beziffern Dr. Norbert<br />
Wolter und Gerhard Mukbel, die geschäftsführenden<br />
Gesellschafter der Bardenhagen-Gruppe,<br />
mit einem „höheren<br />
sechsstelligen Betrag“.<br />
Beide sehen<br />
den neuen Standort<br />
als Basis zusätzlicher<br />
Aktivitäten<br />
nicht nur mit<br />
der PCK am Standort<br />
Schwedt, sondern<br />
darüber hinaus<br />
in den neuen<br />
Bundesländern<br />
und Berlin sowie<br />
für die mögliche<br />
Expansion in Richtung<br />
Osteuropa.<br />
Die PCK Raffinerie<br />
Schwedt<br />
zählt mit über<br />
1.100 Mitarbeitern<br />
zu den Top-Unternehmen<br />
in Brandenburg<br />
und gilt als<br />
das bedeutendste<br />
Unternehmen in<br />
der Uckermark. Mit der Verarbeitung von<br />
jährlich 12 Millionen t Rohöl ist PCK eine<br />
der größten und modernsten Raffinerien in<br />
Europa. In den letzten 20 Jahren haben die<br />
Gesellschafter der Raffinerie rund 2 Milliarden<br />
Euro in die PCK investiert – hauptsächlich<br />
für modernste Technologien und<br />
den Umweltschutz.<br />
Bild: Andreas Möller, Kontraktorbetreuer der PCK (für Leckabdichtung,<br />
mechanische Vor-Ort-Bearbeitung (on-site machining),<br />
Hot Tapping und Line Stop), Frank Uhlig, Betriebsleiter Technische<br />
Dienstleistungen der Bardenhagen Maschinenbau Oder GmbH,<br />
Michael Nemetz, Betriebsleiter Armaturenservice der Bardenhagen<br />
Maschinenbau Oder GmbH, Andreas Schulz, Kontraktorbetreuer<br />
der PCK für Armaturenservice (v.l.n.r.)<br />
Um diese Investitionen auf dem Stand<br />
der Technik zu halten und vor allem auch<br />
unter Sicherheitsaspekten beschäftigt<br />
PCK neben eigenen Fachleuten auch ausgewählte<br />
externe Spezialisten – mit der<br />
neuen Niederlassung und einem kürzlich<br />
geschlossenen Rahmenvertrag zählt nun<br />
auch die Bardenhagen-Gruppe dazu.<br />
SCCP-Zertifikat für Applus RTD<br />
Applus RTD ist es gelungen, das externe<br />
Audit zugunsten der SCC-Rezertifizierung<br />
(„Sicherheits Certifikat Contraktoren“)<br />
nicht nur zu einem erfolgreichen<br />
Abschluss zu bringen, sondern dabei gleich<br />
die nächste, derzeit höchste, Stufe zu erklimmen.<br />
Als bislang zweites Unternehmen im<br />
Bereich der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung<br />
in Deutschland hat Applus RTD<br />
das bereits in der Vergangenheit erworbene<br />
SCC**-Zertifikat zu einem SCCP-Zertifikat<br />
aufgewertet. Ein solches wird nur<br />
dann vergeben, wenn die Erfüllung zusätzlicher<br />
sicherheitstechnischer Anforderungen<br />
der petrochemischen Industrie nachgewiesen<br />
werden kann.<br />
Das SCC-Konzept zählt heute zu den<br />
bedeutendsten Konzepten (Regelwerken)<br />
für ein betriebliches Arbeitsschutzmanagement.<br />
Ein nach diesem Konzept aufgebautes<br />
Arbeitsschutz-Managementsystem<br />
(AMS) ist zertifizierbar. Basis hierfür<br />
ist keine Norm, sondern das normative<br />
SCC-Regelwerk. Das AMS-Konzept SCC<br />
wurde speziell für Kontraktoren und Personaldienstleister<br />
entwickelt. Es stellt ein<br />
innovatives Managementsystem für Sicherheit,<br />
Gesundheit und Umweltschutz<br />
dar.<br />
Zur Abstimmung und Sicherstellung einer<br />
gegenseitigen Anerkennung wurde eine<br />
europäische SCC-Plattform gegründet.<br />
2011 gehörten ihr Belgien, Deutschland,<br />
die Niederlande und Österreich an. Die<br />
Zertifizierung nach SCCP ist ein entscheidendes<br />
Auswahlkriterium vieler Kunden<br />
aus der Petrochemie bei Ausschreibungen<br />
und der letztendlichen Auftragsvergabe.<br />
336 5 / <strong>2012</strong>
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
Rekordteilnahme bei 25. Mitgliederversammlung<br />
des GS Kanalbau in Kassel<br />
Das historische Ambiente des Kongress<br />
Palais Kassel bildete den Rahmen für die<br />
25. Mitgliederversammlung der RAL-Gütegemeinschaft<br />
Güteschutz Kanalbau. Im<br />
Mittelpunkt der Jubiläumsveranstaltung<br />
standen die Berichte des Vorstandsvorsitzenden<br />
der Gütegemeinschaft, Dipl.-Ing.,<br />
Dipl.-Kfm. Carl-Friedrich Thymian, des<br />
Obmanns des Güteausschusses, Dipl.-Ing.<br />
Uwe Neuschäfer, des Beiratsvorsitzenden,<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Feickert M.A. sowie des<br />
Geschäftsführers, Dr.-Ing. Marco Künster.<br />
In seinem Festvortrag würdigte MDgt<br />
Wenzel Mayer, Abteilungsleiter Wasser<br />
und Boden im Hessischen Ministerium für<br />
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
die Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
als wesentlichen Faktor bei der steten<br />
Verbesserung der Qualität in diesem<br />
Bereich.<br />
Mit der Aussetzung der nach der hessischen<br />
Eigenkontrollverordnung (EKVO)<br />
vorgesehenen Dichtheitskontrolle der privaten<br />
Hausanschlüsse griff der Festredner<br />
in seinem Vortrag ein brandaktuelles<br />
Thema auf, über das auch die Mitglieder<br />
der Gütegemeinschaft Kanalbau angeregt<br />
diskutieren. Nach der EKVO hätten<br />
Kommunen oder Verbände die privaten<br />
Bild 1: Vorstandsmitglieder und Geschäftsführung der Gütegemeinschaft Kanalbau:<br />
Dipl.-Ing. MA Rudolf Feickert, Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm. Carl-Friedrich<br />
Thymian (Vorsitzender), Dipl.-Ing. Gunnar Hunold, Dipl.-Ing. Dieter Jacobi, Dr-Ing.<br />
Marco Künster (Geschäftsführer) und Dipl.-Ing. MBA Ulf Michel (v. li.)<br />
Hausanschlüsse kontrollieren müssen.<br />
Mögliche Kosten hierfür hätten die Hauseigentümer<br />
aufbringen müssen. Die Zumutbarkeit<br />
und die Verhältnismäßigkeit<br />
dieser Regelung wird derzeit nicht nur in<br />
Hessen kritisch hinterfragt – trotz der<br />
eindeutigen gesetzlichen Vorgaben des<br />
Wasserhaushaltgesetzes (WHG), wonach<br />
„Abwasseranlagen so zu errichten, zu betreiben<br />
und zu unterhalten sind, dass die<br />
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung<br />
eingehalten werden“ (§ 60 Abs. 1).<br />
Ebenso gilt: „Wer eine Abwasseranlage betreibt,<br />
ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre<br />
Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung und<br />
ihren Betrieb sowie Art und Menge des<br />
Abwassers und der Abwasserinhaltsstoffe<br />
selbst zu überwachen (§ 61 Abs. 2)“.<br />
Damit ist die Sachlage eigentlich hinreichend<br />
geregelt, denn ohne fachgerechte<br />
Überprüfung erhält man keinen Kenntnisstand<br />
über den Zustand der Kanalisation<br />
auf seinem Grundstück. Im Umkehrschluss<br />
ist eine Überprüfung der Kanäle deshalb<br />
Voraussetzung für die Erfüllung der gesetzlichen<br />
Pflichten. „Deshalb werden die<br />
positiven Ansätze der EKVO vielleicht im<br />
Detail etwas reduziert – etwa bezüglich<br />
der Fristen – aber in der Gesamtheit weiter<br />
Bestand haben“, so die Einschätzung<br />
des Festredners.<br />
Vorstandsvorsitzender Thymian ließ in<br />
seiner Rede die Entwicklung der Gütegemeinschaft<br />
im letzten Jahr Revue passieren.<br />
Seine positive Bilanz: Die Zahl der Mitglieder<br />
erhöhte sich auf 3.245. Für Thymian<br />
ein positives Signal – „trotz der nach<br />
wie vor schlechten (bau-)wirtschaftlichen<br />
Lage“. Besonders kritisch und langfristig<br />
ruinös schätzt Thymian ein, dass „nach<br />
wie vor die Angebote der Unternehmen<br />
oft nicht kostendeckend sind“. Thymian<br />
warb bei Auftraggebern, Ingenieurbüros<br />
und Auftragnehmern für eine sachorientierte<br />
und partnerschaftliche Abwicklung<br />
von Bauaufträgen.<br />
In Bezug auf die Gütegemeinschaft<br />
konnte der Vorstandsvorsitzende mit beeindruckenden<br />
Zahlen aufwarten: 5.120<br />
Auftraggeber und Ingenieurbüros berücksichtigten<br />
Ende 2011 das Anforderungsniveau<br />
Gütesicherung RAL-GZ 961 in ihren<br />
Ausschreibungen. Zu diesem Ergebnis hat<br />
auch die Arbeit der Gütegemeinschaft in<br />
2011 beigetragen: Realisiert wurden 929<br />
Besuche zur Beratung bei Auftraggebern<br />
und Ingenieurbüros, 64 Auftraggeber-<br />
Fachgespräche mit 1.987 Teilnehmern<br />
sowie eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Darüber hinaus wurden insgesamt<br />
7.250 Teilnehmer von Gütezeicheninhabern<br />
in 304 Firmenseminaren geschult.<br />
Im Rahmen der Gütesicherung haben die<br />
vom Güteausschuss beauftragten Prüfingenieure<br />
insgesamt 2.127 Firmen- und<br />
3.808 Baustellenbesuche im Geschäftsjahr<br />
durchgeführt.<br />
Damit setzt die Gütegemeinschaft um,<br />
was Auftraggeber und Mitglieder fordern.<br />
Eine Top-Leistung, für die Thymian allen<br />
Beteiligten seinen Dank aussprach – von<br />
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der<br />
Gütegemeinschaft über Prüfingenieure<br />
und Geschäftsführung bis hin zu den Gremien<br />
der Gütegemeinschaft. Dazu zählen<br />
neben der Mitgliederversammlung Vorstand,<br />
Güteausschuss und Beirat. Letzterer<br />
versteht sich „als Interessenvertreter und<br />
Mittler des Güteschutzgedankens“, wie<br />
der Beiratsvorsitzende Feickert betonte.<br />
„In der Gütegemeinschaft arbeiten Auf-<br />
5 / <strong>2012</strong> 337
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
Bild 2: In diesem Jahr trafen sich die Mitglieder der Gütegemeinschaft Kanalbau in Kassel<br />
traggeber und Auftragnehmer<br />
partnerschaftlich zusammen“, so<br />
Feickert, „wobei sich beide Parteien<br />
die Weiterentwicklung der<br />
Gütesicherung RAL-GZ 961 ohne<br />
Niveauverlust zum Ziel gesetzt<br />
haben.“<br />
Uwe Neuschäfer berichtete<br />
als Obmann über die Arbeit im<br />
Güteausschuss. „Fünf Güteausschusssitzungen<br />
fanden im vergangenen<br />
Jahr statt, dabei wurden<br />
5.682 Berichte zu Firmenbzw.<br />
Baustellenbesuchen vorgelegt“<br />
so Neuschäfer, für den die<br />
Veranstal tung in Kassel ein Heimspiel<br />
darstellte. Als Abteilungsleiter<br />
Technik und Stellv. Betriebsleiter<br />
der KASSELWASSER ist<br />
Neuschäfer für rund 840 km Kanalnetz<br />
verantwortlich. Bei den<br />
zugehörigen Vergabeverfahren<br />
von Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
werden konsequent<br />
Eignungsnachweise entsprechend<br />
RAL-GZ 961 gefordert. Damit<br />
hat man in Kassel positive Erfahrungen gemacht.<br />
Nach Auffassung von Neuschäfer stellt<br />
vor allem die Arbeit der vom Güteausschuss<br />
der Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
beauftragten Prüfingenieure einen wichtigen<br />
Baustein der Gütesicherung dar. Diese<br />
besuchen als sachverständige Berater<br />
unangemeldet die Baustellen, fertigen Berichte<br />
an und legen diese dem Güteausschuss<br />
vor. Von den 5.682 in 2011 behandelten<br />
Vorgängen gaben 269 Anlass zu<br />
Beanstandungen und 24 Mal musste ein<br />
Gütezeichen entzogen werden. Im Güteausschuss<br />
der Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
werden allerdings nicht nur die Berichte<br />
der Prüfingenieure behandelt, sondern<br />
auch wichtige Anpassungen der Güte- und<br />
Prüfbestimmungen erarbeitet. So wurden<br />
auch auf dieser Mitgliederversammlung<br />
Änderungen der Güte- und Prüfbestimmungen<br />
verabschiedet, die vor allem zur<br />
Vereinfachung, Klarstellung und Präzisierung<br />
beitragen.<br />
Im Bericht des Geschäftsführers informierte<br />
Dr.-Ing. Marco Künster über Tätigkeit<br />
und Entwicklungen im vergangenen<br />
Geschäftsjahr. „Die von Auftraggebern,<br />
Bauunternehmen und Ingenieurbüros gestellten<br />
Aufgaben wurden umgesetzt“, so<br />
Künster und verwies dabei auf das umfangreiche<br />
Datenmaterial in der Broschüre<br />
„Zahlen & Fakten 2011“. Stellvertretend<br />
hob er die Überarbeitung der Leitfäden für<br />
die Eigenüberwachung und die Neustrukturierung<br />
der Beurteilungsgruppe Sanierung<br />
(S) hervor.<br />
Die neuen Leitfäden wurden für alle<br />
Ausführungsbereiche überarbeitet und<br />
die enthaltenen Muster für die Eigenüberwachung<br />
bieten eine Hilfe für ausführende<br />
Unternehmen bei der Dokumentation. „Die<br />
Leitfäden stellen eine Informationsquelle<br />
für Auftraggeber, Ingenieurbüros und Gütezeicheninhaber<br />
dar. Gütezeicheninhaber,<br />
die die enthaltenen Muster nutzen, können<br />
auf die Erarbeitung eigener Protokolle zur<br />
Eigenüberwachung verzichten“, machte<br />
Künster deutlich.<br />
Mit der Neustrukturierung der Beurteilungsgruppe<br />
S (Sanierung) wird für Auftraggeber<br />
die Transparenz beim Eignungsnachweis<br />
in diesem Ausführungsbereich<br />
erhöht. Die Struktur der neuen Untergruppen,<br />
deren Anzahl sich durch die Umstellung<br />
deutlich reduziert hat, orientiert sich<br />
an den Vorgaben der DIN EN 15885 vom<br />
März 2011.<br />
Leistungen der Gütegemeinschaft<br />
Die Berichte anlässlich der 25. Mitgliederversammlung<br />
machten auch den Leistungsumfang<br />
der RAL-Gütegemeinschaft deutlich:<br />
Aufgabe ist die Erarbeitung eines zwischen<br />
Auftraggebern, Ingenieurbüros und<br />
Auftragnehmern abgestimmten Anforderungsprofils<br />
zur Bewertung der Bietereignung.<br />
Auf Antrag der Mitgliederversammlung<br />
wurden in jüngster Vergangenheit<br />
Beurteilungsgruppen ergänzt für Ausschreibung<br />
und Bauüberwachung in den<br />
Bereichen Offener Kanalbau (ABAK), Vortrieb<br />
(ABV) und Sanierung (ABS). Neben der<br />
Verleihung des RAL-Gütezeichens Kanalbau<br />
an Firmen bzw. Organisationen, die das Anforderungsprofil<br />
erfüllen, stellt die Gütegemeinschaft<br />
die Gütesicherung der Gütezeicheninhaber<br />
in Form von Firmen- und<br />
Baustellenbesuchen sicher. Ergänzend zur<br />
Beratung in Bezug auf technische Anfragen<br />
realisiert die Gütegemeinschaft jährlich ein<br />
umfangreiches Ange bot an praxisnahen und<br />
gut erreichbaren Schulungen für Auftraggeber,<br />
Ingenieurbüros und Gütezeicheninhaber<br />
und leistet darüber hinaus Grundlagenarbeit<br />
im Sinne der Qualität, beispielsweise<br />
durch Erstellung von „Leitfäden für<br />
die Eigenüberwachung“. Die Organisation<br />
von Erfahrungsaustauschen rundet das Gesamtpaket<br />
RAL-Gütesicherung ab, das damit<br />
weit über die Leistungen einer reinen<br />
Zertifizierung hinausgeht.<br />
Die 26. Mitgliederversammlung der<br />
Gütegemeinschaft Kanalbau findet am 11.<br />
April 2013 in Berlin statt.<br />
338 5 / <strong>2012</strong>
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
Fachleute diskutieren Umgang mit<br />
Niederschlagswasser<br />
Die Entwicklungen und der derzeitige<br />
Stand im Umgang mit Regenwasser sind<br />
die zentralen Themen der elften Regenwassertage,<br />
zu denen die Deutsche Vereinigung<br />
für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e. V. (DWA) Fachleute aus<br />
Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und<br />
Kommunen für den 12. und 13. Juni <strong>2012</strong><br />
nach Berlin-Schönefeld einlädt. Der fachliche<br />
Austausch über Erfahrungen mit geplanten<br />
und bereits realisierten Regenwasserprojekten<br />
bildet den Schwerpunkt der<br />
Veranstaltung. Eine Exkursion zum Retentionsbodenfilter<br />
am Halensee rundet das<br />
Programm ab. Retentionsbodenfilter sind<br />
Teile des Entwässerungssystems und reinigen<br />
stark verschmutztes Niederschlagswasser.<br />
Die Tagung der Entwässerungsexperten<br />
befasst sich unter anderem mit zentralen<br />
und dezentralen Behandlungsverfahren<br />
von Niederschlagswasser und deren Effizienz,<br />
mit der Funktionalität von Regenwasserversickerungsanlagen<br />
und dem Beitrag,<br />
den ein innovatives Regenwassermanagement<br />
zum Schutz vor Überflutungen leisten<br />
kann. Parallel zur Tagung präsentieren<br />
25 Aussteller auf einer begleitenden Fachausstellung<br />
neue Entwicklungen sowie die<br />
in den Vorträgen vorgestellten Techniken<br />
und Verfahren.<br />
Die DWA-Regenwassertage finden im<br />
Holiday Inn Berlin Airport-Hotel, Hans-<br />
Grade-Allee 5, 12529 Berlin-Schönefeld<br />
statt.<br />
Kontakt: DWA, Hennef, Sarah<br />
Heimann, Tel. +49 2242 872-192,<br />
E-Mail: heimann@dwa.de, www.dwa.de/<br />
veranstaltungen.html<br />
Schlauchliningmaßnahmen richtig ausschreiben<br />
Im Rahmen dieses TAH-Workshops wird<br />
anhand eines fiktiven, mit dem Schlauchliningverfahren<br />
zu renovierenden Abwasserkanals<br />
eine detaillierte Ausschreibung<br />
erarbeitet, die Vertragsbedingungen,<br />
Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis<br />
beinhaltet. Es werden die Randbedingungen<br />
der zu sanierenden Strecke<br />
analysiert, die Altrohrzustände ermittelt,<br />
die für die statische Sicherheit unerlässlich<br />
sind, der Umgang mit Anforderungsprofilen<br />
erläutert und deren Umsetzung<br />
in die Baubeschreibung beschrieben.<br />
Die Bearbeitung der Ausschreibung umfasst<br />
allgemeine und zusätzliche Vertragsbedingungen,<br />
Baubeschreibung,<br />
Leistungsverzeichnis und anlagen. Um<br />
eine kurze Anreise zu ermöglichen, wird<br />
diese TAH-Veranstaltung an sechs unterschiedlichen<br />
Orten und Terminen stattfinden:<br />
20. Juni in Frankfurt/Main, 27. Juni<br />
in Stuttgart, 28. Juni in Dortmund, 18.<br />
September in Hannover (geänderter Termin!),<br />
19. September in Köln, 25. September<br />
in Leipzig.<br />
Kontakt: Technische Akademie<br />
Hannover e.V., Dr.-Ing. Igor Borovsky,<br />
Tel. +49 5113943330, E-Mail: info@<br />
ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
PSI Products GmbH<br />
Der Spezialist für hochwertiges Pipeline Zubehör<br />
Die PSI Products GmbH, ein Mitglied der GPT-Gruppe, gehört zu den führenden<br />
Spezialanbietern von hochwertigem Zubehör im Pipeline- und Rohrleitungsbau.<br />
Zusätzlich zu den eigenen Produkten wie Link-Seal ® , Compakt- und Keilflanschdichtungen,<br />
Gleitkufen und vieles mehr, vertreibt die Firma PSI in Deutschland auch<br />
namhafte Marken wie Raci (Gleitkufensysteme) und Canusa (Schrumpfprodukte).<br />
PSI Products GmbH · D-72116 Mössingen · Ulrichstr. 25 · Telefon +49 7473/37 81-0 · Fax +49 7473/37 81 35<br />
E-Mail vertrieb@psi-products.de · www.psi-products.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 339
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
10. Deutscher Schlauchlinertag blickt auf<br />
40 Jahre Schlauchlining zurück<br />
Foto: TAH<br />
Die Renovierung hat die Erneuerung überholt<br />
– so der Tenor der rund 600 Teilnehmer<br />
und 50 Aussteller, die am 20. März<br />
<strong>2012</strong> im Berliner Kongresszentrum den<br />
10. Deutschen Schlauchlinertag besuchten.<br />
Die Sponsoren der Veranstaltung<br />
nutzten das kleine Jubiläum, um mit anderen<br />
Unternehmen der Branche Fachbesuchern<br />
ihre Dienstleistungen und Produkte<br />
zu präsentieren. In den Vorträgen des<br />
Hauptprogramms und im angegliederten<br />
Diskussionsforum blickten die Teilnehmer<br />
gemeinsam zurück auf 40 Jahre Schlauchlining<br />
und analysierten Branche und Markt.<br />
Überlegungen zu Wirtschaftlichkeit, Nutzungsdauer<br />
und Abschreibungszeiten gehörten<br />
dabei ebenso zu den Inhalten, wie<br />
die Themen Planung, Auftragsvergabe und<br />
praxisorientierte Anwendung. Der Austausch<br />
machte deutlich: Das Verfahren, bei<br />
dem flexible, mit Reaktionsharzen getränkte<br />
Schlauchträger in eine zu sanierende Haltung<br />
eingebracht und mit Warmwasser-,<br />
UV- Licht- oder Dampf ausgehärtet werden,<br />
hat sich bei Auftraggebern, Netzbetreibern<br />
und Planern als technisch ausgereifte und<br />
wirtschaftliche Kanalsanierungslösung etabliert.<br />
1971 bei der Sanierung eines Londoner<br />
Abwasserkanals erstmals eingebaut, hat<br />
der Schlauchliner vor allem aufgrund seiner<br />
verfahrenstechnischen Vorteile und seines<br />
hohen Qualitätsstandards die Kanalsanierungsbranche<br />
im wahrsten Sinne des Wortes<br />
umgekrempelt.<br />
„Schatz im Untergrund“<br />
Die öffentliche Kanalisation in Deutschland<br />
hat eine Länge von rund 540.000 km. Der<br />
Wiederbeschaffungswert der Anlagen wird<br />
durch verschiedene Institutionen mit rund<br />
500 bis 600 Mrd. Euro angegeben. „Umso<br />
wichtiger ist es, Bewusstsein für die regelmäßige<br />
Inspektion, Sanierung oder Erneuerung<br />
zu schaffen, um den Schatz im<br />
Untergrund zu nachhaltig erhalten“, stellte<br />
Prof. Dr.-Ing. Burkhard Teichgräber, Geschäftsbereichsleiter<br />
Wassermanagement<br />
& Technische Services der Wasserwirtschaftsverbände<br />
Emschergenossenschaft<br />
und Lippeverband, in seinem Vortrag über<br />
„den verborgenen Schatz im Untergrund“<br />
fest. Der Sanierungsbedarf ist<br />
enorm. Auch vorsichtige Schätzungen<br />
gehen davon aus, dass pro Jahr rund<br />
7 Mrd. Euro investiert werden müssten,<br />
um das Netz zu erhalten. Für die<br />
Betreiber stellt dieser Sanierungsaufwand<br />
baulich und planerisch eine immense<br />
Herausforderung dar. Neben<br />
ganzheitlichen Strategien sind deshalb<br />
vor allem innovative Sanierungsverfahren<br />
gefragt, die schnelle und kostengünstige<br />
Lösungen bieten.<br />
Überdurchschnittliche<br />
Marktstellung<br />
„Mittlerweile stellt die Schlauchlining-<br />
Technologie nicht nur das wichtigste<br />
Bild: Dipl.-Ing. Franz Hoppe, Begründer<br />
der Fachveranstaltung,<br />
machte in seinem Vortrag deutlich,<br />
dass sich das Schlauchlining von einem<br />
kritisch betrachteten Renovierungsverfahren<br />
zum Star einer<br />
Branche gemausert an<br />
Verfahren der grabenlosen Kanalsanierung<br />
dar, sondern hat sich auch eine überdurchschnittliche<br />
Marktstellung erarbeitet“, so<br />
Dr.-Ing. Igor Borovsky von der Technischen<br />
Akademie Hannover. In Anbetracht des<br />
enormen Sanierungsbedarfs in Deutschland<br />
ist das nicht verwunderlich. Rund ein<br />
Fünftel aller öffentlichen Abwasserkanäle,<br />
Hausanschlüsse und Grundstücksleitungen<br />
weisen Schäden auf, die kurz- bis mittelfristig<br />
zu sanieren sind. „Das geht uns alle<br />
an“, so der Organisator des Deutschen<br />
Schlauchlinertags weiter, „zumal es sich bei<br />
der Abwasserkanalisation mit einem geschätzten<br />
Wiederbeschaffungswert von<br />
etwa 576 Mrd. Euro um die mit Abstand<br />
wertvollste Position aller Infrastrukturanlagen<br />
handelt.“ Darüber hinaus gilt es, Umweltschutzbelange,<br />
wirtschaftliche Rahmenbedingungen<br />
oder Sicherheitsaspekte<br />
nicht aus den Augen zu verlieren, egal ob<br />
es um den Austritt von Abwasser in Boden<br />
und Grundwasser, die Fremdwasserproblematik<br />
oder die Auswaschung des Bodens<br />
und die Entstehung von Hohlräumen geht.<br />
Gleichzeitig verwies Borovsky auf gesetzliche<br />
Vorgaben wie den § 60 Wasserhaushaltsgesetz<br />
(WHG), nach dem Abwasseranlagen<br />
sind so zu errichten, zu betreiben<br />
und zu unterhalten, dass die Anforderungen<br />
an die Abwasserbeseitigung eingehalten<br />
werden.<br />
Was zum Erfolg der Schlauchlinertechnologie<br />
geführt hat, erläuterte Dipl.-Ing-<br />
Franz Hoppe, Hamburg Wasser, in seinem<br />
Rückblick auf 40 Jahre Schlauchlining. „Hat<br />
die Renovierung die Erneuerung überholt“,<br />
so die nur auf den ersten Blick provokante<br />
Frage des Begründers der Fachveranstaltung,<br />
in deren Rahmen die Vorstellung aktueller<br />
Entwicklungen traditionsgemäß genauso<br />
ihren Platz hat, wie die kritische und<br />
ergebnisoffene Diskussion über alle Aspekte<br />
des Kanalsanierungsverfahrens. Fakt ist:<br />
Immer mehr Kommunen und Netzbetreiber<br />
setzen auf grabenlose Sanierungsverfahren,<br />
insbesondere auf das Schlauchlining.<br />
Das Verfahren, anfangs noch mit Begriffen<br />
wie „die Socke“ oder „Korrosionsschutztapete“<br />
abgetan, hat sich von einem kritisch<br />
betrachteten Renovierungsverfahren zum<br />
Star einer Branche gemausert – dieses<br />
340 5 / <strong>2012</strong>
Superlativ untermauerte Hoppe mit eindrucksvollen<br />
Zahlen: Wurden 1990 nur etwa<br />
30 km Schlauchliner eingebaut, waren<br />
es 2011 schon rund 1.200 km, verteilt auf<br />
Glasfaser- und Synthesenadelfilzliner. Bemerkenswert<br />
ist aber auch der verstärkte<br />
Einsatz der Schlauchlinerverfahren im<br />
Hausanschlussbereich.<br />
Geringere Kosten bei grabenlosen<br />
Verfahren<br />
Wirtschaftliche Aspekte tragen wesentlich<br />
dazu bei, dass das Verfahren bei Auftraggebern<br />
und Netzbetreibern derart hoch im<br />
Kurs steht. „Je nachdem, mit welchen Verfahren<br />
das langlebige Wirtschaftsgut Kanalnetz<br />
saniert wird, unterscheiden sich<br />
die direkten und indirekten Kosten, aber<br />
auch Abschreibungszeiträume und Unterhaltskosten“,<br />
diese Rechnung präsentierte<br />
GSTT-Vorstandsvorsitzender Prof.<br />
Jens Hölterhoff dem Auditorium. Ein Kostenvergleich<br />
von offener und geschlossener<br />
Bauweise machte die Unterschiede<br />
deutlich. So sind die direkten Kosten bei einer<br />
grabenlosen Sanierung vor allem einer<br />
Verringerung von Straßenaufbrüchen, dem<br />
Wegfall von Aushub und Transport großer<br />
Bodenmassen, der Reduzierung von Leitungsumlegungen<br />
und dem Wegfall bzw.<br />
der Einschränkung von Grundwasserhaltungen<br />
erheblich niedriger. Laut der DWA-<br />
Umfrage 2009 zum Zustand der Kanalisation<br />
lagen die Kosten pro Meter bei der Reparatur<br />
bei 118 Euro, bei der Renovierung<br />
bei 827 Euro und bei der Erneuerung bei<br />
1.709 Euro. Ebenso positiv fällt die Bilanz<br />
bei der Betrachtung der indirekten Kosten<br />
aus. Die Beschränkung von Verkehrsbeeinträchtigungen,<br />
die Reduzierung von Unfallgefahren,<br />
die Verminderung von Schäden<br />
an benachbarten Bauten, der Wegfall<br />
von witterungsbedingten Ausfallzeiten, die<br />
Schonung der Vegetation sowie eine Verminderung<br />
der Beeinträchtigung der Anlieger<br />
und des Handels schlagen hier positiv<br />
zu Buche. Ganz zu schweigen von der<br />
Verringerung von Lärm- und Emissionsbelastungen<br />
in Form von CO 2<br />
. Hier sprechen<br />
die von Hölterhoff vorgestellten Erfahrungswerte<br />
für sich: Während bei einer<br />
Baumaßnahme in offener Bauweise in<br />
einem Zeitraum von 40 Tagen rund 30 t<br />
CO 2<br />
ausgestoßen werden, fallen bei einem<br />
Schlauchsanierungsverfahren in fünf Tagen<br />
etwa 2 t CO 2<br />
an.<br />
Darüber hinaus hat die stetige Weiterentwicklung<br />
von Technik und Qualität<br />
zum Siegeszug des Schlauchliners beigetragen<br />
– auch hierin bestand in der Berliner<br />
Kongresshalle Einvernehmen. Großen<br />
Anteil hatten die Einführung von Anforderungsprofilen<br />
(Hamburg und Süddeutsche<br />
Kommunen), Qualtitätssicherungssystemen<br />
sowie den ersten Regelwerken seitens<br />
der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall (DWA),<br />
des Deutschen Instituts für Normung e.V.<br />
(DIN) und der Europäischen Union (EU).<br />
Außerdem zu erwähnen sind die statische<br />
Berechnungsrichtlinie M 127-2 der DWA<br />
für Renovierungsverfahren sowie die mittlerweile<br />
entstandenen Zusätzlichen Technische<br />
Vertragsbedingungen (ZTV) für die<br />
Materialprüfung und das Schlauchliningverfahren.<br />
Ein Übriges taten auch die „Bauaufsichtlichen<br />
Zulassungen“ des Deutschen<br />
Instituts für Bautechnik (DIBt), die<br />
für den öffentlichen Bereich zwar nicht<br />
zwingend, so doch außerordentlich hilfreich<br />
sind.<br />
Der Faktor Qualität spielt eine entscheidende<br />
Rolle, denn über die Qualität<br />
des Endproduktes werden lange Nutzungsdauern<br />
sichergestellt. Dementsprechend<br />
ist für Prof. Volker Wagner von der<br />
Hochschule Wismar eine Aussage über<br />
eine so genannte durchschnittliche Nutzungsdauer<br />
für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich<br />
zwischen Renovierung, Reparatur<br />
und der Erneuerung bzw. dem Neubau<br />
von Bedeutung. Bei der Renovierung gehen<br />
Fachkreise mittlerweile von durchschnittlichen<br />
Nutzungsdauern von 50 Jahren und<br />
mehr aus. „Im Gegensatz zur Reparatur<br />
hat die Renovierung eine technische Nutzungsdauer,<br />
in der sie alle vorhersehbaren<br />
Einwirkungen ertragen kann ohne ihre<br />
Gebrauchstauglichkeit, ihre Standsicherheit,<br />
ihre Umweltverträglichkeit und Funktionalität<br />
einzubüßen“, so Wagner, der in<br />
seinem Vortrag über „Einsatzbereiche des<br />
Schlauchliningverfahren“ die verschiedenen<br />
Renovierungsverfahren miteinander<br />
verglich.<br />
Broschüren können Sie<br />
gerne anfordern unter:<br />
NORMA Germany GmbH<br />
Edisonstraße 4<br />
D-63477 Maintal<br />
Tel.: +49 (61 81) 4 03-679<br />
Fax: +49 (61 81) 4 03-1679<br />
mail: wolfgang.herb@normagroup.com<br />
Für Monteure mit viel Zeit.<br />
Für Monteure mit wenig Zeit.<br />
Haben Sie Zeit zum Schweißen oder Flanschen?<br />
Mit NORMAConnect sparen Sie Zeit: Einfach die Rohrkupplung<br />
über die Rohrenden schieben, festschrauben, fertig.<br />
Was früher Stunden dauerte, ist heute in Minuten erledigt.<br />
NORMACONNECT ® Rohrkupplungen<br />
millionenfach bewährt<br />
www.normagroup.com<br />
5 / <strong>2012</strong> 341
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
AHK Marokko und GWP organisieren<br />
Delegationsreise im Juni<br />
Insgesamt besteht in Marokko ein hoher<br />
Modernisierungs- und Mechanisierungsbedarf<br />
und stellt attraktive Beteiligungschancen<br />
für deutsche Unternehmen dar.<br />
Marokko verfolgt die Modernisierung seiner<br />
Landwirtschaft, woraus sich besonders<br />
attraktive Beteiligungschancen ergeben:<br />
insbesondere für deutsche Ausfuhren<br />
landwirtschaftlicher Geräte, Trink-, Abwasser-<br />
und Bewässerungstechnik, aber<br />
auch für Ingenieurleistungen, Beratungsfirmen<br />
usw. Um dieses Potenzial für deutsche<br />
Firmen greifbar zu machen, organisiert<br />
die Deutsche Industrie- und Handelskammer<br />
in Marokko (AHK Marokko)<br />
in Zusammenarbeit mit der German Water<br />
Partnership (GWP) eine deutsche Delegationsreise<br />
nach Marokko, die vom 18. bis<br />
22. Juni <strong>2012</strong> stattfindet. Hier gilt es frühzeitig<br />
für die weiteren Projekte deutsche<br />
Unternehmen zu platzieren, damit dieser<br />
interessante Markt nicht nur an französische<br />
und spanische Firmen geht.<br />
Mit dem im Juni 2008 von der marokkanischen<br />
Regierung ins Leben gerufenen<br />
Entwicklungsprogramm „Plan Maroc Vert“<br />
soll der Agrarsektor bis 2020 zum wichtigsten<br />
Wachstumsmotor der marokkanischen<br />
Wirtschaft gemacht werden. Dieses<br />
Programm strebt die Modernisierung und<br />
Exportorientierung der marokkanischen<br />
Landwirtschaft an. Dafür werden Investoren<br />
und Produzenten organisatorisch und<br />
finanziell unterstützt. Anfang 2011 hob<br />
Agrarminister Akhannouch erneut die Bedeutung<br />
der Mechanisierung für eine effiziente<br />
landwirtschaftliche Produktion hervor<br />
und ließ das Subventionssystem überarbeiten,<br />
so dass die notwendigen Käufe<br />
nun nachgeholt werden können. Die neuen<br />
Regelungen wurden Ende April vorgestellt<br />
und das Agrarministerium kündigte an, für<br />
die nächsten drei Jahre 2 Mrd. MAD (rund<br />
e 183 Mio.) Subventionen bereit zu stellen.<br />
Von den 8,7 Mio. Hektar bewirtschafteten<br />
Flächen in Marokko sind nur ca. 1,2<br />
Mio. Hektar bewässert und die Landwirtschaft<br />
verbraucht 80 % des Wasserverbrauchs.<br />
Insofern besteht ein hoher Bedarf<br />
an Modernisierung der Bewässerungstechnik<br />
und Abwasserbewirtschaftung.<br />
Die derzeit mit Tropfbewässerung<br />
versorgte Fläche von 154.000 Hektar soll<br />
deshalb bis 2020 über das Vierfache auf<br />
690.000 Hektar ausgebaut werden. Die<br />
Subventionen liegen je nach Art der Installation<br />
bei bis zu 100 % und 2.500 Euro<br />
pro Hektar.<br />
Der marokkanische Markt für Landmaschinen<br />
befindet sich im Wandel. Legt<br />
man die zu bearbeitende Fläche zugrunde,<br />
beläuft sich die Unterversorgung mit<br />
Traktoren auch heute noch auf geschätzte<br />
70.000 Stück. Momentan bedient ein<br />
Mähdrescher 1.500 Hektar Land in Marokko.<br />
Die Mechanisierung wird mit bis zu<br />
80 % subventioniert; Finanzierungsmodelle<br />
von Hersteller, Händler und Banken unterstützen<br />
das Subventionsmodell.<br />
Delegationen aus 30 Nationen bei der ptc <strong>2012</strong><br />
Bild: Mehr als 300 Teilnehmer nahmen an diesjähriger ptc teil, am Pult Advisory<br />
Comittee Co-Chairman Heinz Watzka (Open Grid Europe)<br />
Bereits zum siebten Mal traf sich die internationale<br />
Pipeline Community vom 28. bis<br />
30. März <strong>2012</strong> in Hannover, um sich über<br />
aktuelle Entwicklungen und Technologien<br />
unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit in<br />
den Bereichen Planung, Bau, Betrieb und<br />
Instandsetzung von Pipelinesystemen zu<br />
informieren. Die Pipeline Technology Conference<br />
(ptc) <strong>2012</strong> war größer als bisher.<br />
309 Teilnehmer, von denen 50 % aus dem<br />
Ausland kamen, 64 Redner, 28 Pipeline-<br />
Betreiber und 27 Aussteller, die ihre innovativen<br />
Lösungsvorschläge in der begleitenden<br />
Ausstellung präsentierten, nahmen<br />
an der diesjährigen Konferenz teil.<br />
Ein großes Interesse lag dabei auch in<br />
den vornehmlich deutschen bzw. europäischen<br />
Themen Energiewende, Speicherung<br />
erneuerbarer Energien im Erdgasnetz<br />
(Power to Gas) und öffentliche<br />
Aufmerksamkeit für Infrastruktur-<br />
342 5 / <strong>2012</strong>
projekte. Auch wenn diese Themen eher<br />
für Deutschland und Europa aktuell sind,<br />
führten sie zu lebendigen Diskussionen<br />
unter den Teilnehmern. Die Konferenz<br />
wird unterstützt und beraten von einem<br />
Advisory Committee, das aus internationalen<br />
Experten besteht.<br />
Dr. Klaus Ritter, Chairman des ptc Advisory<br />
Committees, eröffnete die Veranstaltung<br />
mit der Begrüßung der Teilnehmer<br />
aus 30 verschiedenen Nationen weltweit.<br />
Er betonte, dass diese Veranstaltung<br />
mit Delegationen nicht nur aus europäischen<br />
Ländern, sondern auch aus Südund<br />
Nordamerika, Asien und Afrika die<br />
Bezeichnung ‚international‘ verdient. Die<br />
Lösungen für allgemeine und spezielle Aufgaben<br />
und Problemstellungen, die in den<br />
Vorträgen und in der Ausstellung vorgestellt<br />
wurden, waren von hoher Relevanz<br />
und wurden vor allem von den Vertretern<br />
aus 28 Betreibergesellschaften mit viel<br />
Aufmerksamkeit wahrgenommen. Heinz<br />
Watzka (Open Grid Europe) verleitete dieser<br />
Erfolg zu der Aussage, dass „die Betreiber<br />
aus Südamerika, Asien, Afrika und<br />
Osteuropa in Deutschland / auf der ptc Lösungen<br />
für ihre Fragestellungen suchen.“<br />
Neuer Rahmen<br />
Europas führende Pipeline<br />
Technology Conference<br />
(ptc) hat die internationale<br />
Pipeline Community in<br />
diesem Jahr erstmals nicht<br />
im Rahmen der Hannover<br />
Messe zusammengeführt,<br />
sondern an einem neuen<br />
Veranstaltungsort: dem<br />
Hannover Congress Centrum.<br />
Ritter begründete<br />
diesen Umzug mit der steigenden<br />
Teilnehmerzahl und<br />
der zunehmenden Internationalität<br />
der Veranstaltung. „Der neue<br />
Veranstaltungsort, das Hannover Congress<br />
Centrum, gibt der ptc einen familiäreren<br />
Charakter mit eigener Ausstellungshalle<br />
und Konferenzhotel“, so Ritter.<br />
Die EITEP hat bereits mit den Vorbereitungen<br />
der Konferenz im nächsten Jahr<br />
begonnen. Die achte ptc wird vom 18. bis<br />
20. März 2013 in Hannover stattfinden.<br />
Die ersten Sponsoren haben bereits ihre<br />
Unterstützung zugesagt. Auch im nächsten<br />
Jahr wird die ptc durch ein hochrangiges<br />
Advisory Committee unterstützt,<br />
welches sich entschieden hat – neben<br />
den bestehenden Themen wie Integrität<br />
und Sicherheit von Pipelinesystemen –<br />
den Fokus auf „Components & Materials“<br />
zu legen. Das neue Konzept der Company<br />
Workshops als Teil der ptc, wie beispielsweise<br />
der Siemens Workshop „De-risking<br />
Solutions for Pipelines“ oder der Post-<br />
Conference Workshop von Krohne zum<br />
Thema „Pipeline Leak Detection“ wurde<br />
von den Teilnehmern sehr gut angenommen<br />
und wird für das kommende Jahr ausgebaut<br />
werden.<br />
Fachaustausch zu Effizienzpotenzialen in der<br />
türkischen Wasserwirtschaft<br />
Im Rahmen des 2. Turkish-German Water<br />
Partnership-Days vom 17. bis 18. April<br />
in Istanbul diskutierten 230 Experten aus<br />
Wirtschaft und Politik Herausforderungen<br />
und Marktpotenziale in der kommunalen<br />
und industriellen Wasserwirtschaft<br />
in der Türkei und die Chancen der Zusammenarbeit.<br />
Die gemeinsam mit dem türkischen<br />
Ministerium für Umwelt und Städtebau sowie<br />
dem türkischen Städte- und Gemeindebund<br />
(TBB) von German Water Partnership<br />
(GWP) organisierte Veranstaltung<br />
richtete sich inhaltlich an den Bedürfnissen<br />
der türkischen Wasserwirtschaft aus.<br />
In fachspezifischen Workshops und Vorträgen<br />
zu den jeweiligen Themenschwerpunkten<br />
wurden die aktuellen und langfristigen<br />
Anforderungen hinsichtlich einer<br />
nachhaltigen Entwicklung der türkischen<br />
Wasserwirtschaft identifiziert, Lösungsansätze<br />
diskutiert und weiterführende Kooperationen<br />
initiiert.<br />
Dr. Helge Wendenburg, Abteilungsleiter<br />
Wasser und Abfall des Bundesministeriums<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
(BMU), betonte die führende<br />
Rolle Deutschlands als Exporteur in<br />
der Wasserwirtschaft mit einem weltweiten<br />
Marktanteil von rund 10 %. Die Türkei<br />
ist dabei ein wichtiger Exportmarkt, besonders<br />
vor dem Hintergrund, dass der Investitionsbedarf<br />
der Türkei zur Umsetzung<br />
des gemeinschaftlichen Umweltrechts bis<br />
2023 auf rund 60 Mrd. Euro geschätzt<br />
wird.<br />
Stefan Girod, Geschäftsführer von<br />
GWP, bekräftigte die Unterstützung der<br />
türkischen Wasserwirtschaft durch GWP<br />
und die GWP-Mitglieder mittels Knowhow<br />
und Technologietransfer entlang der<br />
gesamten Wertschöpfungskette. Von der<br />
Wasserversorgung, über die Abwasserbehandlung<br />
und Wasserverwertung bis hin<br />
zur Umsetzung eines geeigneten Konzeptes<br />
für die Erhebung von kostendeckenden<br />
Abwassergebühren. Außerdem soll die intensive<br />
Kooperation durch ein mit dem TBB<br />
geplantes Memorandum of Unterstanding<br />
weiter gefestigt werden. Mehmet Kele¸s,<br />
stellvertretender Generalsekretär des TBB,<br />
unterstrich die Notwendigkeit einer Effizienzsteigerung<br />
der regionalen Wasserwirtschaft<br />
und begrüßte den kontinuierlichen<br />
Informations- und Erfahrungsaustausch<br />
mit GWP.<br />
Deutsche und türkische Teilnehmer<br />
aus der Wirtschaft, den Ministerien, Universitäten<br />
und Verbänden, der Finanzbranche<br />
sowie zahlreiche Vertreter von Wasserversorgungsunternehmen<br />
nutzen die<br />
Gelegenheit Kontakte zu vertiefen und<br />
Geschäftsanbahnungen zu initiieren.<br />
5 / <strong>2012</strong> 343
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
IFAT <strong>2012</strong> bricht alle Rekorde<br />
Nach den Bestmarken bei der Ausstellerzahl<br />
und der Fläche, hat die Fachmesse<br />
IFAT ENTSORGA vom 7. bis zum 11. Mai<br />
mit rund 125.000 Besuchern (2010:<br />
109.589 Besucher) einen weiteren Rekord<br />
aufgestellt. Dr. Johannes F. Kirchhoff, Vorsitzender<br />
des Fachbeirats der Messe und<br />
Geschäftsführender Gesellschafter der<br />
Faun Umwelttechnik: „Die IFAT ENT SORGA<br />
<strong>2012</strong> zeichnet sich durch eine hohe Besucherfrequenz<br />
aus - deutlich mehr Gäste<br />
als zur vorherigen Messe 2010. Hervorragend<br />
hat sich auch das internationale Kundenbild<br />
entwickelt.“<br />
Von den 125.000 Besuchern kamen<br />
rund 75.000 aus dem Inland und gut<br />
50.000 aus dem Ausland. Die Top 10-Besucherländer<br />
waren neben Deutschland –<br />
in dieser Reihenfolge – Österreich, Italien,<br />
Schweiz, die Russische Föderation, die Niederlande,<br />
Dänemark, Tschechische Republik,<br />
Türkei, Polen und Spanien.<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Präsident Deutsche<br />
Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V., Deutschland:<br />
„An der IFAT ENTSORGA beeindrucken<br />
besonders Breite und Tiefe des Angebots<br />
sowie die umfassende internationale Abdeckung.<br />
Betrieblich orientierte Kollegen<br />
finden neueste Technik wie sonst nirgends<br />
auf der Welt. Ebenso begegnen sich hier<br />
Führungskräfte in großer Zahl. Als richtige<br />
Entscheidung erweist sich der zweijährige<br />
Turnus dieser Weltleitveranstaltung der<br />
Wasser- und Entsorgungswirtschaft. Dies<br />
belegt der weitere Anstieg der Zahl der<br />
Aussteller. Zeit und Geld für diesen Besuch<br />
in München alle zwei Jahre sind bestens<br />
investiert, wenn man mit der technischen<br />
Entwicklung Schritt halten will. Die<br />
Teilnahme an der IFAT ENTSORGA – sei<br />
es als Besucher, sei es als Aussteller – ist<br />
ein Muss.“<br />
Insgesamt 2.939 Aussteller aus 54<br />
Ländern (2010: 2.730 Aussteller aus 49<br />
Nationen) präsentierten sich auf 215.000<br />
Quadratmetern (2010: 195.000 Quadratmeter)<br />
in München.<br />
Ein weiterer Höhepunkt war erneut<br />
das Konferenzprogramm, wie die von tns<br />
infratest durchgeführte Umfrage bestätigt:<br />
97 % der Besucher des Rahmenprogramms<br />
vergaben die Bewertung „gut“ bis<br />
„ausgezeichnet“. Über 16.000 Teilnehmer<br />
nahmen an den rund 320 Vorträgen und<br />
Diskussionen zu Top-Themen wie Mega<br />
Cities, Wasserwirtschaft, Phosphor-Recycling<br />
aus Klärschlamm, Kreislaufwirtschaftsgesetz<br />
oder Waste-to-Energy teil.<br />
Internationalität, Qualität, Lösungen -<br />
die IFAT ENTSORGA ist in jeder Hinsicht<br />
das „Muss“ der Branche: 91 % der ausstellenden<br />
Unternehmen bewerteten den<br />
Leitmessecharakter der wichtigsten Fachmesse<br />
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und<br />
Rohstoffwirtschaft mit „gut“ bis „ausgezeichnet“.<br />
Josef Heissenberger, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung von Komptech,<br />
Österreich: „Die IFAT ENTSORGA ist im Bereich<br />
Recyclingtechnik die einzige Messe<br />
von internationaler Bedeutung. Dem entsprechend<br />
war auch das Publikum top-international<br />
und unser Stand sehr gut frequentiert.“<br />
Die nächste IFAT ENTSORGA findet<br />
vom 5. bis zum 9. Mai 2014 statt.<br />
Mehr Energieeffizienz und Sicherheit bei<br />
Anlagen und Pipelines<br />
Wie Anlagen, Pipelines und Rohrleitungen<br />
energieeffizient und wirtschaftlich<br />
betrieben werden können und gleichzeitig<br />
die höchstmögliche Sicherheit bei Bau<br />
und Betrieb gewährleistet werden kann,<br />
zeigen Experten in ihren Vorträgen beim<br />
4.anlagen.forum von TÜV SÜD auf, das am<br />
13. und 14. Juni <strong>2012</strong> in Wien stattfindet.<br />
Die im Zweijahres-Rhythmus stattfindende<br />
Fachtagung spricht die Betreiber, Hersteller<br />
und Planer von Anlagen und Rohrleitungen<br />
ebenso an wie die Vertreter von Behörden.<br />
Hersteller und Betreiber müssen sich<br />
den Herausforderungen stellen, um Wirtschaftlichkeit,<br />
Sicherheit und Umwelt in<br />
Einklang bringen zu können. Daher richtet<br />
das Forum ein besonderes Augenmerk<br />
auf die Themen Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit<br />
und auf Fragen der Betriebs-<br />
bzw. Anlagensicherheit. Die Teilnehmer<br />
profitieren von den Anwendungs- und Erfahrungsberichten<br />
namhafter Firmen und<br />
Fachexperten. So ist die Wirtschaftlichkeit<br />
und Versorgungssicherheit bei der Erdgasspeicherung<br />
in einer Großstadt am Beispiel<br />
Wien genauso Thema wie die wirtschaftliche<br />
Erschließung von kleinen Lagerstätten.<br />
Internationale Themen sind ebenfalls<br />
vertreten. So behandelt ein Vortrag die<br />
besonderen Herausforderungen beim internationalen<br />
Einkauf von Flanschen, Rohren<br />
und Rohrverbindungsteilen. Außerdem<br />
werden auch die speziellen Bedingungen<br />
und Erfahrungen bei Bau und Betrieb einer<br />
Gashochdruckleitung im Gebirge erläutert.<br />
Das 4.anlagen.forum von TÜV SÜD<br />
wendet sich an die Betreiber von technischen<br />
Anlagen im Bereich Chemie- und<br />
Mineralölindustrie, Energieversorgung und<br />
Fernwärme, an die Planer und Hersteller<br />
von Kesselanlagen, Anlagen für alternative<br />
Energien und von Rohrleitungen und Pipelines.<br />
Angesprochen sind weiterhin Fachbetriebe<br />
und Zulieferer aus diesen Anwendungsgebieten<br />
sowie Behördenvertreter,<br />
die sich um Belange des Umwelt- und Gewässerschutzes<br />
oder um baurechtliche<br />
Fragen kümmern.<br />
Das anlagen.forum findet traditionell in<br />
Wien statt. Das ausführliche Tagungsprogramm<br />
findet man unter www.tuev-sued.<br />
de/tagungen im Bereich „Anlagentechnik<br />
und Betriebssicherheit“.<br />
Kontakt: TÜV-SÜD, München,<br />
Aniko Jöckel, Tel. +49 89 5791-2350,<br />
E-Mail: aniko.joeckel@tuev-sued.de,<br />
www.tuev-sued.de<br />
344 5 / <strong>2012</strong>
Tube und wire mit neuem<br />
Ausstellerrekord<br />
Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann<br />
Wer auf dem Weltmarkt der Drähte,<br />
Kabel und Rohre produziert, verarbeitet<br />
und handelt, der durfte Ende März bei<br />
den alle zwei Jahre in Düsseldorf stattfinden<br />
Weltleitmessen wire, Internationale<br />
Fachmesse Draht und Kabel, und<br />
Tube, Internationale Rohrfachmesse,<br />
nicht fehlen.<br />
Die rund 2500 Aussteller von wire<br />
und Tube sind sehr zufrieden mit dem<br />
Verlauf der Veranstaltungen. Belegt<br />
waren insgesamt über 106.000 Quadratmeter<br />
Ausstellungsfläche netto, ein<br />
neuer Spitzenwert verglichen mit den<br />
ebenfalls sehr guten Vorveranstaltungen<br />
der Jahre 2010 und 2008. Insgesamt<br />
kamen 73.500 Fachbesucher aus<br />
111 Ländern an fünf Tagen in die Messehallen<br />
am Rhein. Das ist ein Anstieg<br />
von 6,3 % verglichen mit 2010. Damals<br />
waren es 69.200 Messebesucher<br />
aus rund 100 Ländern. Der Anteil internationaler<br />
Messegäste bei der Tube<br />
<strong>2012</strong> lag bei rund 50 %. Die Fachbesucher<br />
reisten primär aus Frankreich, Italien,<br />
den USA, Großbritannien, Brasilien,<br />
Spanien, Indien, den Niederlanden<br />
und Österreich, der Türkei, der Schweiz<br />
und Belgien an. Aus der Industrie kamen<br />
62 % der Messebesucher, 21 % aus<br />
Bild: Mannesmann Salzgitter präsentierte auf<br />
der Messe Präzisionsrohre<br />
dem Handel und 5 % aus dem Handwerk.<br />
Die Unternehmen der Tube präsentierten<br />
sich und ihre Produkte in den<br />
Messehallen 1 bis 7, 7a und 7 0-2. Mit<br />
1.184 Ausstellern aus 48 Ländern belegten<br />
die Tube-Firmen eine Gesamtfläche<br />
von rund 49.000 Quadratmetern.<br />
Bei der Flächenbelegung konnte<br />
sich die Tube verglichen mit 2010 weiter<br />
steigern: Sie verzeichnet <strong>2012</strong> ein<br />
Flächenplus von 9,4 %. <br />
Gezeigt wurde auf der Tube <strong>2012</strong><br />
die gesamte Bandbreite von der Rohrherstellung<br />
über die Rohrbearbeitung<br />
bis hin zur Rohrverarbeitung. Das<br />
Angebot reichte von Rohmaterialien,<br />
Rohren und Zubehör und Maschinen<br />
zur Herstellung von Rohren über<br />
Werkzeuge zur Verfahrenstechnik und<br />
Hilfsmittel. Profile und Profiltechnologie,<br />
Mess -, Steuer- und Regeltechnik<br />
sowie Prüftechnik und Spezialgebiete<br />
wie Lagerautomatisierung, Steuerungs-<br />
und Kontrollanlagen ergänzten<br />
das Messeangebot. <br />
Das Hauptinteresse der Tube-Besucher<br />
lag bei Rohren (57 %), Maschinen<br />
zur Bearbeitung von Rohren (29 %),<br />
Maschinen zur Verarbeitung von Rohren<br />
(26 %), Rohmaterialien (23 %)<br />
und Maschinen zur Rohrherstellung<br />
(22 %). Zubehör (18 %), Profile<br />
(16 %) sowie Maschinen zur Herstellung<br />
von Profilen wurden von<br />
10 % der Besucher als wichtigster<br />
Grund genannt, die Tube <strong>2012</strong> zu<br />
besuchen.<br />
Ein Schwerpunkt der Tube war<br />
wieder der Bereich Handel mit<br />
Rohren. Zum dritten Mal dabei:<br />
Pipelines und die OCTG Technologie<br />
(oil country tubular goods). Ein<br />
expandierender Bereich vor dem<br />
Hintergrund großer internationaler<br />
Pipelineprojekte wie Nabucco,<br />
North Stream und South Stream.<br />
Im Frühjahr 2014 werden die Leitmessen<br />
Tube und wire wieder in<br />
Düsseldorf stattfinden. Der neue<br />
Messetermin steht noch nicht fest.<br />
Rohrsysteme<br />
aus GFK<br />
von Amitech<br />
Flowtite-Rohre bestehen aus glasfaserverstärktem<br />
Polyesterharz,<br />
kurz GFK.<br />
GFK ist extrem leicht, enorm fest<br />
und erstaunlich flexibel. Aus GFK<br />
bauen Ingenieure rund um den<br />
Globus Flugzeuge, Schiffe, hoch<br />
beanspruchte Teile im Fahrzeugbau,<br />
und wir bauen daraus Rohre<br />
für Ihre Ansprüche.<br />
Flowtite-Rohre eignen sich für alle<br />
Druck- und drucklosen Anwendungen,<br />
in denen traditionell<br />
Guss-, Stahl-, Stahlbeton oder<br />
Steinzeugrohre eingesetzt werden.<br />
Amitech Germany GmbH · Am Fuchsloch 19 ·<br />
04720 Mochau · Tel.: + 49 34 31 71 82 - 0 ·<br />
Fax: + 49 34 31 70 23 24 · info@amitech-germany.de ·<br />
www.amitech-germany.de<br />
A Member of the<br />
Group<br />
Weitere Informationen unter www.amiantit.com<br />
5 / <strong>2012</strong> 345
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
<strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong> lockt Fachbesucher<br />
nach Frankfurt<br />
Die Aussichten für die <strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong> sind<br />
kurz vor Beginn der Weltleitmesse (18. bis<br />
22. Juni) für chemische Technik und Biotechnologie<br />
außerordentlich positiv. Die<br />
Veranstalter gehen von einem leichten<br />
Wachstum gegenüber der letzten Veranstaltung<br />
im Jahr 2009 aus, bei der 3.767<br />
Aussteller und über 173.000 Teilnehmer<br />
gezählt wurden. Wachstumsstark zeigen<br />
sich in diesem Jahr vor allem die Ausstellungsgruppen<br />
Mess- und Regeltechnik und<br />
Pharma-, Verpackungs- und Lagertechnik.<br />
Mit rund 50 % ist die internationale Beteiligung<br />
außerordentlich stark, wobei insbesondere<br />
China und Indien hohe Zuwachsraten<br />
verzeichnen, aber auch die Türkei,<br />
Südkorea und einige osteuropäische Länder<br />
legen zu. Die <strong>ACHEMA</strong> findet alle drei<br />
Jahre statt und ist mit ihrer Kombination<br />
aus Ausstellung, einem Kongress mit rund<br />
900 Vorträgen und zahlreichen Gast- und<br />
Partnerveranstaltungen weltweiter Gipfel<br />
für Wissenschaftler, Entwickler und Anwender<br />
aus allen Branchen der Prozesstechnik<br />
und des Anlagenbaus.<br />
Hintergrund für das Wachstum der<br />
Messe ist die positive Entwicklung in<br />
wichtigen Branchen wie der chemischen<br />
Industrie, der Automatisierungsindustrie,<br />
der Labor- und Analysentechnik und im<br />
Maschinen- und Anlagenbau, wie Vertreter<br />
der Branchenverbände bei der Wirtschaftpressekonferenz<br />
zur Messe Mitte<br />
April in Frankfurt am Main erläuterten. Einer<br />
der wesentlichen Treiber ist das Streben<br />
nach Energieeffizienz. Auf der ACHE-<br />
MA <strong>2012</strong> ist Energie eines der Schwerpunktthemen;<br />
neben der effizienten Nutzung<br />
stehen auch die Energiegewinnung<br />
sowie die Entwicklung innovativer Energieträger<br />
und -speicher im Mittelpunkt.<br />
Chemie und Verfahrenstechnik können<br />
hier wesentliche Beiträge leisten, unter<br />
anderem bei der Entwicklung von Batterie-<br />
und Brennstoffzellentechnik, aber<br />
auch durch neue Konzepte zur Wärmespeicherung.<br />
Zweiter wesentlicher Innovationstreiber<br />
ist der allmähliche Übergang<br />
von fossilen zu nachwachsenden<br />
Rohstoffen. Mit der virtuellen Plattform<br />
„BiobasedWorld at <strong>ACHEMA</strong>“ bietet die<br />
Hallenübers icht<br />
Eingang<br />
Galleria<br />
Torhaus<br />
DECHEMA-Haus<br />
Messeturm<br />
11.0<br />
9.2<br />
9.1<br />
9.0<br />
11.1<br />
F2<br />
GA.0<br />
8.0<br />
Eingang<br />
Torhaus<br />
6.1<br />
6.1/5.1<br />
5.1<br />
6.0 5.0<br />
Congress Center (CMF)<br />
Festhalle<br />
11.0<br />
10<br />
4.2<br />
F1<br />
Forum<br />
11.Via<br />
4.1<br />
4.0<br />
4.C<br />
Halle 1<br />
Eingang<br />
City<br />
Eingang<br />
Portalhaus<br />
3.1<br />
Cargo Center<br />
Dependance<br />
3.0<br />
Eingang<br />
Halle 3<br />
Forschung und Innovation<br />
Literatur, Information, Lern- und Lehrmittel<br />
Labor- und Analysentechnik<br />
Anlagenbau<br />
Mechanische Verfahren<br />
Thermische Verfahren<br />
Pumpen, Kompressoren und Armaturen<br />
Pharma-, Verpackungs- und Lagertechnik<br />
Sicherheitstechnik und Arbeitsschutz<br />
Mess-, Regel- und Prozessleittechnik<br />
Werkstofftechnik und Materialprüfung<br />
Sonderschau<br />
Querschnitt Umweltschutz<br />
Querschnitt Biotechnologie<br />
Abfahrt Ausflüge, Werksbesichtigungen<br />
Kongressbüro<br />
Vortragssäle<br />
Discussion Corner<br />
Vortragssäle:<br />
CMF Forum Ebene 0<br />
Conclusio 1 + 2<br />
Fantasie 1 + 2 DECHEMA-Haus<br />
Harmonie 1 - 4 Carl-Duisberg-Hörsaal<br />
Illusion 1 - 3 Franz-Patat-Hörsaal<br />
Spektrum<br />
Halle 9.1<br />
Halle 4.C<br />
Esprit<br />
Alliance<br />
Genius / Logos<br />
Consens<br />
Concorde Halle 9.2<br />
Entente<br />
Dialog<br />
Halle 4.0<br />
Europa<br />
Portalhaus-Via<br />
Frequenz<br />
Einhefter_Hallenplan.indd 1 16.04.<strong>2012</strong> 14:24:40<br />
346 5 / <strong>2012</strong>
Veranstaltung ein weltweites Forum, bei<br />
dem neue wissenschaftliche Erkenntnisse<br />
ebenso Thema sind wie die Entwicklung<br />
geeigneter Verarbeitungsprozesse,<br />
bei denen biotechnologische Verfahren<br />
eine besondere Rolle spielen.<br />
Themengebiete des <strong>ACHEMA</strong>-<br />
Kongresses<br />
Auch <strong>2012</strong> bietet der Kongress auf dem<br />
Weltforum der chemischen Technik und<br />
Prozessindustrie mit mehr als 900 geplanten<br />
Vorträgen ein hochkarätiges, facettenreiches<br />
und brandaktuelles Kongressprogramm,<br />
das die ganze Vielfalt der Prozesstechnik<br />
widerspiegelt. Einen Überblick<br />
zu den Themengebieten findet man unter<br />
http://kongress.achema.de/topics.<br />
Bild: Die Veranstalter erwarten rund 180.000 Besucher aus 100 Ländern<br />
Foto: Dechema / Helmut Stettin<br />
TÜV SÜD referiert über neue Anforderungen in<br />
der Chemie- und Prozessindustrie<br />
Komplexe Prozesstechnik, weltweite Beschaffungen<br />
und neue Werkstoffe verändern<br />
die Chemieindustrie. Für sichere,<br />
zuverlässige und wirtschaftliche Anlagen<br />
bietet TÜV SÜD Chemie Service ganzheitliche<br />
Beschaffungsstrategien, aktive<br />
Risikoprävention und verlässliche Lebensdauerprognosen.<br />
Auf der <strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong><br />
präsentieren die Experten (Halle 9.1, Stand<br />
C39) ihr umfassendes Leistungsspektrum<br />
für die Chemie- und Prozessindustrie.<br />
Beim Global Sourcing in der Chemie-,<br />
Prozess- und Verfahrenstechnik werden die<br />
asiatischen Hersteller immer wichtiger. Sie<br />
bieten für Anlagenkomponenten wie Apparate<br />
und Druckbehälter attraktive Preisniveaus<br />
bei steigender Qualität. „Zwingend<br />
erforderlich bei der weltweiten Beschaffung<br />
sind allerdings die sorgfältige Auswahl<br />
und Evaluation des Herstellers, die ‚wasserdichte‘<br />
Spezifikation der Produkteigenschaften<br />
und die ausdifferenzierte Qualitätssicherung“,<br />
sagt Kurt Schumacher, Experte<br />
für Global Sourcing und Mitglied der<br />
Geschäftsleitung Plant & Equipment Integrity<br />
bei der TÜV SÜD Chemie Service<br />
GmbH. Nur so könne sichergestellt werden,<br />
dass die Einsparungen später nicht durch<br />
kostenintensive Nachbesserungen oder<br />
verzögerte Liefertermine aufgezehrt werden.<br />
Besonderes Augenmerk muss dabei<br />
auf der Erfüllung der im Bestimmungsland<br />
relevanten Gesetze, Regelwerke und Normen<br />
liegen.<br />
Mit HAZOP-Verfahren<br />
Sicherheitsniveau steigern<br />
Die Komplexität prozesstechnischer und<br />
stofflich-physikalischer Gefährdungspotenziale<br />
steigt kontinuierlich. In den vergangenen<br />
Jahren wurden neue Ansätze für<br />
die Risikoqualifizierung und Klassifikation<br />
von Ausfallwahrscheinlichkeiten entwickelt.<br />
HAZOP-Verfahren bieten die Möglichkeit,<br />
die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit<br />
systematisch zu verbessern. Zu diesem<br />
Zweck leitet ein erfahrener TÜV SÜD-Moderator<br />
ein interdisziplinäres Team aus internen<br />
und externen Experten. Für den Betrieb<br />
und für Änderungen der Anlage werden<br />
mögliche Gefahren prognostiziert,<br />
deren Ursachen und Auswirkungen beurteilt<br />
sowie Gegenmaßnahmen entwickelt.<br />
Der mehrstufige Prozess berücksichtigt<br />
technische und organisatorische Risiken,<br />
mögliche Fehlbedienungen oder äußere<br />
Einwirkungen. So lässt sich gezielt zwischen<br />
tatsächlich erforderlichen und weniger<br />
zielführenden sicherheitstechnischen<br />
Maßnahmen unterscheiden oder die beste<br />
Konzeption für die Funktionale Sicherheit<br />
von leittechnischen Komponenten klären.<br />
Ein erfolgreich umgesetztes HAZOP-Verfahren<br />
wirke sich außerdem positiv auf das<br />
Genehmigungsverfahren und die Versicherungskonditionen<br />
einer Anlage aus.<br />
Kunststoffe zuverlässig und<br />
dauerhaft einsetzen<br />
Hochleistungskunststoffe ersetzen in<br />
Chemie- und Prozessanlagen zunehmend<br />
Komponenten aus Stahl. Die Vorteile: geringeres<br />
Gewicht, hohe Beständigkeit gegen<br />
chemisch-mechanische Angriffe sowie<br />
Kosteneffizienz. „Nicht nur die Grundwerkstoffe,<br />
sondern auch Füge- und Schweißverbindungen<br />
werden beispielsweise bei<br />
Kunststoffrohren und -behältern immer<br />
besser“, sagt Franz Hingott, Bereich Werkstofftechnik<br />
von TÜV SÜD Chemie Service.<br />
Weil leistungsfähige Kunststoffe oder GfK-<br />
Systeme höheren Drücken und Temperaturen<br />
über einen längeren Zeitraum widerstehen,<br />
verändert das auch den Anspruch<br />
an die Lebensdauer-Prognosen und den<br />
Prüfprozess. „Um das Zeitstandverhalten<br />
zuverlässig zu bestimmen, müssen die<br />
Komponenten im Gesamtzusammenhang<br />
von der Herstellung, der Verarbeitung und<br />
den späteren Betriebsbedingungen beurteilt<br />
werden“, so Hingott. Dadurch könne<br />
das passende Prüfverfahren in Bezug<br />
auf die zugehörige Norm oder das Regelwerk<br />
ausgewählt werden. Die international<br />
vertretenen Experten von TÜV SÜD Chemie<br />
Service kennen die Märkte aufgrund<br />
5 / <strong>2012</strong> 347
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
ihrer langjährigen Arbeit und von zahlreichen<br />
begleiteten Projekten. Auftraggeber<br />
profitieren davon, dass alle Leistungen vor<br />
Ort aus einer Hand angeboten werden. Zudem<br />
kann die akkreditierte Prüforganisation<br />
zugleich als Benannte Stelle und Zugelassene<br />
Überwachungsstelle arbeiten, was<br />
letztlich das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme<br />
von Anlagen oder Komponenten<br />
erleichtert. Das TÜV SÜD-Prüftechnikum<br />
hat Prüfplätze mit Wärmeöfen und<br />
Druckeinrichtungen selbst für höherfeste<br />
Kunststoffe.<br />
TÜV SÜD-Vorträge auf der <strong>ACHEMA</strong><br />
<strong>2012</strong>:<br />
18. Juni, 14:00 Uhr: HAZOP – a review<br />
on 40 years of application, trends and<br />
challenges in a changing community<br />
and legal environment (Rainer Semmler,<br />
Harmonie 2, CMF)<br />
20. Juni, 12:30 Uhr: Global sourcing of<br />
pressure vessels for chemical and petrochemical<br />
plants (Kurt Schumacher,<br />
Illusion 1, CMF)<br />
21. Juni, 11:00 Uhr: Damages of PTFE<br />
expansion joints (Franz Hingott, Illusion<br />
2, CMF)<br />
Kontakt: www.tuev-sued.de/<br />
chemieservice<br />
Expertengremium entwickelt aktuelle<br />
Leitthemen für K 2013<br />
Schon zur Premiere gab es viel Anerkennung:<br />
Der Innovation Compass der K 2010,<br />
der mit 220.000 Besuchern weltgrößten<br />
Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie,<br />
war ein erfolgreicher Schritt, um<br />
die Fülle der neuen Produkte und Verfahren,<br />
die auf der Messe in Düsseldorf präsentiert<br />
wurden, zu strukturieren und hervorzuheben.<br />
Nun gilt es, zur K 2013, die<br />
vom 16. bis 23. Oktober 2013 stattfinden<br />
wird, aktuelle Leitthemen zu definieren<br />
und die Suchmatrix für Innovationen<br />
anzupassen. Ein Expertengremium – der<br />
Innovationskreis der K 2013 – erarbeitet<br />
derzeit die Grundlagen. Der Innovationskreis<br />
der K 2013, der sich mit der Weiterentwicklung<br />
des Innovation Compass<br />
befasst, besteht aus Vertretern des Ausstellerbeirates<br />
und der Messe Düsseldorf<br />
sowie dem neu besetzten Wissenschaftlichen<br />
Rat. Diesem gehören an: Prof. Dr.-Ing.<br />
Christian Bonten (Universität Stuttgart),<br />
Prof. Dr. Ulrich Giese (Deutsches Institut<br />
für Kautschuktechnologie), Prof. Dr.-Ing.<br />
Christian Hopmann (RWTH Aachen), Prof.<br />
Dipl.-Ing. Dr. Reinhold W. Lang (Johannes<br />
Keppler Universität Linz), Prof. Dr. Dr.<br />
h.c. Bernhard Rieger (TU München), Prof.<br />
Dr.-Ing. Alois Schlarb (TU Kaiserslautern),<br />
Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt (Universität<br />
Bayreuth) sowie Prof. Dr.-Ing. Johannes<br />
Wortberg (Universität Duisburg-Essen).<br />
Bis zum zweiten Halbjahr <strong>2012</strong> werden<br />
die neue Suchmatrix des Innovation<br />
Compass abschließend definiert und die<br />
Leitthemen von den jeweils zuständigen<br />
Wissenschaftlern dargestellt. Die Veröffentlichung<br />
erfolgt auf der website der K<br />
2013: www.k-online.de. Ab Sommer des<br />
kommenden Jahres haben dann die Aussteller<br />
der K 2013 die Möglichkeit, den Innovation<br />
Compass zu nutzen. Unternehmen,<br />
die mit ihren Produkten und Verfahren<br />
innovative Beiträge zu den Leitthemen<br />
leisten, können aufgenommen<br />
werden und haben somit die Möglichkeit,<br />
ihre Leistungsfähigkeit darzustellen. Für<br />
die Fachbesucher der K 2013 werden die<br />
Ausstellereinträge ab September 2013<br />
einsehbar sein.<br />
10. Kunststoffrohr-Tagung Würzburg am<br />
27. und 28. Juni<br />
In diesem Jahr feiert die Veranstaltung ihr<br />
zehnjähriges Jubiläum. Ein Erfolg, zu dem<br />
das Engagement der Veranstalter – Kunststoff-Zentrum<br />
(SKZ) und der Rohrleitungsbauverband<br />
(rbv) – ebenso beigetragen hat<br />
wie das der beteiligten Referenten und Aussteller.<br />
Auch die Teilnehmer haben mit ihrem<br />
Interesse wesentlichen Anteil daran, dass<br />
sich die Veranstaltung auf hohem Niveau<br />
etablieren konnte.<br />
In den zehn Jahren ihres Bestehens<br />
hat die Kunststoffrohr-Tagung ihr Gesicht<br />
verändert – weg von einer ursprünglich<br />
strengen Spezialisierung auf wenige<br />
wichtige Anwendungsbereiche hin zu einem<br />
Branchentreff, der den Blick auf die<br />
„Welt der Kunststoffrohre“ öffnet. Die<br />
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die<br />
Leistungsstärke von Kunststoffrohrsystemen<br />
werden im Rahmen der Veranstaltung<br />
deutlich. Praktisch gibt es für jeden Anwendungsbereich<br />
eine individuelle Lösung<br />
mit einem genau dazu passenden Produkt.<br />
Dementsprechend bietet das Programm<br />
auch im Jubiläumsjahr ein breites<br />
Spektrum an Vorträgen, wobei der Praxisbezug<br />
nicht zu kurz kommt. Die Referenten<br />
werfen einen Blick auf Aktuelles<br />
vom Markt, berichten über Kunststoffrohrsysteme<br />
im Zusammenhang mit alternativen<br />
Energieformen, stellen Konzepte<br />
und Maßnahmen auf dem Sanierungsgebiet<br />
vor und befassen sich mit Fragen des<br />
Leitungsbaus.<br />
Die Tagungsinhalte sind konkret auf den<br />
Teilnehmerkreis zugeschnitten. Eingeladen<br />
sind Mitarbeiter von Kommunen, Tiefbauämtern,<br />
Stadtwerken, Versorgungsunternehmen,<br />
Ingenieurbüros, Behörden, Verbänden,<br />
Hochschulen, Instituten sowie<br />
Rohrleitungsbauer und die branchenrelevante<br />
Industrie. Die Teilnahme am Gesamtprogramm<br />
wird gleichzeitig als Verlängerung<br />
für die GW 331 anerkannt.<br />
Kontakt: SKZ, Würzburg, Alexander<br />
Hefner, Tel: +49 931 4104-164,<br />
E-Mail: a.hefner@skz.de<br />
348 5 / <strong>2012</strong>
Normen & Regelwerk<br />
DWA-Regelwerk<br />
Merkblatt DWA-M 387: „Thermische Behandlung von Klärschlämmen – Mitverbrennung in Kraftwerken“<br />
Mai <strong>2012</strong>, 48 Seiten, ISBN 978-3-942964-29-6, Ladenpreis 52,00 Euro, für fördernde DWA-Mitglieder 41,60 Euro.<br />
Die thermische Behandlung von Klärschlämmen<br />
stellt heute in Deutschland<br />
den mengenmäßig wichtigsten Entsorgungsweg<br />
dar. Sie trägt damit wesentlich<br />
zu einer sicheren, wirtschaftlichen<br />
und umweltgerechten Entsorgung von<br />
Klärschlämmen bei. So ist seit Ende der<br />
1980er Jahre der Anteil der Schlämme,<br />
die einer thermischen Behandlung<br />
zugeführt werden, von ca. 12 % auf<br />
über 50 % gestiegen. Insbesondere hat<br />
in den letzten Jahren die Mitverbrennung<br />
von Klärschlämmen in Kohlekraftwerken<br />
stark zugenommen. Mit einem<br />
Anteil von ca. 25 % des in Deutschland<br />
anfallenden Schlammes wird in diesen<br />
Anlagen etwa die gleiche Menge kommunaler<br />
Klärschlämme wie in den Monoverbrennungsanlagen<br />
behandelt.<br />
Letztere werden in dem bereits im Dezember<br />
2011 erschienen DWA-Merkblatt<br />
M 386 „Thermische Behandlung<br />
von Klärschlämmen – Monoverbrennung“<br />
behandelt.<br />
Ziel des neuen Merkblattes ist es,<br />
grundlegende Hinweise zur technischen<br />
Ausführung und zum Betrieb von Anlagen<br />
zur Mitverbrennung von Klärschlämmen<br />
in Kraftwerken zu geben.<br />
Ausgehend von den Brennstoffeigenschaften<br />
von Klärschlamm werden die<br />
Auswirkungen der Mitverbrennung auf<br />
verschiedene Feuerungssysteme für<br />
Braun- und Steinkohle, die Abgasreinigung<br />
und die Reststoffe intensiv behandelt.<br />
Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
und zu Wirtschaftlichkeitsaspekten<br />
sowie die Darstellung<br />
mehrerer Praxisbeispiele runden<br />
das Merkblatt ab.<br />
Planern und Betreibern von Anlagen<br />
zur Klärschlammmitverbrennung<br />
wird mit dem Merkblatt eine Basis für<br />
die Konzeptfindung während der Planungsphase<br />
sowie für Entscheidungen<br />
über Investitionen beim Neubau an die<br />
Hand gegeben.<br />
Merkblatt DWA-M 303: Wiedernutzbarmachung von kleinen Grundstücken – Abbruch, Rückbau und<br />
geordnete Entsorgung<br />
April <strong>2012</strong>, 56 Seiten, ISBN 978-3-942964-31-9, Ladenpreis: EUR 59,00, für fördernde DWA-Mitglieder EUR 47,20<br />
Einen wichtigen Baustein zur Befriedigung<br />
der Nachfrage nach innerstädtischem<br />
Wohnraum stellt die Wiedernutzung<br />
von bereits bebauten, aber nicht<br />
mehr genutzten Flächen dar. In jüngerer<br />
Zeit rückt die Wiedernutzung kleinerer<br />
bebauter Grundstücke in das Bewusstsein<br />
der Stadtplanung und der Bauherren.<br />
Auch diese kleineren Maßnahmen setzen<br />
sowohl gründliche Planungsüberlegungen<br />
zur Nachfolgenutzung, als auch ein<br />
wohl überlegtes Vorgehen beim Rückbau<br />
vorhandener Bauten und der Sanierung<br />
der Grundstücke voraus. Das Merkblatt<br />
richtet sich gezielt an die meist privaten<br />
Besitzer von nicht mehr nutzbaren Bauten,<br />
die eine Nachnutzung anstreben. Der<br />
Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Gebäude<br />
und womöglich anzutreffenden<br />
Schadstoffen. Fragen des Boden-, Naturund<br />
Gewässerschutzes werden am Rande<br />
gestreift und durch Verweise auf die<br />
einschlägigen Rechtsbereiche und technischen<br />
Normen abgehandelt.<br />
Merkblatt DWA-M 619 (Entwurf): Ökologische Baubegleitung bei Gewässerunterhaltung und -ausbau<br />
Mai <strong>2012</strong>, 58 Seiten, ISBN 978-3-942964-36-4, Ladenpreis: EUR 63,00, Preis für fördernde DWA-Mitglieder EUR 50,40<br />
Mit der Ökologischen Baubegleitung<br />
(ÖBB) sollen sowohl die Umweltverträglichkeit<br />
von Bauvorhaben, die Berücksichtigung<br />
der Belange des Natur-,<br />
Gewässer- und Bodenschutzes als auch<br />
die Umsetzung geeigneter Maßnahmen<br />
zur Erreichung der Umweltziele gemäß<br />
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie<br />
bzw. der leitbildtypischen Entwicklungsziele<br />
erreicht werden. Damit umfasst<br />
die ÖBB alle Maßnahmen, die zu<br />
einer möglichst umweltverträglichen<br />
Umsetzung der Gewässerplanung und<br />
zu einer optimalen Gewässerentwicklung<br />
führen. Im Entwurf des Merkblattes<br />
DWA-M 619 wird angegeben, in<br />
welchen Planungs- und Bauphasen eine<br />
ÖBB sachlich geboten ist und welche<br />
weiteren Tätigkeiten in Betracht<br />
kommen können. Des Weiteren werden<br />
auch Möglichkeiten zur Beauftragung<br />
dieser Leistungen dargestellt. Der<br />
Schwerpunkt liegt auf der Darstellung<br />
und Beschreibung der einzelnen Leistungen<br />
der ÖBB zum Umbau von Fließgewässern<br />
sowie der Zuordnung zu den<br />
einzelnen Phasen im Bauablauf.<br />
Kontakt: DWA Deutsche Vereinigung<br />
für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V., Hennef,<br />
www.dwa.de/shop<br />
5 / <strong>2012</strong> 349
Wir sind ganz rohr<br />
Heute schon Know-how geshoppt?<br />
Der neue Internetauftritt der <strong>3R</strong><br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Vulkan-Verlag
Normen & Regelwerk<br />
DVGW-Regelwerk Gas<br />
Neuerscheinungen<br />
G 488 „Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung – Planung, Errichtung, Betrieb“<br />
Ausgabe 4/12, EUR 28,72 für DVGW-Mitglieder, EUR 38,29 für Nicht-Mitglieder<br />
Im Januar 1993 wurde der DVGW-Arbeitskreis<br />
„Gasbeschaffenheitsmessung“<br />
eingerichtet, um für Gasbeschaffenheitsmessanlagen<br />
eine geschlossene<br />
Darstellung der Bau- und Verfahrensweisen<br />
zu schaffen, die sich in ihrer<br />
praktischen Anwendung bewährt haben<br />
und die nach allgemeiner sachverständiger<br />
Überzeugung als einwandfreie technische<br />
Lösungen gelten. Mit der Neuauflage<br />
des DVGW-Regelwerks G 488 sind<br />
diese Bau- und Verfahrensweisen auf<br />
den neuesten Stand gebracht worden.<br />
Das Arbeitsblatt gilt für Gase, deren Beschaffenheit<br />
nach den DVGW-Arbeitsblättern<br />
G 260 und G 262 definiert sind.<br />
Die Notwendigkeit von Gasbeschaffenheitsmessanlagen<br />
(GBM) ist durch<br />
die Bestimmung der thermischen Energie<br />
nach DVGW G 685 und zur Überwachung<br />
der Gasqualität begründet. Im Arbeitsblatt<br />
wird hierzu neben der Planung,<br />
Errichtung, Inbetriebnahme und Betrieb<br />
besonders auf die Messverfahren zur<br />
Bestimmung der Gasbeschaffenheit und<br />
der Gasqualitätsüberwachung eingegangen.<br />
Die Anlagen bestehen aus der Probenahme-Vorrichtung,<br />
der Probenaufbereitung,<br />
den Messgeräten, Nebeneinrichtungen<br />
sowie dem Aufstellungsraum.<br />
Sie befinden sich an Ein-/Ausspeisestellen<br />
und/oder repräsentativen Stellen eines<br />
Gasnetzes der öffentlichen Versorgung.<br />
Die Anforderungen für Anlagen zur<br />
Gasbeschaffenheitsmessung grenzen<br />
sich dabei von denen der Gas-Druckregelanlagen<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 491 oder Gas-Messanlagen nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 492 ab.<br />
Zurückziehungen<br />
GW 110 „Einheiten im Gas- und Wasserfach“<br />
Das Merkblatt GW 110 (Ausgabe 12/1976) wurde ersatzlos zurückgezogen.<br />
DVGW-Regelwerk Wasser<br />
W 1050 „Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen“<br />
Ausgabe 4/12, EUR 25,79 für DVGW-Mitglieder, EUR 34,38 für Nicht-Mitglieder<br />
Mit dem Schutz von Wasserversorgungsanlagen<br />
gegen unbefugten Zugriff<br />
befasst sich der DVGW seit Ende<br />
der 1950er Jahre. Dies führte im November<br />
1961 zur Regelwerksveröffentlichung<br />
des DVGW W 801 (H) „Vorläufige<br />
Hinweise zur Notstandsplanung in<br />
der zentralen öffentlichen Wasserversorgung“<br />
und im März 1979 zu einer<br />
ersten Fortschreibung. Vor den Hintergründen<br />
der Terroranschläge in New York<br />
am 11.09.2001 erfolgte im März 2002<br />
eine Aktualisierung, die unter W 1050<br />
(H) „Vorsorgeplanung für Notstandsfälle<br />
in der öffentlichen Trinkwasserversorgung“<br />
erschien. Im August 2008 fasste<br />
der DVGW das Thema „Organisation und<br />
Management im Krisenfall“ im W 1002<br />
(H) zusammen, ein Thema, das auch im<br />
W 1050 behandelt wurde. Daher musste<br />
das W 1050 von März 2002 zurückgezogen<br />
werden. Die baulichen Vorsorgemaßnahmen<br />
des W 1050 wurden nicht in das<br />
W 1002 übernommen.<br />
Das neue Merkblatt W 1050 ersetzt<br />
den Teil des ehemaligen DVGW-Hinweises<br />
W 1050, der nicht in DVGW W 1002<br />
(H) eingeflossen ist. Es wurde von einem<br />
Projektkreis im Technischen Komitee<br />
„Anlagen- u Betriebsmanagement in<br />
der Wasserverteilung“ erarbeitet. Dieses<br />
Merkblatt gilt für die Ermittlung von<br />
Maßnahmen zum Objektschutz einzelner<br />
Wasserversorgungsanlagen im Rahmen<br />
des Risikomanagements gemäß DVGW<br />
W 1001 (H) „Sicherheit in der Trinkwasserversorgung<br />
– Risikomanagement im<br />
Normalbetrieb“. Der Hinweis beschränkt<br />
sich dabei im Wesentlichen auf den Einbruchs-<br />
und Zugriffsschutz. Darüber hinaus<br />
gelten weiterhin die speziellen Festlegungen<br />
der objektbezogene Regelwerke<br />
[zum Beispiel DVGW W101 (A), DVGW<br />
W 102 (A), DVGW W 122 (A), DVGW<br />
W 300 (A), DVGW W 400-1 bis 3 (A)].<br />
Ein wesentlicher Teil des Risikomanagements<br />
ist der Schutz der Infrastruktur<br />
der Wasserversorgung gegen Zugriffe<br />
unbefugter Dritter. Der zielgerichtete<br />
Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen<br />
dient der Risikoreduzierung und<br />
damit auch der Risikobeherrschung in der<br />
sicheren Versorgung der Bevölkerung mit<br />
Wasser in Zusammenarbeit mit der zuständigen<br />
Behörde. Der vorliegende Hinweis<br />
dient als Leitfaden zur Identifikation<br />
notwendiger Schutzmaßnahmen gegen<br />
Bedrohungen durch Eingriffe Dritter in<br />
die Anlagen der Wasserversorgung. Mit<br />
Berücksichtigung des Leitfadens kann<br />
das Risiko einer Beeinträchtigung der<br />
Wasserversorgung aufgrund einer abstrakten,<br />
d. h. einer nach den vorliegenden<br />
Erkenntnissen möglichen Gefahr reduziert<br />
werden. Im Falle einer konkreten,<br />
d. h. einer in einem einzelnen Fall bestehenden<br />
Gefahr können die ergriffenen<br />
Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit<br />
hin eingeordnet werden.<br />
W 1050 nimmt beispielsweise das<br />
Zwiebelschalenprinzip auf, das sich bei<br />
der Festlegung anlagenbezogener Sicherheitszonen<br />
und deren Sicherheitsniveaus<br />
bewährt hat. Das heißt, je mehr unterschiedliche<br />
Widerstände gegen unbefugten<br />
Zugriff von außen bestehen, desto<br />
wahrscheinlicher wird ein versuchter<br />
Zugriff auflaufen, scheitern oder erkannt.<br />
Kontakt: DVGW Deutscher<br />
Verein des Gas- und<br />
Wasserfaches e.V., Bonn,<br />
www.dvgw.de<br />
352 5 / <strong>2012</strong>
<strong>ACHEMA</strong>-Produktvorschau <strong>2012</strong><br />
AUMA<br />
Zukunftsfähige Antriebe<br />
In den letzten drei Jahren hat AUMA die<br />
neue Drehantriebsbaureihe der Generation<br />
.2 erfolgreich am Markt eingeführt.<br />
Mittlerweile sind viele Tausend Antriebe<br />
der neuen Generation .2 installiert. Auf der<br />
Achema <strong>2012</strong> zeigt das Müllheimer Unternehmen<br />
die Zukunftsfähigkeit dieser<br />
Antriebe, basierend auf einem modularen<br />
Konzept, das über Jahrzehnte perfektioniert<br />
wurde.<br />
Die Diagnosefähigkeit der Geräte wurde<br />
erweitert, z. B. enthalten die Antriebe<br />
einen Sensor zur Messung von Vibrationen<br />
auf der Armatur. Eine Diagnosesoftware<br />
gibt eine Meldung aus, wenn diese<br />
Schwingungen den zulässigen Grenzwert<br />
des Antriebs überschreiten. Damit besteht<br />
die Möglichkeit, Geräteausfällen rechtzeitig<br />
vorzubeugen. Bei der Klassifizierung der<br />
Diagnosemeldungen orientiert sich AUMA<br />
so weit als möglich an vorhandenen Standards.<br />
Alle Diagnosemeldungen sind nach<br />
der Namur Empfehlung NE 107 kategorisiert.<br />
Ein wichtiges Thema auf dem Achema-Messestand<br />
ist das Thema Funktionale<br />
Sicherheit – SIL. Mit einem neuen<br />
Elektronik-Modul sind die Stellantriebe<br />
SIL 3-fähig.<br />
Bild:<br />
Stellantriebe<br />
für Armaturen<br />
in<br />
allen Größen<br />
und<br />
Bauformen<br />
In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen<br />
viel in Korrosionsschutzmaßnahmen<br />
investiert. Eine zweischichtige<br />
Pulverbeschichtung der Gehäusebauteile<br />
sorgt für einen einzigartigen Schutz gegen<br />
Umwelteinflüsse. Der Schichtaufbau<br />
zeichnet sich durch hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit<br />
sowie hohe mechanische<br />
Widerstandskraft aus.<br />
AUMA hat den Anspruch, für jede Industriearmatur,<br />
die mit einem elektrischen<br />
Antrieb automatisiert werden soll, einen<br />
passenden Antrieb liefern zu können.<br />
Kontakt: AUMA Riester GmbH & Co. KG,<br />
Müllheim, Tel. +49 7631 8090, E-Mail:<br />
riester@auma.com, www.auma.com<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 8.0, Stand C 23<br />
Stenflex<br />
Hochflexibler und zweiwelliger<br />
Gummi-Kompensator Typ C-2<br />
Der STENFLEX- Gummi-Kompensator Typ<br />
C-2 ist ein hochflexibler, zweiwelliger Universal-Kompensator<br />
mit außen zwischen<br />
den Wellen liegendem Stabilisierungsring<br />
und hinterliegenden Anpressflanschen.<br />
Neben dem Standardprogramm sind Sonderbaulängen<br />
möglich. Er findet überall<br />
dort Anwendung, wo große axiale, laterale<br />
und angulare Bewegungen aufgenommen<br />
werden müssen, oder thermische und<br />
mechanische Spannungen in Rohrleitungen<br />
und deren Systemkomponenten wie<br />
z. B. Pumpen, Armaturen und Kondensatoren<br />
reduziert werden sollen.<br />
Für die Aufnahme überlagerter Bewegungen<br />
in Kühlwasserleitungen sowie die<br />
Aufnahme von Gebäudesetzungen und<br />
Montageungenauigkeiten ist der Typ C-2<br />
geradezu prädestiniert. Daher wird er auch<br />
überwiegend in der Energietechnik und im<br />
Anlagenbau eingesetzt. Verfügbar ist der<br />
Typ C-2 in den Nennweiten DN 300 bis<br />
DN 3600 sowie in den Gummi-Qualitäten<br />
EPDM, NBR und CIIR.<br />
Kontakt: STENFLEX® Rudolf Stender<br />
GmbH, Norderstedt, E-Mail: info@<br />
stenflex.com<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 8.0, Stand H 62<br />
5 / <strong>2012</strong> 353
<strong>ACHEMA</strong>-Produktvorschau <strong>2012</strong><br />
KSB Aktiengesellschaft<br />
Neue Absperrklappen für den<br />
Flüssiggastransport<br />
Als Ergänzung zu dem umfangreichen<br />
Klappenprogramm für den Flüssiggastransport<br />
stellt die KSB Aktiengesellschaft<br />
auf der diesjährigen Achema die<br />
neue Baureihe TRIODIS vor. Bei diesen<br />
Armaturen handelt es sich um wartungsfreie<br />
sogenannte „dreifach exzentrische“<br />
Absperrklappen. Sie sind für Betriebsdrücke<br />
bis zu 100 bar und für Medien ausgelegt,<br />
die je nach Beschaffenheit Temperaturen<br />
zwischen –250 und +200 °C haben.<br />
Dank ihrer besonderen Konstruktion<br />
weisen sie ein geringeres erforderliches<br />
Schließmoment als doppelt exzentrische<br />
Bauweisen auf und können so von kleineren<br />
Antrieben betätigt werden. Mit ihrer<br />
dreifach-exzentrischen Lagerung und ihren<br />
speziell geformten konischen Dichtflächen<br />
sind die Armaturen auch bei sehr<br />
hohen Differenzdrücken dicht. Die Abdichtung<br />
selbst kann von HELICOFLEX®-<br />
Dichtringen übernommen werden, die<br />
weltweit für ihre hohe Leistungsfähigkeit<br />
im Bereich der Tieftemperaturtechnik bekannt<br />
sind. Sie können sowohl von der Vorder-<br />
als auch von der Rückseite aus angeströmt<br />
werden.<br />
Die Absperrklappen benötigen keinen<br />
Endanschlag für die Schließ-Stellung,<br />
da ihr metallischer Sitz einen natürlichen<br />
Anschlag bildet. Das schützt den Sitz<br />
Foto: © KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal<br />
Bild 1: Absperrklappen der Baureihe<br />
TRIODIS in der Flanschversion mit hydraulischem<br />
Antrieb<br />
der Armatur für den Fall, dass der Antrieb<br />
falsch herum angesteuert würde. Die Welle<br />
selbst ist aus einem Stück gefertigt und<br />
wird von stark dimensionierten Gleitlagern<br />
in Position gehalten. So ist auch nach vielen<br />
Schaltspielen noch eine exakte Abdichtung<br />
in Durchflussrichtung gewährleistet.<br />
Eine zusätzliche Ausblassicherung verhindert<br />
im Havariefall den Austritt der Welle<br />
aus dem Gehäuse.<br />
Die TRIODIS gibt es mit Durchmessern<br />
von 200 bis 1200 mm. Die Edelstahlgehäuse<br />
sind mit Flanschen oder mit Anschweißenden<br />
lieferbar. Als bauliche Besonderheit<br />
gibt es noch eine sogenannte<br />
„Buttweld-Side-Entry“-Version. Diese<br />
verfügt über Schweißenden, mit denen die<br />
Armatur in die Rohrleitung eingeschweißt<br />
wird. Zu Wartungszwecken kann man die<br />
Innenteile aus dem Gehäuse herausziehen,<br />
ohne die ganze Absperrklappe ausbauen zu<br />
müssen. Ein Vorteil, der vor allem bei beengten<br />
Platzverhältnissen von großer Bedeutung<br />
ist.<br />
Die neue Baureihe ist so gebaut, dass<br />
sie auch im Brandfall dicht bleibt. Sie hat<br />
erfolgreich die „Fire-Safe-Tests“ nach den<br />
Standards des API (American Petroleum<br />
Institute) und des BS (British Standard)<br />
absolviert. Die Tests dieser Baureihe fanden<br />
auf dem eigens dafür gebauten Prüfstand<br />
der KSB-Gruppe im Forschungszentrum<br />
Gradignan, Frankreich, statt. Die Antriebsflansche<br />
und die Wellenenden erlauben<br />
den Aufbau manueller, pneumatischer<br />
und hydraulischer sowie elektrischer Antriebe,<br />
unabhängig von deren Hersteller.<br />
Heute sind etwa 60 % aller in der Welt eingesetzten<br />
Gas-Tanker und viele Verladeund<br />
Verarbeitungsterminals mit AMRI-Armaturen<br />
von KSB ausgestattet.<br />
Kontakt: KSB Aktiengesellschaft,<br />
Frankenthal, E-Mail: info@ksb.com<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 8.0, Stand H 14<br />
Bentley<br />
Softwarelösungen<br />
für Anlagenbauer<br />
und -betreiber<br />
Bentley Systems Inc., ein weltweit führender<br />
Anbieter umfassender Softwarelösungen<br />
für nachhaltige Infrastruktur, unterstützt<br />
die Anforderungen der Prozessindustrie<br />
mithilfe von Produkten für das<br />
Design, die Konstruktion und den Betrieb<br />
verfahrenstechnischer Anlagen. Bentley<br />
stellt auf der<br />
Achema die neuesten<br />
Produkte<br />
und Entwicklungen<br />
seiner Lösung<br />
für die Prozessindustrie<br />
aus.<br />
354 5 / <strong>2012</strong>
Im Einzelnen werden Bentley OpenPlant,<br />
AutoPLANT, Bent ley Raceway and Cable<br />
Management, ProjectWise, ConstructSim,<br />
Bentley Transmittal Services und AssetWise<br />
präsentiert.<br />
Bentley erfüllt die Anforderungen von<br />
Anlagenbetreibern und -bauunternehmen,<br />
indem es die Extraktion von Daten aus Vorgängerdatenquellen<br />
ermöglicht, Funktionen<br />
für 2D- und 3D-Design und -Modellierung<br />
bereitstellt, Bauingenieuren Vor-<br />
Ort-Modellansichten über iPad bietet und<br />
für eine präzise Rückführung der Modelldaten<br />
in die betrieblichen Systeme sorgt.<br />
Die Software optimiert sämtliche betriebliche<br />
Prozesse während der Lebenszyklen<br />
von Anlagen und Projekten. Anlagenbetreiber<br />
können mit Problemen im Hinblick<br />
auf Termine, Datenübergabe und Wartung<br />
konfrontiert werden, während sie gleichzeitig<br />
versuchen, Assets auf sichere Weise<br />
und optimalem Level zu betreiben.<br />
Die folgenden Produktaktualisierungen<br />
und Lösungen werden im Rahmen<br />
der Achema präsentiert und<br />
erörtert:<br />
Informationsmodellierung<br />
– die neuesten Tools für<br />
den Entwurf von Anlagen<br />
(OpenPlant und Auto-<br />
PLANT) in Zusammenwirkung<br />
mit ProjectWise und<br />
eB, einschließlich 2D- und<br />
3D-Workflows sowie<br />
Punktwolken,<br />
Integrierte Projekte –<br />
Vorstellung der jüngsten<br />
Entwicklungen für das<br />
Bauwesen mit neuen Versionen von<br />
ConstructSim, Integrated Structural<br />
Modeler, den neuen Bentley Transmittal<br />
Services sowie den neuesten<br />
Bent ley Apps für das iPad – Project-<br />
Wise Explorer für das iPad und Bentley<br />
Navigator für das iPad,<br />
Intelligente Infrastruktur – die neueste<br />
AssetWise Software zur Verwaltung<br />
der Lebenszyklusinformationen von<br />
Assets (eB, mobile Corrective Action<br />
App und Data Quality Services) sowie<br />
Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher<br />
Vorschriften, Erhöhen der<br />
Anlagensicherheit und Senkung der<br />
Betriebskosten.<br />
Kontakt: Bentley Systems Germany<br />
GmbH, Ismaning<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 9.2, Stand B 27<br />
4pipes<br />
Flexibel und hochbelastbar: Raci-Gleitkufen<br />
4 pipes liefert bewährte Zubehörprodukte<br />
für den Rohrleitungsbau. Dichtungen<br />
für Mauerdurchführungen, Korrosionsschutz-<br />
und Abdichtungssysteme gehören<br />
neben Flanschdichtungen und Flanschisolierungen<br />
sowie einer kompletten Palette<br />
an Rohrleitungszubehör zum Lieferprogramm.<br />
Für die renommierten und hochwertigen<br />
Gleitkufen System raci hat die<br />
Firma die Vertretung in Deutschland.<br />
Die Raci-Gleitkufen ermöglichen eine<br />
komfortable Montage beim Einzug vom<br />
Mediumrohr in Mantelrohre.<br />
Die Gleitkufen<br />
werden ganz<br />
einfach ineinander<br />
gesteckt und mit<br />
Hilfe einer Zange, bei<br />
den großen Typen<br />
mit einem speziellen<br />
Spannwerkzeug, in<br />
zwei bis drei Zügen<br />
dauerhaft verspannt<br />
– ohne mühsame,<br />
lang andauernde<br />
Verschraubungen.<br />
Die schraublose<br />
Steckverbindung ist<br />
besonders vorteilhaft<br />
bei Bündelung von mehreren Rohren.<br />
Die Flexibilität der Kufe ermöglicht extreme<br />
Biegungen. 4 pipes bietet die Berechnung<br />
für die optimalen Gleitkufen zur Bündelung<br />
oder eine individuelle Stahllösung.<br />
Durch die sieben Basis-Typen werden<br />
alle Rohrdurchmesser ab 38 bis 2500 mm<br />
flexibel abgedeckt. Die Raci-Gleitkufen<br />
sind hochbelastbar, aus hochwertigem<br />
Polyethylen hergestellt und ohne Verbindungsteile<br />
aus Metall – 100 % PE und<br />
100 % recycelbar. Der Verzicht auf metallische<br />
Verbindungsteile macht das Produkt<br />
auch im kathodisch geschützten Stahlrohrleitungsbau<br />
einsetzbar.<br />
Kontakt: 4 pipes GmbH, Nürnberg,<br />
E-Mail: info@4pipes.de, www.4pipes.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 355
<strong>ACHEMA</strong>-Produktvorschau <strong>2012</strong><br />
DuPont<br />
Korrosionsbeständige Fluorkunststoffe<br />
Bild: DuPont/Elaflex<br />
Auf der Achema <strong>2012</strong> zeigt DuPont Produkte<br />
zur Steigerung der Effizienz, Zuverlässigkeit<br />
und Sicherheit von Systemen in<br />
der chemischen Industrie. Dazu gehören<br />
DuPont Teflon® und DuPont Tefzel®<br />
Fluorkunststoffe, die eingesetzt werden,<br />
um Maschinen und Geräte gegen korrosionsbedingte<br />
Ausfälle zu schützen, Du-<br />
Pont Kalrez® Perfluorelastomer-Dichtungen<br />
für eine optimale Dichtwirkung<br />
unter Einwirkung aggressiver Chemikalien<br />
und hoher Temperaturen sowie die Familie<br />
der DuPont Vespel® Teile und Halbzeuge,<br />
die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in<br />
chemischen, petrochemischen und thermischen<br />
Prozessen widerstehen.<br />
Das korrosionsbedingte Versagen von<br />
Produktionssystemen in der chemischen<br />
Industrie kann Leckagen, Emissionen, verminderte<br />
Prozesseffizienz, erhöhte Kosten<br />
und Produktionsbeeinträchtigungen<br />
bewirken. Hier ermöglichen Komponenten<br />
aus Teflon® und Tefzel® Fluorkunststoffen<br />
mit ihrer Korrosionsbeständigkeit<br />
über einen breiten Temperaturbereich oft<br />
universellere und ökonomischere Lösungen<br />
als viele exotische Metalle und Legierungen.<br />
Fluorkunststoffe sind nicht spröde<br />
und beständig gegen Schlagbeanspruchung<br />
und Temperaturschocks. Ihr niedriger<br />
Reibwert unterstützt den leichtgängigen<br />
Lauf beweglicher Teile, z. B. in<br />
Kugel- oder Kegelventilen, während ihre<br />
inhärenten Antihafteigenschaften dem<br />
Aufbau von Ablagerungen entgegenwirken<br />
und das Reinigen erleichtern. Spezielle<br />
Fluorkunststofftypen von DuPont<br />
erfüllen die ATEX Richtlinien. Für technische<br />
Beschichtungen sind Teflon® Fluorkunststoffe<br />
sowohl als Pulver als auch in<br />
flüssiger Form verfügbar. Sie eignen sich<br />
für vielfältige Bauteilgrößen und -formen<br />
und bieten dabei über die inhärenten Antihafteigenschaften<br />
hinaus noch weitere<br />
Vorteile, beispielsweise als funktionale<br />
Oberflächenkomponente von leichtgängigen<br />
Kupplungen oder verschleißarmen<br />
Ventilen.<br />
Ein von DuPont während der Achema<br />
<strong>2012</strong> veranstaltetes Seminar mit dem Titel<br />
„Managing Corrosion with DuPont Teflon®<br />
Fluoropolymer Resins“ beschreibt die<br />
Vorteile des Korrosionsschutzes mit Teflon®<br />
Fluorkunststoffen und technischen<br />
Beschichtungen sowie von Tefzel® Fluorkunststoffen,<br />
wie eine verlängerte Lebensdauer<br />
für Maschinen und Geräte, weniger<br />
unplanmäßige Produktionsunterbrechungen<br />
und ein verringertes Risiko unkontrollierter<br />
Emissionen. Das Seminar<br />
findet am 19. Juni von 13:30 Uhr bis ca.<br />
18:00 Uhr im Raum Fantasie 2 des Frankfurter<br />
Kongress-Zentrums statt. Die Teilnahme<br />
ist kostenlos.<br />
Verringerte Systemkosten und<br />
höhere Zuverlässigkeit<br />
Kalrez® Perfluorelastomer-Dichtungen<br />
widerstehen über 1.800 unterschiedlichen<br />
Chemikalien und Temperaturen bis<br />
zu 327 °C. Ihre besonderen Eigenschaften<br />
helfen, die Dichtwirkung zu erhalten,<br />
Wartungs- und Betriebskosten zu reduzieren<br />
und die Sicherheit zu erhöhen. Zur<br />
Achema legt Du-<br />
Pont einen speziellen<br />
Fokus auf die<br />
Kalrez® Spectrum<br />
Produktfamilie für<br />
den zuverlässigen<br />
Langzeiteinsatz in<br />
hoch aggressiven<br />
chemischen Prozessen<br />
sowie in der<br />
Öl- und Gasförderung.<br />
Kalrez® Teile<br />
sind als Standard<br />
O-Ringe oder<br />
kundenspezifische<br />
Halbzeuge sowie<br />
auch in Form FDA-zugelassener Produkte<br />
für Anwendungen in der pharmazeutischen<br />
und biotechnologischen Industrie<br />
verfügbar.<br />
Vespel® Teile und Halbzeuge steigern<br />
die Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Effizienz<br />
von Maschinen und Geräten für chemische<br />
und thermische Prozesse. Sie verbinden<br />
eine extreme Beständigkeit von<br />
kryogenen Temperaturen bis zu kontinuierlich<br />
325 °C (kurzzeitig bis 550 °C) mit<br />
sehr hoher Verschleißfestigkeit, geringer<br />
Reibung und hoher chemischer Beständigkeit.<br />
Damit eignen sie sich für eine Vielzahl<br />
von Anwendungen wie Kolbenringe, Ventilsitze<br />
und -dichtungen, Lager und Flachdichtungen.<br />
Speziell in Zentrifugalpumpen<br />
können DuPont Vespel® CR-6100 Teile<br />
zu mehr Effizienz und Zuverlässigkeit beitragen.<br />
DuPont weiß durch Erfahrungen aus<br />
erster Hand, dass Systeme der chemischen<br />
und petrochemischen Industrie Schmierstoffe<br />
erfordern, die zu mehr Betriebssicherheit<br />
beitragen können. Krytox® Hochleistungsschmierstoffe<br />
bieten eine breite<br />
Auswahl speziell formulierter, nicht brennbarer<br />
und chemisch inerter Syntheseöle<br />
und Fette, die zum Erhalt der Betriebssicherheit<br />
in Systemen der chemischen<br />
und petrochemischen Industrie beitragen<br />
können, ohne Kompromisse hinsichtlich<br />
der Schmierwirkung zu erfordern. Sie<br />
wurden unter Einsatz spezieller Technologien<br />
auf die besonderen Anforderungen<br />
der chemischen Industrie abgestimmt, sind<br />
nicht toxisch, nicht reaktiv, nicht brennbar,<br />
nicht korrosiv und kompatibel mit den in<br />
Dichtungen, O-Ringen und Ventilen eingesetzten<br />
Polymeren. Sie bewahren ihre<br />
Schmierwirkung und eine gleichbleibende<br />
Viskosität über einen breiten Temperaturbereich<br />
in hoch korrosiven Umgebungen.<br />
Zu ihren Anwendungsmöglich keiten gehört<br />
das Schmieren von Ventilen, Lüftern,<br />
Pumpen, Rührern, Reaktoren, Zentrifugen<br />
und anderen Geräten.<br />
Kontakt: DuPont de Nemours (Deutschland)<br />
GmbH, Neu-Isenburg,<br />
E-Mail: horst-ulrich.reimer@dupont.com<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 9.0, Stand C 13<br />
356 5 / <strong>2012</strong>
Lösungen im Anlagenbau:<br />
NORMACONNECT® FGR Rohrkupplungen<br />
Die NORMACONNECT® FGR Rohrkupplung<br />
ist ein Verbindungselement, mit dem<br />
dick- und dünnwandige Kunststoff-, Metall-<br />
und Edelstahlrohre miteinander verbunden<br />
werden. Mit den unterschiedlichen<br />
Typenreihen Flex, Grip, Plast Grip, Combi<br />
Grip und Rep E werden verschiedenste<br />
Anforderungen, die bei der Verbindung<br />
von Rohren bzw. Rohrsystemen auftreten,<br />
erfüllt. So können Rohrendenabstände<br />
von bis zu 65 mm überwunden werden.<br />
Die Verbindungselemente tragen dazu<br />
bei, Montagezeiten und -kosten deutlich<br />
zu reduzieren, da zusätzliche Aufwendungen<br />
wie Verschweißen oder Verzinken<br />
entfallen. Anhand von drei Beispielen im<br />
Anlagenbau werden die Problemlösungseigenschaften<br />
von NORMACONNECT® dargestellt:<br />
Druckluftrohrleitung in einer<br />
Rauchgasreinigungsanlage<br />
Beim Einbau einer Druckluftrohrleitung,<br />
die zur Abreinigung von mechanischen Filtern<br />
benötigt wird, werden St-Rohre mit<br />
den Rohraußendurchmessern 60,3 mm<br />
bzw. 88,9 mm miteinander verbunden.<br />
Die Filter, die jeweils mit einem St-Rohr<br />
verbunden sind, sind in unregelmäßigen<br />
Abständen zu wechseln. Damit der Austausch<br />
der Filter einfach und schnell erfolgen<br />
kann, wird die Rohrkupplung NORMA-<br />
CONNECT® Typ Flex in der Werkstoffqualität<br />
W2 mit EPDM-Dichtung verbaut.<br />
Diese gleicht die Rohrendenabstände und<br />
Auswinkelungen aus, ohne die Funktionsfähigkeit<br />
der Reinigungsanlage zu beeinträchtigen.<br />
Die einfache Handhabung ermöglicht<br />
eine deutlich kürzere Montagezeit.<br />
Zudem werden die durch Wartung<br />
verursachten Stillstandzeiten deutlich reduziert.<br />
Als positiver Nebeneffekt werden<br />
die starken Vibrationen, die bei der Abreinigung<br />
der mechanischen Filter entstehen,<br />
entscheidend gedämpft.<br />
Druckluftrohrleitung eines<br />
Belebungs beckens in einer Kläranlage<br />
Bei der Erweiterung einer Kläranlage werden<br />
für die Druckluftleitung eines Belebungsbeckens<br />
St-Rohre und Edelstahlrohre<br />
mit den Rohraußendurchmessern<br />
von 76,1 mm miteinander verbunden. Da<br />
die horizontal verlaufende Rohrleitung keine<br />
großen Verlegetoleranzen erlaubt, sind<br />
die Differenzen, die beim Ablängen der<br />
Rohre entstehen, auszugleichen. Der Einsatz<br />
der Rohrkupplung NORMACONNECT®<br />
Typ Grip in der Werkstoffqualität W4 mit<br />
NBR-Dichtung und RA = 76,1 erlaubt einen<br />
Rohrendenabstand von bis zu 25 Millimetern,<br />
so dass die entstandenen Rohrlängendifferenzen<br />
schnell und einfach ausgeglichen<br />
werden können. Die Montagezeit<br />
verkürzt sich um 80 % im Vergleich<br />
zur Flanschtechnik.<br />
Erweiterung einer Feuerschutzbzw.<br />
Trinkwasserleitung<br />
Bei der Erweiterung einer Feuerschutzbzw.<br />
Trinkwasserleitung werden verzinkte<br />
St-Rohre mit den Rohraußendurchmessern<br />
76,1 mm bzw. 114,0 mm miteinander verbunden.<br />
Durch den Einsatz der Rohrkupplung<br />
NORMACONNECT® Typ Grip in der<br />
Werkstoffqualität W4 mit EPDM-Dichtung<br />
können im Vergleich zur Flansch-/<br />
Schraubtechnik deutlich dünnwandigere<br />
Rohre verbaut werden. Dadurch entfallen<br />
Schweißarbeiten sowie zusätzlich erforderliche<br />
Verzinkarbeiten an den Schweißstellen.<br />
Für die Arbeiten muss der Betrieb<br />
nur kurz unterbrochen werden. Zudem<br />
verkürzen sich die Montagestunden.<br />
Kontakt: NORMA Group AG, Maintal,<br />
E-Mail: daphne.recker@normagroup.com,<br />
www.normagroup.com<br />
Bild: Anwendung der Rohrkupplung NORMCONNECT Typ Grip im Klärwerksbereich<br />
5 / <strong>2012</strong> 357
<strong>ACHEMA</strong>-Produktvorschau <strong>2012</strong><br />
Frank GmbH<br />
Rohr- und Formteile aus High-Tech<br />
Kunststoff<br />
Das Material ECTFE ist aufgrund seiner<br />
vielseitigen chemischen Widerstandsfähigkeit<br />
für eine Vielzahl von Anwendungen<br />
geeignet. Durch die hohe thermische Stabilität<br />
kommen ECTFE-Rohre und -Formteile<br />
sogar in der pharmazeutischen Industrie<br />
zum Einsatz, wo u. a. hoch agressive<br />
Medien bei Temperaturen bis über 100 °C<br />
transportiert werden. Auch für Reinstraumanwendungen<br />
ist ECTFE bestens geeignet:<br />
Die hohen Auslaugwerte des Materials<br />
beruhen auf einer speziellen chemischen<br />
Zusammensetzung, ohne zusätzliche<br />
Zuschlagstoffe wie Aktivruß oder andere<br />
Pigmentstoffe zur UV-Stabilisierung.<br />
Außerdem präsentiert Frank Großformteile<br />
bis d2000 aus PP, produziert<br />
nach Kundenvorgaben. Aufgrund selbst<br />
produzierter Rohlinge aus Wickelrohr (PE<br />
oder PP, Sondermaterialien nach Rücksprache)<br />
kann eine große Bandbreite abgedeckt<br />
werden, z. B. Reduktionen, Festflansche,<br />
Flanschringe.<br />
Regelventile und Kugelhähne aus<br />
Kunststoff mit ATEX-Zulassung sind eine<br />
echte Alternative zu Edelstahlarmaturen.<br />
Sie zeichnen sich aus durch eine hohe<br />
chemische Widerstandsfähigkeit und sind<br />
selbst in explosionsgefährdeten Bereichen<br />
einsetzbar. Lieferbar sind sie in PVC, PP,<br />
PVDF sowie in PTFE mit ATEX (Richtlinie<br />
94/9/EG ).<br />
Für Schwebekörper-Durchflussmesser<br />
bietet der neue Z 60-Messwertsensor<br />
eine weitere verbesserte Skalierung.<br />
Neben dem analogen Ausgangssignal von<br />
4 bis 20 mA wird durch die vergossenen<br />
Anschlusskabel (optional) ein sicherer Betrieb<br />
bei aggressiven Umgebungsbedingungen<br />
gewährleistet.<br />
Perfekt Schweißen mit der SP110B:<br />
Die neue Schweißmaschine für wulstfreies<br />
Schweißen von Kunststoffrohrleitungen<br />
in der Pharmazeutischen, Halbleiter- und<br />
Lebensmittelindustrie. Bei diesem System<br />
wird eine Schweißung erzeugt, die innen<br />
und außen eine glatte Oberfläche aufweist.<br />
Die automatisch protokollierten Schweißaufzeichnungen<br />
können für die Validierung<br />
verwendet werden.<br />
Kontakt: Frank GmbH, Mörfelden-Walldorf,<br />
Tel. +49 6105 4085-0, E-Mail: info@<br />
frank-gmbh.de, www.frank-gmbh.de<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 8.0, Stand F 94<br />
ITandFactory<br />
Cadison: Anlagenplanungs-Werkzeug im<br />
Umbruch<br />
Weil Anlagen zum einen immer komplexer<br />
werden, zum anderen sich der globale<br />
Wettbewerb um Engineering-Aufträge<br />
verschärft, müssen Planer einen Spagat<br />
meistern: Die Kosten senken oder zumindest<br />
stabil halten, dabei aber die Produktivität<br />
erhöhen. Dazu ist mittelfristig ein<br />
Paradigmenwechsel im Engineering erforderlich,<br />
sagt Ketan Bakshi, CEO der indischen<br />
Neilsoft-Gruppe und Mehrheitsgesellschafter<br />
der ITandFactory GmbH:<br />
„Unser Fokus wird sich klar von der Engineering-Effizienz<br />
zur Anlagen-Effizienz<br />
wandeln, konkret: Der optimierte Energieund<br />
Wasser-Footprint wird im Mittelpunkt<br />
stehen. Dazu werden wir Werkzeuge anbieten,<br />
die den Planer<br />
bei dieser neuen<br />
Sichtweise unterstützen<br />
– beispielsweise<br />
Such-<br />
Assistenten, die den<br />
Planer beim Einkauf<br />
von Komponenten<br />
unterstützen. Wir<br />
werden auch verstärkt<br />
Cloud-Technologien<br />
nutzen, um<br />
die Zusammenarbeit<br />
in der gesamten<br />
Wertschöpfungskette<br />
zu optimieren.<br />
Bild: Die objektorientierten Engineering-Lösung Cadison verbessert<br />
die Produktivität des Planers<br />
Bild: ITandFactory GmbH, Bad Soden<br />
358 5 / <strong>2012</strong>
Nicht zuletzt brauchen wir smarte Werkzeuge,<br />
die den Planer beim Design einer<br />
Anlage wirklich unterstützen.“<br />
Wie solche Werkzeuge konkret aussehen,<br />
zeigt der IT-Spezialist auf der Achema.<br />
Im Mittelpunkt steht Cadison, die objektorientierte<br />
Engineering-Lösung für<br />
den Anlagenbau. Das Tool vereint den Engineering-Workflow<br />
(Angebotsplanung,<br />
Verfahrenstechnik, Aufstellungsplanung,<br />
Rohrleitungsplanung, Elektrotechnik, Instrumentierung<br />
etc.) und vermeidet Schnittstellen<br />
– das spart Zeit und Kosten und<br />
verbessert die Produktivität des Planers.<br />
Unter anderem wird die Citrix-Technologie<br />
für Cadison vorgestellt: Mit dieser Technologie<br />
ist zum Arbeiten mit rechenintensiver<br />
Grafik nicht unbedingt ein Grafikarbeitsplatz<br />
vor Ort notwendig. Ortsunabhängig<br />
kann der Planer selbst mit einem Laptop<br />
umfangreiche 3D-Zeichnungen bearbeiten.<br />
Aus Sicht des Anlagenplaners bzw. Betreibers<br />
bietet die zentrale Bereitstellung<br />
der virtuellen Desktops vor allem den Vorteil<br />
des schnelleren Know-how-Transfers:<br />
Nationale wie internationale Beteiligte an<br />
einem Projekt sind mit Citrix in der Lage,<br />
wesentlich enger und effizienter zusammenzuarbeiten.<br />
Kontakt: ITandFactory GmbH, Bad<br />
Soden, E-Mail: info@itandfactory.de<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 9.2, Stand B 37<br />
Fabreeka<br />
Schwingungs-Isolation für dynamische und<br />
thermische Rohrleitungssysteme<br />
Für Unternehmen der petro-chemischen<br />
Industrie, die Pipelines für den Gastransport<br />
nutzen, und für die Betreiber von<br />
Pipeline-Systemen stellen Ermüdungserscheinungen<br />
aufgrund von Schwingungen<br />
ein großes Problem dar. Übermäßige<br />
Vibrationen bilden eine große Gefahr für<br />
die Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der<br />
Gas-Verdichtung und in Pumpensysteme<br />
für Flüssigkeiten.<br />
Die Fabreeka® Elastomer-Gewebeplatte<br />
ist ein unter wissenschaftlichen<br />
Gesichtspunkten hergestelltes Material,<br />
das aus vielen Lagen eines dichtgewebten,<br />
zugfesten Textils besteht. Fabreeka®<br />
ist aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften<br />
besonders zur Reduzierung von<br />
Schocks, Schwingungen und Körperschall<br />
geeignet. Jede Gewebeeinlage ist mit einem<br />
speziellen Elastomer-Compound beschichtet,<br />
der gleichzeitig Pilz- und Schimmelbefall<br />
verhindert. Die Elastomer-Platten<br />
gibt es als Rohrhalterungseinlage, um<br />
den Kontakt zwischen Metall und Metall zu<br />
verhindern und wirkt gleichzeitig als wirksamer<br />
Vibrationsdämpfer. Die geringe Federkonstante<br />
und die große Hysterese (Interner<br />
Energieverlust) gibt der Rohrhalterung<br />
zugleich eine dynamische und strukturelle<br />
Stabilität. Die Fabreeka® Elastomer-<br />
Gewebeplatten werden bei Anwendungen<br />
mit mäßigem Wärmeaufkommen und/<br />
oder mit hoher pulsierender Resonanz als<br />
Dämmpolster zwischen Rohrleitung und<br />
Halterung eingesetzt (Temperaturbereich<br />
–55° bis +95°). Hergestellt werden die<br />
Elastomer-Gewebeplatten in Standarddicken<br />
von 1,6 mm bis 25,4 mm (nominell).<br />
Andere Dicken sind durch die Kombination<br />
der Standarddicken mittels Verkleben<br />
ebenfalls herstellbar.<br />
Hervorragende Dämpfung<br />
Die Elastomer-Gewebeplatten haben einen<br />
hohen Dämpfungswert (Dämpfungskonstante<br />
0.14). Das Verhältnis einander<br />
folgender Amplituden (von 2 : 1) übertrifft<br />
das von Naturgummi um das Vierund<br />
das von Stahl um das Hundertfache.<br />
Der Störungsabbau beträgt 0.69. Das hohe<br />
Dämpfungsvermögen von Fabreeka®<br />
Pads geht auf den großen Energieverlust<br />
(Hysterese) von 25 bis 45 % pro Schwingung<br />
zurück. Bei mittlerem Wärmeaufkommen<br />
und dort, wo das Rohrleitungssystem<br />
Spiel zur Expansion und Kontraktion<br />
benötigt, bieten die Fabreeka®-PTFE<br />
Pads alle Eigenschaften der Fabreeka®<br />
Elastomer-Gewebeplatten und zusätzlich<br />
eine PTFE-Unterlage. Der niedrige<br />
Gleitreibungsfaktor von nur μ = 0,3<br />
(PTFE gegen Stahl) ermöglicht eine Expansion<br />
der Rohrleitung.<br />
Kontakt: Fabreeka GmbH Deutschland,<br />
Büttelborn, E-Mail: info@fabreeka.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 359
<strong>ACHEMA</strong>-Produktvorschau <strong>2012</strong><br />
GF Piping Systems<br />
Doppelrohrsysteme mit neuem<br />
Membranventil<br />
Bild 1: CONTAIN-IT Plus Membranventil<br />
Bild 2: Innovative Lösung zur kompletten Trennung der<br />
Doppelrohrleitung<br />
Bei Industrieanlagen steht die Sicherheit<br />
gegenüber Personen und der Umwelt an<br />
vorderster Stelle. Das Doppelrohrsystem<br />
CONTAIN-IT Plus von Georg Fischer Piping<br />
Systems bietet hervorragende Testergebnisse.<br />
Die Innenleitung wird in einem ersten<br />
Schritt druckfest verbunden und ausgetestet.<br />
Erst danach wird in einem zweiten<br />
Schritt die Schutzleitung geschlossen.<br />
Diese einzigartige Verbindungstechnologie<br />
macht eine einfache und vertrauenswürdige<br />
Installation möglich.<br />
Bei den Doppelrohrarmaturen geht GF<br />
Piping Systems seit Jahren erfolgreiche<br />
neue Wege. Nach dem 2009 entwickelten<br />
CONTAIN-IT Plus<br />
Kugelhahn wurde jetzt<br />
das neue Membranventil<br />
der Fünfer-Serie<br />
entwickelt. Das Ziel<br />
der Entwicklung ist ein<br />
druckfestes Schutzgehäuse<br />
aus den Standardkomponenten<br />
einer<br />
größeren Dimension.<br />
Folgende Vorteile<br />
bietet das CONTAIN-IT<br />
Plus Membranventil.<br />
Alle Eigenschaften finden<br />
sich in der neuen<br />
innovativen Fünfer-Serie<br />
im Gehäuse. Die Doppelrohrarmatur<br />
kann mit<br />
Standardkomponenten<br />
dem Antrieb erweitert<br />
werden. Das Handrad ist<br />
abschließbar und schützt<br />
so vor ungewolltem Zugriff.<br />
Wird ein Zugang<br />
zum Membranventil benötigt,<br />
kann man dies mit<br />
dem Lösen der Gehäusemutter<br />
in einem Arbeitsschritt<br />
tun.<br />
Zu den Vorteilen des<br />
Schutzgehäuses kommen<br />
die Eigenschaften der neuen Fünfer-Serie<br />
in der Innenleitung, wie z.B.<br />
doppelter Durchfluss und geringer Wartungsaufwand<br />
durch das Voll-Kunststoffgehäuse.<br />
Im ersten Schritt sind die<br />
Dimensionen d20/50 bis d32/63 in den<br />
Materialien PP-H, PVC-U, PVC-C, PVDF<br />
und PE (PVC oder PP-H Gehäuse) verfügbar.<br />
Die Verkaufsfreigabe ist für September<br />
<strong>2012</strong> geplant.<br />
Kontakt: Georg Fischer GmbH,<br />
Albershausen, E-Mail: info.de.ps@<br />
georgfischer.com<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 8.0, Stand E 64<br />
CAD Schroer<br />
3D-Planung für Fabriken leicht gemacht<br />
In vielen komplexen Produktionslinien werden<br />
vertikale Freiräume während des Fertigungsprozesses<br />
effizient genutzt. Daher<br />
gewinnt die Kollisionskontrolle und die<br />
3D-Visualisierung in der Fabrikplanung immer<br />
mehr an Bedeutung. Ein 3D-Ansatz<br />
sorgt für bessere Projektkommunikation<br />
und einfache Erstellung von hochqualitativen<br />
Planungsdaten. Teure Fehler während<br />
der Montage werden verhindert. Trotzdem<br />
gilt 3D für viele immer noch als ein großer<br />
Schritt, sie befürchten eine hohe Komplexität<br />
oder eine aufwändige Implementierung.<br />
CAD Schroer erleichtert Kunden den<br />
Übergang von 2D zu 3D für Großplanungen.<br />
Die Software für die Fabrikplanung<br />
MPDS4 FACTORY LAYOUT ist auch für<br />
reine 2D-Anwender einfach zu erlernen.<br />
Vorhandene Zeichnungen können importiert<br />
und so schnell als Basis für 3D-Layouts,<br />
virtuelle Rundgänge und Visualisierungen<br />
genutzt werden. „Unser Starterpaket<br />
bringt ein Projekt in etwa 15 Tagen<br />
an den Start“, so Mark Simpson vom internationalen<br />
Anbieter von Engineering-<br />
Lösungen CAD Schroer. „Wir liefern alles<br />
für eine kontrollierte und hochqualitative<br />
Instandsetzung oder Anpassung einer<br />
Fabrik in einer 2D- oder 3D-Umgebung.<br />
Wir implementieren die Software normalerweise<br />
innerhalb eines Tages und sorgen<br />
dafür, dass Anwender innerhalb von 3 bis<br />
5 Tagen effektiv damit arbeiten können.<br />
360 5 / <strong>2012</strong>
Bild: MPDS4<br />
Starterpaket:<br />
Fabrikmodellierung,<br />
Implementierung<br />
und<br />
Schulung<br />
Auf Wunsch modellieren wir eine<br />
vorhandene Fabrik oder fügen eine<br />
neue Fertigungslinie in vorhandene<br />
Freiräume ein. Dabei findet<br />
gleichzeitig eine Qualitätskontrolle<br />
aller vom Kunden gelieferten 2D-<br />
Zeichnungen oder 3D-Daten statt.<br />
Wir liefern das komplette 3D-Modell<br />
der Fabrik, das dann vom Kunden<br />
zur schnellen Planung von Änderungen<br />
und 3D-Visualisierung genutzt wird.“<br />
Informationen zum Starterpaket<br />
für Fabrikprojekte mit CAD Schroer unter<br />
www.cad-schroer.de/Dienstleistung/<br />
Consulting/MPDS4Starterpaket/<br />
Kontakt: CAD Schroer, Moers,<br />
E-Mail: info@cad-schroer.com<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 9.2, Stand B 30<br />
VenturisIT<br />
Anlagenplanungs-Werkzeug von und für<br />
Ingenieure<br />
Bild: Tricad MS der VenturisIT bewährt sich in über 3.000<br />
Installationen weltweit<br />
Transparenz und Kommunikation innerhalb<br />
des Anlagenplanungs-Teams ist das A und<br />
O für den Projekterfolg. Kommunikations-<br />
Plattformen wie der vSP Navigator auf der<br />
Basis von Microsoft Sharepoint gewinnen<br />
deshalb an Bedeutung, vereinfachen sie<br />
doch die Zusammenarbeit in Projekten.<br />
Dies gilt insbesondere für dezentral organisierte<br />
Projekte. Jeder Mitarbeiter und<br />
Partner – unabhängig vom Standort seines<br />
Arbeitsplatzes – arbeitet immer auf dem<br />
aktuellen Stand. vSP Navigator erlaubt es,<br />
alle Dokumentenarten zu verwalten – ob<br />
in digitaler Form oder auf Papier und unabhängig<br />
davon, ob es sich um ein CAD-,<br />
Office- oder eMail-Format handelt.<br />
Wie der vSP Navigator den Betreiber<br />
auch bei der Verwaltung und Steuerung<br />
von Daten des Engineering-Planungswerkzeugs<br />
Tricad MS unterstützt, zeigen<br />
die IT-Spezialisten der VenturisIT auf der<br />
Achema <strong>2012</strong>. Ein besonderes Merkmal<br />
dieses Tools ist die Durchgängigkeit, beherrscht<br />
Tricad MS doch alle bei der Planung<br />
einer verfahrenstechnischen Anlage<br />
wichtigen Gewerke: Von der Aufstellungsplanung<br />
über die<br />
Fördertechnik und<br />
die Klima- und Lüftungstechnik<br />
bis hin<br />
zur Rohrleitungsplanung<br />
und dem Stahlbau<br />
arbeitet der Planer<br />
mit dem gleichen<br />
CAD-Werkzeug. Zudem<br />
können Rohrleitungsklassen<br />
der<br />
Kunden und Lieferantenkataloge<br />
eingespielt<br />
werden.<br />
Mit über 3.000<br />
Installationen weltweit<br />
ist die VenturisIT einer der führenden<br />
Lieferanten und Entwickler für IT-Komplettlösungen.<br />
Das 3D-Planungswerkzeug<br />
Tricad MS bewährt sich seit Jahren<br />
bereits bei der Muttergesellschaft Triplan<br />
AG, einem Engineering-Dienstleister mit<br />
rund 400 Mitarbeitern. Die Triplan-Ingenieure<br />
nutzen das Planungswerkzeug<br />
täglich auf über 70 Stationen, die Software-Entwickler<br />
haben so ein permanentes<br />
Feedback. Jede neue Version, jedes<br />
neue Release ist in der Praxis ausreichend<br />
vorgetestet. Resultat: Tricad MS<br />
steigert die Produktivität der Mitarbeiter,<br />
auch komplexe Projekte lassen sich<br />
rascher umsetzen.<br />
Kontakt: VenturisIT GmbH, Bad Soden,<br />
E-Mail: info@VenturisIT.de<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 9.2, Stand B28<br />
Bild: VenturisIT GmbH, Bad Soden<br />
5 / <strong>2012</strong> 361
<strong>ACHEMA</strong>-Produktvorschau <strong>2012</strong><br />
Armacell<br />
Tieftemperatur-Dämmsysteme für<br />
industrielle Prozessleitungen und Tanks<br />
Bild: Armacell<br />
Lagerung und Transport von Tieftemperaturmedien<br />
wie LNG, Methanol oder Äthylen<br />
erfordern hocheffiziente Dämmungen. Mit<br />
Armaflex Cryogenic Systems präsentiert<br />
Armacell jetzt als erster Anbieter speziell<br />
für Tiefkälte-Anwendungen entwickelte<br />
flexible Dämmsysteme. Die Mehrschichtsysteme<br />
gewährleisten eine hervorragende<br />
thermische Dämmung, verringern das<br />
Korrosionsrisiko unter der Dämmung (CUI)<br />
und erlauben erhebliche Kosteneinsparungen<br />
bei der Installation. Die Dämmsysteme<br />
sind zum Patent angemeldet.<br />
Armaflex Cryogenic Systems erfüllen<br />
erstmals mit nur einem Material die speziellen<br />
Anforderungen an Dämmungen im Tiefkältebereich,<br />
die bisher nur mit einer Kombination<br />
unterschiedlicher Materialien, wie<br />
beispielsweise Hartschäume mit separaten<br />
Dampfbremsen und Dehnfugen, erreicht<br />
werden konnten. Die neuen Tieftemperaturschäume<br />
besitzen eine niedrige Wärmeleitfähigkeit<br />
und bewahren ihre Flexibilität<br />
auch bei Tiefsttemperaturen. Diese Flexibilität<br />
gewährleistet, dass Schwingungen<br />
und Stoßbewegungen absorbiert und Rissbildung<br />
durch extreme Temperaturzyklen<br />
oder mechanische Belastungen von außen<br />
vermieden werden. Ein wesentlicher Vorteil<br />
der Armaflex Cryogenic Systems liegt<br />
darin, dass das System weder zusätzliche<br />
Dehnfugen noch Dampfbremsen benötigt.<br />
Eingebaute Dehnfuge und<br />
Dampfbremse<br />
Das auch bei Tiefkälte noch flexible System<br />
wirkt selbst als Dehn- bzw. Schrumpffuge.<br />
So wird die Leitung vor thermischer Spannung<br />
und Haarrissen geschützt. Bei herkömmlichen<br />
Systemen aus Hartschäumen<br />
werden Dehnfugen aus Glas- oder Mineralwolle<br />
eingesetzt. Das erhöht nicht<br />
nur die Installationskosten, sondern aufgrund<br />
der offenzelligen Materialstruktur<br />
der Dehnfugen steigt auch die Gefahr,<br />
dass Feuchtigkeit in das System eindringt<br />
und die Dämmwirkung wesentlich beeinträchtigt.<br />
Zudem benötigen Armaflex Cryogenic<br />
Systems keine zusätzlichen Dampfbremsen.<br />
Als geschlossenzelliges Material<br />
mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand<br />
besitzt Armaflex eine<br />
eingebaute Dampfbremse. Anders als bei<br />
herkömmlichen Systemen, bei denen jede<br />
Dämmschicht mit einer separaten Dampfbremse<br />
vor dem Eindringen von Feuchtigkeit<br />
geschützt werden muss, baut sich<br />
der Wasserdampfdiffusionswiderstand<br />
bei Armaflex über die gesamte Dämmschichtdicke<br />
auf. Das erhöht nicht nur die<br />
Sicherheit des Dämmsystems, sondern<br />
reduziert auch die Installationskosten erheblich,<br />
da auf die aufwändige Installation<br />
von Dampfbremsen mit Dichtmassen<br />
Bild 1: Armaflex<br />
Cryogenic<br />
Systems:<br />
Kosteneffektivität<br />
bei hoher<br />
Sicherheit<br />
und speziellen Klebebändern verzichtet<br />
werden kann.<br />
Anwendungsbereich<br />
Armaflex Cryogenic Systems können im<br />
Temperaturbereich von -200 bis +125 °C<br />
eingesetzt werden. Die innere Systemschicht<br />
aus Armaflex LTD ist ein speziell<br />
entwickeltes Dien-Terpolymer, das thermischen<br />
Spannungen vorbeugt. Die äußeren<br />
Schichten bestehen aus AF/Armaflex,<br />
dem weltweit führenden flexiblen Dämmmaterial,<br />
das Anlagenteile aufgrund seiner<br />
geschlossenen Mikrozellstruktur, seiner<br />
niedrigen Wärmeleit fähigkeit und seinem<br />
hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand<br />
langfristig sicher vor Durchfeuchtung und<br />
Energieverlusten schützt. Die Metallummantelung<br />
liefert eine hohe Beständigkeit<br />
bei mechanischer Belastung. Bei Anwendungstemperaturen<br />
unterhalb von<br />
-110 °C wird das System um die Armaflex<br />
LTD Anti-Abriebfolie ergänzt, die der untersten<br />
Dämmschicht nochmals eine höhere<br />
Festigkeit verleiht. Sollen die Kälterohrleitungen<br />
gleichzeitig akustisch gedämmt<br />
werden, empfiehlt sich der kombinierte<br />
Einsatz der Armacell Schalldämmstoffe<br />
ArmaSound Industrial Systems. Die<br />
Systeme sind aufeinander abgestimmt und<br />
erfüllen die thermisch-akustischen Anforderungen<br />
mit erheblich dünneren Dämmschichtdicken<br />
und geringerem Gewicht als<br />
herkömmliche Dämmsysteme.<br />
Aufgrund ihrer hohen Flexibilität lassen<br />
sich Armaflex Cryogenic Systems wesentlich<br />
einfacher und schneller verarbeiten<br />
als starre Materialien und passen sich<br />
selbst komple xen Anlagetei len sehr gut an.<br />
Armaflex Cryogenic Systems sind speziell<br />
für Anwendungen auf Rohrleitungen,<br />
Tanks und Produktionsanlagen der Öl-,<br />
Gas- und chemischen Industrie entwickelt<br />
worden. Sie eignen sich insbesondere<br />
auch zur Dämmung von Flüssiggas-<br />
(LNG)-Anlagen.<br />
Kontakt: Armacell GmbH, Münster,<br />
E-Mail: IMPS@armacell.com<br />
362 5 / <strong>2012</strong>
Victaulic<br />
Neue Rohrverbindungslösungen<br />
Victaulic-Systeme eignen sich hervorragend<br />
für die Energieindustrie, bei Anwendungen<br />
von Chemikalienzufuhrleitungen,<br />
Abwasseranlagen, Druckluft-,<br />
Brandschutz- und Kühlwasserleitungen.<br />
Einer der führenden Hersteller von mechanischen<br />
Rohrverbindungssystemen<br />
wird seine jüngsten genuteten Rohrverbindungen,<br />
Ventilstationen und Armaturen<br />
auf der POWER-GEN Europa <strong>2012</strong> in<br />
Köln (12.-14. Juni) vorstellen.<br />
Ausstellungs-Höhepunkte am Victaulic-Stand<br />
sind: das Advanced Grooved<br />
System (AGS), ein fortgeschrittenes genutetes<br />
Rohrsystem mit einem patentierten<br />
zweiteiligen Gehäuse und einer keilförmigen<br />
Nut, das Druckwerte von bis zu<br />
350 psi/2400 kPa sowie sehr hohe Einbaugeschwindigkeit<br />
und Zuverlässigkeit<br />
bietet, sowie die 152A Dehnungskupplung<br />
(250–760 mm / 10–30“) geeignet<br />
für Kohlenstaub und Kalkstein mit der Fähigkeit<br />
einer Biegung von 4° und Ausdehnung<br />
und Schrumpfung. Die einfache und<br />
schnelle Wartung des Typs 152A führt<br />
zu reduzierten Ausfallzeiten und erhöhter<br />
Produktivität bei Revisionsarbeiten.<br />
Ebenfalls präsentiert wird die<br />
Vic 300 MasterSeal Drosselklappe<br />
mit ihrem auffälligen<br />
innovativen Design<br />
aus einer versetzten<br />
Scheibe und einem<br />
zweiteiligen Schaft. Das<br />
Scheibendesign erhöht<br />
den Durchfluss, reduziert<br />
das Betriebsdrehmoment um<br />
bis zu 35 % und bietet eine 360º<br />
blasenfreie Dichtung bei vollem Auslegungsdruck<br />
von 300 psi in beiden Richtungen.<br />
Auch die Düsenkupplungen vom<br />
Typ 220 / Typ 221, die eine mechanische<br />
Verbindung für Sprühdüsen in Aluminium<br />
bzw. FK zur Verwendung in Reinigungsanlagen<br />
liefern, werden gezeigt. Ihr leichtes<br />
Gewicht und die Montage mit nur einem<br />
einzigen Bolzen erleichtert und beschleunigt<br />
die Installation im Vergleich zu traditionellen<br />
Flanschverbindungen, verhindert<br />
das übermäßige Anziehen und „Reißen“ der<br />
Düsen und gestattet die vollständige Ausrichtung<br />
der Düse über 360°. Schließlich<br />
wird das Vic-Press-System für Edelstahlrohre<br />
nach Aufstellung 10S des Typs 304<br />
und 316 ausgestellt. Es bietet eine schnelle,<br />
einfache, saubere und zuverlässige Verbindungsmethode<br />
für 15-50 mm (½-2“)<br />
Standard Edelstahlrohre.<br />
Kontakt: Victaulic, Weiterstadt,<br />
E-Mail: viceuro@victaulic.be<br />
POWER GEN: Stand 6G108<br />
Uresh AG<br />
Aseptischer Molch reinigt<br />
ressourcensparend<br />
Das innovative Molchsystem der Uresh<br />
AG aus dem schweizerischen Biel-Benken<br />
(BL) ist einfach aufgebaut und besteht im<br />
Wesentlichen aus aseptischen Formkörpern,<br />
den sogenannten Molchen, sowie<br />
Sende- und Empfangsstationen. Es kann<br />
problemlos in bestehende Anlagen integriert<br />
werden. Zur Reinigung werden die<br />
Molche mit Druckluft durch die Rohre gepresst<br />
und schieben dabei die Reststoffe<br />
vor sich her. Diese können gesammelt und<br />
wiederverwertet werden. Bei den heute<br />
üblichen Verfahren vermischen sich die<br />
Reststoffe mit der Reinigungslauge und<br />
müssen teuer entsorgt werden.<br />
Zur aseptischen Reinigung der Rohre<br />
werden in einem zweiten Durchgang minimale<br />
Mengen an Wasser und Reinigungsmittel<br />
eingesetzt, allerdings nur rund 10 %<br />
der Mengen, die für ein konventionelles<br />
Durchspülen<br />
benötigt werden.<br />
Entscheidend<br />
für ein optimales<br />
Reinigungsergebnis<br />
sind vielmehr<br />
die Geometrie<br />
und Oberfläche<br />
der Molche.<br />
Denn nur wenn<br />
die Geometrie<br />
stimmt und die<br />
Oberfläche sehr glatt ist, können die Molche<br />
sämtliche Produktreste vollständig von<br />
den Rohrwänden abstreifen. Saubere und<br />
keimfreie Rohre sind das Ergebnis.<br />
Ein interessantes Finanzierungskonzept<br />
der Uresh AG soll den Molchen nun<br />
den Weg in die Produktionshallen ebnen.<br />
Dank einem Shared Savings Agreement<br />
können die Molche auch investitionsfrei<br />
ihren Dienst antreten.<br />
Kontakt: Uresh AG, CH-Biel-Benken,<br />
E-Mail: info@uresh.ch<br />
<strong>ACHEMA</strong>: Halle 9.1, Stand D 48<br />
5 / <strong>2012</strong> 363
Faszination Technik
Den Durchblick<br />
behalten<br />
Rohrleitungsverläufe im Anlagenbau sind<br />
nicht immer trivial. Bei der Planung gilt es,<br />
die optimalen Verlege wege für die Produktenrohrleitungen<br />
zu finden. Trotz leistungsstarker<br />
CAD-Software für diesen Bereich ist hier<br />
fundiertes Fachwissen gefragt.
Interview<br />
„GFK-Wickelrohr – ein<br />
Multitalent“<br />
<strong>3R</strong>-Interview mit Mario Frieben, HOBAS-Produktmanager Industrie<br />
Die <strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong>, Weltleitmesse für Prozesstechnik und Anlagenbau, lädt vom 18. bis zum 22. Juni nach Frankfurt/<br />
Main. Erstmals als Aussteller auf dem Technologiegipfel in den Bereichen Chemische Technik, Umweltschutz und Biotechnologie<br />
vertreten ist in diesem Jahr die HOBAS Rohre GmbH. <strong>3R</strong> sprach mit Dipl.-Ing. Mario Frieben, HOBAS-<br />
Produktmanager Industrie.<br />
Herr Frieben, was erwarten Sie von der<br />
diesjährigen <strong>ACHEMA</strong>? Was war für Ihre Entscheidung<br />
ausschlaggebend, in diesem Jahr erstmals selbst dort<br />
auszustellen?<br />
Bild 1: Dipl.-Ing. Mario<br />
Frieben ist Produktmanager<br />
Industrie bei der<br />
HOBAS Rohre GmbH<br />
Frieben: HOBAS ist bereits seit den 1950er Jahren ein etablierter<br />
Lieferant von GFK-Rohrsystemen. Kontinuierliche Weiterentwicklung<br />
und Verbesserung unserer Produkte sorgen<br />
dafür, dass sie den höchsten und vielfältigsten Anforderungen<br />
gerecht werden. Wir bieten eine breite Palette an Anwendungen<br />
– von der industriellen GFK-Abwasserleitung bis hin zur<br />
Prozessleitung in der Industrie.<br />
Seit Ende 2009 haben wir unser Produktportfolio durch<br />
neue GFK-Produkte für den industriellen Anwendungszweck<br />
erweitert und bis heute permanent weiterentwickelt. Um den<br />
stets wachsenden Anforderungen im Chemie- und Anlagenbau<br />
gerecht zu werden, arbeiten wir gemeinsam mit Partnern<br />
aus der Industrie an der Weiterentwicklung von Produktlinien.<br />
Die Entwicklungen der letzten drei Jahre haben uns gezeigt,<br />
dass der eingeschlagene Weg der Richtige ist – und unsere<br />
Entscheidung bestärkt, an der <strong>ACHEMA</strong> teilzunehmen.<br />
Für uns ist die <strong>ACHEMA</strong> die Fachmesse, auf der innovative<br />
Systemlösungen aus dem Bereich der Rohrleitungstechnik<br />
vorgestellt und diskutiert werden. Als Systemanbieter für<br />
GFK-Rohrsysteme, Verbundwerkstoffe und Prozessbehälter<br />
erwarten wir ein interessiertes, breites und internationales<br />
Fachpublikum, das sich für umweltbewusste,<br />
flexible und durchdachte<br />
Fertigungsprozesse interessiert.<br />
Wir möchten Betreibern, Planungsbüros<br />
und Instandhaltungsabteilungen<br />
kundenspezifische Lösungen abseits von Standardprodukten<br />
anbieten. Meiner Meinung nach ist es wichtig, auf einem<br />
solchen Technologiegipfel nicht nur auf standardisierte<br />
Systeme zu setzen, sondern auch individuelle Lösungsvarianten<br />
in vielen Anwendungsgebieten – z. B. der Prozesschemie<br />
oder der Kraftwerkstechnologie – zu zeigen.<br />
Wie präsentieren Sie sich in Frankfurt? Welche<br />
Produkte stellen Sie vor?<br />
Frieben: Aufgrund der Fokussierung der <strong>ACHEMA</strong> auf den<br />
industriellen Bereich und des entsprechenden Fachpublikums<br />
stellen wir natürlich unsere Industrie-Produktlinie in den Vordergrund.<br />
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Kühlwasserleitungen<br />
für Kraftwerke, Prozessleitungen in der Chlorherstellung<br />
sowie Spezialbauteile wie Behälter und Apparate<br />
in den verschiedenen Ausführungen. Detailliert zeigen wir ein<br />
breites Spektrum: von geschleuderten GFK-Vortriebsrohren<br />
über gewickelte GFK-Rohre mit verschiedenen thermoplastischen<br />
Inlinern bis hin zu losen GFK-Flanschen und Bunden,<br />
die im SMC-Verfahren hergestellt werden.<br />
Als Systemlieferant ist Service für uns sehr wichtig. Von<br />
der Projektplanung bis zum Abschluss stehen unsere Experten<br />
dem Kunden und Partner zur Seite und sorgen dafür, dass jedes<br />
Projekt zur vollsten Zufriedenheit aller durchgeführt wird.<br />
Unser Liefer- und Leistungsumfang umfasst von der Projektplanung,<br />
über die Berechnung und konstruktive Gestaltung,<br />
bis hin zur Installation vor Ort alles, was im Industriebereich<br />
erforderlich ist, um Rohrleitungssysteme in höchster Qualität<br />
zu liefern. In unserem eigenen, nach internationalen Standards<br />
zertifizierten technischen Forschungszentrum werden<br />
unsere Produkte umfangreichen Test unterzogen und so die<br />
Normenkonformität geprüft.<br />
Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht für Ihre Kunden<br />
ebenfalls von großer Bedeutung?<br />
Frieben: Das Thema Umweltschutz wird immer wichtiger –<br />
und damit gewinnen bei uns und unseren Kunden Themen wie<br />
die CO 2<br />
-Bilanz unserer Produkte und Umweltmanagement-<br />
366 5 / <strong>2012</strong>
Bild 2: Kühlwasserleitungen in der Versorgungszentrale des internationalen<br />
Flughafens BBI<br />
Bild 3: Absorberbehälter für die Salzsäureregeneration<br />
normen an Bedeutung. Alle unsere Niederlassungen entsprechen<br />
den strengen Auflagen der ISO 14001 Norm. Zusätzlich<br />
hat sich die HOBAS Gruppe zum Ziel gesetzt, die Ökobilanz<br />
Jahr für Jahr zu verbessern. Unser strenges Umweltdenken<br />
zieht sich dabei durch den gesamten Produktlebenszyklus.<br />
Wir präsentieren uns somit als modernes und innovatives<br />
Unternehmen.<br />
Industriell genutzte Rohrsysteme, Behälter und<br />
Apparate müssen besondere Anforderungen erfüllen.<br />
Was zeichnet den Werkstoff GFK aus?<br />
Frieben: Aufgrund der ausgezeichneten Festigkeitseigenschaften<br />
von GFK und der hervorragenden Chemikalienbeständigkeit<br />
unserer Thermoplaste sind die Rohrsysteme ideal<br />
für all diejenigen Einsatzzwecke geeignet, bei denen Korrosion,<br />
Temperatur und Druck beherrscht werden müssen.<br />
HOBAS ist in der Lage, Rohrsysteme für unterirdische sowie<br />
für oberirdische Installationen zu liefern. Durch Anwendung<br />
verschiedener Fertigungsverfahren besitzen wir die Möglichkeit,<br />
unseren Kunden maßgeschneiderte Systemlösungen<br />
anzubieten. Somit wird unter Berücksichtigung aller technischen<br />
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte das für die Kundenanforderungen<br />
optimale GFK-Produkt konzipiert, gefertigt<br />
und geliefert.<br />
Außerdem zeichnet den Werkstoff GFK die hohe Steifigkeit<br />
und Druckfestigkeit bei geringen Gewichten und Wanddicken<br />
aus. Neben den strengen Sicherheitsfaktoren ist die<br />
sehr lange Lebensdauer je nach Betriebsbedingungen ein<br />
ausschlaggebendes Kriterium zur Wahl dieses Werkstoffes.<br />
Durch den speziellen Wandaufbau unserer GFK-Rohre werden<br />
nicht nur perfekte Maßgenauigkeit, sondern auch eine<br />
hohe statische Belastbarkeit, hoher Abriebwiderstand, hohe<br />
UV-Beständigkeit sowie Unempfindlichkeit gegen Frost und<br />
erhöhte Temperaturen erreicht.<br />
GFK-Rohre kommen im Abwasserbereich heute<br />
verstärkt zum Einsatz. Hier zeigen sich die Vorzüge und<br />
die Vielseitigkeit des Werkstoffs. Welche Perspektiven<br />
sehen Sie im Bereich des Anlagenbaus?<br />
Frieben: Durch flexible Fertigungsprozesse sowie durch die<br />
Verwendung unterschiedlicher Rohstoffe insbesondere im<br />
Bereich der Harze, Glasfasern und Thermoplaste kommt das<br />
GFK-Rohr bzw. GFK-Verbundrohr immer mehr in industriellen<br />
Anwendungen zum Tragen. Gerade aufgrund der bereits<br />
geschilderten technischen Eigenschaften sind GFK-Rohrsysteme<br />
aus bestimmten Bereichen der Chemie, des Kraftwerkbaus<br />
und des Anlagenbaus kaum wegzudenken. In den<br />
letzten Jahren haben die Anwendungen von GFK-Systemen<br />
enorm zugenommen. Viele Betreiber legen sehr hohen Wert<br />
darauf, dass ihre Anlagen störungsfrei über viele Jahre in Betrieb<br />
bleiben können. In diesen Fällen erweist sich die Wahl<br />
des GFK-Werkstoffs im Bereich von Prozessleitungen und<br />
Behältern immer als richtig. Insbesondere der Einsatz von<br />
GFK-Rohrleitungen in der Chlorherstellung hat in der letzten<br />
Zeit stark zugenommen. Um die hoch aggressiven Reaktionsprodukte<br />
der Elektrolyse, Chlor und Natronlauge, sicher<br />
zu transportieren und zu lagern, bedarf es chemiebeständiger<br />
Behälter, Apparate und Rohrleitungen, die auch den<br />
prozessbedingten Temperaturen und Drücken standhalten<br />
können. HOBAS kann mit seinem Verbundrohrsystem diese<br />
Anforderungen erfüllen und verfügt über langjährige Erfahrung<br />
auf dem Gebiet der Rohrleitungssysteme für Chloralkali-Elektrolyse<br />
Anlagen. Unsere Chemierohre, an die hohe<br />
Anforderungen in Bezug auf Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit<br />
gestellt werden, werden aus GFK mit thermoplastischem<br />
Inliner hergestellt.<br />
Die jüngste Herausforderung besteht in der Weiterentwicklung<br />
der Herstellung des Verbundes zwischen dem thermoplastischen<br />
Innenliner und dem GFK-Wickelrohr. Hierbei<br />
werden derzeit von uns verschiedene Technologien unter Berücksichtigung<br />
der Einsatzgebiete kritisch geprüft, beurteilt<br />
und so auch neue Anwendungsgebiete erschlossen.<br />
Herr Frieben, wir danken Ihnen für das Gespräch.<br />
5 / <strong>2012</strong> 367
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Beurteilung der Gefährdung<br />
von eingeerdeten<br />
Gashochdruckleitungen<br />
durch Erdbeben in deutschen<br />
Erdbebengebieten<br />
Von Christian Engel, Ulrich Marewski und Christoph Heep<br />
Da Erdbeben in Deutschland nur relativ selten und in geringer Intensität auftreten und bisher keine diesbezüglichen<br />
Schäden an Gashochdruckleitungen bekannt geworden sind, wurden in den relevanten Auslegungsvorschriften bisher<br />
keine Erdbebenlasten berücksichtigt.<br />
Bis zur Einführung der EUROCODE 8 gab es für Deutschland kein gültiges Normenwerk, welches direkten Bezug auf<br />
die Berechnung von Erdbebenlasten auf Gashochdruckleitungen nahm. Mit Einführung der im EUROCODE 8 vorgegeben<br />
Regelwerke EN 1998-1 und EN 1998-4 wird auch für eingeerdete Rohrleitungen eine Vorgehensweise für den<br />
rechnerischen Nachweis gegen Erdbebenlasten angegeben.<br />
Unter Hinzuziehung der in dem Regelwerk beschriebenen Vorgehensweise soll in der folgenden Ausarbeitung das Gefahrenpotenzial<br />
für eingeerdete Gashochdruckleitungen speziell für Gebiete der Bundesrepublik Deutschland abgeschätzt<br />
werden.<br />
Bild 1: Schematische Darstellung der Erdbeben zonen der<br />
Bundesrepublik Deutschland [5]<br />
Relevante Normen und Regelwerke<br />
Der EUROCODE 8 [1] soll für die Mitgliedsländer der EU<br />
als Mittel zum Nachweis der Übereinstimmung der Hochund<br />
Ingenieurbauten mit den wesentlichen Anforderungen<br />
der Richtlinie des europäischen Rates 89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie),<br />
besonders mit der wesentlichen Anforderung<br />
Nr. 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,<br />
dienen.<br />
Als Grundlage für den Erdbebennachweis von Gashochdruckleitungen<br />
sind DIN EN 1998-1 (2010) [2] und DIN EN<br />
1998-4 (2007) [3] für Silos, Tankbauwerke und Rohrleitungen<br />
zu betrachten. Demnach sind „Ingenieurbauten in Erdbebengebieten<br />
so auszulegen und zu errichten, dass diese im<br />
Falle des Bemessungserdbebens die Grenztragfähigkeit nicht<br />
überschritten wird und die geforderte Schadensbegrenzung<br />
gewährleistet ist“ [2].<br />
In DIN EN 1998-1 und DIN EN 1998-4, Anhang B sind<br />
Vorgaben für zulässige Grenzzustände (Fließgrenze, Bruchgrenze)<br />
sowie ein vereinfachter Berechnungsansatz enthalten,<br />
wobei auch insbesondere auf die Berechnung der Verformungen<br />
eingeerdeter Rohrleitungen durch Erdbebenwellen<br />
eingegangen wird. Dieser Ansatz liefert eine Abschätzung<br />
für den oberen Grenzwert der auftretenden Dehnungen in<br />
einer Rohrleitung.<br />
Die Festlegung des gebietsabhängigen Bemessungserdbebens<br />
wird durch nationale Normen geregelt. Für Deutschland<br />
wurde DIN 4149 (2005) [4] durch DIN EN 1998-1/<br />
NA [5] ersetzt. Dort sind die Erdbebenzonen 0-3 festge-<br />
368 5 / <strong>2012</strong>
Tabelle 1: Zuordnung von Intensitätsintervallen und Referenz-<br />
Spitzenwerte der Bodenbeschleunigung zu den Erbebenzonen [5]<br />
legt (Bild 1), wobei für die Erdbebenzonen 1-3 jeweils Referenz-Spitzenwerte<br />
der Bodenbeschleunigungen zugeordnet<br />
sind (Tabelle 1). Hierbei entspricht die Referenz- Spitzenbeschleunigung<br />
der jeweiligen Erdbebenzone der Wiederkehrperiode<br />
eines Erdbebens von 475 Jahren, die sich<br />
aus der 10%-igen Überschreitungswahrscheinlichkeit in 50<br />
Jahren ergibt.<br />
Die Erdbebenzone 0 ist gemäß DIN EN 1998-1/NA als<br />
Gebiet sehr geringer Seismizität definiert. Für Gebiete mit<br />
sehr geringer Seismizität sind keine rechnerischen Nachweise<br />
gemäß EN 1998 erforderlich (DIN EN 1998-1, Abs. 3.2.1<br />
„Erdbebenzonen“). Somit ist für den überwiegenden Anteil<br />
der Grundfläche Deutschlands - welche der Erdbebenzone<br />
0 zugeordnet ist – der rechnerische Nachweis entsprechend<br />
der DIN EN 1998-1 nicht erforderlich bzw. auch nicht<br />
vorgesehen.<br />
Neben den bei einem Erdbeben immer auftretenden Wellen,<br />
können auch Sekundärlasten wie Erdrutsche, Bodenverflüssigungen,<br />
Setzungen usw. die Folge sein, auf die hier nicht<br />
eingegangen wird, da deren Auftreten von lokalen Gegebenheiten<br />
abhängt und diese im Einzelfall zu bewerten sind.<br />
Vereinfachte Berechnung der Erdbebenlasten<br />
von eingeerdeten Rohrleitungen<br />
durch Erdbebenwellen<br />
Bei Hochbauten werden die durch Erdbeben verursachten,<br />
unterschiedlichen Wellenbewegungen über ein Fundament<br />
auf ein Bauwerk übertragen. Dabei werden eigenfrequenzabhängige<br />
Antwortschwingungen im Bauwerk ausgelöst, woraus<br />
Beanspruchungen im Bauteil resultieren.<br />
Bei eingeerdeten Rohrleitungen werden die Wellenbewegungen<br />
unmittelbar übertragen. Entscheidend für die Belastung<br />
von eingeerdeten Rohrleitungen ist damit die in DIN EN<br />
1998-1/NA; Tabelle NA.3 der jeweiligen Erdbebenzone zugeordnete<br />
Maximalbeschleunigung a gR<br />
[m/s²]. Für eine eingeerdete<br />
Rohrleitung ist allerdings neben der Stärke, die Form<br />
der Wellenbewegung und deren Ausbreitungsrichtung relevant.<br />
Unterschiedliche Wellenarten- und Ausbreitungsrichtungen,<br />
sowie die ebenfalls unterschiedlichen Ausrichtungen<br />
von Rohrleitungsverläufen, machen eine eindeutige Aussage<br />
über die Leitungsbelastung einer eingeerdeten Rohrleitung<br />
bei einer definierten Erdbebenintensität allerdings sehr<br />
schwierig.<br />
Unter der (konservativen) Voraussetzung, dass die Rohrleitung<br />
fest an den Boden angekoppelt ist, wird diese den<br />
durch ein Erdbeben ausgelösten Stauchungen und Streckungen<br />
unmittelbar folgen. Daher ist es eine praktikable Vorgehensweise,<br />
für die einzelnen Wellenarten konservativ die jeweils<br />
ungünstigste Wirkung auf die Rohrleitung zu betrachten.<br />
Infolge dieser vereinfachenden – jedoch konservativen –<br />
Annahme, kann die Berechnung auf eine axiale Richtung zum<br />
Rohr (Dehnungen und Stauchungen) und normale Richtung<br />
zum Rohr (Biegungen) reduziert werden.<br />
In DIN EN 1998-4; Anhang B wird auf der Grundlage der<br />
oben beschriebenen, konservativen Annahmen, ein Berechnungsansatz<br />
für die Erdbebenbelastung von eingeerdeten<br />
Rohrleitungen angegeben. Entsprechend diesem Ansatz wird<br />
die Bodenbewegung u(x,t) in Rohrlängsrichtung durch eine<br />
sinus-förmige Welle dargestellt.<br />
( ) = d⋅sin ⎡ω ( t − x / c)<br />
u x,t<br />
ε max<br />
=<br />
a ⋅d gR<br />
(5)<br />
c<br />
Nach DIN EN 1998-1 kann der Bemessungswert d [m] der<br />
maximalen Bodenverschiebung, unter Hinzuziehung des Bemessungswertes<br />
der Bodenbeschleunigung a gR<br />
[m/s²] und in<br />
Abhängigkeit von den Boden- und Baugrundeigenschaften,<br />
berechnet werden.<br />
Die hierfür erforderlichen Parameter können der Tabelle<br />
NA.4 der DIN EN 1998-1/NA entnommen werden (Ta-<br />
Untergrundverhältnisse<br />
⎣<br />
Dabei ist:<br />
d die Amplitude der Gesamtverschiebung<br />
c die auftretende Wellengeschwindigkeit<br />
⎤<br />
⎦<br />
Die Teilchenbewegung „x“ ist in der Längsrichtung der Rohrleitung<br />
(Kompressionswellen) und quer zur Rohrleitung<br />
(Scherwellen) anzunehmen.<br />
Die Teilchenbewegungen in Längsrichtung erzeugen Dehnungen<br />
(e) im Boden, die auf die Rohrleitung übertragen werden:<br />
ε = −( ωd / c)⋅cos ⎡ω ( t − x / c<br />
⎣ )<br />
⎤<br />
⎦<br />
(2)<br />
mit dem Maximalwert:<br />
S<br />
ε max<br />
= ω ⋅d / c (3)<br />
wobei:<br />
e · d der Spitzenwert der Bodengeschwindigkeit<br />
c die auftretende Wellengeschwindigkeit<br />
Der Zusammenhang zwischen dem Spitzenwert der Bodenbeschleunigung<br />
a gR<br />
und Bodenverschiebung d ist:<br />
a gR<br />
= ω 2 d oder ω = a gR<br />
/ d (4)<br />
Somit kann die Eigenkreisfrequenz e durch Einsetzen von (4)<br />
in Gleichung (3) eliminiert werden und es folgt die maximale<br />
Längsdehnung:<br />
T B<br />
s<br />
A-R 1,00 0,05 0,20 2,0<br />
B-R 1,25 0,05 0,25 2,0<br />
C-R 1,50 0,05 0,30 2,0<br />
B-T 1,00 0,1 0,03 2,0<br />
C-T 1,25 0,1 0,40 2,0<br />
C-S 0,75 0,1 0,5 2,0<br />
T C<br />
s<br />
(1)<br />
T D<br />
s<br />
5 / <strong>2012</strong> 369
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Tabelle 2: Werte der Parameter zur Beschreibung des elastischen<br />
horizontalen Antwortspektrums [5]<br />
Erdbebenzone Intensitätsintervall Referenz-Spitzenwert der<br />
Bodenbeschleunigung<br />
a gR<br />
m/s 2<br />
0 6 ≤ I < 6,5 –<br />
1 6,5 ≤ I < 7 0,4<br />
2 7 ≤ I < 7,5 0,6<br />
3 7,5 ≤ I 0,8<br />
belle 2). Die in dieser Tabelle ebenfalls zugeordneten Untergrundklassen<br />
der Erdbebenzonen können ebenfalls der<br />
DIN EN 1998-1/NA entnommen werden (Bild 2).<br />
Die Wellengeschwindigkeit „c“ ist abhängig von der Baugrundklasse<br />
und kann DIN EN 1998-1/NA; Kap. 3.1.2 entnommen<br />
werden. Die Bemessungswerte der Bodenbeschleunigung<br />
a gR<br />
[m/s²] sind ebenfalls in tabellarischer Form vorgegeben und<br />
hängen von der jeweiligen Erdbebenzone ab (siehe Tabelle 1).<br />
Zusätzlich ist nach DIN EN 1998-1/NA Tabelle NA.6 ein<br />
Bedeutungsbeiwert „g“, zur Berücksichtigung des Gefahrenpotenzials<br />
des Transportgutes vorgesehen (siehe auch [6]).<br />
Bild 2: Schematische Darstellung der geologischen Untergrundklassen<br />
in den Erdbebenzonen der Bundesrepublik<br />
Deutschland [5]<br />
Für die Bodenbewegung quer zur Leitung kann die Maximalkrümmung<br />
einer Leitung (c max<br />
) und die daraus resultierende<br />
Längsdehnung (e c,max<br />
) nach folgender Gleichung berechnet<br />
werden.<br />
χ max<br />
= a gR<br />
/ c 2 (6)<br />
Für die Längsbiegedehnung eines Rohres ergibt sich damit unter<br />
Verwendung des Rohraußendurchmessers D a<br />
:<br />
ε χ ,max<br />
= γ ⋅a gR<br />
⋅0,5⋅D a<br />
/ c 2 (7)<br />
Die resultierende Gesamtaxialdehnung ergibt sich damit aus<br />
einer Addition der Längsdehnung und der Krümmung des<br />
Rohres:<br />
ε ax,max<br />
= ε max<br />
⋅ε χ ,max (8)<br />
Grenzwertbetrachtung für eine<br />
eingeerdete Gashochdruckleitung<br />
In DIN EN 1998-1/NA werden in Abhängigkeit von den Baugrund-<br />
und Untergrundverhältnissen Schwingdauerbereiche<br />
(TB, TC, TD) (siehe Tabelle 2) für die bodenabhängigen Frequenzspektren<br />
angegeben.<br />
Die größten Erdbebenlasten für eine eingeerdete Gasleitung<br />
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland würden<br />
demnach in einem Gebiet der Erdbebenzone 3 mit der<br />
Untergrundklasse T und der Baugrundklasse C (stark bis völlig<br />
verwitterte Böden) vorliegen. In Deutschland sind diese<br />
ungünstigsten Bedingungen nur im Raum Aachen-Köln anzutreffen.<br />
Im Bereich Tübingen (Erdbebenzone 3 und Untergrundklasse<br />
R) sind die Untergrund- und Baugrundverhältnisse<br />
etwas günstiger.<br />
Damit ergibt sich für die maximale Längsdehnung bei ungünstigsten<br />
Bedingungen:<br />
ε χ ,max<br />
= γ0,135 ⋅a g<br />
⋅0,5⋅D % a<br />
/ c 2 = 0,003 %<br />
sowie für die Biegedehnung (z.B. DN 1000; D a<br />
= 1016 mm):<br />
ε χ ,max<br />
= γ ⋅a g<br />
⋅0,5⋅D a<br />
/ c 2 = 0,003 %<br />
Die Summe aus Biege- und Axialdehnung ist demnach:<br />
ε ax,max<br />
= ε max<br />
⋅ ε χ ,max<br />
= 0,138 %<br />
Die so abgeschätzten Dehnungen sind deutlich kleiner als die<br />
in DIN EN 1998-4; Kap. 6 angegebenen Grenzwerte:<br />
zulässige Zugdehnung 3 %<br />
zulässige Druckstauchung: min {1%; 20 t/R(%)}<br />
t = Wanddicke des Rohres<br />
R = Radius des Rohres<br />
Als das begrenzende Kriterium für eingeerdete Rohrleitungen<br />
ist in der Regel das zweite Kriterium (die Druckstauchung)<br />
anzusehen, welches das instabile Beulen dünnwandiger<br />
Rohrquerschnitte beschreibt.<br />
Unter der Annahme einer – bezüglich des Beulkriteriums<br />
– ungünstigen Konfiguration für Gashochdruckleitungen<br />
(L480.7, Rohr Ø 1016 x 10 mm) ergibt sich eine zulässige<br />
Druckstauchung von ca. 0,4 %, die somit etwa dreimal so<br />
groß ist, wie die errechnete Stauchung aus der Erdbebenlast.<br />
Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland würde die<br />
Grenzbelastbarkeit einer Gashochdruckleitung demnach auch<br />
unter der Annahme von sehr konservativen Randbedingungen<br />
nicht überschritten.<br />
370 5 / <strong>2012</strong>
Zusammenfassung<br />
Die Normenreihe DIN EN 1998 liefert die Grundlage für<br />
die Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben. Die für die<br />
Auslegung benötigten Randbedingungen werden in nationalen<br />
Anhängen beschrieben, wobei sich die Anwendung<br />
der Normenreihe (bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik<br />
Deutschland) auf die ausgewiesenen Erdbebenzonen<br />
1-3 beschränkt. Für den flächenmäßig überwiegenden<br />
Teil Deutschlands ist die Auslegung nach der Normenreihe<br />
DIN EN 1998 nicht erforderlich, da diese Flächen als Erdbebenzone<br />
0 (Gebiete mit sehr geringer Seimizität) ausgewiesen<br />
sind.<br />
In DIN EN 1998-1 und DIN EN 1998-4, Anhang B sind<br />
Vorgaben für zulässige Grenzzustände, sowie ein vereinfachter<br />
Berechnungsansatz hinsichtlich der Berechnung der<br />
Verformungen eingeerdeter Rohrleitungen bei dem Auftreten<br />
von Erdbebenwellen beschrieben. Dieser Ansatz liefert<br />
eine Abschätzung für den oberen Grenzwert der Dehnungen<br />
in der Rohrleitung.<br />
Unter Zugrundelegung der ungünstigsten Randbedingungen<br />
(größte anzunehmende Bodenbeschleunigungen,<br />
ungünstigste Baugrund- und Untergrundverhältnisse) ergeben<br />
sich Zusatzbeanspruchungen, die deutlich unter den<br />
in der Norm angegebenen Grenzwerten liegen. Damit wird<br />
der in der Norm geforderte Schadensbegrenzungszustand<br />
der die volle Integrität erfordert (Tragwerk und die zugehörigen<br />
spezifischen Elemente bleiben unter den seismischen<br />
Einwirkungen voll funktionsfähig und dicht), erfüllt.<br />
Die im Rahmen dieser Ausarbeitung vorgestellte Vorgehensweise<br />
beinhaltet vereinfachende Annahmen, die für<br />
geradlinig verlaufende, eingeerdete Rohrleitungen konservative<br />
Ergebnisse liefert. Für oberirdisch angeordnete Anlagenbauteile<br />
und/oder Leitungen innerhalb von Bauwerken.<br />
Konstruktionen und Armaturen müssen dem Einzelfall<br />
angepasste, gesonderte Betrachtungen angestellt werden.<br />
Neben der Schwingungseinwirkung eines Erdbebens<br />
können grundsätzlich auch sekundäre Einwirkungen (z.B.<br />
Verwerfungen, Geländebrüche, Bodenverflüssigungen) auftreten.<br />
Diese sind in Deutschland nur in Ausnahmefällen zu<br />
erwarten und müssten dann gegebenenfalls im Rahmen von<br />
Einzelgutachten beurteilt werden.<br />
Literatur<br />
[1] Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben<br />
[2] DIN EN 1998-1, Teil 1 „Grundlagen, Erdbebeneinwirkugen<br />
und Regeln für Hochbauten“; Deutsche Fassung EN 1998-<br />
1: 2004 + AC 2009<br />
[3] DIN EN 1998-4, Teil 4 „Silos Tankbauwerke und Rohrleitungen“;<br />
Deutsche Fassung EN 1998-4: 2006<br />
[4] DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen,<br />
Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“<br />
(2005-04)<br />
[5] DIN EN 1998-1/NA Nationaler Anhang – National festgelegte<br />
Parameter – Teil 1 „Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen<br />
und Regeln für Hochbau“ (2011-01)<br />
[6] CVI-Leitfaden: Der Lastfall Erdbeben im Anlagenbau ,Leitfaden<br />
zur Anwendung der DIN 4149:2005 auf Tragwerke<br />
und Komponenten in der chemischen Industrie, Frankfurt,<br />
Mai 2009<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Christian Engel<br />
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG,<br />
Essen<br />
Tel. +49-201-825-2677<br />
E-Mail: cengel@tuev-nord.de<br />
Dr.-Ing. Ulrich Marewski<br />
Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
Tel. +49-201-3642 18389<br />
E-Mail: ulrich.marewski@<br />
open-grid-europe.com<br />
Dipl.-Ing. Christoph Heep<br />
Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
Tel. +49-203-999 3192<br />
E-Mail: christoph.heep@<br />
open-grid-europe.com<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 371
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Korrosionsschutz durch speziell<br />
auf den Anwendungsbereich<br />
entwickelte Nachumhüllungen<br />
Von Alexander Fehr und Ralf Summ<br />
Bei der Produktauswahl eines geeigneten Nachumhüllungsmaterials darf man nie das Anforderungsprofil des zu<br />
umhüllenden Bereiches vernachlässigen. Denn neben den primären Korrosionsschutzfunktionen ergeben sich für<br />
Nachumhüllungen im Rohrleitungsbau noch eine Reihe weiterer Anforderungen an die Umhüllungssysteme. Hierfür<br />
wurden Schrumpfmaterialien entwickelt, die durch Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Trägermaterialien,<br />
Klebstoffe und Schrumpfraten genau auf die einzelnen Anwendungsbereiche abgestimmt sind. Geeignete Lösungen<br />
für Standard- und Sonderanwendungen werden in diesem Beitrag aufgezeigt.<br />
Passiver Korrosionsschutz<br />
Passiver Korrosionsschutz bedeutet, dass man nicht in die<br />
eigentlichen elektrochemischen Prozesse der Korrosion eingreift.<br />
Diesen Schutz erreicht man mittels einer geeigneten<br />
Umhüllung. Das zu schützende Objekt wird somit vor der korrosiven<br />
Umgebung abgekapselt. Um ihrer Funktion gerecht<br />
zu werden, muss die Umhüllung eine geringe Durchlässigkeit<br />
(Permeabilität) für Wasserdampf und insbesondere für<br />
Sauerstoff aufweisen. Idealerweise sollte die Diffusionsrate<br />
so gering sein, dass daraus ein maximaler Korrosionsabtrag<br />
< 10 µm/Jahr resultiert, was als technisch vernachlässigbar<br />
angesehen werden kann. Außerdem muss die Umhüllung einen<br />
hohen elektrischen Widerstand besitzen, um die Bildung<br />
galvanischer Elemente sowie das Fließen von Streuströmen<br />
zu verhindern.<br />
Heute werden Stahlrohre für die Verlegung in Böden größtenteils<br />
mit Polyethylen umhüllt. Polyethylen hat sich in der<br />
Praxis als ein mechanisch hoch belastbarer Korrosionsschutz<br />
bewährt. Steineindruck durch Bodenverdichtung oder Transportschäden<br />
können zum Großteil ausgeschlossen werden.<br />
Um einen durchgehend guten Korrosionsschutz gewährleisten<br />
zu können, wurde die zuständige Norm für Nachumhüllungssysteme<br />
DIN EN 12068 im September 1998 überarbeitet.<br />
Mit diesem Anforderungsprofil, dem die neue Generation<br />
von High-tech Nachumhüllungen gerecht wird, sind Unterflur<br />
verlegte Rohrleitungen vor Korrosion geschützt und eine optimale<br />
Systemintegration von Werksumhüllung, Nachumhüllungssystem<br />
und kathodischem Korrosionsschutz (zur Absicherung<br />
der Fehlerstellen) geschaffen.<br />
Nachumhüllungen aus optimierten<br />
HDPE-Schrumpfmaterialien<br />
Die moderneren Schrumpfmaterialien bestehen aus mit Klebstoff<br />
beschichtetem, molekularvernetztem Polyethylen mit<br />
eingefrorener Spannung (Formgedächtnis). Bei der Applikation<br />
wird das Polyethylen unter Wärmezufuhr weich. Aufgrund<br />
der dann wirksam werdenden inneren Spannung zieht<br />
sich das PE-Material zusammen und passt sich der Form des<br />
zu umhüllenden Rohres an. Bild 1 veranschaulicht den chemischen<br />
Prozess der Molekularvernetzung und das dreidimensionale<br />
Maschenwerk.<br />
Schrumpfprodukte stehen in verschiedenen Ausführungen<br />
zur Verfügung:<br />
Schläuche<br />
Manschetten<br />
Bänder<br />
Formteile<br />
Je nach Anforderung der zu schützenden Oberfläche gibt es<br />
eine Vielzahl von Möglichkeiten bei der Materialauswahl von<br />
Schrumpfprodukten. Die Produktpalette reicht von LDPE-<br />
Trägermaterialien (geringe Dichte) bis hin zu glasfaserverstärktem<br />
Polyethylen. Unterschiedlich eingestellte Klebstoffe<br />
sorgen für eine optimale Abstimmung auf die geforderten<br />
Kriterien.<br />
Anforderungen an das Trägermaterial<br />
Das molekular vernetzte Trägermaterial dient als mechanischer<br />
Schutz des Klebstoffes, dem eigentlichen Korrosionsschutz.<br />
Hier bieten Materialien aus HDPE (High-density Polyethylen)<br />
aufgrund der höheren Dichte gegenüber LDPE-Produkten<br />
(Low-density Polyethylen) einen besseren Eindruckwiderstand<br />
gegen Fremdeinwirkungen. Zudem ist HDPE resistenter<br />
gegen höhere Betriebstemperaturen. In Bereichen, in<br />
denen besonders hohe mechanische Belastungen auf die Umhüllung<br />
wirken, können heutzutage Hightech-GFK-Schrumpfmanschetten<br />
eingesetzt werden. Hier wird werkseitig ein<br />
Glasfasergewebe in das Trägermaterial einlaminiert. Die Kombination<br />
aus GFK-Trägermaterial, hartem Heißschmelzkleber<br />
und einer einfachen Applizierbarkeit verleiht dem Material ein<br />
anwenderfreundliches Spektrum für Bereiche mit erhöhten<br />
Anforderungen. Der Systemverbund bietet sowohl bei ho-<br />
372 5 / <strong>2012</strong>
hen Flächendrücken im Bereich von Rohrauflagern oder unter<br />
Rohrschellen als auch bei hohen Scher- und abrasiven Kräften<br />
einen hohen mechanischen und Korrosionsschutz.<br />
Korrosionsschutz durch gezielten<br />
Klebstoffeinsatz<br />
Die Klebstoff-Technologie ist maßgeblich für den Korrosionsschutz<br />
und somit für den Erhalt der Grundfunktionen verantwortlich.<br />
Die Bandbreite an Klebstoffen reicht von sehr viskoelastischen<br />
Klebstoffen bis hin zu „harten“ Schmelzklebstoffen.<br />
Die Variablen und Parameter bei der Herstellung einer<br />
Mixtur für einen Korrosionsschutz- oder Abdichtungsklebstoff<br />
sind der Erweichungspunkt, Klebrigkeit, Viskosität,<br />
Schäl- und Scherfestigkeiten und die Fließtemperaturen.<br />
Die „weicheren“ Klebstoffe (häufig auch Mastic-Klebstoffe<br />
genannt) basieren auf amorphen Thermoplasten, wie z.B. Butylkautschuk<br />
oder anderen synthetischen Kautschuken. Diese<br />
dauerelastischen Dichtungsklebstoffe zeichnen sich durch eine<br />
hohe Adhäsionskraft auf fast allen Oberflächen aus. Durch<br />
den Schrumpfvorgang wird der weiche Klebstoff in alle Unebenheiten<br />
und Hohlräume gepresst und dichtet das System<br />
hervorragend ab. Die hohe Viskoelastizität sorgt zudem für<br />
ein größeres Prozessfenster bei der Applikation der Materialien.<br />
Fehlertoleranzen in der Rohrvorbereitung oder bei der<br />
Montage können bis zu einem gewissen Maß durch den Dichtungskleber<br />
aufgefangen werden.<br />
Wie in Bild 2 zu sehen, resultiert aus der Kombination<br />
weicher Klebstoff und hohe Schrumpfkraft der sogenannte<br />
„Selbstheileffekt“. Hier dichtet der Klebstoff Beschädigungen<br />
des Trägermaterials ab.<br />
Dauerelastische Dichtungsklebstoffe gibt es in unterschiedlichen<br />
Einstellungen der Viskosität und den damit verbundenen<br />
Adhäsions-, Kohäsionsverhalten und der Eignung für unterschiedliche<br />
Dauerbetriebstemperaturen.<br />
Die harten Heißschmelzkleber erreichen eine höhere<br />
Schäl- und Scherfestigkeit gegenüber den weichen Klebstoffen<br />
– allerdings auf Kosten von Fließ- und Füllverhalten.<br />
Zur Lösung von projektbedingten Sonderbelastungen und<br />
zur Adhäsionssicherung (Haftbrücke) ist die Verwendung einer<br />
Epoxy-Grundierung möglich. Der Epoxy-Primer gewährleistet<br />
zusätzlich Resistenz gegen kathodische Unterwanderung<br />
und reduziert die geforderten Vorwärmtemperaturen<br />
für Heißschmelzkleber. Bei Anwendungen mit Heißschmelzklebern<br />
sind die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers<br />
unbedingt einzuhalten.<br />
Bild 1:<br />
Vernetzungsprozess<br />
Rohrvorbereitung und Applikation bei<br />
Nachumhüllungen<br />
Moderne Nachumhüllungssysteme weisen einen sehr guten<br />
Korrosionsschutz auf, wenn Sie ordnungsgemäß aufgebracht<br />
sind. Grundlage hierfür bietet der DVGW durch das Regelwerk<br />
GW 15. Es handelt sich dabei um eine praktische Ausbildung<br />
mit integrierter Prüfung für das Nachumhüllen von<br />
Rohren, Armaturen und Formteilen. Bei bestandener Prüfung<br />
wird der „Umhüllerpass“ ausgestellt. Allerdings ist diese<br />
Prüfungsbescheinigung auch nur eine flankierende Maß-<br />
Bild 2: Resultierender ‚Selbstheileffekt‘ durch die Eigenschaft<br />
des viskoelastischen Klebstoffes und HDPE Deckmaterials<br />
5 / <strong>2012</strong> 373
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
nahme, um die Umhüllungsqualität zu erhöhen. In der Praxis<br />
erschweren häufig die äußeren Bedingungen eine optimale<br />
Vorbereitung. Witterung, Platzverhältnisse und der Faktor<br />
Mensch können sich zu einer nicht optimalen Applikation<br />
des Produktes addieren und so zum Versagen der Nachumhüllung<br />
führen. Daher sollte man Materialien einsetzen mit<br />
einem möglichst großen Prozessfenster, um die Fehlerquote<br />
so klein wie möglich zu halten.<br />
Rohrvorbereitung allgemein<br />
Die zu umhüllende Fläche, einschließlich der angrenzenden<br />
Werksumhüllung, werden mit folgenden Kernpunkten<br />
nach DVGW-Merkblatt GW 15 vereinheitlicht: Die Oberfläche<br />
muss sauber (keine lose anhaftenden Partikel von Rost,<br />
Schmutz usw.), trocken und frei von Fremdmaterialien wie Öl,<br />
Fett und Trennmitteln sein. Die Werksumhüllung wird im Ins-<br />
tallationsbereich aufgeraut und die Kante der PE-Werksumhüllung<br />
mit einer Raspel auf ca. 30° oder kleiner angeschrägt.<br />
Applikation von Schrumpfmaterialien<br />
In der Regel brauchen Schrumpfmaterialien anders als Kaltband-Systeme<br />
keinen Voranstrich. Aufbringen und Trocknung<br />
des Haftvermittlers entfallen.<br />
Für die Montage von Schrumpfmaterialien kommt der<br />
Vorwärmung der zu umhüllenden Oberfläche eine besondere<br />
Bedeutung zu. Die erforderlichen Vorwärmtemperaturen<br />
hängen von den Schmelzpunkten der eingesetzten Klebstoffe<br />
ab. Daher ist es ratsam, Herstellerangaben zu beachten. Die<br />
Verarbeitung von Schrumpfmaterialien geschieht in der Regel<br />
mit einer weich eingestellten Propangasflamme. Das Material<br />
wird in Umfangsrichtung unter gleichmäßiger Bewegung erwärmt,<br />
bis die Schrumpftemperatur erreicht ist. Das Material<br />
Bild 3: Übersichtsbild<br />
Korrosionsschutzanwendungen<br />
374 5 / <strong>2012</strong>
eginnt zu schrumpfen und presst den aktivierten Klebstoff<br />
in alle Unebenheiten. Optisches Kennzeichen für eine ausreichende<br />
Verarbeitung ist eine faltenfreie Oberfläche und austretender<br />
Klebstoff in den Randbereichen.<br />
Anwendung von<br />
HDPE-Schrumpfprodukten<br />
Die HSP GmbH bietet für alle Belastungen aus Umwelt, Baustelle<br />
und Betrieb funktionstüchtige Produkte an, mit dem<br />
Ziel, den Anforderungen mit einer möglichst einfachen Montage<br />
gerecht zu werden. Dabei können Schrumpfmaterialien<br />
durch unterschiedliche Breiten, Größen oder Endlosware flexibel<br />
eingesetzt werden. Nachumhüllungsarbeiten splitten sich<br />
allerdings in zwei Obergruppen: den Standardanwendungen<br />
und den Sonderanwendungen.<br />
Kein Voranstrich bei Standardanwendungen<br />
Die Standardanwendungen reichen von Schweißnahtnachumhüllungen<br />
bis hin zu Nachumhüllungen von Aufschweiß-T-<br />
Stücken (siehe Bild 3). Die Anforderungen an die Nachumhüllungsmaterialien<br />
wie Eindruckwiderstand, Schälwiderstand<br />
usw. sind in der DIN EN 12068 festgehalten.<br />
Folgende Faktoren werden für einen sicheren und einfachen<br />
Korrosionsschutz zu Grunde gelegt:<br />
Je weniger Einzelkomponenten pro Applikation zu verarbeiten<br />
sind, desto einfacher gestaltet sich die Montage<br />
vor Ort.<br />
Je weniger manuelle Arbeit geleistet werden muss, desto<br />
weniger Fehler können gemacht werden.<br />
Je weniger unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen,<br />
desto weniger verwirrend für den Monteur (Verwechslung<br />
von den Systemkomponenten).<br />
Je montagetoleranter das System, desto sicherer der<br />
Korrosionsschutz.<br />
Allgemein lässt sich festhalten, dass bei den Standardanwendungen<br />
kein Voranstrich benötigt wird. Es werden häufig sehr<br />
viskoelastische Klebstoffe mit HDPE-Trägermaterialien eingesetzt.<br />
Die HDPE-Trägermaterialien sorgen für den hohen<br />
mechanischen Schutz des weichen Klebstoffes, der mit seiner<br />
hohen Klebkraft und Abdichteigenschaften für einen hervorragenden<br />
Korrosionsschutz sorgt.<br />
Die Standardanwendungen sollten Anwender mit<br />
GW 15 -Aus bildung vor keine Probleme stellen, da diese<br />
Produktlösungen sehr einfach zu verarbeiten sind und ein<br />
großes Prozessfenster bieten. Die Montageanleitungen der<br />
Hersteller dienen als zusätzliche Hilfestellung.<br />
Sonderanwendungen<br />
Im Rohrleitungsnetz treten Bereiche auf, die durch übliche<br />
Umhüllungen nicht ausreichend geschützt sind, da dort sehr<br />
hohe Anforderungen an die Funktion von Korrosionsschutzsystemen<br />
gestellt werden (Tabelle 1). Zu diesen Bereichen<br />
zählen z. B.:<br />
Erde/Luft-Bereich<br />
Rohrdurchführung<br />
Der Bereich unter Rohrschellen<br />
Tabelle 1: Anforderungsprofil an passive Korrosionsschutzsysteme<br />
mechanische<br />
Belastbarkeit<br />
UV-<br />
Beständigkeit<br />
Adhäsion<br />
Rohrlagerung<br />
Grabenlose Rohrverlegung<br />
Hier werden häufig Nachumhüllungssysteme appliziert, die<br />
gegen ihre Herstellerbestimmung eingesetzt werden. Zudem<br />
zeichnen sich beispielsweise außerhalb des Erdbodens veränderte<br />
Anforderungsprofile ab. Es entstehen andere Ansprüche<br />
an ein passives Korrosionsschutzsystem als bei den Standardanwendungen<br />
im erdverlegten Rohrleitungsbau. Belastungen<br />
wie UV-Einstrahlung, Witterung, höhere mechanische<br />
Beanspruchung sowie erhöhte Temperaturen erhöhen den<br />
Anspruch an Korrosionsschutzsysteme. Im Bereich von Rohrauflagern<br />
werden z. B. GFK-Schrumpfmaterialien verwendet,<br />
die für hohe Flächendrücke, UV-Einstrahlungen, Scherkräfte<br />
und extreme Witterungsbedingungen ausgelegt sind (Bild 4).<br />
Dichtigkeit<br />
Unterflur mittel n.r. mittel hoch<br />
Überflur gering hoch mittel hoch<br />
Erde-Luft-Bereich hoch hoch hoch hoch<br />
Unter Rohrschellen hoch mittel hoch hoch<br />
Überflurauflager hoch hoch hoch hoch<br />
Rohrdurchführungen hoch n.r. hoch hoch<br />
Grabenlose Rohrverlegung hoch n.r. hoch hoch<br />
Bild 4: DN 1000 GFK-Manschette (CLMP-F) im Überflur-Auflagerbereich<br />
5 / <strong>2012</strong> 375
Die Fachzeitschrift<br />
für Gasversorgung<br />
und Gaswirtschaft<br />
Sichern Sie sich regelmäßig diese führende Publikation.<br />
Lassen Sie sich Antworten geben auf alle Fragen zur<br />
Gewinnung, Erzeugung, Verteilung und Verwendung von<br />
Gas und Erdgas.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S -<br />
Recht und Steuern im Gas und Wasserfach.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Der harte Schmelzkleber nimmt die hohen axialen Belastungen<br />
auf. Zudem können die Heißschmelzkleber mit einem<br />
zusätzlichen Epoxydharz kombiniert werden. Bei der grabenlosen<br />
Rohrverlegung erhöht man dadurch die Adhäsionskraft<br />
gegen die extremen abrasiven Kräfte, die auf die Umhüllung<br />
wirken. Produktschulungen können die Monteure für die etwas<br />
erhöhten Applikationsanforderungen sensibilisieren.<br />
Fazit<br />
Die HSP-Produktpalette der passiven Korrosionsschutzsysteme<br />
ist optimal an die unterschiedlichen Einsatzgebiete<br />
und den damit verbundenen Anforderungen angepasst. Zudem<br />
wird versucht, die Fehlertoleranzen für den Anwender<br />
so groß wie möglich zu gestalten und so eine einfache Montage<br />
zu gewährleisten. In speziellen Fällen sind anzutreffende<br />
Baustellensituationen gesondert zu beachten. Durch die<br />
Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Systemkomponenten<br />
(Trägermaterial, Klebstoff und Schrumpfraten) bietet die<br />
Schrumpftechnik viele Anwendungsmöglichkeiten.<br />
Literatur<br />
[1] D. Trapmann: Nachumhüllen von erdverlegten Gas- und<br />
Wasserrohrleitungen. Essen Vulkan Verlag, 2.Auflage<br />
[2] R. Summ, A. Fehr: Passiver Korrosionsschutz an Rohrleitungen<br />
in Problembereichen, <strong>3R</strong>, Ausgabe Juni 2009<br />
[3] M. Peschka, R. Summ: Vergrößerung des Prozessfensters<br />
bei der Applikation von Nachumhüllungen im passiven<br />
Korrosionsschutz mit neuem Klebstoff, bbr, Ausgabe<br />
März 2001<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet-PC oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Autoren<br />
Dipl.-Ing. Alexander Fehr<br />
HSP-Vertrieb Ralf Summ, Castrop-<br />
Rauxel<br />
Tel. +49 2305-359980<br />
Mail: afehr@myhsp.de<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.gwf-gas-erdgas.de<br />
Dipl.-Wirt.-Ing. Ralf Summ<br />
HSP-Vertrieb Ralf Summ, Castrop-<br />
Rauxel<br />
Tel. +49 2305-359980<br />
Mail: rsumm@myhsp.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag<br />
www.gwf-gas-erdgas.de<br />
gwf Gas/Erdgas erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
376 5 / <strong>2012</strong>
Marktübersicht<br />
<strong>2012</strong><br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de
<strong>2012</strong><br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Absperrklappen<br />
Anbohrarmaturen<br />
Rohre<br />
PE 100-RC Rohre<br />
Schutzmantelrohre<br />
378 5 / <strong>2012</strong>
RohRe + Komponenten<br />
<strong>2012</strong><br />
Kunststoff<br />
Formstücke<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 379
<strong>2012</strong><br />
mAschInen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Berstlining<br />
Leckageortung<br />
380 5 / <strong>2012</strong>
KoRRosIonsschutZ<br />
<strong>2012</strong><br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
5 / <strong>2012</strong> 381
<strong>2012</strong><br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
382 5 / <strong>2012</strong>
KoRRosIonsschutZ<br />
<strong>2012</strong><br />
Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 383
<strong>2012</strong><br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
Marktübersicht<br />
Dienstleistungen<br />
Ingenieurdienstleistungen<br />
Sanierung<br />
sanierung<br />
Gewebeschlauchsanierung<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Institute<br />
384 5 / <strong>2012</strong>
InstItute + VeRBänDe<br />
<strong>2012</strong><br />
Verbände<br />
Marktübersicht<br />
5 / <strong>2012</strong> 385
<strong>2012</strong><br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
8-10 October <strong>2012</strong><br />
Abu Dhabi National Exhibition Centre, UAE<br />
www.powerandwaterme.com<br />
S u p p l y i n g d e m a n d<br />
G e n e r a t i n g b u s i n e s s<br />
GCC POWER AND WATER PROJECTS NOW WORTH US$ 31.9 BILLION<br />
Invest in your company’s future by confirming its part in the building of Abu Dhabi’s Vision 2030<br />
Confirm your participation: Tel: + 971 4 336 5161<br />
Including:<br />
Partner events:<br />
Email: pwme@informa.com<br />
Organised by:<br />
SECUREYOUR<br />
EXHIBITION<br />
SPACE TODAY<br />
386 5 / <strong>2012</strong>
Wissen für die praxis<br />
RSV-Regelwerk<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und<br />
-leitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2006, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen<br />
mit Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen<br />
durch Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und<br />
-kanälen mit vorgefertigten Rohren durch<br />
TIP-Verfahren<br />
2011, 29 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und<br />
-kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner<br />
(partielle Inliner)<br />
2009, 25 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und<br />
Kanälen durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen<br />
und -kanälen sowie Schachtbauwerken<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in Entwässerungssystemen – Reparatur/<br />
Renovierung (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlußleitungen mit vor Ort härtendem<br />
Schlauchlining<br />
2009, 24 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlußleitungen<br />
– Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Erneuerung von Entwässerungskanälen und Anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RSV Information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die<br />
Erhaltung und Erneuerung von Wasser-,<br />
Gas- und Abwasserleitungen<br />
2011, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Faxbestellschein an: 0201/82002-34<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
___ Ex. RSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Garantie: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen bei der Vulkan-Verlag GmbH, Postfach 10 39 62, 45039 Essen schriftlich widerrufen<br />
werden. Die rechtzeitige Absendung der Mitteilung genügt. Für die Auftragsabwicklung und die Pflege der Kommunikation werden Ihre<br />
persönlichen Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich per Post, Telefon, Telefax<br />
oder E-Mail über interessante Verlagsangebote informiert werde. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Einfluss von Rohrleitungsstützen<br />
auf die Schwingungssituation an<br />
Rohrleitungen<br />
Von Robert Missal<br />
Rohrleitungen werden in erster Linie dazu verwendet, um ein Medium von A nach B zu transportieren. Sie sind zwar in<br />
der Regel für die jeweilige Transportaufgabe durch eine geeignete Wahl des Materials, der Wandstärken, der Durchmesser<br />
und der Verbindungen angepasst worden, zählen aber dennoch zu den oftmals wenig beachteten Bauteilen im<br />
Anlagenbau. In vielen Anwendungsfällen ist dies auch durchaus gerechtfertigt, jedoch gibt es auch Anwendungsfälle,<br />
in denen der Rohrleitung eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Dies betrifft sowohl die Führung der<br />
Rohrleitung als auch insbesondere die Halterung der Rohrleitung, da diese Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die<br />
Schwingungssituation an einer Rohrleitung haben.<br />
Quelle: Wossog, G.: Handbuch Rohrleitungsbau; Essen, Vulkan-Verlag 1998<br />
Auswahl geeigneter<br />
Rohrleitungshalterungen<br />
Rohrleitungshalter haben die Aufgabe, die Rohrleitung zu lagern<br />
und zu führen. Sie stellen die Verbindung der Rohrleitung<br />
zum Baukörper her und übernehmen dabei folgende<br />
Aufgaben:<br />
Bild 1: Aufgaben von Rohrleitungshaltern<br />
Aufnahme der Gewichtslasten<br />
Aufnahme der thermischen Dehnungen<br />
Aufnahme der dynamischen Kräfte<br />
Aufnahme der Betriebskräfte aus anormalen Betriebsund<br />
Störfällen<br />
Lagerung der Rohrleitung<br />
Führung der Rohrleitung<br />
Vermeidung von ungewollten Zwängungen und dadurch<br />
bedingten Zusatzbelastungen auf die Rohrleitung.<br />
Sie müssen sowohl statische als auch dynamische Lasten aufnehmen<br />
und können wie in Bild 1 dargestellt unterteilt werden.<br />
Bei der Auswahl geeigneter Halterungen sind daher im<br />
Wesentlichen die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:<br />
statische Belastung (Gewichtskräfte)<br />
thermische Belastung (Kräfte aufgrund thermischer Dehnung)<br />
dynamische Belastung.<br />
Während die Ermittlung der statischen Belastung in vielen Fällen<br />
noch recht einfach ist, muss für die Ermittlung der thermischen<br />
Belastung einer Rohrleitung schon ein deutlich größerer<br />
Aufwand betrieben werden. Da aber mittlerweile viele<br />
Rohrleitungsberechnungsprogramme auch die thermische<br />
Ausdehnung der Rohrleitung berechnen können, kann mit diesen<br />
Hilfsmitteln auch die thermische Belastung von Rohrleitungshalterungen<br />
berechnet werden.<br />
Für die überschlägige Ermittlung der thermischen Ausdehnung<br />
von Rohrleitungen kann in erster Näherung mit einem<br />
Wärmeausdehnungskoeffizienten von 10 bis 20 · 10 -6 K -1<br />
gerechnet werden, wobei der niedrigere Wert für z. B. St35<br />
und der höhere Wert für hochlegierte Stähle, wie z. B. X8Cr-<br />
NiMoVNb1613, anzusetzen ist. Bei einer Länge von 100 m<br />
Rohrleitung und einer Temperaturdifferenz von 100 °C ergibt<br />
sich somit je nach Material der Rohrleitung eine thermisch<br />
bedingte Längenänderung von 100 bis 200 mm.<br />
Für die Berechnung der dynamischen Belastung ist die<br />
Kenntnis der dynamischen Kräfte erforderlich. Diese Kräfte<br />
388 5 / <strong>2012</strong>
Bild 2: Festpunktlager mit Anschweißnocken<br />
Quelle: Hesterberg<br />
Quelle: Hesterberg<br />
Bild 3: Führungslager und Festpunkt mit Klemmsystem<br />
Bild 4: Rohrleitungshalter mit Tellerfedern<br />
entstehen u. a. durch stochastische oder periodische Druckschwankungen<br />
in den Rohrleitungen und müssen von den Halterungen<br />
aufgenommen werden. Die Höhe der Druckschwankungen<br />
hängt nicht nur von den angeschlossenen Maschinen<br />
oder von dem Prozess sondern auch von der Rohrleitungsführung<br />
und den Einbauteilen in der Rohrleitung ab. So können z.<br />
B. durch akustische Resonanzen innerhalb des Rohrleitungssystems<br />
die von der Maschine erzeugten Druckpulsationen<br />
um ein Vielfaches verstärkt werden. Aus diesem Grund ist<br />
die Berechnung der Druckschwankungen oftmals sehr komplex<br />
und nur durch den Einsatz spezieller Rechenprogramme<br />
möglich.<br />
Bei Rohrleitungen, die sowohl thermisch als auch dynamisch<br />
belastet werden, kommt die Problematik hinzu, dass<br />
zur ungehinderten Aufnahme der Wärmedehnungen die Halterung<br />
als Loslager ausgeführt werden sollte, während aus<br />
der Berechnung der dynamischen Kräfte eine möglichst steife<br />
Halterung erforderlich ist.<br />
Darüber hinaus muss die Halterung so konzipiert sein,<br />
dass möglichst keine Wartung oder regelmäßige Kontrolle<br />
erforderlich ist, denn durch die massiven Personaleinsparungen<br />
bei den Anlagenbetreibern ist meist kein zur Durchführung<br />
derartiger Kontrollen geeignetes Personal mehr vor<br />
Ort.<br />
Unter Beachtung dieser Aspekte ist der Rohrleitungshalter<br />
ein recht komplexes Bauteil, welches möglichst optimal<br />
auf den jeweiligen Einsatzfall angepasst werden sollte.<br />
Beispiele für Standardhalter<br />
Zur Halterung von Rohrleitungen sind auf dem Markt viele<br />
standardisierte Halter verfügbar (Bild 2). Dem Geschick des<br />
Anlagenplaners und Rohrleitungsbauers bleibt es nun überlassen,<br />
aus den vielen verfügbaren Standardhalterungen die<br />
für den jeweiligen Einsatzfall optimalen Halterungen auszuwählen.<br />
Da neben dem Lager auch die Verbindung zwischen<br />
dem Lager und dem Baukörper entscheidend für die richtige<br />
Halterung der Rohrleitung ist, muss auch bei der Auswahl der<br />
Verbindung sehr sorgfältig vorgegangen werden. Zwar gibt es<br />
auch hier eine Vielzahl standardisierter Systeme (z. B. Bild 3),<br />
allerdings bestehen sehr große Unterschiede in den Steifigkeiten.<br />
Deshalb ist es ohne entsprechende Erfahrung schwierig,<br />
die geeignete Konstruktion auszuwählen.<br />
Rohrleitungshalter zur Aufnahme<br />
dynamischer Kräfte<br />
Die bisher betrachteten Halter können sowohl als Festlager als<br />
auch als Führungslager eingesetzt werden. Unter Verwendung<br />
von speziellen Gleitlagern können thermische Ausdehnungen<br />
der Rohrleitung aufgenommen und dennoch eine definierte<br />
Führung der Rohrleitung erzielt werden.<br />
Bei dynamisch z. B. durch Pulsationen oder Schwingungen<br />
belasteten Rohrleitungen kann grundsätzlich zur Aufnahme<br />
der dynamischen Kräfte ein Festlager verwendet werden.<br />
Allerdings muss in diesem Fall sichergestellt werden, dass<br />
5 / <strong>2012</strong> 389
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
die Rohrleitung bei thermischer Ausdehnung nicht unzulässig<br />
verspannt wird. Bei Haltern, die auf hohen Stützen oder<br />
Rohrbrücken montiert sind, ist es oft weniger problematisch,<br />
wenn Festlager verwendet werden, da die Wärmedehnung<br />
durch die Elastizität der Stützen aufgenommen werden kann.<br />
So halten sich die Zusatzkräfte in Grenzen. Sind die Festlager<br />
allerdings auf kurzen und / oder sehr steifen Stützen montiert,<br />
können die thermischen Dehnungen die Sicherheit der<br />
Rohrleitung gefährden. In einem derartigen Fall kann dann<br />
z. B. der Einsatz von Lagern geprüft werden, die mit Hilfe<br />
von Federelementen die Rohrleitung nur bis zu einer voreingestellten<br />
Maximalkraft halten (Bild 4).<br />
Für größere Verschiebungen werden darüber hinaus sogenannte<br />
Stoßbremsen eingebaut. Diese federbelasteten Halter<br />
sorgen dafür, dass bei größeren Auslenkungen eine Federkraft<br />
die Rohrleitung zusätzlich fixiert.<br />
Ein weiteres Bauteil, das bei Rohrleitungen zur Aufnahme<br />
dynamischer Belastungen eingesetzt wird, ist der Rohrleitungsdämpfer<br />
(Bild 5). Dieses Bauteil nimmt in der Regel<br />
keine statischen Kräfte auf, sondern wandelt die Bewegungsenergie<br />
der Rohrleitung durch die Bewegung eines Stempels<br />
in einem Dämpfungsmedium in Wärmeenergie um.<br />
Quelle: Gerb<br />
Bild 5: Aufbau eines Rohrleitungsdämpfers<br />
Fallbeispiel für eine richtig ausgelegte<br />
Rohrleitungshalterung<br />
Zur Veranschaulichung des Einflusses der Rohrleitungshalterung<br />
auf die Schwingungssituation sind nachfolgend einige<br />
Berechnungsergebnisse dargestellt. Das Beispiel beschreibt<br />
eine Rohrleitung an einem 2-stufigen Kolbenverdichter, wobei<br />
hier nur der Verlauf der Rohrleitung auf der Druckseite<br />
der 1. Stufe vom Verdichter bis zum Kühler und vom Kühler<br />
zurück zur Saugseite der 2. Verdichterstufe betrachtet<br />
wird (Bild 6).<br />
Für dieses Projekt wurden im Rahmen einer Pulsationsstudie<br />
die Druckpulsationen in den Rohrleitungen berechnet.<br />
Darauf aufbauend wurde die Reaktion der Rohrleitung<br />
berechnet (Bild 7).<br />
DN 150<br />
ca. 2 m<br />
Druckleitung<br />
1. Stufe<br />
Bild 6: Rohrleitungsverlauf der<br />
Druckleitung der 1. Stufe und der<br />
Saugleitung der 2. Stufe<br />
Saugleitung 2. Stufe<br />
390 5 / <strong>2012</strong>
Bild 7: Qualitative Verformung<br />
der Rohrleitung bei<br />
einer Frequenz von 5,5 Hz<br />
Bild 8: Erste<br />
Modifikation der<br />
Rohrleitungsstützen<br />
Da die Frequenz 5,5 Hz von dem Kolbenverdichter angeregt<br />
wird, war die in Bild 7 dargestellte Verformung der<br />
Rohrleitung so nicht akzeptabel. Die maximale Schwinggeschwindigkeit<br />
an der Rohrleitung wurde mit 150 mm/s RMS<br />
berechnet. Bild 7 zeigt, dass die große Bewegung der Rohrleitung<br />
auf die unzureichende Steifigkeit der Rohrleitungsstützen<br />
zurückzuführen ist. Zur Verbesserung der Schwingungssituation<br />
wurden daher verschiedene Modifikationen<br />
der Stützen berechnet. Im ersten Ansatz wurden die Stützen<br />
derart modifiziert, dass die Steifigkeit in x-Richtung wesentlich<br />
vergrößert wurde (Bild 8).<br />
Für diese Variante wurden an der Rohrleitung maximale<br />
Schwinggeschwindigkeiten von ca. 24 mm/s RMS berechnet.<br />
Obwohl dieser Vorschlag zu einer deutlichen Reduzierung der<br />
Schwinggeschwindigkeiten geführt hat, wurden vom Betreiber<br />
Bedenken hinsichtlich der massiven Stützen geäußert. Als<br />
Modifikation wurde eine Veränderung der Stützen vorgeschlagen,<br />
die nur eine geringfügige Versteifung in x-Richtung<br />
bewirkte (Bild 9). Dies führte dazu, dass die Eigenfrequenz<br />
in einen noch ungünstigeren Frequenzbereich verschoben<br />
wurde und die Schwingungen dadurch auf über 230 mm/s<br />
RMS angestiegen sind.<br />
5 / <strong>2012</strong> 391
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Als Kompromiss wurden dann die Stützen in den Ecken mit<br />
Diagonalstreben versteift, so dass in der Hauptbewegungsrichtung<br />
die Steifigkeit weiter vergrößert wurde (Bild 10).<br />
Durch diese geringfügige Modifikation der vom Kunden favorisierten<br />
Lösung wurden die berechneten Schwinggeschwindigkeiten<br />
auf nur noch 13 mm/s RMS gesenkt.<br />
Wie aus dem Beispiel zu erkennen ist, führen die dynamischen<br />
Kräfte, die aus den Druckpulsationen in den Rohrleitungen<br />
entstehen, aufgrund der zu weichen Rohrleitungsstützen<br />
zu erheblichen Rohrleitungsschwingungen. Die daraus resultierenden<br />
Spannungen von über 27 N/mm² p-p waren nicht<br />
akzeptabel, so dass verschiedene Modifikationen der Stützen<br />
geprüft wurden.<br />
Mit der letztlich favorisierten Stützenkonstruktion konnten<br />
die Schwingungen an den Rohrleitungen von 150 mm/s<br />
RMS auf 13 mm/s RMS verringert werden. Die Schwach-<br />
Bild 9: Zweite<br />
Modifikation der<br />
Rohrleitungsstützen<br />
Bild 10: Endgültige<br />
Modifikation der Rohrleitungsstützen<br />
392 5 / <strong>2012</strong>
Tabelle 1: Betriebszustände der Verdichteranlage<br />
stelle an der Halterung der Rohrleitung war nicht die Befestigung<br />
der Rohrleitung an dem Halter sondern die Steifigkeit der<br />
Rohrleitungsstützen. Ist an dieser Stelle die Steifigkeit nicht<br />
ausreichend, können die dynamischen Kräfte von immerhin<br />
1.200 N nicht aufgenommen werden und die Rohrleitung wird<br />
durch die hohen Schwinggeschwindigkeiten zu stark belastet.<br />
Zustand Volumenstrom [%]<br />
Frischgas<br />
Kreisgas<br />
Z1 100 100<br />
Z2 75 100<br />
Z3 50 100<br />
Z4 25 100<br />
Fallbeispiel für die Sanierung einer<br />
Rohrleitungshalterung<br />
In einer Raffinerie wurden vom Betriebspersonal subjektiv<br />
sehr hohe Rohrleitungsschwingungen beanstandet. Die Rohrleitung<br />
war auf der Druckseite eines 2-zylindrigen, 1-stufigen<br />
Kolbenverdichters montiert. Die beiden Zylinder waren doppeltwirkend<br />
zur Verdichtung von Frisch- und Kreisgas. Die<br />
Verdichterdrehzahl war fest und betrug 370 RPM.<br />
Obwohl der Verdichter Baujahr 1970 war, sind die Schwingungen<br />
erst Mitte 2008 beanstandet worden. Dass die Situation<br />
erst so spät bemängelt wurde, kann daran liegen, dass<br />
der Volumenstrom der Anlage mit Hilfe von Saugventilabhebung<br />
geregelt werden kann und die Schwingungssituation eine<br />
deutliche Abhängigkeit vom Betriebszustand aufweist. Die<br />
zugehörigen Betriebszustände sind Tabelle 1 zu entnemen.<br />
Wie aus Bild 11 zu erkennen ist, traten die hohen Rohrleitungsschwingungen<br />
nur bei den Betriebszuständen Z3 und Z4<br />
auf, wenn der Volumenstrom des Frischgasverdichters 50 %<br />
oder geringer war.<br />
Die Volumenstromregelung wurde mit Hilfe einer Saugventilabhebung<br />
realisiert, d. h. bei Volumenströmen ≤ 50 % ist<br />
ein Verdichtungsraum des Frischgaszylinders deaktiviert, da<br />
das Saugventil zwangsweise geöffnet bleibt. Als Konsequenz<br />
dieser Fahrweise ändert sich die Frequenz der Druckpulsationen<br />
im Medium, weil der Zylinder nur noch einfachwirkend<br />
statt doppeltwirkend arbeitet. Da die Rohrleitungsschwin-<br />
gungen von den Druckpulsationen angeregt werden, ändert<br />
sich damit auch die Frequenz der Rohrleitungsschwingungen.<br />
Erschwerend kam in diesem Fall hinzu, dass die Struktureigenfrequenz<br />
der Rohrleitung in dem Bereich mit den erhöhten<br />
Schwingungen bei ca. 6 Hz lag. Diese Frequenz entspricht<br />
der Pulsationsfrequenz des Zylinders in der einfachwirkenden<br />
Fahrweise.<br />
Die durch Anschlagversuche ermittelte Eigenfrequenz am<br />
Messpunkt S5_a lag bei ca. 6 Hz. Am Messpunkt S1_a war<br />
die Rohrleitung wesentlich steifer gehaltert, so dass hier die<br />
gemessene Eigenfrequenz bei ca. 11 Hz lag. Dies führte dazu,<br />
dass die Rohrleitungsschwingungen bei Volumenströmen<br />
≤ 50 % am Messpunkt S5_a deutlich höher waren als am<br />
Messpunkt S1_a (Bild 11).<br />
Als Minderungsmaßnahme wurde die Rohrleitungshalterung<br />
noch während der Messung mit Hilfe von Kanthölzern<br />
modifiziert (Bild 12), so dass insbesondere am Messpunkt<br />
S5_a in axialer Richtung eine wesentlich größere Steifigkeit<br />
vorhanden war. Die Eigenfrequenz der Struktur konnte mit<br />
Hilfe dieser provisorischen Fixierung von vorher 6 Hz auf ca.<br />
11,5 Hz verschoben werden. Mit Hilfe dieser provisorischen<br />
Fixierung war es möglich, die Auswirkung einer steiferen<br />
Rohrleitungshalterung auf die Schwingungssituation an der<br />
Rohrleitung noch während der Messung zu demonstrieren.<br />
Bild 13 zeigt, dass die Schwinggeschwindigkeit an der<br />
Rohrleitung durch die provisorische Fixierung auf Werte un-<br />
RMS-Werte der Schwinggeschwindigkeit bei<br />
unterschiedlichen Lastzuständen<br />
Schwinggeschwindigkeit [mm/s<br />
RMS]<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
S1_a<br />
S1_h<br />
S1_v<br />
S2_a<br />
S2_h<br />
S2_v<br />
S3_a<br />
S3_h<br />
S3_v<br />
S4_a<br />
S4_h<br />
S4_v<br />
Messpunkt<br />
Lastzustand<br />
Z1 Z2 Z3 Z4<br />
S5_a<br />
S5_h<br />
S5_v<br />
S6_a<br />
S6_v<br />
Bild 11: Effektivwerte der<br />
gemessenen Rohrleitungsschwingungen<br />
bei unterschiedlichen<br />
Betriebszuständen<br />
5 / <strong>2012</strong> 393
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Provisorische Fixierung der Rohrleitung<br />
Bild 12: Provisorische<br />
Fixierung der Rohrleitung<br />
Bild 13: Vergleich der<br />
Rohrleitungsschwingungen<br />
bei unterschiedlichen<br />
Betriebszuständen mit<br />
(Z...Fix) und ohne (Z...)<br />
provisorische Fixierung<br />
Schwinggeschwindigkeit [mm/s RMS]<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
S5_a S5_h S5_v S6_a S6_h<br />
Messpunkt<br />
Z1 Z1 Fix. Z2 Z2 Fix. Z3 Z3 Fix. Z4 Z4 Fix.<br />
ter 10 mm/s RMS reduziert werden konnte. Es wurde daher<br />
empfohlen, die Rohrleitung an dieser Stelle mit einem Halter<br />
zu versehen, der die Rohrleitung ausreichend fixiert.<br />
Auch in diesem Beispiel wird deutlich, wie stark die<br />
Schwingungssituation an der Rohrleitung von dem richtigen<br />
Halterungskonzept beeinflusst wird.<br />
Zusammenfassung<br />
Durch die Auswahl von Rohrleitungshaltern einschließlich der<br />
zugehörigen Rohrleitungsstützen wird die Schwingungssituation<br />
an den Rohrleitungen gravierend beeinflusst. Zur Vermeidung<br />
übermäßiger Rohrleitungsspannungen muss die jeweilige<br />
Belastung berücksichtigt werden. Bei kritischen Anwendungen<br />
können die Auswirkungen der Halter und Stützen<br />
auf die Schwingungssituation bereits in der Planungsphase<br />
berechnet und optimiert werden. Die tatsächliche Schwingungssituation<br />
sollte an diesen Rohrleitungen nach der Inbetriebnahme<br />
messtechnisch überprüft werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Robert Missal<br />
KÖTTER Consulting Engineers KG,<br />
Rheine<br />
Tel. +49 5971 9710-25<br />
E-Mail:<br />
Robert.Missal@koetter-consulting.com<br />
394 5 / <strong>2012</strong>
Aktuelle<br />
Neuerscheinung<br />
Dieses Buch<br />
richtet sich an alle<br />
Rohrleitungspraktiker!<br />
Zahlreiche Beispiele aus der täglichen Arbeitspraxis helfen Ingenieuren<br />
und Technikern bei der Lösung ihrer betrieblichen Aufgabenstellungen.<br />
Alltägliche Rohrleitungsprobleme vom Druckverlust bis zur<br />
Kavitation in Pumpen, Blenden oder Regelventilen werden detailliert<br />
beschrieben. Dabei wird auf ausschweifende, akademische Ausführungen<br />
verzichtet. Vielmehr werden konkrete Lösungsansätze aufgezeigt<br />
und insbesondere auf relevante Einfl ussgrößen hingewiesen.<br />
Der praxisorientierte Charakter des Buchs veranschaulicht, dass die<br />
pragmatische Wissensvermittlung anhand konkreter Problematiken<br />
aus der Arbeitspraxis effektiver ist, als viele Seiten rein theoretischer<br />
Ausführungen.<br />
Die Rohrleitungsfi bel basiert im Wesentlichen auf den Berufserfahrungen<br />
sowie den Erkenntnissen aus Diskussionen aus den Seminaren<br />
über die Rohrleitungsplanung, die der Autor im Haus der Technik in<br />
Essen gehalten hat.<br />
M. Nitsche<br />
1. Aufl age 2011, 265 Seiten, Broschur<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 201 / 820 02 - 34 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex.<br />
Rohrleitungs-Fibel für die tägliche Praxis<br />
1. Aufl age 2011 – ISBN: 978-3-8027-2762-7<br />
zum Preis von € 79,- (zzgl. Versand)<br />
Die bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift<br />
von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen.<br />
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
PARLFI2011
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Schwingungen von Rohrleitungen<br />
aktiv mindern<br />
Von J. Engelhardt<br />
Die Zunahme von Schwingungsproblemen an Rohrleitungen im Anlagenbau tragen dazu bei, dass an bestehenden<br />
Rohrleitungssystemen häufig Maßnahmen zur Schwingungsminderung ergriffen werden müssen. Die Verwendung<br />
aktiver Tilger ist hierbei ein vielversprechender Ansatz.<br />
Das Konzept eines aktiven Tilgers wird auf die Rohrleitung einer Industrieanlage angewandt, die prozessbedingt ein<br />
hohes Schwingungsniveau aufweist. Die Inbetriebnahme des aktiven Tilgers in der Industrieanlage wird durch eine<br />
vielkanalige Betriebsschwingungsmessung der Rohrleitung begleitet. Die Versuchsergebnisse werden mit und ohne<br />
aktiven Tilger, unter realen Betriebsbedingungen und bei voller Auslastung der Rohrleitung betrachtet. Eine breitbandige<br />
Schwingungsminderung ist zu beobachten, wobei spektrale Amplitudenreduktionen bis zu 60 % erreicht werden.<br />
Einleitung<br />
Schwingungsprobleme an Rohrleitungen im Anlagenbau haben<br />
in den vergangenen 30 Jahren zunehmend an Bedeutung<br />
gewonnen. Ursächlich für diese Tendenz sind im Wesentlichen<br />
die gestiegenen Anforderungen an Ausnutzung der Werkstoffe<br />
und Gesamtlebensdauer der Anlagen.<br />
Diese Umstände tragen dazu bei, dass an bestehenden<br />
Rohrleitungssystemen oftmals nachträglich Maßnahmen zur<br />
Schwingungsminderung ergriffen werden müssen. Konventionelle<br />
Ansätze zur Schwingungsminderung erzielen häufig<br />
nicht den gewünschten Erfolg oder erfordern einen starken<br />
Eingriff in das Rohrleitungssystem und sind mit einem hohen<br />
baulichen und finanziellen Aufwand verbunden. Als wirksame<br />
Alternative zu konventionellen Maßnahmen der Schwingungsminderung<br />
bietet sich die Anwendung aktiver Tilger an.<br />
Ein aktiver Tilger besteht aus einer Reaktionsmasse, die<br />
über einen Aktor an die Struktur gekoppelt ist. Parallel zur Reaktionsmasse<br />
ist eine Feder angeordnet. Es ist mindestens ein<br />
Sensor vorhanden, der die Strukturschwingungen bzw. deren<br />
Wirkung erfasst. Das Sensorsignal wird in einem Regler verarbeitet,<br />
der daraus ein Stellsignal generiert und dem Aktor zuführt.<br />
Der Aktor bewegt die Reaktionsmasse und es wird eine<br />
Kraft, proportional zur Beschleunigung der Reaktionsmasse,<br />
auf die Struktur ausgeübt, welche die vorhandenen Schwin-<br />
a) b)<br />
x-R ich tu n g<br />
y-R ich tu n g<br />
z-R ich tu n g<br />
|v| [mm/s]<br />
z<br />
y<br />
x<br />
0 10 20 30 40<br />
f [H z]<br />
Bild 1: a) Obere Umlenkung der Rohrleitung, b) Spektrum der Schwinggeschwindigkeiten<br />
396 5 / <strong>2012</strong>
oh n e Tilg er<br />
m it p assivem Tilg er (m T =500kg )<br />
m it aktivem Tilg er (m T =50kg )<br />
oh n e Tilg er<br />
m it p assivem Tilg er (m T =500kg )<br />
m it aktivem Tilg er (m T =50kg )<br />
|v x<br />
| [mm/s]<br />
|v y<br />
| [mm/s]<br />
0 10 20 30 40<br />
f [H z]<br />
0 10 20 30 40<br />
f [H z]<br />
Bild 2: Wirkungsvergleich per Simulation: Aktiver und passiver Tilger<br />
gungen reduziert. Aktive Tilger sind in der Lage, Schwingungen<br />
breitbandig zu reduzieren. Die Wirksamkeit eines aktiven<br />
Tilgers ist unabhängig vom gewählten Massenverhältnis zwischen<br />
Tilgermasse und mitschwingender Masse der Struktur;<br />
maßgeblich ist hier die darstellbare Aktorkraft.<br />
Der vorliegende Aufsatz beschreibt die Entwicklung und<br />
Inbetriebnahme eines aktiven Tilgers für die Rohrleitung einer<br />
Industrieanlage sowie die skalierbare Weiterentwicklung zu einer<br />
modularen Systemlösung mit breitem Anwendungsbereich.<br />
Beschreibung der Rohrleitung<br />
Die Rohrleitung befindet sich auf dem Gelände des Betreibers<br />
einer Industrieanlage. Die im Rohr laufende Strömung verursacht<br />
starke Schwingungsanregungen. Seitens des Anlagenbetreibers<br />
besteht großes Interesse, das Schwingungsniveau<br />
der Rohrleitung zu reduzieren, zum einen, um das Schadensrisiko<br />
zu mindern, und zum anderen, um eine Durchsatzsteigerung<br />
zu ermöglichen. Infolgedessen sind in der Vergangenheit<br />
verschiedene Maßnahmen zur Schwingungsminderung<br />
ergriffen worden, so z.B. die Installation von Viskodämpfern<br />
und das Verstimmen der Rohrleitung durch Anbringen von Zusatzmassen<br />
am Rohr, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Die<br />
Entwicklung eines aktiven Tilgers soll nun dazu beitragen, das<br />
Schwingungsniveau signifikant zu reduzieren.<br />
Die Höhe der gesamten Anlage beträgt mehrere Stockwerke.<br />
Die Anbindung der Rohrleitung an ein Gerüst erfolgt<br />
über Verbindungselemente, die teilweise wie eine starre<br />
Kopplung wirken, teilweise Feder- oder Dämpferwirkung<br />
ausüben. An dem begehbaren Gerüst sind zu dessen Versteifung<br />
mehrere Nachbesserungen vorgenommen worden.<br />
Die Schwingungsanregung erfolgt prozessbedingt im<br />
Wesentlichen durch das im ersten Rohrabschnitt aufsteigende<br />
Medium, welches am oberen Ende auf eine zweifache<br />
45°-Umlenkung trifft, siehe Bild 1a. An dieser Stelle nimmt<br />
das Schwingungsniveau seine größten Werte an. Messdaten<br />
einer Betriebsschwingungsmessung unter Volllast aus dem<br />
Jahre 2006 zeigen, dass die größten Schwingungsamplituden<br />
horizontal in Strömungsrichtung (x-Richtung) der Rohrleitung<br />
auftreten, siehe Bild 1b. Das Schwingungsniveau in<br />
vertikaler Richtung (z-Richtung) ist vergleichsweise gering.<br />
Es lässt sich feststellen, dass mit wachsendem Abstand zur<br />
Umlenkung eine deutliche Abnahme der Schwinggeschwindigkeiten<br />
einhergeht. Das Niveau am Rohr ist durchgehend<br />
größer als am Gerüst.<br />
Die Amplitudenspektren der gemessenen Schwinggeschwindigkeiten<br />
machen deutlich, dass sich der Frequenzinhalt<br />
der Schwinggeschwindigkeiten im Wesentlichen auf den<br />
Bereich bis 40 Hz beschränkt. Eine Anhäufung von Resonanzstellen<br />
ist im Bereich um 10 Hz gegeben. Hohe Schwingungsamplituden<br />
des Gerüstes am Ort der Umlenkung lassen die<br />
Verwendung von Viskodämpfern an dieser Stelle als wenig erfolgversprechend<br />
erscheinen, da diese nur bei nennenswerten<br />
Relativverschiebungen zwischen Rohr und Gerüst wirksam<br />
sind; diese Vorraussetzung ist hier nicht erfüllt, da Rohr<br />
und Gerüst annähernd gleichförmig schwingen.<br />
Simulation der Rohrleitung mit aktivem<br />
Tilger<br />
Für die konstruktive Umsetzung des aktiven Tilgers ist zunächst<br />
die Kenntnis der erforderlichen Aktorkräfte und Aktorwege<br />
nötig. Hierzu wird ein Gesamtsimulationsmodell, bestehend<br />
aus Rohrleitung mit Gerüst, aktivem Tilger und Regelung,<br />
erstellt.<br />
Hiermit kann die Wirkung des aktiven Tilgers simuliert sowie<br />
Auslegungsdaten für die Aktorik ermittelt werden. Betrachtet<br />
werden die Amplitudenspektren der Schwinggeschwindigkeiten<br />
am Ort des aktiven Tilgers und am Punkt<br />
des größten Schwingungsniveaus. Dieser befindet sich in der<br />
Mitte der oberen Umlenkung. Bild 2 vergleicht das Verhalten<br />
mit und ohne aktiven Tilger in x- und y-Richtung. Für die<br />
Amplitudenreduktion ergibt sich ein Wert von 69 % in x- bzw.<br />
65 % in y-Richtung.<br />
5 / <strong>2012</strong> 397
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Konstruktive Umsetzung des aktiven<br />
Tilgers<br />
Aktorauswahl<br />
Als Aktor wird ein Servotubemotor ausgewählt. Das Aktivteil<br />
dieses Linearmotors enthält Wicklungen sowie ein integriertes<br />
Positionsmesssystem, welches für die Antriebsregelung notwendig<br />
ist. Das Passivteil besteht aus einem Edelstahltubus<br />
bestückt mit Magneten aus seltenen Erden. Durch den rotati-<br />
a)<br />
Aktivteil<br />
Passivteil<br />
y<br />
Reaktionsmasse<br />
x<br />
Ständer<br />
Blattfeder<br />
Rahmen<br />
Linearführung<br />
b) c)<br />
Die Aktorstellgrößen der Simulation liefern eine Aussage<br />
über die erforderliche Aktorkraft und den Aktorweg.<br />
Zur vergleichenden Beurteilung der Wirkung eines passiven<br />
Tilgers an der Rohrleitung erfolgt die Auslegung eines solchen<br />
auf den Bereich um 10 Hz. Der passive Tilger wirkt in x- und<br />
y-Richtung, die Tilgermasse wird hier beispielhaft zu 500 kg<br />
gesetzt, was dem zehnfachen der Reaktionsmasse des aktiven<br />
Tilgers entspricht. Bild 2 vergleicht die Amplitudenreduktion<br />
durch den aktiven und den passiven Tilger. Es ist eine deutliche<br />
Schwingungsminderung mit passivem Tilger zu erkennen,<br />
jedoch bleibt diese hinter der des aktiven Tilgers zurück. Aufgrund<br />
der Breitbandigkeit des Schwingungsproblems ist der<br />
passive Tilger nicht in der Lage, alle Resonanzüberhöhungen<br />
im Bereich um 10 Hz gleichermaßen zu reduzieren. Dies wäre<br />
nur mit einer weiteren Erhöhung der Tilgermasse möglich. Der<br />
aktive Tilger zeigt hier den Vorteil seiner breitbandigen Wirkung,<br />
ohne das Erfordernis einer hohen Tilgermasse. Hierdurch<br />
bleibt die statische Zusatzlast, die durch die Schwingungsminderungsmaßnahme<br />
auf die Rohrleitung einwirkt, gering.<br />
Bild 3: Funktionsprinzip aktiver Tilger mit zwei Freiheitsgraden: a)<br />
Aufbau; b) Betrieb in x-Richtung; c) Betrieb in y-Richtung<br />
x<br />
z<br />
y<br />
a)<br />
b)<br />
steife Verbindung<br />
Aktivteil<br />
Linearlager<br />
c) d)<br />
Ständer<br />
Rahmen<br />
Passivteil<br />
Luftspalt<br />
Achse<br />
Blattfedern<br />
Bild 4: Konstruktion des aktiven Tilgers: a) Gesamtaufbau; b) Reaktionsmasse;<br />
c) Rahmenkonstruktion; d) Ständer<br />
Bild 5: Montage des aktiven Tilgers an der Rohrleitung<br />
(Darstellung ohne Einhausung)<br />
398 5 / <strong>2012</strong>
ohne aktiven Tilger<br />
m it aktivem Tilger<br />
ohne aktiven Tilger<br />
m it aktivem Tilger<br />
|v x<br />
| [mm/s]<br />
|v y<br />
| [mm/s]<br />
0 10 20 30 40<br />
f [H z]<br />
0 10 20 30 40<br />
f [H z]<br />
Bild 6: Amplitudenspektren der Schwinggeschwindigkeiten in der Mitte der Umlenkung<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
undeformiert<br />
ohne aktiven Tilger<br />
mit aktivem Tilger<br />
undeformiert<br />
ohne aktiven Tilger<br />
mit aktivem Tilger<br />
undeformiert<br />
ohne aktiven Tilger<br />
mit aktivem Tilger<br />
f = 9.2 [H z]<br />
f = 19.4 [H z]<br />
f = 26.0 [H z]<br />
Bild 7: Betriebsschwingungsformen<br />
mit und ohne aktiven Tilger (Darstellung<br />
überhöht)<br />
onssymmetrischen Aufbau ist das System frei von Querkräften.<br />
Der darstellbare Aktorweg ist durch entsprechende Wahl<br />
der Länge des Passivteils in weiten Bereichen frei wählbar.<br />
Um die Anforderungen an die Aktorkraft, die per Simulation<br />
ermittelt wurden, zu erfüllen, werden vier identische Servotubemotoren<br />
verwendet, wobei jeweils zwei parallel zueinander<br />
angeordnet sind.<br />
Konstruktives Konzept für den aktiven Tilger<br />
Es wird angestrebt, eine Beeinflussbarkeit aller Schwingungsformen,<br />
die in der Ebene senkrecht zur Rohrachse auftreten,<br />
zu erzielen. Hierzu erfolgt die Entwicklung eines aktiven<br />
Tilgers mit zwei Freiheitsgraden. Zur Gewichtsoptimierung<br />
bietet sich an, für die beiden Freiheitsgrade eine gemeinsame<br />
Reaktionsmasse zu verwenden. Bild 3 zeigt das Funktionsprinzip<br />
des aktiven Tilgers mit zwei Freiheitsgraden. Die<br />
Aktivteile der Aktoren sind durch eine ringförmige Verbindung<br />
miteinander gekoppelt und bilden so die Reaktionsmasse.<br />
Die vier Aktoren sind jeweils in einer Rahmenkonstruktion<br />
geführt, welche durch Blattfedern mit einem Ständer<br />
verbunden ist. Der Ständer ist wiederum an der Rohrleitung<br />
befestigt. Bei entsprechender Ansteuerung der Aktoren<br />
erfolgt eine Bewegung in x- bzw. in y-Richtung, siehe<br />
Bild 3b und Bild 3c.<br />
Bild 4a zeigt die konstruktive Umsetzung des Funktionsprinzips.<br />
Die Konstruktion ist in Bild 4b bis Bild 4d in verschiedenen<br />
Funktionsgruppen dargestellt.<br />
Inbetriebnahme in der Industrieanlage<br />
Die Inbetriebnahme des aktiven Tilgers in der Industrieanlage<br />
erfolgt bei voller Auslastung der Rohrleitung. Die Messung der<br />
5 / <strong>2012</strong> 399
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Betriebsschwingungen erfolgt an insgesamt 25 Messpunktenmit<br />
jeweils triaxialer Beschleunigungsmessung. Zur Aufnahme<br />
des Ist-Zustandes werden zunächst Betriebsschwingungen<br />
ohne aktiven Tilger gemessen. Im Anschluss daran<br />
erfolgt die Montage des aktiven Tilgers an der Rohrleitung,<br />
siehe Bild 5.<br />
Die Auswertung der Messergebnisse im Frequenzbereich<br />
ist Bild 6 zu entnehmen. Betrachtet werden die Amplitudenspektren<br />
der Schwinggeschwindigkeiten in x- und y-Richtung<br />
in der Mitte der Umlenkung mit und ohne aktiven Tilger. Die<br />
Amplitudenreduktion im Bereich der Resonanzüberhöhungen<br />
ist deutlich erkennbar. Die stärkste Reduktion stellt sich<br />
dabei in x-Richtung im Bereich um 9,2 Hz ein. Hier ist eine<br />
Amplitudenreduktion von ca. 60 % zu beobachten. Die<br />
Schwingungsminderung erfolgt im gesamten betrachteten<br />
Frequenzbereich.<br />
Weitere Bereiche ausgeprägter Amplitudenreduktionen<br />
sind bei 19,4 Hz und 26,0 Hz auszumachen. Die zugehörigen<br />
Betriebsschwingungsformen mit und ohne aktiven Tilger sind<br />
Bild 7 zu entnehmen. Gleichwohl werden die deutliche Über-<br />
Bild 8: ADD.Pipe mit zwei Modulen<br />
1D 2D 3D<br />
höhung der Auslenkungen im oberen Bereich der Rohrleitung<br />
wie auch die Wirksamkeit des aktiven Tilgers erkennbar. In y-<br />
Richtung ist eine geringere Schwingungsminderung als in x-<br />
Richtung zu beobachten, was durch das Fehlen prägnanter<br />
Resonanzüberhöhungen begründet ist.<br />
Fazit<br />
Die Wirksamkeit des aktiven Tilgers konnte unter realen Betriebsbedingungen<br />
an der Rohrleitung einer Industrieanlage<br />
nachgewiesen werden. Seit Ende 2009 ist der aktive Tilger<br />
erfolgreich zur permanenten Schwingungsminderung installiert.<br />
Die numerischen Untersuchungen zeigen, dass eine vergleichbare<br />
Schwingungsminderung mit passiven Tilgern nur<br />
bei deutlich größeren Reaktionsmassen erzielt werden kann,<br />
zudem ist die Wirkung im Wesentlichen auf den Bereich der<br />
Abstimmungsfrequenz beschränkt.<br />
Die Montage erfolgte im Bereich des größten Schwingungsniveaus.<br />
Hier zeigte sich der Vorteil des aktiven Tilgers<br />
gegenüber Viskodämpfern, da kein festes Widerlager erforderlich<br />
ist.<br />
Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen sind<br />
als sehr positiv einzustufen, vor allem im Vergleich zu den in<br />
der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen zur Beruhigung<br />
der Rohrleitung, welche keinen nennenswerten Erfolg hatten.<br />
Weiterentwicklung zum modularen skalierbaren<br />
System ADD.Pipe<br />
Aus den gesammelten Erfahrungen im industriellen Einsatz<br />
wurde der aktive Tilger zum Produkt ADD.Pipe weiterentwickelt.<br />
ADD steht für Active Damping Device. ADD.Pipe ist<br />
modular aufgebaut und bietet dadurch ein hohes Maß an Flexibilität.<br />
Ein einzelnes Modul besteht aus Sensor, Aktor, Reaktionsmasse<br />
sowie einer Linearführung der Reaktionsmasse.<br />
Durch ein individuelles mechanisches Interface kann ADD.<br />
Pipe an nahezu jeder beliebigen Rohrleitung appliziert werden.<br />
Bild 8 zeigt ADD.Pipe in der Ausführung mit zwei Basismodulen.<br />
Durch eine entsprechende Anordnung der Basismodule<br />
ist eine Wirkung in einem, zwei und drei Freiheitsgraden<br />
sowie eine Anpassung an die erforderlichen Kräfte<br />
möglich, siehe Bild 9.<br />
Autor<br />
Bild 9: ADD.Pipe: Applikation und Skalierung<br />
Dr.-Ing. J. Engelhardt<br />
Wölfel Beratende Ingenieure GmbH<br />
+ Co.KG, Höchberg<br />
Tel. +49 931 49708-146<br />
E-Mail: engelhardt@woelfel.de<br />
400 5 / <strong>2012</strong>
Schäden an PTFE-Kompensatoren<br />
Von Franz Hingott<br />
Veranlasst durch einen Störfall in der damaligen Hoechst AG, dessen Ursache das Versagen eines PTFE-Kompensators<br />
war, wurde der „AK-Chemie PTFE-Kompensatoren“ gegründet. Ziel war es, einen Überblick über die Einsatzgrenzen<br />
der damals am Markt befindlichen Kompensatorentypen zu erlangen und eine hinreichend ausführliche Spezifikation<br />
für Mindestanforderungen an Kompensatoren zu erarbeiten.<br />
Aufgaben des „AK-Chemie PTFE-<br />
Kompensatoren“<br />
Der AK tagte in seiner 1. Sitzung am 3. Mai 2000 bei der Bayer<br />
AG in Leverkusen und setzte sich aus Vertretern der Firmen<br />
Bayer AG, BASF AG, Infracor, Dyneon und Infraserv, heute die<br />
Interessengemeinschaft Regelwerke Technik (IGR) e.V., vertreten<br />
durch die TÜV SÜD Chemie Service GmbH, zusammen.<br />
Es wurde von allen Teilnehmern festgestellt, dass für<br />
PTFE-Kompensatoren nur mangelhafte Spezifikationen vorlagen.<br />
An Mustern von bereits untersuchten Kompensatoren<br />
wurden deren Mängel vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich<br />
wurde eine Bestandsaufnahme an auf dem Markt verfügbaren<br />
3-welligen Kompensatoren der Nennweiten DN 50, 80<br />
und 100 durchgeführt.<br />
Bei der ersten Konzeption einer Richtlinie für PTFE-Kompensatoren<br />
herrschte bei allen Teilnehmern Einigkeit darüber,<br />
zunächst einen Chemie tauglichen „Standard-Kompensator<br />
mit einer Mindestwanddicke von 2 mm zu spezifizieren, mit<br />
dem ein Großteil der bestehenden Anforderungen abgedeckt<br />
werden kann. Zur Vermeidung von Einschnürungen sollten die<br />
metallischen Stützringe eine Dicke von mindestens 3 mm haben.<br />
Als maßgebend für die festzusetzenden Baulängen wurden<br />
folgende Faktoren betrachtet:<br />
Dicke der Flansche<br />
Flanschausführung zur Aufnahme der Distanzschrauben<br />
mit Durchgangslöchern oder Gewinden<br />
Dicke der Stützringe<br />
PTFE-Wanddicke<br />
Nach Ansicht des AK sind die häufigsten Fehlerquellen bei<br />
PTFE-Kompensatoren starke Wanddickenschwankungen oder<br />
-unterschreitungen, Kerben sowie eine inhomogene Leitrußverteilung.<br />
Derartige Herstellungsfehler sollen spezifiziert und<br />
ausgeschlossen werden. Zusätzlich sollte die Baulänge der<br />
einzelnen Hersteller insbesondere für Neuanlagen vereinheitlicht<br />
werden. Daher wurden die Hersteller Baum Kunststoffe<br />
GmbH, Dr. Schnabel GmbH und Resistoflex GmbH kontaktiert<br />
und um eine Stellungnahme hierzu gebeten.<br />
Um eine konstruktive Verbesserung zu erzielen, wurde<br />
von den AK-Mitgliedern beschlossen, den Herstellern eine<br />
permanente Mitarbeit im AK anzubieten. Die Hersteller<br />
stimmten zu und wurden als ordentliche Mitglieder im AK<br />
aufgenommen.<br />
In Zusammenarbeit aller Teilnehmer wurde eine erste<br />
Werknorm bzw. Guideline über „PTFE-Kompensatoren,<br />
Technische Lieferbedingungen, Maße“ erarbeitet, die im Mai<br />
2004 vorlag. Die Norm gilt für die Ausführung, Herstellung<br />
und Lieferung von Kompensatoren aus virginalem Polytetrafluorethylen,<br />
die spanlos aus pastenextrudiertem Halbzeug<br />
nach ASTM D 4895 ungeformt wurden und die mit metallischen<br />
Stützringen versehen sind.<br />
Werknorm bzw. Guideline<br />
„PTFE-Kompensatoren – Technische<br />
Lieferbedingungen, MaSSe“<br />
Diese vom AK einvernehmlich erarbeitete erste Werknorm<br />
bzw. Guideline „PTFE-Kompensatoren – Technische Lieferbedingungen,<br />
Maße“, floss ein in die Werknormensammlungen<br />
der chemischen Industrie und soll als Grundlage für die<br />
Herstellung, Prüfung und Lieferung von PTFE-Kompensato-<br />
Bild 1: Unzulässig, funktionsbeeinflussende Fehler am<br />
PTFE-Balg (1 – Anrisse auf der Innenseite des Wellenbergs;<br />
2 – Einformung durch Stützringe und Aufwulstungen<br />
mit Kerbbildung; 3 – ungleichmäßige Wellenkontur,<br />
z.T. mit Faltungen am Wellenberg; 4 – plastische Verformungen<br />
mit Weißbruchzonen; 5 – scharfkantige Übergänge<br />
mit Kerben)<br />
5 / <strong>2012</strong> 401
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
ren herangezogen werden. Als wichtigste Bestandteile dieser<br />
Norm werden die Punkte<br />
4.3 Bauteil (Kompensator)<br />
4.4 Ausführungen / Maße<br />
5.5 Prüfung am Fertigteil<br />
angesehen. Unter Punkt „4.3 Bauteil (Kompensator)“ werden<br />
unzulässige, funktionsbeeinflussende Fehler am PTFE-<br />
Balg beschrieben, siehe Bild 1. Bei elektrostatisch nicht aufladbaren<br />
PTFE-Kompensatoren wird die Rußverteilung dokumentiert,<br />
siehe Bild 2 und Bild 3.<br />
Unter Punkt „4.4 Ausführungen / Maße“ werden die Maße<br />
für PTFE-Axialkompensatoren in 2-, 3- und 5-welliger Ausführung<br />
und die Maße für Losflansche festgelegt. In Punkt<br />
„5.5 Prüfung am Fertigteil“ wird insbesondere auf die Prüfung,<br />
Beschaffenheit, Maße, elektrostatische Aufladbarkeit<br />
und Berstdruckprüfung eingegangen.<br />
Die Erfahrungen mit Kompensatoren, die den Anforderungen<br />
dieser Spezifikationen entsprechen, sind bislang positiv,<br />
jedoch traten in Einzelfällen bei hohen Ausnutzungsgraden<br />
z.B. Verformungen an Kompensatoren auf und einige<br />
Kompensatoren barsten während des betrieblichen Einsatzes.<br />
Daher wurde der AK am 14. November 2008 wieder einberufen,<br />
um die Vorfälle gemeinsam zu diskutieren. Die Betreiber<br />
stellten klar, dass im betrieblichen Einsatz Verformungen<br />
und das Bersten von Kompensatoren nicht akzeptiert<br />
werden können. Daher wurde versucht eine Basis für die Einsatzgrenzen<br />
von Kompensatoren zu erarbeiten.<br />
Bild 2: Gleichmäßige Rußverteilung<br />
Bild 3: Ungleichmäßige Rußverteilung, entspricht nicht<br />
den Anforderungen<br />
Zeitstandverhalten von<br />
PTFE-Kompensatoren<br />
In einem ersten Ansatz sollte das Zeitstandverhalten von<br />
PTFE-Kompensatoren in Zeitstandinnendruckversuchen überprüft<br />
werden. Das Zeitstandverhalten von Rohren aus Polyolefinen<br />
(Polyethylen, Polypropylen usw.) wurde an Zeitstandinnendruckversuchen<br />
bei verschiedenen Temperaturen untersucht,<br />
und die daraus resultierenden Zeitstandkurven dienen<br />
als Grundlage für eine Lebensdauerabschätzung von Rohren<br />
unter definierten Bedingungen von Druck und Temperatur.<br />
Dass diese Abschätzungen der Lebensdauer auf einer fundierten<br />
Basis beruhen, beweist der Historien-Prüfstand in der<br />
Werkstofftechnik der TÜV SÜD Chemie Service GmbH (TCS),<br />
ehemals Farbwerke Hoechst AG, in dem sich noch Rohre aus<br />
Polyethylen (Hostalen GM 5010) seit 1956 ununterbrochen<br />
in der Zeitstandinnendruckprüfung bei Raumtemperatur befinden.<br />
Damals wurde für diese Rohre eine Lebensdauer von<br />
50 Jahren vorhergesagt, die die Prüfungen mit nun 55 Jahren<br />
belegen. Neben den Zeitstandinnendruckprüfungen an<br />
Rohren aus Polyolefinen wurde 1990 begonnen, das Zeitstandverhalten<br />
von Rohren aus verschiedenen Fluorpolymeren<br />
zu untersuchen.<br />
Das Zeitstandverhalten von Rohren aus PTFE 2025 ist in<br />
Bild 4 dargestellt und in der DVS-Richtlinie 2205-1 im Beiblatt<br />
21 aufgeführt.<br />
In einem ersten Ansatz wurde die These aufgestellt, dass<br />
sich Kompensatoren in erster Näherung wie Rohre verhalten<br />
und daher auch eine Lebensdauerabschätzung anhand von<br />
Zeitstandinnendruckprüfungen möglich sein sollte. Eine Voraussetzung<br />
hierbei ist, dass die aus der Herstellung der Kompensatoren<br />
bedingten Abweichungen wie Wanddickenunterschiede,<br />
Kristallinitätsgrad usw. sich in engen Grenzen halten.<br />
In einer umfangreichen Versuchsreihe wurden PTFE-Kompensatoren<br />
des Typs „FLUROFLEX ® -N3“, Nennweite DN 80,<br />
geprüft. Neben Berstversuchen wurden Drucksteigerungsversuche<br />
und Zeitstandinnendruckprüfungen durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse dieser Versuche werden nachfolgend kurz zusammengefasst:<br />
1. Berstversuche<br />
Es zeigte sich, dass die bisher als Sicherheitsgrundlage durchgeführten<br />
Berstversuche ein ungeeignetes Mittel sind, um<br />
das Zeitstandverhalten von Kompensatoren zu beschreiben.<br />
Ebenso können Berstversuche nicht zur Qualitätssicherung<br />
herangezogen werden. In Versuchsreihen wurden nämlich<br />
Kompensatoren mit definierten Schädigungen im PTFE-Material<br />
und einwandfreie Kompensatoren geprüft. Im Berstversuch<br />
konnten keine Unterschiede festgestellt werden. In<br />
einer Zeitstandinnendruckprüfung fallen die Kompensatoren<br />
mit Schädigungen im Vergleich zu einwandfreien Kompensatoren<br />
dagegen frühzeitig aus.<br />
Ein weiterer Grund für das Versagen des Berstversuchs als<br />
Qualitätskriterium sind die Prüfbedingungen. Es wurde festgestellt,<br />
dass Hersteller eigene Prüfanweisung hierzu haben,<br />
die teilweise zu nicht reproduzierbaren Ergebnissen führen<br />
und mit Ergebnissen aus Prüfungen anderer Hersteller bzw.<br />
Prüfinstitute nicht vergleichbar sind.<br />
2. Drucksteigerungsversuche<br />
Anhand von Drucksteigerungsversuchen wird versucht den<br />
Beginn der Zeitstandkurve bei vorgegebener Temperatur zu<br />
402 5 / <strong>2012</strong>
Bild 4: Zeitstandfestigkeit von Rohren aus PTFE 2025<br />
Bild 5: Zeitstandfestigkeit von 3-welligen PTFE-Kompensatoren<br />
DN 80 bei 150 °C<br />
bestimmen. Hierbei wird eine definierte Drucksteigerungsrate<br />
pro Zeiteinheit vorgegeben, bis der Kompensator während<br />
des Versuchs durch Bersten ausfällt. Der ermittelte Druck<br />
dient als Anhaltspunkt für die Festlegung der Prüfpunkte, mit<br />
denen die Zeitstandkurve bestimmt werden soll.<br />
3. Zeitstandinnendruck-Prüfungen<br />
Im AK wurde festgelegt, dass Zeitstandinnendruck-Prüfungen<br />
bei 150 °C in Anlehnung an ISO 9080 mit PTFE-Kompensatoren<br />
der Nennweite DN 80 durchgeführt werden sollen.<br />
Um den Prüfumfang zu minimieren, wurde definiert, dass<br />
zehn Prüfpunkte ermittelt und daraus der ertragbare Innendruck<br />
bei einer Lebensdauer von 50 Jahre extrapoliert werden<br />
sollte. Das Ergebnis dieser Prüfungen ist somit eine auf<br />
50 Jahre extrapolierte Zeitstandkurve, siehe Bild 5.<br />
Fazit der Untersuchungen<br />
Das Zeitstandverhalten von PTFE-Kompensatoren kann mit<br />
Zeitstandinnendruckprüfungen ermittelt werden, wenn das<br />
Herstellungsverfahren so optimiert ist, dass Abweichungen<br />
wie Wanddickenunterschiede und andere Einflussfaktoren<br />
sich in engen Grenzen halten. Analog zu den Kunststoffrohren<br />
können nun den betrieblichen Erfordernissen angepasste<br />
Sicherheitsfaktoren definiert werden, die bei einer vorgegebenen<br />
Temperatur einen maximalen Betriebsdruck festlegen.<br />
Somit ist ein sicherer Einsatz von PTFE-Kompensatoren<br />
in chemischen Anlagen gewährleistet.<br />
Berstversuche sind aufgrund der schlechten Reproduzierbarkeit<br />
und Fehlertoleranzen für eine Qualitätssicherung von<br />
PTFE-Kompensatoren nicht geeignet.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Franz Hingott<br />
TÜV SÜD Chemie Service GmbH<br />
5 / <strong>2012</strong> 403
Gezieltes Wissen<br />
schneller als ein Flügelschlag<br />
wo und wann Sie wollen<br />
Jetzt immer online unter www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Das schnellste Wissen für Ihren Beruf. Egal, ob Sie die<br />
aktuellen News der Branche suchen, Hintergrundberichte,<br />
Fachartikel oder Praxisbeiträge. <strong>3R</strong> bietet die Fakten der<br />
Rohrleitungstechnik nun auch online in hoch konzentrierter<br />
Form, gut sortiert und intelligent vernetzt mit allen wichtigen<br />
Themen der Versorgungswirtschaft.<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de - der direkte Klick ins Fach
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Verfahrensweisen bei<br />
Abweichungen von den<br />
DIBt-Zulassungskriterien von<br />
Thermoplastbehältern<br />
Von Frank Griebel und Kay Engel<br />
Moderne Thermoplastbehälter sind für zahlreiche Anwendungen in Industrie und Gewerbe geeignet. Für die allgemeine<br />
bauaufsichtliche Zulassung ist das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zuständig. Wie verfahren werden kann,<br />
wenn ein Behälter aufgrund seiner Konstruktion von den Standardanforderungen des DIBt abweicht, zeigt der folgende<br />
Beitrag. Es wird ein Überblick über das Vorgehen zur „Zustimmung im Einzelfall“ und zur „Ergänzung der allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen Zulassung“ gegeben.<br />
Kunststoffe sind mittlerweile im Behälterbau weit verbreitet.<br />
Verschiedene Formmassen, Halbzeuge und Verfahrenstechniken<br />
machen die unterschiedlichsten Einsatzfelder möglich.<br />
Die Materialien zeichnen sich vor allem durch ihre langjährige<br />
Beständigkeit aus – auch gegen aggressive Medien wie Chemikalien<br />
oder Industrieabwässer. Mit modernen Schweißverfahren<br />
können sie leicht verarbeitet werden. Durch ihre gute<br />
Formbarkeit haben sie ein breites Anwendungsspektrum, das<br />
vielen individuellen Ansprüchen gerecht wird.<br />
Allerdings muss dafür die qualifizierte Produktion beim<br />
Hersteller, der ordnungsgemäße Einbau vor Ort sowie eine<br />
dauerhafte, sachgerechte Verwendung des Behälters sichergestellt<br />
sein. Eine Leckage oder ein Riss in einem Chemikalienlagertank<br />
können erhebliche wirtschaftliche Schäden<br />
im Unternehmen verursachen. Durch das austretende, wassergefährdende<br />
Medium kann zusätzlich eine unmittelbare<br />
Gefährdung für Mitarbeiter und Umwelt entstehen. Folglich<br />
muss nach Bau- und Wasserrecht die ordnungsgemäße<br />
Herstellung und Installation von Lagertanks sichergestellt<br />
werden.<br />
Kunststoffbehälter – aber mit<br />
Sicherheit<br />
Vor diesem Hintergrund stellt das Deutsche Institut für Bautechnik<br />
(DIBt) detaillierte Anforderungen an einen Kunststoffbehälter,<br />
der in Deutschland in Verkehr gebracht werden<br />
soll. Erfüllt ein Behälter die Zulassungskriterien des DIBt,<br />
wird eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erteilt<br />
(siehe Infokasten 1). Mit dieser dürfen Behälter derselben<br />
Baureihe in Verkehr gebracht und verwendet werden.<br />
Auskunft über die Konformität mit den geltenden Richtlinien<br />
und Normen gibt das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen),<br />
mit dem vom DIBt zugelassene Bauprodukte gekennzeichnet<br />
werden. Das Zeichen enthält den Herstellernamen, die DIBt-<br />
Zulassungsnummer sowie den Namen der zugelassenen Prüfstelle.<br />
Diese überprüft und bestätigt von unabhängiger Seite<br />
die regelkonforme Ausführung.<br />
Für einen „klassischen“ LAU-Behälter (einen ortsfesten<br />
Behälter zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen) ist die Erteilung<br />
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Standardverfahren:<br />
Der Hersteller stellt einen Antrag beim DIBt, woraufhin<br />
eine vom DIBt anerkannte, unabhängige Prüfstelle<br />
die Konformität feststellt, so dass die allgemeine bauaufsichtliche<br />
Zulassung erteilt wird. Diese ist dann für einen<br />
Zeitraum von fünf Jahren gültig. Zu beachten ist dabei,<br />
Infokasten 1<br />
Voraussetzungen für die Zulassungen von<br />
Thermoplastbehältern<br />
eine geeignete personelle Ausstattung des Herstellers<br />
(Fachkräfte und geprüfte Schweißer nach DVS 2212)<br />
eine geeignete maschinelle Ausstattung des Herstellers<br />
Verwendung von DIBt-zugelassenen oder gelisteten<br />
Formmassen<br />
eine Fachbetriebszulassung des Herstellers nach dem<br />
Wasserhaushaltsgesetz, wenn er die Behälter auch<br />
aufstellt und instand hält<br />
geprüfte Standsicherheitsnachweise nach DVS 2205<br />
Schweißverbindungen nach DVS-Vorgaben<br />
eine vollständige Fertigung im Herstellerwerk<br />
Qualitätssicherung durch Eigenüberwachung des Herstellers<br />
Qualitätssicherung durch Fremdüberwachung durch<br />
eine DIBt-anerkannte Prüfstelle<br />
Zertifizierung des Herstellers durch einen von DIBt anerkannten<br />
Zertifizierer<br />
406 5 / <strong>2012</strong>
Quelle: Formoplast (Dornstedt)<br />
Bild 1: Für Behälter<br />
mit einem Volumen<br />
von mehr als<br />
50 m 3 muss die allgemeine<br />
bauaufsichtliche<br />
Zulassung ergänzt<br />
oder eine Zustimmung<br />
im Einzelfall eingeholt<br />
werden<br />
dass das DIBt keine Zulassungen für HBV-Behälter erteilt<br />
(Behälter zum Herstellen, Behandeln, Verwenden). In diese<br />
Kategorie fallen beispielsweise alle Behälter, in denen Produktionsprozesse<br />
ablaufen wie Rühren, Katalysieren, Waschen<br />
oder ähnliche. Das DIBt ist für diese nicht zuständig,<br />
da für HBV-Behälter nach Wasserrecht kein Eignungsnachweis<br />
in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung<br />
verlangt wird.<br />
Die Zustimmung im Einzelfall<br />
Weiterhin ist zu beachten, dass das oben genannte Zulassungsverfahren<br />
nur in klar definierten Grenzen möglich ist.<br />
Es wird komplexer, wenn der Behälter aufgrund seiner Materialeigenschaften,<br />
geplanten Verwendung, Bauweise oder<br />
Konstruktion von den üblichen Vorgaben abweicht (siehe Infokasten<br />
2). Die Eignung muss dann sorgfältig geprüft und<br />
festgestellt werden, wobei im Prüfverfahren der jeweilige<br />
Verwendungszweck des Behälters zu berücksichtigen ist.<br />
Prinzipiell kann eine abweichende Behälterkonstruktion<br />
eine „Zustimmung im Einzelfall“ (ZiE) erhalten. Sie wird von<br />
einer anerkannten Prüfstelle bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde<br />
erteilt. Außerdem ist ein Bewertungsverfahren<br />
für die „Ergänzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung“<br />
beim DIBt möglich. Dies ist insbesondere dann sinnvoll,<br />
wenn mehrere Behälter des Typs in Verkehr gebracht werden<br />
sollen. Für beide Verfahren ist jeweils eine separate wasserrechtliche<br />
Eignungsfeststellung erforderlich. Ansonsten unterscheiden<br />
sie sich lediglich formal im Ablauf.<br />
Für die ZiE prüft, beurteilt und bewertet die anerkannte<br />
Prüfstelle die Abweichungen und erstellt einen Bericht,<br />
Infokasten 2<br />
Die allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung<br />
(abZ) ist derzeit auf bestimmte Behälter<br />
beschränkt. Die Rahmenbedingungen:<br />
Behälter zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen (sog. LAU-<br />
Behälter)<br />
Rundbehälter mit maximal 50 m³ Volumen<br />
Durchmesser von maximal 4 m bei einem Höhe/<br />
Durchmesser-Verhältnis ≤ 6<br />
Flachbodenbehälter mit Flachdach oder Kegeldach<br />
(Neigung ≥ 15°)<br />
druckloser Betrieb (kurzzeitig maximal 0,005 bzw.<br />
–0,001 bar)<br />
Betriebstemperatur maximal 40 °C (Polyethylen und<br />
Polypropylen)<br />
Befüllung mit maximal 1.200 Liter pro Minute<br />
Medien nach aktueller DIBt-Medienliste (Flammpunkt<br />
> 55 °C)<br />
keine Stutzen im Boden, Stutzen im Zylinder maximal<br />
160 mm Durchmesser<br />
der bei der zuständigen Genehmigungsbehörde eingereicht<br />
wird. Für die Ergänzung der abZ hingegen muss der Hersteller<br />
zuerst einen Antrag beim DIBt bezüglich der Abweichungen<br />
stellen, woraufhin eine anerkannte Prüfstelle unter Beachtung<br />
der DIBt-Zulassungsgrundsätze die Abweichungen<br />
untersucht und bewertet. Diese sind maßgeblich für die erforderlichen,<br />
zusätzlichen Prüfungen und für beide Verfahren<br />
von gleicher Bedeutung. Die Abweichungen werden da-<br />
5 / <strong>2012</strong> 407
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Bild 2: Auch verschiedene<br />
konstruktive<br />
Details –<br />
wie zum Beispiel<br />
Stutzen im Zylinder<br />
mit mehr als<br />
160 mm Durchmesser<br />
– erfordern eine<br />
Zustimmung im<br />
Einzelfall bzw. die<br />
Ergänzung der allgemeinen<br />
bauaufsichtlichen<br />
Zulassung<br />
Quelle: Schwaben-Kunststoff (Langenneufnach)<br />
Quelle: Schwaben-Kunststoff (Langenneufnach)<br />
Bild 3: Wird der Behälter erst auf der Baustelle fertig gestellt,<br />
muss der ordnungsgemäße Zusammenbau durch zusätzliche Prüfungen<br />
vor Ort sichergestellt werden<br />
bei von der Prüfstelle prinzipiell unter folgenden Gesichtspunkten<br />
bewertet.<br />
Die Behälterprüfung im Überblick<br />
Die Prüfung beginnt mit einer Vorprüfung des Behälters. Bei<br />
ihr wird auf Basis der Konstruktionsunterlagen die Statik untersucht<br />
– inklusive der konstruktiven Abweichungen wie<br />
Mannlöcher oder Schrägböden. Im Einzelfall begutachten die<br />
Sachverständigen anschließend alle sicherheitsrelevanten Aspekte<br />
bei der Fertigung im Herstellerwerk und ggf. auch bei<br />
der Baustellenmontage. Der fertige Behälter wird dann einer<br />
Stabilitäts- und Dichtheitsprüfung unterzogen. Gegebenenfalls<br />
sind weitere „Sonderprüfungen“ erforderlich, wenn beispielsweise<br />
ein Schweißverfahren außerhalb des DVS-Geltungsbereichs<br />
zum Einsatz kommt.<br />
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse erstellt die<br />
anerkannte Prüfstelle ein ausführliches Gutachten, woraufhin<br />
die zuständige Genehmigungsbehörde eine „Zustimmung<br />
im Einzelfall“ beziehungsweise das DIBt eine Ergänzung der<br />
„allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung“ erteilt. Das ist vor<br />
allem für Behälter mit großem Volumen von Bedeutung, denn<br />
bei einem Fassungsvermögen von mehr als 50 m 3 ist eine abZ<br />
allein nicht ausreichend. Durch eine gesonderte Vor-, Bauund<br />
Druckprüfung wird die regelkonforme Herstellung gewährleistet.<br />
Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die<br />
Schweißverbindungen gelegt, da bei diesen Behältergrößen<br />
oftmals automatisierte Verfahren eingesetzt werden, die im<br />
DVS-Regelwerk nicht behandelt werden.<br />
Auch konstruktionsbedingte Abweichungen kommen in<br />
der Praxis häufig vor. Das ist z. B. der Fall, wenn Stutzen im Boden<br />
vorgesehen sind oder Stutzen in der Zylinderwand einen<br />
Durchmesser von mehr als 160 mm aufweisen. Diese Stutzen<br />
und insbesondere große Mannlöcher verschwächen die<br />
Zylinderkonstruktion so erheblich, dass der Behälter in diesen<br />
Bereichen sehr viel dicker ausgeführt werden muss. Darüber<br />
hinaus erfordern Standzargen, Schräg- oder Kegelböden<br />
eine zusätzliche Bewertung der Standsicherheit nach DVS<br />
2205 bzw. der Berechnungsempfehlungen des DIBt. Aber<br />
auch angebrachte Arbeitsbühnen, Leitern oder Traversen am<br />
Behälter müssen die Prüfer in der statischen Berechnung berücksichtigen.<br />
Genaue Analyse bei „kritischen Medien“<br />
Eine weitere Abweichung ist die Lagerung von Medien, die<br />
nicht in der Medienliste des DIBt aufgeführt sind. Darunter<br />
fallen insbesondere Mediengemische, Handelsmedien sowie<br />
„kritische“ Medien (z. B. Schwefelsäure > 78 %). Durch ihre<br />
stofflichen Komponenten und chemischen Eigenschaften<br />
wirken sie mitunter so erheblich auf den Kunststoffbehälter<br />
ein, dass die veranschlagte Betriebsdauer von regulär 25<br />
Jahren bei weitem nicht erreicht werden kann.<br />
Deshalb muss das Medium von einem vom DIBt benannten<br />
Sachverständigen beurteilt werden, der für die jeweilige<br />
Material-Medien-Kombination ein Mediengutachten<br />
erstellt. Es listet alle wichtigen Angaben zu dem Behäl-<br />
408 5 / <strong>2012</strong>
ter, die stofflichen Eigenschaften des Mediums und die Auswirkungen<br />
auf das Behältermaterial auf (z. B. Gefahr von<br />
Quellung oder Spannungsrissbildung). Das Gutachten wird<br />
zur ZiE bei der zuständigen Genehmigungsbehörde vorgelegt.<br />
Zur Ergänzung der abZ kann darüber hinaus noch eine<br />
Bauprüfung durch einen anerkannten Sachverständigen<br />
erforderlich sein – zum Beispiel beim Einbau einer voreilenden<br />
Behälterprobe. Dadurch kann auf eine wiederkehrende<br />
Prüfung des Behälters bis zum Versagen der Probe verzichtet<br />
werden.<br />
Bei abweichenden Betriebsbedingungen – insbesondere<br />
Temperatur und Druck– muss unter anderem eine Beurteilung<br />
der Standsicherheit des Daches erfolgen. Gegebenenfalls<br />
sind zusätzliche Versteifungen an der Dachkonstruktion<br />
vorzusehen. Zudem wird die maximale Lebensdauer des<br />
Thermoplastbehälters nach der Zeitstandkurve rechnerisch<br />
ermittelt und beurteilt. Unter Umständen ist bei erhöhten<br />
Temperaturen keine Auslegung auf 25 Jahre mehr möglich.<br />
Sind Heizungen oder andere konstruktive Details eingebaut,<br />
sind auch diese zu prüfen und zu beurteilen.<br />
Das Fügen unter Baustellenbedingungen<br />
Wenn die Fertigung aufgrund der Größe des Behälters nicht<br />
im Werk des Herstellers möglich ist, werden oft vorgefertigte<br />
Elemente erst auf der Baustelle zusammengefügt. Bei<br />
dieser Abweichung bedarf es immer einer Zustimmung im<br />
Einzelfall, da die Gegebenheiten auf der Baustelle wesentlichen<br />
Einfluss auf die Qualität des Behälters haben. Deshalb<br />
müssen die generellen Baustellenbedingungen von unabhängiger<br />
Stelle mittels einer Bauprüfung vor Ort beurteilt<br />
werden. Hierbei sind insbesondere die Schweißverbindungen<br />
eingehend zu begutachten. Falls erforderlich müssen<br />
Schweißproben unter Baustellenbedingungen angefertigt<br />
und geprüft werden. Abschließend folgt die Stabilitäts- und<br />
Dichtheitsprüfung.<br />
Schließlich ist noch auf eine besondere Abweichung hinzuweisen.<br />
Denn wenn ein Kunststoffbehälter in einem geologisch<br />
kritischen Gebiet mit Erdbebengefahr aufgestellt<br />
werden soll, wird ebenfalls die ZiE oder die Ergänzung zur<br />
abZ benötigt. Dies ist auch in einigen Gebieten Deutschlands<br />
durchaus von Bedeutung – insbesondere in Teilen Baden-<br />
Württembergs, entlang des Rheingrabens sowie im Raum<br />
Aachen. Im Zulassungsverfahren wird deshalb die Standsi-<br />
cherheit des Behälters durch Erdbebeneinwirkungen genauer<br />
beurteilt. Zur Anwendung kommen dafür Berechnungsentwürfe<br />
des DIBt und DVS. Zudem muss die konstruktive<br />
Ausführung ein Kippen bzw. Verrutschen verhindern. Wenn<br />
der Behälter in einer Auffangwanne steht, sind weitere Hinweise<br />
zur konstruktiven Gestaltung nach Entwürfen des<br />
DIBt und DVS zu beachten. Besonderes Augenmerk wird<br />
in jedem Fall auf die sichere Verankerung im Boden gelegt.<br />
Was tun im Schadensfall?<br />
Einen Sonderfall stellt die Reparatur eines Behälters nach<br />
einem Schaden dar. Ursachen sind oftmals Fehlbefüllung,<br />
unsachgemäßer Betrieb oder Schäden durch den Transport.<br />
Eine unabhängige, anerkannte Prüfstelle muss dann<br />
in jedem Einzelfall bestätigen, dass eine Reparatur möglich<br />
ist und der Behälter weiter betrieben werden kann. Dazu<br />
beurteilen die Kunststoff-Sachverständigen den Schaden<br />
direkt vor Ort. Das Reparaturkonzept und die Qualifikation<br />
der Fachfirma werden daraufhin überprüft. Nach der Reparatur<br />
erfolgt die Abnahme, die mit erneuten Bau-, Stabilitäts-<br />
und Dichtheitsprüfungen feststellt, dass der Behälter<br />
auch weiterhin sicher betrieben werden kann. Die Prüfstelle<br />
erstellt dann einen abschließenden Bericht, der für<br />
die innerbetrieblichen und behördlichen Belange verwendet<br />
werden kann.<br />
Fazit<br />
In der Regel sind Thermoplastbehälter für einen Betrieb von<br />
25 Jahren ausgelegt. Damit sie ihre Funktion zuverlässig und<br />
sicher erfüllen, sind die anerkannten Regeln der Technik zu<br />
berücksichtigen. Die Zulassungsverfahren des DIBt und detaillierte<br />
Prüfungen bei Abweichungen durch unabhängige<br />
Sachverständige stellen sicher, dass in Verkehr gebrachte<br />
Behälter den Vorschriften und technischen Regeln entsprechen.<br />
Die Beurteilung des Sicherheitsstandards ist insbesondere<br />
bei Abweichungen von den Normalkriterien wichtig, da<br />
in diesen Fällen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko von den Behältern<br />
ausgehen kann. TÜV SÜD ist als unabhängige Prüfstelle<br />
für Kunststoffbehälter vom DIBt anerkannt. Darüber hinaus<br />
beraten die Experten Hersteller und Anwender in allen<br />
Fragen zur Ausführung, Zulassung und Standsicherheit von<br />
Kunststoffbehältern.<br />
Autoren<br />
Frank Griebel<br />
TÜV SÜD Industrie Service, Institut<br />
für Kunststoffe, München<br />
Tel. +49 89 5190-3228<br />
E-Mail: kunststoffe@tuev-sued.de<br />
Kay Engel<br />
TÜV SÜD Industrie Service, Institut für<br />
Kunststoffe, München<br />
Tel. +49 89 5190-3228<br />
E-Mail: kunststoffe@tuev-sued.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 409
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
Besondere Anforderungen an ein<br />
Baustellenmanagementsystem im<br />
Anlagenbau<br />
Von Helmut Riff<br />
Die im Kraftwerksneubau tätigen Unternehmen sind europa- bzw. weltweit tätig, eine zentrale Steuerung der Baustellen<br />
erfordert einen ständigen Zugang auf die aktuellen Daten der aktiven Baustellen. Die an den Projekten beteiligten<br />
Subunternehmen müssen ihre Tätigkeiten zeitnah dokumentieren, dürfen aber aus Gründen des Datenschutzes<br />
nicht ins Firmennetz des Auftraggebers eingebunden sein. Alle diese Anforderungen führten dazu das Programm<br />
BIMAS als WEB-Lösung zu konzipieren. Hierbei erfolgt der gesicherte Systemzugang über das Internet.<br />
Einleitung<br />
Ein maßgeblicher Zweig des Anlagenbaus ist der Kraftwerksbau<br />
auf der Basis fossiler Brennstoffe. Ziel der gegenwärtig<br />
im Bau befindlichen Braun- oder Steinkohleblöcke ist eine<br />
ressourcen- und umweltschonende Stromerzeugung durch<br />
Einsatz von CO 2<br />
-armen Erzeugungstechniken bei gleichzeitiger<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken.<br />
Durch optimierte Anlagentechniken erreichen die Kraftwerke<br />
der neuen Generation einen um ca. 12 %-Punkte höheren<br />
Wirkungsgrad als die derzeit in Betrieb befindlichen Altanlagen.<br />
Erreicht wird der höhere Wirkungsgrad durch eine Vielzahl<br />
von Einzelmaßnahmen, zu denen insbesondere die Anhebung<br />
der Frischdampfparameter sowie eine aufwändige Rauchgaswärmerückgewinnung<br />
mit Einkoppelung dieser Wärme in die<br />
Verbrennungsluft- und Speisewasservorwärmung gehören. Die<br />
gesteigerten, sog. Überkritischen, Dampfparameter erforderten<br />
den Einsatz von neuartigen Stählen (HR3C, P92, 7CrMoV-<br />
TiB10-10 …. ), die diesen Anforderungen genügen.<br />
Für die Fertigung und Montage der druck- und temperaturführenden<br />
Kraftwerkskomponenten ist deshalb ein noch<br />
höherer Qualitätsstandard als bei den bisher errichteten Anlagen<br />
zu gewährleisten. Allein bei der Montage der Dampfkesselkomponenten<br />
sind die Schweißqualität und die begleitende<br />
Wärmebehandlung von ca. 120.000 Rundnähten mittels<br />
zerstörungsfreier Werkstoffprüfungen zu überwachen<br />
und nachvollziehbar zu dokumentieren.<br />
Bild 1: Struktur des BIMAS-Systems<br />
Besondere Anforderungen<br />
Die im Kraftwerksneubau tätigen Unternehmen sind europabzw.<br />
weltweit tätig, eine zentrale Steuerung der Baustellen<br />
erfordert einen ständigen Zugang auf die aktuellen Daten der<br />
aktiven Baustellen. Die an den Projekten beteiligten Subunternehmen<br />
müssen ihre Tätigkeiten zeitnah dokumentieren,<br />
dürfen aber aus Gründen des Datenschutzes nicht ins Firmennetz<br />
des Auftraggebers eingebunden sein. Alle diese Anforderungen<br />
führten dazu das Programm BIMAS als WEB-Lösung<br />
zu konzipieren. Hierbei erfolgt der gesicherte Systemzugang<br />
über das Internet. Entsprechend seiner Gruppenzugehörigkeit<br />
(seinen Aufgaben) erhält der Anwender nach Abfrage<br />
von Usernamen, Passwort und Rechnerkennung den<br />
Zugang zu bestimmten Eingabemasken innerhalb eines Projektes.<br />
Gruppenrechte gibt es für die Aufgabengebiete Management,<br />
Schweißen, Glühen, ZfP und ThirdParty. Besondere<br />
Auswertetools unterstützen das Management bei der Dokumentation<br />
des Fertigungs- und Qualitätsstandes der verschiedenen<br />
Projekte.<br />
Bild 1 zeigt die Struktur des BIMAS-Systems und die darin<br />
eingebundenen Firmen. Daraus ist ersichtlich, dass das System<br />
für die Erfassung und Erstellung der kompletten technischen<br />
Dokumentation von Großprojekten ausgelegt ist.<br />
410 5 / <strong>2012</strong>
Bild 2: Schweißpositionsliste<br />
(MSP)<br />
Bild 3: Schweißstellenliste<br />
Strukturierte Dokumentierung<br />
groSSer schweiSS- und prüftechnischer<br />
Datenmengen<br />
Die von der RIFF Systemhaus GmbH entwickelte Systemlösung<br />
BIMAS-WEB hat sich zu einer Standard Baustellen-Software<br />
im Bereich des Großkesselbaus entwickelt und wird europaweit<br />
eingesetzt. Das Programm unterstützt das Baustellenmanagement<br />
in effizienter Weise durch<br />
Erfassung aller schweiß- und prüftechnischen Vorgaben<br />
zum Projekt,<br />
Erfassung der Qualifikationen des Schweiß- und Prüfpersonals,<br />
Erfassung der schweißtechnischen Details der Montagezeichnung<br />
(Schweißplanpositionen),<br />
Erfassung der durchgeführten Schweißungen,<br />
schweißnahtbezogene Speicherung aller Wärmebehandlungen<br />
und zerstörungsfreien Werkstoffprüfungen (ZfP),<br />
schweißplanbezogene Erstellung der schweiß- und prüftechnischen<br />
Kundendokumentation (Enddokumentation),<br />
eine aktuelle breitgefächerte Qualitätsauswertung der<br />
durchgeführten Schweißungen sowie der Arbeitsqualität<br />
der Schweißer und deren Qualifikationen.<br />
Montageschweißplan (MSP)<br />
Der MSP ist für Montageschweißungen im Dampfkesselbau<br />
(überwachungspflichtige Anlage) das zentrale Arbeitsdokument.<br />
Im MSP sind alle Vorgaben für das Schweißen, die Wärmebehandlung<br />
und die Schweißnahtprüfungen zusammengefasst<br />
(Bild 2).<br />
Er bildet die Basis für das Baustellen-Management und Informationssystem<br />
BIMAS-WEB, auf die sowohl bei der Einspeicherung<br />
der Schweiß-, Glüh- und Prüfdaten als auch für<br />
die Erstellung von Glühanweisungen, Schweißstellenlisten, Arbeitslisten<br />
für ZfP und Glühungen Bezug genommen wird. Der<br />
5 / <strong>2012</strong> 411
Fachbericht<br />
Anlagenbau<br />
MSP wird projektbezogen abgelegt. Die Software ist so multivalent<br />
nutzbar. Unterschiedliche Aufträge können parallel,<br />
auch an einem Standort, schweißtechnisch bearbeitet werden.<br />
Zu jeder MSP-Position ist eine Schweißstellenliste an<br />
Hand der Konstruktionsunterlagen sowie festgelegter Ordnungsprinzipien<br />
(Zählweise, Strömungsrichtung von Medien)<br />
zu erstellen (Bild 3).<br />
Sie gewährleistet die Identifikation jeder einzelnen<br />
Schweißnaht in einer Anlage und ist Teil der Enddokumentation.<br />
Die Programmverknüpfungen der Software folgen der<br />
Logik: schweißen, glühen, prüfen. Plausibilitätskontrollen erzwingen<br />
diese Vorgehensweise bei der Datenspeicherung.<br />
Diese Verknüpfung verhindert, dass ZfP-Ergebnisse oder Glühungen<br />
für nicht geschweißte Nähte abgelegt werden können.<br />
Das heißt, nur für die abgeschweißten Nähte wird die Eingabensperre<br />
für Glühungen und ZfP aufgehoben.<br />
Dokumentierung von Schweißnahtglühungen<br />
Entsprechend den je nach MSP-Position abgerufenen Glühvorgaben<br />
erfolgt der Ausdruck: „Vorgaben zur Wärmeführung“<br />
als Arbeitsanweisung für den Glüher vor Ort. Die im Glühdiagramm<br />
analog registrierten Glühparameter werden als digitale<br />
Werte MSP-positionsbezogen (noch) manuell im System<br />
abgelegt und im abrufbaren Protokoll über die Wärmeführung<br />
(Glühprotokoll) in der jeweiligen MSP-Position als Teil der Enddokumentation<br />
dargestellt. Hilfreich für die Schweißaufsicht<br />
vor Ort ist eine integrierte Kontrollfunktion über die Vollständigkeit<br />
der Glühungen aller Schweißnähte einer MSP-Position.<br />
Bild 4: Eingabe<br />
Listenansicht RT-Ergebnisse<br />
Bild 5: Abruf der<br />
Enddokumentation<br />
412 5 / <strong>2012</strong>
Bild 6:<br />
Statusbericht<br />
Dokumentierung der Schweißnahtprüfungen<br />
Die Schweißnahtprüfung mittels der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung<br />
ist der bestimmende Nachweis über die Qualität<br />
der ausgeführten Schweißnähte. Deshalb kommt der fachgerechten<br />
Durchführung und dem Umgang mit den Prüfergebnissen<br />
besondere Bedeutung zu. Arbeitsgrundlage für die<br />
Prüfdurchführung, die Ergebnisdokumentierung sowie die<br />
Statusermittlung der durchgeführten ZfP in der jeweiligen<br />
MSP-Position ist der Prüfplan im Rückgriff auf die im MSP<br />
festgeschriebenen Arten und Umfänge durchzuführender<br />
ZfP. Die Prüfergebnisse werden im System abgelegt (Bild 4).<br />
Nachweis der Erhöhung des Prüfumfangs bei<br />
Reparaturnähten<br />
Sowohl in DIN EN ISO 13480 als auch in DIN EN 12952 sind<br />
besondere Verfahren zur Stichprobenerhöhung bei Reparaturen<br />
beschrieben. Bezugsbasis dafür sind die Komponente, der<br />
beteiligte Schweißer und der Schweißnahttyp (bezogen auf<br />
eine Schweißanweisung). Die dort geforderte Vorgehensweise<br />
ist bei den im Großkesselbau vorkommenden Mengen an<br />
Schweißnähten und Schweißpersonal nur unter großem Aufwand<br />
umzusetzen. Auch hier bietet das Programm dem Qualitätsverantwortlichen<br />
eine schnelle Übersicht, welche Anzahl<br />
von Nähten noch zusätzlich geprüft werden muss.<br />
Schweiß-, glüh- und prüftechnische<br />
Enddokumentation<br />
Mit dem Abschluss aller schweiß-, glüh- und prüftechnischen<br />
Aktivitäten innerhalb einer MSP-Position ist die Enddokumentation<br />
abrufbar (Bild 5). Für das montageleitende Personal<br />
ergibt dies einen entscheidenden Rationalisierungseffekt.<br />
stand (Schweißen, Glühen und Prüfen) innerhalb des Vorhabens<br />
(Bild 6).<br />
Fazit und aktueller Stand<br />
Als WebStart-Anwendung wird das Programm beim Start aus<br />
dem Internet geladen, das garantiert eine automatische Aktualisierung<br />
der Clients. Bei jeder Anmeldung am System wird<br />
eine Überprüfung vorgenommen und ggf. neuere Komponenten,<br />
die von der RIFF Systemhaus GmbH freigegeben sind, heruntergeladen<br />
und verwendet.<br />
Anders als bei Browser basierten Anwendungen gibt es<br />
keine Ansichts- und Funktionseinschränkungen durch nicht<br />
darstellbare Steuerelemente im Webbrowser.<br />
BIMAS-WEB ist zurzeit in 20 Projekten im Einsatz. Diese<br />
beinhalten 40.000 Schweiß- und Prüfplanpositionen mit<br />
insgesamt 800.000 bisher geschweißten Nähten. An diesen<br />
Nähten wurden 500.000 zerstörungsfreie Prüfungen durchgeführt,<br />
davon entfielen ca. 50 % auf die RT-Prüfung.<br />
Das Programm ermöglicht in effizienter Weise die Verwaltung,<br />
die Auswertung und die Darstellung umfangreicher<br />
schweiß- und prüftechnischer Daten hinsichtlich<br />
des aktuellen Arbeits- und Erfüllungsstandes durchzuführender<br />
Schweiß- und Prüfarbeiten,<br />
der komplexen Qualitätsbewertung durchgeführter<br />
Schweißarbeiten objekt- und schweißerbezogen,<br />
der Bereitstellung der erforderlichen schweiß-, glüh- und<br />
prüftechnischen Dokumentation.<br />
Es setzt Zwangsbedingungen für die Überschaubarkeit der<br />
Arbeitsabläufe: Schweißen, Glühen, Prüfen und leistet damit<br />
einen Beitrag zur Rationalisierung der Auftragsabwicklung.<br />
Permanente Analyse, ein bestimmendes<br />
Element der Qualitätssicherung<br />
Die Montageschweißungen an Kesselkomponenten werden<br />
manuell ausgeführt (Platzverhältnisse). Damit erhält die Bewertung<br />
der Arbeitsqualität der eingesetzten Schweißer nach<br />
verschiedenen Aspekten besonders Gewicht. Diese Tiefenanalysen<br />
sind bei großen, über einen längeren Zeitraum laufende<br />
Vorhaben nur computergestützt möglich. BIMAS-WEB<br />
ermöglicht das mit Rückgriff auf die eingespeicherten Daten<br />
in effizienter Weise. Das gleiche gilt für den Abarbeitungs-<br />
Autor<br />
Helmut Riff<br />
Riff Systemhaus GmbH, Herten<br />
Tel: +49 2366/567362-0<br />
E-Mail: hr@riff-systemhaus.info<br />
5 / <strong>2012</strong> 413
Projekt kurz beleuchtet<br />
Anlagenbau<br />
GFK-Rohre versorgen das<br />
GDF SUEZ-Kraftwerk<br />
Wilhelmshaven mit Kühlwasser<br />
Zu den Kraftwerksneubauten in Deutschland, deren Fertigstellung nach den aktuellen energiepolitischen Beschlüssen dringender<br />
denn je erwartet wird, gehört das moderne Kohlekraftwerk, das die GDF SUEZ-Gruppe derzeit an der Jade in Wilhelmshaven<br />
baut. Auch bei diesem Kraftwerksprojekt ist der Rohrhersteller Amitech Germany, Mochau, mit von der Partie: GFK-<br />
Wickelrohre des Systems FLOWTITE kommen in Nennweiten bis zu DN 2600 als Druckrohre (On-Shore) für den Kühlwasserkreislauf<br />
zum Einsatz.<br />
Wirkungsgrad von 46 %<br />
Es ist eines der großen Kraftwerksneubauten in Deutschland<br />
und technologisch ein Meilenstein: Das 800 MW-Kohlekraftwerk<br />
Wilhelmshaven, das seit 2008 auf dem Rüstersieler Groden<br />
an der Jade durch die GDF SUEZ-Gruppe gebaut wird.<br />
Das Kraftwerk zeichnet sich vor allem durch den hohen Wirkungsgrad<br />
von 46 % aus.<br />
Zum hohen Wirkungsgrad trägt nicht zuletzt auch die<br />
Kühltechnik bei. Am Rüstersieler Groden setzt man auf das<br />
Prinzip der Durchlaufkühlung mit fließendem Wasser statt<br />
auf Konvektionskühlung und Kühltürme. Das Wasser im geschlossenen<br />
Dampf-/Kondensatkreislauf erreicht bei Drücken<br />
bis zu 280 bar Temperaturen von 620 °C. Der beim<br />
Durchlauf durch die mehrstufige Turbine entspannte Heißdampf<br />
wird im Kondensator von einem Wärmetauscher in die<br />
Flüssigphase heruntergekühlt und dann wieder dem Dampferzeuger<br />
zugeführt. Um die Kondensation zu erreichen, bedarf<br />
es erheblicher Wassermengen – bei Volllast bis zu 36<br />
Bild 1: Die nach Maß gefertigten GFK-Wickelrohre wurden auf Stahlstützen in Endlage in der Baugrube fixiert. Später wurden<br />
Rohre und Stützen samt dem nachfolgenden Vorlaufsystem in Beton eingegossen<br />
414 5 / <strong>2012</strong>
Bild 2: Segmentbögen DN 2600 – Vorbereitung zur<br />
Anbindung an die Auslaufleitung<br />
Kubikmeter pro Sekunde. Dies stellt ein voluminöser Wasserkreislauf<br />
auf der kalten Seite des Wärmetauschers sicher,<br />
dessen Ausgangspunkt das Tiefwasser der Jade ist.<br />
Über vier 15 m tief liegende und 316 m lange Betonrohre<br />
DN 3400 mit PP-Inliner, unter dem Deich im Vortriebsverfahren<br />
eingebaut, wird das Wasser zu- und abgeführt.<br />
Für den weiteren Transport zum Kondensator sorgen<br />
mächtige Pumpen – und große GFK-Druckrohre, die in der<br />
patentierten FLOWTITE-Wickeltechnik bei Amitech Germany<br />
gefertigt wurden. Jeder der vier Vorlauf-Rohrstränge fördert<br />
bei Volllast-Betrieb 8 m 3 Wasser pro Sekunde. Auch auf der<br />
Rücklaufseite setzt man auf GFK-Wickelrohr: Hier wurden<br />
2011 zwei parallele Rohrstränge der Nennweite DN 2600 installiert.<br />
Ingenieurtechnische Kompetenz<br />
gefragt<br />
Für GFK entschied man sich einerseits wegen der auch in solch<br />
großen Nennweiten noch vergleichsweise einfachen Handhabbarkeit<br />
des GFK-Systems, die in seinem geringen spezifischen<br />
Gewicht begründet liegt. Andererseits bietet GFK Materialkennwerte,<br />
die in den relevanten Parametern durchaus<br />
mit Stahl vergleichbar sind. Vor allem aber bietet GFK eine extreme<br />
Bandbreite an konstruktiven Möglichkeiten, mit der<br />
sich die hoch komplexen Leitungsführungen im Kraftwerk<br />
Wilhelmshaven problemlos realisieren lassen. Hier mussten in<br />
Nennweiten von DN 2000 zugfeste Bögen bis zu 90° dreidimensional<br />
hergestellt und montiert werden. Da geht es dann<br />
auch nicht nur um Rohre und Formteile, sondern um die ingenieurtechnische<br />
Kompetenz und Erfahrung auf der Herstellerseite,<br />
die zur erfolgreichen Realisierung solcher Projekte<br />
unverzichtbar sind.<br />
Was die Zugfestigkeit angeht, sind die Kühlwasserleitungen<br />
in Wilhelmshaven technisch doppelt abgesichert: Einerseits<br />
fügte man die Bogen-Segmente, ebenso wie alle Rohrverbindungen,<br />
in Laminattechnik zusammen. Dazu waren<br />
während der gesamten Bauzeit Experten von Amitech im Einsatz.<br />
Andererseits wurden die Kühlwasserrohre letztlich in den<br />
massiven Betonsockel eingegossen. Zwischen zwei großen<br />
Trustblöcken kam in der Nennweite DN 2600 die Keylock-<br />
Steckmuffenverbindung zum Einsatz. Durch dessen zulässige<br />
Abwinklung in den Verbindungsmuffen wird so spätere Bodensetzung<br />
gut ausgeglichen.<br />
Bild 3: Die Baugrube für die mächtigen Hauptrohrstränge<br />
des Rücklaufsystems: Ihre Sohle wurde mit tief in<br />
den Boden gerammten Stahlankern gegen ein Absinken der<br />
gesamten Konstruktion im Nordsee-Sediment gesichert<br />
Lieferumfang<br />
Insgesamt lieferte Amitech Germany nach Wilhelmshaven:<br />
280 m Rücklaufrohre DN 2600 PN 6 SN 10000<br />
230 m Vorlaufrohre DN 2000 PN 6 SN 10000 (biaxial)<br />
12 Bögen 45° im Vorlauf DN 2000 PN 6 SN 10000<br />
(biaxial)<br />
vier Bögen 90° im Rücklauf DN 2600 PN 6 SN 10000<br />
zwei Reduzierungen RD 2600/2000 PN 6 SN 10000<br />
Mit solch beeindruckenden Leistungsdaten stehen die Kühlwasserleitungen<br />
des Kraftwerks Wilhelmshaven als technische<br />
Referenz in einer Reihe unter anderem mit dem neuen<br />
Gaskraftwerk Irsching bei Ingolstadt. Auch dessen riesige<br />
Gasturbine, die jüngst einen Wirkungsgrad-Weltrekord aufstellte,<br />
wird über ein Kreislauf-System von GFK-Wickelrohren<br />
gekühlt.<br />
Was die reine Größe von Rohren angeht, macht Amitech<br />
sich in Wilhelmshaven sogar selbst Konkurrenz. Nur einen<br />
Steinwurf weit von der Kraftwerksbaustelle auf dem Rüstersieler<br />
Groden entstand zeitgleich zum Kraftwerk der neue JadeWeserPort.<br />
Dafür, dass das auf dem riesigen Hafenterminal<br />
anfallende Niederschlagswasser auch bei Starkregen problemlos<br />
in die Nordsee abgeführt werden kann, sorgen gleichfalls<br />
GFK-Wickelrohre von Amitech Germany – hier sogar in<br />
Nennweiten bis zu DN 3000.<br />
Kontakt<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau, Tel. +49 3431 7182 0,<br />
E-Mail: presse@amitech-germany.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 415
Projekt kurz beleuchtet<br />
Anlagenbau<br />
Hebelösung gewährleistet sichere<br />
Montage auf Großbaustelle<br />
Die LGH GmbH, weltweit größter Vermieter für Hebezeuge,<br />
Transportgeräte und Anschlagmittel, bietet als einziger Anbieter<br />
in Deutschland das modulare 4-Punkt-Spreizen-System<br />
an. Wie wichtig diese flexible Hebelösung auf heutigen<br />
Großbaustellen ist, zeigt sich beim Aufstellen des Abhitzedampferzeugers<br />
des neuen Gas- und Dampfkraftwerks in<br />
Bonn. Dort konnten dank des Spreizen-Systems die bis zu<br />
30 t schweren Kesselkomponenten auf eine Höhe von 45 m<br />
schnell, effizient und sicher angehoben werden.<br />
Umbau zum GuD<br />
Die Stadtwerke Bonn bauen derzeit das bestehende Heizkraftwerk<br />
Nord zum Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) um.<br />
Dank des hohen Wirkungsgrades von 60 % sinken so die CO 2<br />
-<br />
Emissionen um 192.000 t jährlich. Gemeinsam mit dem Duisburger<br />
Kraftwerksanlagenbauer XERVON Energy und dem<br />
Unternehmen für Schwerlastlogistik und Turmdrehkrane<br />
Breuer & Wasel aus Bergheim wird dieser Großauftrag umgesetzt.<br />
Das Aufstellen des Abhitzedampferzeugers erforderte<br />
höchste Präzision, da mit zunehmender Montagehöhe<br />
die Anforderungen hinsichtlich Handling und Sicherheit stark<br />
zunehmen. Nachdem der Kessel bis zu einer Höhe von 28 m<br />
fertig montiert worden war, kam das modulare 4-Punkt-<br />
Spreizen-System mit einer Tragfähigkeit von 55 t zum Einsatz.<br />
Ein Raupenkran Liebherr LR 1600 mit 600 t Tragfähigkeit<br />
von Breuer & Wasel konnte so die drei letzten, bereits am<br />
Boden vormontierten, rechteckigen Kesselkomponenten mit<br />
dem modularen 4-Punkt-Spreizen-System heben.<br />
Bild 1: Das 4 Punkt-Spreizen-System wurde vor dem Projekt<br />
individuell angepasst und war auf der Baustelle sofort einsatzbereit<br />
Bild 2: Das modulare 4 Punkt-Spreizen-System der LGH eignet<br />
sich besonders für Lasten die vier oder mehr Anschlagpunkte<br />
erfordern<br />
416 5 / <strong>2012</strong>
Bild 3: Vorbereitungen am Boden: Die äußerst niedrige<br />
Bauhöhe des 4 Punkt-Spreizen-Systems gewährleistet einfaches<br />
Handling<br />
Bild 4: Die 13 m hohe Schalldämpferhaube ist das oberste Bauteil<br />
des Abhitzedampferzeugers und wurde auf einer Höhe von 32 m<br />
montiert.<br />
Zunächst sind zwei gleich große Kesselbauteile – jeweils 8<br />
mal 4 m breit, bis zu 1,80 m hoch und 30 t schwer – nacheinander<br />
angehoben und auf den bereits vormontierten Kesseldruckteil<br />
aufgesetzt worden. Die 4-Punkt-Spreize konnte hierbei<br />
ihre Stärken in puncto Stabilität ganz ausspielen: Denn die<br />
vier Anschlagpunkte gewährleisten eine hohe Lastenstabilität.<br />
„Die Zusammenarbeit mit der LGH hat die Montage des Abhitzedampferzeugers<br />
entscheidend erleichtert und sicherer<br />
gemacht”, erklärt Rudolf Drescher, Oberbauleiter bei XERVON<br />
Energy, Hersteller des Abhitzedampferzeugers. „Mit dieser Lösung<br />
mussten wir keine Untertraversen miteinander koppeln,<br />
sondern konnten die Module direkt und ohne langes Hantieren<br />
an vier Stellen verankern – essentiell für eine gute Stabilität.”<br />
32 m Montagehöhe<br />
Anschließend erforderte dann auch das oberste und letzte<br />
Bauteil des Abhitzedampferzeugers, die Schalldämpferhaube,<br />
in einer Montagehöhe von 32 m ein flexibles Arbeitsgerät<br />
während des Hebevorgangs. Das zu montierende Bauteil<br />
konnte aufgrund seiner besonderen Form mit einer rechteckigen<br />
Grundfläche und dem pyramidenartigen Überbau ausschließlich<br />
an vier Punkten befestigt werden.<br />
„Die letzte Komponente war insgesamt 13 m hoch, daher<br />
war es besonders wichtig, dass sich das 4-Punkt-Spreizen-<br />
System durch die modulare Bauweise problemlos dem Bauteil<br />
anpassen lässt und so für ein einfacheres Handling sorgt”, so<br />
Thomas Wagner, technischer Außendienst bei Breuer & Wasel,<br />
dem ausführenden Kranunternehmen. „Klassische Traversen<br />
haben den großen Nachteil, dass durch mehrfaches Koppeln<br />
häufig Schrägzug entsteht. Zudem erhöht sich durch das<br />
Unterkoppeln dann auch immer noch zusätzlich die Bauhöhe<br />
– was bei dieser bereits hohen Montagehöhe nicht wünschenswert<br />
war. Mit dem 4-Punkt-Spreizen-System konnten<br />
wir deutlich sicherer und schneller agieren und haben uns<br />
durch die direkte Verankerung an den vier Punkten sogar noch<br />
einiges an Kosten gespart.“<br />
Das modulare 4-Punkt-Spreizen-System von der LGH<br />
wurde im Vorfeld individuell auf das Bauvorhaben angepasst<br />
und war somit vor Ort direkt einsatzbereit.<br />
Kontakt<br />
LGH GmbH, Essen, Tel. +49 201 74705-0, E-Mail: info@<br />
lghgroup.de, www.lgh.eu<br />
5 / <strong>2012</strong> 417
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – brbv<br />
Spartenübergreifend<br />
Grundlagenschulungen<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Grundlagenschulung<br />
ganzjährig Gera, Greifswald<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Nachschulung<br />
ganzjährig Gera, Greifswald<br />
Stecken, Pressen und Klemmen von Kunststoffrohren<br />
ganzjährig bundesweit<br />
Baustellenabsicherung und Verkehrssicherung<br />
RSA/ZTV-SA – 1 Tag<br />
25.09.<strong>2012</strong> München<br />
08.10.<strong>2012</strong> Sulzbach<br />
Baustellenabsicherung und Verkehrssicherung<br />
RSA/ZTV-SA – 2 Tage<br />
08./09.10.<strong>2012</strong> Frankfurt/Main<br />
09./09.12.<strong>2012</strong> Sulzbach<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Seminar für Führungskräfte aus der Bauund<br />
Versorgungswirtschaft<br />
16./17.07.<strong>2012</strong> Grainau am Eibsee<br />
Erneuerbare Energien – Biogas<br />
27.09.<strong>2012</strong> Hannover<br />
Spartenübergreifende Hausanschlusstechnik<br />
10.10.<strong>2012</strong> Kerpen<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und Sanierung<br />
17.10.<strong>2012</strong> Nürnberg<br />
14.11.<strong>2012</strong> Oldenburg<br />
18.12.<strong>2012</strong> Potsdam<br />
Arbeitsvorbereitung und Kostenkontrolle<br />
im Rohrleitungsbau – Arbeitskalkulation<br />
18.10.<strong>2012</strong> Berlin<br />
Neue Entwicklungen bei den Anwendungen<br />
und Einbauverfahren duktiler Guss-Rohrsysteme<br />
09./10.10.<strong>2012</strong> Frankfurt/Main<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und Sanierung<br />
17.10.<strong>2012</strong> Nürnberg<br />
14.11.<strong>2012</strong> Oldenburg<br />
18.12.<strong>2012</strong> Potsdam<br />
Arbeitssicherheit im Tief- und Leitungsbau<br />
08.11.<strong>2012</strong> Mannheim<br />
06.12.<strong>2012</strong> Münster<br />
Baurecht <strong>2012</strong><br />
08.11.<strong>2012</strong> Potsdam<br />
27.11.<strong>2012</strong> Bielefeld<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren<br />
– Fortbildungsveranstaltung nach GW 329<br />
05.12.<strong>2012</strong> Kassel<br />
Bauausführung<br />
12.12.<strong>2012</strong> Nürnberg<br />
Abnahme und Gewährleistung<br />
13.12.<strong>2012</strong> Nürnberg<br />
Gas/Wasser<br />
Grundlagenschulungen<br />
Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser – Vollzeitlehrgang<br />
20.08.<strong>2012</strong>-15.03.2013 Berlin, Dresden,<br />
Köln<br />
Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser – Vollzeitlehrgang<br />
20.08.<strong>2012</strong>-15.03.2013 Berlin, Dresden,<br />
Köln<br />
Fachkraft für die Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 316-2<br />
24.-28.09.<strong>2012</strong> Frankfurt/Main<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
03.-07.09.<strong>2012</strong> Hannover<br />
22.-26.10.<strong>2012</strong> Aachen<br />
19.-23.11.<strong>2012</strong> Hannover<br />
26.-30.11.<strong>2012</strong> Würzburg<br />
26.-30.11.<strong>2012</strong> Leipzig<br />
Vermessungsarbeiten an Gas- und Wasserrohrnetzen<br />
nach DVGW Hinweis GW 128<br />
– Grundkurs<br />
ganzjährig bundesweit<br />
Vermessungsarbeiten an Gas- und Wasserrohrnetzen<br />
nach DVGW Hinweis GW 128<br />
– Nachschulung<br />
ganzjährig bundesweit<br />
Fachkraft für die Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 316-2<br />
24.-28.09.<strong>2012</strong> Frankfurt/Main<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
ganzjährig bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
ganzjährig bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerungskurs<br />
ganzjährig bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen, und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Grundkurs<br />
ganzjährig bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen, und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Nachschulung<br />
ganzjährig bundesweit<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
ganzjährig Bad Zwischenahn, Gera,<br />
Greifswald, Leipzig<br />
Kontaktadresse<br />
brbv<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
GmbH, Köln,<br />
Tel. 0221/37 658-20,<br />
E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
Lehrgänge – RSV<br />
ZKS-Berater-Lehrgänge<br />
Modulare Schulung <strong>2012</strong><br />
Kerpen<br />
10.-15.09.<strong>2012</strong><br />
24.-29.09.<strong>2012</strong><br />
15.-19.10.<strong>2012</strong><br />
12.-17.11.<strong>2012</strong><br />
Feuchtwangen<br />
17.-22.09.<strong>2012</strong><br />
08.-13.10.<strong>2012</strong><br />
05.-09.11.<strong>2012</strong><br />
26.11.-01.12.<strong>2012</strong><br />
Bad Zwischenahn<br />
24.-29.09.<strong>2012</strong><br />
15.-20.10.<strong>2012</strong><br />
12.-16.11.<strong>2012</strong><br />
03.-08.12.<strong>2012</strong><br />
Kontaktadresse<br />
RSV<br />
RSV – Rohrleitungssanierungsverband e. V.,<br />
49811 Lingen (Ems), Tel. 05963/9 81 08 77,<br />
Fax 05963/9 81 08 78, E-Mail: rsv-ev@<br />
t-online.de, www.rsv-ev.de<br />
418 5 / <strong>2012</strong>
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – Verschiedene<br />
DVGW<br />
Intensivschulungen<br />
Abnahme von Druckprüfungen an Gas- und<br />
Wasserrohrleitungen<br />
13.11.<strong>2012</strong> Walsrode<br />
Abnahme von Druckprüfungen an Trinkwasserrohrleitungen<br />
06.11.<strong>2012</strong> Karlsruhe<br />
04.12.<strong>2012</strong> Hannover<br />
11.12.<strong>2012</strong> Herdecke<br />
GWI<br />
Seminare<br />
Sachkundigenschulung Gas-Druckregelund<br />
-Messanlagen im Netzbetrieb und in<br />
der Industrie<br />
03.-05.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Praxis der Prüfung von Gas-Messanlagen<br />
nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 492<br />
10./11.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Arbeiten an Gasleitungen bei unkontrollierter<br />
Gasausströmung – Schulung nach<br />
BGR 500<br />
12.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Erfahrungsaustausch und Weiterbildung<br />
der Sachkundigen für Odorieranlagen<br />
12./13.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Arbeiten an freiverlegten Gasrohrleitungen<br />
auf Werksgelände und im Bereich<br />
betrieblicher Gasverwendung gemäß<br />
DVGW G 614<br />
18.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Neuerungen im Bereich Gasmessung und<br />
Gasabrechnung<br />
18./19.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Gas-Druckregel- und Messanlagen<br />
19./20.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Neuerungen im Bereich Gasmessung und<br />
Gasabrechnung<br />
18./19.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Gasspüren und Gaskonzentrationsmessungen<br />
22./23.10.<strong>2012</strong> Essen<br />
HDT<br />
Seminare<br />
Festigkeitsmäßige Auslegung von Druckbehältern<br />
03./04.12.<strong>2012</strong> Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
25./26.09.<strong>2012</strong> Kochel<br />
06./07.11.<strong>2012</strong> Essen<br />
04./05.12.<strong>2012</strong> Leibstadt, Schweiz<br />
Rohrleitungsplanung für Industrie- und<br />
Chemieanlagen<br />
22./23.11.<strong>2012</strong> Berlin<br />
Die Europäische Norm EN 1591 zur<br />
Flanschberechnung<br />
20.09.<strong>2012</strong> Essen<br />
Dichtungen – Schrauben – Flansche<br />
20.09.<strong>2012</strong> Berlin<br />
Verfahren zur Montage und Demontage<br />
von Dichtverbindungen an Rohrleitungen<br />
und Apparaten<br />
07.11.<strong>2012</strong> Essen<br />
Dichtungstechnik im Rohrleitungs- und<br />
Apparatebau<br />
15.11.<strong>2012</strong> Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
21./22.11.<strong>2012</strong> Essen<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
13.09.<strong>2012</strong> München<br />
25.10.<strong>2012</strong> Essen<br />
Radiodetection<br />
Praxisseminare<br />
Kabel- und Leitungsortung – Grundmodul<br />
18./19.09.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
06./07.11.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
13./14.11.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
Kabel- und Leitungsortung – Aufbaumodul<br />
15./16.05.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
04./05.12.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
Kabelfehlerortung<br />
27.-29.11.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
Tiefbau<br />
15.11.<strong>2012</strong> Erfurt<br />
TAH<br />
Seminare<br />
Auf den Punkt gebracht <strong>2012</strong><br />
06.11.<strong>2012</strong> Karlsruhe<br />
07.11.<strong>2012</strong> Mainz<br />
08.11.<strong>2012</strong> Mönchengladbach<br />
27.11.<strong>2012</strong> Salzburg<br />
28.11.<strong>2012</strong> Nürnberg<br />
29.11.<strong>2012</strong> Leipzig<br />
Lehrgang zum Zertifizierten Kanalsanierungs-Berater<br />
<strong>2012</strong><br />
ab 10.09.<strong>2012</strong> Heidelberg<br />
ab 08.10.<strong>2012</strong> Weimar<br />
TAW<br />
Seminare<br />
Verfahrenstechnische Erfahrungsregeln bei<br />
der Auslegung von Apparaten und Anlagen<br />
12./13.11.<strong>2012</strong> Wuppertal<br />
Rohrleitungen in verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
23./24.10.<strong>2012</strong> Wuppertal<br />
Überdrucksicherungen, Sicherheitsventile<br />
und Berstscheiben auswählen, dimensionieren<br />
und betreiben<br />
05./06.11.<strong>2012</strong> Altdorf<br />
Schweißtechnik an Rohren in der chemischen<br />
Industrie und im Anlagenbau<br />
14./15.11.<strong>2012</strong> Wuppertal<br />
Kontaktadresse<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V., Bonn; Tel. 0228/9188-607,<br />
Fax 0228/9188-997, E-Mail: splittgerber@<br />
dvgw.de, www.dvgw.de<br />
GWI<br />
Gas- und Wärme-Institut Essen e.V., Essen;<br />
Frau B. Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146, E-Mail: hohnhorst@<br />
gwi-essen.de, www.gwi-essen.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik, Essen; Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
Radiodetection CE<br />
Tel. 02851/9237-20, Fax 02851/9237-520,<br />
E-Mail: rd.sales.de@spx.com,<br />
www.de.radiodetection.com<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.;<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
TAW<br />
Technische Akademie Wuppertal;<br />
Dr.-Ing. Ulrich Reith,<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
5 / <strong>2012</strong> 419
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – Verschiedene<br />
Veranstaltungen zum<br />
Korrosionsschutz<br />
Tagungen<br />
EuroCorr<strong>2012</strong><br />
09.-13.09.<strong>2012</strong> Istanbul, Türkei,<br />
info@eurocorr<strong>2012</strong>.org,<br />
www.eurocorr<strong>2012</strong>.org<br />
fkks Infotag 2013<br />
29.01.2013 Esslingen<br />
49. Jahreshauptversammlung des fkks<br />
Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e.V.<br />
30.01.2013 Esslingen<br />
ZfW<br />
Seminar<br />
Qualitätssicherung bei Gashochdruckleitungen<br />
27.-29.11.<strong>2012</strong> Trier<br />
Kontaktadresse<br />
ZfW<br />
Zentrum für Weiterbildung des Instituts für<br />
Rohrleitungsbau Oldenburg, Anke Lüken,<br />
Tel. 0441-361039-20,<br />
E-Mail: anke.lueken@jade-hs.de, www.<br />
jade-hs.de/weiterbildung/zentrum-fuerweiterbildung/<br />
Messen und Tagungen<br />
4. Deutscher Tag der Grundstücksentwässerung<br />
19.06.<strong>2012</strong> in Dortmund; Technische Akademie Hannover e.V., Tel.<br />
0511/39433-30, Fax 0511/39433-40, E-Mail: info@<br />
ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
<strong>ACHEMA</strong> <strong>2012</strong><br />
18.-22.06.<strong>2012</strong> in Frankfurt/Main; DECHEMA, Dr. Kathrin Rübberdt, Tel.<br />
069/7564-277/-296, Fax: 069/7564-272, E-Mail:<br />
presse@dechema.de, www.achema.de<br />
geofora<br />
21./22.06.<strong>2012</strong> Fachmesse und Kongress für Bohrtechnik, Wassergewinnung<br />
und Geothermie in Hof; figawa Service<br />
GmbH, Dipl.-Ing. Mario Jahn, Tel. 0221/37668-20, Fax<br />
0221/37668-63, E-Mail: jahn@geofora.de, www.figawaservice.de<br />
10. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung<br />
27./28.06..<strong>2012</strong> mit Fachausstellung; SKZ –ConSem GmbH, Alexander Hefner,<br />
Tel. 0931/4104-164, Fax 0931/4104-227, E-Mail:<br />
a.hefner@skz.de oder unter www.skz.de<br />
wat <strong>2012</strong><br />
24./25.09.<strong>2012</strong> in Dresden; DVGW-Hauptgeschäftsführung, Petra Salz, Tel.<br />
0228/9188-604, E-Mail: salz@dvgw.de oder unter www.<br />
wat-dvgw.de<br />
gat <strong>2012</strong><br />
25./26.09.<strong>2012</strong> in Dresden; DVGW-Hauptgeschäftsführung, Petra Salz, Tel.<br />
0228/9188-604, E-Mail: salz@dvgw.de oder unter www.<br />
wat-dvgw.de<br />
16. Workshop Kolbenverdichter<br />
24./25.10.<strong>2012</strong> in Rheine; KÖTTER Consulting Engineers KG, Martina<br />
Brockmann/Nadja Schoppe, Tel. 05971/9710-65, Fax<br />
05971/9710-43, E-Mail: martina.brockmann@koetterconsulting.com,<br />
www.koetter-consulting.com, www.kceakademie.de<br />
2. Praxistag Wasserversorgungsnetze - Leckortung und<br />
Netzoptimierung<br />
06.11.<strong>2012</strong> in Essen; Vulkan-Verlag, Barbara. Pflamm, Tel.<br />
0201/82002-28, Fax 0201/82002-40, E-Mail:<br />
b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau OT Großsteinbach 345<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim 327<br />
Düker GmbH & Co. KGaA, Laufach 333<br />
HOBAS Rohre GmbH, Neubrandenburg<br />
Teilbeilage<br />
NORMA Germany GmbH, Maintal 341<br />
PSI Products GmbH, Mössingen 339<br />
SIMONA AG, Kirn 331<br />
WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH, Ditzingen<br />
Titelseite<br />
Marktübersicht 377–386<br />
420 5 / <strong>2012</strong>
Impressum<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49(0)201-82002-0, Telefax +49(0)201-82002-40.<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56,<br />
45128 Essen, Telefon +49(0)201-82002-33,<br />
Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Telefon +49(0)201-82002-<br />
35, Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer, Vulkan-Verlag/Oldenbourg Industrieverlag<br />
GmbH, Telefon +49(0)89-45051-471, Telefax +49(0)89-<br />
45051-300, E-Mail: mittermayer@oiv.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL, Postfach 91 61, 97091<br />
Würzburg, Telefon +49(0)931-4170-1616, Telefax +49(0)931-<br />
4170-492, E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Gestaltung, Satz und Druck<br />
Gestaltung: deivis aronaitis design I dad I,<br />
Leonrodstraße 68, 80636 München<br />
Satz: e-Mediateam Michael Franke, Breslauer Str. 11,<br />
46238 Bottrop<br />
Druck: Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 268,- + € 27,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 268,- + € 31,50 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 34,- +<br />
€ 3,- Versand; Einzelheft (Ausland): € 34,- + € 3,50 Versand;<br />
Einzelheft als ePaper (PDF): € 34,-; Studenten: 50 % Ermäßigung<br />
auf den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten<br />
bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede Buchhandlung<br />
möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der<br />
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Auch die<br />
Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung,<br />
im Magnettonverfahren oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung<br />
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der<br />
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V., Köln · Rohrleitungsbauverband<br />
e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband e.V., Essen ·<br />
Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten, Gasmeßund<br />
Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld, Vorsitzender des<br />
Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik<br />
und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) · Dipl.-Ing. K. Küsel, Heinrich<br />
Scheven Anlagen-und Leitungsbau GmbH, Erkrath · Dipl.-Volksw. H. Zech,<br />
Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln · Rechtsanwalt<br />
C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing. Th. Grage,<br />
Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen · Dr.-Ing.<br />
A. Hilgenstock, E.ON Ruhrgas AG, Technische Kooperationsprojekte, Kompetenzcenter<br />
Gastechnik und Energiesysteme /(Netztechnik), Essen · Dipl.-<br />
Ing. D. Homann, IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, RWE –<br />
Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH, Dortmund · Dipl.-Ing.<br />
J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dr. H.-C. Sorge, IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für Wasser, Biebesheim · Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter<br />
des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen · Dipl.-Ing.<br />
D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG · W. Burchard, Geschäftsführer<br />
des Fachverbands Armaturen im VDMA, Frankfurt · Bauassessor<br />
Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Köln ·<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren ·<br />
Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes<br />
e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn, BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing.<br />
B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure GmbH, München · Dr.-Ing. W. Lindner,<br />
Vorstand des Erftverbandes, Bergheim · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer<br />
des Kunststoffrohrverbands e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß,<br />
Mitglied des Vorstandes, FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD<br />
Systems GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der<br />
Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · Dipl.‐Berging.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer<br />
der ARKIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener, Institut<br />
für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg · Prof. Dr.-Ing.<br />
B. Wielage, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische Universität<br />
Chemnitz-Zwickau · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer Geschäftsführer der<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen
6. Praxistag<br />
mit neuem<br />
Internet auftritt:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Korrosionsschutz<br />
am 13. Juni <strong>2012</strong> in Gelsenkirchen<br />
Programm<br />
Moderation:<br />
U. Bette, Technische Akademie Wuppertal<br />
Strategien für die Optimierung des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes von Rohrleitungen unter Wechselspannungsbeeinflussung<br />
Dr. M. Büchler, SGK Schweizerische Gesellschaft<br />
für Korrosionsschutz, Zürich<br />
Neues Berechnungsverfahren für Erderspannungstrichter<br />
R. Watermann, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
Prof. Dr. R. Schröder, TFH Bochum, Bochum<br />
Wechselstromkorrosion – Ergebnisse von Messungen an<br />
ER-Coupons mit einem 16-Bit-Digital-Speicher-Oszilloskop<br />
U. Bette, Technische Akademie Wuppertal, Wuppertal<br />
MiniLog2: der Datenlogger für den KKS und<br />
Pfadfinder in die Cloud<br />
Th. Weilekes, Weilekes Elektronik GmbH, Gelsenkirchen<br />
Smart KKS: Integration von KKS-Messdaten in die<br />
bestehende Infrastruktur eines Netzbetreibers<br />
M. Müller, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
Polyamidumhüllung als Verschleißschutz<br />
bei der Verlegung von Stahlleitungsrohren<br />
mittels grabenloser Verfahren<br />
Dr. H.-J. Kocks, Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
Nachumhüllung von Schweißnähten<br />
für besondere Einsatzfälle<br />
A. Drees, Kettler GmbH & Co. KG, Herten-Westerholt<br />
Ziehkopf zur Überwachung der Umhüllung während<br />
des Einzugs der Rohrleitung beim HDD-Verfahren<br />
H. Engelke, EWE Oldenburg<br />
Modul zur Korrosionskalkulation<br />
bei nicht molchbaren Leitungen<br />
Th. Laier, RWE – Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH,<br />
Dortmund<br />
Aktuelle Entwicklungen im Regelwerk<br />
H. Gaugler, SWM, München<br />
Wann und Wo?<br />
Veranstalter:<br />
Veranstalter<br />
<strong>3R</strong>, fkks<br />
Termin: Mittwoch, 13.06.<strong>2012</strong>,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Veltinsarena, Gelsenkirchen,<br />
www.veltins-arena.de<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken,<br />
Energieversorgungs- und<br />
Korrosionsschutzfachunternehmen<br />
Teilnahmegebühr:<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und fkks-Mitglieder: 365,- €<br />
Nichtabonnenten: 395,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201-82002-55 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin fkks-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein fkks-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift