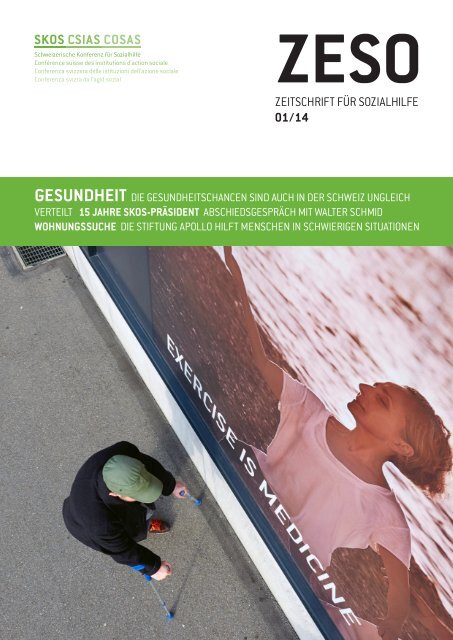ZESO 01/14
ZESO 01/14
ZESO 01/14
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SKOS CSIAS COSAS<br />
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe<br />
Conférence suisse des institutions d’action sociale<br />
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale<br />
Conferenza svizra da l’agid sozial<br />
ZeSo<br />
Zeitschrift für Sozialhilfe<br />
<strong>01</strong>/<strong>14</strong><br />
Gesundheit Die Gesundheitschancen sind auch in der Schweiz ungleich<br />
verteilt 15 Jahre skos-präsident abschiedsgespräch mit walter schmid<br />
wohnungssuche die stiftung apollo hilft Menschen in schwierigen Situationen
SCHWERPUNKT16–27<br />
gESUNDHEIT<br />
Armut macht krank, und soziale Einschränkungen<br />
führen zu gesundheitlichen Belastungen. Ein geringer<br />
Sozialstatus wird so zum Gesundheitsrisiko.<br />
Das Problem wird akzentuiert, wenn Ärzte wenig<br />
Kenntnis über die Zusammenhänge der Armutsproblematik<br />
haben, und Sozialversicherungen der<br />
psychischen Verfassung ihrer Klientinnen und<br />
Klienten zu wenig Aufmerksamkeit schenken.<br />
Durch besser abgestimmte Hilfen könnten mehr<br />
Personen mit psychischen Problemen im Arbeitsmarkt<br />
gehalten werden.<br />
<strong>ZESO</strong> zeitschrift für sozialhilfe<br />
Herausgeberin Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS,<br />
www.skos.ch Redaktionsadresse Redaktion <strong>ZESO</strong>, SKOS,<br />
Monbijoustrasse 22, Postfach, CH-3000 Bern <strong>14</strong>, zeso@skos.ch,<br />
Tel. 031 326 19 19 Redaktion Michael Fritschi Redaktionelle<br />
begleitung Dorothee Guggisberg Autorinnen und Autoren<br />
in dieser Ausgabe Niklas Baer, Franziska Ehrler, Rachèle Féret,<br />
Bettina Fredrich, Regine Gerber, Paula Lanfranconi, Lucrezia Meier-<br />
Schatz, Markus Morger, Daniela Moro, Rahel Müller de Menezes,<br />
Christian Rupp, Emine Sariaslan, Margrit Schmid, Simon Steger,<br />
Martin Wild-Näf, Hans Wolff Titelbild Rudolf Steiner layout<br />
mbdesign Zürich, Marco Bernet Korrektorat Peter Brand<br />
Druck und Aboverwaltung Rub Media AG, Postfach, 30<strong>01</strong> Bern,<br />
zeso@rubmedia.ch, Tel. 031 740 97 86 preise Jahresabonnement<br />
Inland CHF 82.– (für SKOS-Mitglieder CHF 69.–),<br />
Abonnement ausland CHF 120.–, Einzelnummer CHF 25.–.<br />
© SKOS. Nachdruck nur mit genehmigung der Herausgeberin.<br />
Die <strong>ZESO</strong> erscheint viermal jährlich.<br />
ISSN <strong>14</strong>22-0636 / 111. Jahrgang<br />
Bild: Keystone<br />
Erscheinungsdatum: 10. März 2<strong>01</strong>4<br />
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2<strong>01</strong>4.<br />
2 ZeSo 1/<strong>14</strong> inhalt
INHALT<br />
5 Nach wie vor hoher Handlungsbedarf<br />
in der Familienpolitik. Kommentar<br />
von Lucrezia Meier-Schatz<br />
6 13 Fragen an Margrit Schmid<br />
8 Die Besteuerung von Sozialhilfeleistungen<br />
schafft neue Probleme<br />
10 Praxis: Unregelmässige Einkommen<br />
– wann ist die Soziahilfeablösung<br />
möglich?<br />
11 Frühe Förderung zahlt sich aus<br />
12 «Das Eröffnen von Perspektiven<br />
ist das A und O jeder Hilfe»: Interview<br />
zum Rücktritt von Walter Schmid<br />
16 SCHWERPUNKT: gesundheit<br />
18 Armut und Unterversorgung schaden<br />
der Gesundheit<br />
21 Migrantenvereine als Plattform für die<br />
Anliegen der Gesundheitsförderung<br />
22 Psychische Krankheit und Armut<br />
sind eng miteinander verbunden<br />
24 Informationslücken an der Schnittstelle<br />
von medizinischer und sozialer<br />
Tätigkeit<br />
26 Freiwillige leisten Unterstützung bei<br />
der Bewältigung des Alltags<br />
Die verlegerin<br />
Der sozialhilfepromotor<br />
die milizsozialberater<br />
Margrit Schmid ist Verlagsleiterin des<br />
Schweizerischen Jugendschriftenwerks<br />
(SJW), das Kindern und Jugendlichen<br />
Literatur in allen vier Landessprachen<br />
bietet. Sie ist auch als Dokumentarfilmerin<br />
und Ausstellungsmacherin tätig.<br />
6<br />
Im Mai tritt SKOS-Präsident Walter Schmid<br />
nach 15 Jahren engagiertem Einsatz von<br />
seinem Amt zurück. Die SKOS nehme<br />
in einem sehr schwierigen Politikfeld<br />
eine Brückenbauerfunktion ein, sagt er<br />
im Interview, und blickt auf kommende<br />
Herausforderungen für den Verband und die<br />
Sozialhilfe.<br />
12<br />
Die Büros des Armeesozialdienstes<br />
lassen einen militärischen Kontext kaum<br />
erahnen. Hier werden die Einsätze der<br />
26 Milizsozialberater koordiniert, die im<br />
Rahmen ihres Militärdienstes Beratungen in<br />
den Rekrutenschulen durchführen.<br />
28 Professionelle Sozialarbeit bedingt<br />
flexible Vorgehensweisen<br />
30 Reportage: Wenn in der Rekrutenschule<br />
das Geld ausgeht<br />
32 Plattform: Die Stiftung Apollo hilft<br />
Benachteiligten bei der Wohnungssuche<br />
34 Lesetipps und Veranstaltungen<br />
36 Porträt: Schwester Agnes Schneider,<br />
Lehrerin in Tansania<br />
Die Missionarin<br />
30<br />
Schwester Agnes Schneider unterrichtet<br />
auch mit 74 Jahren noch an der St. Martins<br />
Girls Secondary School in Tansania. Sie hat<br />
eine Mission: Junge Frauen durch Bildung<br />
vor Aids und Drogen bewahren.<br />
36<br />
inhalt 1/<strong>14</strong> ZeSo<br />
3
Die Besteuerung von Sozialhilfeleistungen<br />
schafft neue Probleme<br />
Bei einem guten Steueraufkommen kann der Staat mehr Leistungen anbieten, was insbesondere<br />
einkommensschwachen Haushalten zugute kommt. Doch Steuern sind nicht gleich Steuern. Sie<br />
können auch Armut begünstigen. Und die Besteuerung von Sozialhilfeleistungen würde mehr<br />
Probleme schaffen, als sie löst.<br />
Steuern lassen sich grob in zwei Kategorien<br />
einteilen: in Steuern auf Einkommen und<br />
Vermögen sowie in Verbrauchssteuern. Bei<br />
den Verbrauchssteuern fällt die Mehrwertsteuer<br />
für einkommensschwache Haushalte<br />
am stärksten ins Gewicht. Einkommensschwache<br />
Haushalte geben insgesamt zwar<br />
einen kleineren Betrag, anteilmässig aber<br />
einen grösseren Teil ihres Einkommens für<br />
den unmittelbaren Konsum aus als Haushalte<br />
mit hohen Einkommen. Einkommensschwache<br />
Haushalte sind deshalb von<br />
Erhöhungen der Mehrwertsteuer stärker<br />
betroffen. Sie können ihren bereits bescheidenen<br />
Konsum nicht weiter reduzieren. In<br />
der anderen Kategorie sind für einkommensschwache<br />
Haushalte vor allem die<br />
Einkommenssteuern von Bedeutung. Für<br />
einkommensschwache Haushalte ist es wesentlich,<br />
wie Einkommen besteuert und<br />
welche Abzüge getätigt werden können<br />
und wie das Steuer- und das Sozialtransfersystem<br />
aufeinander abgestimmt sind.<br />
Zwischen Sozial- und Fiskalpolitik<br />
Das Einkommen eines Haushalts umfasst<br />
nicht nur den Lohn, sondern alle finanziellen<br />
Einkünfte des Haushalts. Dazu gehören<br />
auch Sozialversicherungs- und Bedarfsleistungen.<br />
Diese werden unterschiedlich<br />
besteuert. Die Renten der AHV und der IV<br />
sowie Leistungen der Arbeitslosenversicherung<br />
werden beispielsweise vollständig<br />
besteuert, und auch bevorschusste Alimente<br />
und Kinderzulagen werden wie Lohneinkommen<br />
besteuert. Andere Renten und<br />
Pensionen hingegen werden mit einem tieferen<br />
Steuersatz besteuert, beispielsweise<br />
Renten aus der beruflichen Vorsorge und<br />
Leibrenten. Von den Steuern ausgenommen<br />
sind Stipendien, Ergänzungsleistungen<br />
zur AHV oder IV und Leistungen der<br />
Sozialhilfe. Wie viele Steuern ein Haushalt<br />
bezahlen muss, hängt also nicht unwesentlich<br />
davon ab, wie sich sein Einkommen<br />
zusammensetzt.<br />
Neben dem Einkommen spielen bei der<br />
Berechnung der Steuern auch die Abzüge<br />
eine Rolle. Mit diesen werden teilweise explizit<br />
sozialpolitische Ziele verfolgt. So wird<br />
beispielsweise der verminderten finanziellen<br />
Leistungsfähigkeit eines Haushalts<br />
mit Kindern gegenüber einem Haushalt<br />
ohne Kinder Rechnung getragen, indem<br />
ein Kinderabzug getätigt werden kann<br />
und Kosten für die familienergänzende<br />
Kinderbetreuung in Abzug gebracht wer-<br />
Ohne sorgfältige Abstimmung zwischen dem Steuer- und dem Sozialsystem können Ineffizienz und Ungerechtigkeit entstehen.<br />
Bild: Keystone<br />
8 ZeSo 1/<strong>14</strong> position skos
den können. Solche Abzüge können Haushalte<br />
steuerlich entlasten und damit im<br />
besten Fall Armut verhindern. Allerdings<br />
schmälert eine allgemeine Erhöhung der<br />
Abzüge das Steueraufkommen, und aufgrund<br />
der progressiven Ausgestaltung des<br />
Steuersystems fällt die Steuereinsparung<br />
für tiefe Einkommen geringer aus als für<br />
hohe Einkommen. Ein weiterer Faktor ist<br />
der Steuersatz, mit dem tiefe Einkommen<br />
besteuert werden. Die Zusammenhänge<br />
zwischen dem Steuer- und dem Sozialsystem<br />
sind also vielfältig, und es braucht eine<br />
sorgfältige Abstimmung zwischen den beiden<br />
Systemen, damit beide effizient und<br />
gerecht funktionieren können.<br />
Working-Poor-Haushalte sind<br />
besonders betroffen<br />
Dies ist vor allem in Bezug auf Working-<br />
Poor-Haushalte eine Herausforderung. Für<br />
sie kann die Steuerbelastung der Tropfen<br />
sein, der das Fass zum Überlaufen bringt<br />
und die Armutsproblematik akzentuiert.<br />
Zudem kann eine mangelhafte Abstimmung<br />
der Systeme dazu führen, dass sich<br />
Working-Poor-Haushalte in einer Situation<br />
wiederfinden, in der sich Erwerbsarbeit<br />
finanziell nicht mehr lohnt, weil Erwerbseinkommen<br />
besteuert werden und Sozialleistungen<br />
nicht. Um solches zu verhindern,<br />
können Massnahmen sowohl auf<br />
Seiten der Sozial- als auch der Steuerpolitik<br />
ergriffen werden. Bei den Sozialleistungen<br />
etwa können Freibeträge auf Erwerbseinkommen,<br />
wie sie die Sozialhilfe kennt, die<br />
Steuerlast von Working-Poor-Haushalten<br />
kompensieren und dafür sorgen, dass sich<br />
Erwerbsarbeit in jedem Fall finanziell<br />
lohnt. Auf Seite der Steuerpolitik kann die<br />
Steuerbefreiung des Existenzminimums,<br />
wie sie bei den Bundessteuern und in einigen<br />
Kantonen bereits umgesetzt ist, dafür<br />
sorgen, dass die Steuerbelastung niemanden<br />
in die Armut treibt.<br />
Ein radikalerer Ansatz zur Lösung dieser<br />
Problematik sieht die Besteuerung von<br />
Sozialhilfeleistungen bei gleichzeitiger<br />
Steuerbefreiung des Existenzminimums<br />
vor. Der Bundesrat wird im Frühling einen<br />
Bericht zu einer entsprechenden parlamentarischen<br />
Vorlage veröffentlichen.<br />
Aktuelle<br />
Steuervorlagen aus<br />
armutspolitischer<br />
Perspektive<br />
«Millionen-Erbschaften besteuern<br />
für unsere AHV» (SP)<br />
Die Initiative sieht die Schaffung einer<br />
Erbschafts- und Schenkungssteuer vor. Die<br />
Einnahmen kämen zu zwei Dritteln der AHV<br />
und zu einem Drittel den Kantonen zugute.<br />
Eine solide, langfristig finanzierte AHV ist für<br />
die Bekämpfung von Armut zentral. Ob diese<br />
mit der Erbschaftssteuer erreicht werden<br />
kann, bleibt allerdings fraglich.<br />
«Für Ehe und Familie –<br />
gegen die Heiratsstrafe» (CVP)<br />
Die Initiative möchte die Nachteile verheirateter<br />
Paare gegenüber Konkubinatspaaren<br />
bei den Steuern und Sozialversicherungen<br />
ausmerzen. Die Auswirkungen sind schwierig<br />
einzuschätzen. Es ist nicht klar, ob es bei<br />
einzelnen Sozialleistungen zu Veränderungen<br />
bei der Behandlung von Ehe- respektive Konkubinatspaaren<br />
kommen wird.<br />
«Familien stärken! Steuerfreie Kinderund<br />
Ausbildungszulagen» (CVP)<br />
Angestrebt wird eine steuerliche Entlastung<br />
aller Familien. Faktisch ist die steuerliche Entlastung<br />
umso höher, je höher das Einkommen<br />
ist. Die Wirkung auf Armutsbetroffene und<br />
Haushalte im Niedriglohnbereich ist sehr<br />
gering bis nichtig, gleichzeitig kommt es zu<br />
erheblichen Steuerausfällen.<br />
Die SKOS hat den Vorschlag analysiert.<br />
Es hat sich gezeigt, dass die Besteuerung<br />
von Sozialhilfeleistungen mehr Probleme<br />
schafft, als sie löst. Unter anderem aus<br />
folgenden Gründen: Der Staat entrichtet<br />
Sozialhilfeleistungen an Privathaushalte.<br />
Für die Festlegung der Höhe dieser Leistungen<br />
wird der effektive Bedarf des Haushalts<br />
berechnet. Bei einer Besteuerung<br />
der Sozialhilfeleistungen würde der Staat<br />
einen Teil dieser Leistungen wieder in<br />
Form von Steuern zurückfordern. Damit<br />
stellt er seine eigene Bedarfsrechnung in<br />
Frage. Der Haushalt hat anschliessend auf<br />
dem Vollstreckungsweg die Möglichkeit,<br />
einen Steuererlass zu beantragen. Dabei<br />
wird wiederum eine Bedarfsrechnung erstellt,<br />
und falls die Steuerforderung in das<br />
Existenzminimum eingreift, werden die<br />
Steuern erlassen.<br />
Aufwändiges Nullsummenspiel<br />
verhindern<br />
Das ergibt ein Nullsummenspiel für den<br />
Staat, das mit grossem administrativem<br />
Aufwand verbunden ist und das die Legitimation<br />
des Systems gefährdet. Werden die<br />
Steuern nicht erlassen und ein Teil der Sozialhilfeleistungen<br />
muss in Form von Steuern<br />
zurückbezahlt werden, führt das zudem für<br />
einige Haushalte zu einer Unterwanderung<br />
des Existenzminimums. Um das Existenzminimum<br />
weiterhin zu garantieren, müssten<br />
höhere Sozialhilfeleistungen entrichtet<br />
werden. Das wiederum führt zu unerwünschten<br />
Finanztransfers, da die Leistungen<br />
der Sozialhilfe in verschiedenen Kantonen<br />
von der Gemeinde finanziert werden.<br />
Die Sozialhilfebeziehenden geben einen Teil<br />
der Leistungen, die sie von ihrer Gemeinde<br />
erhalten, in Form von Steuern an den Kanton<br />
weiter. Die Besteuerung von Leistungen<br />
der Sozialhilfe ist also wenig sinnvoll und<br />
verletzt die Steuergerechtigkeit.<br />
Fazit: Damit die Sozialhilfe ihre Ziele<br />
erreichen kann, ist es wichtig, dass das<br />
Steuersystem und das Sozialleistungssystem<br />
Hand in Hand gehen und dass die beiden<br />
Systeme die beabsichtigten Wirkungen des<br />
anderen nicht torpedieren. Damit dies gelingt,<br />
muss das soziale Existenzminimum<br />
von den Steuern ausgenommen sein. Wer<br />
am Existenzminimum lebt, soll keine Steuern<br />
zahlen, unabhängig davon, ob das verfügbare<br />
Einkommen aus Erwerbstätigkeit<br />
oder aus Sozialhilfeleistungen stammt. •<br />
Franziska Ehrler,<br />
Leiterin Fachbereich Grundlagen, SKOS<br />
www.skos.ch/grundlagen-und-positionen<br />
position skos 1/<strong>14</strong> ZeSo<br />
9
«Das Eröffnen von Perspektiven<br />
ist das A und O jeder Hilfe»<br />
Für die SKOS geht eine Ära zu Ende: Nach 15 Jahren Präsidentschaft tritt Walter Schmid im Mai von<br />
seinem Amt zurück. Die SKOS nehme in einem sehr schwierigen Politikfeld eine Brückenbauerfunktion<br />
ein, sagt Schmid, und blickt auf kommende Herausforderungen für den Verband und die Sozialhilfe.<br />
Als Sie im Jahr 1999 zum Präsidenten<br />
der SKOS gewählt wurden, beschäftigte<br />
sich der Verband mit einem<br />
«drastischen Zuwachs» der Fallzahlen<br />
bei der Sozialhilfe. Die SKOS forderte<br />
in Anbetracht neuer sozialer Risiken<br />
als Folge von Liberalisierung und Deregulierung<br />
Massnahmen gegen den<br />
brüchig gewordenen Sozialversicherungsschutz.<br />
Wo stehen wir in dieser<br />
Hinsicht heute, 15 Jahre später?<br />
Walter Schmid: Damals ging eine lange<br />
Rezessionsphase in der Schweiz zu Ende.<br />
Während meiner Amtszeit als Chef des<br />
Fürsorgeamts der Stadt Zürich beispielsweise<br />
hatten sich die Fallzahlen verdoppelt<br />
und die Kosten verdreifacht. Wir forderten<br />
einen Umbau der sozialen Sicherungssysteme.<br />
Dazu ist es allerdings nicht gekommen.<br />
Dafür zu verschiedenen Teilrevisionen.<br />
Dank guter Konjunktur flachte das<br />
Wachstum der Fallzahlen in der Sozialhilfe<br />
später wieder ab.<br />
Was entgegnen Sie den Kritikern, die<br />
sagen, die heutige Sozialhilfe sei zu<br />
attraktiv und zu grosszügig?<br />
Die Leistungen der Sozialhilfe haben<br />
sich seit 1999 nicht wesentlich verändert,<br />
und der Grundbedarf wurde nur teuerungsbereinigt<br />
angehoben. Der Grundbedarf in<br />
der Sozialhilfe ist wesentlich tiefer als bei<br />
den Ergänzungsleistungen und auch tiefer<br />
als beim Betreibungsrecht. Es stimmt<br />
also nicht, dass die Sozialhilfe grosszügiger<br />
geworden ist. Aber man kann sagen,<br />
dass mehr Menschen nicht mehr auf<br />
den Versicherungsschutz der Sozialwerke<br />
zählen können und dass es auch mehr<br />
Menschen gibt, die die Voraussetzungen<br />
für einen Sozialversicherungsbezug nicht<br />
erfüllen und nie erfüllen werden. Aus<br />
diesem Grund sind die Zahl der Sozialhilfebeziehenden<br />
und die Kosten weiter<br />
angestiegen.<br />
Die Sozialhilfe kommt gegenüber den<br />
Sozialversicherungen vermehrt komplementär<br />
zum Einsatz. Wie beurteilen<br />
Sie diesen schleichenden Paradigmawandel,<br />
der den subsidiären<br />
Charakter der Sozialhilfe zunehmend<br />
infrage stellt?<br />
Natürlich gilt in der Sozialhilfe weiterhin<br />
das Subsidiaritätsprinzip. Sie kommt<br />
also nur zum Zuge, wenn keine anderen<br />
Mittel zur Verfügung stehen. Wenn man<br />
jedoch bedenkt, welche Arbeitsplätze in<br />
den vergangenen Jahren neu geschaffen<br />
wurden und welche verschwunden sind,<br />
dann erkennt man gewaltige Umwälzungen.<br />
Die Sozialhilfe hat wesentlich<br />
mitgeholfen, die Nebenwirkungen dieses<br />
Strukturwandels der Wirtschaft zu bewältigen<br />
und den Menschen ein Minimum an<br />
Sicherheit zu geben. Zur komplementären<br />
Seite der Sozialhilfe: Für mich bedeutet<br />
das eigentlich nur, dass die Sozialhilfe ein<br />
wichtiger und etablierter Bestandteil des<br />
Ganzen geworden ist.<br />
In Ihre «Ära» fällt die Festschreibung<br />
der aktivierenden Sozialhilfe in den<br />
SKOS-Richtlinien. Was hat man damit<br />
bewirken können?<br />
Die Sozialhilfeempfängerinnen und<br />
-empfänger sollen dabei unterstützt werden,<br />
wieder in die Erwerbstätigkeit zurückzufinden<br />
und auf eigenen Füssen stehen zu<br />
können. Das ist ein wichtiges Prinzip und<br />
ein generelles Paradigma in der Schweizer<br />
Sozialpolitik. Die aktivierende Sozialpolitik<br />
hat Möglichkeiten geschaffen, dass<br />
Leute wieder arbeiten konnten, die dies<br />
sonst nicht mehr getan hätten. Sie eröffnet<br />
für viele Menschen Perspektiven und<br />
erhöht die Akzeptanz der Sozialhilfe in der<br />
Bevölkerung.<br />
Wo sehen Sie die Grenzen des Gegenleistungsprinzips?<br />
Es hat eine gewisse Verabsolutierung<br />
dieses Prinzips stattgefunden, die mir<br />
missfällt. Man hat aus den Augen verloren,<br />
dass es auch Menschen gibt, die trotz<br />
Aktivierung nicht mehr zurück in einen<br />
Job finden, und die dennoch eine Existenzberechtigung<br />
haben. Auch für sie trägt die<br />
Gesellschaft eine Verantwortung. Was mir<br />
auch nicht gefällt ist, dass die Armut individualisiert<br />
wird. Man schiebt alle sozialen<br />
Probleme dem Individuum zu, und auch<br />
die Lösungen werden nur bei ihm gesucht.<br />
Dadurch entsteht schnell einmal der Eindruck,<br />
es läge nur am Individuum, seine<br />
Situation zu verbessern. Gesellschaftliche<br />
Entwicklungen wie der Strukturwandel<br />
oder der Einfluss der Bildungschancen<br />
werden ausgeblendet.<br />
Welchen weiteren Herausforderungen<br />
muss sich die SKOS vermehrt stellen?<br />
Das heutige Instrumentarium kann<br />
schlecht unterscheiden zwischen kurzfristiger,<br />
subsidiärer Unterstützung für<br />
Personen, die es schaffen, aus eigenem<br />
Antrieb wieder aus der Sozialhilfe herauszukommen,<br />
und Personen, die auf Dauer<br />
auf Sozialhilfe angewiesen sind. Auch das<br />
gibt es, etwa wenn die Invalidenversiche-<br />
«Die Sozialhilfe<br />
hat wesentlich<br />
mitgeholfen, die<br />
Nebenwirkungen<br />
des Strukturwandels<br />
zu<br />
bewältigen.»<br />
12 ZeSo 1/<strong>14</strong> interview
ung heute gewisse Krankheitsbilder nicht<br />
mehr als für eine Rente relevant betrachtet<br />
und arbeitsunfähige Menschen keinen Zugang<br />
mehr zur Sozialversicherung haben.<br />
Diese Entwicklungen bedingen differenzierte<br />
Antworten.<br />
Eine andere grosse Herausforderung<br />
ist die öffentliche Wahrnehmung der Sozialhilfe<br />
und der Armut. Sie ist manchmal<br />
ziemlich weit von der Realität entfernt. So<br />
werden viele Probleme auf die Sozialhilfe<br />
projiziert, die gar nichts mit ihr zu tun<br />
haben, etwa bei Jugendlichen und ihren<br />
Bildungschancen: Bis die Sozialhilfe zum<br />
Zug kommt, ist schon sehr viel schief gelaufen.<br />
Gleichwohl macht die Öffentlichkeit<br />
solche Probleme an der Sozialhilfe<br />
fest und erwartet von uns Lösungen, für<br />
die wir die Instrumente nicht haben. Die<br />
Sozialhilfe wird oft mit dem Sozialstaat<br />
gleichgesetzt, obwohl bekannt ist, dass die<br />
Sozialhilfeausgaben nur rund zwei Prozent<br />
der gesamten Sozialausgaben und Sozialtransfers<br />
ausmachen. Solche Verzerrungen<br />
in der Wahrnehmung sind echte Herausforderungen.<br />
Daraus resultiert auch das Imageproblem,<br />
das die Sozialhilfe und mit ihr<br />
die SKOS in der Öffentlichkeit haben.<br />
Wie kann die SKOS dem begegnen?<br />
Solange die SKOS sich mit Sozialhilfe<br />
befasst, wird sie immer wieder mit Imageproblemen<br />
konfrontiert sein. Die Sozialhilfe<br />
war noch nie ein geliebtes Kind der<br />
Gesellschaft. Das war auch schon so, als<br />
man das Bettlervolk am Abend noch aus<br />
den Städten hinaus trieb, um die Leute<br />
nicht mehr sehen zu müssen. Wir haben<br />
es mit Menschen zu tun, die relativ wenig<br />
geben können und die oft als Belastung<br />
empfunden werden. Ich glaube aber, dass<br />
wir als Fachverband trotzdem viel Anerkennung<br />
geniessen. Wir haben in einem<br />
sehr schwierigen Politikfeld eine Brückenbauerfunktion<br />
und wir konnten in schwierigen<br />
Fragen immer wieder einen Konsens<br />
herstellen. Der Verband leistet insgesamt<br />
gute Arbeit. Ich habe das gerade jetzt bei<br />
der Ankündigung meines Rücktritts erfahren,<br />
als verschiedenste Kreise ihre Anerkennung<br />
unserer Arbeit zum Ausdruck<br />
gebracht haben.<br />
<br />
Bilder: Béatrice Devènes<br />
interview 1/<strong>14</strong> ZeSo<br />
13
Wie haben Sie die Position der SKOS<br />
vis-à-vis von Bund, Kantonen und<br />
Gemeinden erlebt?<br />
Die Rolle der SKOS ist einzigartig, auch<br />
im internationalen Vergleich. Alle Akteure<br />
sind im Verband versammelt. Dadurch haben<br />
wir die wichtigsten Stimmen immer<br />
einfangen und in die Lösungsentwicklung<br />
einbinden können. Das ist ein grosses<br />
Privileg. Wir sind in unserer Entscheidfindung<br />
manchmal etwas schwerfällig,<br />
dafür sind unsere Entscheide solide abgestützt.<br />
Die Kehrseite ist, dass sich der Bund<br />
nicht besonders um das Thema Sozialhilfe<br />
kümmert – sie gehört nicht in seinen Zuständigkeitsbereich<br />
– und dass auch die<br />
Kantone dem Thema selten hohe Priorität<br />
einräumen.<br />
Fühlten Sie sich von den Kantonen in<br />
der Öffentlichkeit genügend unterstützt,<br />
als die Sozialhilfe im vergangenen<br />
Jahr politisch heftig angegriffen<br />
wurde?<br />
Im Grossen und Ganzen haben uns die<br />
Sozialdirektoren in der Sache sehr unterstützt.<br />
Sie haben aber verständlicherweise<br />
auch stark Rücksicht auf ihre kantonsinternen<br />
politischen Verhältnisse nehmen müssen.<br />
Aus Sicht der SKOS hätte man sich<br />
gelegentlich noch klarere oder vernehmbarere<br />
Aussagen zum Thema Sozialhilfe<br />
gewünscht. Das gilt übrigens auch für den<br />
Bund.<br />
Können Sie das noch weiter ausführen?<br />
Gerade etwa während der Debatte<br />
über die Renitenten vom vergangenen<br />
Frühjahr: Just zu jenem Zeitpunkt haben<br />
Behörden und Verbände sich mit<br />
grossen Gesten bei den Opfern der<br />
administrativen Verwahrung entschuldigt.<br />
Überspitzt gesagt waren die administrativ<br />
Versorgten die Renitenten von<br />
damals. Sie waren teilweise auch keine<br />
angenehmen Zeitgenossen. Man hat<br />
sie verwahrt und hat dabei rechtsstaatliche<br />
Prinzipien verletzt. Deshalb reicht<br />
es aus heutiger Sicht nicht, wenn man<br />
sich vierzig Jahre später entschuldigt<br />
für das, was man damals falsch gemacht<br />
hat, und nicht darüber nachdenkt, dass<br />
man auch in der Gegenwart etwas falsch<br />
machen könnte. Ein Wort zum Umgang<br />
mit Armutsbetroffenen und zur Bedeutung<br />
von rechtstaatlichen Prinzipien auch<br />
heute wäre da angebracht gewesen.<br />
<strong>14</strong> ZeSo 1/<strong>14</strong> interview<br />
Walter Schmid<br />
Walter Schmid (60) studierte Rechtswissenschaft<br />
in Lausanne, Zürich und Stanford.<br />
Von 1982 bis 1991 war er Zentralsekretär<br />
der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, danach<br />
Leiter des Amts für Jugend- und Sozialhilfe<br />
der Stadt Zürich. Von 2000 bis 2003<br />
arbeitete er als Projektleiter im Auftrag<br />
des Bundesrats für die Solidaritätsstiftung<br />
und die Verwendung von Goldreserven der<br />
Nationalbank. Seit 2003 ist Walter Schmid<br />
Direktor des Departements Soziale Arbeit<br />
an der Hochschule Luzern. Walter Schmid<br />
tritt an der Mitgliederversammlung im Mai<br />
nach 15 Jahren als Präsident der SKOS<br />
zurück.<br />
«Es genügt nicht,<br />
wenn man sich<br />
40 Jahre später<br />
entschuldigt für<br />
das, was man<br />
damals falsch<br />
gemacht hat.»<br />
Ein Ziel der SKOS ist die Harmonisierung<br />
der Sozialhilfe. Nun sind<br />
Tendenzen zu beobachten, die dem<br />
Erreichten entgegenlaufen. Wie gewonnen,<br />
so zerronnen?<br />
Die Harmonisierung ist relativ weit<br />
fortgeschritten, und es gibt immer wieder<br />
Gegenbewegungen. Das wird solange so<br />
bleiben, wie das System Sozialhilfe vom<br />
föderativen Staat gelenkt wird. Dort, wo es<br />
Abweichungen gibt, sind diese entweder<br />
im Rahmen der Bandbreiten, die die SKOS<br />
empfiehlt, oder sie bewirken keine allzu<br />
grossen Einschränkungen. Wenn etwa der<br />
Kanton Waadt die SKOS-Richtlinien nicht<br />
integral übernimmt, dafür bei den Jugendlichen<br />
eine «Stipendien-statt-Sozialhilfe-<br />
Strategie» verfolgt, dann ist das ein gutes<br />
kantonales Experiment. Der Föderalismus<br />
birgt gerade auch dann Chancen, wenn es<br />
auf nationaler Ebene zu politischen Blockaden<br />
kommt. Wir sehen das zurzeit bei den<br />
Ergänzungsleistungen für einkommensschwache<br />
Familien. Das sind Beispiele für<br />
gute und innovative Entwicklungen.
«Die Bekämpfung<br />
der Armut ist eine<br />
komplexe Sache,<br />
zu der es keine<br />
einfachen Rezepte<br />
gibt.»<br />
Was läuft, allgemein betrachtet, im<br />
System der sozialen Sicherheit der<br />
Schweiz gut?<br />
Wir haben ein zwar kompliziertes aber<br />
gut ausgebautes Netz von Sozialversicherungen,<br />
und im Hintergrund wirkt auch<br />
die Sozialhilfe als letztes verlässliches Netz<br />
der sozialen Sicherheit stabilisierend in der<br />
Sozialpolitik. Schwachpunkte sind gewisse<br />
Doppelspurigkeiten bei den Sozialwerken<br />
oder die immer noch sehr ungenügende interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit. Man sollte<br />
auch hinschauen, wo Fehlallokationen stattfinden,<br />
wo der Sozialstaat Umverteilungen<br />
vornimmt, von denen nicht unbedingt jene<br />
profitieren, die Leistungen nötig haben.<br />
Welchen konkreten Nutzen steuert die<br />
Sozialhilfe dem System bei?<br />
Es ist entscheidend für eine Gesellschaft,<br />
dass die letzten Existenzrisiken aufgefangen<br />
werden. Dass die Leute wissen,<br />
dass sie nicht ins Bodenlose fallen. Das<br />
gibt ihnen eine gewisse Autonomie und<br />
eine gewisse Risikofreude. Das ist nicht<br />
nur unter dem Aspekt des Strukturwandels,<br />
sondern ganz generell für den Zusammenhalt<br />
der Gesellschaft wichtig.<br />
Dank der Sozialhilfe haben wir in der<br />
Schweiz keine grösseren Bevölkerungsgruppen,<br />
die von der Gesellschaft ausgegrenzt<br />
leben. Das Eröffnen von Perspektiven<br />
für die Menschen ist das A und O<br />
jeder Hilfe.<br />
Wie beurteilen Sie die Armutspolitik<br />
des Bundes und der Kantone?<br />
Armut ist ein Thema, das alle staatlichen<br />
Ebenen angehen muss. Die Bekämpfung<br />
von Armut ist eine komplexe<br />
Sache, zu der es keine einfachen Rezepte<br />
gibt. Armut lässt sich im übrigen auch<br />
nie vollständig beseitigen. Es ist aber<br />
ein grosser Unterschied, ob man sich in<br />
einem Land mit der Armut arrangiert<br />
und nichts dagegen unternimmt oder ob<br />
man sie wahrnimmt und versucht, die<br />
Menschen zu unterstützen. Dabei muss<br />
auch dem Bund eine Rolle zukommen.<br />
Er hat – zwar erst in homöopathischen<br />
Dosen – damit begonnen, sich mit dem<br />
Thema zu befassen und Projekte zur Armutsbekämpfung<br />
aufzugleisen. Das ist<br />
ein erster wichtiger Schritt. Sonst überlässt<br />
man auf nationaler Ebene das Feld einseitig<br />
den Protagonisten der Empörungspolitik.<br />
Hatten Sie persönliche Ziele, als Sie<br />
vor 15 Jahren die Führung der SKOS<br />
übernommen haben, und sind Sie<br />
zufrieden mit dem, was Sie erreicht<br />
haben?<br />
Ich hatte die Absicht, den Verband gut<br />
zu führen und einen Beitrag an die Weiterentwicklung<br />
der Sozialhilfe zu leisten. Die<br />
Sozialhilfe hat in den vergangen Jahren gut<br />
funktioniert und sich weiterentwickelt. Die<br />
SKOS hat dazu einen wichtigen Beitrag<br />
geleistet. Insofern habe ich meine Ziele<br />
erreicht. Der grösste Teil der Verbandsarbeit<br />
wird allerdings nicht vom Präsidenten<br />
geleistet. Deshalb möchte ich an dieser<br />
Stelle auch den vielen Leuten, die uns bei<br />
unserer Arbeit unterstützt haben, meinen<br />
Dank aussprechen.<br />
Welche Erfahrung wird Ihnen nachhaltig<br />
in Erinnerung bleiben?<br />
Die Verabschiedung der Richtlinien<br />
von 2005 in der Helferei des Grossmünsters<br />
in Zürich, als wir während Stunden<br />
um die letzten Formulierungen des damals<br />
neuen Richtlinienwerks gerungen<br />
hatten und es uns schliesslich gelang, bis<br />
auf ganz wenige Enthaltungen sämtliche<br />
Mitglieder des Vorstands zur Zustimmung<br />
zu bewegen. <br />
•<br />
Das Gespräch führte<br />
Michael Fritschi<br />
interview 1/<strong>14</strong> ZeSo<br />
15
Armut und Unterversorgung schaden<br />
der Gesundheit<br />
Menschen, die unter Mangel leiden, sind einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Wer wenig<br />
Geld hat, spart bei den Gesundheitsleistungen. Da die Ärmsten der Bevölkerung auch am häufigsten<br />
krank sind, entsteht eine doppelte Ungleicheit: Die, die eigentlich mehr zum Arzt gehen sollten, sind<br />
gleichzeitig jene, die am ehesten auf einen Arztbesuch verzichten.<br />
Ein geringer Sozialstatus ist für den Menschen das grösste<br />
Gesundheitsrisiko. Das war vor 500 Jahren so, und das ist leider<br />
auch heute noch so, sogar wieder mit zunehmender Tendenz. Die<br />
Situa-tion von damals ist belegt durch statistische Zahlen des<br />
Hospice Général in Genf. Dort wurden ab dem 17. Jahrhundert<br />
Kinder nach der Geburt registriert und dabei in drei Gruppen eingeteilt,<br />
abhängig davon, ob sie in reiche, arme oder in Familien<br />
zwischen diesen Polen hineingeboren wurden. Vergleicht man die<br />
Mortalitätsquotionten dieser «Versuchsgruppen», so zeigt sich anhand<br />
der Sterblichkeit in der Kindheit und im Alter, dass die arme<br />
Bevölkerung im Durchschnitt viel häufiger gestorben ist respektive<br />
weniger alt wurde. Im Weiteren lässt sich zeigen, dass sich die<br />
Gesundheitschancen der Menschen im Verlauf der Jahrhunderte<br />
deutlich verbessert haben und dass die Armen davon am meisten<br />
profitiert haben. Die Entwicklung, wonach die Gesundheitsrisiken<br />
aufgrund von sozialen Ungleichheiten geringer wurden, dauerte<br />
bis Mitte 20. Jahrhundert. Seit 1950 wird eine Trendwende beobachtet.<br />
Die Schere der Ungleichheiten zwischen arm und reich<br />
und damit der Gesundheitschancen geht seither wieder auseinander.<br />
Je reicher man ist, desto weniger besteht ein Risiko, an einem<br />
Herzschlag zu sterben oder an Diabetes zu leiden. Je nach Krankheit<br />
trägt die Gruppe der Armen in der Bevölkerung ein zwei-, vieroder<br />
sogar ein zehnfaches Risiko, zu erkranken. Wohlhabende<br />
Menschen scheinen sehr viel mehr von den diversen sozialen, medizinischen<br />
und kulturellen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts<br />
zu profitieren als materiell schlechtgestellte Menschen.<br />
15 Prozent verzichten<br />
Eine repräsentative Studie zum Gesundheitsverhalten der Genfer<br />
Bevölkerung zeigt, dass 15 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2009<br />
aus ökonomischen Gründen während der letzten zwölf Monate auf<br />
Der « Zahnstatus»<br />
eines Menschen lässt<br />
auf seinen Sozialstatus<br />
schliessen.<br />
Gesundheitsleistungen verzichtet haben. Drei Viertel dieser<br />
Gruppe haben beispielsweise auf Zahnarztleistungen verzichtet.<br />
Das erstaunt noch nicht sonderlich, wenn man bedenkt, dass in<br />
der Schweiz Zahnarztleistungen nicht durch die obligatorische<br />
Krankenversicherung abgedeckt werden. Die eigentliche Überraschung<br />
war, dass 35 Prozent dieser Gruppe auf medizinische<br />
Konsultationen verzichten, und dass 5 Prozent sogar auf einen<br />
chirurgischen Eingriff verzichtet haben – dies trotz obligatorischer<br />
Krankenversicherung.<br />
Wenn man die Verzichte auf Gesundheitsleistungen unter dem<br />
Aspekt des Einkommens betrachtet, so sind darunter 4 Prozent<br />
Personen, die mehr als 13 000 Franken pro Monat verdienen.<br />
Bei den Ärmsten, jenen, die weniger als 3000 Franken verdienen,<br />
sind es 30 Prozent. Da die Ärmsten der Bevölkerung auch<br />
am häufigsten krank sind, entsteht eine doppelte Ungleichheit:<br />
Die, die eigentlich mehr zum Arzt gehen sollten, sind gleichzeitig<br />
jene, die am ehesten darauf verzichten. Eine Ursache für diesen<br />
Missstand ist das Schweizer Krankenversicherungssystem. Seit<br />
der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung im<br />
Jahr 1996 haben sich die Prämien mehr als verdoppelt, und das<br />
geltende Franchisensystem verleitet sozial Schwächere dazu, eine<br />
hohe Franchise zu wählen. Wenn dann etwas passiert, steht ihnen<br />
das nötige Geld für die Behandlung nicht zur Verfügung. Verallgemeinernd<br />
gesagt lässt sich vom «Zahnstatus» eines Menschen auf<br />
seinen Sozialstatus schliessen.<br />
Die Rolle der sozio-ökonomischen Stellung<br />
Die wachsende soziale Ungleichheit und mit ihr die ungleiche<br />
Ressourcenverteilung führen also dazu, dass armutsbetroffene<br />
Menschen von der Gesellschaft als selbstverständlich angesehene<br />
Gesundheitsziele vermehrt nicht mehr erreichen und dass sie die<br />
ihnen zustehenden medizinische Leistungen nicht erhalten. Um<br />
die diversen Gesundheitsrisiken besser abschätzen zu können, beobachtet<br />
die Wissenschaft so genannte soziale Determinanten. Sie<br />
haben den weitaus grössten Einfluss auf unsere Gesundheit: Die<br />
Forschung geht davon aus, dass die sozio-ökonomische Situation<br />
und mit ihr verbundene Verhaltensweisen unsere Gesundheit<br />
zu 40 bis 50 Prozent bestimmen. Weiteren Einfluss üben die<br />
Umwelt sowie die Wohnsituation aus (20 Prozent). Die genetische<br />
Veranlagung ist zu 20 bis 30 Prozent bestimmend. Der Einfluss<br />
des Gesundheitssystems, in dem wir uns bewegen, auf die Gesundheit<br />
beträgt hingegen lediglich 10 bis 15 Prozentpunkte.<br />
Die zehn wichtigsten sozialen Determinanten sind, gemäss<br />
WHO, der Sozialgradient (die Stellung in der Gesellschaft), Stress,<br />
die frühe Kindheit, soziale Isolierung, die Situation am Arbeits-<br />
18 ZeSo 1/<strong>14</strong> SCHWERPUNKT
Gesundheit<br />
15 Prozent der Genfer Bevölkerung verzichtet gemäss einer Studie aus ökonomischen Gründen auf Gesundheitsleistungen. Bilder: Keystone<br />
platz, Arbeitslosigkeit, soziale Unterstützung, (Sucht-)Abhängigkeiten,<br />
die Ernährung und die Transportsituation (Bewegung,<br />
Distanzen, Kosten). Am Sozialgradient beispielsweise lässt sich<br />
zeigen, dass Personen mit universitärer Ausbildung eine fünf bis<br />
sieben Jahre höhere Lebenserwartung haben als Personen, die<br />
nur die Grundstufe absolviert haben oder über keine Ausbildung<br />
verfügen. Es gilt: je höher die sozio-ökonomische Stellung, desto<br />
höher die Lebenserwartung.<br />
Eine besonders wichtige Determinante ist auch die frühe Kindheit.<br />
In dieser Phase wird unsere gesundheitliche Entwicklung fürs<br />
ganze weitere Leben vorbestimmt. Das Risiko von Diabetes bei<br />
Männern beispielsweise hängt erwiesenermassen mit dem Geburtsgewicht<br />
zusammen. Je geringer das Geburtsgewicht, desto höher<br />
das Diabetesrisiko (mit 64 Jahren bis zu siebenfach erhöhtes Risiko).<br />
Wenn man untersucht, welche Frauen Kinder zur Welt bringen,<br />
die ein geringes Geburtsgewicht haben, dann sind das häufig<br />
Frauen, die rauchen oder die unter mehr Stress stehen als andere,<br />
beispielsweise weil sie ihr Kind ohne Partner aufziehen. Monoparentale<br />
Kinder sind zudem tendenziell auch einer schlechteren<br />
und unregelmässigeren Ernährung ausgesetzt. Später gesellen sich<br />
die Ausbildungschancen als weiterer gesundheitsbestimmender<br />
Faktor hinzu. Über die Ausbildung lernt man beispielsweise, was<br />
dem Körper gut tut und was nicht. Ein Blick auf des Rauchverhalten<br />
von 25-jährigen Amerikanern zeigt: Von den Jugendlichen, die<br />
nur eine Basisausbildung machen, rauchen rund 30 Prozent, bei<br />
den Studentinnen und Studenten sind es 10 Prozent.<br />
Es ist allerdings nicht immer so, dass eine einzelne, spezifische<br />
soziale Determinante stärker auf unsere Gesundheit wirkt als andere.<br />
Vielmehr greifen Determinanten ineinander über. Das Bild<br />
ist immer als Ganzes zu betrachten. Bei der Determinante Arbeit<br />
– um ein weiteres Beispiel zu nennen – geht es um die Autonomie,<br />
die Arbeitsprozesse selbst zu bestimmen. Ein Manager, der zwar<br />
oft unter grossem Stress steht, kann seinen Arbeitsplan selber einteilen.<br />
Wenn er sich vom Stress erholen muss, geht er Golf spielen<br />
oder joggen. Seine Sekretärin hingegen muss die Arbeit erledigen,<br />
die er ihr vorgibt. Sie kann die Arbeit nicht einfach kurz mal liegen<br />
lassen. Es gilt: je tiefer in der sozialen Hierarchie, desto geringer<br />
die Autonomie, seine Arbeitsprozesse zu bestimmen. Und je weniger<br />
Autonomie, desto höher ist beispielsweise das Risiko für einen<br />
Herzinfarkt.<br />
Den Einfluss der Determinanten ernst nehmen<br />
In den aktuellsten verfügbaren Zahlen weist das Bundesamt für<br />
Statistik (BfS) für das Jahr 2<strong>01</strong>1 rund 580 000 Personen aus, die<br />
von Einkommensarmut betroffen sind. 2<strong>01</strong>2 waren ebenfalls<br />
gemäss BfS 15 Prozent der Bevölkerung oder jede siebte Person in<br />
der Schweiz armutsgefährdet. Schon aufgrund dieser Zahlen ist es<br />
angezeigt, den Einfluss der sozialen Determinanten ernst zu<br />
nehmen und gegen die zunehmende soziale Ungleichheit aktiv zu<br />
werden. Dass die Schweiz ein reiches Land ist, ist kein Grund,<br />
nicht genau hinzuschauen. Denn das Motto «je reicher, desto<br />
höher die Lebenserwartung» gilt primär für Entwicklungsländer<br />
SCHWERPUNKT 1/<strong>14</strong> ZeSo<br />
<br />
19<br />
mit einem Pro-Kopf-Einkommen bis 5000 Dollar. Für industrialisierte<br />
Länder mit hohen Pro-Kopf-Einkommen hat man hingegen<br />
festgestellt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei extremen<br />
Unterschieden bei der Vermögensverteilung tiefer ist als in<br />
Ländern, wo diese Schere weniger weit geöffnet ist.<br />
Den diversen wissenschaftlichen Erkenntnissen kann ich eigene<br />
Beobachtungen aus rund zwanzig Jahren sozialmedizinischer<br />
Arbeit hinzufügen. Ich hatte viel mit vulnerablen Populationen,<br />
mit Obdachlosen, mit nicht versicherten «illegalen» Migranten<br />
und aktuell mit Gefängnisinsassen zu tun und bin zur Einsicht<br />
gekommen, dass man aufgrund des Gesundheitszustandes eines<br />
Menschen oft auch auf die Qualität des Gesundheitssystems in<br />
seinem Herkunftsland schliessen kann. Wenn eine Gesellschaft<br />
vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Migranten oder Häftlinge<br />
schlecht behandelt oder von Sozialleistungen ausschliesst, besteht<br />
eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Gesellschaft auch andere<br />
sozial schwache Gruppen schlecht behandelt oder misshandelt.<br />
In Ländern, die auch für Häftlinge eine gute Gesundheitsversorgung<br />
gewährleisten, kann man hingegen davon ausgehen, dass<br />
die gesamte Population sehr gut betreut wird.<br />
Konsequenzen für die Sozialarbeit<br />
In Analogie kann man wohl davon ausgehen, dass, wenn in einem<br />
Land die Sozialsysteme bei den Ärmsten greifen, sie generell gut<br />
greifen und dass dadurch die Ungleichheit bei der Vermögens-<br />
verteilung geringer ist. Ungleichheiten im System sind für alle<br />
schlecht. Sie bergen die Gefahr von sozialer Unruhe, senken die<br />
durchschnittliche Lebenserwartung und verursachen langfristig<br />
Mehrkosten, die auf den Staat und die Gesellschaft zurückfallen.<br />
Soziale Systeme sind dann gut, wenn die sozialen Auffangmechanismen<br />
auch bei vulnerablen Gruppen richtig umgesetzt<br />
werden.<br />
Wer die wichtigsten sozialen Determinanten kennt und beachtet,<br />
kann früher intervenieren und gezielter handeln, auch in der<br />
Sozialarbeit. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sollten deshalb<br />
die genannten zehn Determinanten «auf dem Radar» haben<br />
und ihren Klienten entsprechende Fragen stellen. Wenn mehrere<br />
Fragen alarmierende Antworten zur Folge haben, dann ist unter<br />
Umständen eine Kontaktaufnahme mit dem Arzt angebracht.<br />
Möglicherweise zeigt sich auch, dass dem Klient die Kompetenz<br />
fehlt, mit Ärzten zu sprechen oder eine Packungsbeilage zu lesen<br />
und zu verstehen («health illiteracy»). Solchen Klienten können<br />
Sozialarbeitende begleitend zur Seite stehen und ihnen helfen, sich<br />
im System zu orientieren. Eine parallele Handlungsebene besteht<br />
sinngemäss bei der Ernährung respektive bei Ernährungsfragen.<br />
Investieren, wo es sich lohnt<br />
Die Gesellschaft sollte erkennen, dass es sich lohnt, möglichst früh in<br />
Integrationsprojekte zu investieren. Was Integrationsmassnahmen<br />
langfristig bewirken können, zeigt das «Perry-Preschool-Project»,<br />
für das in einer amerikanischen Kleinstadt in der Nähe von Detroit<br />
rund 120 drei- bis vierjährige Kinder aus sehr prekären Verhältnissen<br />
in zwei Gruppen eingeteilt wurden: Die Hälfte der Kinder<br />
wurde während sechs Monaten von Erzieherinnen betreut und stimuliert,<br />
etwa indem ihnen bei den Hausaufgaben geholfen wurde<br />
oder indem man ihnen eine ausgewogene Ernährung reichte. Die<br />
andere Hälfte wurde nicht stimuliert und betreut. Die Kinder wurden<br />
dann 40 Jahre lang beobachtet.<br />
Es zeigten sich spektakuläre Unterschiede im Werdegang der<br />
Probanden: Die während eines halben Jahrs geförderten Kinder<br />
hatten im Vergleich zu den anderen Kindern wesentlich häufiger<br />
einen Schulabschluss gemacht, sie verdienten wesentlich häufiger<br />
mehr als 20 000 Dollar im Jahr, es kam in dieser Gruppe zu wesentlich<br />
weniger Verhaftungen durch die Polizei usw. Das Projekt<br />
kostete den Staat rund 18 000 Dollar, gut investiertes Geld. Man<br />
hat berechnet, dass jeder Dollar dem Staat eine Ausgabenersparnis<br />
von 16 Dollar generiert hat. Wenn ein Staat also bei den Ausgaben<br />
sparen will, wie er es auch bei uns in jüngster Zeit wieder vermehrt<br />
tun muss, sollte man bedenken, dass man durch eine gezielte<br />
Förderung von sozial Benachteilgten einen sehr viel grösseren<br />
Spareffekt erreicht, als wenn man neue Gefängnisse baut und bei<br />
Gesundheits- und Bildungsangeboten spart. <br />
•<br />
Hans Wolff<br />
Universitätsspital Genf, Leiter gefängnismedizinische Abteilung<br />
Mitglied der Antifolterkommission des Europarats<br />
protokolliert von Michael Fritschi<br />
Manche können Gesundheitsinformationen nicht selbständig verarbeiten.<br />
Literatur<br />
Hans Wolff, Jean-Michel Gaspoz, Idris Guessous, Health care<br />
renunciation for economic reasons, Swiss Medical Weekly, 2<strong>01</strong>1.<br />
20 ZeSo 1/<strong>14</strong> SCHWERPUNKT
Unregelmässige Einkommen: Wann<br />
ist die Soziahilfeablösung möglich?<br />
Das Einkommen einer Sozialhilfebezügerin unterliegt wegen unregelmässiger Arbeitseinsätze<br />
Schwankungen. Massgebend für den Zeitpunkt der Ablösung ist die Bedürftigkeit. Um diese besser<br />
abschätzen zu können, kann das Einkommen über mehrere Monate beobachtet und beurteilt werden.<br />
Frage<br />
Maria C. arbeitet neu im Stundenlohn als<br />
Verkäuferin. Sie wird unregelmässig beschäftigt.<br />
In gewissen Monaten reicht ihr<br />
Einkommen nicht aus, um den Bedarf zu<br />
decken, während in anderen Monaten der<br />
Lohn über dem errechneten Existenzminimum<br />
liegt. Ihre Sozialarbeiterin stellt sich<br />
die Frage, ob dieser Einkommensüberschuss<br />
Frau C. jeweils zur freien Verfügung<br />
stehen sollte, wenn absehbar ist, dass ihr<br />
Einkommen im nachfolgenden Monat den<br />
Bedarf nicht decken wird und sie in der<br />
Folge erneut ergänzend mit Sozialhilfe<br />
unterstützt werden muss.<br />
PRAXIS<br />
In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen aus<br />
der Sozialhilfe praxis an die «SKOS-Line» publiziert<br />
und beantwortet. Die «SKOS-Line» ist ein webbasiertes<br />
Beratungsangebot für SKOS-Mitglieder.<br />
Der Zugang erfolgt über www.skos.ch Mitgliederbereich<br />
(einloggen) SKOS-Line.<br />
Grundlagen<br />
Die Ablösung von der wirtschaftlichen Hilfe<br />
ist zu dem Zeitpunkt möglich, ab dem<br />
der Bedarf durch ein Einkommen gedeckt<br />
wird. Bei unregelmässigen Einkommen ist<br />
dieser Zeitpunkt aber nicht immer eindeutig<br />
feststellbar. Auch die gesetzlichen Grunlagen<br />
geben auf diese Frage keine Antwort.<br />
Daher besteht eine unterschiedliche Praxis,<br />
zu welchem Zeitpunkt ein Fall verwaltungstechnisch<br />
abgeschlossen wird und somit<br />
bei einer allfälligen Neuanmeldung<br />
das teils umfangreiche Abklärungsprozedere<br />
zu Beginn einer sozialhilferechtlichen<br />
Unterstützung wiederholt werden muss.<br />
Bei der Beurteilung können unterschiedliche<br />
Berechnungszeiträume für die sozialhilferechtliche<br />
Notlage gewählt werden.<br />
Ausschlaggebend muss jedoch immer die<br />
aktuelle Bedürftigkeit sein. Dabei sind die<br />
Prinzipien der Subsidiarität und der<br />
Gleichbehandlung, aber auch die Verhältnismässigkeit<br />
der getroffenen Lösung zu<br />
beachten.<br />
Grundsätzlich ist bei unregelmässigen<br />
Einkünften der Sozialhilfeanspruch jeden<br />
Monat neu zu berechnen. Dies bedeutet jedoch<br />
nicht, dass der Abrechnungszeitraum<br />
ebenfalls monatlich gewählt werden muss.<br />
Eine dreimonatige oder in begründeten<br />
Fällen sogar eine halbjährliche oder jährliche<br />
Abrechnung kann je nach Situation<br />
geeignet und erforderlich sein, um den<br />
grundsätzlichen Anspruch zu prüfen. So<br />
stellte das Bundesgericht kürzlich für einen<br />
Fall aus dem Kanton Zürich zusammenfassend<br />
fest (8C_325/2<strong>01</strong>2, 24. August<br />
2<strong>01</strong>2, Abschnitte 4.3 bis 4.5): Die Frage<br />
der Anrechenbarkeit von Einkünften stellt<br />
sich im sozialhilferechtlichen Sinne so lange,<br />
als sich die bedürftige Person in einer<br />
Notlage befindet. Eine besondere Problematik<br />
ergibt sich bei der Anrechnung von<br />
schwankendem Einkommen. Entscheidend<br />
ist, für welchen Zeitraum die Bedürftigkeit<br />
beurteilt wird. Eine monatliche<br />
Prüfung kann je nachdem zu anderen Ergebnissen<br />
führen als die Berücksichtigung<br />
einer Gesamtperiode. «Es ist nicht bundesrechtswidrig<br />
und bedeutet insbesondere<br />
keine willkürliche Auslegung und Anwendung<br />
(Art. 9 BV) der Bestimmungen des<br />
zürcherischen Sozialhilferechts, wenn die<br />
Überschussabrechnung nicht monatlich<br />
erfolgt.» Diese Einschätzung dürfte auch<br />
auf die Rechtslage in den meisten anderen<br />
Kantonen zutreffen.<br />
Diese Betrachtungsweise lässt sich<br />
insbesondere vor dem Hintergrund der<br />
Gleichbehandlung mit Personen rechtfertigen,<br />
die ebenfalls nahe dem sozialhilferechtlichen<br />
Existenzminimum leben und<br />
entsprechende Rücklagen bilden müssen.<br />
Es kann davon ausgegangen werden, dass<br />
von der Sozialhilfe unterstützte Personen<br />
Lohnüberschüsse in den Folgemonaten für<br />
Bedarfsdefizite nutzen und somit selber in<br />
der Lage sind, eine Bedürftigkeit abzuwenden<br />
oder zumindest zu mindern.<br />
Sofern im gewählten Betrachtungszeitraum<br />
ein durchschnittlicher Überschuss<br />
ermittelt wird, kann davon ausgegangen<br />
werden, dass keine sozialhilferechtliche<br />
Bedürftigkeit mehr besteht und die bisher<br />
unterstützte Person von der Sozialhilfe<br />
abgelöst werden kann. Andernfalls ist die<br />
Person weiter zu unterstützen, und ein<br />
allfälliger Überschuss ist im Folgemonat<br />
anzurechnen.<br />
Antwort<br />
Maria C. hat keinen Rechtsanspruch darauf,<br />
dass ihr der Lohnüberschuss eines einzelnen<br />
Monats zur freien Verfügung steht<br />
und im Folgemonat nicht angerechnet<br />
wird. Die Einschätzung, ob Maria C. im<br />
Durchschnitt über ausreichend Einkommen<br />
verfügt, um den Lebensunterhalt selbständig<br />
zu bestreiten, dürfte in diesem Fall<br />
nach drei Monaten möglich sein. Die Abrechnung<br />
kann demzufolge auch erst nach<br />
drei Monaten erfolgen. Sofern das durchschnittliche<br />
Einkommen nur knapp über<br />
dem Bedarf liegt, insbesondere wenn im<br />
nächsten Monat erneut ein Manko entsteht,<br />
ist eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums<br />
um weitere drei Monate zu prüfen. •<br />
Markus Morger<br />
Daniela Moro<br />
Kommission Richtlinien<br />
und Praxishilfen der SKOS<br />
10 ZeSo 1/<strong>14</strong> praxis
Psychische Probleme und Armut sind<br />
eng miteinander verbunden<br />
Psychisch Kranke sind besonders häufig von Erwerbslosigkeit und Armut betroffen. Mit einem<br />
abgestimmten Vorgehen könnten Ärzte und Sozialarbeitende dazu beitragen, mehr Personen mit<br />
psychischen Problemen im Arbeitsmarkt zu halten.<br />
Menschen mit psychischen Problemen haben ein signifikant erhöhtes<br />
Armutsrisiko gegenüber psychisch gesunden Menschen. In der<br />
Schweiz zeigt sich das beispielsweise darin, dass unter den Personen,<br />
deren Haushalteinkommen nicht mehr als 60 Prozent des<br />
Medianeinkommens der Bevölkerung entspricht, der Anteil der Personen<br />
mit psychischen Problemen etwa ein Drittel höher ist als jener<br />
der psychisch Beschwerdefreien. In den meisten anderen Industriestaaten<br />
liegen die Quoten zwischen psychisch kranken und gesunden<br />
armutsgefährdeten Personen noch deutlicher auseinander.<br />
Betrachtet man nur Personen mit schwereren psychischen<br />
Störungen, zum Beispiel psychisch Kranke mit einer IV-Rente,<br />
dann ist das Armutsrisiko nochmals signifikant höher – auch<br />
im Vergleich zu IV-Berenteten mit körperlichen Krankheiten,<br />
Geburtsgebrechen oder unfallbedingten Gebrechen. Fast jeder<br />
zweite psychisch behinderte IV-Rentner lebt in Armut oder ist<br />
armutsgefährdet. Bei Geburtsgebrechen, körperlich Behinderten<br />
und unfallbedingten Behinderungen betragen die entsprechenden<br />
Werte 25, 33 respektive 20 Prozent.<br />
Negative Wechselwirkungen<br />
Armut wiederum ist ein wesentlicher Risikofaktor für die Ausprägung<br />
einer psychischen Krankheit. Armut ist ein starker psychischer<br />
Stressor, der die Bewältigung des täglichen Lebens konkret<br />
erschwert. Wie stark die Belastung durch Armut sein kann, lässt<br />
sich erahnen, wenn man bedenkt, dass die Angst vor Arbeitsplatzverlust<br />
zu den grössten psychischen Stressoren gehört, die es gibt.<br />
Armut und von ihr ausgelöster Stress wirkt sich aber auch indirekt<br />
auf die psychische Befindlichkeit aus. Man fühlt sich inkompetent,<br />
an den Rand der Gesellschaft gedrängt, ausgeschlossen, und man<br />
ist abhängig von den Systemen der sozialen Sicherung. Dass die<br />
Betroffenen Sozialversicherungsleistungen erhalten, ist selbstverständlich<br />
eine wichtige Unterstützung. Auf der anderen Seite bedeutet<br />
es auch einen engen Kontakt zu den Behörden mit all den<br />
jeweiligen Vorschriften, Regeln und Pflichten, die subjektiv als bevormundend,<br />
erniedrigend oder stigmatisierend (als faul, undiszipliniert<br />
oder unwillig) erlebt werden können.<br />
Dies ist gerade bei Personen mit einer psychischen Störung<br />
nicht selten der Fall, weil ihre konkreten Behinderungen für Aussenstehende<br />
nur schwer einzuschätzen sind. Kommt hinzu, dass<br />
die häufigen Versagensängste psychisch Kranker oft mit fehlender<br />
Veränderungsmotivation verwechselt werden und die teils krankheitsbedingte<br />
«Uneinsichtigkeit» in das eigene problematische<br />
Verhalten als Verletzung der Mitwirkungspflicht interpretiert<br />
wird. Viele psychisch Kranke sehen sich deshalb latent oder offen<br />
mit dem Verdacht konfrontiert, zu Unrecht Sozialversicherungsleistungen<br />
zu beziehen.<br />
In der Schweiz entsteht die Verbindung zwischen Armut und<br />
psychischer Krankheit häufig über die Erwerbslosigkeit. Schweizerinnen<br />
und Schweizer mit psychischen Problemen haben eine<br />
geringere Erwerbsquote und eine höhere Arbeitslosenquote als<br />
die beschwerdefreie Population. Betrachtet man die Bezügerinnen<br />
und Bezüger von Sozialversicherungsleistungen, so leiden<br />
zwischen 30 bis 45 Prozent der Arbeitslosen, der Sozialhilfeempfänger<br />
und der IV-Berenteten unter einer psychischen Störung,<br />
während die Rate in der Gesamtbevölkerung rund 20 Prozent<br />
beträgt.<br />
Die Gründe für den engen Zusammenhang zwischen psychischer<br />
Krankheit und Erwerbslosigkeit liegen in besonderen Merkmalen<br />
dieser Krankheiten, der Personen und der Reaktionen des<br />
Umfelds. Besonders der frühe Beginn psychischer Störungen ist<br />
bedeutsam. Anders als die meisten körperlichen Erkrankungen<br />
beginnt die Hälfte aller psychischen Erkrankungen vor dem<br />
<strong>14</strong>. Lebensjahr und drei Viertel davon vor dem 24. Lebensjahr.<br />
Dieses frühe Erkrankungsalter hat negative Konsequenzen auf<br />
die Ausbildung (Schulprobleme, Ausbildungsabbrüche) und auf<br />
den Berufseinstieg (prekäre Jobs, häufige Stellenwechsel), und<br />
das frühe Erkrankungsalter prägt das Erleben der Betroffenen<br />
(Versagensängste und in der Folge starkes Vermeidungsverhalten).<br />
Neben dem frühen Störungsbeginn ist wesentlich, dass psychische<br />
Krankheiten oft wiederkehrend oder chronisch verlaufen und sich<br />
durch psychiatrische Behandlung zwar stabilisieren, aber meist<br />
nicht heilen lassen.<br />
Persönlichkeitsmerkmale mit Konfliktpotenzial<br />
Dies schlägt sich im Einkommen nieder: Personen, die aus psychischen<br />
Gründen eine IV-Rente beziehen, haben auch in der Zeit, als<br />
sie noch erwerbstätig waren, oft ein stark unterdurchschnittliches<br />
Einkommen erzielt, bedingt durch schlechte Jobs, wiederholte<br />
Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit. Armut und Erwerbslosigkeit<br />
haben fast immer eine lange Geschichte. Bei den personbezogenen<br />
Merkmalen ist wesentlich, dass schwer psychisch Kranke<br />
oft eine «schwierige» Persönlichkeit haben und in ihrem Erleben<br />
und Verhalten nur schwer zu beeinflussen sind. Sie verhalten sich<br />
uneinsichtig, stur und anklagend, fühlen sich schlecht behandelt<br />
oder sehen sich als Opfer. Diese häufigen Persönlichkeitsmerkmale<br />
sind auf dem biografischen Hintergrund der Betroffenen zu<br />
verstehen, und führen oft zu Konflikten am Arbeitsplatz oder in<br />
der Beziehung zu Behörden.<br />
Schliesslich tragen auch umfeldbezogene Charakteristiken zur<br />
besonderen Problematik psychisch Kranker bei, so etwa Vorurteile,<br />
ungenügendes professionelles Know-how involvierter Instanzen<br />
und die meist fehlende Vernetzung unter den behandelnden Ärzten.<br />
22 ZeSo 1/<strong>14</strong> SCHWERPUNKT
Gesundheit<br />
Psychisch bedingte Arbeitsprobleme lassen sich oft nur mit einem integrierten Vorgehen lösen. <br />
Bild: Keystone<br />
Aber auch behandelnde Ärzte sind oft wenig hilfreich, weil sie den<br />
Kontakt mit den Arbeitgebenden und den Behörden zu selten suchen<br />
oder ihn mit Verweis auf das Arztgeheimnis gar verhindern.<br />
Das Krankschreibeverhalten der Ärzte – man will den Patienten<br />
«schützen» – ist nicht selten eine Barriere für den Arbeitsplatzerhalt<br />
oder für eine Wiedereingliederung. Zudem tragen die Sozialversicherungen<br />
der Häufigkeit von psychischen Störungen bei<br />
ihrer Klientel kaum Rechnung. Sei es, weil psychische Krankheit<br />
mehr oder weniger negiert wird wie bei der Arbeitslosenversicherung<br />
oder weil die entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen<br />
nicht vorhanden sind. Die meist negativen Reaktionen des Umfelds<br />
verstärken zudem die Hemmung der Betroffenen, sich mit<br />
ihren psychischen Problemen beispielsweise am Arbeitsplatz zu<br />
outen. Dies wiederum verhindert oft eine adäquate Reaktion des<br />
Umfelds. So lässt sich erahnen, wie komplex der Zusammenhang<br />
zwischen psychischen Problemen und Erwerbslosigkeit ist.<br />
Gemeinsam ein Setting erarbeiten<br />
Psychische Probleme spielen in der sozialen Arbeit sehr häufig eine<br />
wesentliche Rolle. Diese sollten von den Sozialarbeiterinnen und<br />
Sozialarbeitern aufgegriffen werden, und wenn psychische Probleme<br />
oder eine schwierige Persönlichkeit den Unterstützungsprozess<br />
entscheidend hemmen, sollten die Klienten respektive Klientinnen<br />
nach Möglichkeit einer ärztlichen oder psychiatrischen Behandlung<br />
zugewiesen werden. Generell sollte der Kontakt mit den<br />
behandelnden Ärzten gesucht werden. Dies ist gerade bei Klienten,<br />
die immer wieder Arbeitsstellen wegen Konflikten am Arbeitsplatz<br />
verlieren, besonders wichtig. Denn psychisch bedingte<br />
Arbeitsprobleme sind oft so komplex und dynamisch, dass man sie<br />
nur gemeinsam lösen kann. Das bedeutet allerdings, dass Sozialarbeitende,<br />
behandelnde Ärtinnen und Ärzte und die Klientel sich<br />
darüber einig werden müssen, wo das Problem zu verorten ist<br />
(Problemanalyse), wie dagegen vorgegangen werden soll (Eingliederungsplanung)<br />
und welche «Spielregeln» dabei gelten sollen<br />
(Setting).<br />
Psychische Krankheit, Erwerbslosigkeit und Armut sind nicht zuletzt<br />
deshalb eng miteinander verbunden, weil das Sozial- und das<br />
Gesundheitswesen so fragmentiert sind: Ärzte gehen Arbeitsprobleme<br />
in der Behandlung nicht konkret an und Sozialarbeitende kümmern<br />
sich zu wenig um die psychische Problematik. Mit einem integrierteren<br />
Vorgehen könnten mehr Personen mit psychischen Problemen im<br />
Arbeitsmarkt gehalten werden. Angesichts der steigenden Belastung<br />
der Sozialversicherungen durch die Ausgliederung psychisch Kranker<br />
sollte dies dringend an die Hand genommen werden. <br />
•<br />
Niklas Baer<br />
Leiter Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation<br />
Psychiatrie Baselland<br />
SCHWERPUNKT 1/<strong>14</strong> ZeSo<br />