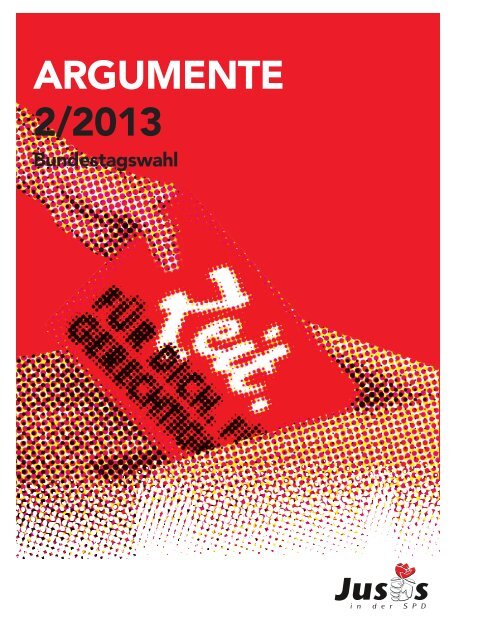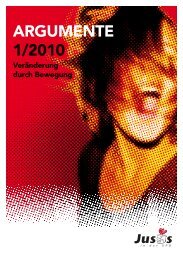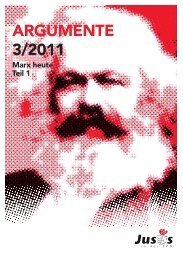ARGUMENTE 2/2013 Bundestagswahl - Jusos
ARGUMENTE 2/2013 Bundestagswahl - Jusos
ARGUMENTE 2/2013 Bundestagswahl - Jusos
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ARGUMENTE</strong><br />
2/<strong>2013</strong><br />
<strong>Bundestagswahl</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 1<br />
<strong>ARGUMENTE</strong><br />
2/<strong>2013</strong><br />
<strong>Bundestagswahl</strong><br />
Impressum<br />
Herausgeber Bundesverband der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD beim<br />
SPD-Parteivorstand<br />
Verantwortlich Sascha Vogt und Jan Böning<br />
Redaktion Jan Schwarz, Katharina Oerder, Matthias Ecke und Ariane Werner<br />
Redaktionsanschrift SPD-Parteivorstand, Juso-Bundesbüro, Willy-Brandt-Haus,<br />
10963 Berlin<br />
Tel.: 030 25991-366, Fax: 030 25991-415, www.jusos.de<br />
Verlag Eigenverlag<br />
Druck braunschweig-druck GmbH<br />
Die Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion oder<br />
des Herausgebers wieder.
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 2<br />
INHALT<br />
Intro: Und jetzt alle: Gerechtigkeit! Zur <strong>Bundestagswahl</strong> <strong>2013</strong> ............................ 5<br />
von Matthias Ecke, Katharina Oerder und Jan Schwarz,<br />
Mitglieder der Redaktion<br />
Magazin<br />
Die folgenden Artikel wurden durch ein Call for Paper zu „Zeit für Gerechtigkeit“ eingeworben<br />
und ausgewählt.<br />
Homo Gerechticus ................................................................................................... 9<br />
von Katharina Oerder, Doktorandin Psychologie, Juso-Bundesvorstand,<br />
Peter Beule, Doktorand Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaftler<br />
und Lena Oerder, Doktorandin Rechtswissenschaft, Juso-Vorstand Köln<br />
Wie die Linken die Moral entdeckten – und die Mitte sie aus dem Blick verlor 16<br />
von Rainer Freudenthaler, Student der Medien- und Kommunikationswissenschaft<br />
Universität Mannheim, SPD Stuttgart<br />
Ist Hans verrückt?<br />
Über das Zusammenspiel von Freiheit, Gleichheit und Demokratie ................... 22<br />
von Katharina Schenk, promoviert an der Universität Leipzig<br />
im Fachbereich Philosophie zum Themenkomplex Gemeinwohl und Glück<br />
Mehr Gleichheit wagen ..........................................................................................26<br />
von Moritz Rudolph, stellv. Vorsitzender <strong>Jusos</strong> Nordost<br />
Schwerpunkt<br />
Programm für den linken Politikwechsel .............................................................. 33<br />
von Sascha Vogt, Juso-Bundesvorsitzender<br />
2 Inhalt Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 3<br />
Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen:<br />
Wie beeinflussen sie die Wahlentscheidung? ...................................................... 39<br />
von Aiko Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „German Longitudinal<br />
Election Study (GLES)“, Abteilung „Demokratie und Demokratisierung“ am Wissenschaftszentrum<br />
Berlin für Sozialforschung (WZB)<br />
„E-Mail ist total 90er!“ – Perspektiven einer vernetzten Gesellschaft................. 46<br />
von Prof. Dr. Gesche Joost, Professorin für Designforschung und Mitglied im Kompetenzteam<br />
von Peer Steinbrück für den Bereich Netzpolitik<br />
Holt Deutschland von der Insel! Antworten der SPD auf die Krise der Eurozone:<br />
Was leistet das Regierungsprogramm? ................................................................ 52<br />
von Dr. Björn Hacker, stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses Europa der<br />
SPD Berlin und Referent in der Friedrich-Ebert-Stiftung<br />
Umsteuern für Bildung und Gerechtigkeit ........................................................... 58<br />
von Dr. Carsten Sieling, MdB<br />
Wohnen muss bezahlbar bleiben ......................................................................... 64<br />
von Felix von Grünberg, Vorsitzender des Mieterbundes und Landtagsabgeordneter der<br />
SPD in NRW<br />
It’s the women’s vote, honey. ............................................................................... 69<br />
von Nancy Haupt und Elisa Gutsche, Projektgruppe Junge Frauen im SPD-Parteivorstand<br />
Die SPD auf dem Weg zu einem progressiven Selbstverständnis<br />
im pluralen Deutschland? ...................................................................................... 77<br />
von Daniela Kaya, Mitglied im Bundesvorstand der SPD-AG Migration und Vielfalt,<br />
Autorin<br />
3
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 4<br />
Die Würde der Arbeit – SPD-Politik für Beschäftigte .......................................... 85<br />
von Klaus Wiesehügel, Vorsitzender der Gewerkschaft IG BAU und<br />
zuständig für den Bereich Arbeit und Soziales im Kompetenzteam von Peer Steinbrück<br />
Von der Leistungs- zur Erbengesellschaft? .......................................................... 90<br />
von Anita Tiefensee, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hertie School<br />
of Governance<br />
Ein anderes Deutschland in einem anderen Europa:<br />
Was EuropäerInnen von der <strong>Bundestagswahl</strong> erwarten ..................................... 95<br />
von Daniel Cornalba, Vizepräsident der Young European Socialists,<br />
Nationalsekretär für den Arbeitsbereich Europa des MJS France<br />
Mit Essen spielt man nicht! ................................................................................. 101<br />
von David Hachfeld, Referent für Handelspolitik bei Oxfam Deutschland<br />
Auch Kevin muss können dürfen! ....................................................................... 105<br />
von Mareike Strauß und Amina Yousaf, Mitglieder im Bundesvorstand<br />
der Juso-Hochschulgruppen<br />
4 Inhalt Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 5<br />
INTRO: UND JETZT ALLE:<br />
GERECHTIGKEIT! ZUR<br />
BUNDESTAGSWAHL <strong>2013</strong><br />
von Matthias Ecke, Katharina Oerder und Jan Schwarz, Mitglieder der Redaktion<br />
Einleitung zum Schwerpunkt<br />
Am 22. September sind fast 62 Millionen<br />
BundesbürgerInnen berechtigt<br />
und aufgerufen den 18. Deutschen<br />
Bundestag zu wählen. Plakate, Flyer<br />
und Großflächen, Sondersendungen<br />
und TV-Duelle zeugen von der kommenden<br />
Entscheidung.<br />
Eine nervöse Spannung im Land ist<br />
deswegen derzeit kaum zu spüren.<br />
Der Wahlkampf gilt vielen als gewohntes<br />
und manchmal skurriles Ritual einer<br />
konsolidierten Demokratie in relativem<br />
Wohlstand.<br />
Ist die Wahl also nur ein Popstar-Casting<br />
für Erwachsene? Wer sich die entpolitisierte,<br />
oft seicht psychologisierende<br />
und bisweilen erschreckend<br />
lethargische Berichterstattung über<br />
die <strong>Bundestagswahl</strong> anschaut, könnte<br />
leicht diesen Eindruck gewinnen. Ganz<br />
so, als gelte es im September nur darüber<br />
zu entscheiden, wessen tägliches<br />
Erscheinen im abendlichen Nachrichtenprogramm<br />
den Fernsehzuschauern<br />
zumutbarer erscheint. Tatsächlich geht<br />
es aber um weit mehr: Es geht um<br />
eine Grundsatzentscheidung über Lebensumstände,<br />
Rechte und Freiheitsgrade<br />
von über 80 Millionen Menschen<br />
in diesem Land (von den Lebens -<br />
umständen hunderter Millionen anderer<br />
EuropäerInnen ganz zu schweigen).<br />
Oft werden vor Wahlen Richtungsentscheidungen<br />
beschworen, das gehört zur<br />
Mobilisierung dazu. Allerdings: In jüngerer<br />
Vergangenheit war diese Einschätzung<br />
niemals so zutreffend wie heute. Das konservative<br />
und das rot-grüne Lager verorten<br />
die Probleme dieses Landes in jeweils anderen<br />
Bereichen. Ihre programmatischen<br />
Profile dienen den Interessen unterschiedlicher<br />
sozialer Gruppen in diesem Land.<br />
Sie bieten andersgeartete, teils gar gegensätzliche<br />
Lösungen an. Das Gesicht dieses<br />
Landes wird durch die Entscheidung am<br />
22. September entscheidend geprägt werden,<br />
das steht fest. Mindestlohn, Steuerpolitik,<br />
Rente und Bürgerversicherung, Bildungsinvestitionen,<br />
Entgeltgleichheit,<br />
Mietenbremse oder doppelte Staatsbürgerschaft:<br />
Nur mit der SPD besteht die Chance,<br />
dass die gesellschaftlichen Wunden aus<br />
der zunehmenden sozialen Spaltung<br />
schrittweise heilen. Schwarz-Gelb will und<br />
wird tiefere Kerben schlagen.<br />
5
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 6<br />
Wir <strong>Jusos</strong> haben in den letzten Jahren<br />
an der programmatischen Konsolidierung<br />
der SPD intensiv mitgewirkt, Reformdebatten<br />
angestoßen und auch manchen<br />
Kompromiss geschmiedet. Wir haben uns<br />
sprichwörtlich als Trümmerfrauen und -<br />
männer einer nach der Wahlniederlage<br />
2009 erschütterten und programmatisch<br />
förmlich entstellten SPD verdingt. Nicht<br />
alle Trümmer konnten wir beseitigen;<br />
manche Brocken waren zu groß, andere zu<br />
verschüttet, dritte wiederum wurden von<br />
Anderen vor dem Wegräumen geschützt.<br />
Trotz alledem hat die SPD (auch mit unserer<br />
Hilfe) aus den Trümmern ein neues<br />
Haus errichtet, das sich sehen lassen kann.<br />
Bis zum 22. September suchen wir nach<br />
weiteren BewohnerInnen.<br />
Dieses Heft ist als eine Art Inventur<br />
der gesellschaftlichen Herausforderungen<br />
und Konflikte im Deutschland des Jahres<br />
<strong>2013</strong> angelegt, verbunden mit der kritischen<br />
Würdigung der Lösungsvorschläge<br />
der SPD. Die AutorInnen durchleuchten<br />
die zentralen Reformbaustellen der Gegenwartsgesellschaft<br />
und zeigen auf, ob die<br />
SPD die richtigen Werkzeuge zur Hand<br />
hat. Wir fragen: Wird sich das Leben in<br />
diesem Land für die Mehrheit der Menschen<br />
real und spürbar verbessern, wenn<br />
die SPD ab September in diesem Land regiert?<br />
Wenn ja: warum?<br />
Diese Perspektive trägt unserer Überzeugung<br />
Rechnung, dass politischer<br />
Machterwerb niemals Selbstzweck sein<br />
kann und Machtbegehren ohne politisches<br />
Ziel immer scheitern muss. Wahlsiege und<br />
Regierungswechsel sind stets Mittel, um<br />
gesellschaftliche Mehrheiten für fortschrittliche<br />
und emanzipatorische Politik<br />
in Parlaments- und Regierungsmehrheiten<br />
zu überführen. Sie sollen dazu dienen, die<br />
richtigen Leute mit den richtigen Lösungen<br />
an die wichtigen Stellen zu bringen.<br />
Dafür kämpfen wir als Teil der Sozialdemokratie.<br />
Darum geht es am 22. September.<br />
Deutschland im Sommer <strong>2013</strong>. Es ist<br />
Zeit für einen Politikwechsel. Zeit für Gerechtigkeit!<br />
Die Beiträge im Einzelnen<br />
Sascha Vogt zeigt in seinem Beitrag<br />
auf, wie die SPD sich in den letzten vier<br />
Jahren einer Re-Sozialdemokratisierung un -<br />
terzogen hat. In diesem Prozess spielten die<br />
<strong>Jusos</strong> eine erhebliche Rolle. Das Regierungs -<br />
programm enthält nach längerer Zeit erstmals<br />
wieder viele Juso-Positionen. Es wird<br />
anhand unterschiedlicher Kernbereiche<br />
des Programms deutlich gemacht, inwiefern<br />
die SPD-Positionen für einen klaren<br />
Kurswechsel hin zu linker Politik stehen.<br />
Welchen messbaren Beitrag leisten<br />
SpitzenkandidatInnen für die Stimmentscheidung<br />
der WählerInnen tatsächlich,<br />
fragt Aiko Wagner. Er hinterfragt die gängige<br />
Personalisierungsthese wonach politikfremde<br />
Charaktereinschätzungen von<br />
politischen Führungspersonen einen zunehmend<br />
gravierenderen Einfluss erhalten<br />
hätten. Parteien blieben vielmehr die relevanteren<br />
Bewertungsobjekte für die Bürgerinnen<br />
und Bürger. Die SpitzenkandidatInnen<br />
übten einen kleinen, aber in<br />
Pattsituationen womöglich entscheidenden<br />
Einfluss aus.<br />
Visionen für die Ausgestaltung der vernetzten<br />
Gesellschaft entwirft Prof. Dr.<br />
6<br />
Intro: Und jetzt alle: Gerechtigkeit! Zur <strong>Bundestagswahl</strong> <strong>2013</strong> Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 7<br />
Gesche Joost. Die digitale Entwicklung<br />
hält viele Chancen für Bürgerinnen und<br />
Bürger bereit, jedoch stellt die Überwindung<br />
der digitalen Spaltung eine große<br />
Herausforderung dar. Der Beitrag zeigt<br />
auf, welche politischen Diskurse dringend<br />
geführt werden müssen, um die richtigen<br />
Rahmenbedingungen für eine vernetzte<br />
Gesellschaft zu setzen. Ob digitale Arbeitswelt,<br />
vernetztes Engagement oder digitale<br />
Technologien – alle Bereiche zeigen,<br />
dass die Partizipation aller insbesondere<br />
von seitens der Politik umfassende Anstrengungen<br />
erfordert.<br />
Die politische „Insellage“ Deutschlands<br />
in der Europadebatte beschreibt Dr. Björn<br />
Hacker. In keinem anderen Land werde<br />
die Refinanzierungskrise der Staaten im<br />
Euroraum so einseitig zur Schuldenkrise<br />
verklärt wie hierzulande. Er erläutert, wie<br />
es der Opposition trotz eines breiten Fundus’<br />
an alternativen Ideen nicht gelang,<br />
dem dominanten Krisendiskurs der Bundesregierung,<br />
vieler Medien und der Mainstream-Ökonomie<br />
eine Alternative entgegen<br />
zu setzen. Wie ein Paradigmenwechsel<br />
für ein soziales und demokratisches Europa<br />
aussehen kann skizziere der Europateil des<br />
SPD-Wahlprogramms.<br />
Der Bundestagsabgeordnete Dr. Cars -<br />
ten Sieling kritisiert in seinem Beitrag die<br />
verfehlte Finanz- und Steuerpolitik der<br />
schwarz-gelben Bundesregierung und<br />
stellt die Alternativen der SPD vor. Für ihn<br />
hat Steuer- und Finanzpolitik eine dienende<br />
Funktion für die Erfüllung der zentralen<br />
Aufgaben unseres Gemeinwesens. Chancen<br />
zur Finanzierung der notwendigen<br />
Zukunftsinvestitionen in Bildung, Infrastruktur,<br />
ökologische Modernisierung und<br />
zur Finanzierung des Sozialstaats müssten<br />
durch eine Verbesserung der Staatseinnahmen<br />
genutzt werden. Wichtig seien dabei<br />
die Reform der Einkommenssteuer, eine<br />
Rückführung der Abgeltungssteuer in die<br />
Einkommensbesteuerung und das Heranziehen<br />
großer Vermögen durch Reformen<br />
in der Erbschaftssteuer sowie der Wiedereinführung<br />
der Vermögensteuer.<br />
Wohnungsnot und steigende Wohnkosten<br />
sind gerade im Wahlkampf wieder<br />
vermehrt in die Aufmerksamkeit der Politik<br />
gerückt. Der Vorsitzende des Mieterbundes<br />
und Landtagsabgeordnete der SPD<br />
in NRW, Felix von Grünberg beschreibt<br />
Forderungen des Mieterbundes an die Politik,<br />
um Wohnen wieder bezahlbar zu machen.<br />
Nancy Haupt und Elisa Gutsche beschreiben<br />
in ihrem Beitrag ein Konzept,<br />
mit dem die SPD die Stimmen von Frauen<br />
(zurück) gewinnen soll. Junge Frauen, die<br />
sich 2009 von der SPD abgewandt werden,<br />
sollen mit den richtigen Konzepten wieder<br />
von der SPD-Politik überzeugt werden.<br />
Nur wer TESH ist (also die richtigen Themen<br />
hat, echte Einbindung verspricht,<br />
neutrale Sprache verwendet und eine ehrliche<br />
Haltung zu Frauenpolitik an den Tag<br />
legt) kann heute noch überzeugen, argumentieren<br />
die beiden Willy-Brandt-Haus<br />
Mitarbeiterinnen.<br />
Den Weg der SPD zu einem progressiven<br />
Selbstverständnis der Einwanderungsgesellschaft<br />
in Deutschland analysiert Daniela<br />
Kaya. Trotz der historischen<br />
Verortung im Internationalismus und des<br />
Bekenntnisses zum republikanischen Nationenverständnis<br />
sei die Programmatik<br />
der SPD zu Nation und Pluralismus seit<br />
langem ambivalent. Anhand einer Analyse<br />
7
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 8<br />
der zentralen Programmbausteine der Integrationspolitik<br />
seit dem Berliner Programm<br />
1989 zeigt sie das Changieren der<br />
SPD zwischen paternalistischen Assimilationsappellen<br />
einerseits und einer modernen<br />
Diversitätspolitik andererseits. Trotz<br />
Fortschritten in einzelnen Feldern fehle es<br />
der Partei diesbezüglich noch an einer Gesellschaftsvision.<br />
Der zukünftige Arbeitsminister Klaus<br />
Wiesehügel beschreibt in seinem Artikel<br />
die immer weiter verbreiteten schlechten<br />
Arbeitsbedingungen für viele Beschäftigte<br />
und beschreibt seine Vorstellungen von der<br />
Würde der Arbeit. Erwerbsarbeit werde<br />
entwertet, weil sie immer schlechter bezahlt<br />
wird. Deswegen fordert er den gesetzlichen<br />
Mindestlohn von mindestens<br />
8,50 Euro, einheitlich, in allen Branchen<br />
und überall. Erwerbsarbeit werde aber<br />
auch entwertet, weil sie unsicherer geworden<br />
ist. Dem möchte er mit einer Regulierung<br />
der Leiharbeit und Maßnahmen gegen<br />
den Missbrauch von Werkverträgen<br />
vorgehen. Die Würde des Menschen und<br />
die Würde der Arbeit seine für die Sozialdemokratie<br />
immer unverzichtbar. Dazu gehört<br />
für ihn auch die Demokratisierung der<br />
Wirtschaft.<br />
Die Transformation von der Leistungsin<br />
die Erbengesellschaft analysiert Anita<br />
Tiefensee in ihrem Beitrag. Sie beschreibt<br />
die zunehmende Konzentration von Vermögen<br />
in den Händen weniger, oft durch<br />
Erbschaft begünstigter Menschen und die<br />
gesellschaftlichen Konsequenzen dieser<br />
Entwicklung. Sie schlägt vor die steuerpolitischen<br />
Vorschläge der SPD um eine beherzte<br />
Erbschaftssteuerreform zu ergänzen.<br />
Daniel Cornalba blickt aus Sicht der<br />
europäischen NachbarInnen auf die anstehende<br />
<strong>Bundestagswahl</strong>. Er beschreibt die<br />
verheerenden Folgen der Politik der Regierung<br />
Merkel für viele Menschen in Europa<br />
und deckt zusätzlich den Versuch auf, dieses<br />
Treiben als alternativlos hinzustellen.<br />
Cornalba berichtet von den Hoffnungen,<br />
die viele EuropäerInnen in die SPD setzen,<br />
und zählt auf welche Probleme die SPD<br />
angehen müsste um diese zu erfüllen.<br />
Die weltweiten Auswirkungen von<br />
Nahrungsmittelspekulationen beschreibt<br />
David Hachfeld von Oxfam Deutschland<br />
in seinem Beitrag „Mit Essen spielt man<br />
nicht“. Organisationen wie Oxfam oder<br />
Attac setzen sich schon seit längerem gegen<br />
Nahrungsmittelspekulationen und die<br />
daraus resultierenden Hungersnöte für die<br />
Ärmsten der Armen ein. Oxfam fordert<br />
beispielsweise Obergrenzen für den Wert<br />
der von Händlern gehaltenen Rohstoffderivate<br />
um Fehlentwicklungen auf dem Terminmarkt<br />
endlich einzuschränken.<br />
Wie stark Bildungschancen in<br />
Deutschland immer noch von der Herkunft<br />
abhängen erläutern Mareike Strauß<br />
und Amina Yousaf. Sie bemängeln die<br />
mangelnde Ausfinanzierung der öffentlichen<br />
Bildungseinrichtungen in Deutschland<br />
und die Lücken in der Studienfinanzierung.<br />
Strauß und Yousaf fordern nicht<br />
nur institutionelle und finanzielle Verbesserungen,<br />
wie sie das SPD-Regierungsprogramm<br />
etwa hinsichtlich Gebührenfreiheit,<br />
Durchlässigkeit, Ganztagsschulen,<br />
inklusiver Bildung, Aus bil dungs -<br />
platzgarantie oder einer BAföG-Reform<br />
vorsieht. Sie mahnen zudem eine neue<br />
Kultur des Lehrens und Lernens an. l<br />
8 Intro: Und jetzt alle: Gerechtigkeit! Zur <strong>Bundestagswahl</strong> <strong>2013</strong> Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 9<br />
HOMO GERECHTICUS<br />
von Katharina Oerder, Peter Beule und Lena Oerder, ???<br />
Magazin<br />
Wie eine heiße Welle breitet sich das<br />
Gefühl im Körper aus. Heiße Wut,<br />
Ohnmachtsgefühle, das dringende<br />
Bedürfnis dagegen anzugehen. Ungerechtigkeit<br />
zu erleben, sie mit ansehen<br />
zu müssen, ist schwer zu ertragen. Ein<br />
unbändiges Gefühl der Ungerechtigkeit<br />
ist es, das viele Menschen in die<br />
Politik getrieben hat: Das Bedürfnis an<br />
einer ungerechten Welt etwas zu ändern,<br />
etwas zu verbessern, die Welt<br />
gerechter zu machen.<br />
Mit „Zeit für Gerechtigkeit“ ziehen wir<br />
<strong>Jusos</strong> nun in den Wahlkampf. Mit der<br />
inneren Überzeugung, dass es so nicht<br />
weitergehen kann, dass die Zeit für<br />
Gerechtigkeit nun endlich gekommen<br />
ist.<br />
Aber auch andere Parteien werben –<br />
gerade im Wahlkampf – damit, mit ihren<br />
Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit<br />
zu sorgen. Gerechtigkeit ist in der<br />
Öffentlichkeit durchweg positiv besetzt,<br />
keine Partei würde für weniger<br />
Gerechtigkeit eintreten. So wirbt beispielsweise<br />
die neoliberale, CDU/FDPnahe<br />
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft<br />
auf großen Plakatwänden mit<br />
ihrer Interpretation von Gerechtigkeit:<br />
„Ist es gerecht, dass Sandra bessere<br />
Chancen hat als Laura? Nein. Ist es<br />
gerecht die Steuern zu erhöhen?<br />
Nein“, heißt es dort, und beschreibt<br />
damit das Gegenteil dessen, was wir<br />
uns unter Gerechtigkeit vorstellen.<br />
Aber auch das sozialdemokratische<br />
Verständnis von Gerechtigkeit hat sich<br />
in den letzten Jahren immer wieder<br />
gewandelt.<br />
Soziale Gerechtigkeit<br />
Die wichtigste Gerechtigkeitskategorie<br />
der Sozialdemokratie ist die der „sozialen<br />
Gerechtigkeit“. Es waren die durch die Industrialisierung<br />
hervorgebrachte „soziale<br />
Frage“ und die erstarkende Arbeiterbewegung,<br />
in der sich die Verbindung der Begriffe<br />
„sozial“ und „Gerechtigkeit“ vollzog.<br />
Seither hat sich das Grundverständnis von<br />
sozialer Gerechtigkeit als Verteilungs -<br />
gerechtigkeit herausgebildet. Nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg ist sie zum Grundwert<br />
des Sozialstaats schlechthin geworden. Sie<br />
beinhaltet eine breite soziale Sicherung<br />
und Gleichheit, gleiche Rechte und Chan-<br />
9
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 10<br />
cen und die dafür erforderliche Umverteilung<br />
von Einkommen und Vermögen von<br />
oben nach unten.<br />
Im Kern geht es bei in der Auseinandersetzung<br />
um soziale Gerechtigkeit immer<br />
um die Grundfrage des Verhältnisses<br />
zwischen Markt und Staat/Politik. Im<br />
Zuge des Aufschwungs marktradikaler<br />
Theorien und Politikansätze beginnend in<br />
den 1970er Jahren ist die Kategorie der sozialen<br />
Gerechtigkeit intellektuell ins Hintertreffen<br />
geraten. Auch das sozialdemokratische<br />
Verständnis von Gerechtigkeit<br />
blieb davon nicht unberührt. Der Ansatz<br />
des Dritten Weges setzte auf „mehr Markt“<br />
und ließ die Frage der gerechten Verteilung<br />
weitgehend außen vor. Eine kapitalistische<br />
Wirtschaftsordnung schaffe hohes Wachstum,<br />
das, wenn auch nicht allen, so doch<br />
der großen Mehrheit zugute komme. Ungleichheit<br />
galt eher als ein die Wirtschaft<br />
belebendes Element.<br />
Kennzeichen des neoliberalen Vormarsches<br />
war auch, dass andere Begriffe von<br />
Gerechtigkeit gegen die soziale Gerechtigkeit<br />
gesetzt wurden, mit dem Ziel, das Verhältnis<br />
von Markt und Staat in Richtung<br />
„mehr Markt“ zu verschieben. So gebrauchen<br />
die Marktradikalen „Leistungsgerechtigkeit“,<br />
um den Sozialstaat auszuhebeln.<br />
Oft missbraucht wird in diesem<br />
Sinne auch „Generationengerechtigkeit“,<br />
um sie gegen vorgeblich „alte Verteilungsfragen“<br />
auszuspielen. Dabei geht es immer<br />
um dasselbe: Besitzstandswahrung der Kapitalseite.<br />
Auch bei Sozialdemokraten war seit<br />
den 1990er Jahren immer wieder von<br />
„Chancengerechtigkeit“ und weniger von<br />
sozialer Gerechtigkeit die Rede. Die<br />
„Chancengesellschaft“ drohte den „demokratischen<br />
Sozialismus“ als Leitbild abzulösen.<br />
Der breite Angriff aus marktliberalkonservativer<br />
Warte gipfelte schließlich in<br />
der perfiden Argumentation, soziale Gerechtigkeit<br />
sei nicht mehr als eine leere<br />
Formel, ihre Verfechter wollten nur Neid<br />
schüren, eine Ausbeutung fände heute von<br />
unten nach oben statt: fleißige Leistungsträger<br />
durch asoziale Leistungsempfänger.<br />
Seit uns der Kapitalismus mit der Finanzmarkt-<br />
und Bankenkrise eine lange<br />
Nase gezeigt hat, der Marktradikalismus<br />
an die Wand gefahren ist und sich Herausgeber<br />
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung<br />
eingestehen müssen, dass die Linke<br />
Recht behalten hat, hat sich der Wind allerdings<br />
gedreht. Heute wird immer mehr<br />
deutlich, dass das Konzept der „Chancengerechtigkeit“<br />
nicht taugt, um den Begriff<br />
der sozialen Gerechtigkeit abzulösen.<br />
Denn ist es gerecht, nur den zur Chance<br />
Befähigten, der egoistisch Bildung, sozialem<br />
Aufstieg und Prestige hinterherjagt,<br />
Anerkennung zukommen zu lassen und<br />
Armut als selbstverschuldetes Schicksal<br />
hinzunehmen? Nein, sagt die Sozialdemokratie<br />
(mittlerweile wieder) und mit ihr<br />
auch die meisten anderen Menschen.<br />
Was aber ist dann gerecht, und warum<br />
empfinden wir so? Was bedeutet nun eigentlich<br />
Gerechtigkeit?<br />
Gerechtigkeitsdefinitionen<br />
Eine (westliche) Definition, auf die<br />
sich viele Menschen einigen können, lautet:<br />
„Gerechtigkeit bedeutet, jedem das zu<br />
geben, was ihm gebührt“ – worüber wir uns<br />
dann schnell wieder uneinig sein können:<br />
Was gebührt mir? Muss ich mir „verdie-<br />
10<br />
Homo gerechticus Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 11<br />
nen“, was mir gebührt oder stehen mir gewisse<br />
Dinge einfach zu? Gebührt mir das<br />
gleiche wie dir – egal ob ich vielleicht etwas<br />
ganz anderes brauche als du?<br />
Distributive Gerechtigkeit<br />
Distributive Gerechtigkeit beschreibt<br />
die Gerechtigkeit der Verteilung von Gütern.<br />
Eine Sonderumfrage im Rahmen des<br />
sozio-ökonomischen Panels im Jahr 2003<br />
bestätigt für Deutschland die Auffassung,<br />
dass Gleichheit, Leistung und Bedürfnisse<br />
von der Bevölkerung als gleichzeitig nebeneinander<br />
gültige Gerechtigkeitskriterien<br />
betrachtet werden. Diese drei Auffassungen<br />
von Gerechtigkeit scheinen es zu<br />
sein, die wir immer wieder zur Beurteilung<br />
verschiedener Situationen heranziehen, die<br />
sowohl staatliche Leitlinien vorgeben als<br />
auch in der Sozialdemokratie in jeweils<br />
verschiedenen Situationen unsere Handlungsmaximen<br />
sind.<br />
„Jede/r kriegt was er verdient“ ist das<br />
Motto der Leistungsgerechtigkeit (eaquity).<br />
Dieses Prinzip wird beispielsweise bei<br />
der Entlohnung von Arbeit und auch in<br />
der Rentenversicherung angewandt.<br />
„Jede/r kriegt was er braucht“ heißt es<br />
nach dem Verständnis der Bedürfnisgerechtigkeit<br />
(need), die zum Beispiel die<br />
Grundidee der Krankenversicherung beschreibt<br />
(auch wenn dieses Prinzip in einigen<br />
Bereichen bereits ausgehöhlt wurde).<br />
Gerecht ist, wenn „Jede/r das gleiche<br />
kriegt“ sagt die Gleichheit (equity). Nach<br />
dieser Idee wird beispielsweise das Kindergeld<br />
verteilt. Zumindest rhetorisch war<br />
dem Staat stets jedes Kind gleich viel Wert<br />
(auch wenn diese Argumentation durch die<br />
hohen Steuerfreibeträge für Besserverdienende<br />
eine reine Farce war).<br />
Auch wenn es natürlich noch weitere<br />
Gerechtigkeitsbegriffe gibt, die die Distribution<br />
von materiellen oder immateriellen<br />
Gütern beschreibt (Umweltgerechtigkeit,<br />
Generationengerechtigkeit, Tauschgerechtigkeit),<br />
sind diese meist einer der oben beschriebenen<br />
Spielarten zuzuordnen.<br />
Prozedurale Gerechtigkeit<br />
Bei der prozeduralen Gerechtigkeit<br />
hingegen steht nicht das Ergebnis, sondern<br />
der Prozess, der zur Entscheidung führt,<br />
im Mittelpunkt. Auch Entscheidungen,<br />
die für die eigene Person oder Gruppe mit<br />
einem ungünstigen Ergebnis verbunden<br />
sind, werden akzeptiert, wenn das Verfahren,<br />
das zu dieser Lösung geführt hat, als<br />
gerecht wahrgenommen wurde (Tyler &<br />
Folger, 1980).<br />
Ein gutes Beispiel dafür ist die Debatte<br />
um Stuttgart 21. Die Sympathien für die<br />
Gegner des Bahnhofbaus brachen in dem<br />
Moment weg, als sich die Mehrheit der<br />
BürgerInnen in einem als gerecht empfundenen<br />
Verfahren (Volksentscheid), FÜR<br />
den Bau des Bahnhofes aussprach. Auch<br />
der große Wunsch nach „Transparenz“ in<br />
der Politik, der bei Umsetzung in den politischen<br />
Prozess auch nicht zwangsläufig zu<br />
anderen Ergebnissen führt – wie Stuttgart<br />
21 gezeigt hat –, kann durch dieses Streben<br />
nach prozeduraler Gerechtigkeit zumindest<br />
ansatzweise erklärt werden.<br />
Justizielle Gerechtigkeit<br />
Unter justizieller Gerechtigkeit werden<br />
gemeinhin angemessene Gesetze sowie<br />
11
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 12<br />
eine faire Rechtsprechung verstanden.<br />
Doch wann sind Gesetze „richtig“, wann<br />
ist Rechtsprechung ausgewogen? Schnell<br />
erinnern wir uns an den oft zitierten Satz,<br />
Recht haben und Recht bekommen sei<br />
nicht das gleiche. Ist es auch nicht. Man<br />
kann einen Anspruch zugesprochen bekommen,<br />
obwohl man ihn eigentlich gar<br />
nicht hat – und umgekehrt. Manchmal ist<br />
der Fall klar. Und wenn das passiert, wenn<br />
Recht haben und Recht bekommen auseinander<br />
fallen, empfinden wir das als ungerecht.<br />
Manchmal aber, und das geschieht<br />
vor den Gerichten weit öfter als man meinen<br />
könnte, ist der Fall eben gar nicht klar.<br />
Justizielle Gerechtigkeit kann nicht in jeder<br />
Lebenslage eine objektive Gerechtigkeit<br />
widerspiegeln. Dies ist unabhängig von<br />
der philosophischen Frage einleuchtend,<br />
ob es eine objektive Gerechtigkeit überhaupt<br />
gibt. Unser Anspruch an Gesetze<br />
und Rechtsprechung muss daher sein, dass<br />
sich diese so häufig wie möglich, so nah<br />
wie möglich einer objektiven Gerechtigkeit<br />
annähern. Dies wird durch verschiedene<br />
Rechtsprinzipien und Verfahrensregeln ver -<br />
sucht. Die von uns selbst gesetzten Normen<br />
spiegeln folglich wider, was wir als Ge -<br />
rechtigkeit (vor dem Gesetz) empfinden.<br />
Zunächst fällt dabei auf, dass zivilrechtliche<br />
Gerechtigkeit, beispielsweise aus<br />
Verträgen oder Erbe, von uns gänzlich anders<br />
gehandhabt wird, als die Gerechtigkeit<br />
im Strafrecht. In letzterem haben wir<br />
nämlich die Vorstellung, dass es gerecht ist,<br />
wenn nicht jede einzelne Person individuell<br />
Vergeltung gegenüber ihren PeinigerInnen<br />
üben muss. Das darf sie gar nicht. Es<br />
wird vielmehr davon ausgegangen, dass<br />
Gerechtigkeit am besten durch den Staat<br />
ausgeübt werden kann. Deshalb klagt im<br />
Strafrecht keine individuell geschädigte<br />
Partei die angeschuldigte Person an, sondern<br />
die Staatsanwaltschaft. Das leuchtet<br />
ein, hält man sich vor Augen, dass im<br />
Strafrecht nicht in erster Linie individuelle<br />
Unrecht an einer einzelnen Person vergolten<br />
wird, sondern die Tatsache, dass die<br />
TäterInnen sich gegen die Rechtsordnung<br />
und damit gegen gesellschaftliche Vereinbarungen<br />
gestellt haben. Denn wenn Personen<br />
andere verletzen, betrügen oder ihnen<br />
etwas stehlen, dann ist dies nach<br />
unserem Verständnis ein Angriff auf unser<br />
Zusammenleben. Dieses zu schützen, ist<br />
Aufgabe des Staates. Das empfinden wir<br />
als gerecht.<br />
Im Zivilrecht hingegen haben wir ein<br />
anderes Gerechtigkeitsverständnis. Hier<br />
gilt die Dispositionsmaxime, was bedeutet,<br />
dass es den einzelnen Parteien frei steht zu<br />
bestimmen, ob sie überhaupt ein Verfahren<br />
einleiten wollen. Obwohl man es als ungerecht<br />
empfinden kann, wenn Menschen für<br />
sich selbst nachteilige Verträge schließen,<br />
oder sie Forderungen erfüllen, die eigentlich<br />
gar nicht bestehen, wird nicht „im Namen<br />
des Volkes“ Klage erhoben. Hier sehen<br />
wir die Rechtsordnung offenbar nicht<br />
so sehr in Gefahr, dass wir von staatlicher<br />
Seite eingreifen müssten. Die Parteien<br />
müssen sich nicht nur selbst an die Gerichte<br />
wenden, sondern Beweise vorbringen.<br />
Wer dies nicht kann oder will, muss eben<br />
mit der Situation leben. Das empfinden<br />
wir als gerecht.<br />
Gerechte-Welt-Glaube<br />
Das Bedürfnis, in einer gerechten Welt<br />
zu leben, in der prinzipiell jeder das bekommt,<br />
was „ihm gebührt“, ist ein basales<br />
soziales Motiv von Menschen (Lerner,<br />
1977, 1980). Wir glauben an motivierende<br />
12<br />
Homo gerechticus Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 13<br />
Sinnsprüche wie: „Jeder kriegt was er verdient“<br />
oder „alles gleicht sich irgendwann<br />
aus“. Tatsächlich erleben wir jedoch tagtäglich<br />
Ungerechtigkeiten: eine ungerechte<br />
Abfuhr, einen unfreundlichen Kollegen;<br />
oder noch schlimmer: Krankheit, Gewalt<br />
oder gar Tod. Diese folgen keinem glaubhaften<br />
Schema.<br />
Die gerechte Welt ist daher keine Tatsache,<br />
sondern lediglich eine Hoffnung,<br />
und allzu oft nur noch eine Illusion.<br />
Nichtsdestotrotz wollen wir Menschen sie<br />
aufrechterhalten, um drohende Kontrollverluste<br />
und Gefühle der fundamentalen<br />
Sinnlosigkeit abzuwehren (vergl. Montada<br />
& Lerner, 1998 ). Dieses Bedürfnis des<br />
„Gerechte-Welt-Glaubens“ geht so weit,<br />
dass wir uns nicht nur wünschen, dass jeder<br />
kriegt was er verdient, sondern auch, dass<br />
jeder verdient was er bekommt. Solche Erklärungsmuster<br />
können unter Umständen<br />
sogar zu lasten der „Wahrheit“ gehen. So<br />
lassen sich beispielsweise „blaming the victim“-Muster<br />
erklären. Arbeitslosigkeit?<br />
Wahrscheinlich hat sich da jemand nicht<br />
rasiert oder nicht gut genug gearbeitet. Sexuelle<br />
Belästigung? Die hatte doch bestimmt<br />
einen viel zu kurzen Rock an. Irgendeinen<br />
Grund muss es ja geben, gäbe es<br />
nämlich keinen, könnten mir solche<br />
schrecklichen Situationen auch jederzeit<br />
passieren, ohne dass ich mich dagegen<br />
schützen kann.<br />
Entsprechende Untersuchungen können<br />
also zeigen, dass es sich bei dem „Gerechtigkeitsmotiv“<br />
von Menschen nicht allein<br />
um eine prosoziale Form des Strebens<br />
nach Gerechtigkeit handelt, sondern dass<br />
diese durchaus aufs Spiel gesetzt werden<br />
kann, für eine „gerechte Wahrnehmung“<br />
der Situation (Montada, 1998).<br />
Handlungsrelevanz von Gerechtigkeit<br />
Die Gerechtigkeitsforschung kann zeigen,<br />
dass auch Kosten-Nutzen-Verteilungen,<br />
von denen Ökonomen unterstellen,<br />
Menschen würden nur nach ihrer eigenen,<br />
persönlichen Vorteilsrechnung handeln,<br />
nicht greifen. Menschen denken und handeln<br />
eben nicht als homo oeconomicus,<br />
sondern in Kategorien von Gerechtigkeit!<br />
Anders als häufig angenommen, ist Gerechtigkeit<br />
für viele Menschen keine theoretische,<br />
sondern eine ganz reale, handlungsrelevante<br />
Größe, an Hand derer<br />
Entscheidungen getroffen werden.<br />
So genannte „Green Justice“-Forschung<br />
kann zum Beispiel zeigen, dass sowohl<br />
emotionales als auch kognitives (Un)Gerechtigkeitsempfinden<br />
Auswirkungen auf<br />
(umweltrelevantes) Handeln haben kann<br />
(Ittner et al., 2002). Auch die Social Dilemma-Forschung<br />
zeigt, wie wichtig „Gerechtigkeit“<br />
für Urteile und Handlungen von<br />
Menschen ist. Ein soziales Dilemma stellt<br />
Beispielsweise die Nutzung von Automobilen<br />
oder Flugzeugen dar. Während es für<br />
einzelne Personen deutlich komfortabler<br />
ist, mit dem Auto zur Arbeit oder in den<br />
Urlaub zu fahren, anstatt das Fahrrad oder<br />
ÖPNV zu nutzen, erscheint es für die Allgemeinheit<br />
(und so eigentlich auch wieder<br />
für jeden einzelnen) im Hinblick auf saubere<br />
Luft und Lärmreduzierung angemessener,<br />
auf solche Verkehrsmittel zu verzichten.<br />
Ähnlich angelegt funktioniert auch<br />
„Free Riding“, also das Phänomen, dass<br />
Menschen (oder Institutionen) von etwas<br />
profitieren, ohne selbst einen Beitrag zu<br />
leisten. Beispiele hierfür sind Beschäftigte,<br />
die nicht bereit sind, einer Gewerkschaft<br />
13
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 14<br />
beizutreten und einen Mitgliedsbeitrag zu<br />
entrichten, aber von den gewerkschaftlich<br />
erstrittenen Lohnerhöhungen profitieren.<br />
Auf der Ebene der Institutionen ist das<br />
Nicht-Ratifizieren des Koyoto-Protokolls<br />
durch die USA ein Beispiel dafür, wie ein<br />
Land, in dem verantwortungsbewusster<br />
Umgang mit der Umwelt kleingeschrieben<br />
wird (das also selbst maßgeblich für das<br />
Problem mitverantwortlich ist), von den<br />
Auswirkungen des Protokolls profitiert.<br />
Solche Geschichten lassen uns wieder mit<br />
einem brennenden Gefühl der Ungerechtigkeit<br />
zurück.<br />
Selbst Personen, dies kann in Studien<br />
gezeigt werden, für die Gerechtigkeitsmotive<br />
und das Erreichen gemeinsamer Ziele<br />
einen sehr hohen Stellenwert haben, sind<br />
überraschenderweise nicht mehr bereit zu<br />
kooperieren bzw. entpuppen sich als unerbittliche<br />
Defekteure, wenn sie mit „Free<br />
Riding“ konfrontiert sind. Sie stellen in<br />
dem Moment das gemeinsame Ziel zurück,<br />
um vorrangig den Freifahrer zu sanktionieren,<br />
da er ihr Gerechtigkeitsempfinden<br />
massiv verletzt.<br />
Ein subjektives „Gerechtigkeitsurteil“ –<br />
das ist gerecht, das ist ungerecht – kann<br />
sich dabei entweder auf einen individuellen<br />
Vergleich (dieses Jahr habe ich mehr gearbeitet<br />
als letztes Jahr, deshalb ist es gerecht,<br />
wenn ich mehr Geld bekomme) oder soziale<br />
Vergleiche (mein Arbeitskollege bekommt<br />
mehr als ich, das ist ungerecht) beziehen.<br />
Klar ist, dass gerade in der Wahl<br />
dieser Referenzgruppe ein wichtiger Faktor<br />
bzw. eine Variable in der Gerechtigkeitswahrnehmung<br />
von Menschen liegt.<br />
Einem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse,<br />
dessen Gehalt gedeckelt werden soll,<br />
erscheint dies wahrscheinlich ungerecht,<br />
wenn er sich mit dem Vorstandsvorsitzenden<br />
der Deutschen Bank vergleicht. Vergleicht<br />
er sich jedoch mit seinen eigenen<br />
Angestellten, wird ihm sein Gehalt schon<br />
eher gerecht erscheinen. In dieser Erkenntnis<br />
liegt für die Sozialdemokratie Chance<br />
und Risiko zugleich, wenn es darum geht,<br />
die richtige Referenzgruppe zur Klärung<br />
unserer Vorstellung von Gerechtigkeit zu<br />
finden.<br />
Schlussfolgerung<br />
Welche Schlussfolgerungen können aus<br />
den oben beschriebenen Prinzipien sowie<br />
Wahrnehmung von Gerechtigkeit gezogen<br />
werden?<br />
Gerechtigkeit ist relativ (Referenzgruppe),<br />
das bedeutet, die Politik muss den<br />
Rahmen (die Relation) für das Gerechtigkeitsempfinden<br />
setzten. Menschen haben<br />
ein Gerechtigkeitsempfinden; Politik muss<br />
handeln.<br />
Gerechtigkeit hat verschiedene Bezugsrahmen<br />
(Leistung, Bedürfnis, Gleichheit,<br />
prozedurale Gerechtigkeit). Die Politik<br />
hat die Aufgabe, den Bezugsrahmen<br />
entsprechend ihres Wertekanons zu wählen.<br />
In unterschiedlichen Situationen halten<br />
wir in der Sozialdemokratie unterschiedliche<br />
Bezugsrahmen für an gemessen.<br />
Die entsprechende Handlungsmaxime<br />
gibt uns in der Sozialdemokratie die soziale<br />
Gerechtigkeit (Verteilungsgerechtigkeit).<br />
Gerechtigkeit ist nicht bloß eine abstrakte<br />
Norm, sondern die Menschen haben<br />
ein Empfinden für Gerechtigkeit. Das<br />
sozialdemokratische Gerechtigkeitsverständnis<br />
muss also von den Menschen ver-<br />
14 Homo gerechticus Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 15<br />
standen werden, muss bei ihnen ankommen.<br />
Dies zu transportieren ist eine politische<br />
Aufgabe, die im Wahlkampf auch<br />
emotional geleistet werden kann und muss<br />
– denn Gerechtigkeit ist Emotion.<br />
Auch Ungerechtigkeit ist Emotion, die<br />
sich ebenso gut (vielleicht sogar besser) bedienen<br />
lässt. Menschen haben den<br />
Wunsch, Ungerechtigkeit nicht zuzulassen<br />
(aggressives Reagieren gegen „Free Riding“).<br />
Auch das ist eine Chance für soziale<br />
Gerechtigkeit.<br />
Schließlich ist das Streben nach Gerechtigkeit<br />
nicht naiv, nicht bloße Traumtänzerei,<br />
das Bedürfnis nach einer gerechten<br />
Welt ist in den Menschen angelegt<br />
(Gerechte-Welt-Glaube). Diesen Wunsch<br />
wollen wir bedienen – denn auch wir glauben,<br />
dass eine gerechte Welt möglich ist.<br />
Es ist Zeit für Gerechtigkeit. l<br />
Literatur<br />
Lerner, M. J. (1980). The belief in a just world. A<br />
fundamental delusion. New York: Plenum Press.<br />
Lerner, M. J. (1977). The justice motive in social behavior.<br />
Some hypotheses as to its origins and forms.<br />
Journal of Personality, 45, 1 – 52.<br />
Montada, L. (1998), Gerechtigkeitsmotiv und Eigeninteresse.<br />
Zeitschrift für Erziehungswissenschaften,<br />
3,413 – 430.<br />
Ittner, H. (2002), Verkehrspolitische Engagements<br />
und Mobilitätsentscheidungen: Eine Frage von Moral,<br />
eigenem Nutzen oder Lebensstilen? Trier: Universitätsbibliothek<br />
Trier.<br />
Tyler, T.R./Folger, R. (1980). Distributional and procedural<br />
aspects of satisfaction with citizen-police encounters.<br />
Basis and Applied Social Psychology, 1,<br />
281 – 292.<br />
Montada, L. & Lerner, M.J. (1998). Responses to<br />
Victimizations and Belief in a Just World. New York:<br />
Plenum Press.<br />
15
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 16<br />
WIE DIE LINKEN DIE MO-<br />
RAL ENTDECKTEN – UND<br />
DIE MITTE SIE AUS DEM<br />
BLICK VERLOR<br />
von Rainer Freudenthaler, Student der Medien- und Kommunikationswissenschaft<br />
Universität Mannheim, SPD Stuttgart<br />
Dieses Jahr feierte die SPD ihren<br />
150. Geburtstag. Gleichzeitig befindet<br />
sie sich im Wahlkampf zur <strong>Bundestagswahl</strong>,<br />
und damit mitten im Deutungskampf<br />
darum, welche Politik als<br />
normativ richtig und als politisch realistisch<br />
gesehen werden kann. Dabei<br />
fehlt es häufig nicht an Vertrauen in<br />
die moralische Richtigkeit sozialdemokratischer<br />
Politik, viel häufiger wird einerseits<br />
die Umsetzbarkeit sozialdemokratischer<br />
Forderungen in Frage<br />
gestellt, oder der Wille sozialdemokratischer<br />
PolitikerInnen, ihre Versprechen<br />
auch einzulösen. Sozialdemokratische<br />
Politik ist heute auf einen<br />
Hoffnungsvorsprung angewiesen, den<br />
sie sich im Wahlkampf erst noch erarbeiten<br />
muss.<br />
Darum ist es interessant, die historische<br />
Entwicklung der Rolle moralischer<br />
Argumentation innerhalb linker<br />
Politik zu betrachten, um zu sehen,<br />
dass weder der Appell an das Mögliche<br />
immer typisch links war, noch der<br />
Rückgriff auf Sachzwänge immer typisch<br />
für bürgerliche Politik. Dieser<br />
Blick in die Geschichte zeigt, dass die<br />
Öffnung linker Diskurse für moralische<br />
Argumentation als Teil der Demokratisierung<br />
der Bewegung der Arbeitenden<br />
gesehen werden kann – und dass<br />
der Verweis auf vermeintliche geschichtliche<br />
Notwendigkeiten heute<br />
oft nur dazu dient, einer demokratischen<br />
Diskussion der moralischen<br />
Grundlagen der eigenen Politik aus<br />
dem Weg zu gehen.<br />
Die sozialistische Öffnung zur Moralphilosophie<br />
Heutzutage fällt es schwer, sich daran<br />
zu erinnern, dass die Orientierung an einer<br />
offenen, gestaltbaren Zukunft nicht schon<br />
immer eine genuin linke, sozialdemokratische<br />
Position war:<br />
Wie so verschiedene AutorInnen wie<br />
Laclau und Mouffe (2006) oder Habermas<br />
(1995) eindrucksvoll nachzeichnen, war im<br />
16 Wie die Linken die Moral entdeckten – und die Mitte sie aus dem Blick verlor Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 17<br />
19. Jahrhundert innerhalb der deutschen<br />
Sozialdemokratie ein Marxismus bestimmend,<br />
der davon ausging, den objektiven<br />
Gang der Geschichte aus den Widersprüchen<br />
des Kapitalismus ablesen zu können,<br />
und damit die eigene Politik an vermeintlichen<br />
geschichtlichen Notwendigkeiten<br />
orientieren zu können. Vor diesem Hintergrund<br />
erschien eine eigenständige Moralphilosophie<br />
nicht notwendig, sogar unmöglich:<br />
Da gesellschaftliche Moral als<br />
geschichtlich bedingt gesehen wurde, wurde<br />
die Aufgabe der Politik als wissenschaftliches<br />
Ablesen des geschichtlich notwendigen<br />
Handelns verstanden, und eine<br />
moralische Diskussion bestenfalls als ideologische<br />
Ablenkung. Wie Mouffe und Laclau<br />
zeigen, geriet diese Anschauung bereits<br />
zu Zeiten der zweiten Internationale<br />
ins Wanken – wenn das objektive Interesse<br />
der Arbeitenden Massen Maßstab sozialistischer<br />
Politik sein sollte, warum wählten<br />
diese nicht konsequent sozialistische Parteien,<br />
und warum waren sozialistische PolitikerInnen<br />
weit uneiniger über die historisch<br />
notwendige Politik, als dies die<br />
Theorie vorhersah?<br />
Diese latente Krise des Marxismus verschärfte<br />
sich Anfang des 20. Jahrhunderts,<br />
als die politische Entwicklung des Westens<br />
nahelegte, dass der Kapitalismus sich mit<br />
Hilfe des Wohlfahrtsstaates weit genug<br />
stabilisieren konnte, dass sein Untergang in<br />
absehbarer Zeit als unwahrscheinlich erschien.<br />
Gleichzeitig zeigten westliche Demokratien<br />
Möglichkeiten zur Reform, die<br />
einen sozialdemokratischen Reformismus<br />
zu bestätigen schienen – dabei aber das<br />
prinzipielle Abhängigkeitsverhältnis zwischen<br />
Arbeitenden und Besitzenden nicht<br />
in Frage stellten. Die Erfahrung des totalitären<br />
Sozialismus der Sowjetunion auf der<br />
anderen Seite zeigte, dass das blinde Vertrauen<br />
darauf, dass sozialistische Parteien<br />
die objektiven Interessen der Arbeitenden<br />
erkennen könnten und immer vertreten<br />
würden, naiv war.<br />
Damit ging dem Marxismus sowohl die<br />
historische Legitimation als auch der Anspruch,<br />
objektive Interessen direkt aus der<br />
historischen Situation ableiten zu können,<br />
verloren.<br />
SozialistInnen und SozialdemokratInnen<br />
reagierten auf verschiedenste Weise<br />
auf diese Entwicklung: Einerseits durch<br />
eine Abwendung vom Marxismus und<br />
Hinwendung zu anderen politischen Strömungen,<br />
vor allem zu linksliberalen und<br />
keynesianischen Argumentationen.<br />
Andererseits, indem verschiedene postmarxistische<br />
Strömungen sich einer moralischen<br />
Begründung linker Politik zuwandten:<br />
Wenn sich normative Maßstäbe nicht<br />
einfach aus der historischen Situation ableiten<br />
ließen, war es an der Zeit, diese moralisch<br />
zu begründen. Habermas (1995 und<br />
1998) beispielsweise begann, die kritische<br />
Theorie normativ zu unterfüttern, indem<br />
er moralische Urteile vom gesellschaftlichen<br />
Diskurs abhängig machte. Moralisch<br />
richtig ist für ihn, was in einem zwanglosen<br />
Diskurs Zustimmung finden würde. Da<br />
dieser zwanglose Diskurs unter realen Bedingungen<br />
nie vollständig gegeben ist, ist<br />
es Aufgabe der demokratischen Institutionen,<br />
Einschränkungen und Verzerrungen<br />
des demokratischen Diskurses problematisierbar<br />
zu machen und damit den Einfluss<br />
von Macht und Geld zurückzudrängen.<br />
Für Laclau und Mouffe wiederum ist<br />
die Bildung gesellschaftlichen Konsenses<br />
17
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 18<br />
weniger wichtig als die Ermöglichung gesellschaftlichen<br />
Dissenses und der Herausbildung<br />
alternativer Identitäten – wenn es<br />
keine vereinende Identität eines Proletariats<br />
mehr gibt, die gesellschaftliche Veränderungen<br />
vorgeben könnte, muss es vielmehr<br />
jeder gesellschaftlichen Gruppe<br />
möglich sein, sich eigene Identitäten und<br />
davon abhängige Interessen herauszubilden<br />
und diese im demokratischen Konflikt<br />
mit anderen Interessengruppen zu vertreten.<br />
Analytische MarxistInnen wie Cohen<br />
(1995 und 2009) wiederum bemühen sich<br />
nun, analog zur liberalen Philosophie, zunächst<br />
komplett losgelöst von konkreten<br />
historischen Situationen für universalistische<br />
Gerechtigkeitsmaßstäbe der Chancen-<br />
und Leistungsgerechtigkeit und sozialer<br />
Fürsorge zu argumentieren, bevor<br />
deren Möglichkeit zur Umsetzung diskutiert<br />
wird.<br />
Was die genannten TheoretikerInnen,<br />
bei allen Differenzen, gemeinsam haben,<br />
ist die Betonung der Wichtigkeit, dass demokratische<br />
Institutionen Spielräume für<br />
alternative Politikentwürfe schaffen und<br />
den diskursiven Raum bereitstellen, diese<br />
Alternativen zu diskutieren. An die Stelle<br />
historischer Gegebenheiten tritt die Aufgabe<br />
der Politik, in die Gesellschaft gestaltend<br />
einzugreifen – und den Bürgern die<br />
Möglichkeit zu geben, an dieser Gestaltung<br />
teilzuhaben. Demokratie wird damit<br />
nicht mehr nur Mittel zur Durchsetzung<br />
sozialistischer Politik, sondern selbst Ziel<br />
linker Politik, da nur im demokratischen<br />
Diskurs legitime politische Ziele herausgebildet<br />
werden können.<br />
Die Spaltung des Liberalismus<br />
Was heute ebenfalls häufig vergessen<br />
wird, ist, dass der Liberalismus seinen Anfang<br />
in der Moralphilosophie hatte. Für<br />
DenkerInnen wie David Hume und Adam<br />
Smith war der freie Markt kein Selbstzweck,<br />
sondern verbunden mit dem Anspruch,<br />
dass sich auf ihm die moralische<br />
Autonomie der StaatsbürgerInnen verwirklichen<br />
ließe, dass die Unsichtbare<br />
Hand des Marktes zu tatsächlich moralisch<br />
überlegenen Ergebnissen führt. Amartya<br />
Sen (2007 und 2009) weist vor diesem<br />
Hintergrund darauf hin, dass Smith Eingriffen<br />
in den Markt nicht prinzipiell ablehnend<br />
gegenüber stand, sondern diesen,<br />
sofern er sie moralisch gerechtfertigt sah,<br />
zustimmte. Gleichzeitig unterschätzte er<br />
wohl die Ungleichheit, die der aufkommende<br />
Kapitalismus erzeugte.<br />
Habermas (1995) spricht in diesem<br />
Zusammenhang nicht umsonst von der<br />
„Vernunftutopie der Aufklärung“: Die<br />
Idee, dass sich eine Gesellschaft aus relativ<br />
gleichen und freien BürgerInnen durch einen<br />
weitestgehend unregulierten Markt<br />
verwirklichen ließe, stieß schon im 19.<br />
Jahrhundert auf die Realität von Massenarmut<br />
und Ungleichheit der frühkapitalistischen<br />
Gesellschaft. Die Vernunft des<br />
Marktes und die Vernunft der Moral traten<br />
deutlich auseinander.<br />
Dem Liberalismus blieben zwei Reaktionen:<br />
Einerseits die, teilweise widerspenstige,<br />
Anerkennung des im 20. Jahrhundert<br />
sich immer weiter ausbreitenden Sozialstaats,<br />
und der Versuch, diesen mit liberalen<br />
Prinzipien in Einklang zu bringen –<br />
John Rawls (1971) und Amartya Sens<br />
(2009) Beiträge zum Sozialliberalismus<br />
18 Wie die Linken die Moral entdeckten – und die Mitte sie aus dem Blick verlor Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 19<br />
beispielsweise versuchen, Gerechtigkeitsprinzipien<br />
aus der moralischen Autonomie<br />
des Einzelnen demokratisch zu begründen<br />
und einen Freiheitsbegriff zu etablieren,<br />
der von den Lebenschancen der Einzelnen<br />
ausgeht, statt sich mit der formalen Freiheit<br />
der Besitzenden zu begnügen. Übereinstimmend<br />
mit Habermas betont Sen<br />
dabei die Bedeutung des demokratischen<br />
Aushandelns solcher Wertmaßstäbe: Da in<br />
einer pluralistischen Gesellschaft verschiedenste<br />
normative Ansprüche aufeinandertreffen,<br />
muss für ihn das demokratische<br />
Aushandeln von Kompromissen solche<br />
Konflikte mindern.<br />
Andererseits fanden sich AutorInnen<br />
wie Friedrich August von Hayek (1993),<br />
die einfach einen immer geringeren moralischen<br />
Anspruch an den freien Markt forderten:<br />
Der Markt solle nun nicht mehr an<br />
den Ergebnissen gemessen werden, die er<br />
erzeugt, sondern anhand einer Verfahrensgerechtigkeit,<br />
die auf die Konsequenzen<br />
marktwirtschaftlicher Verfahren keine<br />
Rücksicht mehr nimmt – Einkommensungleichheit,<br />
Armut, sogar Monopole sind<br />
aus dieser Sicht hinzunehmende Übel, die<br />
man in Kauf nehmen muss. Die Gerechtigkeit<br />
einer Gesellschaft wird nicht mehr<br />
an externen Maßstäben gemessen, sondern<br />
nur noch daran, inwieweit sie mit marktwirtschaftlichen<br />
Prinzipien übereinstimmt.<br />
Die Orientierung an anderen Prinzipien,<br />
beispielsweise an sozialer Gerechtigkeit,<br />
wird dabei von Hayek als nicht nur<br />
nicht wünschenswert, sondern funktional<br />
unmöglich erklärt: Jeder Versuch, soziale<br />
Gerechtigkeit zu definieren und politisch<br />
durchzusetzen führe automatisch in den<br />
Totalitarismus. Ziel liberaler Politik solle<br />
daher sein, solche Sozialpolitik unmöglich<br />
zu machen – einerseits durch ein Verfassungsrecht,<br />
das die Gestaltungsmöglichkeiten<br />
des Staates beschränkt, andererseits<br />
durch Förderung eines Steuerwettbewerbs<br />
zwischen Staaten, der die steuerlichen<br />
Spielräume demokratischer Staaten weiter<br />
einschränken soll (Vgl. Hayek 1991).<br />
Francis Fukuyama (1992) führte diese<br />
Abkehr von der Moralphilosophie noch<br />
weiter, indem er die Behauptung aufstellte,<br />
Kapitalismus und liberale Demokratie<br />
stellten das Ende der Geschichte dar. Damit<br />
tauchte der Geschichtsdeterminismus,<br />
von dem sich die politische Linke mühsam<br />
losgesagt hatte, plötzlich als Geschichtsphilosophie<br />
des freien Marktes wieder auf.<br />
Nach dem Fall der Sowjetunion konnte<br />
diese Philosophie, wonach die immer weitere<br />
Ausbreitung und Entgrenzung der<br />
Marktwirtschaft historisch gegeben und<br />
jede Kritik daran unzeitgemäß und unrealistisch<br />
sei, lange Zeit beinahe Hegemonie<br />
für sich beanspruchen (Naomi Klein<br />
(2007) konnte diese Entwicklung sehr gut<br />
nachzeichnen). Auch die europäische Sozialdemokratie<br />
war an diesem Prozess nicht<br />
unbeteiligt. Der Vorwurf an die SPD, dass<br />
unter Schröder linke Politikgestaltung fast<br />
komplett hinter der Anpassung an (vermeintliche)<br />
weltwirtschaftliche Gegebenheiten<br />
zurücktrat, ist schwer zu entkräften<br />
(sehr differenziert dargelegt beispielsweise<br />
in Ulrich Beck (2005)).<br />
Möglichkeiten und Notwendigkeiten<br />
in der aktuellen Politik<br />
In den Jahren seit der Finanzkrise 2007<br />
lässt sich relativ deutlich beobachten, wie<br />
sehr die Definition dessen, was als möglich,<br />
und was als notwendig angesehen<br />
wird, selbst Teil des gesellschaftlichen Dis-<br />
19
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 20<br />
kurses ist. Politische Alternativen für unmöglich<br />
zu erklären ist heutzutage die<br />
Ausweichstrategie, um das moralisch Unbegründbare<br />
zum Notwendigen zu erklären.<br />
So galt eine strengere Regulierung des<br />
Bankensektors jahrelang als unmöglich, die<br />
Deregulierung als notwendig. Nach Ausbruch<br />
der Krise kehrte sich diese Stimmung<br />
für kurze Zeit komplett – die Re-<br />
Regulierung des Bankensektors wurde zur<br />
allgemein anerkannten Notwendigkeit, die<br />
Einführung einer Finanztransaktionssteuer<br />
wurde plötzlich – wenn auch halbherzig<br />
– sogar von der CDU vorangetrieben.<br />
Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke<br />
in Deutschland galt der CDU<br />
lange Zeit als Notwendigkeit, ein Atomausstieg<br />
wie geplant als unmöglich – was<br />
sich über Nacht komplett umkehrte. Die<br />
Tendenz, die eigene Politik als unausweichlich<br />
zu deklarieren, fand sich schon<br />
unter Schröder – aber unter Angela Merkel<br />
wurde daraus das einzig bestimmende<br />
Prinzip.<br />
Was als machbar gilt, kann sich über<br />
Nacht ändern, und wird sogleich notwendig<br />
– im Kanzleramt wird einfach jeden<br />
Tag aufs Neue entschieden, was morgen als<br />
realistisch gilt.<br />
Dabei sollte die SPD nicht unterschätzen,<br />
dass ein solcher Kurs für WählerInnen<br />
durchaus attraktiv sein kann – was auf der<br />
einen Seite als dreiste Wankelmütigkeit<br />
und undemokratischer Führungsstil wirken<br />
kann, kann auf der anderen Seite auch<br />
als Führungsstärke und politische Expertise<br />
angesehen werden. Zynischer Weise<br />
könnte es gerade die Undurchsichtigkeit<br />
von Merkels Führungsstil sein, die den<br />
Eindruck bestärkt, Politik sei so unüberschaubar,<br />
dass nur noch das Regierungskabinett<br />
den Überblick behalten kann.<br />
Dennoch sollte die SPD sich davor hüten,<br />
diesen Politikstil zu kopieren. Als „etwas<br />
bessere CDU“ könnte die Sozialdemokratie<br />
längerfristig kaum glaubhafte Politik<br />
machen.<br />
Stattdessen liegt es an der Sozialdemokratie,<br />
zu zeigen, dass Politik aus der öffentlichen<br />
Diskussion darüber bestehen<br />
kann, in was für einer Gesellschaft wir leben<br />
wollen. Die partizipative Erarbeitung<br />
des Wahlprogramms im Bürger-Dialog<br />
verspricht die Beteiligung der BürgerInnen.<br />
Es liegt an der SPD, in der politischen<br />
Praxis zu zeigen, dass sie dieses Versprechen<br />
auch einlösen kann – nicht nur durch<br />
mittelfristige politische Entscheidungen,<br />
sondern auch durch längerfristige Weichenstellungen,<br />
die die Gestaltungsspielräume<br />
der Politik wieder erweitern und<br />
diese gleichzeitig unter stärkere demokratische<br />
Kontrolle bringen. Wie Beck (2012)<br />
und Habermas (2011) zeigen, ist es gerade<br />
in der aktuellen Krise des Euroraums wichtig,<br />
einerseits die Möglichkeiten europäischer<br />
Institutionen zur demokratischen<br />
Gestaltung der Politik auszubauen, da eine<br />
Stabilisierung des Sozialstaats auf rein nationalstaatlicher<br />
Ebene längerfristig an der<br />
zwischenstaatlichen Konkurrenz scheitern<br />
würde. Andererseits ist eine solche Politik<br />
nur verantwortbar, wenn sie mit einer Stärkung<br />
der europäischen Legislative und einer<br />
stärkeren Beteiligung der BürgerInnen<br />
Europas einhergeht. Dem steht momentan<br />
eine weitverbreitete Europaverdrossenheit<br />
entgegen, die auf der Erfahrung gründet,<br />
dass europäische Institutionen bisher we-<br />
20<br />
Wie die Linken die Moral entdeckten – und die Mitte sie aus dem Blick verlor Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 21<br />
der ausreichend demokratisch legitimiert,<br />
noch in der Lage sind, sozialpolitische<br />
Weichenstellungen vorzunehmen, es sei<br />
denn zur Einschränkung sozialstaatlicher<br />
Leistungen. Wenn es der Sozialdemokratie<br />
gelingt, die realistische Hoffnung auf ein<br />
demokratischeres und sozialeres Europa zu<br />
wecken, würde sie damit nicht nur die Tradition<br />
demokratischer linker Politik bestärken,<br />
sondern könnte zur Erneuerung der<br />
europäischen Demokratie beitragen. l<br />
Literatur<br />
Beck, U. (2005). Was zur Wahl steht. Frankfurt am<br />
Main: Suhrkamp.<br />
Hayek, Friedrich August von (1993). Law, legislation<br />
and liberty: a new statement of the liberal principles<br />
of justice and political economy. London: Routledge.<br />
Klein, N. (2007). Die Schock-Strategie. Der Aufstieg<br />
des Katastrophen-Kapitalismus. Frankfurt am<br />
Main: S. Fischer Verlag GmbH.<br />
Laclau, E., Mouffe, C. (2006). Hegemonie und radikale<br />
Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus.<br />
Wien: Passagen Verlag, 3. Auflage.<br />
Sen, A. (2007). Ökonomie für den Menschen. Wege<br />
zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft.<br />
München: Deutscher Taschenbuch Verlag<br />
GmbH & Co. KG, 4. Auflage.<br />
Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard: Harvard<br />
University Press.<br />
Beck, U. (2012). Das deutsche Europa: Neue Machtlandschaften<br />
im Zeichen der Krise. Berlin: Suhrkamp<br />
Verlag.<br />
Cohen, G. A. (1995). Self-Ownership, Freedom and<br />
Equality. Cambridge: Press Syndicate of the University<br />
of Cambridge.<br />
Cohen, G. A. (2009). Why not Socialism? Princeton:<br />
Princeton University Press.<br />
Fukuyama, F. (1992). Das Ende der Geschichte: Wo<br />
stehen wir? München: Kindler.<br />
Habermas, J. (1995). Theorie des kommunikativen<br />
Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche<br />
Rationalisierung. Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp.<br />
Habermas, J. (1995). Theorie des kommunikativen<br />
Handelns. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen<br />
Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
Habermas, J. (1998). Faktizität und Geltung. Beiträge<br />
zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen<br />
Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp.<br />
Habermas, J. (2011). Zur Verfassung Europas. Ein<br />
Essay. Berlin: Suhrkamp Verlag.<br />
Hayek, Friedrich August von (1991). Die Verfassung<br />
der Freiheit. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck),<br />
3. Auflage.<br />
21
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 22<br />
IST HANS VERRÜCKT?<br />
Über das Zusammenspiel von Freiheit, Gleichheit und Demokratie<br />
von Katharina Schenk, promoviert an der Universität Leipzig im Fachbereich Philosophie<br />
zum Themenkomplex Gemeinwohl und Glück<br />
Es war einmal ein junger Mann, der<br />
bekam, als er seinen Meister verließ,<br />
einen Klumpen Gold zum Lohn, der so<br />
groß war, wie sein eigener Kopf. Hans,<br />
so hieß der junge Mann, hatte an dem<br />
Klumpen ganz schön zu schleppen.<br />
Auf seiner Reise nach Hause, die nicht<br />
eben kurz war, tauschte er deswegen<br />
den lästigen Klumpen zuerst gegen<br />
ein geschwind trabendes Pferd, alsbald<br />
dann gegen eine flattrige Gans<br />
und immer so weiter, bis er schließlich<br />
mit leeren Händen, aber sehr glücklich<br />
bei seiner Mutter in der Heimat anlangte.<br />
Aus diesem Grimmschen Märchen<br />
können wir, neben der glänzenden Unterhaltung<br />
durch die unerwarteten<br />
Wendungen Hänschens, zweierlei ziehen:<br />
Zum einen die Wahrheit, dass<br />
materieller Besitz in keinem Fall ein<br />
Garant für Glück ist, zum anderen –<br />
und das macht die Sache besonders<br />
spannend – zeigt uns Hans im Tauschen,<br />
dass wir die Möglichkeit haben,<br />
selbst den Weg zu unserem Glück zu<br />
wählen, ja sogar selbst zu bestimmen,<br />
wo der Weg hinführen sollen. Hans<br />
tauscht den lästigen Brocken einfach<br />
ein und gewinnt auf diese Weise<br />
selbst handelnd seine Freiheit zurück.<br />
Eine inspirierende Vorstellung!<br />
Dass materieller Besitz keine Garantie<br />
für Glück im Sinne eines andauernden Gefühls<br />
von Lebenserfolg ist, ist eine alte,<br />
man kann fast schon sagen, traditionelle<br />
Aussage. Schon Diogenes von Sinope, der<br />
berühmte Kyniker, der in einer Tonne lebte,<br />
verzichtete weitgehend auf Besitz. Und<br />
auch andere Philosophen, wie etwa Platon,<br />
der in seiner Staatsutopie den Wächterstand<br />
vom Besitz befreite, erkannten frühzeitig<br />
die Gefahren des Besitzens. Besitz<br />
als Last, denn wer viel hat, kann nicht nur<br />
viel verlieren, sondern muss sich auch um<br />
viel kümmern.<br />
Auch jenseits der philosophischen<br />
Schulen war diese Ansicht verbreitet, man<br />
denke nur an das Gebot der Besitzlosigkeit<br />
für die meisten Mönche.<br />
Kurz und gut: Es kann einen sogar einigermaßen<br />
verwundern, dass das viel zitierte<br />
Buch „The spirit level. Why Equality is<br />
Better for Everyone“ von Richard Wilkinson<br />
und Kate Pickett in den Industriestaaten<br />
für kaum übersehbare Aufregung sorgte.<br />
Aber mal ehrlich: Würden Sie, wenn<br />
Sie jetzt noch einmal Hans auf seiner Reise<br />
zu seiner Mutter begleiten würden, nicht<br />
auch an irgendeinem Punkt sagen: „Halt,<br />
22 Ist Hans verrückt? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 23<br />
stopp – hör doch endlich mal auf zu tauschen<br />
Du Depp, sonst stehst Du am Ende<br />
mit leeren Händen da!“ Nein? Dann sind<br />
Sie vermutlich Teil einer aussterbenden<br />
Spezies, denn fast alle Menschen, die ich<br />
bisher kennen lernen durfte, wünschen<br />
sich, auch wenn sie es nicht so explizit sagen,<br />
vor allem eins: Sicherheit. Und diese<br />
ist – das ist ein Fakt – wesentlich von materieller<br />
Sicherheit, also Geld, bestimmt.<br />
Jede und jeden treibt das bange Gefühl<br />
um, abgehängt zu werden oder zumindest<br />
abgehängt werden zu können. Jede und jeder<br />
kennt den bangen Blick auf den Lebenslauf<br />
der eigenen Freunde und Freundinnen<br />
und die heimlichen Gedanken<br />
darüber, ob man nicht doch noch ein Praktikum<br />
mehr hätte in Angriff nehmen sollen.<br />
All diese Ängste sind auf eine gewisse<br />
Art luxuriös, das macht sie jedoch keineswegs<br />
zu weniger relevanten Ängsten.<br />
Fest steht, dass unsere Gesellschaft zu<br />
einem immer größer werdenden Teil aus<br />
Menschen besteht, die nicht nur heimlich<br />
Hans ein „Halt, stopp!“ zuflüstern würden,<br />
sondern die ganz entschieden in seinen<br />
Weg sprängen. Menschen, die so verzweifelt<br />
um das bisschen Geld kämpfen, das sie<br />
zum täglichen Leben brauchen, dass ihnen<br />
ein junger Mann, der seinen Goldklumpen<br />
gegen die Freiheit tauscht, um unbeschwerter<br />
laufen zu können, wie ein Affront<br />
vorkommen muss.<br />
Warum ist das so?<br />
Das Märchen „Hans im Glück“, so<br />
habe ich Eingangs geschrieben, lehrt uns<br />
zwei grundsätzliche Dinge: Die Volksweisheit,<br />
dass Geld allein nicht glücklich macht<br />
– und eine Tatsache, die heute oft mit der<br />
Redewendung ,Jeder ist seines eigenen<br />
Glückes Schmied‘ zum Ausdruck gebracht<br />
wird. Die Freiheit, sein Leben selbst in die<br />
Hand nehmen zu können, selber Autor<br />
oder Autorin seines Lebens zu sein, ist die<br />
– betrachtet man ihre lange Geschichte –<br />
treibende Kraft der Sozialdemokratie und<br />
ihrer Gedankenvorläufer. Weg mit den<br />
vorbestimmenden Merkmalen Herkunft<br />
und Geschlecht, weg mit den klassengebundenen<br />
Lebensungerechtigkeiten. Ich<br />
bestimme wie ich lebe!<br />
Für sein Leben selbst verantwortlich zu<br />
sein, bedeutete zunächst und lange Zeit ein<br />
neues Maß an Freiheit – und Gleichheit.<br />
Endlich waren bestimmte Dinge nicht<br />
mehr nur einer ganz bestimmten Schicht<br />
oder Gruppe vorbehalten. Die Arbeiter<br />
gründeten eine Vielzahl von Vereinen, in<br />
denen sie all das taten, was zuvor für die<br />
Oberschicht reserviert war. Frauen errangen<br />
den Zugang zu Universitäten und das<br />
Wahlrecht. Ein emanzipiertes, ein kämpferisches<br />
Ich schien lange der Motor der sozialdemokratischen<br />
Bewegung zu sein –<br />
und ein Garant für jedermanns Glück.<br />
Andere Staaten wurden vom individuellen<br />
Streben nach Glück weit eher erfasst.<br />
Ein verheißungsvolles Symbol in der Ferne<br />
waren die Vereinigten Staaten von Amerika,<br />
die als erstes Land der Welt in ihren<br />
Gründungsdokumenten ein Recht auf<br />
Glück festschrieben. Der Beginn eines<br />
Nimbus, der bis heute den Reiz des sogenannten<br />
Landes der unbegrenzten Möglichkeiten<br />
ausmacht, auch wenn die soziale<br />
Mobilität in kaum einem anderen Land<br />
nachweislich so niedrig ist, wie in den Vereinigten<br />
Staaten.<br />
23
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 24<br />
Es scheint zunächst so, als sei mit der<br />
Entfesselung des Ichs auch ein neues Wir<br />
entstanden. Kollektiv kämpfen zunächst<br />
Meister, dann Handwerker und schließlich<br />
Industriearbeiter für ihre Rechte. Die Freiheit<br />
nimmt zu, die Unterschiede zu den<br />
oberen Schichten werden durch den Kapitalismus<br />
immer weiter abgeschmolzen.<br />
Man kann sagen: Der Ausbruch aus der<br />
malthusianischen Falle begann mit dem<br />
Kapitalismus. Thomas Malthus hat die<br />
Kraft des technischen Fortschritts und des<br />
investitionsgetriebenen Wachstums nicht<br />
erkannt. Von 1900 bis etwa 1975 kann man<br />
den fulminanten Aufstieg einer ganzen<br />
Klasse beobachten.<br />
Dieser Artikel könnte nun also mit der<br />
Feststellung enden, dass die Emanzipation<br />
des Ichs zu immer größerer Gleichheit<br />
führt, und dass das Ende der Geschichte<br />
eine Welt der Gleichen ist. Die Welt zeigt<br />
uns jedoch ein ganz anderes Gesicht. Zunehmende<br />
Ungleichheit, die ihr kaum fassbares<br />
Ausmaß in Zahlen wie dem Gini-<br />
Koeffizienten manifestiert.<br />
Im Godesberger Programm war es, als<br />
die historische Trias „Freiheit, Gleichheit,<br />
Brüderlichkeit“ eine entscheidende Wandlung<br />
erfuhr. Die Gleichheit wurde gegen<br />
die Gerechtigkeit eingetauscht. Zwar verschwand<br />
die Gleichheit nicht vollständig<br />
aus dem sozialdemokratischen Gedächtnis,<br />
sie wurde von nun an aber am liebsten als<br />
Teil einer endlosen Schlange von Komposita<br />
gebraucht. Chancengleichheit ist das<br />
wohl bekannteste Beispiel. Und auch den<br />
marxschen Geschichtsdeterminismus haben<br />
die SozialdemokratInnen – hier kann<br />
man sagen zum Glück – mittels des Godesberger<br />
Programms in der Mottenkiste<br />
verstaut.<br />
Was ist mit der Gleichheit geschehen?<br />
Die Gleichheit fiel der immer größeren<br />
Individualisierung zum Opfer. Man kann<br />
auch sagen: Das immer stärker werdende<br />
Ich hat sein eigenes Kind, die zunehmende<br />
Gleichheit, aufgefressen.<br />
Während man 1900 noch fast zwei<br />
Jahrzehnte vom Frauenwahlrecht entfernt<br />
war, genossen in den 1960er Jahren immer<br />
mehr Menschen den wachsenden Wohlstand.<br />
Die Produkte wurden immer individueller,<br />
es herrschte Überfluss – und demokratische<br />
Teilhabe. Dies ist nun vielleicht<br />
eine überraschende Korrelation, es lässt<br />
sich jedoch zweifelsfrei zeigen, dass die historisch<br />
größte Wahlbeteiligung der Bundesdeutschen<br />
am 19. November 1972 verzeichnet<br />
wurde. Sie war von der auch<br />
schon beachtlichen Marke von 78,5 Prozent<br />
zur ersten <strong>Bundestagswahl</strong> 1949 auf<br />
91,9 Prozent geklettert. Ein Zufall?<br />
Nein! Der breite Wohlstand der 1960er<br />
Jahre machte diese umfassende Teilhabe<br />
erst möglich. Seit 1972 können wir einen<br />
kontinuierlichen Rückgang der Wahlbeteiligung<br />
beobachten. Den aktuellen Tiefstand<br />
erreichte die Bundesrepublik 2009<br />
mit 72,5 Prozent. Ist das bloße Politikverdrossenheit?<br />
Ist es einfach immer mehr<br />
Menschen egal, was in unserem Land passiert?<br />
Ist es Faulheit, oder ist es das viel zitierte<br />
Misstrauen gegenüber den PolitikerInnen,<br />
wie es in den Medien allzu oft<br />
kolportiert wird?<br />
Nein! Es ist die einfache Tatsache, dass<br />
die Freiheit, sein Leben zu gestalten, zunehmend<br />
von den eigenen finanziellen<br />
Kräften abhängt.<br />
24 Ist Hans verrückt? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 25<br />
Gestalten, AutorIn des eigenen Lebens<br />
sein, das bedeutet wählen zu können – im<br />
privaten und im öffentlichen Raum. Dazu<br />
braucht es, das lässt sich an allerhand Beispielen<br />
zeigen, finanziellen Spielraum.<br />
Gute Gesundheitsversorgung, gute Bildung,<br />
gute Kinderbetreuung, sicheren und<br />
erschwinglichen Wohnraum, flächendekkender<br />
ÖPNV, bezahlbarer Strom. Die Liste<br />
der Bereiche, aus denen der Staat sich<br />
im Glauben an die Kompetenz des Marktes<br />
und die individuellen Kräfte immer<br />
weiter zurückgezogen hat, könnte noch<br />
fortgesetzt werden.<br />
Jede und jeder ist seines eigenen Glükkes<br />
Schmied. Was Hänschen noch als Freiheitsversprechen<br />
verstand, wird für die Generation,<br />
die nach 1972 das Wahlrecht<br />
erlangt, zur Drohung. Du trägst die Verantwortung<br />
für dein Leben, deine Erfolge<br />
und dein Versagen. Du musst dich um deinen<br />
Lebenslauf, deine Wohnung, deine<br />
Gesundheit, die Versorgung deiner Kinder,<br />
deine Weiterbildung, deinen Kontostand<br />
und deine Stromrechnung sorgen. Und so<br />
kämpft meine Generation bisher wohl am<br />
deutlichsten in einem Strudel aus Praktika,<br />
Teilnahmebescheinigungen und Sprachzertifikaten<br />
um den individuellsten und<br />
detailreichsten Lebenslauf.<br />
Das Ich, das im Kollektiv der Interessen<br />
der Arbeiter erstarkte, wurde sich selbst<br />
zum Feind. Gleichheit wurde als abgegriffen,<br />
verstaubt, vielleicht sogar als bedrohlich<br />
empfunden. Wir wollen frei sein.<br />
Selbst handeln, selbst bestimmen, selbst an<br />
unserem Leben schmieden. Am Ende der<br />
Selbstverwirklichungstheorie steht jedoch<br />
oft eine traurige Bilanz. Wir wollen unverwechselbare<br />
Individuen sein – trotzdem<br />
bedauern wir die Konsequenzen der Ellenbogengesellschaft.<br />
Die existenzielle Angst,<br />
die immer mehr Menschen spüren,<br />
schränkt uns in unserer Freiheit ein. Die<br />
alte Trias der Sozialdemokratie, deren sich<br />
bedingendes Gefüge lange verkannt wurde,<br />
geriet mit Godesberg immer mehr ins<br />
Wanken. Es ist Zeit zurück zu rudern. Wir<br />
müssen die Gleichheit zurück ins Boot,<br />
mindestens aber zurück in die praktische<br />
sozialdemokratische Politik holen! Erst ein<br />
starkes Wir ermöglicht ein starkes Ich.<br />
Gleichheit als Gleichheit von Zugängen<br />
verstanden ist ein wesentlicher Teil der Sozialdemokratie.<br />
Gleichheit als eine Gleichheit<br />
von Fähigkeiten etwas tun oder wählen<br />
zu können ist nicht nur eine reizvolle<br />
Quelle größtmöglicher Individualität, sondern<br />
auch die Basis für eine stabile Demokratie.<br />
Gleichheit – das klingt für viele nach<br />
Gleichschaltung, Gleichmacherei und<br />
nach dem Ende der Individualität. Für uns<br />
SozialdemokratInnen und demokratische<br />
SozialistInnen sollte Gleichheit jedoch der<br />
Schlüssel zu dem sein, was wir unseren<br />
Markenkern nennen: Gerechtigkeit. Die<br />
Gerechtigkeit, und auch das wussten die<br />
antiken Denker schon, ist die allumfassende,<br />
die oberste Tugend. Alle anderen<br />
Grundwerte sind Teilaspekte, wenn auch<br />
sehr wichtige. Es kann ohne Sozialstaat,<br />
ohne die Umverteilung und die Ermöglichung<br />
gleicher Zugänge keine Demokratie<br />
geben, zumindest keine substantielle.<br />
Gleichheit ist kein illusorisches Projekt.<br />
Gleichheit ist die normative Basis der Demokratie.<br />
Deswegen muss Gleichheit<br />
durch den Staat geschaffen werden. Das<br />
Wir entscheidet. So lautet der Wahlkampfslogan<br />
der SPD. Man kann also hoffen,<br />
dass das, was Hänschen gelernt hat,<br />
Hans auch noch lernen kann. l<br />
25
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 26<br />
MEHR GLEICHHEIT<br />
WAGEN<br />
von Moritz Rudolph, stellv. Vorsitzender <strong>Jusos</strong> Nordost<br />
Prächtig gedieh die Ungleichheit im<br />
neoliberalen Treibhaus der vergangenen<br />
Dekaden; doch war es wohl eher<br />
Unkraut, das da wuchs. Eine Gegenbewegung<br />
ist längst überfällig – sozial,<br />
politisch und ökonomisch.<br />
Umverteilt wird immer; nur von wem<br />
zu wem, das ist zu allen Zeiten offen.<br />
In den vergangenen Jahren – den<br />
neoliberalen – kannte der Mittelfluss<br />
in den OECD-Staaten vor allem eine<br />
Richtung: Von unten nach oben.<br />
Derzeit wird jedoch wieder ernsthaft<br />
über die gegenläufige Bewegung diskutiert:<br />
François Hollande boxte in<br />
Frankreich einen Spitzensteuersatz<br />
von 75 % durch, die SPD will ebenfalls<br />
Vermögende stärker besteuern, Obama<br />
prescht auch immer mal wieder<br />
mit Derartigem vor; Bündnisse wie<br />
„umfairteilen“ oder „Appell für eine<br />
Vermögensabgabe“ entfalten zivilgesellschaftlichen<br />
Druck in Richtung Umverteilung<br />
von oben nach unten; das<br />
neoliberale Gefüge der Vorkrisenzeit<br />
scheint – zumindest diskursiv – ins<br />
Wanken zu geraten.<br />
Das ist gut so; und dringend notwendig.<br />
Gleichheit ist Glück<br />
Reichtum ist eine feine Sache. Umfassend<br />
entfaltete Produktivkräfte ermöglichen<br />
eine Bedürfnisbefriedigung auf hohem<br />
Niveau; das schafft Wohlstand und<br />
die Möglichkeit zur freien Entfaltung des<br />
Individuums; Reichtum birgt daher ein gewaltiges<br />
emanzipatorisches Potenzial.<br />
Doch liegt der Schlüssel zur Entfaltung<br />
dieses Potenzials in der Verteilungsfrage.<br />
Konzentriert er sich in den Händen weniger,<br />
verliert Reichtum sein emanzipatorisches<br />
Gesicht; er wird zum Siechtum.<br />
In ihrer vielbeachteten Studie „The<br />
Spirit Level“ (deutsche Ausgabe: „Gleichheit<br />
ist Glück“) wiesen Wilkinson/Pickett<br />
– gestützt auf umfassendes empirisches<br />
Material – nach, dass gleiche Gesellschaften<br />
bei Lebensqualitätsindikatoren durchweg<br />
besser abschneiden als ungleiche: Kriminalitäts-<br />
und Selbstmordrate, Lebenserwartung,<br />
psychische Krankheiten, Vertrauen,<br />
Säuglingssterblichkeit, soziale Mobilität,<br />
Bildung etc.: Der Schlüssel zum guten<br />
Leben liegt im Verhältnis zwischen den<br />
oberen und den unteren 20 % einer Gesellschaft.<br />
Ab einer gewissen Schwelle beeinflusst<br />
vor allem die relative Vermögensver-<br />
26 Mehr Gleichheit wagen Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 27<br />
teilung – weniger der absolute Wohlstand –<br />
die Lebensqualität. Die Pointe: Nicht nur<br />
die Armen, auch Reiche profitieren von<br />
egalitären Gesellschaften. Anders als in Johannesburg<br />
oder Sao Paulo sollten sie sich<br />
in Helsinki und Stockholm kaum zur Errichtung<br />
scharfer (materieller und symbolischer)<br />
Schutz- und Trutzburgen zur Verteidigung<br />
gegen den Ansturm der Armen<br />
veranlasst sehen. Sozialer Druck und Statusgerangel<br />
verlieren an Notwendigkeit, je<br />
weiter sich die soziale Schere schließt; es<br />
lebt sich stressfreier. Das egalitäre Finnland<br />
etwa, dessen Pro-Kopf-Einkommen unter<br />
dem US-amerikanischen Durchschnitt<br />
liegt, schneidet deutlich besser ab als die<br />
Vereinigten Staaten – nicht nur verglichen<br />
mit den ärmsten AmerikanerInnen; auch<br />
Reiche leiden an der Ungleichheit.<br />
Doch steigert Gleichheit nicht nur Lebensqualität<br />
und gesellschaftliche Stabilität,<br />
sie ist überdies ein Gebot ökonomischer<br />
Vernunft.<br />
„Die Rückkehr der Bourbonen“<br />
(Steindl)<br />
Reifen kapitalistischen Ökonomien<br />
wohnt stets eine stagnative Tendenz inne.<br />
Oligopolisierung und ein säkularer Trend<br />
zu fallenden Investitionsraten verlangsamen<br />
den Akkumulationsprozess mit zunehmender<br />
Entwicklung der Produktivkräfte.<br />
Der Nachkriegsboom war daher für<br />
den postkeynesianischen Ökonomen Josef<br />
Steindl „eine große Überraschung“, die im<br />
Kern durch eine nachfrageorientierte, keynesianische<br />
Wirtschaftspolitik ermöglicht<br />
wurde.<br />
Jedoch bereitete die neoliberale Konterrevolution<br />
(= die „Rückkehr der Bourbonen“,<br />
die man in keynesianisch-revolutionärer<br />
Manier bereits endgültig vom<br />
Thron gestoßen zu haben glaubte) der erstaunlichen<br />
Prosperitätsphase vor etwa<br />
dreieinhalb Jahrzehnten ein jähes Ende.<br />
Die Wirtschaftspolitik arbeitete von nun<br />
an angebotsorientiert, bemühte sich autistisch<br />
um Preisstabilität, deregulierte, liberalisierte,<br />
privatisierte und schwächte die<br />
Verhandlungsmacht von Arbeit. Im Verbund<br />
mit einer erhöhten Sparneigung der<br />
privaten Haushalte infolge (relativ) abnehmender<br />
Konsumbedürfnisse reifer kapitalistischer<br />
Ökonomien führte dies geradewegs<br />
in eine „neue Stagnationspolitik“. Der<br />
Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen<br />
sank; Nicht-Lohneinkommen<br />
(Vermögenseinkommen) stiegen rasant an.<br />
Die Steuerlast verschob sich von den Gewinnen<br />
zu den Löhnen und dämpfte die<br />
expansive Wirkung der öffentlichen Investitionen.<br />
Insbesondere in Europa verlangsamte<br />
sich das Wachstum deutlich.<br />
Steindl forderte daher, die „Bourbonen<br />
wieder von ihrem Thron zu vertreiben“ und<br />
an die Errungenschaften der keynesianischen<br />
Revolution anzuknüpfen. Im Kern<br />
geht es dabei um Umverteilung von oben<br />
nach unten und von den Vermögens- zu<br />
den Lohneinkommen. Untere Einkommensgruppen<br />
weisen eine signifikant höhere<br />
Konsumneigung auf, während höhere<br />
Einkommenssegmente eher zum Sparen<br />
tendieren. Letzteres gilt ebenso für Vermögenseinkommen<br />
im Vergleich zu Lohneinkommen.<br />
Eine Verschiebung der (funktionalen<br />
und persönlichen) Einkommensverteilung<br />
zugunsten der Reichen und Vermögensbesitzer<br />
destabilisiert die Konsumnachfrage.<br />
„Entsparen“ muss daher auf der<br />
wirtschaftspolitischen Tagesordnung stehen,<br />
um den stagnativen Tendenzen entge-<br />
27
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 28<br />
genzuwirken; oder um sie zumindest hinauszuzögern.<br />
Mit Steindl können wir festhalten:<br />
Je fortgeschrittener eine kapitalistische<br />
Ökonomie, umso mehr ist sie auf Gleichheit<br />
angewiesen, um Wachstum zu generieren.<br />
Kein Fußbreit dem Feudalismus<br />
Kapitalismus ist, wenn die KapitalistInnen<br />
nachts nicht ruhig schlafen können,<br />
weil sie Sorgen haben, dass ihnen die<br />
ArbeitInnen aufs Dach steigen und (idealiter<br />
produktivitätsorintierte) Lohnsteigerungen<br />
durchboxen, die die kurzfristigen<br />
Profite schmälern, aber die Massennachfrage<br />
ausweiten, Absatzerwartungen stabilisieren<br />
und Investitionen stimulieren. Der<br />
Kapitalist ist eine eigenartige Figur, die eigentlich<br />
gar nicht sein will, was sie ist. Anstatt<br />
auf dezentralen Wettbewerbsmärkten<br />
agieren zu müssen, möchte sie viel lieber<br />
ein unbeschwertes Rentiersdasein führen;<br />
erst die Arbeiterbewegung macht sie zum<br />
realinvestiven Kapitalisten. Kapitalismus<br />
als „dezentrales System“ hängt daher „von<br />
der Gegenmacht der Vielen gegen die Bereicherung<br />
der Wenigen ab“ (Elsenhans).<br />
Wer hingegen die Verhandlungsmacht<br />
von Arbeit schwächt, ebnet Strukturen den<br />
Weg, die nicht kapitalistisch sind. Neoliberale<br />
sind daher beinharte AntikapitalistInnen.<br />
Doch hat dies nichts mit einer progressiven<br />
Aufhebung des Kapitalismus zu<br />
tun – über die sich durchaus diskutieren<br />
ließe –; vielmehr bläht sie neofeudale<br />
Strukturen auf. Gesellschaftliche Stratifizierung,<br />
Klientelismus, die Verschmelzung<br />
und Konzentration von politischer und<br />
ökonomischer Macht, Postdemokratie,<br />
Stagnation und Siechtum wären die Konsequenz.<br />
Lesen wir nun Steindl durch die Elsenhanssche<br />
Brille, so können wir festhalten,<br />
dass Gleichheit uns vor stagnativ-neofeudalen<br />
Tendenzen bewahrt, die drauf und<br />
dran sind, uns in die schlechte alte Zeit zu<br />
katapultieren und demokratietheoretisch<br />
äußerst bedenkliche Konsequenzen hervorzubringen<br />
drohen. Wählen wir also besser<br />
den Weg der egalitären Moderne anstatt<br />
uns vom Neoliberalismus in die<br />
Vormoderne treiben zu lassen.<br />
Die Krise als Verteilungskrise<br />
Doch werden wir ein wenig konkreter:<br />
Ungleichheit bereitet nicht nur langfristig<br />
stagnativen Tendenzen den Boden, auch<br />
kurze, eruptive Entladungen angestauter<br />
Widersprüche haben hier ihre Ursache.<br />
Die gegenwärtige Krise ist eine Krise der<br />
Reichtumsverteilung.<br />
Wie schon in den 1920er Jahren erfuhr<br />
die (persönliche und funktionale) Einkommensverteilung<br />
im Vorfeld der Krise eine<br />
ungeheure Spreizung. Stöbern wir ein wenig<br />
nach dem Zusammenhang zwischen<br />
Ungleichheit und Krise:<br />
Ungleichheit bläht Finanzmärkte auf.<br />
Das Kapital, „geil wie ein Bock“ (Marx),<br />
jagt auf der Suche nach rentablen Anlagemöglichkeiten<br />
über den Erdball und forciert<br />
Instabilität auf den Finanzmärkten.<br />
Doch was mästet den geilen Bock? Polarisierte<br />
Einkommen, die sich zu konzentrierten<br />
Vermögen anhäufen, sind sein<br />
Treibstoff. „Finanzmaktinnovationen“ sind<br />
eher Ausdruck, weniger Ursache der Möglichkeit<br />
spekulativer Exzesse. Die aufge-<br />
28 Mehr Gleichheit wagen Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 29<br />
blähten Finanzmärkte wiederum verschieben<br />
die Kräfteverhältnisse zugunsten der<br />
Vermögenden und das Spiel beginnt von<br />
vorn; ein Teufelskreis.<br />
Noch einmal: Das alles hat wenig mit<br />
Kapitalismus zu tun. Vermachtete Finanzmärkte<br />
sind eher ein Fingerzeit in Richtung<br />
Refeudalisierung der Gesellschaft.<br />
Die Regulierung von Finanzmärkten<br />
ist notwendig; doch um diese erstens<br />
machtpolitisch möglich und um zweitens<br />
spekulative Exzesse unmöglich zu machen,<br />
sollten wir ein wenig tiefer bohren und der<br />
Ungleichheit bereits im den Finanzmärkten<br />
vorgelagerten Raum des Verteilungskampfes<br />
die Stirn bieten.<br />
Denn nicht erst auf Finanzmärkten<br />
richtet Ungleichheit allerhand Schaden an.<br />
Der Unsinn entfaltet seine destruktive<br />
Kraft bereits in der damit verschlungenen<br />
Sphäre der Warenproduktion, -zirkulation<br />
und -konsumtion. Der entstandene Nachfragemangel<br />
infolge ungleicher Einkommens-<br />
und Vermögensverteilung wurde<br />
bereits weiter oben diskutiert. Nun mussten<br />
die entwickelten Volkswirtschaften<br />
darauf eine Antwort finden. Zwei Hauptstrategien<br />
kristallisierten sich in der Vergangenheit<br />
heraus: ein kreditgetriebenes<br />
Wachstumsmodell im angelsächsischen<br />
Raum und Südeuropa sowie ein exportgestütztes<br />
in Deutschland, China und Japan.<br />
Der Ausweg durch das Nadelöhr Kredit<br />
bzw. Export schuf gigantische globale Außenhandelsungleichgewichte,<br />
ermöglicht<br />
durch die Liberalisierung internationaler<br />
Kapitalflüsse in der Post-Bretton-Woods-<br />
Ära. Nicht Im- und Exporte bestimmten<br />
fortan die Wechselkurse; es durfte munter<br />
spekuliert werden; riesige Kapitalbrocken<br />
rauschten über den Erdball. Das kann eine<br />
Zeit lang gut gehen; doch irgendwann,<br />
wenn die „capital flow bonanzas“ (Reinhart/Reinhart)<br />
allzu fette Blasen genährt<br />
haben und die schmerzhafte Korrektur der<br />
Ungleichgewichte ansteht, wird es bitter.<br />
Die (partielle) eruptive Entladung der<br />
Ungleichgewichte äußert sich in der globalen<br />
Krise. Stärker noch erleben wir derzeit<br />
einen beinharten und ökonomisch wie gesellschaftlich<br />
verheerenden Korrekturmechanismus<br />
in der Eurozone als Teil der<br />
weltweiten Ungleichgewichte.<br />
Die Explosion der privaten Haushaltsverschuldung<br />
in den USA steht im Zusammenhang<br />
mit der dümpelnden Einkommensentwicklung,<br />
die die (Konsum-)Nachfrage<br />
tendenziell zu destabilisieren droht.<br />
Als das Lohnwachstum der unteren Einkommensschichten<br />
ausblieb, wurde es kurzerhand<br />
durch wachsende Privatverschuldung<br />
der Armen ersetzt. Über kurz oder<br />
lang musste dieser „Privatkeynesianismus“<br />
(Crouch) vor die Wand donnern. Der US-<br />
Immobiliencrash, der ab 2006 ins Rollen<br />
kam, ist dessen allzu konkreter Ausdruck.<br />
Was lernen wir daraus? Ungleichheit<br />
wirkt krisentreibend und langfristig stagnativ;<br />
alle Wege der Vernunft führen uns<br />
daher zur Überwindung des ungleichen<br />
Zustands; es schlägt die Stunde der Umverteilung.<br />
Was tun?<br />
Doch werden wir noch etwas konkreter<br />
und ziehen wir einige Schlüsse aus der<br />
Analyse. Der klassische Besteckkasten redistributiver<br />
Politik hält hier allerhand<br />
29
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 30<br />
Nützliches bereit; wir brauchen nur zuzugreifen:<br />
Einführung eines saftigen Spitzensteuersatzes.<br />
Warum nicht einmal 75 % wagen,<br />
wie sie in Frankreich wohl kommen<br />
werden. Dafür sollte er jedoch erst<br />
in reichlich hohen Einkommenssegmenten<br />
greifen, um nur wenige zu<br />
Spit zensteuersatzzahlern zu machen<br />
(1,5 – 3% der Bevölkerung). Dies erleichtert<br />
Hegemonie und die Bildung<br />
strategischer Allianzen mit großen Teilen<br />
der Mittelklassen, die niemals in die<br />
Reichweite derartiger Steuersätze<br />
kommen und sich darüber auch keine<br />
Illusionen machen müssen.<br />
Erhebung einer einmaligen, europaweit<br />
koordinierten Vermögensabgabe. Rasche<br />
Durchsetzung ist hier geboten; die<br />
Krise stößt ein window of opportunity<br />
auf, um die Abgabe kommunikationsstrategisch<br />
an eine notwendige Kostenbegleichung<br />
infolge der Krise zu binden.<br />
Eine supranationale Erhebung<br />
und Verwendung auf europäischer<br />
Ebene wäre wünschenswert, könnte sie<br />
doch zur so dringend benötigten politischen<br />
und Fiskalunion beitragen; und<br />
überdies die Stellung des Europäischen<br />
Parlaments stärken. Allerdings legt das<br />
geltende EU-Primärrecht einer zentralisierten<br />
Steuererhebung einige Steine<br />
in den Weg. Eine Implementierung<br />
wird daher wohl (vorerst) auf nationalstaatlicher<br />
Ebene erfolgen müssen.<br />
Erhöhung der Kapitalertragssteuer.<br />
Einführung einer Finanztransaktionssteuer;<br />
Frankreich macht es seit August<br />
2012 vor.<br />
Steuerflucht bekämpfen; Steueroasen<br />
trocken legen.<br />
Erbschaftssteuer drastisch erhöhen<br />
(dies ist eine zutiefst liberale Forderung<br />
zur Herstellung annähernd gleicher<br />
Startbedingungen; siehe USA und<br />
Großbritannien).<br />
EU-Mindeststeuersätze festschreiben,<br />
um ruinöses Steuerdumping zu verhindern.<br />
allgemein: Orientierung an der Zauberformel<br />
„produktivitätsorientierte<br />
Lohnpolitik“. Hierfür muss die Verhandlungsmacht<br />
von Arbeit gestärkt<br />
werden. Mindestlohn und Unterstützung<br />
der Gewerkschaften (politisch wie<br />
rechtlich) können einen entscheidenden<br />
Beitrag dazu leisten.<br />
Doch Geld allein reicht nicht aus. Der<br />
Ungleichheit wird bereits in Sphären jenseits<br />
von Fiskus und Arbeitsmarktes der<br />
Weg geebnet. In Deutschland ist die Schule<br />
die schlagkräftigste Reproduktionsinstanz<br />
der Klassengesellschaft; und somit<br />
auch der Ungleichheit.<br />
Wer etwas mehr Gleichheit will, muss<br />
dem vormodernen dreigliedrigen Schulsys -<br />
tem ans Leder; eine ganztätige Gemeinschaftsschule<br />
nach skandinavischem Vorbild<br />
könnte stattdessen als Vorbild dienen.<br />
Sicher, die Klassengesellschaft wird sich<br />
auch dann noch ihren Weg suchen. Einebnen<br />
lassen sich die Unterschiede wohl<br />
nicht, doch eine asymptotische Annäherung<br />
an die „Assoziation freier Individuen“<br />
(Marx) ist allemal drin. Umso wichtiger<br />
wird eine ex-post Umverteilung über das<br />
Steuersystem.<br />
30 Mehr Gleichheit wagen Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 31<br />
Hegemonie entfalten<br />
Wie wir es auch drehen und wenden;<br />
ob sozial, politisch, ökonomisch etc.: Der<br />
Schluss ist immer derselbe: Mehr Gleichheit<br />
durch Umverteilung brauchen wir<br />
jetzt. Doch werden nicht alle Feuer und<br />
Flamme sein in Anbetracht der damit verbundenen<br />
politischen Konsequenzen. Einige<br />
aus dem Lager der Opponierenden<br />
können wohl durch Offenlegung ihrer objektiven<br />
Interessenlage auf unsere Seite gezogen<br />
werden; dies betrifft große Teile der<br />
Mittelschichten.<br />
Hier ist jedoch Ideologie im Spiel; allerhand<br />
falsches Bewusstsein schwirrte und<br />
schwirrt durch den neoliberal strukturierten<br />
Raum des Politischen (sonst hätte die<br />
FDP niemals knapp 15 % holen können).<br />
Konsequente Ideologiekritik ist daher notwendig;<br />
die neoliberale Diskurshoheit beginnt<br />
bereits zu bröckeln, doch wartet hier<br />
wohl noch ein ganzer ideologischer<br />
Schutthaufen, der sorgfältig abgetragen<br />
werden muss.<br />
Auch der inklusive „Gleichheit ist<br />
Glück“-Ansatz, der Vermögende mit ins<br />
Boot holt und ihnen Sicherheit bietet,<br />
könnte die Grundlage für ein umfassendes<br />
hegemoniales Projekt sein. Und eigentlich<br />
ist Umverteilung von oben nach unten<br />
auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit.<br />
Warum also sind nicht alle längst auf<br />
unserer Seite?<br />
Einsichten in ökonomische Vernunftgebote<br />
führen nicht automatisch zu adäquatem<br />
Handeln der entscheidenden Akteure.<br />
Kalecki hat in seinem Aufsatz<br />
„Politische Aspekte der Vollbeschäftigung“<br />
gezeigt, dass Unternehmer an eine Stärkung<br />
der Verhandlungsmacht von Arbeit<br />
nicht unmittelbar interessiert sind; schließlich<br />
wollen sie nicht Unternehmer, sondern<br />
Rentiers sein; das ist viel angenehmer.<br />
Selbst wenn Vollbeschäftigung makroökonomisch<br />
sinnvoll ist, fürchten sie deren<br />
Konsequenzen: Aufmüpfige Arbeiter bedeuten<br />
Stress; sie sind ihnen ein Dorn im<br />
Auge. Die Unternehmer werden daher alles<br />
daran setzen, ihrerseits Hegemonie zu<br />
entfalten – vielleicht im Verbund mit einigen<br />
Rentiers –, eine Ausweitung der<br />
Lohnquote zu verhindern und somit werden<br />
sie den Kapitalismus ein wenig zum<br />
Wanken bringen; er neigt sein Haupt bereits<br />
gewaltig in Richtung Feudalismus; die<br />
schlechten alten Zeiten drohen wiederzukehren.<br />
Also wird es doch nicht auf rein konsensuellem<br />
Wege möglich sein, Umverteilung<br />
durchzusetzen. Ideologiekritik hin,<br />
Aufklärung her – Ideen sind klassenbasiert<br />
und einige gewinnen, andere verlieren<br />
(kurzfristig).<br />
Die Zauberformel lautet daher konfrontative<br />
Hegemonie; sie setzt weder auf<br />
Avantgarde noch vertraut sie in einen allgemeinen<br />
postpolitischen Konsens. Stattdessen<br />
sucht sie nach einer breiten politischen<br />
Basis, um der Verhandlungsmacht<br />
von Arbeit den Rücken zu stärken und das<br />
Klassengleichgewicht wiederherzustellen.<br />
Dafür müssen wir uns jedoch von der Mär<br />
vom Ende von links und rechts verabschieden.<br />
Politik kann nicht zu Verwaltung erstarren;<br />
tut sie es doch, verfestigt sie in der<br />
Regel Klassenstrukturen zugunsten der<br />
Mächtigen; mit – wie oben gezeigt – sozial,<br />
politisch und ökonomisch verheerenden<br />
Konsequenzen. Scheuen wir uns daher<br />
nicht vor der Umverteilung; und trauen wir<br />
31
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 32<br />
uns ruhig, das Kind beim Namen zu nennen:<br />
Es ist ein linkes Projekt. l<br />
Literatur<br />
Elsenhans, H. (2009): Kapitalismus kontrovers. Zerklüftungen<br />
im nicht so sehr kapitalistischen Weltsystem,<br />
Welt Trends Papiere, Potsdam.<br />
Kalecki, M (1987): Politische Aspekte der Vollbeschäftigung,<br />
in: Ders.: Krise und Prosperität im Kapitalismus,<br />
Marburg, S. 235f.<br />
Pickett, K./Wilkinson, R. (2009): Gleichheit ist<br />
Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser<br />
sind, Hamburg.<br />
Steindl, J. (1952): Maturity and Stragnation in American<br />
Capitalism, Oxford.<br />
Steindl, J. (1988): Diskussionsbeitrag zur EG-Frage.<br />
In: Kurswechsel, 4 (3), S. 3–7.<br />
Stockhammer, A. (2011): Von der Verteilungs- zur<br />
Wirtschaftskrise. Die Rolle der zunehmenden Polarisierung<br />
als strukturelle Ursache der Finanz- und<br />
Wirtschaftskrise . In: http://www.wege-aus-der-kri-<br />
se.at/fileadmin/dateien/downloads/HINTER-<br />
GRUNDMATERIAL/Studie_Stockhammer.pdf<br />
[10.06.<strong>2013</strong>].<br />
32 Mehr Gleichheit wagen Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 33<br />
PROGRAMM<br />
FÜR DEN LINKEN<br />
POLITIKWECHSEL<br />
von Sascha Vogt, Juso-Bundesvorsitzender<br />
Schwerpunkt<br />
Als „Linksschwenk“ oder gar als<br />
„Linksruck“ wurde das Regierungsprogramm<br />
der SPD bei seiner Verabschiedung<br />
von vielen Medien bezeichnet.<br />
Auch SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück<br />
verortet es – etwas zurückhaltender<br />
– als „links von der Mitte“. Wer<br />
auch immer diese ominöse Mitte ist,<br />
sie scheint auf jeden Fall mit dem Programm<br />
zufrieden: Etliche zentrale Aussagen<br />
des Programms werden von einer<br />
großen Mehrheit der Menschen –<br />
gemessen an den Ergebnissen der<br />
Meinungsforschung – geteilt. Ein Widerspruch?<br />
Nur zum Teil. Denn erstens<br />
haben Finanzkrise und Co. in der Tat<br />
dazu geführt, dass auch der Zeitgeist<br />
ein Stück nach links gerückt ist. Zweitens<br />
gibt es anscheinend und erfreulicherweise<br />
eine Mehrheit für solidarische<br />
und sozial gerechte Politik – auch<br />
wenn das manchen auch in der SPD<br />
verwundern sollte. Und drittens eignen<br />
sich einige zugespitzte und gewollt<br />
skandalisierende Formulierungen<br />
mancher JournalistInnen nicht immer<br />
zur Einordnung. Das Regierungsprogramm<br />
ist das Programm einer linken<br />
Volkspartei, es stellt eine Re-Sozialdemokratisierung<br />
der SPD dar, es ist in<br />
vielen Bereichen ein Erfolg für die <strong>Jusos</strong>,<br />
die für eine inhaltliche Erneuerung<br />
der SPD gekämpft haben, und es<br />
macht deutlich, wie eine Alternative –<br />
eben ein Politikwechsel – zu schwarzgelb<br />
aussehen kann. Nicht mehr, aber<br />
auch nicht weniger.<br />
Auch das war und ist freilich nicht<br />
selbstverständlich. Blicken wir zurück ins<br />
Jahr 2009. Mit gerade einmal 23 Prozent<br />
hat die SPD ihr schlechtestes Ergebnis bei<br />
einer <strong>Bundestagswahl</strong> eingefahren. Ein<br />
maßgeblicher Grund: Viele Menschen<br />
trauen der SPD nicht mehr zu, tatsächlich<br />
für soziale Gerechtigkeit zu sorgen und<br />
bleiben deswegen der Wahl fern. Auch das<br />
Wahlprogramm ist voll des Zögerns und<br />
Zauderns und taugt neben vielen weiteren<br />
Ursachen nicht unbedingt zu einer Zuspit-<br />
33
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 34<br />
zung, sondern verfestigt eher den Eindruck,<br />
dass die Fortsetzung der großen Koalition<br />
eine beschlossene Sache sei. Spätestens<br />
mit dem Dresdner Bundesparteitag<br />
im November 2009 macht sich die SPD<br />
auf den mühevollen Weg der Erneuerung,<br />
arbeitet die Vergangenheit auf und findet<br />
neue Positionierungen. Für uns <strong>Jusos</strong> war<br />
klar: Wir wollen eine Triebfeder für die Erneuerung<br />
sein, wir mischen uns in die Debatten<br />
über die Neuaufstellung der SPD<br />
ein. Wir entwerfen und diskutieren auf vielen<br />
Veranstaltungen eigene Ideen. Egal ob<br />
Arbeit, Bildung, Rente oder Steuern – wir<br />
bringen eigene Vorschläge in die Debatte,<br />
kämpfen in den Vorständen der Partei, auf<br />
Parteitagen und überall wo es sonst sinnvoll<br />
erscheint für einen neuen Kurs. Dabei<br />
halten wir engen Kontakt zu unseren<br />
Bündnispartnern außerhalb der SPD und<br />
lassen viele Vorschläge etwa von Gewerkschaftsjugend<br />
und anderen Jugendverbänden<br />
in die innerparteiliche Debatte einfließen.<br />
Doppelstrategie eben. Das alles war<br />
nicht immer einfach. Manche Debatten<br />
sind zäh. Manchmal fasst man sich an den<br />
Kopf. Und gelegentlich muss man auch<br />
Kompromisse eingehen. Aber alles in allem<br />
hat es sich gelohnt. Denn ohne Zweifel<br />
kann man nun sagen, dass es in den vergangenen<br />
15 Jahren wohl kaum ein Regierungsprogramm<br />
gegeben hat, in dem so<br />
viele Positionen der <strong>Jusos</strong> enthalten sind.<br />
Im Vergleich zum Jahr 2009 lässt sich mit<br />
Fug und Recht behaupten: Die SPD hat<br />
sich auf die Positionen der <strong>Jusos</strong> zubewegt<br />
und nicht umgekehrt.<br />
Nahezu in allen Politikfeldern oder Kapiteln<br />
des Programms lässt sich ein solcher<br />
Kurswechsel deutlich machen, der übrigens<br />
auch im Hinblick auf die Sorge vieler,<br />
die nächste große Koalition stehe vor der<br />
Tür, deutlich macht, dass dies entweder<br />
nur unter maximalen Zugeständnissen der<br />
Union oder des Verlustes der Glaubwürdigkeit<br />
der SPD funktionieren könnte.<br />
Dieser Kurs- und mit der Regierungsübernahme<br />
dann auch eben Politikwechsel lässt<br />
sich an den folgenden Kernbereichen aufzeigen:<br />
1. Der Kampf für gute Arbeit als Kernidentität<br />
der SPD umfasst anders als<br />
2009 eben nicht nur die inzwischen<br />
zum Allgemeingut gehörende Forderung<br />
nach dem gesetzlichen Mindestlohn.<br />
Dieser ist sicherlich weiterhin<br />
eine zentrale Forderung, dürfte aber<br />
nicht ausreichen, um prekäre Beschäftigung<br />
und vernünftige Löhne zu sichern.<br />
Deshalb tritt die SPD auch für<br />
eine umfassende Regulierung der Leiharbeit<br />
unter anderem durch die Durchsetzung<br />
des Equal-Pay-Grundsatzes<br />
und die Abschaffung der sachgrundlosen<br />
Befristung ein. Letzteres ist gerade<br />
für junge BerufseinsteigerInnen enorm<br />
wichtig, kann damit eben der Arbeitgeber<br />
nicht mehr beliebig den Kündigungsschutz<br />
umgehen, sondern muss<br />
auch jungen Menschen eine sichere<br />
Perspektive geben. Zusätzlich soll eine<br />
Reform der Minijobs unter anderem<br />
durch eine Begrenzung der Zahl der<br />
Stunden dafür sorgen, dass diese nicht<br />
mehr für Millionen Menschen Dumpinglöhne<br />
bedeuten. Ebenso möchte<br />
die SPD der ausufernden Praxis, durch<br />
Werkverträge einen regulären Arbeitsvertrag<br />
zu ersetzen, einen Riegel vorschieben.<br />
Abgerundet wird dieser Katalog<br />
durch ein klares Bekenntnis zu<br />
einem Tariftreuegesetz sowie einer Reform<br />
der Zumutbarkeitskriterien beim<br />
Arbeitslosengeld II: Künftig sollen nur<br />
34 Programm für den linken Politikwechsel Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 35<br />
noch Jobs angenommen werden müssen,<br />
die nach dem ortsüblichen Lohn<br />
vergütet werden. Das komplette Maßnahmenbündel<br />
würde nicht nur dazu<br />
führen, die in den vergangenen Jahren<br />
erschreckend ausgeweitete prekäre Beschäftigung<br />
zurückzudrängen, es würde<br />
auch ganz allgemein die Position der<br />
Gewerkschaften in Tarifverhandlungen<br />
stärken und damit dafür sorgen, dass<br />
die Politik ihren Teil zur Forderung<br />
nach Lohnsteigerungen für die Beschäftigten<br />
nachkommt.<br />
2. Eine Kehrtwende vollzieht die SPD<br />
auch im Bereich der sozialen Sicherungssysteme<br />
und möchte allgemein<br />
das Prinzip der Solidarität stärken und<br />
die eingeleiteten Schritte zur Privatisierung<br />
zumindest zum Teil zurücknehmen.<br />
Das beginnt bei der Gesetzlichen<br />
Krankenversicherung und der Einführung<br />
der Bürgerversicherung. Alle<br />
Menschen sollen einen guten Versicherungsschutz<br />
genießen, nach und nach<br />
sollen alle Gruppen in die Bürgerversicherung<br />
einzahlen. Das stärkt die Solidarität.<br />
Das gleiche Prinzip soll im Bereich<br />
der Pflegeversicherung gelten,<br />
außerdem ist hier eine Steigerung der<br />
Beitragssätze vorgesehen. Das ist angesichts<br />
der jetzt schon teilweise katastrophalen<br />
Bedingungen in der Pflege sowie<br />
der abzusehenden Herausforderungen<br />
auch mehr als notwendig. Innerparteilich<br />
am meisten umstritten, aber<br />
letztlich auch einer der vielleicht deutlichsten<br />
Kurswechsel ist in der Rentenpolitik<br />
zu sehen. Die umstrittene Rente<br />
mit 67 wird so lange ausgesetzt, bis es<br />
ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
für ältere Beschäftigte gibt, zusätzlich<br />
sollen Verbesserungen bei der<br />
Erwerbsminderungsrente dafür sorgen,<br />
dass Menschen aus gesundheitlichen<br />
Gründen ohne Rentenkürzung früher<br />
in den Ruhestand gehen können. Für<br />
Menschen, die lange Zeit gearbeitet<br />
haben, wird über eine Solidarrente sichergestellt,<br />
dass sie auch, wenn sie lange<br />
Jahre in prekären Jobs tätig waren,<br />
eine Rente deutlich über dem Niveau<br />
der Sozialhilfe erhalten. Das für die <strong>Jusos</strong><br />
wichtigste Element ist und bleibt<br />
jedoch die Sicherung des Rentenniveaus<br />
und damit der Stopp der weiteren<br />
Privatisierung. Damit wird klargestellt,<br />
dass die solidarische umlagefinanzierte<br />
Rentenversicherung weiterhin die<br />
hauptsächlich tragende Säule bleiben<br />
soll. Finanziert wird das ganze übrigens<br />
über eine Demographiereserve, also einem<br />
leichten Vorzug der ohnehin vorgesehenen<br />
Steigerungen der Rentenbeitragssätze.<br />
3. Hatte die rot-grüne Bundesregierung<br />
noch dafür gesorgt, dass massive Steuersenkungen<br />
die staatlichen Handlungsmöglichkeiten<br />
insbesondere bei<br />
den Kommunen eingeschränkt hatten,<br />
bekennt sich die SPD in ihrem Programm<br />
deutlich zu Steuererhöhungen<br />
für hohe Einkommen und Vermögen.<br />
Der Spitzensteuersatz soll auf 49 Prozent<br />
erhöht, Kapitaleinkünfte wieder<br />
genauso wie Arbeit besteuert und die<br />
Vermögensteuer eingeführt werden.<br />
Das ist nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit<br />
– schließlich sind die reichsten<br />
dieser Gesellschaft in den vergangenen<br />
Jahren immer reicher geworden.<br />
Das ist angesichts des Investitionsstaus<br />
auch eine Notwendigkeit, wenn man<br />
künftigen Generationen nicht die Zukunft<br />
verbauen möchte. Deswegen sol-<br />
35
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 36<br />
len die zusätzlichen Einnahmen auch<br />
für Investitionen in Bildung, Infra -<br />
struktur und zur Stärkung der Kommunen<br />
eingesetzt werden. In allen diesen<br />
Bereichen hinkt Deutschland im europäischen<br />
Vergleich übrigens deutlich<br />
zurück – höchste Zeit also, das zu verändern.<br />
4. Bildung ist zwar in vielen Bereichen<br />
Ländersache, das Wahlprogramm zeigt<br />
trotzdem die klaren Unterschiede zu<br />
schwarz-gelb auf. Neben den zusätz -<br />
lichen finanziellen Mitteln (die Einnahmen<br />
der Vermögensteuer z. B.<br />
kommen ausschließlich den Ländern<br />
zur Finanzierung von Bildung zugute)<br />
soll auch das Kooperationsverbot fallen.<br />
Damit hätte der Bund wieder die<br />
Möglichkeit, gemeinsam mit den Ländern<br />
große Aufgaben zu stemmen. Ein<br />
weiterer Kernpunkt ist der Bereich der<br />
beruflichen Ausbildung. Allen Berichten<br />
und Bündnissen zum Trotz gibt es<br />
immer noch viel zu wenig Ausbildungsplätze,<br />
hier möchte die SPD mit<br />
einer Ausbildungsgarantie und der<br />
Einführung von branchenbezogenen<br />
Fonds oder Umlagen Abhilfe schaffen.<br />
Außerdem soll gemeinsam mit den Tarifpartnern<br />
die teilweise schlechte Ausbildungsqualität<br />
verbessert werden, indem<br />
zum Beispiel längere<br />
Ausbildungsgänge wieder stärker unterstützt<br />
werden. Und auch für Studierende<br />
soll sich etwas ändern: Das elitäre<br />
Deutschlandstipendium wird<br />
abgeschafft, dafür das BAföG verbessert,<br />
unter anderem durch eine stärkere<br />
Anerkennung ehrenamtlichen Engagements<br />
bei der Bemessung der Förderungshöchstdauer.<br />
Alles in allem wird<br />
deutlich, dass es in Sachen Chancengleichheit<br />
in der Bildung einen enormen<br />
Unterschied macht, wer regiert.<br />
5. Endlich wird auch das Thema Gleichstellung<br />
offensiv angegangen. Das unsinnige<br />
Betreuungsgeld wird abgeschafft,<br />
stattdessen soll in einem<br />
Stufenplan flächendeckend und kostenfreie<br />
Kinderbetreuung ab dem ersten<br />
Lebensjahr zur Verfügung gestellt<br />
werden. Das betrifft zwar nicht nur<br />
Frauen, in der Realität aber leider immer<br />
noch zu häufig Frauen, da die Kinderbetreuung<br />
zwischen Frauen und<br />
Männern ungleich verteilt ist. Für die<br />
beruflichen Chancen mindestens ebenso<br />
wichtig ist die Einführung eines<br />
Entgeltgleichheitsgesetzes, das dafür<br />
sorgen soll, dass Frauen bei gleichem<br />
Job eben nicht mehr 23 Prozent weniger<br />
verdienen als ihre männlichen Kollegen.<br />
Und ebenso soll eine Quote bei<br />
Aufsichtsräten und Vorständen von<br />
börsennotierten Unternehmen dafür<br />
sorgen, dass endlich mehr Frauen in<br />
Chefetagen zu finden sind. Ein wichtiger<br />
Schritt nach vorn ist darüber hinaus<br />
die Abschaffung des Ehegattensplitting,<br />
das völlig unsinnig Milliarden verschlingt<br />
und traditionelle Rollenbilder<br />
verfestigt. Klar, volle Gleichstellung ist<br />
auch eine gesellschaftliche Einstellungsfrage.<br />
Die Politik kann aber Einfluss<br />
nehmen. Und das will die SPD –<br />
anders als die Union mit ihren freiwilligen<br />
Selbstverpflichtungen und Flexiquoten.<br />
6. Bei aller berechtigten Kritik am eigenen<br />
Regierungshandeln in der Vergangenheit:<br />
Was schon rot-grün gewaltig<br />
nach vorne gebracht hat – nämlich die<br />
Liberalisierung und Öffnung der Ge-<br />
36 Programm für den linken Politikwechsel Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 37<br />
sellschaft – soll nun fortgesetzt werden.<br />
Ausgehend von der Idee einer offenen,<br />
toleranten und solidarischen Gesellschaft<br />
würde sich bei einem Wahlsieg<br />
der SPD auch gesellschaftspolitisch einiges<br />
tun. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft<br />
– deshalb brauchen<br />
wir eine Willkommenskultur und auch<br />
hierfür kann die Politik etwas tun.<br />
Etwa mit der Einführung der doppelten<br />
Staatsbürgerschaft für alle, die das<br />
wünschen. Mehrere Identitäten zu haben<br />
ist in einer Einwanderungsgesellschaft<br />
total normal – das sollte die Politik<br />
auch endlich akzeptieren. Dazu<br />
gehört auch die Einführung des Wahlrechts<br />
für Migrantinnen und Migranten<br />
– wer längere Zeit hier lebt, soll<br />
auch an demokratischen Entscheidungen<br />
beteiligt werden. Zu einer toleranten<br />
Gesellschaft gehört auch das Zusammenleben<br />
von Menschen mit und<br />
ohne Behinderung. Auch Inklusion<br />
kann nicht von oben verordnet, aber<br />
von Politik beeinflusst werden, z. B. indem<br />
Mittel zum Umbau von Gebäuden<br />
bereit gestellt werden, oder indem bei<br />
der Jobvermittlung gezielter auf die Bedürfnisse<br />
aller Menschen geachtet<br />
wird. Und zu einer toleranten Gesellschaft<br />
gehört auch, homosexuelle Paare<br />
endlich mit allen anderen Paaren tatsächlich<br />
gleichzustellen und nicht immer<br />
erst dann zu reagieren, wenn das<br />
Bundesverfassungsgericht mal wieder<br />
ein Urteil gefällt hat. Eines braucht<br />
eine tolerante Gesellschaft aber garantiert<br />
nicht: Nazis. Deshalb ist es gut,<br />
dass die SPD auch die Extremismusklausel<br />
abschaffen möchte und so gesellschaftliche<br />
Initiativen gegen Nazis<br />
wieder besser gefördert werden können.<br />
Man könnte nun noch viele weitere<br />
Punkte aufzählen. Die Ablehnung von<br />
Kampfdrohnen etwa. Die flächendeckende<br />
Einführung von Breitbandversorgung auch<br />
in ländlichen Räumen. Oder die Einführung<br />
des Wahlalters 16 auch bei Bundestags-<br />
und Europawahlen. In nahezu jedem<br />
Kapitel wird deutlich, warum es sich für einen<br />
Wahlsieg der SPD zu kämpfen lohnt,<br />
wenn man tatsächlich für gesellschaftliche<br />
Veränderungen einstehen möchte. Nun<br />
gibt es diejenigen die nicht glauben, dass<br />
das alles ernst gemeint ist und viele Punkte<br />
in Regierungsverantwortung nicht umgesetzt<br />
würden. Denen kann man dreierlei<br />
zurückrufen:<br />
1. Mit der Fortsetzung der schwarz-gelben<br />
Bundesregierung wäre sogar ziemlich<br />
sicher, dass kaum einer der genannten<br />
Punkte umgesetzt würde.<br />
2. Wohl kaum ein Wahlprogramm der<br />
vergangenen Jahre ist so intensiv diskutiert<br />
worden wie dieses. Das führt auch<br />
zu einer breiten und tief verwurzelten<br />
Mehrheit in der SPD für so ziemlich<br />
jeden Punkt. Es dürfte daher schwierig<br />
für wen auch immer sein, gravierend<br />
davon abzuweichen.<br />
3. Natürlich kann es sein, dass im Zuge<br />
von Koalitionsverhandlungen oder<br />
neuen Rahmenbedingungen auch zu<br />
Regierungszeiten neue Debatten entstehen.<br />
Na und? Für gesellschaftlichen<br />
Fortschritt muss man immer kämpfen.<br />
Und es gibt diejenigen, die befürchten,<br />
dass große Teile des Programms auf dem<br />
Basar einer großen Koalition geopfert werden.<br />
Wenn man nichts dagegen tut, kann<br />
das geschehen. Aber erstens geht es jetzt<br />
37
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 38<br />
erstmal darum, mit einem guten Programm<br />
ein möglichst gutes Ergebnis für<br />
die SPD zu erkämpfen. Und zweitens wird<br />
eigentlich aus jeder Zeile des Programms<br />
deutlich, dass damit keine große Koalition<br />
möglich ist. Deshalb geht es umso mehr<br />
darum, unsere Positionen im Wahlkampf<br />
nach vorne zu tragen und deutlich zu machen,<br />
was wir unter einem linken Politikwechsel<br />
verstehen! l<br />
38 Programm für den linken Politikwechsel Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 39<br />
KANZLERKANDIDATEN<br />
UND -KANDIDATINNEN:<br />
WIE BEEINFLUSSEN SIE<br />
DIE WAHLENTSCHEI-<br />
DUNG?<br />
Von Aiko Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „German Longitudinal<br />
Election Study (GLES)“, Abteilung „Demokratie und Demokratisierung“ am Wissenschaftszentrum<br />
Berlin für Sozialforschung (WZB)<br />
Das politische Personal entscheidet<br />
die Wahlen – Die Personalisierungsthese<br />
Die These von der Personalisierung<br />
der Politik geistert seit Längerem<br />
durch die Medien. Sie besagt, dass,<br />
erstens, das politische Personal stärkere<br />
Beachtung fände als politische Inhalte<br />
und Parteibewertungen, zweitens,<br />
dass die Bedeutung rollenferner<br />
Bewertungskriterien relevanter seien<br />
als dezidiert politische Eigenschaften<br />
und drittens, dass diese Ungleichgewichte<br />
zunähmen. Demnach würde<br />
der Souverän in erster Linie nicht mehr<br />
die Parteien, ihre Politikvorschläge<br />
und bisherigen Leistungen bewerten,<br />
sondern vorrangig die KandidatInnen.<br />
Flankiert wird dieser Befund von der<br />
Beobachtung, dass vor allem die Boulevardmedien<br />
ihre Berichterstattung<br />
mehr auf die Personen konzentrierten<br />
als auf die inhaltlichen Aussagen der<br />
Parteiprogramme . Diese Konzentration<br />
der Medien auf die Kandidaten<br />
und Kandidatinnen in ihre Strategie<br />
aufnehmend, würden insbesondere<br />
die großen Parteien ihre Kanzlerkandidatin<br />
bzw. ihren Kandidaten stärker in<br />
den Vordergrund rücken. Diese Wandlung<br />
der Wahlkämpfe gälte nicht nur<br />
für Deutschland, sondern sei ein in<br />
fast allen Demokratien anzutreffendes<br />
Phänomen.<br />
Die drei kurz vorgestellten Sachverhalte<br />
– Fokussierung der Medien auf die Spitzenkandidaten<br />
unter Hervorhebung ihrer<br />
politikfernen Persönlichkeitsmerkmale,<br />
Betonung des Personals durch die Parteien<br />
und deren Relevanz für die Wahlentscheidungen<br />
– hängen inhaltlich natürlich stark<br />
zusammen. Die politischen Parteien kon-<br />
39
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 40<br />
zentrieren ihre Wahlkämpfe genau dann<br />
stärker auf ihr Führungspersonal, wenn sie<br />
unterstellen, dass die Wählerinnen und<br />
Wähler (immer stärker) auf Spitzenkandidaten<br />
achten und ihnen für ihre Wahlentscheidung<br />
mehr Gewicht zumessen (Adam<br />
und Maier 2010). Zugleich drängt es sich<br />
aus Sicht der Wählerinnen und Wähler geradezu<br />
auf, die Bewertung von Parteien<br />
durch das Bewerten der Kandidaten zu ersetzen,<br />
wenn in den Medien vor allem Personal<br />
dargestellt wird und Inhalte vergleichsweise<br />
kurz kommen. Dieser Logik<br />
nach ist Personalisierung durch das Zusammenwirken<br />
dieser drei Elemente quasi<br />
zwangsläufig: Sie wäre somit ein stärker<br />
werdender und sich selbst verstärkender<br />
Prozess.<br />
Personenorientierung und<br />
Wahlentscheidung<br />
Dementsprechende Befunde finden<br />
sich in den Medien. So titelte Spiegel Online<br />
beispielsweise mit Blick auf den Wahlkampf<br />
2009: „Union feiert die Merkel-<br />
Show“, und führte aus, dass der Wahlkampf<br />
„nun mal in diesen Zeiten […] vor<br />
allem Inszenierung, Spektakel, Show“ sei<br />
(Spiegel Online, 06.09.2009). Zudem verdanke<br />
die Union 2009 „knapp ein Drittel<br />
ihrer Wähler der Person Merkel“ (Bartsch<br />
et al., Der Spiegel, 29.09.2009). Ähnliches<br />
scheint sich im momentanen Wahlkampf<br />
zu wiederholen. Allerdings wurden bereits<br />
frühere Wahlkämpfe als hochgradig personalisiert<br />
bezeichnet. Die Konfrontation<br />
von Franz Josef Strauß und Helmut<br />
Schmidt 1980 habe laut ZEIT bereits ein<br />
„schlimmes Beispiel dafür geliefert, wie<br />
Polarisierung und Personalisierung jede<br />
Sachdebatte erschlagen“ könnten (Die<br />
Zeit, 24.10.1980). Und bereits Willy<br />
Brandts Wahlkämpfen wurde nachgesagt,<br />
in besonderem Maße Rücksicht auf die moderne<br />
Medienrealität genommen zu haben.<br />
In der Politikwissenschaft werden sich<br />
zum Teil widersprechende Ergebnisse berichtet.<br />
Einige verweisen auf den Umstand,<br />
dass die meisten der eine Personalisierung<br />
fördernden Faktoren, wie etwa die<br />
starke Position des Regierungschefs, auf<br />
Deutschland zutreffen , wenngleich das<br />
Wahlrecht eine Fokussierung auf das Spitzenpersonal<br />
weniger als in anderen Ländern<br />
begünstigt . Andere Autoren finden<br />
in empirischen Studien keine starke oder<br />
etwa zunehmende Personenorientierung<br />
des Wahlverhaltens . Wieder andere konstatieren,<br />
dass die KanzlerkandidatInnen in<br />
einigen Wahlen durchaus ergebnisrelevant<br />
gewesen seien, allerdings nicht in allen und<br />
auch nicht in zunehmendem Maße . Als<br />
allgemeiner Befund lässt sich festhalten,<br />
dass generalisierte Parteibewertungen im<br />
Mittel deutlich relevanter als KandidatInnenbewertungen<br />
sind .<br />
Träfe die Personalisierungshypothese<br />
hinsichtlich der Bedeutungszunahme der<br />
Personenbewertung für die Wahlentscheidung<br />
zu und evaluierten die BürgerInnen<br />
das Personal auch noch anhand weitgehend<br />
unpolitischer Kriterien, wären die erwähnten<br />
demokratietheoretischen Bedenken<br />
womöglich dennoch berechtigt. Die<br />
Politik liefe Gefahr, zu einem Schönheitswettbewerb<br />
zu verkommen, in dem bloße<br />
physische Attraktivität oder charismatische<br />
Ausstrahlung über die Zuweisung politischer<br />
Macht entscheiden und die KandidatInnen<br />
nur „attraktiv verpackte Waren<br />
[sind], hergestellt vom ‚image-Maker’, der<br />
die Öffentlichkeit manipuliert“ . Eine solche<br />
Entwicklung wäre auch darum be-<br />
40 Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen: Wie beeinflussen sie die Wahlentscheidung? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 41<br />
denklich, da in der Bundesrepublik mit der<br />
relevanteren Zweitstimme nicht SpitzenpolitikerInnen<br />
gewählt werden, sondern<br />
politische Parteien. Andererseits griffe<br />
auch hier eine Untergangsprophetie der<br />
Demokratie zu kurz, denn sie würde die<br />
Mehrdimensionalität der Personenbeurteilung<br />
sowie die komplexitätsreduzierende<br />
Rolle von Personen im Prozess der Beurteilung<br />
der Wahloptionen verkennen.<br />
Wie beeinflussen KanzlerkandidatInnen<br />
die Wahlentscheidung?<br />
Wahlergebnisse in der Bundesrepublik<br />
sind einerseits also nicht durch die KanzlerkandidatInnen<br />
determinert. Andererseits<br />
widerspricht niemand der These, dass<br />
ein Teil des Wahlverhaltens der Bürgerinnen<br />
und Bürger durch sie mitbestimmt<br />
wird. Zwei demokratietheoretisch weniger<br />
bedenkliche Wege der Beeinflussung der<br />
individuellen Wahlentscheidung lassen<br />
sich unterscheiden: Erstens können die in<br />
den Medien sichtbaren Spitzenpolitiker als<br />
Entscheidungshilfe verwendet werden – in<br />
der politischen Psychologie und Sozialpsychologie<br />
spricht man von Heuristiken oder<br />
information shortcuts: Selbst im Internetzeitalter<br />
ist es mit großem (vor allem zeitlichen)<br />
Aufwand verbunden, sich über die<br />
Positionen der Parteien zu allen relevanten<br />
Themen zu informieren, um darauffolgend<br />
eine sachfragenorientierte Wahlentscheidung<br />
zu treffen. Daher können politisch<br />
weniger informierte Bürgerinnen und Bürger<br />
oder Personen, die sich vor dieser Zeitinvestition<br />
scheuen, auf die einfacher zugänglichen<br />
Bewertungen von Politikerinnen<br />
und Politikern zurückgreifen. Von Positionen<br />
zur Wirtschafts- oder Außenpolitik<br />
einer Kanzlerkandidatin bzw. eines -<br />
kandidaten beispielsweise schließen Informationskosten<br />
sparende Wählerinnen und<br />
Wähler auf die Parteiposition. Zweitens<br />
muss die Gesamtbewertung von politischem<br />
Personal nicht vorrangig aus der Beurteilung<br />
von physischer Attraktivität oder<br />
menschlicher Sympathie resultieren. Die<br />
Bewertung eines Spitzenpolitikers kann<br />
ebenfalls von dezidiert politischen und politisch<br />
relevanten Kriterien abhängen. Dabei<br />
rücken sowohl die Lösungskompetenz<br />
für wichtige anstehende Probleme in den<br />
Blickpunkt als auch sogenannte rollennahe<br />
Persönlichkeitseinschätzungen wie Führungsstärke,<br />
Tatkraft und Integrität .<br />
Schaubild 1 stellt die Prozesse der Bewertungsgeneralisierung,<br />
Präferenzbildung<br />
und Entscheidung dar: Die spezifischen<br />
Beurteilungen der KandidatInnen hinsichtlich<br />
der vier Bereiche, in die sich laut<br />
der politikwissenschaftlichen Literatur die<br />
Evaluierung von SpitzenpolitikerInnen<br />
einordnen lässt, werden im ersten Schritt<br />
von den WählerInnen in eine allgemeine<br />
Einschätzung überführt. Diese generalisierte<br />
Bewertung dient als Grundlage für<br />
die Präferenzbildung – wer wird als KanzlerIn<br />
bevorzugt? Diese Präferenz geht<br />
dann in die Wahlentscheidung zugunsten<br />
einer der beiden großen Parteien ein. Ganz<br />
zentral ist dabei, dass auf jede dieser vier<br />
Entitäten die Parteineigung, also langfristige<br />
affektive Bindungen an die Parteien,<br />
einen erheblichen Einfluss ausübt. Sowohl<br />
die letztendliche Wahlentscheidung als<br />
auch Bewertungen und Präferenzen erfolgen<br />
demnach nicht ungefiltert oder entspringen<br />
einer quasi objektiven Beurteilung<br />
des Kandidaten oder der Kandidatin,<br />
sondern sind ganz zentral davon abhängig,<br />
ob eine Person der dazugehörigen Partei<br />
zuneigt oder nicht. Auch hierin zeigt sich<br />
wiederum die Relevanz des Objekts ‚Partei‘.<br />
41
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 42<br />
Spezifische<br />
Bewertungen<br />
(Führungsstärke,<br />
Integrität, Kompetenz,<br />
Sympathie)<br />
Generalisiserte<br />
Bewertungen<br />
Kanzlerpräferenz<br />
Wahlentscheidung<br />
Schaubild 1: Generalisierung, Präferenzbildung und Entscheidungsfindung:<br />
Wie KandidatInnenorientierungen die Wahlentscheidung beeinflussen<br />
Quelle: Eigene Abbildung nach Wagner/Weßels<br />
Wie wichtig die einzelnen spezifischen<br />
Bewertungsdimensionen sind, variiert zwischen<br />
den Wahlen. Für die letzten <strong>Bundestagswahl</strong>en<br />
lässt sich aber festhalten, dass<br />
die Gesamtbeurteilung der Kanzlerkandidaten<br />
zumeist politisch erfolgt: Wie kompetent<br />
wirkt der/die KandidatIn? Wie viel<br />
Vertrauenswürdigkeit, wie viel Tatkraft<br />
strahlt er oder sie aus? Nur selten waren<br />
rollenferne Bewertungen, wie die menschliche<br />
Sympathie, relevanter.<br />
Bewertung der KanzlerkandidatInnen<br />
und Wahlergebnis<br />
Der Effekt der Parteibewertung ist für<br />
die individuelle Wahlentscheidung relevanter<br />
als die Beurteilungen der KanzlerkandidatInnen<br />
und letztere beeinflussen<br />
die Entscheidungen der WählerInnen, indem<br />
spezifische Bewertungen von rollennahen<br />
und rollenfernen Aspekten zu allgemeineren<br />
Evaluierungen generalisiert und<br />
diese in Präferenzen umgesetzt werden.<br />
Welches Ausmaß haben die KanzlerkandidatInnen<br />
nun auf das Wahlergebnis?<br />
Partei Ergebnis 2009<br />
Modellvorhersage<br />
für 2009<br />
Simulation 1 Simulation 2<br />
Union 36 % 41 % 39 % 40 %<br />
SPD 24 % 23 % 23 % 22 %<br />
FDP 15 % 11 % 12 % 11 %<br />
Grüne 11 % 12 % 12 % 12 %<br />
Linke 13 % 14 % 15 % 14 %<br />
Tabelle 1: Ergebnis der <strong>Bundestagswahl</strong> 2009 (Zweitstimmanteile an den Zweitstimmen für alle Bundestagsparteien)<br />
und Simulationsergebnisse<br />
Anmerkung: Anteile an den Stimmen, die für die Bundestagsparteien abgegeben wurden:<br />
Lesehinweis: 24 % aller Stimmen, die für die Bundestagsparteien abgegeben wurden, entfielen auf die SPD, die<br />
Modellvorhersage für 2009 liegt bei 23 %; Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt; Quelle für das<br />
Wahlergebnis: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/<br />
bundesergebnisse/ [10.07.<strong>2013</strong>]. Quelle für die Modellvorhersage sowie die Simulationen stammen aus dem<br />
Nachwahlquerschnitt der „German Longitudinal Election Study (GLES)“.<br />
42<br />
Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen: Wie beeinflussen sie die Wahlentscheidung? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 43<br />
Tabelle 1 zeigt das Wahlergebnis –<br />
Zweit stimmenanteile der im Bundestag<br />
vertretenen Fraktionen an allen Zweitstimmen<br />
der Bundestagsparteien – sowie eine<br />
Modellvorhersage. Dafür wurde die Wahlabsicht<br />
auf die Parteineigung, die wahrgenommene<br />
ideologische Distanz zwischen<br />
der jeweiligen Partei und Ego und die generalisierten<br />
Partei- und KandidatInnenbewertungen<br />
zurückgeführt. 1<br />
Vor dem Hintergrund, dass Wahlentscheidungen<br />
durch viele weitere Faktoren<br />
beeinflusst werden, ist die Vorhersage des<br />
Modells durchaus passabel. Die Abweichungen<br />
für die SPD, die Grünen und die<br />
Linke liegen bei unter 1,5 Prozentpunkten.<br />
Der Zweitstimmenanteil der Union wird<br />
deutlich überschätzt, der der FDP dagegen<br />
unterschätzt, was auf strategisches Stimmverhalten<br />
von WählerInnen hindeutet, die<br />
aus sog. aufrichtigen Motiven für die Unionsparteien<br />
gestimmt hätten, ihr Kreuz<br />
doch letztlich beim Wunschkoalitionspartner<br />
machten. Nichtsdestotrotz können diese<br />
Vorhersagen für eine kleine Simulation<br />
verwendet werden. Dazu wurde ermittelt,<br />
wie sich das Wahlergebnis verändert hätte,<br />
wenn der SPD-Herausforderer Frank-<br />
Walter Steinmeier so populär wie die<br />
Kanzlerin Angela Merkel gewesen und<br />
Merkel wie der SPD-Spitzenmann bewertet<br />
worden wäre. 2<br />
Bekanntermaßen wurde Merkel 2009<br />
sowohl absolut als auch im Vergleich zum<br />
Herausforderer von der Bevölkerung sehr<br />
gut bewertet (7,1 Punkte im Vergleich zu<br />
6,3 Punkte für Steinmeier auf einer Skala<br />
von 1 bis 11). Tauscht man nun diese Einschätzungen<br />
aus, nimmt man also einmal<br />
an, die Merkelbewertungen hätten Steinmeier<br />
gegolten und umgekehrt, ergibt sich<br />
das Wahlergebnis aus der dritten Ergebnisspalte<br />
(„Simulation 1“).<br />
Aus der Perspektive des Personalisierungsparadigmas<br />
sind diese Ergebnisse ernüchternd.<br />
Die Unionsparteien hätten –<br />
wie aufgrund der nun im Mittel niedrigeren<br />
Bewertung ihrer Kandidatin zu erwarten<br />
war – wohl etwa knapp zwei Prozentpunkte<br />
weniger Zweitstimmen erhalten als<br />
in der Modellvorhersage für die <strong>Bundestagswahl</strong><br />
2009, also auf Basis der realen<br />
Umfragedaten. Allerdings hätte die SPD<br />
davon und durch den nun beliebter simulierten<br />
Spitzenkandidaten kaum profitiert:<br />
die Abweichungen bewegen sich lediglich<br />
im Nachkommabereich.<br />
Was bedeuten diese Ergebnisse für die<br />
anstehende <strong>Bundestagswahl</strong>? Nach dem<br />
ARD-DeutschlandTREND vom Juni <strong>2013</strong><br />
sind 70 Prozent der Bundesbürgerinnen<br />
und Bundesbürger mit der politischen Arbeit<br />
der Kanzlerin sehr zufrieden oder zufrieden,<br />
30 Prozent weniger oder gar nicht<br />
zufrieden. Für den Herausforderer Peer<br />
Steinbrück lauten die Zahlen 36 zu 59. 3<br />
Verwendet man die Salden (+40 bei Mer-<br />
1 Es wurde ein konditionales Logit-Modell für<br />
WählerInnen einer der Bundestagsparteien geschätzt.<br />
Daten gewichtet mittels sozialstrukturellem,<br />
regionalstrukturellem und Transformationsgewicht;<br />
1.483 Befragte.<br />
2 Konkret wurden schlicht die generalisierten Bewertungen<br />
(Kandidatenskalometerwerte) von<br />
Merkel auf Steinmeier übertragen und vice versa.<br />
Die Grenzen dieser Simulation sollten jedoch beachtet<br />
werden. So wurde nicht untersucht, welche<br />
Auswirkungen die KandidatInnenbewertungen<br />
auf andere Faktoren (zum Beispiel die Passung<br />
von KandidatIn und Partei) und auf die Mobilisierung<br />
hätte. So ist durchaus vorstellbar, dass ein<br />
beliebterer Kandidat oder eine beliebtere Kandidatin<br />
womöglich nicht den anderen Parteien<br />
Stimmen genommen, aber mehr Anhänger an die<br />
Wahlurne gelockt hätte.<br />
3 Vgl. http://www.infratest-dimap.de/umfragenanalysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/<strong>2013</strong>/juni/<br />
[10.07.<strong>2013</strong>].<br />
43
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 44<br />
kel und –23 bei Steinbrück) als Kenngrößen<br />
im obigen Modell in einer zweiten Simulation,<br />
ergibt sich das in der letzten<br />
Spalte berichtete, simulierte Wahlergebnis<br />
(„Simulation 2“). 4 Natürlich sollte beachtet<br />
werden, dass <strong>2013</strong> nicht 2009 ist und sich<br />
demnach selbstredend nicht nur die Bewertungen<br />
der KandidatInnen der beiden<br />
großen Parteien geändert haben. Diese Simulation<br />
ist daher nicht als Prognose für<br />
den Wahlausgang, sondern lediglich als<br />
Gedankenexperiment zu verstehen. Sie<br />
sagt uns, wie sich die Kräfteverhältnisse<br />
2009 dargestellt hätten, wenn der SPD-<br />
Kandidaten so beliebt gewesen wäre wie es<br />
momentan Steinbrück ist und wenn die<br />
Bewertung von Merkel der gegenwärtigen<br />
entsprochen hätte. Was erkennen wir nun?<br />
Wiederum ist der Unterschied nur marginal.<br />
Im Vergleich zur Vorhersage des Ursprungsmodells<br />
verlieren beide Volksparteien<br />
jeweils einen Prozentpunkt. Die<br />
<strong>Bundestagswahl</strong> 2009 wäre demnach mit<br />
den gegenwärtigen KanzlerkandidatInnen<br />
wohl ähnlich ausgegangen.<br />
Fassen wir zusammen: Die politikwissenschaftliche<br />
Forschung zeigt auf, dass<br />
Parteien noch immer die relevanteren Bewertungsobjekte<br />
für die Bürgerinnen und<br />
Bürger sind. Zudem sind politiknahe Bewertungskriterien<br />
wichtiger für die generalisierte<br />
Beurteilung der KandidatInnen als<br />
politikferne Kriterien. Hinsichtlich des<br />
Wahlverhaltens kann also Entwarnung gegeben<br />
werden – ein Trend demokratietheoretisch<br />
problematischer Personalisierung<br />
ist nicht erkennbar, vielmehr ist jede Wahl<br />
unterschiedlich.<br />
KandidatInnen machen jedoch einen<br />
Unterschied für das Wahlergebnis. Dieser<br />
bleibt allerdings recht überschaubar – sie<br />
bewegen das Wahlergebnis wohl eher im<br />
niedrigen einstelligen Bereich. Zwar sind<br />
wenige Prozentpunkte durchaus wichtig,<br />
können sie doch über Koalitionsmöglichkeiten<br />
und Mehrheitsverhältnisse, kurz:<br />
über Sieg und Niederlage entscheiden. Die<br />
präsentierten Simulationen zeigen aber,<br />
dass die SPD auch mit einem genauso beliebten<br />
Kandidaten wie Angela Merkel<br />
eine war (und ist) die Wahl 2009 zumindest<br />
nicht gewonnen hätte. Und auch die<br />
Wahl <strong>2013</strong> wird wohl nicht vorrangig<br />
durch das Duell zwischen Merkel und<br />
Steinbrück entschieden werden. l<br />
4 Diese Salden, die theoretisch Werte von -100 bis<br />
+100 annehmen können, wurden in den Wertebereich<br />
von 1 bis 11 umgewandelt, der in den Umfragen<br />
gebräuchlich ist (mit -100 = 1, 0 = 6 und<br />
+100 = 11). Daraufhin wurden Zufallsvariablen<br />
erstellt, die den Saldo als Mittelwert (8,0 und 5,2)<br />
und ähnliche Standardabweichungen wie die empirischen<br />
Werte aus 2009 aufweisen.<br />
44<br />
Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen: Wie beeinflussen sie die Wahlentscheidung? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 45<br />
Literatur<br />
Adam, S. & Maier, M. (2010). Personalization of<br />
Politics. A Critical Review and Agenda for Research.<br />
In: C. T. Salmon (Hrsg.). Communication Yearbook<br />
34. New York: Routledge, 213 – 257.<br />
Bartsch, M., Brandt, A., Dahlkamp, J., Kaiser, S.,<br />
Schmid, B. & Verbeet, M. (2009). Volkspartei ohne<br />
Volk. In: Der Spiegel. 29.09.2009.<br />
Brettschneider, F. (2002). Spitzenkandidaten und<br />
Wahlerfolg. Personalisierung, Kompetenz, Parteien.<br />
Ein internationaler Vergleich. Wiesbaden: Westdeutscher<br />
Verlag.<br />
Brettschneider, F. & O. W. Gabriel (2003). The<br />
Nonpersonalization of Voting Behavior in Germany.<br />
In: Anthony King (Hrsg.). Leaders' Personalities and<br />
the Outcomes of Democratic Elections.<br />
Oxford: Oxford University Press, 127 – 157.<br />
Die Zeit (1980). Die Frage nach Personen,<br />
24.10.1980, http://www.zeit.de/1980/44/Die-Fragenach-Personen,<br />
Zugriff 11.11.2010.<br />
Holtz-Bacha, C. (2002). Massenmedien und<br />
Wahlen: Die Professionalisierung der Kampagnen.<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte. B 15 – 16, 23 – 28.<br />
Karvonen, L. (2010). The Personalisation of Politics.<br />
A Study of Parliamentary Democracies.<br />
Essex: ECPR Press.<br />
Kindelmann, K. (1994). Kanzlerkandidaten in den<br />
Medien. Eine Analyse des Wahljahres 1990.<br />
Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
McAllister, I. (2007). The Personalization of Politics.<br />
In Dalton, R. J. & Klingemann, H.-D. (Hrsg.).<br />
The Oxford Handbook of Political Behavior.<br />
Oxford: Oxford University Press, 571 – 588.<br />
Miller, W. E. & Shanks J. M. (1996). The New<br />
American Voter. Cambridge; London: Harvard<br />
University Press.<br />
Mondak, J. J. (1993). Public Opinion and Heuristic<br />
Processing of Source Cues. Political Behavior. 15,<br />
167 – 192.<br />
Pappi, F. U. & Shikano, S. (2001). Personalisierung<br />
der Politik in Mehrparteiensystemen am Beispiel<br />
deutscher <strong>Bundestagswahl</strong>en seit 1980. Politische<br />
Vierteljahresschrift. 42, 355 – 387.<br />
Poguntke, T. (2005). A Presidentializing Party State?<br />
The Federal Republic of Germany. In: Poguntke, T.<br />
& Webb, P. (Hrsg.). The Presidentialization of<br />
Politics. Oxford: Oxford University Press, 63 – 87.<br />
Rattinger, H., Roßteutscher, S., Schmitt-Beck, R. &<br />
Weßels, B. (2011). Nachwahl-Querschnitt (GLES<br />
2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5301 Datenfile<br />
Version 4.0.0. doi:10.4232/1.10998.<br />
Spiegel Online, Union feiert die Merkel-Show,<br />
06.09.2009, http://www.spiegel.de/politik/<br />
deutschland/0,1518,647292,00.html, [05.12.2010].<br />
Wagner, A. (2011). Die Personalisierung der Politik:<br />
Entscheiden Spitzenkandidaten Wahlen? In: Bytzek,<br />
E. & Roßteutscher, S. (Hrsg.). Der unbekannte<br />
Wähler? Mythen und Fakten über das Wahlverhalten<br />
der Deutschen. Frankfurt a.M.: Campus,<br />
81 – 97.<br />
Wagner, A. & Weßels, B. (2012a). Kanzlerkandi -<br />
daten – Wie beeinflussen sie die Wahlentscheidung?<br />
Politische Vierteljahresschrift Sonderheft (45).<br />
Wählen in Deutschland, 345 – 370.<br />
Wagner, A. & Weßels, B. (2012b). Parties and their<br />
Leaders. Does it matter how they match? The<br />
German General Elections 2009 in comparison.<br />
Electoral Studies. 31, 72 – 82.<br />
Weßels, B. (2000). Kanzler- oder Politikwechsel?<br />
Bestimmungsgründe des Wahlerfolgs der SPD bei<br />
der <strong>Bundestagswahl</strong> 1998. In van Deth, J., Rattinger,<br />
H. & Roller, E. (Hrsg.) Die Republik auf dem Weg<br />
zur Normalität? Opladen: Leske + Budrich, 35 – 66.<br />
Weßels, B. & Wagner, A. (2011). Regionale Differenzierung<br />
des Wahlverhaltens. In Rattinger, H.<br />
et al. (Hrsg.). Zwischen Langeweile und Extremen:<br />
Die <strong>Bundestagswahl</strong> 2009. Baden-Baden: Nomos,<br />
119 – 129.<br />
Münkel, D. (2005). Willy Brandt und die Vierte Gewalt“.<br />
Politik und Massenmedien in den fünfziger bis<br />
siebziger Jahren. Frankfurt am Main: Campus Verlag.<br />
45
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 46<br />
„E-MAIL IST TOTAL 90ER!“<br />
– PERSPEKTIVEN<br />
EINER VERNETZTEN<br />
GESELLSCHAFT<br />
von Prof. Dr. Gesche Joost, Professorin für Designforschung und Mitglied<br />
im Kompetenzteam von Peer Steinbrück für den Bereich Netzpolitik<br />
Wenn sich Kleinkinder heute vor den<br />
heimischen Fernseher stellen und mit<br />
der Wisch-Bewegung, die sie vom<br />
Smartphone kennen, das Programm<br />
wechseln wollen – spätestens dann<br />
wissen wir, dass wir in einer vernetzten<br />
Gesellschaft angekommen sind. An<br />
diesem Bild wird vieles deutlich: Zum<br />
einen, dass die Technik-Nutzung bestimmte<br />
Erwartungen an Logik und<br />
Bedienkomfort weckt – einfache Gesten<br />
werden zum Standard. Die Art<br />
der Nutzung verändert unsere Wahrnehmung<br />
und unsere Erwartungen an<br />
die Welt, die uns umgibt. Wer hat sich<br />
noch nicht intuitiv die „Rückgängig“-<br />
Eingabe gewünscht, wenn der Kaffeebecher<br />
umfiel? Die Nutzung des Computers<br />
in all seinen heutigen Formen<br />
ist kaum mehr aus dem Leben wegzudenken<br />
– beeinflusst sie doch unsere<br />
Art zu kommunizieren, uns zu organisieren<br />
und zu informieren, zu arbeiten<br />
und unsere Freizeit zu gestalten. Zum<br />
anderen wird an dem Bild des Kindes<br />
vor dem Fernseher deutlich, dass die<br />
sogenannte „Generation Y“ der heute<br />
20- bis 30-jährigen, die mit der Nutzung<br />
der digitalen Welt aufgewachsen<br />
sind, zum neuen Standard wird. Ihre<br />
Kinder werden uns fragen, wozu denn<br />
diese runde Scheibe am alten Telefon<br />
gut war. Und sie werden uns fragen,<br />
wie wir uns denn in Zeiten, bevor es<br />
soziale Netzwerke gab, überhaupt verabreden<br />
konnten. „E-Mail ist total<br />
90er!“ – so eine 15-jährige Schülerin in<br />
einem meiner Forschungsprojekte an<br />
der Universität der Künste in Berlin auf<br />
die Frage, welche Medien sie denn<br />
täglich nutzen würde. Dagegen sehen<br />
viele von uns ganz schön alt aus.<br />
Die „Generation Y“ kommuniziert dezentral-vernetzt,<br />
mit vielen gleichzeitig<br />
über Facebook, Twitter & co. Sie sind immer<br />
im Loop der Neuigkeiten. Das ist Mikro-Kommunikation:<br />
schnell, kurz, stän-<br />
46 „E-Mail ist total 90er!“ – Perspektiven einer vernetzten Gesellschaft Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 47<br />
dig. Das sind massive Veränderungen in<br />
unserem Alltag, die besonders viele junge<br />
Menschen betreffen – und die teilweise<br />
von der älteren Generation kaum nachvollzogen<br />
werden. Die Selbstverständlichkeit,<br />
mit der sich junge Menschen heute im<br />
Netz bewegen – always online – ist für<br />
„Offliner“ fremd und ist ein Grund für eine<br />
digitale Spaltung unserer Gesellschaft in<br />
diejenigen, die das Netz als selbstverständliche<br />
Struktur in ihren Alltag integrieren,<br />
und diejenigen, die das Netz selten oder<br />
gar nicht nutzen. Einer solchen Spaltung<br />
müssen wir entgegentreten – denn eine<br />
vernetzte Gesellschaft bietet große Chancen<br />
für alle Bürgerinnen und Bürger, z. B.<br />
auf gute Bildung oder Teilhabe an gesellschaftspolitischen<br />
Debatten. Dabei sollten<br />
wir nicht vergessen: Die Technik-Affinität<br />
und alltägliche Nutzung digitaler Technologien<br />
verläuft nicht entlang der Altersgrenze<br />
der jungen Generation, sondern ist<br />
quer dazu in allen Altersgruppen zu finden<br />
– bis hin zu älteren Menschen, die mehr<br />
und mehr aufgeschlossen und kompetent<br />
neueste Technologien nutzen. Eine Politik<br />
der vernetzten Gesellschaft bezieht sich<br />
daher nicht allein auf eine junge Generation,<br />
sondern knüpft an die alltägliche Erfahrungswelt<br />
aller an.<br />
In der vernetzten Gesellschaft liegt ein<br />
großes Potential für die Zukunft von Wirtschaft,<br />
Kultur, Bildung, Forschung und<br />
Technologie; es bedeutet aber auch Herausforderungen<br />
an die Politik, alle mit an<br />
Bord zu holen. Daher müssen wir immer<br />
wieder Anknüpfungspunkte und Schnittstellen<br />
für Partizipation gestalten. Grundbegriffe<br />
unseres politischen Handelns sind<br />
daher Vernetzung und Teilhabe, die soziale<br />
und technologische Strukturen betreffen.<br />
Welche gesellschaftspolitischen Diskurse<br />
und regierungspolitischen Rahmenbedingungen<br />
müssen wir initiieren, um unsere<br />
Vision einer vernetzten Gesellschaft<br />
zu realisieren? Dazu gehören aktuelle Themen,<br />
etwa die gesetzliche Festschreibung<br />
der Netzneutralität oder die Neuregelung<br />
des Urheberrechts. Aber auch unsere Reaktionen<br />
auf die Schattenseiten der vernetzten<br />
Gesellschaft – wie etwa das Cybermobbing,<br />
dem junge Menschen heute viel<br />
zu oft ausgesetzt sind – entscheiden über<br />
die Wahrnehmung von politischer Kompetenz<br />
in Netzfragen.<br />
Gleichzeitig müssen wir die großen Potentiale<br />
der Vernetzung politisch und gesellschaftlich<br />
ermöglichen:<br />
Open Data und Open Government –<br />
bieten freien Zugang zu öffentlich relevanten<br />
Daten ohne bürokratische Hürden;<br />
die Zukunft der Bürokratie<br />
Open Access – ermöglicht die freie und<br />
direkte Verfügbarkeit wissenschaftlicher<br />
Publikationen; eine Revolution für<br />
die Wissenschaft, die schon vielerorts<br />
begonnen hat.<br />
Open Innovation – initiiert eine offene<br />
Zusammenarbeit an Zukunftsthemen<br />
über die Grenzen von Institutionen<br />
hinweg; die Zukunft des Fortschritts.<br />
Digitale Arbeit<br />
Die „Generation Y“ ist eine der treibenden<br />
Kräfte, um die digitale Revolution<br />
zum Nutzen aller Gesellschaftsschichten<br />
umzusetzen. Sie verändern auch die Arbeitswelt.<br />
Vielfach sind die fachlichen<br />
Qualifikationen dieser Generation hervor-<br />
47
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 48<br />
ragend, sie ist technikaffin sozialisiert und<br />
ihre Vorstellung von einer erfüllenden Arbeit<br />
ist gleichzeitig hoch. Sie verlangt flexible<br />
Arbeitsstrukturen, deren Grundvoraussetzungen<br />
eine ausgewogene Work-Life-<br />
Balance, die Vereinbarkeit von Familie und<br />
Beruf sowie die Möglichkeit der heterogenen<br />
Karrierepfade in unterschiedlichen<br />
Lebensphasen sind (z. B. internationale<br />
Bildungsaufenthalte, private Auszeiten<br />
und „Sabbaticals“). So können Modelle<br />
entstehen, die zu einer nachhaltigen Arbeitskultur<br />
führen – weg von der Burnout-<br />
Falle. Die digital vernetzten Arbeitsstrukturen<br />
ermöglichen hier oftmals insofern<br />
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und<br />
Beruf, als dass das Arbeiten zeitlich und<br />
räumlich unabhängiger wird. Gleichzeitig<br />
müssen jedoch die sozialen Sicherungssysteme<br />
auf diese Flexibilität und Heterogenität<br />
reagieren können. Die Erwerbsbiografien<br />
der jungen Generation sind häufig<br />
durch Diskontinuitäten gekennzeichnet,<br />
durch Praktika und Freelancer-Tätigkeiten,<br />
durch „Auszeiten“ und Neuorientierungen.<br />
Vernetztes Engagement<br />
Diese Generation ist mit den Möglichkeiten<br />
der dezentralen, vernetzten Kommunikation<br />
aufgewachsen und äußert zum<br />
Teil Skepsis gegenüber hierarchischen,<br />
dauerhaften Organisationen wie den politischen<br />
Parteien. Für sie gilt es insbesondere,<br />
Formate der Teilhabe zu schaffen. Ihr<br />
soziales Engagement ist vielfach über digitale<br />
Plattformen und dezentrale Formate<br />
organisiert. Es ist situations- und themenbezogen,<br />
temporär, Community-orientiert<br />
und mit Spaß verbunden. Das Engagement<br />
ist besonders in Großstädten und<br />
Ballungsräumen weniger auf das lokale<br />
Umfeld und die Nachbarschaft bezogen,<br />
sondern kann global vernetzt stattfinden.<br />
Der Erfolg des Engagements wird online<br />
direkt erlebbar gemacht: bei betterplace.org<br />
kann der Nutzer oder die Nutzerin<br />
direkt den Projektfortschritt und damit<br />
virtuell die Wirkung der Spende nachverfolgen,<br />
bei kickstarter.com kann der Nutzende<br />
durch seine (Mini-)Investition<br />
Startups die nötige Starthilfe geben und<br />
sich somit direkt an der Wirtschaftsförderung<br />
beteiligen. Dadurch entsteht eine gemeinsame<br />
Verantwortung und ein gemeinsames<br />
Risiko, das diese Community verbindet.<br />
Diese Art der (digitalen) Schnittstellen<br />
zur aktiven Beteiligung wollen wir<br />
zukünftig verstärkt auch als politisches Instrument<br />
nutzen. Dadurch würde auch der<br />
Begriff des politischen Engagements neu<br />
verhandelt werden. Darüber hinaus ist es<br />
sinnvoll, Schnittstellen und Formate der<br />
Beteiligung weiter zu entwickeln oder neu<br />
zu gestalten, und zwar unter massiver Einbeziehung<br />
der unterschiedlichen Nutzergruppen<br />
und Communities. Nur durch einen<br />
Dialog mit der „Netzgemeinde“ und<br />
der Berücksichtigung der Wissenstands<br />
der netzpolitisch Informierten kann es gelingen,<br />
zu gemeinsamen Schnittstellen und<br />
Formaten zu kommen, die analoges und<br />
digitales, dezentrales und lokales, parteipolitisch<br />
organisiertes und temporär-themenorientiertes<br />
Engagement verbinden.<br />
Ziel unseres politischen Engagements<br />
ist daher eine Haltungsänderung: weg von<br />
der Politikverdrossenheit. Menschen die<br />
Möglichkeit zu geben, sich nach ihren eigenen<br />
Interessen, Fähigkeiten und Möglichkeiten<br />
zu beteiligen, ist eine der wichtigsten<br />
Aufgaben für eine zukunftsfähige<br />
Gesellschaft. Immer weniger junge Menschen<br />
durchlaufen eine parteipolitische So-<br />
48<br />
„E-Mail ist total 90er!“ – Perspektiven einer vernetzten Gesellschaft Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 49<br />
zialisation; sie sind nicht vertraut mit den<br />
lokalen Organisationsstrukturen und traditionellen<br />
Beteiligungsformaten am politischen<br />
Geschehen. Gleichzeitig wächst jedoch<br />
die Nachfrage nach einem individuellen,<br />
sinnvollen sozialen Engagement –<br />
wo kann ich mich beteiligen? Hier müssen<br />
wir Angebote schaffen.<br />
Die „Digitale Revolution“ gestalten<br />
Der Fortschritt digitaler Technologien<br />
birgt ein großes Potential für die Innovationsentwicklung<br />
in Deutschland: es entstehen<br />
neue Produktionsprozesse, die dezentral<br />
vernetzt organisiert sind. So können<br />
beispielsweise Entwürfe von Produkten<br />
über das Netz geteilt, verändert und dezentral<br />
produziert werden – entweder durch<br />
lokale Handwerksbetriebe im traditionellen<br />
Sinne, oder aber durch neue Herstellungsverfahren<br />
wie 3D Druck. Plattformen<br />
wie etsy.com bieten neue Distributionswege<br />
für (kunst-)handwerkliche Produkte in<br />
kleiner Stückzahl, die individuell von Selbständigen<br />
hergestellt und auf der Plattform<br />
kollektiv vertrieben werden, Jovoto.com<br />
bietet die Plattform für kollaborative Projektentwicklungen<br />
weltweit. Hier entstehen<br />
neue Geschäftsmodelle und Produktionsabläufe,<br />
die in Zukunft noch an<br />
Bedeutung gewinnen werden.<br />
Gleichzeitig entwickelt sich rund um<br />
digitale Technologien eine lebendige Startup-Szene,<br />
die besonderer Förderung und<br />
Begleitung bedarf und ein hohes, dynamisches<br />
Innovationspotential hat. Die Struktur<br />
solcher Startups unterscheidet sich<br />
meines Erachtens in vielen Punkten von<br />
denen anderer KMUs: die Zyklen der Unternehmensgründung<br />
und Erfolgsgeschichten<br />
sind häufig wesentlich kürzer,<br />
digitale Produkte sind dezentral herstellbar,<br />
die Finanzierung erfolgt durch Venture<br />
Capital und oftmals gibt es Verbindungen<br />
zur Kreativwirtschaft. Diese hoch<br />
dynamische Startup-Kultur stellt ein zusätzliches<br />
Feld für die Innovationsentwicklung<br />
in Deutschland dar, dem besondere<br />
Aufmerksamkeit gelten muss. Insbesondere<br />
in der Kreativwirtschaft sind die Akteure<br />
als selbständige Kleinstunternehmen<br />
oder Ein-Mann- oder Eine-Frau-Unternehmungen<br />
organisiert und leben leider<br />
genau so häufig in prekären Verhältnissen.<br />
Diese Lebensmodelle müssen in Deutschland<br />
eine bessere Unterstützung erfahren,<br />
so dass sich ihr sozialer Status verbessern<br />
kann, nicht nur da der Kreativwirtschaft in<br />
Deutschland ein hohes Wirtschaftspotential<br />
vorausgesagt wird. Diese Selbständigen<br />
bilden eine eigene Kategorie von Freiberuflern,<br />
die eigene Rahmenbedingungen<br />
brauchen.<br />
Mittelständische Unternehmen müssen<br />
verstärkt dabei unterstützt werden, den<br />
Anschluss an die Digitalisierung zu finden,<br />
wo es sinnvoll und angemessen ist. Die Digitalisierung<br />
von Arbeits-und Produktionsprozessen,<br />
der strategische Einsatz<br />
neuer Technologien und das zugehörige<br />
Know-how sind Zukunftsfaktoren, die es<br />
zu unterstützen gilt.<br />
Die Entwicklung der „Sharing Economy“<br />
bedarf gesonderten Augenmerks, da<br />
sich hier potentiell eine alternative Wirtschaftsform<br />
entwickelt – eine, die auf der<br />
Idee des Teilens statt des Besitzens beruht.<br />
Zum Teil gehen Angebote der Sharing<br />
Economy mit einer Kritik am ungezügelten<br />
Massenkonsum und an der Anhäufung<br />
immer neuer Industrieprodukte einher.<br />
Gleichzeitig entwickeln sich neue Ge-<br />
49
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 50<br />
schäftsmodelle, die zum Teil auf alternativen<br />
(Tausch-)Währungen basieren und der<br />
eine Community zugrunde liegt. Das gemeinsame<br />
Nutzen von Ressourcen, von der<br />
Vermietung der privaten Wohnung auf<br />
Airbnb bis zu Car-Sharing Services, liegt<br />
vielen Angeboten und Plattformen zugrunde.<br />
Diese Community-basierten<br />
Dienstleistungen haben ein großes Zukunftspotential<br />
und integrieren zum Teil<br />
nicht-kommerzielle Formen des sozialen<br />
Engagements und der gesellschaftspolitischen<br />
Positionierung (z. B. Food-Sharing<br />
Services, FixMyStreet, Adopt-a-Hydrant).<br />
Potentiale vernetzter Bildung<br />
Die Vernetzung von Schulen und<br />
Hochschulen über das Internet bietet die<br />
Möglichkeit, Bildungsangebote strukturell<br />
zu erweitern. Schulen stellen auf digitale<br />
Lehrinhalte um und bringen Schülerinnen<br />
und Schülern bei, wie sie das Netz zur Informationssuche<br />
effizient nutzen können.<br />
Universitäten weltweit nutzen das Netz,<br />
um ihre Lehrangebote global zu Verfügung<br />
zu stellen und damit den Zugang jenseits<br />
lokaler Grenzen, kultureller und sozialer<br />
Rahmenbedingungen zu ermöglichen.<br />
MOOCs (massive open online courses)<br />
sind die Online-Formate, die interaktive<br />
Lerninhalte im Netz abbilden und die auch<br />
in Deutschland an einigen Universitäten<br />
bereits etabliert wurden. Das führt zu einer<br />
neuen Durchlässigkeit des Bildungssystems,<br />
so dass auch sozial schwachen<br />
Schichten oder Menschen, die außerhalb<br />
von Universitätsstädten leben, die Option<br />
geboten wird, an Lerninhalten zu partizipieren<br />
und sich weiterzubilden. Der Zugang<br />
zu Universitäten wird damit erweitert,<br />
gleichzeitig müssen sie sich aber auch<br />
neu positionieren und ihr Alleinstellungsmerkmal<br />
als Bildungseinrichtung behaupten.<br />
Eine Differenzierung wird damit einhergehen<br />
können und müssen. Der Diskurs<br />
mit den akademischen Einrichtungen<br />
im nationalen wie internationalen Kontext<br />
muss daher intensiviert werden, in den<br />
auch „Bildungsnehmer“ eingebunden werden.<br />
Eines der zentralen Ziele der SPD ist<br />
es, eine bessere Durchlässigkeit des Bildungssystems<br />
zu ermöglichen. Die Barriere<br />
der sozialen Herkunft kann durch vernetzte<br />
Bildung gemindert werden. Aufgabe<br />
unserer Gesellschaft ist es daher, Medienkompetenz<br />
zu vermitteln und den Zugang<br />
zum Internet auf breiter Basis zu ermöglichen.<br />
Um diese Potentiale einer vernetzten<br />
Gesellschaft umsetzen zu können, bedarf<br />
es zunächst der grundlegenden digitalen<br />
Infrastruktur: den Zugang zum Netz. Der<br />
Breitbandausbau ist daher eines der vorrangigen<br />
politischen Ziele, um auch ländliche<br />
Regionen Deutschlands einzubeziehen<br />
– denn gerade hier können die Vorteile der<br />
digitalen Arbeit, Bildung und politischen<br />
Partizipation zum Standortvorteil werden.<br />
Neben diesen ganz konkreten Vorhaben<br />
geht es aber darüber hinaus auch darum,<br />
den gesellschaftspolitischen Diskurs zur<br />
vernetzten Gesellschaft zu intensivieren.<br />
Dies wird gerade vor dem Hintergrund der<br />
jüngsten Datenskandale um PRISM und<br />
TEMPORA eklatant deutlich – mit den<br />
Enthüllungen ging ein massiver Vertrauensverlust<br />
der Bürgerinnen und Bürger in<br />
das Netz einher. Daher ist die Debatte um<br />
Bürgerrechte und den Schutz privater Daten<br />
dringend notwendig, gekoppelt mit einem<br />
massiven Eintreten von politischer<br />
Seite, um für ein freies und offenes Netz in<br />
50 „E-Mail ist total 90er!“ – Perspektiven einer vernetzten Gesellschaft Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 51<br />
Europa und weltweit einzutreten. Die<br />
Möglichkeiten einer vernetzten Gesellschaft<br />
sind immens – wir müssen sie gesellschaftlich<br />
und politisch wach und vorausschauend<br />
begleiten. l<br />
51
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 52<br />
HOLT DEUTSCHLAND<br />
VON DER INSEL!<br />
ANTWORTEN DER SPD<br />
AUF DIE KRISE DER<br />
EURO ZONE: WAS LEIS -<br />
TET DAS REGIERUNGS-<br />
PROGRAMM?<br />
von Dr. Björn Hacker, stellvertretender Vorsitzender des Fachausschusses Europa der<br />
SPD Berlin und Referent in der Friederich-Ebert-Stiftung<br />
Betrachtet man die vergangenen über<br />
drei Jahre Krisenmanagement in der<br />
Eurozone, erkennt man eine erstaunliche<br />
Inselposition Deutschlands. Hier<br />
wurde wie in kaum einem anderen<br />
Land der systemische Charakter der<br />
Krise zu spät, bei einigen Akteuren bis<br />
heute gar nicht erkannt. Hier verfing<br />
das populistische und falsche Bild der<br />
angeblich faulen Südeuropäer, die<br />
über ihre Verhältnisse gelebt und so<br />
eine Staatsschuldenkrise verursacht<br />
hätten. Und hier gefällt man sich in<br />
der Rolle einer Nation, deren relative<br />
wirtschaftliche Stärke auf marktliberale<br />
Reformpolitiken der jüngeren Vergangenheit<br />
zurückzuführen sei, die man<br />
nun mit erhobenem Zeigefinger anderen<br />
Mitgliedstaaten als best practice<br />
andienen kann.<br />
Die Hauptverantwortung für den so<br />
beschriebenen Kurs aus falschem Krisenverständnis,<br />
einseitigen Schuldzuweisungen<br />
und selbstgefälligem Sendungsbedürfnis<br />
ist der Deutschen Bundesregierung<br />
zuzuschreiben. Sie hat 2010 die Krise als<br />
„griechisches Problem“ verharmlost, die<br />
schließlich unumgängliche Reaktion einer<br />
Refinanzierungshilfe nur lavierend und mit<br />
harten Konditionen der Austerität belegt<br />
zugestanden und zeitgleich die deutsche<br />
Mitverantwortung umgedeutet in die Geschichte<br />
eines Erfolgsmodells. Diese sehr<br />
52<br />
Holt Deutschland von der Insel! Antworten der SPD auf die Krise der Eurozone:<br />
Was leistet das Regierungsprogramm? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 53<br />
deutsche Erzählung des Krisenhergangs<br />
und eines alternativlosen Rezepts zu ihrer<br />
Überwindung wurde der Bundesregierung<br />
aber von weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit<br />
abgekauft. Die Inselposition<br />
Deutschlands in der Krise erklärt sich<br />
durch eine breite institutionelle und gesellschaftliche<br />
Unterstützung des hier skizzierten<br />
Krisengeschehens. Nur so konnte<br />
dieser Blick auf die Krise Dominanz im<br />
deutschen Diskursraum erlangen und<br />
maßgeblich die europäische Krisenpolitik<br />
beeinflussen.<br />
Akteure des dominierenden<br />
Krisendiskurses<br />
Zu den einflussreichen Akteuren in der<br />
Diffusion dieses Weltbilds gehört eine<br />
Mehrheit deutscher Ökonomen, die auch<br />
nach dem Fall von Lehman Brothers und<br />
der globalen Finanzkrise an die Selbstregulierungskräfte<br />
des freien Marktes glaubt.<br />
Während man außerhalb der deutschen<br />
Grenzen keine Neo-Keynesianer aufspüren<br />
muss, um Bewegung in der Zunft der<br />
Volkswirte im Sinne eines New Economic<br />
Thinking feststellen zu können, bleiben die<br />
deutschen Kolleginnen und Kollegen<br />
größtenteils in der Neoklassik verhaftet.<br />
Hier glaubt man daran, dass Staaten sich<br />
aus einer Rezession heraussparen können<br />
und wenn Defizite in der Architektur der<br />
Währungsunion zugestanden werden, so<br />
wird über mangelnde Wettbewerbsfähigkeit,<br />
Arbeitsmarktrigiditäten und laxe<br />
Haushaltsführung lamentiert.<br />
Auch die deutschen Medien tragen<br />
Verantwortung für die Festigung eines sehr<br />
spezifischen Blicks auf die Krise. Dies lag<br />
und liegt teilweise an einer offensichtlichen<br />
Überforderung politischer Journalistinnen<br />
und Journalisten, die komplexen ökonomischen<br />
Sachverhalte verstehen und bewerten<br />
zu können. Oft erschien es wohl einfacher,<br />
die auf Brüsseler Krisengipfeln<br />
produzierten Scheinlösungen als Erfolge<br />
darzustellen, als sie kritisch auseinanderzunehmen<br />
und zu hinterfragen. Und jene<br />
Journalistinnen und Journalisten, die sich<br />
seit Jahren in den Wirtschaftsredaktionen<br />
mit der Thematik beschäftigen, sind in<br />
Deutschland mehrheitlich von einer mikroökonomischen,<br />
betrieblichen Sicht auf<br />
die Dinge geprägt, wohingegen – die in<br />
dieser Krise ungleich relevanteren – makroökonomischen<br />
Zusammenhänge und<br />
Kreisläufe nur von einigen wenigen ins<br />
Feld geführt werden. Gravierender allerdings<br />
als journalistische Versäumnisse zu<br />
einem mehrdimensionalen Krisenverständnis<br />
ist der ebenfalls beobachtbare affirmative<br />
Journalismus jener Medienvertreterinnen<br />
und -vertreter, die aus der Krise<br />
einen Gegensatz von Staaten, politischen<br />
Grundannahmen und Kulturen herbeischreiben.<br />
Die solventen Länder des Nordens<br />
gegen die klammen Staaten des Südens<br />
in Europa auszuspielen, nützt in einer<br />
gemeinsamen Währungsunion wirtschaftlich<br />
niemandem und ist schädlich für das<br />
politische Klima. Und wenn Journalistinnen<br />
und Journalisten sich zur Verteidigung<br />
deutscher Interessen gegenüber anderen<br />
Staaten aufschwingen, muss gefragt werden,<br />
ob sie das Gemeinwohl noch im Blick<br />
haben oder billiger Stimmungsmache<br />
durch Bedienung altgedienter Klischees<br />
erliegen.<br />
Die Opposition in der Krise<br />
Wenn die Regierung und die sie stützende<br />
schwarz-gelbe Koalition zusammen<br />
mit dem Gros der zur Krisenanalyse rele-<br />
53
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 54<br />
vanten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
und der Mehrheit der deutschen<br />
Medienvertreterinnen und -vertreter auf<br />
der Insel sitzt, bleibt noch der Blick auf die<br />
parlamentarische Opposition und hier insbesondere<br />
auf die größte Oppositionspartei,<br />
die Sozialdemokratie. Und auch hier<br />
muss konstatiert werden, dass eine alternative<br />
Erzählung zum öffentlich dominierenden<br />
Krisendiskurs es lange sehr schwer<br />
hatte durchzudringen. Die SPD hat zwar<br />
seit Beginn der Krise einen umfangreichen<br />
Fundus an alternativen Konzepten zu ihrer<br />
Überwindung erstellt, kontrovers diskutiert,<br />
mit den europäischen Schwesterparteien<br />
abgestimmt und bis zur baldigen Regierungsübernahme<br />
archiviert. Aber die<br />
Partei zuckte jedes Mal zusammen (und<br />
zurück), wenn es um die deutschen Haftungssummen,<br />
wenn es um die Kosten der<br />
Rettungspolitik für den „deutschen Steuerzahler“<br />
– wie es die Medien plakativ nennen<br />
– ging. Aufgestellte Gegenpositionen<br />
zum Krisenmanagement der Regierung<br />
wurden dann häufig revidiert. In der Bilanz<br />
zeigte sich die größte Oppositionspartei in<br />
der Krise so als tastend, vorsichtig, letztlich<br />
unentschlossen. Dem gegenüber erscheint<br />
die blind durch die Krise tapsende Regierungskoalition<br />
in der Öffentlichkeit plötzlich<br />
als entschieden, ihre verfehlte Europapolitik<br />
als geradlinig und vertrauenswürdig.<br />
Schlimmer noch als die Angst vor<br />
dem Gegenwind der Öffentlichkeit beim<br />
Beziehen unorthodoxer Positionen: Inhaltlich<br />
ist der Glaube an den Staat<br />
als –„schwäbische Hausfrau“, an das Sparund<br />
Konsolidierungsmantra, das zwischenstaatliche<br />
Wettbewerbsprinzip und<br />
Wirtschaftswachstum infolge sozialer Entschlackung<br />
auch im linken politischen Lager<br />
fest etabliert worden. Der Neoliberalismus<br />
in den Köpfen ist – trotz Finanzkrise –<br />
längst nicht durch ein neues Narrativ ersetzt.<br />
Drei Baustellen Europas<br />
Umso wichtiger ist die klare Positionierung<br />
der SPD im Wahlkampf. Das Regierungsprogramm<br />
<strong>2013</strong> – 2017 spricht in<br />
unmissverständlicher Diktion die drei<br />
wichtigsten Baustellen des europäischen<br />
Integrationsprozesses an:<br />
Ökonomisch mit der Forderung nach einer<br />
gemeinsam gestalteten Wirtschaftspolitik<br />
der Euro-Länder in Form einer europäischen<br />
Wirtschaftsregierung. Hier sollen<br />
die wirtschaftlichen Ungleichgewichte<br />
frühzeitig erkannt und austariert werden.<br />
Als konkretes Instrument soll ein europäischer<br />
Schuldentilgungsfonds eingerichtet<br />
werden, der ein gemeinsames Schuldenmanagement<br />
ermöglicht und die Staaten<br />
von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit.<br />
Das Wahlprogramm steht zu den strengen<br />
Auflagen für die Steigerung nationaler<br />
Haushaltsdisziplin, stellt aber fest, dass<br />
nun auch eine gemeinsame Haftung „kein<br />
Tabu“ mehr bleiben dürfe (S. 105). Ein<br />
deutliches Bekenntnis zur in der EU angestrebten<br />
Bankenunion wird abgelegt, das<br />
eine gemeinsame Bankenaufsicht und europäische<br />
Abwicklungsregeln einschließlich<br />
eines Restrukturierungsfonds umfasst.<br />
Ein zentraler Punkt ist die Forderung nach<br />
einer europäischen Wachstumsstrategie,<br />
„die wirtschaftliche Innovation mit sozialer<br />
Gerechtigkeit und ökologischer Erneuerung<br />
zusammenbringt“ (S. 26). Durch die<br />
konkreten Maßnahmen der Vermögensbesteuerung,<br />
der Ausgabe von Projektanleihen,<br />
der Umschichtung von Strukturfondsmitteln,<br />
der Aufwertung der<br />
Europäischen Investitionsbank und aus<br />
54<br />
Holt Deutschland von der Insel! Antworten der SPD auf die Krise der Eurozone:<br />
Was leistet das Regierungsprogramm? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 55<br />
Mitteln der Finanztransaktionssteuer soll<br />
ein europäischer Investitions- und Aufbaufonds<br />
gespeist werden. Mit diesem sollen<br />
zum einen akute Probleme wie etwa die<br />
hohe Jugendarbeitslosigkeit angegangen<br />
werden, zum anderen Investitionen in die<br />
Zukunft, in Bildung, Forschung und Infrastruktur<br />
ermöglicht werden. Für den gemeinsamen<br />
Binnenmarkt soll die Steuerharmonisierung<br />
vorangetrieben werden<br />
durch verbindliche Steuer-Mindeststandards<br />
für Unternehmensgewinne und Kapitaleinkommen.<br />
Steuerhinterziehung und<br />
unfairer Steuerwettbewerb sollen unterbunden<br />
werden.<br />
Sozialpolitisch wird zentral die Ermöglichung<br />
einer europäischen Sozialunion gefordert,<br />
die auf den sozialen Rechten der<br />
EU-Grundrechtecharta basiert. Mit einer<br />
sozialen Fortschrittsklausel in den Verträgen<br />
soll festgeschrieben werden, dass soziale<br />
Grundrechte nicht den Freiheiten des<br />
Binnenmarktes untergeordnet werden dürfen:<br />
„In Europa muss gelten: gleiche Lohnund<br />
Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit<br />
am gleichen Ort“ (S. 105). Besonders geschützt<br />
vor marktlichen Eingriffen werden<br />
soll die öffentliche Daseinsvorsorge, etwa<br />
durch die Ablehnung eines Privatisierungszwangs<br />
öffentlicher Unternehmen.<br />
Die Sozialsysteme der Einzelstaaten sollen<br />
nicht vereinheitlicht werden, aber gemeinsame<br />
Standardsetzung soll Dumpingprozesse<br />
unterbinden. Dafür wird ein Sozialer<br />
Stabilitätspakt vorgeschlagen, der konkrete<br />
Ziele und Vorgaben für die Höhe nationaler<br />
Sozial- und Bildungsausgaben entsprechend<br />
der jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklung<br />
ebenso enthält, wie die<br />
Verpflichtung zur Einführung existenzsichernder<br />
Mindestlöhne in allen EU-Staaten,<br />
gemessen am jeweiligen nationalen<br />
Durchschnittseinkommen. Darüber hinaus<br />
soll die Wirtschaftsdemokratie auf europäischer<br />
Ebene durch Erweiterung der<br />
Spielräume für Mitbestimmung, Betriebsräte<br />
und sozialen Dialog ausgebaut werden.<br />
Demokratischer werden soll die EU, indem<br />
schrittweise das nationale Modell der<br />
Gewaltenteilung auf die transnationale<br />
Ebene übertragen wird. Bereits zur Europawahl<br />
2014 soll eine gemeinsame Spitzenkandidatin<br />
bzw. ein gemeinsamer Spitzenkandidat<br />
in allen EU-Ländern für die<br />
jeweiligen Parteifamilien antreten. Die<br />
Mehrheitsfraktion im Europäischen Parlament<br />
soll diesen dann zum Präsidenten der<br />
Europäischen Kommission wählen. „Der<br />
nächste Europawahlkampf kann in seiner<br />
neuen Form bereits der Anfang einer umfassenden<br />
Debatte über die Richtung der<br />
EU sein“ (S. 106). Auch die vorgeschlagene<br />
europäische Wirtschaftsregierung soll<br />
parlamentarisch kontrolliert sein. Langfristig<br />
soll die Kommission zu einer europäischen<br />
Regierung ausgebaut werden, die<br />
vom Europäischen Parlament gewählt und<br />
kontrolliert wird. Der Rat soll dann als eine<br />
zweite Kammer fungieren, der Gesetze<br />
gleichberechtigt mit dem Europäischen<br />
Parlament beschließt. Überprüfen will die<br />
SPD die Kompetenzverteilung zwischen<br />
EU und Mitgliedstaaten auf der Grundlage<br />
des Subsidiaritätsprinzips. Bevor ein<br />
Konvent vertragliche Reformschritte ausarbeitet,<br />
sollen alle Spielräume der bestehenden<br />
Verträge ausgeschöpft werden.<br />
Was fehlt?<br />
An einigen Stellen hätte man sich die<br />
Formulierung des Alternativprogramms<br />
zum derzeitigen Krisenmanagement noch<br />
55
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 56<br />
mutiger und im Detail konkreter gewünscht.<br />
Eurobonds scheinen als Begriff<br />
für gemeinschaftliche Anleihen verbrannt,<br />
weniger nötig sind sie dennoch nicht. Immer<br />
wieder wird in das Programm eingeflochten,<br />
dass man zu den verabredeten<br />
strengen budgetären Auflagen in der neuen<br />
Struktur der Wirtschaftsgovernance steht;<br />
Solidarität dürfe keine Einbahnstraße sein,<br />
„sondern muss an Anstrengungen der Krisenstaaten<br />
für tragfähige Haushalte geknüpft<br />
sein“ (S. 26). Hier wäre es angebracht,<br />
über neue Formen der Solidarität<br />
und Reformverbindlichkeit nachzudenken,<br />
etwa durch eine Abkehr vom bestrafenden<br />
Charakter europäischer Regelwerke und<br />
Sanktionen hin zu einem belohnenden und<br />
antizyklisch funktionierendem System, wie<br />
es etwa eine Fiskalkapazität für die Eurozone<br />
ermöglichen könnte. Während die<br />
Maßnahmen für die Stärkung der sozialen<br />
Dimension umfassend dargestellt und vorstellbar<br />
sind, bleibt die geforderte europäische<br />
Wirtschaftsregierung ebenso im nebulösen<br />
wie die Ermöglichung einer<br />
europäischen Vermögensbesteuerung zur<br />
anteiligen Finanzierung des europäischen<br />
Investitions- und Aufbaufonds. Denkbar<br />
wäre hier eine Übernahme des detailliert<br />
berechneten Marshallplans des Deutschen<br />
Gewerkschaftsbundes gewesen. Ähnlich<br />
unklar ist die Einsatzbereitschaft eines Restrukturierungsfonds<br />
für Banken, der<br />
durch eine Bankenabgabe finanziert werden<br />
soll. Diese Passage deutet ebenso wie<br />
die zurückhaltenden Formulierungen für<br />
die europäische Bankenaufsicht (nur große<br />
Banken) und den Verzicht auf Forderungen<br />
zur Einlagensicherung auf eine im<br />
Hintergrund weiter mitschwingende<br />
Angst der SPD vor möglichen Transferzahlungen<br />
Deutschlands an andere Staaten<br />
der Währungsunion hin. Dies steht im<br />
Widerspruch zum klaren Bekenntnis zum<br />
Erhalt der Währungsunion und der Zustimmung<br />
zu einer Haftungsgemeinschaft.<br />
Im Hinblick auf die Stärkung der demokratischen<br />
Legitimation fokussiert das<br />
Wahlprogramm mit der Europawahl auf<br />
die kurze und mit der europäischen Gewaltenteilung<br />
auf die lange Frist. Wie sich<br />
in der mittleren Frist eine „parlamentarisch<br />
kontrollierte Wirtschaftsregierung“ (S.<br />
105) umsetzen lässt, wird dagegen nicht<br />
näher erörtert. Wegweisend könnten in<br />
diesem Zusammenhang Überlegungen zur<br />
Zusammenarbeit der nationalen Parlamente<br />
mit dem Europäischen Parlament,<br />
unter Umständen auch im Rahmen eines<br />
sog. Euro-Parlaments sein.<br />
Paradigmenwechsel für ein soziales<br />
und demokratisches Europa<br />
Insgesamt überzeugt der Europateil des<br />
Regierungsprogramms durch die Benennung<br />
der Versäumnisse und Leerstellen im<br />
vorherrschenden Krisenmanagement, das<br />
unmissverständliche Bekenntnis zu einer<br />
Vertiefung der europäischen Integration<br />
und der Betonung des sozialen Charakters<br />
künftig zu ergreifender Maßnahmen. Normativ<br />
wird hier ein Wechsel von einer primär<br />
auf Währungspolitik und Wettbewerb<br />
gegründeten Gemeinschaft zu einer politischen<br />
Union im Sinne einer erneuerten sozialen<br />
Marktwirtschaft in Europa angekündigt.<br />
Dies ist der Paradigmenwechsel,<br />
den die EU dringend benötigt. Nur wenn<br />
den Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit<br />
über die Gründe der Krise in einem<br />
unvollständigen und einseitig auf die Erweiterung<br />
des Marktes ausgerichteten Integrationsgebäude<br />
erklärt werden, kann<br />
eine ehrliche Debatte um die richtigen Lö-<br />
56<br />
Holt Deutschland von der Insel! Antworten der SPD auf die Krise der Eurozone:<br />
Was leistet das Regierungsprogramm? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 57<br />
sungen zu ihrer Überwindung geführt werden.<br />
Nur wenn die in Brüsseler Krisengipfeln<br />
produzierten Scheinlösungen ins rechte<br />
Licht gerückt werden und die<br />
Mitverantwortung Deutschlands am Entstehen<br />
der Krise, etwa durch Jahre der<br />
lohnpolitischen Zurückhaltung, thematisiert<br />
wird, kann ein symmetrischer Anpassungsprozess<br />
begonnen werden. Nur wenn<br />
der Glaube an die Selbstregulierungskräfte<br />
des freien Marktes und das Austeritätsdogma<br />
als Erfolgskonzept ersetzt werden<br />
durch eine rahmende und regulierende politische<br />
sowie sozial schützende Hand und<br />
Investitionsimpulse ermöglicht werden,<br />
wird es gelingen aus der Krise herauszuwachsen<br />
und das europäische Sozialmodell<br />
zu festigen.<br />
Ein Wahlprogramm muss und kann<br />
nicht alle offenen Fragen beantworten.<br />
Wichtig erscheint vor allem, dass die an einigen<br />
Stellen sich noch bemerkbar machende<br />
Angst vor einem alternativen Politikangebot<br />
zugunsten des enthaltenen<br />
mutigen Bekenntnisses „für ein besseres<br />
Europa“ (S. 103) schwindet. Eine alternative<br />
Politik wird stets mit dem Mainstream<br />
anecken und von zögerlichen Reaktionen<br />
auf den Marktplätzen der Republik, Kritik<br />
in den Medien und schwankenden Umfragewerten<br />
begleitet sein. Hannelore Kraft<br />
hat in Nordrhein-Westfalen bewiesen, wie<br />
man in Wahlen mit einer Akzentverschiebung<br />
vom unbedingten Kürzungsprogramm<br />
hin zur Konsolidierung mit Augenmaß<br />
durch Investitionen in die<br />
Zukunft bei den Wählerinnen und Wählern<br />
punkten kann. Diese Chance gilt es für<br />
Europa zu nutzen, indem Deutschland von<br />
seiner zunehmend einsamen Inselposition<br />
befreit wird. l<br />
57
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 58<br />
UMSTEUERN<br />
FÜR BILDUNG UND<br />
GERECHTIGKEIT<br />
von Dr. Carsten Sieling, MdB<br />
Hunderte junge Menschen aus ganz<br />
Europa – unter ihnen viele <strong>Jusos</strong> –<br />
protestieren Anfang Juli dieses Jahres<br />
zusammen mit Sigmar Gabriel vor<br />
dem Bundeskanzleramt gegen Angela<br />
Merkels Tatenlosigkeit bei der Bekämpfung<br />
der europaweiten Jugendarbeitslosigkeit.<br />
Anstatt die dramatische Lage von Millionen<br />
junger Europäerinnen und Europäer<br />
zu verbessern, flüchtet sich<br />
Merkel in abstrakte Gesten und Gipfelshows,<br />
während sich Europa nach<br />
fast vier Jahren „Deutschunterricht“<br />
kaputtspart. Deutschland dagegen<br />
eine Insel der Glückseligen? Griechenland,<br />
Spanien und selbst Frankreich:<br />
Weit weg? Im Gegenteil: Die Bröckelrepublik<br />
Deutschland ist längst Realität.<br />
I. Wo wir herkommen<br />
Die verfehlte Finanz- und Steuerpolitik<br />
der schwarz-gelben Bundesregierung,<br />
begleitet von konjunkturbedingten Einnahmeausfällen,<br />
hat die Handlungsfähigkeit<br />
des Bundes, der Länder und der Kommunen<br />
in Deutschland massiv geschwächt.<br />
Die Hoffnung, dass durch Steuersenkungen<br />
und staatliche Ausgabenkürzungen<br />
Wachstum und Beschäftigung zunehmen,<br />
hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die<br />
Finanzbasis der öffentlichen Haushalte in<br />
Deutschland erodiert zunehmend, die Verschuldung<br />
wächst bis zur drohenden<br />
Handlungsunfähigkeit, überall fehlt das<br />
nötige Geld für Bildung, Infrastruktur,<br />
ökologische Modernisierung und zur Finanzierung<br />
des Sozialstaats. Die Ungerechtigkeit<br />
in der Verteilung hat deutlich<br />
zugenommen: Die unteren und mittleren<br />
Einkommen sind zu stark belastet; die Reichen<br />
werden geschont. Mit anderen Worten:<br />
Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands<br />
ist gefährdet!<br />
Während der Staat in den letzten Jahren<br />
immer ärmer geworden ist, hat sich das<br />
private Vermögen in Deutschland vervielfacht.<br />
Immerhin Einzug in den Entwurf<br />
des vierten Armuts- und Reichtumsberichts<br />
der Bundesregierung hat die Tatsache<br />
gefunden, dass das Nettovermögen des<br />
deutschen Staates zwischen Anfang 1992<br />
58 Umsteuern für Bildung und Gerechtigkeit Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 59<br />
und Anfang 2012 um über 800 Milliarden<br />
Euro zurückgegangen ist. Gleichzeitig hat<br />
sich das Nettovermögen der privaten<br />
Haushalte von knapp 4,6 auf rund 10 Billionen<br />
Euro mehr als verdoppelt. Auch die<br />
internationale Finanzkrise hat diesen<br />
Trend nicht gestoppt, sondern eher verschärft.<br />
So kam es u. a. durch die staatlichen<br />
Rettungsmaßnahmen zu einer Verschiebung<br />
privater Forderungen und<br />
Verbindlichkeiten in staatliche Bilanzen,<br />
wodurch sich das private Nettovermögen<br />
zeitgleich zum Anstieg der Staatsverschuldung<br />
allein zwischen 2007 und 2012 um<br />
1400 Milliarden Euro erhöht hat.<br />
Angesichts von Steuereinnahmen von<br />
insgesamt über 600 Milliarden Euro in<br />
diesem Jahr scheinen die Befürworter von<br />
Steuersenkungen wieder an Zuspruch zu<br />
gewinnen, als hätte es die internationale<br />
Finanzkrise und die damit einhergehenden<br />
milliardenschweren Konjunktur- und Bankenrettungspakete<br />
nicht gegeben. Auch in<br />
der medialen Berichterstattung hat man<br />
den Anstieg der Steuereinnahmen euphorisch<br />
zur Kenntnis genommen.<br />
Mit Superlativen wie Rekordsteuereinnahmen<br />
wird hierbei der Eindruck erweckt,<br />
der Staat würde Bürgerinnen und<br />
Bürger inzwischen über Gebühr belasten.<br />
Lassen wir uns nicht täuschen! So erfreulich<br />
das gestiegene Aufkommen auch sein<br />
mag. Dieses Bild ist falsch. Denn erstens<br />
liegt das Steueraufkommen tatsächlich<br />
noch ca. 40 Milliarden Euro unter dem vor<br />
der Krise 2008/2009 für das Jahr 2012 veranschlagten<br />
Wert. Ohne die Krise wären<br />
die Steuereinnahmen deutlich höher ausgefallen.<br />
Zweitens deuten die Schätzungen<br />
für 2014 bereits an, dass sich die Aufkommensgewinne<br />
nicht wiederholen. Schließlich<br />
sind Superlative wie Rekordsteuereinnahmen<br />
in der Regel wenig aussagekräftig.<br />
Das Institut für Makroökonomie und<br />
Konjunkturforschung (IMK) weist in seiner<br />
Steuerschätzung 2012 – 2016 richtigerweise<br />
darauf hin, dass die bundesrepublikanische<br />
Steuergeschichte allein in 52<br />
von 61 Jahren Rekordeinnahmen verzeichnen<br />
konnte, was in einer nominal wachsenden<br />
Wirtschaft durchaus folgerichtig ist.<br />
Tatsächlich dürfte die gesamtwirtschaftliche<br />
Steuerquote <strong>2013</strong> nach den aktuellen<br />
Konjunkturprognosen bei gut 23 Prozent<br />
des Bruttoinlandsprodukts liegen. Das ist<br />
nicht mehr als in der Vergangenheit und<br />
im internationalen Vergleich eher niedrig.<br />
Dem internationalen Steuerwettbewerb<br />
folgend sind unter anderem die Steuersätze<br />
in Deutschland gesunken. Zahlreiche<br />
Steuerreformen zugunsten von<br />
Unternehmen, Vermögensmillionären und<br />
Beziehern hoher Einkommen haben dabei<br />
in der Folge nicht etwa zu mehr Steuergerechtigkeit<br />
und einem Anstieg auskömmlicher<br />
Arbeitsverhältnisse geführt, sondern<br />
stattdessen kumulierte Steuerausfälle in<br />
Höhe von mehreren hundert Milliarden<br />
Euro verursacht. Ohne die Steuersenkungen<br />
hätten Bund, Länder und Kommunen<br />
wesentlich mehr Geld in ihren Kassen,<br />
müssten deutlich weniger Kredite aufnehmen<br />
und hätten damit im Ergebnis eine<br />
niedrigere Zinslast zu tragen.<br />
Dies hat nicht nur zu einem ganz erheblichen<br />
Modernisierungs- und Sanierungsbedarf<br />
geführt, der allein im kommunalen<br />
Bereich auf rund 700 Milliarden<br />
Euro bis zum Jahr 2020 beziffert wird, sondern<br />
ebenfalls zu einem ungesunden Privatisierungsdruck,<br />
der weder zu einer merklichen<br />
Verbesserung bei der öffentlichen<br />
59
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 60<br />
Daseinsvorsorge noch zu einer Lösung der<br />
strukturellen Unterfinanzierung der öffentlichen<br />
Haushalte geführt hat. Im Gegenteil:<br />
Die Verschuldung der Kommunen<br />
hat sich in den Jahren nach der Finanzkrise<br />
noch einmal deutlich verschärft, und<br />
seitdem Jahr 2000 sogar versechsfacht.<br />
Während die Kreditmarktschulden häufig<br />
unverändert blieben, stieg der Umfang der<br />
Kassenkredite der Gemeinden und Gemeindeverbände<br />
seit 2002 von 10,7 Milliarden<br />
Euro kontinuierlich auf über 44 Milliarden<br />
Euro. Kassenkredite, die eigentlich<br />
nur der kurzfristigen Überbrückung von<br />
Liquiditätsengpässen dienen sollen, sind<br />
damit faktisch längst zu einem Instrument<br />
kommunalen Schuldenmanagements geworden.<br />
Nimmt man diese Entwicklungen auf<br />
der Einnahmen- und Ausgabenseite ernst,<br />
liegt der Schluss nahe, dass nicht die Ausgaben<br />
zu hoch, sondern die Einnahmebasis<br />
für die als notwendig erachteten öffentlichen<br />
Aufgaben zu niedrig sind. Bis 2016<br />
sieht der Bundeshaushalt keine Nettokreditaufnahme<br />
mehr vor. Entsprechend wird<br />
man die Frage beantworten müssen, ob<br />
und wie lange es noch möglich ist, auf<br />
wichtige staatliche Einnahmen zu verzichten,<br />
ohne in Zukunft gegen die Vorgaben<br />
der grundgesetzlichen Schuldenbremse zu<br />
verstoßen.<br />
II. Für eine gerechte Steuerpolitik<br />
Steuer- und Finanzpolitik hat eine dienende<br />
Funktion für die Erfüllung der zentralen<br />
Aufgaben unseres Gemeinwesens.<br />
Sie ist weder Selbstzweck noch darf sie<br />
starken Gruppen und Eliten der Gesellschaft<br />
außerordentliche Vorteile verschaffen.<br />
Die Hoffnung, durch Steuersenkungen<br />
und staatliche Ausgabenkürzung mehr<br />
Wachstum und Beschäftigung zu generieren,<br />
hat sich nicht erfüllt. Die Wahrheit ist:<br />
Chancen zur Finanzierung der notwendigen<br />
Zukunftsinvestitionen in Bildung, Infrastruktur,<br />
ökologische Modernisierung<br />
und zur Finanzierung des Sozialstaats wurden<br />
vergeben.<br />
Nach Jahrzehnten einseitig marktorientierter<br />
Politik geht es in den nächsten<br />
Jahren um die Stärkung von Bildung, des<br />
Gemeinwesens, der Infrastrukturen und<br />
sozialstaatlichen Aufgaben. Die zentrale<br />
Aufgabe zukunftsgerichteter deutscher Politik<br />
liegt daher in der Wiederherstellung<br />
der finanziellen Stabilität durch Entschuldung<br />
sowie in einer nachhaltigen wirtschaftlichen<br />
und ökologischen Modernisierung<br />
auf Grundlage einer gerechten<br />
Gesellschaft. Die Stärkung der Handlungsfähigkeit<br />
von Staat und Kommunen<br />
dient damit vor allem auch den Menschen,<br />
die durch geringes Einkommen und eingeschränkte<br />
Teilhabechancen in Arbeit und<br />
Bildung besonders auf staatliche Hilfen<br />
angewiesen sind: Denn nur Reiche können<br />
sich einen armen Staat leisten. Hier setzt<br />
unser Konzept an.<br />
1. Reform der Einkommensteuer<br />
Wir müssen die Fehlentwicklung bei<br />
der personellen Einkommenverteilung<br />
aufhalten. Denn nicht nur bei den Vermögen,<br />
sondern auch bei den Einkommen hat<br />
die Spreizung im internationalen Vergleich<br />
stark zugenommen, da einerseits die Gehälter<br />
der Gutverdiener überdurchschnittlich<br />
gestiegen sind und andererseits die<br />
Niedrigverdiener von der ohnehin nicht<br />
besonders starken allgemeinen Lohnentwicklung<br />
abgehängt wurden. Die Mittel-<br />
60<br />
Umsteuern für Bildung und Gerechtigkeit Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 61<br />
schicht ist geschrumpft. Dabei haben sich<br />
nicht nur die Markteinkommen deutlich<br />
auseinanderentwickelt, sondern auch die<br />
verfügbaren Einkommen nach Steuern<br />
und Sozialtransfers. Um diesem Trend entgegenzuwirken,<br />
schlagen wir eine moderate<br />
Erhöhung des Spitzensteuersatzes von<br />
42 Prozent auf 49 Prozent für zu versteuernde<br />
Einkommen ab 100.000 Euro bzw.<br />
200.000 Euro bei Eheleuten vor. Gleichzeitig<br />
wollen wir das Ehegattensplitting für<br />
zukünftige Ehen durch eine Individualbesteuerung<br />
mit Unterhaltsabzug umgestalten<br />
und so den geänderten Rollenbildern<br />
in unserem Land Rechnung tragen. Kapitalerträge<br />
sollen über eine erhöhte Abgeltungsteuer<br />
stärker herangezogen werden.<br />
2. Rückführung der Abgeltungssteuer<br />
in die Einkommenbesteuerung<br />
Unser Ziel ist die synthetische Besteuerung<br />
von Kapital- und Erwerbseinkommen.<br />
Es ist nicht länger hinnehmbar, dass<br />
Einkünfte, die ohne Leistung erzielt werden,<br />
teils deutlich geringer besteuert werden,<br />
als Arbeit, die mit dem Kopf oder den<br />
Händen geleistet wird. Deshalb muss die<br />
bestehende Abgeltungssteuer in die Einkommenbesteuerung<br />
rückgeführt werden,<br />
damit Dividenden, Erlöse aus Wertpapiergeschäften<br />
und Zinseinkünfte gegenüber<br />
Arbeitseinkommen nicht länger steuerlich<br />
privilegiert werden. Um eine Privilegierung<br />
hoher und höchster Einkommen auszugleichen,<br />
reicht eine Anhebung des Abgeltungssteuersatzes<br />
von 25 auf 30 Prozent<br />
nicht aus.<br />
Dividenden, Zinseinkünfte und Erlöse<br />
aus Wertpapiergeschäften müssen künftig<br />
wieder dem individuellen Einkommensteuersatz<br />
unterworfen werden. Die Übergangszeit<br />
mit der Möglichkeit, Altverluste<br />
bis zum Jahr <strong>2013</strong> vorzutragen, ist abzuschaffen.<br />
Dabei soll im Rahmen der rechtlichen<br />
Möglichkeiten die Regelung erhalten<br />
bleiben, dass im Zusammenhang mit<br />
dem Kapitalvermögen entstehende besondere<br />
Aufwendungen weiterhin pauschal<br />
abgegolten werden. Seit der Einführung<br />
der Abgeltungssteuer ist ihr Aufkommen<br />
um fast 5 Milliarden Euro zurückgegangen.<br />
Selbst unter Einbeziehung gegenläufiger<br />
Faktoren, wie dem derzeit niedrigeren<br />
Zinsniveau und teils abweichender Berechnungsgrundlagen,<br />
kann so mit Mehreinnahmen<br />
von deutlich über 1 Milliarde<br />
Euro gerechnet werden. Damit leisten wir<br />
einen wichtigen Beitrag zur Steuergerechtigkeit<br />
in Deutschland und schaffen zusätzliches<br />
Aufkommen, das für die Finanzierung<br />
einer solidarischen<br />
Bürgerversicherung im Gesundheitswesen<br />
verwendet werden könnte.<br />
3. Große Vermögen heranziehen –<br />
Reform der Erbschaftssteuer, Wiedereinführung<br />
der Vermögensteuer<br />
Noch immer wird der Vermögensbestand<br />
in Deutschland im weltweiten Vergleich<br />
weit unterdurchschnittlich besteuert.<br />
Dies zeigt sich nicht nur bei der<br />
Vermögensteuer. Bei der Erbschaftssteuer<br />
ergibt sich ein ähnliches Bild. Gegenwärtig<br />
werden in Deutschland zwar jedes Jahr bis<br />
zu 200 Milliarden Euro vererbt. Dennoch<br />
liegen die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer<br />
gerade einmal bei rund vier Milliarden<br />
Euro. Das ist im Vergleich mit Nachbarländern<br />
wie Frankreich nicht nur<br />
be sonders wenig, sondern mit Blick auf andere<br />
Steuern auch besonders ungerecht.<br />
Daher werden wir uns nicht nur für einen<br />
Erhalt, sondern vor allem auch für eine<br />
61
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 62<br />
verfassungsfeste Reform der Erbschaftsund<br />
Schenkungssteuer einsetzen. Kleinere<br />
und mittlere Erbschaften und Schenkungen<br />
im Familienkreis müssen auch künftig<br />
steuerfrei bleiben, hohe Erbschaften sind<br />
endlich angemessen zu besteuern. Hierfür<br />
sind zunächst die von der schwarz-gelben<br />
Koalition eingeführten Begünstigungen<br />
zugunsten von reichen Erben zurückzunehmen.<br />
Gleichzeitig sind Vergünstigungen<br />
bei der Erbschaftssteuer viel stärker an<br />
den dauerhaften Erhalt von Arbeitsplätzen<br />
zu koppeln. Eingetragene Lebenspartner<br />
sollen hingegen Ehegatten bei der Erbschafts-<br />
und Schenkungssteuer gleichgestellt<br />
werden.<br />
Die Vermögensteuer wird in Deutschland<br />
seit dem Jahr 1997 nicht mehr erhoben.<br />
Mit einem Steuersatz von 1 Prozent<br />
für natürliche Personen (0,5 Prozent für<br />
Betriebsvermögen und 0,6 Prozent für<br />
Körperschaften) bei Freibeträgen von pro<br />
Person in Höhe von 120.000 DM, konnte<br />
die öffentliche Hand jährlich umgerechnet<br />
ca. 4,6 Milliarden Euro einnehmen. Das<br />
Bundesverfassungsgericht erklärte im Jahr<br />
1995 das geltende Recht für verfassungswidrig,<br />
bei dem Immobilienvermögen besser<br />
behandelt wurde als anderes Vermögen.<br />
Die derzeit regierenden Parteien Union<br />
und FDP verweigern eine verfassungskonforme<br />
Neuregelung der Vermögensteuer.<br />
Für uns Sozialdemokraten ist klar, dass<br />
die Vermögensteuer, die vollständig den<br />
Ländern zukommt, wieder eingeführt werden<br />
muss. Diese wollen wir dabei so gestalten,<br />
dass Personengesellschaften und Unternehmen<br />
nicht in ihrer Substanz belastet<br />
werden. Eine Arbeitsgruppe, die sich derzeit<br />
mit der Ausgestaltung befasst, geht davon<br />
aus, dass sich selbst bei großzügigen<br />
Freistellungen beim persönlichen und familiären<br />
Gebrauchsvermögen und bei einem<br />
niedrigen Steuersatz von 1 Prozent,<br />
ein bundesweites Aufkommen von ca. 10<br />
Milliarden Euro erzielen lässt. Dies wäre<br />
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.<br />
III. Bildungsrepublik Deutschland<br />
Dass die Forderung nach einer fairen<br />
Lastenverteilung nicht immer auf Gegenliebe<br />
stößt, ist uns Sozialdemokraten dabei<br />
ebenso bewusst, wie die in weiten Teilen<br />
der Gesellschaft akzeptierte Erkenntnis,<br />
dass man die Sicherung des sozialen Zusammenhalts<br />
und die Wiederherstellung<br />
der Leistungsfähigkeit von Kommunen<br />
und Ländern nicht ohne zusätzliche Anstrengungen<br />
wird erreichen können.<br />
Dies gilt insbesondere im Bildungsbereich.<br />
Denn um es klar zu sagen: Auch<br />
wenn die derzeitige Lage vieler Jugendlicher<br />
in unseren südeuropäischen Nachbarländern<br />
an Dramatik wohl nicht zu überbieten<br />
ist, kennen wir auch in Deutschland<br />
das Problem der verlorenen Generation:<br />
Noch immer verfügen 7,5 Millionen Menschen<br />
in Deutschland nicht über notwendige<br />
Lese- und Schreibkompetenzen.<br />
Rund 2,2 Millionen junge Erwachsene unter<br />
35 haben keinen Berufsabschluss und<br />
bleiben überwiegend in gering bezahlten<br />
Hilfstätigkeiten.<br />
Das ist nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen,<br />
sondern auch mit Blick auf unser<br />
volkswirtschaftliches Gesamtinteresse ein<br />
Skandal. Denn gerade eine gute Berufsausbildung<br />
und stetige Qualifizierung und<br />
Weiterbildung der Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer sind die Grundlage für<br />
62 Umsteuern für Bildung und Gerechtigkeit Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 63<br />
wirtschaftlichen Erfolg und die Sicherung<br />
der Fachkräftebasis in der Zukunft. Schon<br />
heute leiden neben vielen jungen Menschen<br />
viele Unternehmen unter der Unterfinanzierung<br />
des Bildungssystems: Sie<br />
müssen ihre Auszubildenden zusätzlich<br />
schulen, weil diese nicht genügend auf den<br />
Arbeitsalltag vorbereitet sind. Und sie suchen<br />
händeringend nach qualifizierten<br />
Fachkräften, während gleichzeitig im Jahr<br />
2012 in Deutschland 6,5 % aller Schüler<br />
ihre Schulzeit ohne einen Abschluss beendeten.<br />
Studien bezifferten die Kosten für<br />
den Fachkräftemangel allein im Jahr 2011<br />
auf 30 Mrd. Euro.<br />
Um gerade jungen Menschen einen<br />
reibungslosen Start in ihren Lebensweg zu<br />
ermöglichen, müssen wir die hohe Abhängigkeit<br />
des Bildungserfolgs von der sozialen<br />
Herkunft sukzessive verringern. Da<br />
insbesondere finanzielle Hürden soziale<br />
Benachteiligungen verstärken und Menschen<br />
von Bildung fernhalten, kämpfen wir<br />
für die gebührenfreie Bildung von der Kita<br />
bis zur Hochschule.<br />
Darüber hinaus wollen wir ab 2014<br />
schrittweise aufbauend bis zu jährlich 20<br />
Mrd. Euro mehr für Erzieherinnen und<br />
Erzieher, für Ganztagsschulden, zur Qualitätsverbesserung<br />
von Lehre und Studium,<br />
für die Ausweitung des Hochschulpakts<br />
und für die Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten<br />
BAföG und Schüler-<br />
BAföG investieren. Davon soll der Bund<br />
10 Mrd. Euro und die Länder 10 Mrd.<br />
Euro bereitstellen (die Länder durch Stärkung<br />
ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit).<br />
Ziel muss es sein, die staatlichen Bildungsausgaben<br />
mindestens auf<br />
OECD-Durchschnitt zu heben. Dem Ziel<br />
von sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts<br />
für Bildung kommen wir mit 20<br />
Mrd. Euro mehr pro Jahr einen großen<br />
Schritt näher und schaffen damit die<br />
Grundlage für einen wirklichen Bildungsaufbruch<br />
in Deutschland.<br />
Die protestierenden Jugendlichen vor<br />
dem Kanzleramt hatten Föne mitgebracht.<br />
Motto: „Europa braucht mehr als Merkels<br />
heiße Luft.“<br />
Zeit für frischen Wind für Bildung und<br />
Gerechtigkeit! l<br />
Um dies zu erreichen, werden wir das<br />
bildungsfeindliche Betreuungsgeld abschaffen.<br />
Die bis zu 2 Mrd. Euro, die dafür<br />
mittelfristig jährlich anfallen würden, werden<br />
wir komplett in den Ausbau von Kitas<br />
und Tagespflege investieren. Der Rechtsanspruch<br />
auf einen Kitaplatz muss umfassend<br />
eingelöst werden, damit nicht länger<br />
der Zufall des Wohnorts oder die Höhe der<br />
Kita-Gebühren über Bildungschancen der<br />
Kinder entscheidet.<br />
63
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 64<br />
WOHNEN MUSS<br />
BEZAHLBAR BLEIBEN<br />
von Felix von Grünberg, Vorsitzender des Mieterbundes und Landtagsabgeordneter<br />
der SPD in NRW<br />
In letzter Zeit steht die Diskussion<br />
über wohnungspolitische Probleme,<br />
Wohnungsnöte und drastisch steigende<br />
Wohnkosten wieder stärker im<br />
Fokus der Öffentlichkeit und der<br />
Parteien. Aufgrund der aktuellen Entwicklung<br />
auf den Wohnungsmärkten<br />
in einigen Großstädten erwartet der<br />
Deutsche Mieterbund, dass die poli -<br />
tischen Versprechen auch zeitnah<br />
umgesetzt werden.<br />
Zunächst einmal ist festzustellen, dass<br />
der Wohnungsmarkt in Deutschland vielerorts<br />
sehr uneinheitlich ist. Neben einigen<br />
Schrumpfungsregionen ist in einigen<br />
Großstädten, Ballungsgebieten oder Universitätsstädten<br />
immer wieder von einer<br />
sich weiter ausbreitenden Wohnungsnot<br />
die Rede. Insgesamt fehlen heute schon<br />
mehr als 250.000 Mietwohnungen. Parallel<br />
dazu erhöht sich das Wohnungsangebot im<br />
Verhältnis jedoch nicht angemessen. Gerade<br />
auf den angespannten Wohnungsmärkten<br />
geht preiswerter Wohnraum vielfach<br />
verloren. Die Wohnungsbaufertigstellungen<br />
bewegen sich in den letzten vier Jahren<br />
auf einem historischen Tiefstand. Gründe<br />
hierfür sind hohe Baulandpreise, gestiegene<br />
Baukosten, die schlechtere steuerliche<br />
Abschreibung und die Begrenzung der<br />
Fördermöglichkeiten.<br />
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in<br />
bestimmten Regionen sind bei Neuvertragsmieten<br />
Mietsprünge von bis zu 40 %<br />
keine Seltenheit mehr. Dies führt zunehmend<br />
dazu, dass sich junge Familien,<br />
Haushalte mit geringem Einkommen, aber<br />
auch Normalverdiener das Wohnen in<br />
manchen Städten nicht mehr leisten können.<br />
Aber nicht nur die Nettomiete steigt.<br />
Auch die steigenden Kosten für Energie<br />
machen sich immer mehr bemerkbar. So<br />
haben die Wohnkosten für die Mieterinnen<br />
und Mieter bereits heute Rekordniveau<br />
erreicht, denn auch die Nebenkosten<br />
sind in den letzten Jahren stark angestiegen.<br />
Der Anteil der Ausgaben für Miete<br />
und Energie an den Gesamtausgaben eines<br />
Haushaltes liegt durchschnittlich bei<br />
34,1 %; bei Haushalten mit einem Einkommen<br />
bis 1.300 Euro bei rund 45 %.<br />
Nach EU-Definition sind die Haushalte,<br />
die mehr als 40 % des verfügbaren Haushaltseinkommens<br />
für ihre Miete aufbringen<br />
müssen, als finanziell überlastet anzusehen.<br />
Das trifft in Nordrhein-Westfalen<br />
64 Wohnen muss bezahlbar bleiben Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 65<br />
auf 16,8 % der Haushalte zu, in den Kernstädten<br />
sind es 20 %.<br />
Außerdem sind die hohen Neuvertragsmieten<br />
die Vergleichsmieten von<br />
Morgen, weil bei der Berechnung der ortsüblichen<br />
Vergleichsmiete nur die in den<br />
letzten vier Jahren erhöhten Bestandsmieten<br />
und die Neuvertragsmieten berücksichtigt<br />
werden. Dadurch drohen auch<br />
hohe Preissteigerungen in bestehenden<br />
Mietverhältnissen.<br />
Der Deutsche Mieterbund fordert deshalb<br />
die Einführung einer Kappungsgrenze<br />
bei der Wiedervermietung. Diese sollte<br />
bei maximal 5 % über der ortsüblichen<br />
Vergleichsmiete liegen.<br />
Auch für bestehende Mietverträge fordern<br />
wir eine Kappungsgrenze, damit<br />
Wohnen für die Mieterinnen und Mieter<br />
nicht unbezahlbar wird. Durch das 1. Mietrechtsänderungsgesetz<br />
wurden die Bundesländer<br />
ermächtigt, Gebiete auszuweisen,<br />
in denen auf Grund der schwierigen<br />
Wohnungssituation die Mieterhöhungsmöglichkeit<br />
auf 15 % (statt 20 %) in drei<br />
Jahren reduziert wird. Der Deutsche Mieterbund<br />
fordert eine bundesweit einheitliche<br />
Begrenzung der Mietpreise auf 15 %<br />
Prozent in vier Jahren. Die in diesem Zusammenhang<br />
von der Landesregierung untersuchte<br />
Gebietskulisse kann im Übrigen<br />
auch herangezogen werden für den Erlass<br />
einer Neuregelung der Zweckentfremdungsverordnung<br />
(Leerstehenlassen von<br />
Wohnraum und Umwandlung in Büroraum),<br />
durch die der Wohnungsmangel<br />
und damit die Verteuerung der Wohnkosten<br />
eingedämmt werden kann. Gleiches<br />
gilt für eine Neuregelung zur Kündigungssperrfristverordnung<br />
(längere Kündigungsschutzzeiten<br />
bei Umwandlung von Mietin<br />
Eigentumswohnungen).<br />
Darüber hinaus setzen wir uns ein für<br />
die Abschaffung von § 559 BGB. Nach<br />
dieser Vorschrift kann der Vermieter nach<br />
Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen<br />
die jährliche Miete um 11 % der<br />
für die Wohnung aufgewendeten Kosten<br />
erhöhen und das auf Dauer. Diese Quote<br />
ist festgelegt worden als die Zinsen bei 8 %<br />
lagen; jetzt liegen sie nur noch bei 3 %. Der<br />
Vermieter kann damit einen immer höheren<br />
Betrag zur Tilgung seines Darlehens<br />
verwenden, während der Mieter einseitig<br />
benachteiligt wird. Vor diesem Hintergrund<br />
halten wir auch die Forderung der<br />
SPD, die Modernisierungskosten in Höhe<br />
von 9 % auf den Mieter umzulegen, für<br />
nicht ausreichend.<br />
Selbstverständlich sind die energetische<br />
Sanierung von Wohngebäuden und<br />
der damit verbundene Klimaschutz im Interesse<br />
des Deutschen Mieterbundes. Dennoch<br />
kommt es für die Akzeptanz der<br />
Energiewende bei den Mieterinnen und<br />
Mietern entscheidend auf die sozialgerechte<br />
Verteilung der Kosten und Belastungen<br />
an. Die Anwendung der Vorschrift des §<br />
559 BGB führt zu Mietpreissprüngen, die<br />
sich durch eine Heizkostenersparnis, wenn<br />
überhaupt, erst nach Jahrzehnten bemerkbar<br />
machen. Die Anknüpfung an die reinen<br />
Modernisierungskosten, ohne den Erfolg<br />
der Modernisierungsarbeiten zu<br />
berücksichtigen, halten wir außerdem für<br />
falsch. Zudem bleibt für Mieterhöhungen<br />
nach einer Modernisierung den Vermietern<br />
im frei finanzierten Wohnungsbau<br />
immer noch die Mieterhöhung nach § 558<br />
BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.<br />
Allerdings bilden bislang nicht alle Miet-<br />
65
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 66<br />
spiegel den energetischen Zustand hinreichend<br />
ab. Für einen Übergangszeitraum,<br />
bis sich Energieeffizienz und energetische<br />
Qualität der Wohnung bei der ortsüblichen<br />
Vergleichsmiete widerspiegeln, soll<br />
der Vermieter deshalb einen Zuschlag auf<br />
die bisherige Miete verlangen können.<br />
Im Zusammenhang mit dem 1. Mietrechtsänderungsgesetz<br />
ebenfalls umgesetzt<br />
wurde der Minderungsausschluss des Mieters<br />
bei energetischer Modernisierung.<br />
Diese Vorschrift ist nicht mit dem vom<br />
Gesetzgeber vorgesehen Prinzip von Leistung<br />
und Gegenleistung zu vereinbaren.<br />
Außerdem ist in der Praxis die Abgrenzung<br />
der Modernisierung zur Instandsetzung<br />
kaum nachzuvollziehen. Wir fordern<br />
deshalb die Abschaffung dieser Vorschrift.<br />
Die in einigen Regionen bestehende<br />
Wohnungsnot erzeugt vor allem bei sozial<br />
Schwachen einen enormen Druck. Gerade<br />
der Rückgang an öffentlich geförderten<br />
Wohnungen führt noch zu einer Verschärfung<br />
dieses Problems. So hat sich der Bestand<br />
dieser Wohnungen von 1,5 Mio. im<br />
Jahr 1992 auf heute 650.000 mehr als halbiert.<br />
Durch das Auslaufen der Bindungen<br />
und die zunehmende vorzeitige Kreditrückzahlung<br />
sinkt der Bestand jährlich um<br />
durchschnittlich 46.000 Mietwohnungen.<br />
Aus der aktuellen Studie des Pestel-Institutes<br />
geht hervor, dass in Nordrhein-Westfalen<br />
mehr als 1,17 Mio. Sozialwohnungen<br />
fehlen. Wenn pro Jahr mit den bisherigen<br />
Mitteln nur 4.200 Wohnungen gebaut<br />
werden können, zeigt dies welche Dimension<br />
diese Entwicklung langfristig haben<br />
wird. Wird dieser Prozess nicht gestoppt,<br />
dann wird es in einigen Jahren aufgrund<br />
des Auslaufens der Preis- und/oder Belegungsbindungen<br />
keine Sozialwohnungen<br />
mehr geben. Die Ursache dafür liegt vor allem<br />
darin, dass es an Unternehmen fehlt,<br />
die in Sozialwohnungen investieren, weil<br />
die hier erzielbaren Renditen im Vergleich<br />
zu denen des freien Wohnungsbaus eher<br />
gering sind.<br />
Dies hat auch Auswirkungen für die<br />
Kommunen. Sie müssen ihren Transferleistungsempfängern<br />
die Miete zahlen, zu der<br />
diese auch tatsächlich eine Wohnung finden.<br />
Können die Kommunen nicht auf<br />
preiswerte, öffentlich geförderte Wohnungen<br />
zurückgreifen, steigen daher bei engen<br />
Wohnungsmärkten die Transferleistungskosten<br />
enorm an. Die Kommunen werden<br />
daher auf den Wohnkosten einer immer<br />
größer werdenden Zahl von Transferleistungsempfängern<br />
sitzen bleiben. Dies ist<br />
angesichts der katastrophalen Haushaltslage<br />
einiger Städte und Gemeinden nicht<br />
akzeptabel. Andererseits sind die im Jahr<br />
2012 bereitgestellten Wohnungsbaufördermittel<br />
im Umfang von 250 Mio. Euro<br />
nicht verbaut worden. Dies liegt vor allem<br />
daran, dass aufgrund der niedrigen Zinsen<br />
Investoren lieber freifinanziert als öffentlich<br />
gefördert bauen. Für 15-jährige Darlehen<br />
(bisherige Dauer der Wohnungsmarktdarlehen<br />
im öffentlich geförderten<br />
Wohnungsbau) sind Bankzinsen schon für<br />
2,5 bis 3 % Zinsen zu erhalten. Für den öffentlich<br />
geförderten Wohnungsbau muss<br />
man bisher 0,5 % Zinsen und 0,5 % Verwaltungskostenbeitrag<br />
zahlen. Für eine<br />
Zinsdifferenz von 1,5 bis 2 % erzielte der<br />
Bauherr aber oft das Doppelte an Miete<br />
anstatt der bisherigen Bewilligungsmiete<br />
von 5,25 Euro in Düsseldorf, Bonn und<br />
Köln für öffentlich geförderte Wohnungen.<br />
Für eine frei finanzierte Wohnung<br />
wäre auf diesen Märkten eine Miete zwischen<br />
11 und 13 Euro durchaus erzielbar.<br />
66 Wohnen muss bezahlbar bleiben Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 67<br />
Diese hohen Mieterlöse führen dazu, dass<br />
die Bauherren auch höhere Grundstückspreise<br />
akzeptieren mit der Folge, dass diese<br />
so stark steigen, dass der öffentlich geförderte<br />
Wohnungsbau auf diesen Grundstücken<br />
immer unvorteilhafter wird.<br />
Wir fordern deshalb, dass die Kommunen<br />
eigene Instrumente zur Marktregulierung<br />
einsetzen. Hierzu gehört auch die<br />
Stärkung der kommunalen Wohnungsbauunternehmen.<br />
Sie sollten die öffentlich geförderten<br />
Wohnungen bauen, für die das<br />
Land NRW immerhin 450 Mio. Euro an<br />
Fördergeldern zur Verfügung stellt. Leider<br />
mussten viele kommunale Unternehmen<br />
bisher ihre Gewinne an die Kommunen<br />
zum Haushaltsausgleich übertragen und<br />
hatten dadurch nicht genügend Eigenkapital<br />
zum Bau öffentlich geförderter Wohnungen.<br />
Der Deutsche Mieterbund sieht daher<br />
auch die Landesregierung in der Pflicht im<br />
Hinblick auf die Umstellung der bisherigen<br />
Förderrichtlinie. Statt 20 % Eigenkapital<br />
bei 15-jähriger Bindungsfrist sollte<br />
das Eigenkapital auf 10 % reduziert werden<br />
bei 30-jähriger Bindungsfrist. Darüber<br />
hinaus sollte die Förderung der Wohnungen<br />
pro Wohneinheit von 1.500 qm<br />
Wohnfläche wegen der gestiegenen Bauund<br />
Grund stückskosten ansteigen und bei<br />
2.300 qm liegen.<br />
Ein weiteres Problem sind die fehlenden<br />
und für öffentlich geförderte Wohnungen<br />
viel zu teuren Grundstücke. Auch hier<br />
könnten die Kommunen ihre Gestaltungsmöglichkeiten<br />
nutzen. So sollte bei der Erstellung<br />
von Bebauungsplänen immer auch<br />
auf Verdichtungsmöglichkeiten geachtet<br />
werden. Außerdem kann mit einer „sozial<br />
gerechten Bodennutzung“, wie sie beispielsweise<br />
in München praktiziert wird,<br />
vorgeschrieben werden, dass 30 % der zusätzlichen<br />
Bauflächen für öffentlich geförderten<br />
Wohnungsbau ausgewiesen werden.<br />
Will der Bauherr diese Flächen nicht<br />
selbst bebauen, kann er sie zu einem angemessenen<br />
Preis zum Beispiel an ein kommunales<br />
Wohnungsbauunternehmen veräußern.<br />
Die Vergabe städtischer<br />
Grundstücke für Neubaumaßnahmen darf<br />
darüber hinaus nicht immer nach dem<br />
Höchstgebot erfolgen. Das bedeutet, dass<br />
Grundstücke auch nach sozialen und<br />
stadtentwicklungspolitischen Kriterien<br />
vergeben werden müssen.<br />
Eine weitere Forderung des Deutschen<br />
Mieterbundes ist die Erhöhung des Wohngeldes.<br />
Mieterhöhungen und hohe Energiekosten<br />
haben die Wohnkostenbelastung<br />
vieler Mieterhaushalte auf Rekordniveau<br />
steigen lassen. Trotzdem ist die Zahl der<br />
Wohngeldempfänger in Deutschland im<br />
Jahr 2011 gesunken. Mitverantwortlich<br />
hierfür ist eine Änderung des Wohngeldgesetzes,<br />
das zum 1. Januar 2011 in Kraft<br />
getreten ist. Die Bundesregierung hat mit<br />
der Begründung, die Heizkosten seien gesunken,<br />
die sog. Heizkostenkomponente<br />
aus dem Wohngeldgesetz ersatzlos gestrichen.<br />
Diese Begründung ist aus heutiger<br />
Sicht nicht mehr tragbar. So liegen die<br />
Preise für Öl, Strom, Gas und Fernwärme<br />
über den Preisen von 2008 und 2009 und<br />
drastisch über den Preisen von 2010. Deshalb<br />
halten wir eine Erhöhung des Wohngeldes<br />
um 10 % für gerechtfertigt. Darüber<br />
hinaus fordern wir eine Aktualisierung der<br />
Einkommensgrenzen und der Höchstbeträge<br />
und die Einführung einer Energiekomponente.<br />
67
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 68<br />
Eine weitere Herausforderung ist der<br />
demographische Wandel. Der Anteil älterer<br />
Menschen nimmt immer mehr zu. Es<br />
ist davon auszugehen, dass die Zahl der<br />
über 65-Jährigen sich bis 2030 auf knapp<br />
30 % und bis 2060 auf rund ein Drittel der<br />
Bevölkerung erhöhen wird. Damit diese<br />
Menschen solange wie möglich selbstbestimmt<br />
in ihren eigenen vier Wänden wohnen<br />
bleiben können, setzen wir uns ein für<br />
den Ausbau und die Schaffung von barrierefreien<br />
bzw. barrierearmen Wohnungen.<br />
So gibt es aktuell etwa 550.000 altengerechte<br />
Wohnungen in Deutschland. Dem<br />
steht nach einer Untersuchung des Instituts<br />
für Bau-, Stadt- und Raumforschung<br />
für das Bundesbauministerium aber ein<br />
kurzfristiger Bedarf an altengerechten<br />
Wohnungen um das Vier- bis Fünffache<br />
gegenüber.<br />
Die Verwahrlosung von Wohnungen<br />
finanzmarktgetriebener Wohnungsunternehmen<br />
ist ebenfalls ein Problem, das seit<br />
den 1990er Jahren immer wieder auftritt.<br />
Insbesondere in weiten Teilen des Ruhrgebietes<br />
kaufen internationale Finanzinvestoren<br />
große Wohnungsbestände auf, um<br />
dadurch eine maximale Rendite zu erzielen.<br />
In diesem Zusammenhang setzt sich<br />
der Deutsche Mieterbund für eine erweiterte<br />
Wohnungsaufsicht ein, die an die Daseinsfürsorge<br />
des Wohnens anknüpft und<br />
damit über die Gefahrenabwehr hinausgeht.<br />
Zahlreiche Kommunen sind verschuldet.<br />
Freiwillige Aufgaben werden<br />
mangels finanzieller und personeller Ressourcen<br />
oft nicht mehr ausgeübt. Wir fordern<br />
deshalb die Wohnungsaufsicht den<br />
Kommunen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung<br />
nach Weisung zu übertragen. Außerdem<br />
zahlen zahlreiche dieser Wohnungsunternehmen<br />
aufgrund steuerlicher Umgehungstatbestände<br />
keine Grunderwerbssteuer.<br />
Dies hat zur Folge, dass einige<br />
Wohnungsbestände immer wieder ihren<br />
Eigentümer wechseln. Wir fordern deshalb<br />
eine entsprechende Anpassung des Steuerrechts,<br />
damit auch diese Unternehmen in<br />
Zukunft bei der Grunderwerbssteuer zur<br />
Kasse gebeten werden. l<br />
68<br />
Wohnen muss bezahlbar bleiben Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 69<br />
IT’S THE WOMEN’S<br />
VOTE, HONEY.<br />
von Nancy Haupt und Elisa Gutsche, Projektgruppe Junge Frauen<br />
im SPD-Parteivorstand<br />
Die Themen Gleichstellung und<br />
Geschlechtergerechtigkeit spielen im<br />
<strong>Bundestagswahl</strong>kampf <strong>2013</strong> bisher<br />
keine große Rolle. Unserer Meinung<br />
nach tut sich die SPD damit keinen<br />
Gefallen. Denn: Wir erleben gerade<br />
einen feministischen Frühling.<br />
Geschlechterpolitisch relevante<br />
Themen prägen die Medienlandschaft<br />
und mobilisieren wie selten zuvor.<br />
Juli <strong>2013</strong>. Bis zur <strong>Bundestagswahl</strong> sind<br />
es nur noch wenige Wochen. Die Zustimmungswerte<br />
der CDU erreichen ungeahnte<br />
Höhen, die der SPD stagnieren bei unter<br />
30 Prozent, neueste Umfragen zeichnen<br />
das düstere Bild von 22 Prozent.<br />
Das Horrorszenario vor unseren Augen:<br />
die Wiederwahl der schwarz-gelben<br />
Koalition und damit: vier weitere verschwendete<br />
Jahre mit einer Regierung, die<br />
einfach nicht mehr zur heutigen Zeit passt.<br />
Doch was ist dagegen zu tun? Wie<br />
können wir vier weitere Jahre politischer<br />
Untätigkeit verhindern? Wie kann es die<br />
SPD schaffen, als bestimmende Kraft in<br />
den Bundestag einzuziehen?<br />
Gender-Gap im Wahlergebnis<br />
Die Mehrheit der Deutschen ist weiblich:<br />
31,8 Millionen Frauen sind am<br />
22. September aufgerufen, ihr Kreuz zu<br />
machen. Möglichst viele sollen dies bei der<br />
SPD tun. Wir wollen einen Gender-Gap<br />
im Wahlergebnis, wir wollen mehr Frauen<br />
als Männer überzeugen. Denn: Die SPD<br />
war immer dann am stärksten, wenn Frauen<br />
der alten Tante ihre Stimme gaben.<br />
2009 hat die SPD die größte Niederlage<br />
ihrer Geschichte einstecken müssen,<br />
auch weil sie die Frauen, insbesondere die<br />
jungen, nicht überzeugen konnte. Sie verlor<br />
bei den Frauen 13,5 Prozent. Die größten<br />
Verluste hatten wir bei den jungen<br />
Wählerinnen: im Vergleich zu 2005 wählten<br />
21 Prozent weniger junge Frauen sozialdemokratisch.<br />
Fragen über Fragen<br />
Doch wie ist die Lage <strong>2013</strong>? Was hat<br />
sich seit 2009 getan? Wie werden Frauen<br />
angesprochen? Welche Themen bewegen<br />
Frauen heute? Können wir „Frauen“ überhaupt<br />
als homogene Gruppe sehen?<br />
69
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 70<br />
Zuerst die guten Nachrichten: Beim<br />
Thema Geschlechtergerechtigkeit ist die<br />
SPD am besten von allen im Bundestag<br />
vertretenen Parteien aufgestellt. Wir haben<br />
die Ideen und die Lösungen für die drängenden<br />
Probleme unserer Zeit. Wir haben<br />
mit dem Wahlprogramm zur <strong>Bundestagswahl</strong><br />
<strong>2013</strong> entscheidende Reformansätze<br />
vorgelegt. Ausgehend vom ersten Gleichstellungsbericht<br />
der Bundesregierung haben<br />
wir umfassende und konsistente Konzepte<br />
entwickelt, um in diesem Land das<br />
Thema Geschlechtergerechtigkeit auf den<br />
richtigen Weg zu bringen.<br />
Die schlechte Nachricht: Das wird im<br />
Wahlkampf bisher kaum thematisiert. Dabei<br />
liegen die entscheidenden Tools bereit.<br />
Die SPD hat sich in den vergangenen vier<br />
Jahren wie keine andere Partei auch intern<br />
mit dem Thema Gleichstellung und Chancengleichheit<br />
beschäftigt. Verschiedene Initiativen<br />
wurden ins Leben gerufen, um vor<br />
allem die weiblichen Mitglieder sichtbar zu<br />
machen, bzw. diese zu stärken. Nach der<br />
verlorenen <strong>Bundestagswahl</strong> 2009 setzte der<br />
SPD-Parteivorstand auf Initiative vieler<br />
engagierter junger Frauen die Projektgruppe<br />
junge Frauen wieder ein. Diese regte<br />
zum einen den Austausch innerhalb des<br />
Parteivorstanden an, zum anderen suchte<br />
sie den Kontakt in die Bundestagsfraktion,<br />
die Gewerkschaften, die Stiftungen und zu<br />
anderen gesellschaftlichen AkteurInnen.<br />
Hour ihres Lebens befinden, die Teilnahme<br />
an ehrenamtlicher Parteiarbeit zu ermöglichen.<br />
Beim jährlich in Berlin stattfindenden<br />
Barcamp Frauen kommen bis zu 250 Frauen<br />
und Männer zusammen, um einen Tag<br />
lang über alle möglichen Facetten von Geschlechtergerechtigkeit<br />
zu diskutieren.<br />
Hinzu kommt der „Rote Frauensalon“, der<br />
sich an engagierte und erfolgreiche Frauen<br />
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und<br />
Politik richtet und neue Schnittstellen zwischen<br />
SPD und Bürgerinnen schafft.<br />
Aktionsplan Gleichstellung<br />
Neben diesen neuen Kommunikationsformen<br />
hat die SPD natürlich auch ihre<br />
gleichstellungspolitischen Inhalte ausdifferenziert.<br />
Sie sollen ein schlüssiges Konzept<br />
für ein ganzes Frauenleben bilden, allerdings<br />
je nach Unterzielgruppe priorisiert<br />
werden. Die Inhalte dürfen sich nicht widersprechen,<br />
der alten Einsicht folgend,<br />
dass man Zielgruppen nicht addieren und<br />
demnach jeder erzählen kann, was sie hören<br />
will.<br />
Wir unterscheiden vier verschiedene<br />
Gruppen von Frauen 5 :<br />
Die SPD ist weiblicher<br />
Im Frühjahr dieses Jahres launchte das<br />
SPD-Fem.Net. Eine Vernetzungsseite<br />
speziell für weibliche Mitglieder, die die<br />
Möglichkeit geben soll, unattraktive und<br />
zeitintensive Ortsvereinsstrukturen zu ergänzen,<br />
um Frauen, die sich in der Rush-<br />
5 Erarbeitet durch die Arbeitseinheit „Zielgruppe<br />
Frauen“ des WBH.<br />
70 It’s the women’s vote, honey. Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 71<br />
Junge Frauen<br />
Frauen in der<br />
Familienphase<br />
Berufstätige Frauen<br />
Ältere Frauen<br />
Ausbildungs -<br />
qualität<br />
Ausbildungs -<br />
garantie<br />
Mindest aus bil -<br />
dungs vergütung<br />
Selbstbestimmung<br />
Weiterentwicklung<br />
Elterngeld<br />
Kitas statt<br />
Betreuungsgeld<br />
Betreuungsqualität<br />
Reform des<br />
Kindergeldes<br />
Familienarbeitszeit<br />
Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf<br />
und von Kind und<br />
Karriere<br />
Leitbild Partnerschaftlichkeit<br />
Erzieher/-innenberuf<br />
aufwerten<br />
Leitbild Partnerschaftlichkeit<br />
Leitbild der Frau<br />
als Gestalterin des<br />
eigenen Lebens<br />
Gleicher Lohn für<br />
gleiche und gleichwertige<br />
Arbeit<br />
Verbindliche<br />
Frauenquote<br />
Überwindung<br />
Ehegattensplitting<br />
Reform Minijobs<br />
Zeitsouveränität<br />
erhöhen (z. B.<br />
mehr verbindliche<br />
Zeiterfassung;<br />
flexible Arbeitszeitmodelle)<br />
Vereinbarkeit<br />
Beruf/Pflege<br />
Rückkehrrecht<br />
in Vollzeit nach<br />
befristeter Teilzeit<br />
Anerkennung<br />
Gemeinschaft<br />
Engagement/<br />
Aktives Alter<br />
Aufstieg ermög -<br />
lichen für Nachkommen;<br />
bessere<br />
Bildung<br />
Gesicherte Renten<br />
Gesundheit/<br />
Pflege<br />
Sicherheitsgefühl<br />
im privaten und<br />
öffentlichen Raum<br />
Genau das hat die SPD-Bundestagsfraktion<br />
mit dem Aktionsplan Gleichstellung<br />
geschafft. Die Bundestagsfraktion<br />
legt damit erstmals widerspruchsfreie Ideen<br />
vor, die ein existenzsicherndes und eigenständiges<br />
Leben für Frauen ermöglichen<br />
soll. Von einer Reform der Minijobs<br />
und des Ehegattensplittings, über den qualitativen<br />
und quantitativen Ausbau der<br />
Kinderbetreuung bis hin zu besseren Aufstiegschancen<br />
für Frauen und der Einführung<br />
eines Gesetzes zur Entgeltgleichheit,<br />
setzt der Aktionsplan überall da an, wo<br />
Frauen vor entscheidenden Weichenstellungen<br />
ihres Lebens stehen und bietet eine<br />
echte Alternative zur derzeitigen Politik<br />
von CDU/CSU und FDP.<br />
Girlsteam im Merkel-Camp<br />
Richten wir aber unseren Blick auf den<br />
aktuellen Wahlkampf. Denkt man an Merkel,<br />
kommt einem eines nicht in den Sinn:<br />
progressive Frauenpolitik. Aber man hat<br />
starke Frauen vor Augen. Angela Merkel<br />
als erste Kanzlerin der Bundesrepublik.<br />
71
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 72<br />
Ursula von der Leyen als starke Ministerin,<br />
die nicht selten die alte-Herren Partei vor<br />
sich her treibt.<br />
Die Kanzlerin umgibt sich sprichwörtlich<br />
mit einem Girls-Team: Ihre engsten<br />
Beraterinnen sind Frauen. Ihre Büroleiterin<br />
Beate Baumann begleitet sie seit über<br />
einem Jahrzehnt. Eva Christiansen ist<br />
Chefin des Planungsstabes im Kanzleramt<br />
und berät Merkel in ihrem medialen Auftreten.<br />
Was eint diese Frauen? Neben ihrem<br />
Parteibuch sicher auch ein anderer<br />
Blick auf die Politik und ein anderer Habitus.<br />
Von Machtgebaren und der Hysterie<br />
ihrer männlichen Kollegen sind diese drei<br />
kilometerweit entfernt. Das wirkt auf viele<br />
Frauen attraktiv.<br />
Und die SPD? Sie war mal der Motor<br />
des Fortschritts, was ist davon heute geblieben?<br />
Bebel und die Frau im Sozialismus?<br />
Nachdem Peer Steinbrück zum Kanzlerkandidaten<br />
erklärt wurde, legte er fest,<br />
dass sein Kompetenzteam zur Hälfte aus<br />
Frauen und zur Hälfte aus Männern bestehen<br />
soll. Soweit so gut. Das Kompetenzteam<br />
steht, sein Versprechen hat Peer gehalten.<br />
Doch schauen wir uns die Sache<br />
genauer an.<br />
Das Kompetenzteam<br />
Manuela Schwesig: das Gesicht der<br />
SPD für Frauen und Familie. Sie ist natürlich<br />
im Kompetenzteam vertreten und zuständig<br />
für die Themen Frauen, Familie,<br />
Aufbau Ost, Demografie und Inklusion.<br />
Yeah! Allein das Thema „Frauen“ ist eine<br />
riesige Baustelle, bei der es um nichts weniger<br />
als gesellschaftliches Umdenken geht.<br />
Moderne wagen<br />
Das Thema „Frauenpolitik“ sollte nicht<br />
mit „Familienpolitik“ zusammengedacht<br />
werden, da wir so genau das reproduzieren,<br />
was wir eigentlich vermeiden sollten: Frauen<br />
und ihre Zuständigkeit für Familie zusammenzudenken.<br />
Die SPD will modernere<br />
Rollen und mehr Freiheit für Frauen<br />
und Männer. Unser Lösungsvorschlag:<br />
Ordnet die Ressorts neu! Was hat ein<br />
Equal-Pay-Gesetz denn mit Familienpolitik<br />
zu tun? Oder die Umsetzung der UN-<br />
Behindertenrechtskonvention mit einer<br />
Frauenquote für Aufsichtsräte?<br />
Feminismus = Mobilisierung<br />
Wäre es nicht an der Zeit gewesen, die<br />
Themen „Gleichstellung“ und „Geschlechtergerechtigkeit“<br />
moderner zu besetzen<br />
und anderen Ressorts zuzuordnen? Jetzt ist<br />
es nur eines von vielen und wird damit dem<br />
Zeitgeist nicht gerecht.<br />
In der Politik, in den Medien, abends<br />
an der Bar: Überall haben geschlechterpolitische<br />
Themen Hochkonjunktur: der<br />
Hastag „Aufschrei“ erhielt nun gar den<br />
Grimme-Online-Award in der Kategorie<br />
„Spezial“. Die Empörung über eine Entscheidung<br />
des Gesundheitsausschusses im<br />
Bundestag, die Rezeptpflicht für die Pille<br />
danach beizubehalten, drückte sich auf<br />
Twitter rasend schnell in „wiesmarties“ aus.<br />
Feministische Themen haben in diesem<br />
Jahr ein Mobilisierungspotenzial, wie<br />
man es vorher kaum kannte. Will die SPD<br />
es schaffen, diese <strong>Bundestagswahl</strong> zu gewinnen,<br />
muss sie es lernen, diese Themen<br />
auch glaubhaft zu besetzen.<br />
72 It’s the women’s vote, honey. Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 73<br />
Ein Blick über den Tellerrand<br />
Wagen wir den Blick in die USA. <strong>2013</strong><br />
lassen sich alle größeren Parteien vom Präsidentschaftswahlkampf<br />
Barack Obamas<br />
inspirieren. Warum auch nicht? Schließlich<br />
haben Frauen die US-Präsidentschaftswahlen<br />
2012 entschieden, dem<br />
Amtsinhaber eine zweite Amtszeit gesichert.<br />
Die Kampagne der Demokraten<br />
hatte als Zielgruppe junge Frauen im Blick<br />
und hat es geschafft mit feministischen<br />
Themen zu punkten und massiv Wählerinnenstimmen<br />
zu gewinnen. Barack Obama<br />
gewann die Wahl. Warum? Wegen der<br />
geistreichen, klugen, den richtigen Tonfall<br />
treffenden Kampagne.<br />
Julia und ihre kleine Schwester Elli<br />
Um Frauen zu erreichen, wurde „the<br />
life of Julia“ ins Leben gerufen. Anhand<br />
von Julia erklärt die Kampagne, wie Obamas<br />
Politik das Leben von Frauen, egal in<br />
welchem Alter, zum positiven beeinflusst.<br />
Glücklicherweise hat Obama einige<br />
Erfolge aus seiner ersten Amtszeit vorzuweisen,<br />
zum Beispiel den Lilly Ledbetter<br />
Fair Pay Act von 2009, der die gleiche Bezahlung<br />
von Frauen und Männern garantiert<br />
und den Affordable Care Act, der eine<br />
Krankenversicherung für alle Amerikanerinnen<br />
und Amerikaner gewährleistet, die<br />
für Verhütungsmittel bezahlt.<br />
Gerade mit diesen beiden Themen<br />
konnte er bei jungen Frauen punkten. Hier<br />
möchten wir erwähnen, dass es für viele<br />
Frauen unerheblich ist, wie viele Frauen<br />
denn nun in den Aufsichtsräten sitzen.<br />
Was wichtig ist: sichere und gute Jobs, unbefristete<br />
Arbeitsverträge, um das Leben<br />
zu planen (ja, auch den Nachwuchs), soziale<br />
Sicherheit und eine Gesellschaft, in der<br />
man als Frau nicht automatisch den Kürzeren<br />
gezogen hat.<br />
Die SPD-Bundestagsfraktion macht<br />
das übrigens anhand von „Elli“ auf den<br />
Seiten der SPD-Bundestagsfraktion. „Elli<br />
verdient mehr“ findet ihr hier:<br />
www.spdfraktion.de/elli-verdient-mehr/.<br />
Anhand des Lebens der fiktiven Figur<br />
„Elli“ wird online und in einem Flyer die<br />
Geschlechterpolitik der SPD-Bundestagsfraktion<br />
anschaulich erklärt. Wir begleiten<br />
„Elli“ durch ihr Leben – von der Kindheit,<br />
über Ausbildung, Familie und Karriere, bis<br />
ins Rentenalter. Es wird gezeigt, wie die<br />
gleichstellungspolitischen Konzepte der<br />
SPD-Bundestagsfraktion positive Impulse<br />
für Frauen und Männer im Land geben,<br />
eine eigenständige Existenzsicherung aufzubauen.<br />
Peer, Barack und Hillary<br />
Landauf, landab war nach der Ernennung<br />
Peer Steinbrücks zum Kanzlerkandidaten<br />
zu lesen, dass er gerade bei jüngeren<br />
Wählerinnen nicht ankomme und diese<br />
eher Merkel wählen würden. Sicher, Steinbrück<br />
ist nicht Obama und Deutschland<br />
nicht die USA. Doch wir als junge Frauen<br />
möchten uns damit nicht zufrieden geben.<br />
Uns reicht es nicht, dass es ein paritätisch<br />
besetztes Kompetenz-Team gibt, in dem<br />
Frauen dann doch wieder für Frauen und<br />
Familie zuständig sind. Wie wäre es denn<br />
mal mit einer weiblichen Außenministerin?<br />
Obama hat nicht gezögert und Hillary<br />
Clinton zu seinem Aushängeschild in der<br />
Welt gemacht. Nicht nur wir hoffen, dass<br />
sie 2016 zur nächsten US-Präsidentin gewählt<br />
wird.<br />
73
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 74<br />
… und der passende Tonfall<br />
Nicht allein die Themen machten den<br />
Wahlkampf so spannend, sondern auch deren<br />
Kommunikation. Unterstützung im<br />
Wahlkampf bekam der Amtsinhaber zum<br />
Beispiel von Lena Dunham, der Autorin<br />
und Hauptdarstellerin der fantastischen<br />
Serie „Girls“. Sie ist eine der coolsten und<br />
glaubwürdigsten jungen Frauen, die die<br />
USA gerade zu bieten hat, und sie engagierte<br />
sich in einem wunderbaren und famosen<br />
Spot für Obamas Wiederwahl. Neben<br />
Lena Dunham setzten sich viele<br />
andere Frauen aus Medien und Kultur für<br />
die Wiederwahl Barack Obamas und für<br />
dessen politische Agenda ein.<br />
Was also können wir von der amerikanischen<br />
Präsidentschaftswahl und von<br />
Obama in Bezug auf die Wählergruppe der<br />
jungen Frauen lernen? Was sollte „unser“<br />
Kandidat anders machen, damit er wirklich<br />
UNSER Kandidat wird?<br />
Wir brauchen mehr TESH 6<br />
Wer mehr Frauen erreichen möchte,<br />
muss TESH werden. Wer TESH ist, erreicht<br />
die Frauen. Wer die Frauen erreicht,<br />
gewinnt erst ihr Herz und dann ihre Stimme.<br />
TESH wird, wer die richtigen Themen<br />
hat, Frauen einbindet, die richtige Sprache<br />
hat und die passende Haltung dazu.<br />
Frauen haben ein Gespür dafür, ob man<br />
nur ihre Stimme haben will oder tatsächlich<br />
für ihre Anliegen kämpft. Viele Frauen<br />
haben der SPD den Rücken gekehrt, sie<br />
sind skeptisch, ob sie „zurückkehren“ sollten.<br />
Sie wollen umworben und überzeugt<br />
werden.<br />
Die richtigen Themen<br />
Frau ist nicht gleich Frau. Jede Frau hat<br />
eine andere Lebensrealität. Die Zielgruppe<br />
Frauen darf nicht als homogene Masse,<br />
sondern muss differenziert betrachtet werden.<br />
Unsere Inhalte müssen konkrete Lösungen<br />
für reale Lebensprobleme sein.<br />
Daher schlagen wir vier Untergruppen<br />
vor: Junge Frauen, Frauen in der Familienphase,<br />
Berufstätige Frauen und Ältere. Frau -<br />
enpolitik ist Gesellschaftspolitik. Frau en -<br />
politik ist Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik,<br />
Wirtschaftspolitik und noch vieles mehr.<br />
Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen<br />
stellen sich andere Fragen. Niemand würde<br />
auf die Idee kommen, Politik für Männer<br />
unter dem Sammelbegriff „Männerpolitik“<br />
zu denken und einen 18-jährigen Auszubildenden<br />
in einen Topf mit dem 60-jährigen<br />
Vorstandsvorsitzenden, der sich kurz<br />
vor der Rente befindet, zu stecken.<br />
Junge Frauen haben andere Ansprüche<br />
und Erwartungen an Politik als Frauen in<br />
der Familienphase oder als Frauen, die mit<br />
beiden Beinen in der Berufstätigkeit stehen.<br />
Eine junge Studentin interessiert sich<br />
vielleicht mehr für ihre reproduktiven<br />
Rechte – z. B. den rezeptfreien Zugang zur<br />
Pille danach oder die Streichung des § 218<br />
StGB – als für eine Reform der Minijobs.<br />
Frauen in der Familienphase stellen sich<br />
Vereinbarkeitsfragen, die für Frauen, die<br />
bereits in Rente sind, so nicht mehr aufkommen.<br />
Das sind also völlig unterschiedliche<br />
Zielgruppen.<br />
6 Erarbeitet durch die Arbeitseinheit „Zielgruppe<br />
Frauen“ des WBH.<br />
74 It’s the women’s vote, honey. Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 75<br />
Frauen einbinden<br />
Frauen wollen Frauen sehen. Die Entscheidung<br />
des Kanzlerkandidaten, dass die<br />
Hälfte des Kompetenzteams Frauen sind,<br />
ist gut. Entscheidend wird sein, wie stark<br />
die benannten Personen es schaffen, eigene<br />
Akzente zu setzen. Eine Frau, die für ein<br />
Thema Mitglied des Kompetenzteams geworden<br />
ist, sollte auch die volle Kompetenz<br />
inklusive der Beinfreiheit für das Thema<br />
erhalten.<br />
Wir wissen aus der Team-Forschung,<br />
dass bei einem Geschlechteranteil von unter<br />
20 % die Produktivität und Kreativität<br />
von Einzelpersonen und die Innovationskraft<br />
des gesamten Teams stark ausgebremst<br />
wird. Erst bei einem Frauenanteil<br />
von mindestens 30 % wird die Schwelle<br />
überschritten, wo die weibliche Perspektive<br />
objektive und subjektive Wirkung entfalten<br />
kann.<br />
Die richtige Sprache<br />
Geschlechtergerechte Sprache ist anstrengend,<br />
aber alternativlos. Wollen wir<br />
Frauen und Männer erreichen, müssen wir<br />
Frauen UND Männer ansprechen. Generalklauseln<br />
sind billige Ausreden. Frauen<br />
(aber auch Männer) sind nicht zu gewinnen<br />
mit komplizierten, trockenen und toten<br />
Satzkonstruktionen. Frauen wünschen<br />
eine lebendige Sprache. Die Sprache der<br />
Politik wirkt oftmals abgehoben und distanzierend.<br />
Nicht die wohlfeile Formulierung<br />
reizt, sondern echte Gefühle, Leidenschaft<br />
und Einsatz.<br />
Lieber eine kantige Formulierung als<br />
eine zur Unkenntlichkeit geschliffene Abfassung.<br />
Die richtige Haltung<br />
Authentisch sein. Eine harte Linie fahren.<br />
Gerade in der Geschlechterpolitik.<br />
Nicht nachgeben und Haltung bewahren.<br />
Mindestens eine der Autorinnen dieses<br />
Textes hatte ihre Zweifel, was Peer und<br />
sein Verhältnis zu Gleichstellungspolitik<br />
angeht. Doch seit dem Auftritt von Getrud<br />
Steinbrück auf dem Parteikonvent sind<br />
diese verflogen. Ein Mann mit dieser Frau<br />
– der hat die richtige Haltung und möchte<br />
in dieser Gesellschaft etwas verändern.<br />
Peer Steinbrück hat die Frauen angesprochen.<br />
Er hat sich festgelegt, eine verbindliche<br />
Quote einzuführen, das Ehegattensplitting<br />
zu reformieren, ein Gesetz zur<br />
Entgeltgleichheit durchzusetzen. Die Erwartungen<br />
sind hoch – doch wir sind uns<br />
sicher, dass er diese Erwartungen erfüllen<br />
wird. Peer Steinbrück geht es um eine gerechtere<br />
Gesellschaft.<br />
Viele Politiker und auch Politikerinnen<br />
sehen Frauen als die Erwerbsreserve für die<br />
Beseitigung des Fachkräftemangels oder<br />
als Gebärmaschinen, um den demografischen<br />
Wandel mit einer Armee Babys zu<br />
stoppen. Das darf nicht der Ansatz der<br />
SPD sein. Wählerinnen haben ein feines<br />
Gespür dafür, wann jemand ehrlich ist und<br />
wann sie angelogen werden. Für die weibliche<br />
Zielgruppe bedeutet das: durch innere<br />
Haltung die richtigen Inhalte nach außen<br />
kommunizieren, um bei Frauen<br />
Vertrauen zu erzeugen, damit sie ihr Kreuz<br />
wieder bei der SPD machen.<br />
Schlusswort<br />
Wir als Frauen, vor allem aber als junge<br />
Menschen, wünschen uns einen Kandidaten,<br />
der es schafft, den Tonfall unserer Ge-<br />
75
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 76<br />
neration zu treffen und der unsere Sorgen,<br />
Ängste, Träume und Wünsche verstehen<br />
kann und vielleicht sogar weiß, wie es sich<br />
anfühlt, manchmal machtlos vor den gesellschaftlichen,<br />
ökonomischen und sozialen<br />
Herausforderungen unserer Zeit zu<br />
stehen.<br />
Wir wünschen uns von unserem Kandidaten<br />
visionäres und progressives Denken<br />
und Handeln. Barack Obama hat es<br />
geschafft, 2012 genau das zu verkörpern<br />
und damit das Vertrauen junger Frauen zu<br />
gewinnen. Peer Steinbrück hat das Potential<br />
das auch zu schaffen. l<br />
76 It’s the women’s vote, honey. Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 77<br />
DIE SPD AUF DEM WEG<br />
ZU EINEM PROGRESSI-<br />
VEN SELBSTVERSTÄND-<br />
NIS IM PLURALEN<br />
DEUTSCHLAND?<br />
von Daniela Kaya, Mitglied im Bundesvorstand der SPD-AG Migration und Vielfalt,<br />
Autorin 7 7 u. a. (<strong>2013</strong>): Deutschland neu erfinden. Impulse<br />
1. Ausgangslage<br />
In aller Regelmäßigkeit verkünden<br />
konservative Kräfte in Deutschland: „Der<br />
Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut<br />
gescheitert!“ Zuletzt erklärte dies Bundeskanzlerin<br />
Angela Merkel im Oktober<br />
2010, fünf Jahre nach Inkrafttreten des rotgrünen<br />
Zuwanderungsgesetzes. Jenes markiert<br />
einen Paradigmenwechsel in der<br />
deutschen Politik. Die Abkehr vom deutschen<br />
Gastarbeiter-Modell. „Das deutsche<br />
Gastarbeiter-Modell ist gescheitert, absolut<br />
gescheitert“ kann Angela Merkel also<br />
nur gemeint haben. Denn eine Politik des<br />
Multikulturalismus hat es bis dato in<br />
Deutschland nicht gegeben. Eine multikulturelle<br />
Gesellschaft sehr wohl. Viel zu<br />
lange war Deutschland ein Einwanderungsland<br />
wider Willen. Heute sind wir<br />
eine Einwanderungsgesellschaft. Dennoch<br />
ist die Behauptung des gescheiterten Multikulturalismus<br />
ein wiederkehrendes Motiv<br />
in der politischen Auseinandersetzung.<br />
Heute finden wir eine Mischform von<br />
multikultureller und integrationsgeleiteter<br />
Politik in Deutschland vor – so wie in vielen<br />
anderen Einwanderungsgesellschaften.<br />
Das Merkel-Zitat macht deutlich: Es<br />
geht um die Deutungshoheit. Um sie zu<br />
erlangen und (neue) Wählermilieus (wieder)<br />
zu erreichen, ist es für die Sozialdemokratie<br />
unumgänglich, das Versprechen der<br />
sozialen Gerechtigkeit für die Einwanderungsgesellschaft<br />
zu erneuern. Inwiefern<br />
ihr das im Wahlprogramm gelingt, wird<br />
hier untersucht.<br />
für die Neuausrichtung sozialdemokratischer Integrationspolitik.<br />
Rotation Vorwärts Verlag.<br />
77
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 78<br />
2. Quo vadis SPD?<br />
Für sozialdemokratische Diversitätspolitik<br />
wird im Wahlprogramm wie folgt erklärt:<br />
„Deutschland ist ein offenes Land.<br />
Wir setzen uns für ein gleichberechtigtes<br />
gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt<br />
ein. Integrationspolitik neu zu denken<br />
heißt letztlich auch, den Begriff der Integration<br />
zu überwinden und durch den selbstverständlichen<br />
gesellschaftlichen Anspruch auf<br />
Teilhabe und Partizipation zu ersetzen.“ (58)<br />
Die Überwindung des Integrationsbegriffs<br />
ist zukunftsweisend. Er verkörpert eine<br />
rückwärtsgewandte Perspektive. Mit ihm<br />
ist der Imperativ der Anpassung und der<br />
individuellen Bringschuld von Einwanderern<br />
verbunden. Er hat einen paternalistischen<br />
Anstrich. Progressive Politik hingegen<br />
nimmt Gesellschaftsstrukturen in den<br />
Blick: Welche Gelegenheitsstrukturen bietet<br />
eine Gesellschaft, damit jede/r unabhängig<br />
von sozialer Herkunft, Ethnizität<br />
und Geschlecht gleichberechtigt teilhaben<br />
kann? Welche Barrieren bestehen? Wie kön -<br />
nen sie abgebaut werden? Sozialdemokratische<br />
Gesellschaftspolitik, die sich an den<br />
eigenen Grundwerten der Freiheit, Gerechtigkeit<br />
und Solidarität orientiert, muss<br />
ein kohärentes Konzept der sozialen Gerechtigkeit<br />
im Sinne von Lebenschancengleichheit<br />
8 entwickeln. Der Wille zur Über -<br />
windung der Integrations-Perspektive ist<br />
hierfür die Voraussetzung. Neben dem As -<br />
pekt der Teilhabe muss die SPD hierfür auch<br />
das Feld der Anerkennungspolitik gestalten.<br />
Anerkennung und Teilhabe –<br />
Leitgedanken sozialdemokratischer<br />
Gesellschaftspolitik<br />
Die politische, rechtliche und gesellschaftliche<br />
Anerkennung heterogener<br />
Iden titäten aller Gesellschaftsmitglieder<br />
als Gleiche ist Voraussetzung für die Schaffung<br />
von Teilhabegerechtigkeit. In diesem<br />
Sinne hat Anerkennungspolitik weitgehende<br />
politische und rechtliche Implikationen.<br />
Soziale Ungleichheit wird auch diskursiv<br />
hergestellt. Dabei dienen Selbst- und<br />
Fremdbilder der normativen Legitimierung<br />
und Begründung sozialer Hierarchien.<br />
Politische Akteure bedienen die<br />
Klaviatur immer wieder kehrender Motive,<br />
scheinbarer Alltagsgewissheiten, und formen<br />
so Diskurse der Ungleichheit. In ihnen<br />
zeigt sich eine Kontinuität vorherrschender<br />
Deutungsmuster seit den 1950er<br />
Jahren. Für Deutschland werden die Bilder<br />
des kriminellen Ausländers, der vollständig<br />
anderen und unvereinbaren Kultur von<br />
Einwanderern und damit einer Überfremdung<br />
sowie die des integrationsunwilligen<br />
Ausländers diskursiv behandelt. Hinzu<br />
kommen Bilder der Belastung durch Einwanderung<br />
gepaart mit der Forderung nach<br />
Begrenzung von Einwanderung und der<br />
Topos des Missbrauchs von Sozialleistungen.<br />
Ebenso wie die Bewertung nach Nützlichkeit<br />
von ausländischen Arbeitskräften<br />
(Mikler 2006: 568).<br />
Die Forderung nach Überwindung des<br />
Integrationsbegriffs kann die SPD nur<br />
selbst einlösen, indem sie ihre Politik narrativ<br />
begleitet. Dafür muss sie die Stellvertreter-Debatten<br />
um angebliche Integrationsverweigerer<br />
oder die deutsche Leit kultur<br />
entschlüsseln. Unsere Gesellschaft verhandelt<br />
darin die Kernfrage, was wir heute als<br />
Deutschsein verstehen wollen, wer dazu<br />
8 Zum Begriff der Lebenschancengleichheit: Wolfang<br />
Merkel et. al. (2006).<br />
78 Die SPD auf dem Weg zu einem progressiven Selbstverständnis im pluralen Deutschland? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 79<br />
gehören soll und wer nicht. Anders ausgedrückt:<br />
Sind Fatma und Luigi ebenso typisch<br />
deutsch wie Peter und Silke? Aufgabe<br />
der SPD ist es, klar zu machen, dass<br />
solche Versuche der Grenzziehung nicht<br />
Schritt halten mit der vielfältigen Realität<br />
in Deutschland. Daher muss die SPD neue<br />
Erzählungen entwickeln, vom Deutschsein,<br />
von der deutschen Geschichte als<br />
Einwanderungsland. Hierfür sollte die<br />
SPD im Jahr ihres 150. Jubiläums beispielsweise<br />
die Rolle der Pluralität in ihrer<br />
Geschichte sichtbarer machen. Um die<br />
Köpfe und Herzen zu erreichen, wird es<br />
beispielsweise nicht ausreichen, die Öffnung<br />
der Mehrstaatigkeit für alle zu fordern.<br />
Die SPD muss ihre Forderung in ein<br />
modernes Selbstbild einbetten. Identifikationsräume<br />
für Ein- und Mehrfachzugehörigkeiten<br />
anbieten. Dafür muss die SPD<br />
eine Großerzählung entwickeln, die Zutrauen<br />
und Mut in die Einwanderungsgesellschaft<br />
schafft. Nur so kann die doppelte<br />
Staatsbürgerschaft konsequent heraus aus<br />
der konservativen „Schmuddelecke“ der Sicherheits-<br />
und Ordnungspolitik gehievt<br />
werden und dort ankommen, wo sie hingehört:<br />
im Selbstverständnis eines multikulturellen<br />
Deutschlands.<br />
Ausgehend von dem Postulat gleicher<br />
Chancen der Teilhabe an allen materiellen<br />
wie immateriellen Ressourcen müssen sich<br />
politische Maßnahmen daran messen lassen,<br />
inwiefern sie zu einer am Ergebnis orientierten<br />
tatsächlichen Chancengleichheit<br />
für Menschen mit und ohne Migrationsbiographie<br />
beitragen. Teilhabe sollte als<br />
Zielvorstellung also ungeachtet von Gruppenzugehörigkeiten,<br />
Geschlecht, Alter<br />
oder anderer Merkmale auf die Herstellung<br />
von Lebenschancengleichheit ausgerichtet<br />
sein. Hierzu zählen allgemeine Politiken<br />
für gute Bildung, Ausbildung und<br />
Arbeit. Hinzukommen spezifische Maßnahmen,<br />
die darauf abzielen, strukturelle<br />
Hürden abzubauen.<br />
Wie ist das Programm vor diesem Hintergrund<br />
nun einzuordnen? Welche Fortoder<br />
Rückschritte haben sich vollzogen?<br />
Hierzu folgt zunächst eine Skizzierung<br />
einschlägiger Beschlüsse. 9<br />
3. Programm Genese – vom Berliner<br />
Programm bis zur Zukunftswerkstatt<br />
Integration 10<br />
Das Verhältnis der SPD zur Rolle der<br />
Nation ist programmatisch komplex. Seit<br />
ihrer Gründung verstand sich die SPD als<br />
Teil einer internationalen ArbeiterInnenbewegung,<br />
die sich im Spannungsverhältnis<br />
von Partikularismus und Universalismus<br />
bewegt. In der Programmatik der<br />
SPD findet sich kontinuierlich das republikanische<br />
Nationenverständnis wider. Allerdings<br />
zeigt die Nachzeichnung der Beschlüsse,<br />
dass sich die SPD noch in einer<br />
Suchbewegung befindet hinsichtlich der<br />
Frage, wie der Staat mit Diversität umgehen<br />
sollte.<br />
Bereits im Berliner Grundsatzprogramm<br />
von 1989 findet sich unter der<br />
Überschrift: „Solidarität zwischen Kulturen“<br />
eine erste programmatische Positio-<br />
9 Quellen: Berliner Grundsatzprogramm, Berliner<br />
Rede von Bundespräsident Johannes Rau, Wahlmaifest<br />
2005, Hamburger Grundsatzprogramm,<br />
Regierungsprogramm 2009, Deutschlandplan,<br />
Beschlüsse des Bundesparteitages 2010 und 2012,<br />
Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion, Beschluss<br />
des Parteivorstandes von 05/2011, Bericht<br />
der Zukunftswerkstatt Integration 2009 – 2011.<br />
10 Vgl. Kaya <strong>2013</strong>.<br />
79
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 80<br />
nierung. Vielfalt wird bejaht und die Realität<br />
multikultureller Gesellschaften in ganz<br />
Europa anerkannt: „In der Bundesrepublik<br />
leben Menschen unterschiedlicher Nationalität,<br />
Kultur und Religion zusammen; die<br />
Länder Europas sind multikulturell geworden.“<br />
(ebd. 24). Fehlende Zugänge zur gesellschaftlichen<br />
Partizipation werden kritisiert<br />
(ebd.). Gleichwohl hatte die<br />
Perspektive auf Einwanderer und ihrer<br />
Kinder einen eher paternalistischen Anstrich.<br />
18 Jahre später ist ein programmatischer<br />
Wandel im Hamburger Programm<br />
(2007) nachzulesen. Darin vollzieht sich<br />
ein eindeutiger Perspektivwechsel auf Einwanderer<br />
und Neudeutsche. Anders als zuvor<br />
im Berliner Programm fällt die Sicht<br />
auf Einwanderer unter der Überschrift „Integration<br />
und Einwanderung“ nunmehr<br />
ambivalent aus. Besondere Betonung findet<br />
der ökonomische Nutzen durch Einwanderung<br />
für Deutschland. Die Einsicht<br />
in „gemeinsame Anstrengungen“ wird explizit<br />
mit Forderungen nach individuellen<br />
Integrationsleistungen verbunden. Wobei<br />
unklar bleibt, was die sozialdemokratische<br />
Deutung des Begriffs Integration ist. Die<br />
Ausführungen sind vom Zeitgeist des Forderns<br />
und Förderns geprägt, wobei das<br />
Fordern überwiegt (ebd. 36). Insgesamt<br />
findet sich hier der Mainstream-Diskurs<br />
einer Defizit-Perspektive auf Einwanderer<br />
und Bindestrich-Deutsche wieder.<br />
Bereits im Wahlprogramm „Vertrauen<br />
in Deutschland – das Wahlmanifest der<br />
SPD“, zwei Jahre zuvor (2005), kündigte<br />
sich die tendenzielle Problemperspektive<br />
auf die Einwanderungsgesellschaft an. Das<br />
Augenmerk lag in diesem Programm auf<br />
Restriktionen und die Defizite der „Personen<br />
ausländischer Herkunft“ (sic!). Die<br />
Kernforderungen beziehen sich auf die<br />
Ablehnung von Parallelgesellschaften und<br />
Zwangsverheiratung sowie Bekenntnissen<br />
zur Gleichberechtigung von Mann und<br />
Frau, zur Sprachförderung und der Einführung<br />
staatlichen Islam-Unterrichts.<br />
Für die folgende <strong>Bundestagswahl</strong><br />
(2009) legte die SPD sowohl das Wahlprogramm<br />
„Sozial und demokratisch. Anpa -<br />
cken für Deutschland“ als auch den so genannten<br />
Deutschlandplan des Spit zen kan -<br />
didaten Frank-Walter Steinmeier vor. Anders<br />
als im vorangegangenen Wahlprogramm<br />
wurde hier eine positive Perspektive<br />
auf die deutsche Einwanderungsgesellschaft<br />
eingenommen. Integration wurde<br />
hierin erstmals als Politik der Chancengleichheit<br />
verstanden, bei der es um die<br />
Förderung von Potenzialen und um eine<br />
Kultur der Anerkennung geht. Kernforderungen<br />
waren die interkulturelle Öffnung<br />
der Verwaltung sowie eine proaktive Einbürgerungspolitik.<br />
Anders als zuvor wurde<br />
nun der Gestaltungsauftrag der Politik angenommen.<br />
„Gelingende Integration“<br />
wurde nicht mehr ausschließlich als zu erbringende<br />
Individualleistung von EinwanderInnen<br />
und PostmigrantInnen gesehen.<br />
Gleichzeitig fand wieder ein Rekurs<br />
statt: Integration wird mit Sicherheitspolitik<br />
verknüpft. Im Deutschlandplan des<br />
Kanzlerkandidaten Steinmeier wird der<br />
Ansatz Integration durch Bildung aufgegriffen<br />
und mit Blick auf den volkwirtschaftlichen<br />
Nutzen argumentativ untermauert.<br />
Institutionell wird ein<br />
Bundesministerium für Bildung und Integration<br />
vorgeschlagen. Dieser bemerkenswerte<br />
Vorschlag findet sich in keinem späteren<br />
Programmtext wieder.<br />
80 Die SPD auf dem Weg zu einem progressiven Selbstverständnis im pluralen Deutschland? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 81<br />
Seit dem Jahr 2010 11 unternimmt die<br />
SPD merklich große Anstrengungen, um<br />
sich programmatisch neu aufzustellen.<br />
Jüngst gründete sich auf Beschluss des<br />
Bundesparteitages 2011 die Bundes-AG<br />
Migration und Vielfalt.<br />
Unter dem Eindruck der Sarrazin-Debatte<br />
beschloss der Bundesparteitag 2010<br />
die Resolution „Ohne Angst und Träumereien.<br />
Gemeinsam in Deutschland leben.“<br />
Sie verkörpert den inhaltlichen Widerspruch<br />
zwischen einem Bekenntnis zur<br />
Einwanderungsgesellschaft und dem Verständnis<br />
von Integration als vornehmlich<br />
soziale Frage (Aufstiegsversprechen) einerseits<br />
und der Defizit-geleiteten Sichtweise<br />
auf Einwanderung mit Augenmerk auf die<br />
Integrationspflicht von „Zuwanderern“ andererseits.<br />
Bemerkenswerterweise hat man<br />
für die Resolution auf die gleichnamige<br />
Berliner Rede des damaligen Bundespräsidenten<br />
Johannes Rau aus dem Jahr 2000<br />
zurückgegriffen. Sie lieferte kaum zukunftsweisende<br />
Impulse: „Zuwanderungspolitik“<br />
wurde darin ausschließlich über ihren<br />
volkswirtschaftlichen Nutzen legitimiert.<br />
Einwanderer und Neudeutsche wurden<br />
problembehaftet konnotiert. 12 Integration<br />
vornehmlich mit Anstrengung assoziiert.<br />
Im Jahr 2011 wurde eine Reihe von<br />
programmatischen Beiträgen veröffentlicht.<br />
Im Februar 2011 setzte das Positionspapier<br />
Integration der Bundestagsfraktion<br />
einen programmatischen Kontrapunkt<br />
zur vorangegangenen Resolution. Indem<br />
Integration als Frage von Zugehörigkeit<br />
und als sozialpolitische Aufgabe definiert,<br />
sowie der Querschnittscharakter des Politikfeldes<br />
durchdekliniert wurde, fand eine<br />
Abkehr vom 2010 begonnen negativen<br />
Mainstreamdiskurs statt. Das Positionspapier<br />
markiert die Fortsetzung der 2009er<br />
Papiere um Frank-Walter Steinmeier.<br />
Nach dem gescheiterten Ausschlussverfahren<br />
von Thilo Sarrazin (April 2011)<br />
fasste der Parteivorstand im Mai 2011 den<br />
Beschluss „Für Gleichberechtigung und<br />
eine Kultur der Anerkennung“. Hierin<br />
wurde die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit<br />
proklamiert, die sich zu einer<br />
Kultur der Anerkennung und Teilhabe bekennt.<br />
Darüber hinaus wurde darin eine<br />
aktive Hinwendung zur interkulturellen<br />
Öffnung der SPD formuliert. Damit nahm<br />
der Parteivorstand eine inhaltliche Abkehr<br />
von der im Dezember 2010 auf dem Bundesparteitag<br />
beschlossenen Resolution vor.<br />
Im Frühjahr 2012 legte schließlich die<br />
Steuerungsgruppe der Zukunftswerkstatt<br />
Integration das Ergebnis ihrer 2-jährigen<br />
Arbeit unter dem Titel „Auf dem Weg zu<br />
einer modernen Integrationspolitik. Anregungen<br />
zur programmatischen Positionsbestimmung<br />
aus der Zukunftswerkstatt Integration<br />
2009 – 2011“ vor. Der 50-seitige<br />
Bericht umfasste programmatische Impulse<br />
zu den folgenden Schwerpunkten: Bildung,<br />
Wirtschaft und Arbeit, Kommune<br />
und soziale Stadt, Migrationsrecht und<br />
Verwaltung, Politik und Partei sowie Religion<br />
– Schwerpunkt Islam. Besonders her-<br />
11 Am 30.08.2010 veröffentlichte der SPD-Politiker<br />
Thilo Sarrazin das Buch „Deutschland schafft<br />
sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen“<br />
Deutsche-Verlags-Anstalt. Laut Media Control<br />
wurden bis Januar 2012 1,5 Mio. gebundene Exemplare<br />
verkauft.<br />
12 Beispielsweise: „Ich kann verstehen, wenn nicht<br />
nur Mädchen und junge Frauen Angst vor der<br />
Anmache oder Einschüchterung durch Cliquen<br />
von ausländischen Jugendlichen haben.“ (ebd.).<br />
81
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 82<br />
vorzuheben sind die Kernelemente in den<br />
Feldern Bildung, Migrationsrecht und<br />
Verwaltung sowie Politik und Partei. Bildung<br />
als soziale Frage in der Einwanderungsgesellschaft.<br />
Zudem wird ein Leitbild<br />
einer serviceorientierten Verwaltung im<br />
Migrationsrecht skizziert. Denn die integrationsorientierte<br />
Servicefunktion, also<br />
der Dienstleistungscharakter der Behörden,<br />
steht „mitunter noch in der Tradition<br />
des Fremdenrechts.“ (SVR 2011: 77 f.).<br />
4. Wahlprogramm <strong>2013</strong>:<br />
Gleichberechtigte Teilhabe –<br />
Für eine moderne Integrationspolitik<br />
Das Wahlprogramm reiht sich ein in<br />
die Linie des Steinmeier-Papiers (Chancenpolitik,<br />
Interkulturelle Öffnung, proaktive<br />
Einbürgerungspolitik), der Positionierung<br />
der Bundestagsfraktion (Zugehörigkeit<br />
und Sozialpolitik stehen im Fokus;<br />
der Querschnittscharakter des Politikfeldes<br />
wird angepeilt) und der Steuerungsgruppe<br />
(u. a. Bildung als soziale Frage,<br />
serviceorientierte Verwaltung). Im Wahlprogramm<br />
fehlen ein konsequenter Querschnittscharakter<br />
und eine progressive Begriffspraxis.<br />
Außerdem bleibt es teilweise<br />
zurück hinter weitergehenden Beschlüssen.<br />
Die Forderungen für eine moderne<br />
Teilhabepolitik im Einzelnen, exemplarisch<br />
kommentiert (58 – 60):<br />
• „Gemeinsam mit den Ländern wollen<br />
wir deshalb die Ausländerbehörden zu<br />
Willkommensbehörden, zu Anlaufund<br />
Leitstellen für Integration und<br />
Einbürgerung weiterentwickeln.“ (58)<br />
Bereits die Steuerungsgruppe der Integrationswerkstatt<br />
schlug einen Organisationswandel<br />
der Ausländerbehörden vor,<br />
hin zu einer serviceorientierten Verwaltung.<br />
Wie die Willkommensbehörden ausgestaltet<br />
werden sollen, bleibt im Wahlprogramm<br />
unklar: Orientiert sich die SPD<br />
damit am kanadischen Modell der Welcome<br />
Center, die in Trägerschaft von MigrantInnenorganisationen<br />
liegen, oder am<br />
Hamburger Modell? Auch die Frage nach<br />
einer generellen Umstrukturierung bleibt<br />
offen: Möchte die SPD das Politikfeld aufwerten,<br />
indem es an ein Bundesministerium<br />
angegliedert oder in die Funktion der<br />
Staatsministerien aufgewertet wird?<br />
• Die SPD möchte „den Öffentlichen<br />
Dienst weiter für Menschen mit Migrationshintergrund<br />
öffnen und ihren<br />
Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl<br />
signifikant erhöhen. Mit weiteren Modellversuchen<br />
werden wir prüfen, ob<br />
auch die anonymisierte Bewerbung geeignet<br />
ist, dieses Ziel zu erreichen.“<br />
(59)<br />
Bereits im Steinmeier-Papier bekannte<br />
sich die SPD zu einer interkulturellen<br />
Öffnung des öffentlichen Dienstes. Die<br />
SPD-Bundestagsfraktion fasste danach<br />
einen weitergehenden Beschluss hierzu:<br />
„Bewerbungsverfahren sind entsprechend<br />
der Zielrichtung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes<br />
anonymisiert durchzuführen,<br />
damit Bewerberinnen und Bewerber<br />
mit Migrationshintergrund bei<br />
Bewerbungen nicht von vornherein von<br />
Vorstellungsgesprächen ausgeschlossen<br />
werden. Es sind die notwendigen gesetzlichen<br />
Anpassungen vorzunehmen.“ Und:<br />
„Um Diskriminierung zu beseitigen, sollten<br />
im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft<br />
verbindliche Zielvereinbarungen,<br />
die zum Inhalt haben, den Anteil<br />
82<br />
Die SPD auf dem Weg zu einem progressiven Selbstverständnis im pluralen Deutschland? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 83<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
an den Beschäftigten zu erhöhen,<br />
getroffen werden. Der öffentliche Dienst<br />
sollte hierbei eine Vorreiterrolle übernehmen“.<br />
13 Insofern bleibt das Wahlprogramm<br />
hinter aktuellen Positionierungen zurück.<br />
• Das Programm Soziale Stadt soll wieder<br />
umfänglich wirken und unter Einbeziehung<br />
der MigrantInnenorganisationen<br />
sollen die lokalen Bündnisse für<br />
Teilhabe und sozialen Zusammenhalt<br />
wieder gestärkt werden.<br />
MigrantInnenorganisationen können<br />
über die kommunale Arbeit hinaus eine<br />
Brückenfunktion einnehmen und einen<br />
Beitrag zur politischen und sozialen Partizipation<br />
von Personen mit Migrationsbiographie<br />
leisten. MigrantInnenorganisationen<br />
sind in Zeiten von<br />
Islamkonferenz, Integrationsgipfel und<br />
nationalen Aktionsplänen gefragt wie nie.<br />
Sie sollen und wollen als professioneller<br />
Akteur an der Gestaltung der deutschen<br />
Einwanderungsgesellschaft mitarbeiten.<br />
Daher positionierte sich die SPD-Bundestagsfraktion<br />
im Herbst 2012 für tragfähige<br />
Förderstrukturen bundesweiter MigrantInnenorganisationen.<br />
14 Dieser Aspekt<br />
bleibt im Wahlprogramm unberührt.<br />
• Deutschland soll vom Einwanderungsland<br />
zum Einbürgerungsland werden.<br />
• Die doppelte Staatsbürgerschaft soll im<br />
Regelfall akzeptiert und die Optionspflicht<br />
abgeschafft werden.<br />
• Ausländische Studierende, die in<br />
Deutschland einen Hochschulabschluss<br />
oder eine vergleichbare Qualifikation<br />
(z. B. Meisterprüfung) erwerben,<br />
soll ermöglicht werden, ohne Einschränkungen<br />
in Deutschland zu arbeiten.<br />
• Die SPD möchte das kommunale<br />
Wahlrecht nach einem fünfjährigen legalen<br />
Aufenthalt einführen.<br />
• Die Qualität der Integrationskurse soll<br />
– die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte<br />
eingeschlossen – weiter verbessert<br />
werden.<br />
• Der Familiennachzug soll erleichtert<br />
werden.<br />
5. Fazit<br />
Die Bewertung des Wahlprogramms<br />
<strong>2013</strong> fällt ambivalent aus: Die Hinwendung<br />
zu einer Gesellschaftspolitik, die sich<br />
dem Anspruch auf Teilhabe verpflichtet, ist<br />
ein begrüßenswerter Fortschritt. Sie passt<br />
sich hervorragend in das Leitmotiv eines<br />
neuen Miteinanders ein. In diesem Sinne<br />
beschreitet die SPD den richtigen Weg.<br />
Der Perspektivwechsel weg vom Integrationsbegriff<br />
hin zu einer kohärenten Gesellschaftspolitik<br />
muss aber noch normativ<br />
aufgeladen werden. Bislang fehlt es an einer<br />
überzeugenden Diversitätspolitik aus<br />
einem Guss. Noch fehlt es an einer Gesellschaftsvision.<br />
l<br />
13 Drucksache 17/9974: Neue Chancen für Menschen<br />
mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt.<br />
14 Drucksache 17/10200: Änderungsantrag der<br />
Fraktion der SPD im Innenausschuss des Deutschen<br />
Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes<br />
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans<br />
für das Jahr 2012.<br />
83
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 84<br />
Literatur<br />
Kaya, Daniela (<strong>2013</strong>): Deutschland neu erfinden.<br />
Impulse für die Neuausrichtung sozialdemokratischer<br />
Integrationspolitik. Rotation Vorwärts Verlag<br />
Merkel, Wolfang et. al. (2006): Die Reformfähigkeit<br />
der Sozialdemokratie. Herausforderungen und<br />
Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa.<br />
Wiesbaden.<br />
Mikler, Anja (2006): Migrationsdiskurse politischer<br />
Eliten: Identitätspolitik durch einen Diskurs der<br />
Ungleichheit? Eine diskursanalytische Untersuchung<br />
von Migrationsdiskursen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland 1999 – 2002. Dissertation, Universität<br />
Dortmund.<br />
Rau, Johannes (2000): Ohne Angst und Träumereien:<br />
Gemeinsam in Deutschland leben. Berliner Rede<br />
des Bundespräsidenten.<br />
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für<br />
Integration und Migration (SVR) (2011):<br />
Einwanderungsgesellschaft 2010. Jahresgutachten<br />
mit Integrationsbarometer.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1989):<br />
Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen<br />
Partei Deutschlands. Beschlossen vom Programm-<br />
Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands<br />
am 20. Dezember 1989 in Berlin („Berliner<br />
Programm“).<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (2005):<br />
Vertrauen in Deutschland – das Wahlmanifest der<br />
SPD.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (2011):<br />
Beschlüsse des ordentlichen Bundesparteitages der<br />
SPD in Berlin, 4.-6. Dezember 2011.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Grundwertekommission<br />
beim Parteivorstand (2011):<br />
Gleichberechtigt zusammenleben Grundwerte<br />
sozial demokratischer Integrationspolitik:<br />
demokratisch, pluralistisch und sozial.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partei -<br />
vorstand (2011): Für Gleichberechtigung und eine<br />
Kultur der Anerkennung.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partei -<br />
vorstand (2012): Auf dem Weg zu einer modernen<br />
Integrationspolitik. Anregungen zur programma -<br />
tischen Positionsbestimmung aus der Zukunfts -<br />
werkstatt Integration 2009 – 2011. Ergebnisbericht<br />
der Steuerungsgruppe.<br />
SPD-Bundestagsfraktion (2011): Gleichberechtigt<br />
miteinander leben. Positionspapier Integration.<br />
Themenreihe, Februar 2011.<br />
SPD-Bundestagsfraktion (13.06.2012). Neue<br />
Chancen für Menschen mit Migrationshintergrund<br />
am Arbeitsmarkt, Drucksache 17/9974, 17. Wahl -<br />
periode, Deutscher Bundestag.<br />
SPD-Bundestagsfraktion (2012): Änderungsantrag<br />
der Fraktion der SPD im Innenausschuss des Deutschen<br />
Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes über<br />
die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das<br />
Jahr 2012, Drucksache 17/10200, 17. Wahlperiode,<br />
Deutscher Bundestag.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (2007):<br />
Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der<br />
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.<br />
Beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag<br />
der SPD am 28. Oktober 2007.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (2009):<br />
Sozial und Demokratisch. Anpacken. Für Deutschland.<br />
Das Regierungsprogramm der SPD.<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (2010):<br />
Ohne Angst und Träumereien. Gemeinsam in<br />
Deutschland leben. Resolution des Bundespartei -<br />
tages.<br />
84 Die SPD auf dem Weg zu einem progressiven Selbstverständnis im pluralen Deutschland? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 85<br />
DIE WÜRDE DER ARBEIT<br />
– SPD-POLITIK<br />
FÜR BESCHÄFTIGTE<br />
von Klaus Wiesehügel, Vorsitzender der Gewerkschaft IG BAU und zuständig für den<br />
Bereich Arbeit und Soziales im Kompetenzteam von Peer Steinbrück<br />
In den deutschen Medien ist ein Stimmungswandel<br />
zu beobachten. Über<br />
viele Jahre beschäftigten sich Print-,<br />
Rundfunk- und Fernsehbeiträge mit<br />
„faulen“ Arbeitslosen, „Sozialabzocke“,<br />
„überhöhten“ tariflichen Leistungen<br />
und vielem mehr. Die Grundtendenz<br />
bei vielen Beiträgen war klar: Die Errungenschaften,<br />
für die Generationen<br />
von Gewerkschaftern und Sozial -<br />
demokraten durchaus erfolgreich gekämpft<br />
hatten, waren mitschuldig an<br />
hoher Arbeitslosigkeit und mangelnder<br />
Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Seit einiger Zeit hat sich das Bild gewandelt.<br />
Berichte über unzumutbare Arbeitsbedingungen<br />
beim größten Versandhändler<br />
Amazon, die Ausbeutung von<br />
Menschen über (Schein-) Werkverträge<br />
bei einem Hersteller deutscher Luxusautos<br />
oder zuletzt die unwürdige Beschäftigung<br />
in der Fleischzerlegung zeigen, dass der radikale<br />
Wandel der Arbeitswelt dramatische<br />
Folgen im deutschen Sozialgefüge hat und<br />
dass diese Entwicklung auch vielen zu denken<br />
gibt, von denen man es früher nicht<br />
unbedingt erwartet hätte. Die Berichterstattung<br />
macht nun einer breiten Öffentlichkeit<br />
deutlich: Wir haben es mit einer<br />
tiefgreifenden Entwertung von Erwerbsarbeit<br />
zu tun. Und diese Entwertung hat verschiedene<br />
Facetten.<br />
Erwerbsarbeit wird entwertet, weil sie<br />
immer schlechter bezahlt wird. Das WSI<br />
der Hans-Böckler-Stiftung hat unlängst<br />
bekanntgegeben, dass Deutschland den<br />
siebtgrößten Niedriglohnsektor in der Europäischen<br />
Union hat. Vor uns liegen Litauen,<br />
Lettland, Estland, Rumänien, Polen<br />
und Zypern. Und dann kommt unser<br />
Land, ein Land, das sich gleichzeitig mit<br />
dem Titel des Exportweltmeisters schmückt.<br />
Mittlerweile arbeiten rund 23 % der Beschäftigten<br />
im Niedriglohnbereich. 6,8<br />
Mil lionen Menschen verdienen weniger als<br />
8,50 Euro. Rund 1,3 Millionen Menschen<br />
müssen sich trotz Arbeit staatliche Unterstützung<br />
holen.<br />
85
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 86<br />
Im Berliner Stadtbezirk Schöneberg<br />
wirbt ein Friseurgeschäft mit einem Preis<br />
für den Haarschnitt von 6,95 Euro. Wohlgemerkt:<br />
Der Friseurberuf erfordert eine<br />
Ausbildung von drei Jahren. Bei einem<br />
Haarschnitt für 6,95 Euro kann man nur<br />
vermuten, wie viel Lohn für den Friseur<br />
oder die Friseurin übrigbleibt.<br />
Wie muss sich ein Mensch fühlen, der<br />
eine lange Ausbildung absolviert hat und<br />
jeden Tag hart arbeitet, wenn sein Fachwissen<br />
und Können derart verramscht<br />
wird?<br />
Deswegen brauchen wir den gesetzlichen<br />
Mindestlohn von mindestens 8,50<br />
Euro, einheitlich, in allen Branchen, in Ost<br />
und West. Die Union will das nicht, die<br />
FDP schon gar nicht. Sie wollen differenzieren,<br />
nach Branchen und nach Regionen.<br />
Sie vergessen dabei einen ganz entscheidenden<br />
Punkt: Der Mindestlohn muss gewährleisten,<br />
dass Arbeit zum Leben reicht.<br />
Dabei geht es um die Würde des Menschen<br />
und seiner Arbeit. Und die Würde<br />
des Menschen und seiner Arbeit kann man<br />
nicht differenzieren, nicht nach Branchen<br />
und nicht nach Regionen. Diesen Grundzusammenhang<br />
haben Merkel und von der<br />
Leyen nicht verstanden, oder schlimmer,<br />
wahrscheinlich ist es ihnen egal.<br />
Vor kurzem wurde ein tariflicher Mindestlohn<br />
für das Friseurhandwerk vereinbart,<br />
der stufenweise eingeführt wird. Ab<br />
2015 soll ein einheitlicher Mindestlohn von<br />
8,50 Euro gelten. Dieser tarifliche Mindestlohn<br />
gilt aber erst einmal nur in den Betrieben,<br />
die Mitglied des Innungsverbandes<br />
sind. Im Saarland beispielsweise sind aber<br />
nur 190 der 1.000 Friseurbetriebe Mitglied<br />
der Innung. Deswegen wird die Allgemein -<br />
verbindlichkeit des Tarifabschlusses angestrebt.<br />
Dafür gibt es aber derzeit noch zu<br />
hohe Hürden.<br />
Niedriglöhne sind in den Betrieben<br />
weit häufiger, in denen es keine Tarifbindung<br />
gibt. Und die Tarifbindung befindet<br />
sich seit vielen Jahren im Sinkflug. Derzeit<br />
arbeiten noch 61 % der westdeutschen Beschäftigten<br />
und nur noch 49 % der ostdeutschen<br />
Beschäftigten in einem tarifgebundenen<br />
Betrieb. Das ist ein Grund,<br />
warum insgesamt der Druck auf die Löhne<br />
massiv zugenommen hat und warum wir<br />
über viele Jahre eine schlechtere Reallohnentwicklung<br />
hatten, als in allen anderen<br />
unserer Nachbarländer. Aufgrund dieser<br />
Entwicklung ist die Behauptung von Konservativen<br />
und Liberalen auch Unsinn, der<br />
gesetzliche Mindestlohn sei ein Eingriff in<br />
die Tarifautonomie. Die massive Tarifflucht<br />
vieler Betriebe macht den Mindestlohn<br />
notwendig und stellt eine Ergänzung<br />
des Tarifvertragssystems dar. Tarifflucht<br />
darf sich nicht lohnen. Deshalb werden wir<br />
die Bedingungen erleichtern, unter denen<br />
ein Tarifvertrag allgemeinverbindlich werden<br />
kann und damit für alle Arbeitgeber<br />
und Beschäftigten einer Branche gilt. Derzeit<br />
müssen als Voraussetzung 50 % der<br />
Beschäftigten einer Branche in einem tarifgebundenen<br />
Betrieb arbeiten. Dieses<br />
Quorum wird immer seltener erreicht. Nur<br />
etwas mehr als 500 von insgesamt rund<br />
68.000 gültigen Tarifverträgen sind heute<br />
allgemeinverbindlich, eine größere Zahl<br />
darunter übrigens im Baugewerbe. Die<br />
SPD wird deshalb das 50 %-Quorum<br />
durch Kriterien ersetzen, die das öffentliche<br />
Interesse an der Allgemeinverbindlichkeit<br />
konkretisieren. Wenn wir die Zahl allgemeinverbindlicher<br />
Tarifverträge steigern,<br />
stärken wir damit auch die Tarifautonomie.<br />
86 Die Würde der Arbeit – SPD-Politik für Beschäftigte Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 87<br />
Erwerbsarbeit wird aber auch entwertet,<br />
weil sie unsicherer geworden ist. Diese<br />
Entwicklung geht über alle Branchen. Im<br />
produzierenden Gewerbe ebenso wie im<br />
Handwerk und im Dienstleistungsbereich.<br />
Es geht einerseits um die massive Ausweitung<br />
von Leiharbeit. Die Deregulierung<br />
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im<br />
Rahmen der Hartz-Reformen hat nicht<br />
zum erhofften Ziel geführt, Arbeitslose<br />
schneller in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.<br />
Der so genannte Klebeeffekt<br />
liegt unter 15 % der Leiharbeitsverhältnisse.<br />
Stattdessen wurden größere Teile der<br />
Stammbelegschaften durch unsichere,<br />
schlechter bezahlte Leiharbeit ersetzt.<br />
Dem Lohndumping wurde Tür und Tor<br />
geöffnet. Die tariflich vereinbarten Zuschläge<br />
für Leiharbeit sind zwar ein Schritt<br />
in die richtige Richtung, die gesetzliche<br />
Durchsetzung von equal pay und equal<br />
treatment ersetzen sie aber nicht. Sie ist<br />
überfällig.<br />
Und dann geht es um den Missbrauch<br />
von Werkverträgen: die alte Masche in<br />
Branchen, in denen Leiharbeit verboten<br />
ist, die neue Masche der Arbeitgeber, denen<br />
selbst Leiharbeit zu teuer geworden<br />
ist. Wir brauchen eine klarere, einfacher<br />
nachweisbare gesetzliche Regelung, wo ein<br />
Werkvertrag aufhört und illegale Arbeitnehmerüberlassung<br />
beginnt. Vor allem<br />
muss der Missbrauch einfacher und stärker<br />
kontrolliert und durch Staatsanwälte verfolgt<br />
werden, die sich in der Materie auskennen.<br />
Und es geht um die Millionen Menschen,<br />
die nur einen befristeten Vertrag bekommen.<br />
Jeder zweite neue Arbeitsvertrag<br />
wird nur noch befristet abgeschlossen. Vor<br />
kurzem hat die IG Metall die Ergebnisse<br />
ihrer Beschäftigtenbefragung veröffentlicht,<br />
an der sich mehr als eine halbe Million<br />
Beschäftigte beteiligt haben. Auf die<br />
Frage, was sie mit guter Arbeit verbinden,<br />
antworteten die meisten nicht „ein gutes<br />
Betriebsklima“ oder „eine interessante Arbeit“.<br />
99 % halten einen unbefristeten Arbeitsvertrag<br />
für entscheidend. Ich bin sicher,<br />
vor 20 Jahren sah die Priorität noch<br />
anders aus, weil sich dieses Problem für die<br />
meisten überhaupt nicht stellte. Es geht für<br />
viele heute schlicht um Planungssicherheit,<br />
ohne die Sorge, wie es in einem Jahr weitergeht.<br />
Gerade von jungen Menschen<br />
wird verlangt, sie sollten vorsorgen, Wohneigentum<br />
schaffen, eine Familie gründen<br />
und sich am besten auch noch ehrenamtlich<br />
engagieren. Gleichzeitig sind es gerade<br />
junge Menschen, die von einem befristeten<br />
Vertrag in den anderen geschoben werden.<br />
Das passt nicht zusammen. Und deswegen<br />
werden wir die sachgrundlose Befristung<br />
abschaffen. Sie hat nicht mehr Beschäftigung<br />
gebracht, sondern mehr unsichere<br />
Beschäftigung.<br />
Und letztlich wird Erwerbsarbeit oft<br />
nachträglich entwertet, wenn man sie unverschuldet<br />
verliert. Ein Viertel der Menschen,<br />
die arbeitslos werden, bekommt gar<br />
kein Arbeitslosengeld mehr, sondern<br />
rutscht direkt in Hartz IV. Sie zahlen zwar<br />
Beiträge in die Arbeitslosenversicherung,<br />
schaffen es aber nicht, die notwendige Zeit<br />
in Arbeit zu bleiben, die einen Anspruch<br />
auf Arbeitslosengeld begründet. Eine Folge<br />
von zunehmender prekärer Beschäftigung,<br />
von Leiharbeit, Niedriglohn und Befristungen.<br />
Darum müssen wir uns<br />
kümmern. Indem wir prekäre Beschäftigung<br />
zurückdrängen; und indem wir die<br />
Anspruchsvoraussetzungen der Arbeitslosenversicherung<br />
wieder verbessern. Das<br />
87
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 88<br />
steht in unserem Wahlprogramm. Für<br />
manche mag das ein Detail sein, für sehr<br />
viele Menschen bedeutet es mehr Schutz<br />
gegen Abstieg und Existenzangst.<br />
Das sind wichtige Maßnahmen, um<br />
zentrale Sicherungsversprechen unserer<br />
Arbeitsgesellschaft und unseres Sozialstaates<br />
wieder mit Leben zu füllen. Leistung<br />
lohnt sich und wenn Du unverschuldet in<br />
Not gerätst, wird Dir geholfen und Du<br />
musst Dir keine Sorgen um Deine Existenz<br />
machen.<br />
Die Würde des Menschen und die<br />
Würde der Arbeit ist für die Sozialdemokratie<br />
immer unverzichtbar und auch<br />
durch eine starke Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer in<br />
den Betrieben gewährleistet worden. Die<br />
Würde des Menschen und seiner Arbeit<br />
verlangt die Demokratisierung der Wirtschaft.<br />
Die Interessen der Menschen müssen<br />
im Vordergrund sozial verantwortbaren<br />
Wirtschaftens stehen, nicht kurzfristige<br />
Gewinninteressen. Mehr Demokratie im<br />
Betrieb zu wagen ist deshalb eine zentrale<br />
Herausforderung der nächsten Jahre. Das<br />
betrifft mehrere Ebenen: die Mitbestimmung<br />
der Arbeitnehmerbank in den Aufsichtsräten,<br />
die Rechte der Betriebsräte sowie<br />
Dialog- und Beteiligungs möglichkeiten<br />
der Beschäftigten.<br />
Uns allen ist die Hilflosigkeit der Betroffenen<br />
und der Politik in schlechter Erinnerung,<br />
als etwa Nokia in Bochum oder<br />
AEG in Nürnberg die Tore schlossen und<br />
die Produktion ins Ausland verlagerten,<br />
weil sich dort noch etwas billiger – aber<br />
nicht besser – produzieren ließ. Wir müssen<br />
die Rechte der Betriebsräte und Gewerkschaften<br />
in den Aufsichtsräten stärken,<br />
indem wir einen gesetzlichen Mindestkatalog<br />
zustimmungsbedürftiger Geschäfte<br />
festlegen. Dazu muss die Entscheidung<br />
über Einrichtung, Schließung oder<br />
Verlagerung von Produktionsstandorten<br />
gehören. Zugleich wollen wir den Schwellenwert<br />
für die Geltung der paritätischen<br />
Mitbestimmung von derzeit 2.000 auf<br />
1.000 Beschäftigte senken. Und wir müssen<br />
endlich unterbinden, dass Unternehmen<br />
mit Sitz in Deutschland eine ausländische<br />
Rechtsform wie die „Limited“<br />
wählen, um das hiesige Mitbestimmungsrecht<br />
zu umgehen.<br />
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
erleben Mitbestimmung und Teilhabe<br />
in erster Linie über die Interessenvertretung<br />
im Betrieb. Betriebsräte helfen und<br />
unterstützen in vielen konkreten Fragen<br />
oder Problemen. Sie sind Ansprechpartner<br />
und Vertrauenspersonen und übernehmen<br />
häufig auch Managementaufgaben. Die<br />
Betriebsräte leisten einen unverzichtbaren<br />
Beitrag für mehr Demokratie und Ausgleich<br />
im Betrieb. Die Rechte der Betriebsräte<br />
zu stärken, hilft damit auch den<br />
Unternehmen, denn ein erfolgreiches Unternehmen<br />
lebt von seinen gut ausgebildeten<br />
und motivierten Beschäftigten.<br />
Die massive Ausweitung atypischer<br />
und prekärer Beschäftigungsformen setzt<br />
die Stammbelegschaften und die Betriebsräte<br />
zunehmend unter Druck. Der günstigere<br />
Mitarbeiter nebenan, der die gleiche<br />
Arbeit macht, aber nur die Hälfte bekommt,<br />
stellt immer auch ein Drohpotential<br />
dar. Es ist deshalb dringend notwendig,<br />
die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte<br />
bei Fremdbeschäftigung im Betrieb<br />
deutlich zu stärken. Das betrifft Umfang<br />
und Dauer von Leiharbeit ebenso wie das<br />
88 Die Würde der Arbeit – SPD-Politik für Beschäftigte Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 89<br />
Zustimmungsverweigerungsrecht beim<br />
Einsatz von Werkverträgen. Und natürlich<br />
müssen Leiharbeitsbeschäftigte bei der Bestimmung<br />
der zu wählenden Betriebsratsgröße<br />
mitzählen.<br />
Die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre<br />
wird sein, den Wert der Arbeit wiederherzustellen.<br />
Denn in den letzten 20 Jahren<br />
hat sich ein massiver Kultur- und<br />
Wertewandel in unserer Arbeitsgesellschaft<br />
vollzogen. Grundprinzipien der sozialen<br />
Marktwirtschaft wie die gerechte<br />
Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Erfolg,<br />
Teilhabe und Mitbestimmung werden zunehmend<br />
außer Kraft gesetzt und durch<br />
das Recht des Stärkeren ersetzt. Das ist in<br />
einer kapitalistischen Wirtschaftsweise<br />
nicht überraschend, aber die Bundesrepublik<br />
war mit dem Prinzip der sozialen<br />
Marktwirtschaft, den so genannten „weichen“<br />
Standortvorteilen, immer auch wirtschaftlich<br />
erfolgreich. Dieser Erfolg ist gefährdet.<br />
Auch deshalb müssen wir das, was<br />
in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen<br />
ist, wieder in geordnete Bahnen lenken.<br />
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt ist Ausdruck<br />
politischer Verantwortung im Interesse<br />
der Menschen, aber auch der vielen<br />
Unternehmen, die sich an die Regeln halten.<br />
Das war früher einmal politischer<br />
Konsens. Heute entziehen sich Union und<br />
FDP mit ihrer schon grotesken Tatenlosigkeit<br />
jeglicher Verantwortung für die Gestaltung<br />
politischer Rahmenbedingungen.<br />
Das ist auch eine Chance. Denn die<br />
Sozialdemokratie hat klare politische Alternativen<br />
benannt, für die ich als Person<br />
stehe. Wir brauchen Taten, die die Würde<br />
der Arbeit wiederherstellt! l<br />
89
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 90<br />
VON DER LEISTUNGS-<br />
ZUR ERBENGESELL-<br />
SCHAFT?<br />
von Anita Tiefensee, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hertie School<br />
of Governance*<br />
Wer sich anstrengt wird belohnt. Dieses<br />
Mantra wird nun schon seit Jahrzehnten<br />
ins Feld geführt, wenn es um<br />
das Thema (Um-)Verteilung geht. Das<br />
heißt, wer sich (weiter-)bildet und fleißig<br />
arbeitet erhält ein adäquates Einkommen<br />
und gesellschaftliches Ansehen.<br />
All jene, die ihren<br />
Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten<br />
können und auf Unterstützung<br />
vom Staat angewiesen sind, haben<br />
sich nach dieser Logik also nicht genug<br />
angestrengt, werden im Zweifel<br />
sogar als faul gebrandmarkt.<br />
Einflussfaktor Elternhaus<br />
Mal ganz abgesehen davon, dass starke<br />
Schultern mehr tragen können als Schwache,<br />
und dies gerade in einem Sozialstaat<br />
auch praktisch gelebt werden sollte, ist spätestens<br />
seit PISA bekannt, dass (schulischer)<br />
Erfolg nicht nur vom Leistungswillen<br />
oder gar der Begabung des Kindes<br />
abhängt. Ausschlaggebend ist, in welchem<br />
Elternhaus es groß geworden ist. Bereits<br />
bei der Empfehlung für die weiterführende<br />
Schule werden Kinder aus sogenannten<br />
bildungsfernen Haushalten bei gleicher<br />
Leistung benachteiligt (Bos et al. 2012).<br />
An die Uni/Hochschule schaffen es dann<br />
aktuell von 100 Kindern mit AkademikerInneneltern<br />
77, von 100 Kindern mit<br />
Nicht-AkademikerInneneltern sind es 23<br />
(Middendorff et al. <strong>2013</strong>). Dies hat natürlich<br />
Auswirkungen auf den beruflichen<br />
Werdegang und das damit verbundene<br />
Einkommen. Für Kinder aus AkademikerInnenhaushalten<br />
kommen neben der geistigen<br />
und finanziellen Unterstützung in<br />
der Schulzeit bei der Jobsuche weitere fördernde<br />
Aspekte hinzu, wie ein erlernter<br />
Habitus oder gute Kontakte der Eltern, die<br />
häufig türöffnend wirken. Eine Person aus<br />
einer bildungsfernen Familie hat somit bei<br />
gleichem Einkommen in der Regel (relativ<br />
gesehen) mehr dafür leisten müssen.<br />
Das Elternhaus bestimmt aber nicht<br />
nur das eigene Einkommen sondern, gerade<br />
auch das Vermögen. Dessen Besitz kann<br />
neben erweiterten Konsummöglichkeiten<br />
* Der Artikel gibt die persönliche Meinung der<br />
Autorin wieder und nicht die der Institution.<br />
90 Von der Leistungs- zur Erbengesellschaft? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 91<br />
u. a. auch Einkommensausfälle stabilisieren<br />
und der Alterssicherung, der (Aus-<br />
)Bildung von Kindern und der intergenerationalen<br />
Übertragung dienen. Der Besitz<br />
von Vermögen schafft somit eine finanzielle<br />
Unabhängigkeit, und das Vorhandensein<br />
von hohen Vermögen geht häufig mit einer<br />
wirtschaftlichen und politischen Machtposition<br />
einher (Grabka und Frick 2007 und<br />
Hauser 2009). Im Jahr 2007 belief sich das<br />
Nettogesamtvermögen der Personen in<br />
privaten Haushalten in Deutschland auf<br />
rund 6,1 Billionen Euro. 15 Die Konzentration<br />
des Vermögens nahm in den vergangenen<br />
Jahren zu. Zwischen 2002 und 2007<br />
stieg der Gini-Koeffizient 16 des individuellen<br />
Nettovermögens von 0,777 auf 0,799.<br />
Die oberen 10 Prozent der Bevölkerung<br />
hielten im Jahr 2002 57,9 Prozent am Gesamtvermögen,<br />
fünf Jahre später waren es<br />
bereits 61,1 Prozent. Die unteren 70 Prozent<br />
verfügten hingegen 2002 über 10,3<br />
Prozent und 2007 sogar nur noch über 8,8<br />
Prozent. Die unteren 30 Prozent besitzen<br />
nach wie vor kein bzw. ein negatives Nettovermögen<br />
(Frick, Grabka und Hauser 2010<br />
und Abbildung 1). Das verfügbare Ein-<br />
kommen ist hingegen wesentlich weniger<br />
konzentriert (vgl. Grabka, Goebel, Schupp<br />
2012).<br />
Materielles Vermögen erwirbt man<br />
entweder durch Sparen des eigenen Einkommens<br />
oder durch Schenkungen und<br />
Erbschaften. Diese werden in den nächsten<br />
Jahren gerade in Westdeutschland aus<br />
den seit den 1950er Jahren akkumulierten<br />
Vermögen bestehen. Braun, Pfeiffer und<br />
Thomschke (2011) prognostizieren die generationenübergreifenden<br />
Übertragungen<br />
zwischen 2011 und 2020 auf 1,7 Billionen<br />
Euro oder 174 Milliarden Euro jährlich.<br />
Immobilienbesitz wird den größten Anteil<br />
(ca. 50 Prozent) am Erbe ausmachen. Die<br />
Höhe der Erbschaft steigt laut der Prognose<br />
mit dem Einkommen. Geringverdiener<br />
erben zudem seltener. Es erben also vor allem<br />
diejenigen hohe Beträge, die es sich finanziell<br />
leisten konnten bereits überdurchschnittliche<br />
Vermögen aus ihrem lau fenden<br />
Einkommen anzusparen. Mit einer abnehmenden<br />
Kinderzahl wird das Erbschaftsvolumen<br />
zudem auf einen kleineren<br />
Teil der Bevölkerung verteilt, so dass davon<br />
ausgegangen werden kann, dass die Vermögensungleichheit<br />
weiter zunehmen<br />
dürfte.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Fakten<br />
stellt sich nun natürlich die Frage, wie sie<br />
Abbildung 1<br />
Quellen: SOEP, Berechnungen des DIW Berlin<br />
15 Grundlage dieser Berechnung (sowie der folgenden<br />
in diesem Absatz) ist das Sozio-oekonomische<br />
Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.<br />
Das dort erhobene Vermögen<br />
enthält keine PKWs oder Hausrat. Zudem wird<br />
der obere Rand der Verteilung trotz Hocheinkommensstichprobe<br />
immer noch untererfasst.<br />
16 Ein Wert von 0 bedeutet, dass das Vermögen auf<br />
alle Personen gleich verteilt ist. Ein Wert von 1<br />
heißt, dass das gesamte Vermögen einer einzigen<br />
Person gehört.<br />
91
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 92<br />
mit dem eingangs beschriebenen Mantra<br />
„Wer sich anstrengt wird belohnt“ zu vereinbaren<br />
sind. Der Weg über den vermeintlich<br />
klassischen Bildungsaufstieg ist<br />
mit vielen Hindernissen übersät. Er kann<br />
zwar zu einem hohen Einkommen und sicherlich<br />
auch zu einem gewissen Vermögen<br />
führen, aber die wirklich hohen Vermögen<br />
werden mittlerweile in der Regel<br />
von der vorherigen Generation übernommen.<br />
17 Sowohl Schenkungen als auch Erbschaften<br />
beruhen in der Regel nicht auf<br />
Leistung, sondern auf verwandtschaftlichen<br />
Verhältnissen. Ein Kind hat somit<br />
Glück oder Pech in eine wohlhabende oder<br />
eine arme Familie geboren zu werden. Natürlich<br />
zählen im Leben nicht nur materielle<br />
Dinge, sondern vor allem auch Liebe<br />
und Geborgenheit, die Eltern sowie das<br />
persönliche Umfeld völlig unabhängig von<br />
Einkommen und Vermögen geben können.<br />
Zudem wird in Deutschland eine materielle<br />
Grundsicherung vom Staat gewährleistet.<br />
Gesellschaftliche Teilhabe<br />
bedeutet allerdings weit mehr, sie funktioniert<br />
bei uns aktuell nur bedingt ohne materielle<br />
Ressourcen. Zudem gehen, wie bereits<br />
erwähnt, hohe Vermögen häufig mit<br />
einer wirtschaftlichen und politischen<br />
Machtposition einher, die über demokratische<br />
Wahlen hinausgehen.<br />
Was macht die SPD?<br />
Für die SPD steht „bei der Besteuerung<br />
von Erbschaften […] die Steuergerechtigkeit<br />
im Vordergrund“. Sie will deshalb „die<br />
missbräuchliche Ausnutzung von steuerlichen<br />
Gestaltungsmöglichkeiten zugunsten<br />
einer geringen Zahl reicher Erben nicht<br />
länger hinnehmen“ und „Begünstigungen<br />
bei der Erbschaftsbesteuerung künftig viel<br />
stärker an den dauerhaften Erhalt von Arbeitsplätzen<br />
koppeln“ (SPD <strong>2013</strong>, S. 68).<br />
Sehr begrüßenswerte Forderungen. Die<br />
Union lehnt eine Erhöhung der Erbschaftssteuer<br />
„entschieden ab“ (CDU/CSU<br />
<strong>2013</strong>, S. 27). Genau diese Debatte sollte allerdings,<br />
gerade auch von der SPD, geführt<br />
werden. Der maximale Steuerbetrag für<br />
Ehegatten/LebenspartnerInnen und Kinder<br />
liegt aktuell bei 30 Prozent (§§ 15 und<br />
19 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz,<br />
ErbStG). Dieser greift allerdings<br />
erst ab einer Erbsumme von 26 Millionen<br />
Euro pro Person – Freibeträgevon500.000<br />
Euro für Ehegatten/LebenspartnerInnen<br />
bzw. 400.000 Euro für jedes Kind sind<br />
hierbei bereits berücksichtigt (§§ 16 und<br />
19 ErbStG). 18 Ein Beispiel: Liegt die Erbsumme<br />
pro Person bei 500.000 Euro zahlen<br />
Ehegatten/LebenspartnerInnen überhaupt<br />
keine Erbschaftssteuer und Kinder<br />
müssen 11 Prozent von 100.000 Euro abgeben<br />
(also 11.000 Euro). Bei selbst genutzten<br />
Immobilien gibt es für Ehegatten/<br />
LebenspartnerInnen und Kinder zudem<br />
Sonderreglungen, die unabhängig vom<br />
Wert der Immobilie zu Steuerfreiheit führen<br />
können (§ 13 ErbStG). Wird Betriebsvermögen<br />
oder land- und forstwirtschaftliches<br />
Vermögen geerbt, kann die zu<br />
zahlende Erbschafssteuer bereits aktuell<br />
auf bis zu zehn Jahre zinslos gestundet<br />
werden, sofern dies zur Erhaltung des Betriebs<br />
notwendig ist (§ 28 ErbStG).<br />
17 Von den 10 reichsten Deutschen sind bereits über<br />
2/3 Erben (Manager Magazin 2012).<br />
18 Die Erbschaftssteuer kann aktuell maximal 50<br />
Prozent betragen. Dies betrifft alle übrigen Erben,<br />
die nicht in eine der folgenden Kategorien<br />
fallen: Ehegatten/LebenspartnerInnen, Kinder,<br />
EnkelInnen, Eltern, Geschwister. Der Freibetrag<br />
liegt für diese Gruppe bei 20.000 Euro (§§ 15, 16<br />
und 19 ErbStG).<br />
92 Von der Leistungs- zur Erbengesellschaft? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 93<br />
Die Steuereinnahmen aus der Erbschaftssteuer,<br />
die den Ländern zugute<br />
kommen, beliefen sich im Jahr 2012 auf 4,3<br />
Milliarden Euro. Die Kraftfahrzeugsteuer<br />
brachte im Vergleich fast doppelt so viel<br />
ein – 8,4 Milliarden Euro (Bundesministerium<br />
der Finanzen <strong>2013</strong>). Im Jahr 2010<br />
(das ähnliche Steuereinnahmen verzeichnete)<br />
waren lediglich etwa 10 Prozent der<br />
Erbfälle erbschaftssteuerpflichtig. Dies<br />
liegt an den hohen Freibeträgen innerhalb<br />
des familiären Bereichs (Braun, Pfeiffer<br />
und Thomschke 2011). Auch hierüber<br />
sollte die SPD eine ehrliche Debatte führen.<br />
Zwar machen gewisse Freibeträge mit<br />
Sicherheit Sinn, da gerade Haushalte, die<br />
über keinerlei Vermögen verfügen, erst<br />
durch eine Erbschaft in die Lage versetzt<br />
werden, Vermögen aufzubauen (Künemund<br />
und Vogel 2011). Aber über die<br />
Höhe der Freibeträge sollte die SPD noch<br />
einmal nachdenken und verschiedene Szenarien<br />
und ihre Verteilungswirkungen<br />
durchrechnen. Dabei sollten vor allem<br />
Auswirkungen auf das Immobilien- und<br />
Betriebsvermögen berücksichtigt werden<br />
sowie eventuelle Ausweicheffekte.<br />
In was für einer Gesellschaft wollen wir<br />
leben?<br />
Insgesamt sollte die SPD in der Debatte<br />
um die Erbschaftssteuer viel mehr betonen,<br />
dass es gerecht und zudem ökonomisch<br />
sinnvoll ist, wenn leistungslos<br />
ererbtes Vermögen angemessen besteuert<br />
wird. Chancengleichheit ist bekanntlich<br />
am ehestens gegeben, wenn möglichst alle<br />
Kinder von Anfang an von (frühkindlicher)<br />
Bildung profitieren. Dies kostet Geld. Mal<br />
ganz abgesehen davon, dass Menschen<br />
durch Bildung die Welt und ihre Möglichkeiten<br />
ganz anders wahrnehmen und nutzen<br />
können, ist es zudem ökonomisch<br />
sinnvoller, in Bildung als später dann in<br />
Sozialleistungen zu investieren.<br />
Eine Debatte um die Erbschaftssteuer<br />
hat also nichts mit Neid oder gar Enteignung<br />
zu tun, sondern mit ökonomischer<br />
Vernunft und vor allem mit Gerechtigkeit.<br />
Den Übergang von einer Leistungs- in<br />
eine Erbengesellschaft kann niemand in<br />
der Sozialdemokratie wirklich wollen.<br />
Lasst uns darüber diskutieren, in was für<br />
einer Gesellschaft wir zukünftig leben wollen<br />
und lasst uns dabei nicht nur das ich<br />
(und meine Familie) betonen, sondern das<br />
WIR! l<br />
Literatur<br />
Bos, W., I.Tarelli, A.Bremerich-Vos, K.Schwippert<br />
(2012): IGLU 2011 – Lesekompetenzen von Grundschulkindern<br />
in Deutschland im internationalen<br />
Vergleich. Waxmann. Berlin.<br />
Braun, R., U. Pfeiffer und L. Thomschke (2011):<br />
Erben in Deutschland – Volumen, Verteilung und<br />
Verwendung. Deutsches Institut für Altersvorsorge<br />
GmbH. Köln.<br />
Bundesministerium der Finanzen (<strong>2013</strong>): Steuereinnahmen<br />
nach Steuerarten 2010 – 2012.<br />
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/<br />
DE/Standardartikel/Themen/Steuern/<br />
Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/<br />
2-kassenmaessige-steuereinnahmen-nachsteuerarten-1950-bis-2012.html<br />
[27.06.<strong>2013</strong>].<br />
CDU/CSU (<strong>2013</strong>): Gemeinsam erfolgreich für<br />
Deutschland. Regierungsprogramm <strong>2013</strong> – 2017.<br />
Frick, J.R., M.M. Grabka, R. Hauser (2010): Die<br />
Verteilung der Vermögen in Deutschland. Edition<br />
Sigma. Berlin.<br />
Grabka, M.M. und J.R. Frick (2007): Vermögen in<br />
Deutschland wesentlich ungleicher verteilt als Einkommen.<br />
In: DIW Wochenbericht LXXVII (45),<br />
665 – 672.<br />
93
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 94<br />
Grabka, M.M., J. Goebel, J. Schupp (2012): Höhepunkt<br />
der Einkommensungleichheit in Deutschland<br />
überschritten? DIW-Wochenbericht. 79(43). 3 – 15.<br />
Hauser, Richard (2009): Die Entwicklung der Einkommens-<br />
und Vermögensverteilung in Deutschland<br />
in den letzten Dekaden. In: Druyen, Thomas; Lauterbach,<br />
Wolfgang; Grundmann, Matthias (Hg.).<br />
Reichtum und Vermögen. Zur gesellschaftlichen<br />
Bedeutung der Reichtums- und Vermögens -<br />
forschung. VS-Verlag, Wiesbaden. S. 54 – 68.<br />
Künemund, H. und C. Vogel (2011): Erbschaften<br />
und Vermögensungleichheit. Vortrag zur Frühjahrstagung<br />
2011 der Sektion Wirtschaftssoziologie<br />
(MS).<br />
Manager Magazin (2012): Die 500 reichsten<br />
Deutschen. Manager Magazin spezial.<br />
Middendorff, E., B. Apolinarski, J. Poskowsky,<br />
M. Kandulla, N. Netz (<strong>2013</strong>): Die wirtschaftliche<br />
und soziale Lage der Studierenden in Deutschland<br />
<strong>2013</strong>. Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung. Bonn, Berlin.<br />
SPD (<strong>2013</strong>): Das WIR entscheidet. Das Regierungsprogramm<br />
<strong>2013</strong> – 2017.<br />
94 Von der Leistungs- zur Erbengesellschaft? Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 95<br />
EIN ANDERES DEUTSCH-<br />
LAND IN EINEM ANDE-<br />
REN EUROPA: WAS<br />
EUROPÄERINNEN VON<br />
DER BUNDESTAGSWAHL<br />
ERWARTEN<br />
von Daniel Cornalba, Vizepräsident der Young European Socialists, Nationalsekretär<br />
für den Arbeitsbereich Europa des MJS France<br />
Vor einem Jahr im Juni 2012 gewannen<br />
die SozialistInnen mit François<br />
Hollande die Präsidentschaftswahl.<br />
Dieser erste Schritt in Richtung eines<br />
Wandels in Frankreich und einer Umorientierung<br />
Europas, so wichtig er<br />
sein mag, bedeutet noch kein Sieg unserer<br />
Ideen für ein anderes, soziales<br />
und ökologisches Europa.<br />
Soziale Gerechtigkeit, nachhaltiges<br />
Wachstum, Umverteilung, ständige<br />
Demokratisierung: All diese Ziele sind<br />
nur dann in Europa zu erreichen, wenn<br />
im September <strong>2013</strong> in Deutschland<br />
und kurz danach im Juni 2014 in ganz<br />
Europa wir SozialdemokratInnen und<br />
SozialistInnen eine Mehrheit zusammen<br />
mit unseren linken KoalitionspartnerInnen<br />
gewinnen.<br />
Europa braucht eine Alternative<br />
Wenn 57 % der Jugendlichen in Griechenland<br />
arbeitslos sind, mehr als 50 % in<br />
Spanien, 30 % in Irland, 26 % in Frankreich<br />
und allgemein 26,5 Millionen Menschen<br />
in Europa keine Arbeit finden; wenn<br />
tausende von ArbeiterInnen dazu gezwungen<br />
sind, im Ausland eine bessere Zukunft<br />
zu suchen; wenn Gehälter in Portugal oder<br />
Griechenland wegen Sparmaßnahmen um<br />
50 % reduziert werden; wenn im Namen<br />
der „Konsolidierungspolitik“ – sagen wir es<br />
einfach: der Sozialabbaupolitik – Grundbestandteile<br />
der Demokratie, wie Medien,<br />
Sozialversicherungen, Bildung, Kultur,<br />
Zukunftsinvestitionen, schlicht und einfach<br />
gestrichen werden, wie soll dann<br />
Europa auf irgendeiner Weise noch eine Hoffnung<br />
darstellen?<br />
95
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 96<br />
Wenn man Merkel oder Schäuble zuhört<br />
(das mag ab und zu vorkommen), gäbe<br />
es gegenüber dieser heutigen Lage keine<br />
andere mögliche Politik.<br />
Sparpolitik oder Chaos. „Politik für<br />
Wettbewerbsfähigkeit“ oder Niedergang.<br />
Mit Merkel erhält die berühmte Parole von<br />
Thatcher ein neues Leben: „There is no Alternative.“<br />
Keine Alternative.<br />
Diese Ansicht ist besonders in der Europapolitik<br />
durch ihre Institutionalisierung<br />
in den europäischen Verträgen mit der Unterstützung<br />
der heutigen europäischen<br />
Kommission unter Barroso zu beobachten:<br />
Es gäbe keine andere Möglichkeit als von<br />
der griechischen Regierung Massenentlassungen<br />
im öffentlichen Sektor zu verlangen,<br />
Gehälter zu kürzen und soziale Hilfen<br />
zu streichen. Schulen, Universitäten, Krankenhäuser,<br />
Museen werden geschlossen<br />
oder wenn möglich privatisiert. Es gibt<br />
keine Alternative!<br />
1600 Milliarden konnte man für Banken<br />
finden, um „Europa zu retten“. Ein<br />
„Marschallplan“ aber gegen Jugendarbeitslosigkeit<br />
und für nachhaltiges Wachstum,<br />
wie es Hollande oder Steinbrück vertreten,<br />
das ist völlig unmöglich. Höchstens 6 Milliarden<br />
für die nächsten zwei Jahre.<br />
Dabei handelt es sich hier nicht nur um<br />
eine Frage der internationalen Solidarität.<br />
Die Zukunft der europäischen und insbesondere<br />
der deutschen Wirtschaft hängt<br />
von der Nachfrage der anderen europäischen<br />
Länder ab. Drastische Kürzungen,<br />
massive Entlassungen und weniger Investitionen<br />
bedeuten auch weniger Konsum,<br />
weniger Importe, weniger Nachfrage und<br />
damit die allgemeine Verschlechterung der<br />
wirtschaftlichen Lage. Ist das wirtschaftliche<br />
Kompetenz? Wo Konservative dauerhafte<br />
Rezession bieten, wollen wir nachhaltiges<br />
Wachstum.<br />
Wozu sollten wir denn überhaupt noch<br />
wählen, wenn es nur eine einzige Politik<br />
gibt?<br />
Wo bleibt die Demokratie, wenn nicht<br />
gewählte Institutionen wie die Troika (Internationaler<br />
Währungsfonds, Europäische<br />
Kommission und Europäische Zentralbank),<br />
aufgrund einer vermeintlichen<br />
„Expertise“ einer demokratisch gewählten<br />
Regierung ihre Politik diktieren?<br />
Wo bleibt denn die Demokratie, wenn die<br />
Europäische Zentralbank (EZB) ohne jegliche<br />
demokratische Legitimität oder Kontrolle<br />
die Währungspolitik Europas entscheidet?<br />
Die „Stabilität“ der Preise kann<br />
nicht das einzige Ziel darstellen und die<br />
letzten Entscheidungen gegen die angebotsorientierte<br />
Politik der Konservativen<br />
haben es auch gezeigt. Nachhaltiges<br />
Wachstum und Arbeitslosigkeitsbekämpfung<br />
dürfen in den Statuten der EZB nicht<br />
vergessen werden.<br />
Wo bleibt die Demokratie, wenn das europäische<br />
Parlament entmachtet bleibt?<br />
Wie können wir uns noch wundern, dass<br />
die Beteiligung an Europawahlen und das<br />
Vertrauen in die EU ständig sinken?<br />
Wir SozialdemokratInnen und SozialistInnen<br />
stehen für Demokratie. Es<br />
ist unsere Aufgabe, eine Alternative zu<br />
verkörpern: Eine Auswahl soll es bei einer<br />
Wahl immer geben!<br />
Ein anderes Deutschland in einem anderen Europa:<br />
96 Was EuropäerInnen von der <strong>Bundestagswahl</strong> erwarten Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 97<br />
Willy Brandt hat es bereits in seiner<br />
Regierungserklärung 1969 erörtert: „Wir<br />
wollen mehr Demokratie wagen“, „wir<br />
brauchen Menschen, die kritisch mitdenken,<br />
mitentscheiden und mitverantworten“.<br />
Er fügte hinzu: „Demokratie ist ein<br />
Prozess.“ Den wollen wir heute weiterführen.<br />
Wie Sigmar Gabriel vor kurzem in<br />
Madrid auf einer Pressekonferenz mit Alfredo<br />
Rubalcaba (PSOE) klarmachte, ist es<br />
diese Jugend, die wir heute ausbeuten, zertreten,<br />
missachten, die morgen Europa<br />
weiterentwickeln soll. Wie soll sie es tun,<br />
wenn für sie Europa nur noch Sparpolitik,<br />
soziale Unsicherheit und alternativlose<br />
Entscheidungen bedeutet?<br />
Die Gefahr für die Demokratie ist groß<br />
18 % der Jugendlichen wählten 2012<br />
bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich<br />
Marine Le Pen (Front National). Neonazis<br />
sind seit den letzten landesweiten Wahlen<br />
im griechischen Parlament vertreten. Antieuropäische,<br />
ausländerfeindliche, rechtsextreme<br />
Parteien gewinnen nach und nach<br />
in den meisten europäischen Staaten an<br />
Einfluss, besonders in den Staaten, wo Sparpakete<br />
oktroyiert worden sind. In Ungarn<br />
ist diese Ideologie bereits an der Macht.<br />
Wenn Zukunftsperspektiven und Solidarität<br />
nicht mehr auf der Agenda stehen,<br />
und wenn Konservative und Liberale als<br />
Antwort zur heutigen wirtschaftlichen, sozialen<br />
und ökologischen Krise nur noch<br />
Sparmaßnahmen bieten, wie können wir<br />
uns noch wundern, dass Menschen langsam<br />
keine Hoffnung mehr in die Politik setzen und<br />
sogar den etablierten Parteien den Rücken<br />
kehren?<br />
Die Rechtsextremen nutzen das aus:<br />
Wir SozialdemokratInnen und Sozialis -<br />
tInnen müssen eine politische Alternative<br />
auf nationaler und europäischer Ebene<br />
darstellen, die Reichtümer umverteilt und<br />
nachhaltiges Wachstum ermöglicht. So<br />
können wir diesen rechtsextremen Parteien<br />
die Wurzeln herausreißen.<br />
Vor dem Hintergrund der heutigen<br />
Lage (soziale Krise, konservative Mehrheit<br />
in Europa, Aufstieg von rechtsextremen<br />
Bewegungen) ist unsere völlige Mobilisierung<br />
und unerschütterliche Entschlossenheit<br />
für die kommenden Wahlen in<br />
Deutschland und Europa notwendig.<br />
Wahlen <strong>2013</strong> und 2014:<br />
Zeit für einen Wandel<br />
Die deutschen SozialdemokratInnen<br />
stehen seit 150 Jahren für soziale Gerechtigkeit.<br />
Für Bildung. Für Umverteilung.<br />
Für Nachhaltigkeit. Das SPD-Regierungsprogramm<br />
<strong>2013</strong> – 2017 zeigt, dass diese<br />
Grundziele der Sozialdemokratie nicht<br />
vergessen wurden. Macht euch bewusst,<br />
dass der Wandel, den ihr erkämpft, für<br />
ganz Europa Konsequenzen haben wird.<br />
Mindestlohn<br />
Die Entscheidung in Deutschland einen<br />
Mindestlohn von 8,50 Euro einzuführen,<br />
ist nicht nur eine gute Nachricht für<br />
alle ArbeiterInnen in Deutschland, die<br />
demnächst von einer besseren Verteilung<br />
der Gewinne profitieren werden. Es ist<br />
auch ein Schritt in Richtung eines sozialen<br />
Europa, ein Beispiel für andere Nachbarn<br />
und ein Weg, um die europäische Wirtschaft<br />
durch Nachfrage anzukurbeln.<br />
97
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 98<br />
Steuerpolitik<br />
Die Vorschläge der SPD im Bereich<br />
Steuerpolitik bilden einen Fortschritt für<br />
eine gerechtere Umverteilung des Wohlstands.<br />
Die Erhöhung des Spitzensteuersatzes<br />
„von 42 bzw. 45 Prozent auf 49 Prozent<br />
für zu versteuernde Einkommen ab<br />
100.000 Euro bzw. 200.000 Euro bei Eheleuten“<br />
(SPD-Regierungsprogramm <strong>2013</strong><br />
– 2017, S. 67) illustriert die Rehabilitierung<br />
der Idee, dass Steuern nur progressiv<br />
erhoben werden dürfen. Kurzgefasst: Je<br />
reicher man ist, desto mehr soll man auch<br />
für die Gemeinschaft beitragen. Eine gerechtere<br />
Besteuerung der Erbschaften sowie<br />
die Abschaffung der steuerlichen Privilegien,<br />
die CDU und FDP in Deutschland<br />
und die UMP unter Nicolas Sarkozy<br />
in Frankreich geschaffen haben, gehören<br />
auch zu einer sozialdemokratischen Politik,<br />
die Ungleichheiten nicht toleriert.<br />
Diese Umorientierung der Steuerpolitik<br />
auf mehr Gleichheit und Gerechtigkeit<br />
soll in Europa weitergeführt werden. Sie<br />
öffnet Perspektiven für eine wahre Steuerharmonisierung<br />
in der EU etwa durch eine<br />
europaweite Vermögenabgabe, wie sie das<br />
Europaparlament im Juni 2012 empfahl,<br />
und die ständige Bekämpfung jeglicher Art<br />
von Steuerdumping, die in manchen Mitgliedstaaten<br />
leider noch der Fall ist. Die<br />
Implementierung von „einheitliche(n)<br />
Mindeststeuersätzen und Mindestbemessungsgrößen<br />
bei Ertrags- und Unternehmenssteuern“<br />
(Idem, S.71) werden wir gemeinsam<br />
gegen Konservative und<br />
Neoliberale verteidigen, Steueroasen restlos<br />
trockenlegen. Wir SozialdemokratInnen<br />
müssen immer wieder sagen, dass Solidarität,<br />
Wohlfahrt, Daseinsvorsorge,<br />
Beschäftigungspolitik oder Bildung finanziert<br />
werden müssen, und dass dafür jede<br />
und jeder je nach Reichtum ihren/seinen<br />
Beitrag leisten muss.<br />
Energiewende<br />
Nach dem Atomausstieg 2010 schauen<br />
viele Staaten in Europa und in der Welt auf<br />
Deutschland. Diese Energiewende, falls sie<br />
erfolgreich ist, könnte zu einem Modellbeispiel<br />
für weitere Länder werden. Der<br />
Wille der SPD, eine sozialverträgliche<br />
Energiewende ohne ständige wahltaktische<br />
Änderungen voranzutreiben, indem<br />
zum Beispiel bis 2020 40 bis 45 Prozent<br />
und bis 2030 75 Prozent des Stromanteils<br />
aus erneuerbaren Quellen stammen, könnte<br />
die notwendige europäische Energiewende<br />
dynamisieren. Die von François<br />
Hollande und Peer Steinbrück gewollte<br />
gemeinsame Europäische Energiepolitik<br />
könnte somit kurzfristig verwirklicht werden.<br />
Die Entwicklung von gemeinsamen<br />
Infrastrukturen und Netzen sowie die europaweite<br />
Gebäudesanierung würden die<br />
öffentlichen und privaten Energiekosten<br />
reduzieren, zudem weitere Investitionen<br />
ermöglichen und im Endeffekt kohlenstoffarmes<br />
Wachstum und viele Arbeitsstellen<br />
in ganz Europa schaffen.<br />
Bändigung des Finanzkapitalismus<br />
Die Bändigung des Finanzkapitalismus<br />
und klare Regeln für Finanzmärkte stehen<br />
in diesem Programm im Vordergrund:<br />
durch strenge Regulierung der Märkte,<br />
Transparenz, Finanztransaktionssteuer,<br />
Trennung von Investment- und Geschäftsbanken<br />
oder darüber hinaus durch die<br />
Stärkung des Genossenschaftswesens.<br />
Auch hier soll Deutschland mit einer linken<br />
Mehrheit ab September <strong>2013</strong> gemein-<br />
Ein anderes Deutschland in einem anderen Europa:<br />
98 Was EuropäerInnen von der <strong>Bundestagswahl</strong> erwarten Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 99<br />
sam mit Frankreich für eine Kultur der<br />
Nachhaltigkeit und eine Rückkehr zur Realwirtschaft<br />
im Interesse der Menschen in<br />
Europa arbeiten.<br />
Diese Beispiele – es gäbe noch andere –<br />
zeigen, welche konkreten Folgen ein Sieg<br />
der SPD in den nächsten <strong>Bundestagswahl</strong>en<br />
in ganz Europa hätte. Währenddessen<br />
scheint Angela Merkel jegliche progressive<br />
Vorschläge – sei es der französischen Sozialisten,<br />
des Europaparlamentes oder der<br />
SPD – für ein anderes Europa bremsen zu<br />
wollen. Das heißt zwar nicht, dass durch<br />
dieses Programm die Idealgesellschaft, die<br />
wir uns erträumen, auf einmal Wirklichkeit<br />
werden wird. Weitere politische Kämp fe<br />
müssen noch geführt werden, um uns auch<br />
völlig von den neoliberalen Einflüssen zu<br />
befreien, die ab und zu unsere älteren Geschwister<br />
infiziert haben. Dieses Regierungsprogramm<br />
bleibt jedoch eine gute Basis,<br />
um einen Wandel in Deutschland zu<br />
ermöglichen, um eine bessere Umverteilung<br />
des Wohlstands zu implementieren. Es ist<br />
eine Antwort auf die soziale und ökologische<br />
Krise, die wir kennen, und eine Perspektive<br />
für die Jugend: für Bildung, Beschäftigung<br />
und Zukunftsinvestitionen.<br />
Die Europawahlen 2014 geben uns die<br />
Möglichkeit, diesen Wandel auf Europaebene<br />
fortzuführen. Der Sieg der deutschen<br />
SozialdemokratInnen <strong>2013</strong> soll uns<br />
dabei helfen. Aber darüber hinaus stellt<br />
sich die Frage: Welche Europäische Union<br />
wollen wir?<br />
Wir SozialdemokratInnen und SozialistInnen<br />
stehen für eine demokratische EU:<br />
Es ist jetzt Zeit, dem Europaparlament das<br />
Initiativ- und volle Mitentscheidungsrecht<br />
zu eröffnen.<br />
Europa soll die Möglichkeit haben, seine<br />
Politik durchzuführen. Wie können wir<br />
weiterhin akzeptieren, dass das Budget der<br />
Union nicht einmal 1 % des europäischen<br />
BIPs entspricht, verglichen mit 20 % in<br />
den USA? Europa braucht eigene Ressourcen:<br />
durch eine Finanztransaktionssteuer,<br />
durch eine europäische Körperschaftsteuer<br />
und eine sogenannte „Greentax“, die sowohl<br />
das Budget aufstocken als auch unsere<br />
Gesellschaften in Richtung Nachhaltigkeit<br />
orientieren würde. Priorität des<br />
künftigen Budgets muss die Bekämpfung<br />
der Arbeitslosigkeit haben, insbesondere<br />
der Jugendlichen durch eine Garantie auf<br />
Jugendbeschäftigung unter 30 und das<br />
Verbot ausbeuterischer Praktika.<br />
Zudem muss die EU langfristig vom<br />
Einfluss der Finanzmärkte befreit werden.<br />
Darum müssen Bildung und Zukunftsinvestitionen<br />
aus der Berechnung der Staatsschulden<br />
ausgeschlossen werden. Für uns<br />
sind Bildung und Zukunft keine Last, sondern<br />
eine Chance. Für Staaten, die bereits<br />
wegen ihrer Verschuldung unter dem<br />
Druck der Märkte stehen, müssen Eurobonds<br />
entwickelt werden. Die EZB müsste<br />
zuletzt auch dazu beitragen, die Teufelskreise<br />
der Spekulation zu stoppen, indem<br />
sie, wie an Privatbanken, auch an Staaten<br />
direkt Geld verleiht. Es ist inakzeptabel,<br />
dass Privatbanken, die für Wirtschaftskrise<br />
eine besondere Verantwortung tragen, sich<br />
zu Lasten der verschuldeten Staaten bereichern<br />
können. Das können wir moralisch<br />
und wirtschaftlich nicht tolerieren.<br />
Zudem sollten wir uns nicht scheuen,<br />
unsere Werte zu vertreten.<br />
Die Rechte der ArbeiterInnen müssen<br />
wir als SozialdemokratInnen und Sozialis -<br />
99
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 100<br />
tInnen verteidigen und erweitern, während<br />
Konservative und Liberale sie in den letzten<br />
Jahren ständig angegriffen haben. So<br />
ist zum Beispiel die Reduzierung der Arbeitszeit<br />
sowie die Gleichberechtigung von<br />
Frauen und Männern in allen Bereichen<br />
Teil der europäischen sozialdemokratischen<br />
Agenda.<br />
Soziale und ökologische Normen sollten<br />
wir ständig vertreten. Auch und besonders<br />
in unseren Handelsabkommen. Wir<br />
können es nicht weiter dulden, dass europäische<br />
Firmen Produktionsstellen und<br />
ganze Industrien in Europa schließen, um<br />
außerhalb der EU unsere sozialen und<br />
ökologischen Normen zu umgehen. Das<br />
Verbot der Kinderarbeit, Menschenrechte<br />
und Umweltschutz wollen wir als InternationalistInnen<br />
überall entschlossen unterstützen.<br />
Unsere Handelsabkommen sollen<br />
diesen Werten auch entsprechen.<br />
Der ehemalige sozialistische Premier<br />
Minister Léon Blum (1936 – 1938) sagte:<br />
„Links zu sein heißt zunächst empört zu<br />
sein“. Die Gründe unserer Empörung sind<br />
immer noch da: Die Ungleichheiten bestehen<br />
fort, die Ungerechtigkeit steigt. Mehr<br />
denn je brauchen wir einen Wandel; und<br />
GenossInnen, die ihn tragen.<br />
Also: Es ist längst Zeit, dass das „Wir“<br />
entscheidet. Europa und Deutschland<br />
brauchen im September einen Wandel. l<br />
Schließlich hat die Parti Socialiste die<br />
Wahlen 2012 gewonnen, weil sie eine<br />
Hoffnung für die Franzosen verkörpern<br />
konnte. Die heutige Ungeduld, die zu spüren<br />
ist, besteht darin, dass die Mehrheit<br />
unserer MitbürgerInnen auf diesen Wandel<br />
nicht länger warten kann.<br />
Der Sieg der SPD und der SPE (Sozialdemokratische<br />
Partei Europas) in den<br />
nächsten Wahlen und der Erfolg der linken<br />
Parteien allgemein hängen von der Fähigkeit<br />
ab, diese Alternative in ihrem Programm<br />
und in ihrer Politik zu verkörpern.<br />
Gegen den Fatalismus der Rechten, die die<br />
Machtlosigkeit der Politik organisieren,<br />
müssen wir die Rückeroberung der Handlungs-<br />
und Gestaltungsmöglichkeiten für<br />
nachhaltiges Wachstum und gerechtes Zusammenleben<br />
organisieren.<br />
100<br />
Ein anderes Deutschland in einem anderen Europa:<br />
Was EuropäerInnen von der <strong>Bundestagswahl</strong> erwarten Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 101<br />
MIT ESSEN SPIELT MAN<br />
NICHT!<br />
von David Hachfeld, Referent für Handelspolitik bei Oxfam Deutschland<br />
Seit einigen Jahren gleicht der Weltmarkt<br />
für Agrarrohstoffe einer Achterbahn.<br />
2008, 2011 und 2012 jagte eine<br />
Preisspitze die andere, binnen Monaten<br />
verdreifachten sich die Kurse von<br />
Weizen und Mais, jeweils gefolgt von<br />
massiven Einbrüchen. Für in Armut<br />
lebende Menschen, die bis zu 80 Prozent<br />
ihres Einkommens für Essen aufwenden<br />
müssen, sind die Folgen katastrophal.<br />
Wenn das Haushalts -<br />
einkommen nicht mehr reicht, sind<br />
Frauen und Kinder meist die Ersten,<br />
die Hunger leiden. Auch kleine bäuerliche<br />
Betriebe sind betroffen, denn angesichts<br />
der massiven Preisschwankungen<br />
werden Investitionen zum<br />
unberechenbaren Risiko. Stürzen die<br />
Preise zum Zeitpunkt der Ernte ab,<br />
droht der Verlust der wirtschaftlichen<br />
Existenzgrundlagen.<br />
Hohe und stark schwankende Preise<br />
haben viele Ursachen. Missernten, Klimawandel,<br />
wachsender Fleischkonsum, Biospritförderung<br />
und andere Faktoren beeinflussen<br />
Angebot und Nachfrage und damit<br />
die Preise. Doch die Preis-Rallye der letzten<br />
Jahre lässt sich nicht alleine aus dem<br />
Verhältnis von Angebot und Nachfrage erklären.<br />
Viele Experten und Organisationen<br />
wie die Welternährungsorganisationen<br />
schreiben der Zunahme von spekulativen<br />
Geschäften eine Mitverantwortung zu. 19<br />
Und selbst interne Studien von Finanzinstituten<br />
wie der deutschen Bank und der<br />
Allianz weisen auf diese Risiken hin. 20<br />
Über Jahrzehnte hinweg wurden die<br />
Agrarterminbörsen vor allem von realen<br />
Händlern von Nahrungsmitteln zur Absicherung<br />
gegen Preisschwankungen genutzt.<br />
Heute hingegen werden mehr als<br />
zwei Drittel der Weizenkontrakte an der<br />
Chicagoer Börse von Finanzspekulanten<br />
gehalten. Das Volumen der Weizen-Kontrakte,<br />
die an den US-Terminbörsen gehandelt<br />
werden, ist 70mal größer als die<br />
gesamte US-Ernte.<br />
19 Für eine Studienübersicht siehe Markus Henn,<br />
WEED (<strong>2013</strong>): Evidence on the Negative Impact<br />
of Commodity Speculation by Academics,<br />
Analysts and Public Institutions, online unter<br />
http://www2.weed-online.org/uploads/<br />
evidence_on_impact_of_commodity_<br />
speculation.pdf [10.07.<strong>2013</strong>].<br />
20 Siehe foodwatch (<strong>2013</strong>): Konzernforscher warnten:<br />
Spekulation treibt Preise, online unter<br />
http://www.foodwatch.org/de/informieren/<br />
agrarspekulation/aktuelle-nachrichten/<br />
konzernforscher-warnten-spekulation-treibtpreise/?sword_list[0]=konzernforscher.[10.07.<strong>2013</strong>].<br />
101
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 102<br />
Die Dominanz von Finanzspekulanten<br />
ist besonders problematisch, weil sich viele<br />
von ihnen bei ihren Geschäften nicht an<br />
Marktdaten, sondern an marktfremden<br />
Impulsen oder am Verhalten anderer<br />
Händler orientieren. Die Preissignale der<br />
Terminmärkte haben immer weniger mit<br />
dem Geschehen auf den realen Märkten zu<br />
tun. Es kommt zur vermehrten Blasenbildung.<br />
Anders als oft behauptet wird, versorgt<br />
diese Form der Spekulation die<br />
Landwirtschaft auch nicht mit neuem Investitionskapital.<br />
Stattdessen treiben sie,<br />
als Folge der zunehmenden Schwankungen,<br />
die Kosten für Absicherungsgeschäfte<br />
in die Höhe.<br />
Seit der Jahrtausendwende wurden die<br />
globalen Finanzmärkte sukzessive dereguliert<br />
– auch auf massiven Druck der Finanzlobby<br />
hin. Die Rohstoffmärkte waren<br />
davon ebenfalls betroffen. Infolge dieser<br />
Entwicklung bildete sich ein neuer, gewaltiger<br />
Geschäftszweig für Banken und Kapitalanlagegesellschaften<br />
heraus: Fonds,<br />
die es großen wie kleinen Anlegern ermöglichen,<br />
auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen<br />
zu wetten, schossen wie Pilze aus<br />
dem Boden und wurden als neue Anlageklasse<br />
vermarktet. Und institutionelle und<br />
private Kapitalanleger, stets auf der Suche<br />
nach neuen rentablen Anlagemöglichkeiten,<br />
nahmen diese Chance gerne wahr. Das<br />
in Rohstofffonds angelegte Kapital stieg<br />
von 20 Milliarden Euro im Jahr 2003 auf<br />
321 Milliarden im Jahr 2012 an. Etwa 57<br />
Milliarden Euro entfallen dabei auf Agrarrohstoffe.<br />
Während Investoren, die ihr Geld in<br />
Rohstofffonds stecken, erhebliche Risiken<br />
eingehen und nicht selten auch deutliche<br />
Verluste abschreiben müssen, befinden sich<br />
Banken und Fondsgesellschaften in einer<br />
komfortableren Situation. Als Anbieter<br />
und Verwalter von Rohstofffonds bringen<br />
sie meist kein oder nur wenig eigenes Kapital<br />
in einen Rohstofffonds ein. Deshalb<br />
hängen ihre Einnahmen weniger von den<br />
Preisentwicklungen ab, sondern speisen<br />
sich vor allem aus den Verwaltungsgebühren<br />
der Fonds. Wenn die Fondsgesellschaften<br />
mit Depotbanken und Anlageberatern<br />
zusammenarbeiten, die zur selben Konzerngruppe<br />
gehören, können sie außerdem<br />
noch mit Einnahmen aus Depotbank- und<br />
Beratungsgebühren rechnen.<br />
Diese Gebühren fallen immer an, egal<br />
ob die Preise steigen oder fallen. Sie werden<br />
in den Bilanzen der Fonds als Geschäftsausgaben<br />
ausgewiesen und letztendlich<br />
von den Investoren bezahlt. Die Höhe<br />
dieser Gebühren liegt bei ca. 0,5 bis 2 Prozent<br />
pro Jahr, bezogen auf das Volumen des<br />
von Investoren angelegten Kapitals. Die<br />
Sätze klingen niedrig, doch angesichts der<br />
Größe der Fonds kommen beachtliche<br />
Summen zusammen: 2012 haben die deutschen<br />
Finanzinstitute, die Nahrungsmittelrohstofffonds<br />
anbieten, mindestens 116<br />
Millionen Euro durch verschiedene Formen<br />
von Verwaltungsgebühren eingenommen.<br />
Die höchsten Einnahmen erzielte dabei<br />
mit mindestens 62 Millionen Euro die<br />
Allianz. Zurückzuführen ist dies vor allem<br />
auf die zum Konzern gehöhrende Investmentgesellschaft<br />
PIMCO, die einen der<br />
weltweit größten Rohstofffonds verwaltet:<br />
Der PIMCO Commodity Real Return<br />
Strategy Fund hatte 2012 ein Gesamtvolumen<br />
von 16,31 Milliarden Euro. Die<br />
Deutsche Bank verwaltet mindestens 34<br />
Investmentfonds, die Agrarrohstoffderiva-<br />
102 Mit Essen spielt man nicht! Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 103<br />
te halten. Organisiert sind sie über mehrere<br />
Tochtergesellschaften, unter anderem<br />
die DWS und das Bankhaus Sal. Oppenheim.<br />
Darunter befindet sich auch der<br />
größte Fonds, der ausschließlich auf<br />
Agrarrohstoffe setzt: der PowerShares DB<br />
Agriculture Fund. Die Einnahmen aus der<br />
Verwaltung dieser Fonds beliefen sich<br />
2012 auf mindestens 40,84 Millionen<br />
Euro. Die Fondsgesellschaften der anderen<br />
deutschen Finanzinstitute nahmen 2012<br />
zusammen 13,49 Millionen Euro aus der<br />
Verwaltung der Anlagen ein.<br />
Spekulanten in die Schranken!<br />
Wenn Menschen infolge künstlicher<br />
Preissprünge hungern, wird ihr fundamentales<br />
Menschenrecht auf Nahrung verletzt.<br />
Angesichts der vielen fundierten Hinweise<br />
darauf, dass spekulative Anlagen in Agrarrohstoffen<br />
problematische Auswirkungen<br />
auf die Preisentwicklung von Nahrungsmitteln<br />
haben können, sollte ein verantwortungsvolles<br />
Finanzinstitut das Vorsorgeprinzip<br />
ernst nehmen und auf das<br />
Anbieten eben dieser Produkte verzichten.<br />
Oxfam fordert die deutschen Banken und<br />
Versicherungen auf, einen Ausstieg aus der<br />
Spekulation mit Nahrungsmitteln zu beschließen<br />
und schnellstmöglich umzusetzen.<br />
Agrarrohstoffe sollten in keinem Investmentfonds<br />
enthalten sein.<br />
Doch die Vehemenz und Kompromisslosigkeit,<br />
mit denen die Allianz und die<br />
Deutsche Bank als Schwergewichte im<br />
deutschen Markt an dem Geschäft mit der<br />
Nahrungsmittelspekulation festhalten, machen<br />
deutlich, dass auch auf politischer<br />
Ebene gehandelt werden muss. Sowohl in<br />
den USA als auch in der EU wird derzeit,<br />
ausgelöst durch die Fehlentwicklungen auf<br />
den Terminmärkten in den letzten Jahren,<br />
über die Einführung von Positionslimits<br />
diskutiert. Diese würden Obergrenzen für<br />
den Wert der von Händlern gehaltenen<br />
Rohstoffderivate festsetzen. Allianz und<br />
Deutsche Bank sperren sich jedoch gegen<br />
diese Bestrebungen. In den Augen der<br />
Deutschen Bank würden solche Obergrenzen<br />
„die Fähigkeit der Banken einschränken,<br />
auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittene<br />
Geschäfte anzubieten“, sie<br />
seien daher „kritisch zu sehen“. Angesichts<br />
der Probleme von Menschen in armen<br />
Ländern, die sich bei Preisexplosionen ihr<br />
Essen nicht mehr leisten können, sollten<br />
die Interessen der Anlagekunden der Konzerne<br />
allerdings nachrangig sein. Positionslimits<br />
würden tatsächlich bestimmte<br />
Geschäfte einschränken. Doch sie sind<br />
keineswegs ein neues Instrument. Vielmehr<br />
waren die Terminmärkte in den USA<br />
über viele Jahrzehnte mittels Positionslimits<br />
reguliert, ohne dass dies erkennbare<br />
Probleme für das ordentliche Funktionieren<br />
der Märkte dargestellt hätte.<br />
Erst seit der Jahrtausendwende wurden<br />
diese Positionslimits aufgeweicht und<br />
durch umfangreiche Ausnahmen ausgehöhlt<br />
– mit der Folge, dass Finanzspekulanten<br />
die Märkte dominieren konnten<br />
und die Preisvolatilität bis dahin unbekannte<br />
Ausmaße annahm. Heute geht es<br />
um die Korrektur dieser Fehlentwicklung.<br />
Auch mit Positionslimits könnten Banken<br />
und Finanzdienstleister ihren Kunden<br />
noch verschiedenste Geschäfte anbieten –<br />
nur eben nicht in einem Umfang, der das<br />
Verhältnis der Akteure an den Märkten aus<br />
dem Gleichgewicht bringt.<br />
Oxfam fordert die Bundesregierung,<br />
die EU und die G20-Staaten auf, mit ef-<br />
103
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 104<br />
fektiven Gesetzen und starken Aufsichtsbehörden<br />
gegen Exzesse auf den Agrar-<br />
Terminmärkten sowohl präventiv als auch<br />
reaktiv vorzugehen. So könnten diese<br />
Märkte auch ihre Kernfunktionen der Absicherung<br />
und Preisfindung wieder erfüllen.<br />
Dafür sind Positionslimits, Berichtspflichten<br />
für Händler und eine Einschränkung<br />
des Handels mit fragwürdigen<br />
Finanzprodukten nötig.<br />
Auch Bürgerinnen und Bürger müssen<br />
der Nahrungsmittelspekulation nicht tatenlos<br />
zusehen. Sie können Aktionen und<br />
Kampagnen unterstützen, damit Banken,<br />
Versicherungen und Pensionsfonds ihr<br />
Rohstoff-Portfolio auf den Prüfstand stellen<br />
und zurückfahren. Kundinnen und<br />
Kunden von Banken, Fonds und Versicherungen<br />
sollten sich über die mögliche Beteiligung<br />
ihrer Finanzinstitute an fragwürdigen<br />
Spekulationsgeschäften erkundigen,<br />
von ihren Kundenbetreuer/innen Aufklärung<br />
über Anlagestrategien und Versicherungsrücklagen<br />
einfordern und gegebenenfalls<br />
den Wechsel zu einem anderen<br />
Anbieter prüfen.<br />
l<br />
⇒ www.oxfam.de/gegenspekulation<br />
104 Mit Essen spielt man nicht! Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 105<br />
AUCH KEVIN MUSS<br />
KÖNNEN DÜRFEN!<br />
Warum Bildung noch immer von der Herkunft abhängt – und sogar vom Vornamen<br />
von Mareike Strauß und Amina Yousaf, Mitglieder im Bundesvorstand<br />
der Juso-Hochschulgruppen<br />
Vor wenigen Jahren sorgte eine Studie<br />
einer Erziehungswissenschaftlerin aus<br />
Oldenburg für Schlagzeilen: Darin<br />
wurden Grundschullehrer/innen danach<br />
gefragt, welche Erwartungen sie<br />
an Vornamen haben – mit dem Ergebnis,<br />
dass bestimmte Vornamen die Bildungschancen<br />
massiv beeinträchtigen<br />
können. Kinder mit Namen wie Kevin,<br />
Mandy oder Justin werden als weniger<br />
leistungsstark eingeschätzt als Kinder<br />
mit Namen wie Charlotte, Jakob oder<br />
Marie. Denn schon Namen gäben Aufschluss<br />
auf den sozialen Hintergrund<br />
von Kindern, so eine Begründung von<br />
Befragten. Eine Reaktion trifft das<br />
wohl sehr plakativ: „Kevin ist kein<br />
Name, sondern eine Diagnose“, antwortete<br />
eine Befragte (Kaiser).<br />
Vorurteile über Namen und daraus resultierendes<br />
„Schubladendenken“ und Beeinflussung<br />
der Förderung und Bewertung<br />
sind Anzeichen für die ungleichen Chancen<br />
in unserem Bildungssystem. Ein Bildungssystem,<br />
in dem vor allem die Herkunft<br />
über die Bildungschancen entscheidet.<br />
Doch gleiche Bildungschancen sind<br />
Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit.<br />
Denn gute Bildung ist Grundstein für ein<br />
selbstbestimmtes Leben, die Entwicklung<br />
von Fähig- und Fertigkeiten und nicht zuletzt<br />
Garant für gute Berufschancen. Deshalb<br />
dürfen sie auch kein romantisches Zukunftsbild<br />
oder gar gesellschaftliches Feindbild<br />
mehr sein! Das bedeutet, dass alle über<br />
ihre individuellen Bildungsbiographien frei<br />
entscheiden können sollten. „Alle müssen<br />
können dürfen“ ist Voraussetzung und Ziel<br />
zugleich. Nur wenn Strukturen geschaffen<br />
werden, die darauf ausgerichtet sind, individuelle<br />
Stärken zu fördern, die Fähig- und<br />
Fertigkeiten junger Menschen zu erkennen<br />
und zu unterstützen, dann kann auch gewährleistet<br />
werden, dass niemand aufgrund<br />
seiner/ihrer Herkunft, aufgrund von<br />
Behinderungen, chronischer Krankheiten<br />
oder aufgrund von Geschlecht diskriminiert,<br />
ausgebremst oder bevorzugt wird.<br />
Die im Juni erschienene 20. Sozialerhebung<br />
des Deutschen Studentenwerks<br />
(DSW) lässt viele Rückschlüsse in Bezug<br />
auf die Durchlässigkeit im Bildungssystem<br />
zu. Der „Bildungstrichter“ ist ein markan-<br />
105
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 106<br />
tes Bild für die soziale Selektivität des Bildungssystems.<br />
Es zeigt besonders anschaulich,<br />
wie unterschiedlich die Bildungschancen<br />
von Kindern aus akademischen<br />
Elternhäusern (mindestens ein Elternteil<br />
hat einen Hochschulabschluss) gegenüber<br />
Kindern aus nicht-akademischen Elternhäusern<br />
sind. Von der Primarstufe bis zur<br />
Studienaufnahme wird der Trichter enger<br />
– vor allem für diejenigen aus nicht-akademischen<br />
Haushalten.<br />
Die Ergebnisse der Sozialerhebung<br />
sind erschreckend: Kinder aus akademischen<br />
Elternhäusern besuchen 1,8-mal so<br />
oft eine gymnasiale Oberstufe wie diejenigen<br />
aus nicht akademischen Elternhäusern,<br />
von denen überhaupt nur 43 Prozent<br />
den Übergang zur Sekundarstufe II schaffen.<br />
Noch deutlicher ist der Unterschied<br />
beim Hochschulzugang: Nur 23 Prozent<br />
der Kinder aus nicht-akademischen Haushalten<br />
nehmen ein Studium auf. Dieser<br />
Anteil ist bei jungen Menschen mit akademischem<br />
Hintergrund 3,3-mal so hoch.<br />
Die Herkunft bestimmt noch immer die<br />
Bildungschancen. Mit Gerechtigkeit hat<br />
das nichts zu tun! Wir wollen, dass alle ihren<br />
Bildungsweg individuell gestalten können<br />
– und zwar unabhängig davon, woher<br />
sie kommen.<br />
Ein gerechtes Bildungssystem kann<br />
nicht von jetzt auf gleich geschaffen werden.<br />
Die Politik muss auf mehreren Ebenen<br />
ansetzen: Es muss deutlich mehr in<br />
Bildung investiert werden und die Rahmenbedingungen<br />
und die soziale Infrastruktur<br />
müssen gestärkt werden. Außerdem<br />
muss ein Wandel stattfinden im<br />
Verständnis dessen, was gutes Lernen und<br />
Lehren bedeuten. Das bedeutet im Einzelnen:<br />
Bildung staatlich ausfinanzieren!<br />
Ein wichtiger Schritt hin zu einem gerechteren<br />
Bildungssystem ist, dass dessen<br />
staatliche Finanzierung deutlich steigt. Die<br />
Bildungsausgaben in Deutschland liegen<br />
noch immer deutlich unter dem, was tatsächlich<br />
für die Ausfinanzierung des Bildungssystems<br />
gebraucht würde. Und auch<br />
unter dem, was andere Länder investieren.<br />
Im OECD-Bericht „Bildung auf einen<br />
Blick“, der im Juni diesen Jahres erschien,<br />
steht es wieder einmal geschrieben: Die<br />
Bildungsausgaben in Deutschland prozentual<br />
gemessen am BIP liegen genau zehn<br />
Prozentpunkte unter dem OECD-Durchschnitt:<br />
2010 wurden in Deutschland 5,8<br />
Prozent des BIP für formale Bildungseinrichtungen<br />
ausgegeben, im OECD-<br />
Durchschnitt waren es 6,8 Prozent, in<br />
Norwegen beispielsweise sogar 7,6 Prozent<br />
(OECD, <strong>2013</strong>). Die SPD will deshalb<br />
jährlich 20 Mrd. Euro mehr in Bildung investieren,<br />
um dem Ziel einer staatlichen<br />
Ausfinanzierung endlich näher zu rücken.<br />
Durch sinkende Geburtenraten wird<br />
die Anzahl der Schüler/-innen in den<br />
nächsten Jahren sinken. Das darf nicht<br />
dazu führen, dass an den Bildungsausgaben<br />
gekürzt wird. Vielmehr muss das Geld im<br />
Sinne der demografischen Rendite genutzt<br />
werden, also im System bleiben und so<br />
dazu beitragen, dass gute Lehre und gute<br />
Infrastruktur und somit auch gute Bildungschancen<br />
geschaffen werden.<br />
Eine Finanzierung von Bildungseinrichtungen<br />
über Bildungsgebühren, seien<br />
es Kindertagesstätten oder Hochschulen,<br />
wirkt nachweislich sozial selektiv und ist<br />
daher keine Alternative. Studiengebühren<br />
wurden in den letzten Jahren sukzessive<br />
106 Auch Kevin muss können dürfen! Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 107<br />
abgeschafft und bestehen nur noch in<br />
Form von Studienkonten oder Langzeitgebühren<br />
in einigen Bundesländern. Wo noch<br />
Gebühren existieren, gleich an welcher Stel -<br />
le im Bildungssystem, müssen sie schleunigst<br />
abgeschafft werden. Vor allem im Bereich<br />
der frühkindlichen Bildung ist eine<br />
Selektion aufgrund der finanziellen Möglichkeiten<br />
von Eltern nicht akzeptabel.<br />
Die richtigen Rahmenbedingungen<br />
schaffen!<br />
Für eine solidarische, offene Gesellschaft<br />
und ein gerechtes Bildungssystem,<br />
wie wir sie uns vorstellen, ist es nötig, dass<br />
nicht nur die Institutionen an sich ausfinanziert<br />
werden, sondern auch die soziale<br />
Infrastruktur.<br />
Die Sozialdemokratie hat in den<br />
1970er Jahren eine Öffnung der Bildungslandschaft<br />
vorangetrieben. Durch das<br />
BAföG als Vollzuschuss hat sie dafür gesorgt,<br />
dass Hochschulen für die breite Gesellschaft<br />
zugänglich wurden. Das BAföG<br />
ist das zentrale Element für einen Aufstieg<br />
durch Bildung. Doch es ist längst nicht<br />
mehr das Studienfinanzierungsinstrument<br />
Nummer eins, sondern liegt hinter Unterstützungen<br />
durch die Eltern und dem eigenen<br />
Verdienst. Nur rund ein Drittel der<br />
Studierenden erhält BAföG – ein BAföG,<br />
was nach der Regelstudienzeit ausläuft, das<br />
Studierende verschuldet ins Leben starten<br />
lässt und dadurch zusätzlichen Druck verursacht.<br />
Die 20. Sozialerhebung des DSW<br />
zeigt aber, dass für über 80 Prozent der<br />
Studierenden gerade aus bildungsfernen<br />
oder sozial benachteiligten Familien ein<br />
Studium ohne den Bezug von BAföG<br />
nicht möglich ist. Um weiterhin den Aufstieg<br />
durch Bildung zu gewährleisten,<br />
braucht es eine umfassende Reform des<br />
BAföG, die auch die Struktur neu ordnet.<br />
Dabei muss auch das BAföG für Schüler/<br />
-innen wiederbelebt und wieder zu einem<br />
Instrument für mehr soziale Gerechtigkeit<br />
werden!<br />
Um jungen Menschen ein unabhängiges<br />
Leben zu ermöglichen, welches sich an<br />
ihren Bedürfnissen orientiert, muss sichergestellt<br />
sein, dass sie auf eigenen Beinen<br />
stehen und in ihren eigenen vier Wänden<br />
leben können! Wohnungsnot ist vielerorts<br />
ein reales Problem, steigende Mieten und<br />
teure Courtagen für Makler/-innen übersteigen<br />
häufig das Budget junger Menschen.<br />
Studierende stehen immer wieder<br />
spätestens zum Start des Wintersemesters<br />
vor dramatischen Engpässen, was nicht sel -<br />
ten in Turnhallen-Notunterkünften gipfelt.<br />
Dabei ist die Wohnraumsituation kein<br />
alleiniges Problem der sogenannten Metro -<br />
polen. Auch in kleineren Städten wird bezahlbarer<br />
Wohnraum immer weiter aus<br />
den Zentren in weniger attraktive äußere<br />
Stadtteile oder Vororte verdrängt. Wir<br />
wollen, dass mehr in den Bau von Studierendenwohnheimen<br />
und sozialen Wohnungsbau<br />
investiert wird. Ein Bund-Länder-Programm<br />
zum Bau von 250.000 zusätzlichen<br />
Wohnheimplätzen, wie die SPD<br />
es umsetzen will, wäre dafür ein guter Anfang.<br />
Ebenso setzt sich die SPD dafür ein,<br />
dass steigende Mietpreise durch eine Obergrenze<br />
gedeckelt werden und dass die Courtage<br />
für Makler/-innen von denen gezahlt<br />
wird, die die Makler/-innen engagieren.<br />
Ein neues Verständnis von Lernen und<br />
Lehren!<br />
Die Ökonomisierung der Bildung, die<br />
Einengung des Bildungsbegriffs auf Be-<br />
107
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 108<br />
schäftigungsfähigkeit, die Fokussierung<br />
auf Abschlüsse und internationalen Wettbewerb<br />
ist tief verwurzelt im politischen<br />
Handeln und dies spiegelt sich auch in den<br />
Reformen der letzten Jahre wider. Wir<br />
wollen ein anderes, ein besseres und gerechteres<br />
Bildungssystem, das den Menschen<br />
in den Mittelpunkt stellt. In unserer<br />
Vorstellung soll Bildung vor allem dazu befähigen,<br />
kritisch zu hinterfragen, solidarisch<br />
zu handeln und sich unabhängig von<br />
Herkunft frei zu entfalten.<br />
Doch junge Menschen stehen ständig<br />
unter Strom, sind gestresst, nicht selten<br />
folgen gesundheitliche Probleme. Und das<br />
beginnt schon in der frühen Kindheit: Bereits<br />
in der Grundschule leiden Schüler/-<br />
innen unter Stress und Leistungsdruck.<br />
Rund zwei Drittel der Zweit- und Drittklässler/-innen<br />
fühlen sich laut einer Studie<br />
des Kinderschutzbundes durch die<br />
Schule gestresst. Zu viele Tests, zu viele<br />
Hausaufgaben überfordern Kinder im jungen<br />
Alter und lassen die Schulzeit zur Belastungsprobe<br />
werden. Zudem werden in<br />
der Grundschule die Weichen für den zukünftigen<br />
Bildungsweg gestellt, was zusätzlichen<br />
Leistungs- und Erwartungsdruck<br />
bei den Schüler/-innen, aber vor<br />
allem auch bei Eltern erzeugt. Durch die<br />
Einteilung in drei Schularten wird schon<br />
früh über die Bildungsbiographien von<br />
Kindern entschieden. Und einmal entschieden,<br />
sind die Chancen gering, zwischen<br />
den Schulformen zu wechseln. Denn<br />
nur drei Prozent der Schüler/-innen wechseln<br />
überhaupt während der Sekundarschulzeit<br />
die Schulform, vor allem in niedrigere<br />
Schulformen. Die Durchlässigkeit<br />
ist im Endeffekt nur nach unten gegeben<br />
(Dombrowski/Solga, 2009). Um ein wirklich<br />
gerechtes System zu schaffen, muss die<br />
Gemeinschaftsschule wieder zentral in die<br />
bildungspolitische Debatte gerückt und als<br />
einzige Schulform etabliert werden.<br />
Und auch Hochschulen sind zu Orten<br />
des „Bulimie-Lernens“ geworden, zu Orten,<br />
in denen junge Menschen einem Abschluss<br />
hinterherhetzen und wo kritisches<br />
Denken und eigene Interessen kaum noch<br />
eine Rolle spielen.<br />
Wir wollen, dass individuelle Förderung<br />
und gute Lehre in den Fokus bildungspolitischer<br />
Anstrengungen gerückt<br />
werden. Die Bildungsforschung hat viel<br />
dazu geforscht, wie besseres Lernen und<br />
Lehren funktionieren kann. Fächerübergreifendes<br />
Lernen, Lernen anhand konkreter<br />
Projekte oder problembasiertes Lernen<br />
sind keine neuen Erfindungen. 21 Beispielsweise<br />
wurde problemorientiertes<br />
Lernen als Form des entdeckenden und interdisziplinären<br />
Lernens bereits 1976 an<br />
der Medizinischen Fakultät der Universität<br />
Maastricht, in den letzten Jahren auch an<br />
Hochschulen wie der Universität Bochum<br />
oder der Charité Berlin im Bereich Medizin<br />
eingeführt. Konzepte liegen auf dem<br />
Tisch, allein der politische Wille, sie umzusetzen,<br />
fehlt bislang. Die SPD will laut<br />
Regierungsprogramm mehr Ganztagsschulen<br />
schaffen, die es ermöglichen,<br />
Schule nicht nur als Unterricht, sondern<br />
auch als Ort sozialen Zusammenlebens,<br />
der Förderung eigener Schwerpunkte und<br />
der Gestaltung von Freizeit durch breite<br />
Angebote zu fördern. Außerdem legt sie<br />
einen Schwerpunkt auf gute Lehre: Sie will<br />
21 Ausführliche Gedanken dazu finden sich im Buch<br />
„Lernen neu lernen: Alternativen zur Ökono -<br />
misierung“ von Marie-Christine Reinert und<br />
Kerstin Rothe.<br />
108 Auch Kevin muss können dürfen! Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 109<br />
im Bereich der Lehre an Hochschulen den<br />
Qualitätspakt Lehre deutlich stärken.<br />
Ein gutes Bildungssystem versetzt junge<br />
Menschen in die Lage, ihre eigenen<br />
Stärken und Schwächen kennen zu lernen<br />
und sich einen Überblick über Möglichkeiten<br />
zur weiteren (Aus-)Bildung zu verschaffen.<br />
Es soll Schüler/-innen ermutigen,<br />
ihren Weg zu gehen, ihren Interessen<br />
zu folgen, und gleichzeitig aber auch (finanzielle)<br />
Sicherheit geben und die entsprechenden<br />
Kapazitäten zur Verfügung<br />
stellen. Berufliche wie akademische Bildung<br />
bieten auf ihre Art verschiedene<br />
Qualifikationen, die gleichwertig nebeneinander<br />
stehen. Alleine auch aus dieser<br />
Logik heraus muss uneingeschränkte Durchlässigkeit<br />
bestehen! Lebenslanges Lernen,<br />
wie es nicht erst seit der Bologna-Reform<br />
immer wieder propagiert wird, kann nicht<br />
bedeuten, dass irgendwann eine künstliche<br />
Grenze der weiteren Qualifikation erreicht<br />
ist. Vielmehr muss es bedeuten, dass es jederzeit<br />
möglich ist, sich weiter zu bilden,<br />
egal ob im beruflichen oder akademischen<br />
Feld. Das muss auch für Kevin gelten! Und<br />
für Mandy! Und für Marie!<br />
Studien wie PISA, das Engagement<br />
der Bildungsstreikbewegung der letzten<br />
Jahre und nicht zuletzt auch die Diskussion<br />
um die Schulzeitverkürzung von Gymnasien<br />
auf 8 Jahre haben in den letzten Jahren<br />
verschiedene und unterschiedlich zu bewertende<br />
punktuelle Reformen zur Folge<br />
gehabt. Doch was ausbleibt, ist eine breite<br />
Diskussion darüber, was für uns eigentlich<br />
ein gutes Bildungssystem ist. Welche Idee<br />
von Bildung, welche Ziele wir verfolgen<br />
und welche Aufgaben ein Bildungssystem<br />
in unserer Gesellschaft übernehmen sollte.<br />
Was wir brauchen ist eine Vision. Eine Vision<br />
von guter Bildung, eine Vision einer<br />
gerechten Gesellschaft.<br />
In einigen Bereichen findet eine Öffnung<br />
statt: Das Verständnis von inklusiver<br />
Bildung nimmt zu, auch wenn die Mittel<br />
und Maßnahmen zur Umsetzung noch immer<br />
zu wünschen übrig lassen. Außerdem<br />
studieren so viele junge Menschen wie nie<br />
zuvor; erstmals wurde im Wintersemester<br />
2011/2012 die halbe Millionen-Grenze<br />
geknackt.<br />
In einem sozialdemokratischen Verständnis<br />
muss Bildung die höchste Priorität<br />
eingeräumt und Chancengleichheit im<br />
Bildungssystem endlich geschaffen werden.<br />
„Aufstieg durch Bildung“ forderte die<br />
SPD unter Willy Brandt – und schaffte die<br />
Öffnung des Bildungssystems. Dazu gehörte<br />
vor allem eins: Mut! Das Regierungsprogramm<br />
zur <strong>Bundestagswahl</strong> zeigt<br />
viele gute Punkte auf, die ein gerechteres<br />
Bildungssystem schaffen können: Gebührenfreiheit<br />
von der Kita bis zur Hochschule,<br />
mehr Durchlässigkeit, mehr Ganztagsschulen,<br />
inklusive Bildung und eine<br />
Ausbildungsplatzgarantie, ein starkes BAföG<br />
für Schüler/-innen und Studierende – all<br />
das sind viele gute Forderungen, die Voraussetzungen<br />
für mehr soziale Gerechtigkeit<br />
sind. Es braucht vor allem Mut, um<br />
diese Forderungen wirklich umzusetzen –<br />
und noch weiter zu gehen. Schwarz-Gelb<br />
hat in den letzten Jahren das Gegenteil bewiesen.<br />
Die Bundesregierung hat keine<br />
Antworten auf die sozialen Fragen, keine<br />
Vision, das Bildungssystem weiterzuentwickeln,<br />
und ein elitäres Gesellschaftsbild,<br />
das sich mit gleichen Bildungschancen für<br />
alle nicht vereinen lässt. Deshalb ist es an<br />
der Zeit, diese Regierung abzuwählen. Damit<br />
alle können dürfen. l<br />
109
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 110<br />
Literatur<br />
Beisenkamp, Anja et al. (2012). Elefanten-Kinder -<br />
gesundheitsstudie 2011. Im Internet verfügbar:<br />
https://dl.dropbox.com/u/13038373/<br />
ELEFANTEN/Elefanten-<br />
Kindergesundheitsstudie%202012.pdf.<br />
Dombrowski, Rosine, Solga, Heike (2009). Soziale<br />
Ungleichheiten in schulischer und außerschulischer<br />
Bildung, Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung,<br />
Online verfügbar:<br />
http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_171.pdf<br />
[10.07.<strong>2013</strong>].<br />
Kaiser, Astrid. Vornamensstudie, im Internet<br />
http://astrid-kaiser.de/forschung/projekte/<br />
vornamensstudien.php [10.07.<strong>2013</strong>].<br />
Middendorff, Elke et al. (<strong>2013</strong>). Die wirtschaftliche<br />
und soziale Lage der Studierenden in Deutschland<br />
2012. 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks<br />
durchgeführt durch das HIS-Institut für<br />
Hochschulforschung. Bonn/Berlin: Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung.<br />
OECD (<strong>2013</strong>), Education at a Glance <strong>2013</strong>: OECD<br />
Indicators. OECD Publishing. im Internet verfügbar:<br />
http://dx.doi.org/10.1787/eag-<strong>2013</strong>-en<br />
Reinert, Marie-Christine, Rothe, Kerstin (2011).<br />
Lernen neu lernen: Alternativen zur Ökonomisierung.<br />
Berlin: Vorwärts.<br />
110 Auch Kevin muss können dürfen! Argumente 2/<strong>2013</strong>
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 111<br />
Notizen<br />
111
Argumente_02_<strong>2013</strong>_Inhalt 13.08.13 11:39 Seite 112<br />
Notizen<br />
112 Notizen Argumente 2/<strong>2013</strong>
<strong>ARGUMENTE</strong> 2/<strong>2013</strong> <strong>Bundestagswahl</strong><br />
Bei Unzustellbarkeit wegen Adressänderung erfolgt die Rücksendung an<br />
den Herausgeber unter Angabe der gültigen Empfängeranschrift<br />
Postvertriebsstück G 61797<br />
Gebühr bezahlt<br />
Juso-Bundesverband<br />
Willy-Brandt-Haus, 10963 Berlin<br />
August <strong>2013</strong><br />
ISSN 14399785<br />
Gefördert aus Mitteln des Bundesjugendplanes