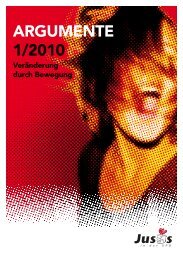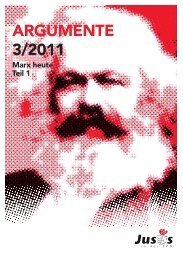B 1 - Jusos
B 1 - Jusos
B 1 - Jusos
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Kampf hat begonnen.<br />
Die Alternative:<br />
Soziale Gerechtigkeit!<br />
Beschlussbuch<br />
Juso-Bundeskongress 2008<br />
10. bis 12. Oktober, Weimar/CongressCentrum Neue<br />
Weimarhalle
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Beschlüsse<br />
A Arbeit & Gute Ausbildung 5<br />
Seite<br />
A 1<br />
A 11<br />
Bundesvorstand<br />
Prekäre Beschäftigung abschaffen – gute Arbeit für alle!<br />
BZ Nord-NDS<br />
Keine Spaltung in Beschäftigte erster und zweiter Klasse<br />
5<br />
17<br />
B Bildungs- und Forschungspolitik 27<br />
B 1<br />
B 2<br />
B 12<br />
Bundesvorstand<br />
Bildung: Gerecht und Gut!<br />
BZ Nord-NDS<br />
Bildung<br />
BZ Hannover<br />
Stoppt „McKita“ – Keine Förderung von kommerziellen Kita-Anbietern mit<br />
öffentlichen Mitteln<br />
27<br />
39<br />
42<br />
C Chancengleichheit & Sozialpolitik 44<br />
C 1<br />
C 4<br />
Bundesvorstand<br />
Für eine linke Sozialpolitik – Zum „Fordern und Fördern“ beim Arbeitslosengeld<br />
II<br />
LV Berlin<br />
Solidarität statt Kampf der Generationen<br />
44<br />
58<br />
D Daseinsvorsorge & Gesundheitspolitik 78<br />
D 1<br />
D 2<br />
Bundesvorstand<br />
Privatisierung – Mittel von gestern, Gestaltungstod von morgen<br />
Bundesvorstand<br />
Falsche Weichenstellung bei der Bahn<br />
78<br />
91<br />
E Europa 95<br />
E 1<br />
Bundesvorstand<br />
Europa verändern – Die Alternative heißt soziale Gerechtigkeit/ Europa-<br />
Wahlkampfplattform<br />
95<br />
F Frieden und Internationales 106<br />
F 1<br />
F 2<br />
Bundesvorstand<br />
Stoppt die Massenvernichter – Kleinwaffen umfassend abrüsten<br />
Bundesvorstand<br />
Decent Work Weltweit<br />
106<br />
116<br />
G Gleichstellungspolitik 129<br />
G 1<br />
Bundesvorstand<br />
Gleichstellung – jetzt!<br />
129<br />
2
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
J Justiz- und Innenpolitik 150<br />
J 1<br />
Bundesvorstand<br />
Autoritärem Gesinnungsstrafrecht entgegentreten: § 129 a, b abschaffen!<br />
150<br />
K Kampf gegen rechts 155<br />
K 2<br />
K 6<br />
LV Schleswig-Holstein<br />
Verbot des rechtsextremen Heimattreue Deutsche Jugend e.V. (HDJ)<br />
LV RLP<br />
Erstklassige Fans tragen kein „Thor Steinar“<br />
155<br />
155<br />
M Migration & Integration 157<br />
M 2<br />
LV NRW, BZ Hessen-Süd<br />
Gleiche Rechte, gleiche Chancen – Die Integration als eine der<br />
Zukunftsaufgaben in unserem Land begreifen und endlich angehen!<br />
157<br />
N Nachhaltige Wirtschafts- und Steuerpolitik 180<br />
N 2<br />
N 6<br />
LV NRW<br />
Finanzmärkte regulieren! Nachhaltiges Wachstum fördern,<br />
Kurzfristorientierung verhindern!<br />
LV RLP<br />
Die Unternehmenssteuerreform der Großen Koalition – keine GROSSE Reform! –<br />
Flat Tax: Nein Danke!<br />
180<br />
192<br />
R Resolutionen 205<br />
R 1<br />
R 3<br />
R 4<br />
LV NRW<br />
Moderne sozialdemokratische Wirtschaftspolitik – der Weg zur Guten Arbeit<br />
Bundesvorstand<br />
Abrüstung jetzt! Deutschland und Frankreich müssen Vorbilder in der<br />
Abrüstungspolitik werden<br />
Bundesvorstand<br />
Freiheit statt Angst – Gegen den Überwachungswahn<br />
205<br />
216<br />
217<br />
S SPD - Anforderungen an die Partei 219<br />
S 1<br />
Bundesvorstand<br />
Unsere Anforderungen an die Aufstellung der Sozialdemokratie für die<br />
Bundestagswahl 2009<br />
219<br />
T Thesendiskussion 226<br />
T 1<br />
Bundesvorstand<br />
Für eine Linke der Zukunft – 63 Thesen zu jungsozialistischer Politik<br />
226<br />
U Umwelt- , Energie- und Verkehrspolitik 281<br />
3
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
U 1<br />
U 8<br />
Bundesvorstand<br />
Nachhaltig in die Zukunft<br />
BZ Braunschweig, BZ Mittelfranken<br />
Kein Ausstieg aus dem Ausstieg – Atomkraft ist keine Lösung!<br />
281<br />
295<br />
I Initiativanträge 302<br />
I 3<br />
I 8<br />
I 9<br />
I 10<br />
LV Berlin<br />
Erbschaftssteuer erhalten – Umverteilungsspielräume nutzen!<br />
LV NRW<br />
Antworten auf die Finanzmarktkrise: kurzfristig stabilisieren, danach<br />
regulieren!<br />
LV NRW<br />
Aus ökölogischen und ökonomischen Gründen: Komprimierung von<br />
Änderungsanträgen!<br />
LV Saarland<br />
Atomstrom = Ökostrom = unverschämter geht es nicht!<br />
302<br />
303<br />
304<br />
305<br />
4
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
A<br />
Arbeit & Gute Ausbildung<br />
A1 – Bundesvorstand<br />
Prekäre Beschäftigung abschaffen – gute<br />
Arbeit für alle!<br />
Für uns Jungsozialistinnen und Jungsozialisten ist das Thema Arbeit zentral. Arbeit schafft die<br />
grundlegenden Werte in Form von Produkten und Dienstleistungen. Arbeit ermöglicht Teilhabe<br />
an diesen gemeinschaftlich produzierten Werten und soziale Teilhabe an der Gesellschaft.<br />
Arbeit ist zentral für das Leben jedes Menschen.<br />
Die kapitalistische Gesellschaft wird bestimmt durch den Interessengegensatz zwischen Arbeit<br />
und Kapital. Dieser produziert soziale Ungleichheit. Wir wollen diese Gesellschaft überwinden.<br />
Wir wollen eine Gesellschaft, in der jede/r selbstbestimmt leben und arbeiten, sich persönlich<br />
entfalten und seine individuellen Fähigkeiten vollständig entwickeln kann. Nur eine solche<br />
Gesellschaft ermöglicht sozialen und ökonomischen Fortschritt. Deshalb setzen wir uns für<br />
Arbeit zu guten Bedingungen und sichere Beschäftigung mit individuellen<br />
Entwicklungsperspektiven im hier und jetzt ein. Unser Ziel ist die Vollbeschäftigung.<br />
Der DGB-Index Gute Arbeit befragt in jedem Jahr Beschäftigte nach ihren Anforderungen an<br />
und Einstellungen zur Erwerbstätigkeit. In der Sonderauswertung „Arbeitsqualität aus Sicht<br />
von jungen Beschäftigten unter 30 Jahren“ aus dem Jahr 2007 wünschten sich zuallererst 99 %<br />
der Befragten ein „ausreichendes leistungsgerechtes Einkommen“ sowie 95 %<br />
„Arbeitsplatzsicherheit“. Dicht gefolgt von „guten Qualifizierungs- und<br />
Entwicklungsmöglichkeiten“. Gute Arbeit zu haben bedeutet also insbesondere auch für junge<br />
Menschen zunächst, ein ausreichendes und ein als gerechte empfundenes Gehalt zu<br />
bekommen, über einen sicheren Arbeitsplatz zu verfügen und sich weiterqualifizieren- und<br />
entwickeln zu können. Hinzu kommen ausreichende Anerkennung für die geleistete Arbeit, die<br />
Entwicklung sozialer Beziehungen über die Beschäftigung sowie eine angemessene, jedoch<br />
nicht übermäßige Belastung.<br />
5
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Prekarisierung der Arbeitswelt – Dimensionen und Wirkungen<br />
Die seit den 1980er Jahren festzustellende ‚Erosion des Normalarbeitsverhältnisses‘ hat in den<br />
vergangenen Jahren an erheblicher Dynamik gewonnen. Unter ‚Normalarbeit‘ wird dabei eine<br />
unbefristete, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung verstanden, durch deren<br />
Lohn oder Gehalt zumindest der eigene Lebensunterhalt, in der Regel aber auch der der<br />
gesamten Familie bestritten werden kann. Dieses meist von Männern ausgeübte<br />
Arbeitsverhältnis war zumindest bis tief in die 1980er Jahre hinein das deutlich dominierende<br />
‚Familienernährermodell‘, welches von den <strong>Jusos</strong> aufgrund der damit einhergehenden<br />
indirekten Diskriminierung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt auch kritisiert wurde.<br />
Zwar ist dieses Modell für viele noch immer Realität, doch ist der Anteil dieser unbefristet<br />
Vollzeitbeschäftigten zwischen 1985 und 2000 von 67 auf nur noch gut 50 % gesunken. Auf der<br />
anderen Seite haben sich so genannte ‚atypische‘ Beschäftigungsverhältnisse deutlich<br />
ausgeweitet: Teilzeitbeschäftigung, befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, Niedriglöhne,<br />
Minijobs, Scheinselbstständigkeit und unbezahlte Kettenpraktika bestimmen mehr und mehr<br />
das Bild. Atypisch Beschäftigte verdienen oft weniger, werden zum Teil von der betrieblichen<br />
Mitbestimmung ausgeschlossen, erhalten weniger Sozialleistungen, schlechteren Zugang zu<br />
Weiterbildungsmaßnahmen und ihre Stellen sind oftmals unsicherer als bei<br />
Vollzeitbeschäftigten im Normalarbeitsverhältnis. Atypische Beschäftigung ist deshalb oft<br />
auch prekär.<br />
Quer durch alle ‚atypischen‘ Beschäftigungsverhältnisse sind BerufseinsteigerInnen oder junge<br />
Beschäftigte in besonderem Maße von ihnen betroffen: Rund ein Drittel aller jungen<br />
Berufstätigen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung waren bereits einmal arbeitslos<br />
oder verfügten nur über einen befristeten Arbeitsvertrag. JedeR Fünfte war mindestens einmal<br />
nur teilzeitbeschäftigt und jedeR Zehnte war als LeiharbeitnehmerIn beschäftigt. Dies macht<br />
deutlich: Atypische und prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind insbesondere für junge<br />
Beschäftigte längst Massenphänomene. Die Daten zeigen auch: Eine abgeschlossene<br />
Berufsausbildung allein schützt nicht mehr vor prekärer Arbeit.<br />
Zudem sind Frauen überdurchschnittlich häufig von atypischen Beschäftigungsverhältnissen<br />
betroffen. Dies betrifft vor allem zwei Bereiche: Frauen arbeiten weitaus häufiger in Teilzeit als<br />
Männer. Für viele Frauen scheint Teilzeitarbeit eine Möglichkeit zu sein, Familie und Beruf<br />
miteinander vereinbaren zu können. Damit wird aber auch deutlich, dass die Familienarbeit in<br />
der Regel noch immer hauptsächlich von Frauen erledigt wird und sie dafür auf einen Teil ihres<br />
Einkommens verzichten. Damit haben sie nicht nur heute weniger Einkommen, über das sie<br />
frei verfügen können, sie verzichten auch auf einen breiteren Sozialversicherungsschutz und<br />
sind weiterhin von ihren Partnern bzw. Ehemännern abhängig. Frauen stellen auch einen<br />
weitaus größeren Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor als an den Beschäftigten<br />
insgesamt. Ebenso gelingt ihnen der Aufstieg aus dem Niedriglohnsektor weniger häufig als<br />
6
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Männern. Prekäre Beschäftigung und Armutslöhne sind also insbesondere ein Problem von<br />
Frauen.<br />
Die beschriebenen Veränderungen in der Arbeitswelt stehen den Interessen der<br />
ArbeitnehmerInnen diametral gegenüber. Die Diskrepanz zwischen Wünschen der<br />
Beschäftigten und der erlebten Wirklichkeit im Arbeitsalltag führt zu einer steigenden<br />
Abstiegsangst breiter sozialer Schichten. Atypische und prekäre Arbeitsverhältnisse sind keine<br />
Einzelphänomene mehr, sondern stellen für viele Beschäftigte akute Gefahren oder<br />
perspektivische Bedrohungen dar. Bis in die ‚Mittelschichten‘ hinein ist es nicht mehr nur die<br />
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, sondern zusätzlich die Sorge, auch mit einem Arbeitsplatz<br />
sich selbst oder die Familie nicht mehr ernähren zu können. Viele ArbeitgeberInnen nutzen<br />
diesen Umstand aus und erhöhen den Leistungsdruck auf ihre Beschäftigten. Nicht ohne Grund<br />
stellen psychische Krankheiten wie überhöhter Stress vor allem für Männer schon längst einen<br />
der wichtigsten Krankheitsgründe dar.<br />
Die Prekarisierung von immer mehr Beschäftigungsverhältnissen hat auch zur Folge, dass von<br />
den Unternehmen der Marktdruck und ein Teil des unternehmerischen Risikos zunehmend an<br />
die Beschäftigten abgegeben wird. So tragen immer häufiger die Beschäftigen als<br />
LeiharbeitnehmerInnen oder befristet eingestellte ArbeitnehmerInnen das Risiko<br />
schwankender Auftragslagen.<br />
Die Prekarisierung der Arbeitswelt führt auch zu einer Veränderung in der Machtbalance<br />
zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen: Mit der Angst vor einem drohenden<br />
Arbeitsplatzverlust sind viele Beschäftigte bereit, auch schlechtere Arbeitsbedingungen wie<br />
etwa niedrigere Löhne in Kauf zu nehmen, wenn dafür der (sichere) Arbeitsplatz nicht<br />
aufgegeben werden muss. Damit wird die Stellung der Betriebsräte und Gewerkschaften<br />
geringer. Durch prekäre Arbeitsverhältnisse entsteht somit auch ein Druck auf das gesamte<br />
Tarifgefüge.<br />
Auch die gesamtwirtschaftlichen Folgen des Ausbaus prekärer Beschäftigung sind keineswegs<br />
so positiv wie neoklassische ‚WirtschaftsberaterInnen‘ dies weismachen wollen: Die deutsche<br />
Wirtschaft konnte in den vergangenen beiden Jahren einen deutlichen Aufschwung<br />
vermelden. Ursächlich dafür war aber nicht eine stärkere Konsumnachfrage, sondern eine<br />
deutliche Ausweitung der Investitionsnahfrage. Auch mit dem Abbau der Arbeitslosigkeit<br />
wurde die Nachfrage der KonsumentInnen nicht deutlich angekurbelt. Nun drohen aufgrund<br />
einer schlechteren Weltkonjunktur einbrechende Exporte und ein Einbrechen der<br />
Investitionsnachfrage. Bleibt die Binnennachfrage weiterhin schwach, droht eine Rezession.<br />
Gründe hierfür liegen in der Prekarisierung der Arbeitswelt selbst: Erstens sind zwar viele neue<br />
Jobs entstanden, davon aber etliche im Niedriglohnsektor, so dass die Erwerbseinkommen<br />
nicht viel höher (oder sogar niedriger) sind als die vorherigen Transferleistungen. Zusätzliche<br />
Nachfrage entsteht dabei nicht. Zweitens neigen viele prekär Beschäftigte aufgrund der<br />
Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse zu einer höheren marginalen Sparneigung und<br />
7
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
konsumieren einen geringeren Anteil ihres Einkommens. Auch damit sinkt die Nachfrage nach<br />
Waren und Dienstleistungen. Und drittens reduziert der Druck auf das gesamte Tarifgefüge die<br />
Lohnquote trotz höherer Tarifabschlüsse in diesem Jahr immer weiter. Ausdruck dieser<br />
Entwicklung sind die im Zeitraum zwischen 2000 und 2008 um 0,8% gesunkenen Reallöhne<br />
pro Kopf.<br />
Die Prekarisierung der Arbeitswelt ist also Ausdruck eines veränderten Kräfteverhältnisses von<br />
Arbeit und Kapital zu Ungunsten der ArbeitnehmerInnen. Durch die Politik der Agenda 2010<br />
wurde die Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen in Deutschland deutlich befördert.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> sind nicht bereit weiter zuzuschauen, wie sich auf dem Arbeitsmarkt immer mehr<br />
menschenunwürdige Verhältnisse durchsetzen. Hier müssen wir uns in den politischen Kampf<br />
für konkrete staatliche Regulierungen begeben. Unser Ziel muss es sein, den heute prekär und<br />
atypisch Beschäftigten eine gesicherte und gute Arbeit zu ermöglichen.<br />
Der Prekarisierung politische Regulierung entgegensetzen!<br />
Prekäre Beschäftigung ist sehr vielfältig. Im Folgenden möchten wir die negativen<br />
Auswirkungen der am meisten verbreiteten Formen prekärer Beschäftigung skizzieren und<br />
Forderungen für eine politische Regulierung aufstellen.<br />
Wir wollen die Situation der betroffenen Beschäftigten verbessern und ihnen die Perspektive<br />
auf eine menschenwürdige Arbeit zu eröffnen.<br />
Befristete Beschäftigungsverhältnisse<br />
Junge ArbeitnehmerInnen sind überproportional häufig von Befristung betroffen. Einmal<br />
wegen ihres jugendlichen Alters – mit jungen Menschen werden eher befristete Verträge<br />
geschlossen – und dann, weil sie häufig BerufseinsteigerInnen sind. Dabei sind sowohl<br />
ArbeitnehmerInnen mit unter- als auch solche mit überdurchschnittlicher Qualifikation<br />
besonders von Befristung betroffen. ArbeitnehmerInnen mit mittleren beruflichen<br />
Ausbildungsabschlüssen sind unterdurchschnittlich häufig in einer befristen Stelle beschäftigt.<br />
Viele ArbeitgeberInnen nutzen befristete Arbeitsverträge, um den Kündigungsschutz teilweise<br />
zu umgehen. Befristete Arbeitsverhältnisse bergen erhebliche Einschränkungen für die<br />
betroffenen ArbeitnehmerInnen. Durch häufig wechselnde Arbeitsverhältnisse sind die<br />
ArbeitnehmerInnen zu erhöhter Mobilität gezwungen. Die Entlohnung, die Aufstiegs- und<br />
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die soziale Situation im Betrieb sind in den meisten Fällen<br />
schlechter als in unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen. In der Langzeitbetrachtung ist die<br />
Nutzung befristeter Beschäftigung zudem prozyklisch. In Zeiten guter Konjunktur werden<br />
besonders viele befristete Stellen geschaffen, die wieder verloren gehen, wenn die Konjunktur<br />
8
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
nachlässt. Hier ist eine erhebliche Gruppe von ArbeitnehmerInnen vorhanden, die dauerhaft<br />
zwischen Arbeitslosigkeit und befristeter Beschäftigung hin und her wechseln. Für diese hat<br />
sich durch die Befristung der prekäre Status verfestigt. Befristete Beschäftigungen bringen also<br />
ein Risiko der Arbeitslosigkeit mit sich: Zwischen 10 und 15% der befristet Beschäftigten stehen<br />
ein Jahr später ohne Arbeit da bzw. sind nicht erwerbstätig.<br />
• Um den Übergang von befristeten Beschäftigten in reguläre Arbeitsverhältnisse<br />
zu gewährleisten, treten wir für einen Anspruch von befristet Beschäftigten auf<br />
bevorzugte Einstellung ein. Dabei soll neben einer Informationspflicht der<br />
ArbeitgeberInnen über freie Stellen gegenüber den befristet Beschäftigten auch<br />
ein Anspruch darauf eingeführt werden, bevorzugt bei der Besetzung der<br />
unbefristeten Arbeitsplätze berücksichtigt zu werden, wenn keine betrieblichen<br />
Gründe entgegenstehen.<br />
• Darüber hinaus muss das Teilzeit- und Befristungsgesetz so geändert werden,<br />
dass Befristungen ohne Sachgrund zukünftig verboten sind. Der<br />
Sachgrundkatalog des § 14 Abs. 1 TzBfG muss auf seine Sozialverträglichkeit hin<br />
überprüft werden, dies betrifft insbesondere die Befristung im Anschluss an eine<br />
Ausbildung oder ein Studium (Nr. 2) und die Befristung zur Erprobung (Nr. 5).<br />
• Wir treten für die Aufhebung des Befristungsgrundes nach §14 Abs.1 Nr.7 TzBfG<br />
(Vergütung des Arbeitnehmers aus Haushaltsmitteln, die haushaltsrechtlich für<br />
eine befristete Beschäftigung bestimmt sind) ein. Hier handelt es sich um eine<br />
ausschließlich auf den öffentlichen Dienst bezogene Regelung. Für eine solche<br />
Sonderbehandlung des öffentlichen Dienstes gibt es keinerlei Notwendigkeit.<br />
Gerade der öffentliche Arbeitgeber sollte beispielhaft in der Gestaltung seiner<br />
Arbeitsverhältnisse sein und die fortschreitende Tendenz zu unsicheren<br />
Arbeitsverhältnissen stoppen, und nicht noch durch Sonderregelungen fördern.<br />
Gerade im Bereich des öffentlichen Dienstes und insbesondere im Bildungs- und<br />
Hochschulbereich sind inzwischen kaum noch unbefristete Arbeitsverhältnisse zu<br />
finden.<br />
Leiharbeit<br />
Die Leiharbeitsbranche in Deutschland boomt. Mitte 2007 waren bundesweit 731.152<br />
Leiharbeitskräfte in 21.000 Leiharbeitsunternehmen beschäftigt. Dies entspricht 2,4% der<br />
sozialversicherungspflichtigen Jobs. Hintergrund des offenbar auch 2008 anhaltenden<br />
Wachstums der Leiharbeit ist nicht nur der konjunkturelle Aufschwung, sondern auch die<br />
Veränderung der gesetzlichen Grundlage. Besonders junge Menschen sind von Leiharbeit<br />
9
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
betroffen. Jede/r zehnte zwischen 18 und 34 Jahren war bereits einmal in einem<br />
Leiharbeitsverhältnis beschäftigt.<br />
Die Lage der LeiharbeitnehmerInnen ist jedoch mehrfach prekär: Sie verdienen in der Regel<br />
weniger als ihre festangestellten KollegInnen im selben Unternehmen, sind von den<br />
Möglichkeiten der Mitbestimmung und Weiterbildung weitgehend ausgeschlossen und<br />
müssen damit rechnen, von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz zu verlieren, da mit dem Ende<br />
der ‚Entleihung‘ häufig auch der Arbeitsvertrag mit dem entsprechenden<br />
Leiharbeitsunternehmen endet. Gleichzeitig werden LeiharbeiterInnen von ihren fest<br />
angestellten KollegInnen auch als reale ‚Bedrohung‘ wahrgenommen, da die ArbeitgeberInnen<br />
die Möglichkeit der nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten von LeiharbeiterInnen dazu<br />
nutzen, Druck auf das gesamte Tarifgefüge auszuüben. Damit sinkt auch die Solidarität der<br />
Beschäftigten in den Unternehmen insgesamt.<br />
Auslöser für die massive Ausweitung der Leiharbeit war eindeutig die fast vollständige<br />
Deregulierung der Arbeitnehmerüberlassung durch die Hartz-Gesetze 2003. Diese<br />
Fehlentwicklung auf dem Arbeitsmarkt muss dringend korrigiert werden.<br />
• Deshalb fordern wir <strong>Jusos</strong> schnellstmöglich eine Re-Regulierung der Leiharbeit.<br />
Die wichtigsten Sofortmaßnahmen zur Eindämmung der Leiharbeit sind unserer<br />
Ansicht nach die gesetzliche Durchsetzung des Prinzips „equal pay“ / „equal<br />
treatment“ (gleiche Bezahlung und gleiche Arbeitsbedingungen für<br />
Leiharbeitskräfte) ohne die Möglichkeit durch Tarifverträge abzuweichen, die<br />
Wiedereinführung des Synchronisations- und Wiedereinstellungsverbots sowie<br />
eine gesetzliche Höchsteinsatzfrist für den Einsatz von Leiharbeitskräften.<br />
Teilzeitarbeit<br />
Unter dem Sammelbegriff „prekäre Beschäftigung“ fällt auch die sozialversicherungspflichtige<br />
Teilzeitarbeit. Im Mai 2003 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 7,9<br />
Mio. Teilzeiterwerbstätigen in Deutschland zwei Drittel (66%) überwiegend von ihrem<br />
Einkommen aus der Teilzeitarbeit. Lag die Teilzeitquote zu Beginn der 1990er Jahre noch bei<br />
rund 15 %, war im Jahr 2006 jedeR dritte ArbeitnehmerIn nicht mehr vollzeitbeschäftigt. Zwar<br />
entspricht dieser Anwuchs in vielen Fällen auch dem Wunsch der ArbeitnehmerInnen,<br />
gleichzeitig arbeiten aber insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern auch viele<br />
Menschen ‚unfreiwillig‘ in Teilzeit. Problematisch ist an dieser Beschäftigungsform neben dem<br />
geringeren und häufig nicht existenzsichernden Einkommen auch der unzureichende<br />
Sozialversicherungsschutz bei längerer Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter.<br />
Diese Daten widersprechen der verbreiteten Annahme, dass Teilzeitkräfte in der Regel<br />
anderweitig finanziell und sozial abgesichert sind und lediglich dazu verdienen. Im Gegenteil<br />
10
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
bringt diese Entwicklung mit sich, dass eine wachsende Zahl der Betroffenen kein<br />
existenzsicherndes Einkommen erzielt und nicht in ausreichendem Umfang für die<br />
Absicherung im Alter vorsorgen kann. Daneben besteht auch das Problem der<br />
Unterbeschäftigung, also der ungewollten Teilzeittätigkeit. Im Zeitraum von Januar 2005 bis<br />
Januar 2006 stieg der Anteil der Unterbeschäftigten an allen Erwerbstätigen um drei<br />
Prozentpunkte von 10,9% auf 13,9%. Fast jeder siebte Erwerbstätige hätte somit im Januar 2006<br />
bei entsprechender Vergütung gern mehr gearbeitet.<br />
Viele der Probleme, die aus der Stellung von Teilzeitbeschäftigten in den Unternehmen<br />
resultieren, wie die unzureichende Einbindung in Arbeitsprozesse, der fehlende Zugang zu<br />
Weiterbildungsmaßnahmen, die fehlende Anerkennung aufgrund der „Anwesenheitskultur“ in<br />
Unternehmen müssen in der konkreten Organisation der Arbeitsprozesse in den Betrieben<br />
durch die Betriebsräte gelöst werden.<br />
Grundsätzlich muss im Rahmen einer veränderten Arbeitszeitpolitik die starre Unterteilung in<br />
Vollzeit- und Teilzeitarbeitsverhältnisse überwunden werden. Viele Vollzeitbeschäftigte haben<br />
heute den Wunsch, zumindest phasenweise weniger zu arbeiten, viele Teilzeitbeschäftigte<br />
arbeiten unfreiwillig in Teilzeit. Perspektivisch müssen sich Arbeitszeitregime durchsetzen, in<br />
denen der zeitliche Umfang der zu leistenden Arbeit den individuellen Bedürfnissen in der<br />
jeweiligen Lebensphase entspricht.<br />
Besteht in einem Betrieb der Bedarf für eine Vollzeitstelle, so müssen in Teilzeit angestellte<br />
ArbeitnehmerInnen Rechtsanspruch auf Vollzeittätigkeit erhalten.<br />
Geringfügige Beschäftigung<br />
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind auf eine maximale monatliche<br />
Einkommensgrenze von derzeit 400 € begrenzt. Die ArbeitnehmerInnen entrichten auf die so<br />
genannten Mini-Jobs weder Steuern, noch Sozialabgaben. Auch wird ein geringfügiges<br />
Beschäftigungsverhältnis nicht auf weitere Einkommen angerechnet. Die ArbeitgeberInnen<br />
bezahlen für jeden Mini-Job eine Abgabenpauschale von 25 %. Die Neujustierung der Mini-Jobs<br />
hat dazu geführt, dass frühere Vollzeitstellen in mehrere durch Steuer- und<br />
Abgabenentlastung subventionierte ‚Mini-Jobs‘ aufgeteilt wurden. Mit dieser<br />
Subventionierung liegt in Deutschland de facto eine Form des Kombi-Lohns vor. Junge<br />
Menschen und Frauen sind besonders häufig geringfügig beschäftigt. Im Dezember des Jahres<br />
2007 bestanden 7,1 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Die Ausweitung des<br />
Niedriglohnsektors und die Zunahme der geringfügigen Beschäftigung stehen in<br />
Zusammenhang. Im Jahr 2006 arbeiteten 29,7 % der von prekären Löhnen betroffenen<br />
ArbeitnehmerInnen in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Und 78,9 % der<br />
geringfügig Beschäftigten erhielten wiederum prekäre Löhne.<br />
11
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Zunächst erreichen geringfügig Beschäftigte durch ihre Tätigkeit kein Einkommen, von dem ein<br />
auskömmliches und selbstbestimmtes Leben möglich ist. Darüber hinaus ist es für die<br />
Betroffenen problematisch, dass die Beschäftigung in einem Mini-Job meist weder ein sicheres<br />
Arbeitsverhältnis darstellt, noch die Teilhabe an betrieblicher Mitbestimmung sowie der<br />
sozialen Sicherung ermöglicht.<br />
• Zunächst fordern wir daher, dass für alle Beschäftigte ein bundesweiter,<br />
gesetzlicher, branchen-, alters- und qualifikationsunabhängiger Mindestlohn von<br />
mindestens 7,50 € eingeführt wird. Die Höhe des Mindestlohnes muss jährlich<br />
überprüft und angepasst werden. Dazu fordern wir die Einsetzung einer<br />
Kommission ähnlich der Low Pay Commission in Großbritannien, in der<br />
Sozialpartner und Wissenschaft verpflichtende Anpassungen der Höhe des<br />
Mindestlohnes ausarbeiten. Vom erarbeiteten Einkommen muss man Leben<br />
müssen. Der Mindestlohn muss ein soziokulturelles Existenzminimum abdecken.<br />
• Darüber muss der Niedriglohnbereich sozial zu reguliert und langfristig<br />
vollständig abgeschafft werden. Wir wollen hier in enger Verbindung mit unseren<br />
Anforderungen für die Ausgestaltung des öffentlichen Beschäftigungssektors ein<br />
politisches Konzept für die Reform des Niedriglohnsektors erarbeiten.<br />
• Als erste Maßnahme müssen jegliche Erwerbsarbeiten in Zukunft steuer und<br />
sozialabgabenpflichtig werden. Ausnahmen soll es hierfür nicht geben.<br />
Der Anstieg der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse in den letzten Jahren<br />
ist unter anderem auch auf die veränderte Vermittlungspraxis der<br />
Arbeitsagenturen im Zuge der Hartz-Gesetze zurück zuführen, nach der jede<br />
Arbeit, sofern sie nicht sittenwidrig ist, zumutbar ist. Demnach können<br />
Arbeitslose auch zur Annahme eines Mini- oder Midi-Jobs gezwungen werden. Da<br />
mit diesen Jobs der Lebensunterhalt nicht selbst bestritten werden kann, sind<br />
diese Arbeitnehmerinnen weiterhin auf ergänzendes ALG II angewiesen. Diese<br />
staatliche Subventionierung prekärer Beschäftigung ist abzulehnen, ebenso wie<br />
das „Abschieben“ angeblich nicht vermittelbarer Langzeitarbeitsloser in die so<br />
genannten 1-Euro-Jobs oder andere kurzfristige Maßnahmen. Sinnvoller ist es<br />
dagegen, Beschäftigte mit niedrigen Gesamteinkommen zu entlasten. Diese<br />
Entlastung kann aber nicht wie derzeit im Rahmen der Mini/Midi-Jobs am Status<br />
eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses festgemacht werden, sondern<br />
muss die gesamten Einkünfte umfassen, um eine zielgerichtete Entlastung<br />
tatsächlich einkommensschwacher Haushalte herbeizuführen. Ein Element einer<br />
solchen Entlastung kann über eine progressive Staffelung der<br />
ArbeitnehmerInnen-Beiträge zu den Sozialversicherungen bei gleichzeitigen<br />
12
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
vollen Sozialversicherungsansprüchen bis zu einer Grenze, ab der der volle<br />
Beitragssatz geleistet werden muss, vorgenommen werden. Durch die<br />
gleichzeitige volle Erhebung der ArbeitgeberInnen-Beiträge sowie die Einführung<br />
des Mindestlohns besteht in einem solchen Fall auch keinerlei Anreiz für die<br />
ArbeitgeberInnen, sozialversicherungspflichtige Jobs wie derzeit in mehrere<br />
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse aufzuspalten<br />
• Wir <strong>Jusos</strong> fordern stattdessen für Menschen, für die mittel- bis langfristig keine<br />
Vermittlungschance in den regulären Arbeitmarkt besteht, eine wirkliche<br />
(geförderte) Beschäftigungsperspektive im Rahmen des öffentlichen<br />
Beschäftigungssektors (ÖBS) zu schaffen und ihnen so eine Lebensplanung über<br />
die nächste von der Arbeitsagentur verordnete Maßnahme hinaus zu<br />
ermöglichen. Zur Finanzierung ist insbesondere zu prüfen, wie Sozialleistungen<br />
mit aktiven Mitteln zur Wiedereingliederung gemeinsam genutzt werden<br />
könnten und in welcher Weise die Wirtschaft an den Kosten von Arbeitslosigkeit<br />
beteiligt werden muss. Dies würde das System auf eine dauerhafte, stabile<br />
Finanzierungsgrundlage stellen. Klar muss jedoch sein, dass es sich bei den so<br />
neugeschaffenen Beschäftigungsverhältnissen um Angebote an die Arbeitslosen<br />
handelt. Modellen die den Bezug des ALG II im Sinne eines „Workfare“-Ansatzes<br />
generell an Beschäftigung knüpfen wollen, lehnen wir ab. Wir wollen auch nicht<br />
ein Billiglohnverhältnis durch ein anderes ersetzen. Daher müssen die neu<br />
geschaffenen Beschäftigungsverhältnisse sozialversicherungspflichtig<br />
ausgestaltet und nach Tarif bzw. den branchenüblichen Löhnen entlohnt werden.<br />
Potentielle Zielgruppe sollen hauptsächlich Arbeitslose aus dem Rechtskreis des<br />
ALG II sein, die derzeit in 1-Euro- Jobs vermittelt werden. Um ein bloßes<br />
Abschieben „unbequemer“ Arbeitsloser zu verhindern, ist diese Zielgruppe genau<br />
zu definieren. Bei jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren und Menschen ohne<br />
Berufsausbildung muss deren Qualifizierung im Vordergrund stehen. Darüber<br />
hinaus müssen Aufstiegsperspektiven entwickelt werden. Sei es innerhalb des<br />
Systems oder durch einen Wechsel in den regulären Arbeitsmarkt. Dies steht<br />
nicht im Widerspruch zu einer grundsätzlichen Entfristung geförderter<br />
Beschäftigung, sondern soll sicherstellen, dass die Zielgruppe nicht von der<br />
beruflichen Weiterbildung ausgeschlossen wird. Wir wollen keine reguläre<br />
Beschäftigung verdrängen, sondern neue schaffen. Daher ist, bei der<br />
Identifizierung möglicher Tätigkeitsfelder, eine enge Zusammenarbeit mit<br />
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und kommunalen Gesellschaften sinnvoll<br />
und notwendig.<br />
13
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Selbstständige<br />
Seit den 1980er Jahren ist der Anteil der Selbstständigen an den Beschäftigten von 7,5 auf 10 %<br />
angestiegen. Gleichzeitig hat sich die Art der selbstständigen Tätigkeit verändert. So ist jede/r<br />
zweite Selbstständige ein/e so genannte „Solo-Selbstständige/r“ d.h. sie/ er beschäftigt keine<br />
weiteren ArbeitnehmerInnen. Ein verbreitetes Phänomen ist die Scheinselbstständigkeit.<br />
Unternehmen verlagern dauerhafte Tätigkeiten von abhängig Beschäftigten auf formal<br />
Selbstständige. Oftmals arbeiten diese Scheinselbstständigen nur für diesen eine/n<br />
ArbeitgeberIn. In diesen Fällen liegt ein Missbrauch der Beschäftigungsform vor. Es dient dann<br />
ausschließlich dazu, um das Unternehmensrisiko auf den Beschäftigten zu verlagern. Häufig<br />
wechseln Beschäftigte auf diese Weise in ihrem Erwerbsverlauf zwischen Phasen der<br />
abhängigen und der selbstständigen Beschäftigung. Selbstständige Beschäftigung kann auch<br />
prekär sein. Nicht nur dann, wenn offensichtlich Scheinselbstständigkeit vorliegt und<br />
Arbeitsplatzsicherheit sowie Mitbestimmung versagt werden. Auch nimmt die Zahl der<br />
Selbstständigen zu, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Seit 2003 fördert die Agentur für<br />
Arbeit die Existenzgründung in so genannten Ich-AGs. 2004 wurden 171.000 dieser<br />
selbstständigen Tätigkeiten begonnen. Untersuchungen haben ergeben, dass nur 17 % dieser<br />
Ich-AGs ein existenzsicherndes Einkommen erreichen.<br />
Die in der prekären Selbstständigkeit Beschäftigten sind häufig nur unzureichend sozial<br />
abgesichert. Insbesondere der Aufbau einer sozialen Sicherung für das Alter ist oftmals nicht<br />
möglich.<br />
• Wir fordern daher, dass alle Selbstständigen in die gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen einbezogen werden. Die Gesetzlichen Kranken- und die<br />
Soziale Pflegeversicherung sollen in solidarische Bürgerversicherungen umgebaut<br />
werden. Alle BürgerInnen sollen in der BürgerInnenversicherung versichert und<br />
alle Einkommensarten zur Finanzierung herangezogen werden. Die gesetzliche<br />
Rentenversicherung muss in eine Erwerbstätigenversicherung umgewandelt<br />
werden, um alle Beschäftigten abzusichern. Die Arbeitslosenversicherung soll in<br />
eine Arbeitsversicherung umgestaltet werden, die alle Erwerbstätigen einbezieht.<br />
So wollen wir insbesondere auch Selbstständige gegen Unterbrechungen der<br />
Erwerbstätigkeit versichern.<br />
Gute soziale Absicherung der Selbstständigen muss auch auf europäischer Ebene gelten.<br />
Deshalb dürfen Regulierung wie die E101 Bescheinigung und mangelndes Kontrolle nicht zu<br />
Lohndumping und schlechter Arbeit führen.<br />
Praktika nach abgeschlossener Berufsausbildung<br />
Eine spezielle Form der prekären Beschäftigung findet seit Jahren sehr hohe Beachtung in der<br />
öffentlichen Debatte und in den Medien. Dabei handelt es sich um AbsolventInnen von<br />
14
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
berufsqualifizierenden Ausbildungen, die nach Abschluss ihrer Ausbildung als PraktikantInnen<br />
eine nicht oder nur sehr schlecht bezahlte Beschäftigung aufnehmen. Sie werden von<br />
Unternehmen oft wie reguläre Beschäftigte eingesetzt. Wir <strong>Jusos</strong> sind nicht für ein Verbot von<br />
Praktika; Praktika können in einer Ausbildung wichtige Einblicke in das Arbeitsleben<br />
vermitteln. Wir sind aber der Ansicht, dass Praktika in der Regel vor oder während einer<br />
Ausbildung absolviert werden sollten, um den Missbrauch von PraktikantInnen als (schlechtoder<br />
unbezahlte) reguläre Arbeitskräfte zu unterbinden.<br />
In den Medienberichten entsteht meist der Eindruck, dass es sich bei der „Generation<br />
Praktikum“ nur um HochschulabsolventInnen handeln würde. Ohne Zweifel sind viele der<br />
betroffenen AbsolventInnen eines Hochschulstudiums. Eine vom Bundesministerium für Arbeit<br />
und Soziales (BMAS) in Auftrag gegebene Studie zeigt jedoch, dass AbsolventInnen einer<br />
beruflichen Ausbildung in weit größerem Maße nach ihrem Ausbildungsabschluss Praktika<br />
aufnehmen als HochschulabsolventInnen. Während von den HochschulabsolventInnen nach<br />
Abschluss ihres Studiums 24% noch mindestens ein Praktikum absolviert haben, sind es bei den<br />
AbsolventInnen einer betrieblichen Ausbildung 19%, bei den AbsolventInnen einer schulischen<br />
Ausbildung sogar 31%. Insgesamt haben von den beruflich qualifizierten jungen Beschäftigten<br />
20% mindestens einmal ein Praktikum gemacht.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> begrüßen zwar, dass sich das BMAS dem Missbrauch von Praktika annimmt. Die vom<br />
Ministerium eingeleiteten Maßnahmen reichen aber bei weitem nicht aus; sie werden<br />
weitgehend ohne Wirkung bleiben. Wir haben gegen den Missbrauch von Praktika als reguläre<br />
Arbeitskräfte bereits auf dem Bundeskongress 2006 in Saarbrücken umfangreiche Forderungen<br />
beschlossen:<br />
• Ein Praktikum darf nicht länger als drei Monate dauern;<br />
• Jedes Praktikum von Menschen in Ausbildung ist mit mind. 300 Euro/Monat zu<br />
vergüten (Ausnahmen für „Schnupperpraktika“, die weniger als einen Monat<br />
dauern, können getroffen werden);<br />
• Jedes Praktikum von AbsolventInnen einer Berufsausbildung oder eines Studiums<br />
ist mit mind. 600 Euro/Monat zu vergüten;<br />
• Für jedes Praktikum wird ein Praktikumsvertrag abgeschlossen, in dem<br />
insbesondere Dauer, Vergütung, Arbeitszeit sowie Ausbildungsziele<br />
festgeschrieben werden;<br />
• Nach dem Praktikum muss ein qualtiatives Arbeitszeugnis ausgestellt werden.<br />
Dies beinhaltet mindestens: Dauer, Tätigkeitsfeld, Bewertung des Absolventen. ;<br />
• Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Arbeitszeit etc. richtet sich nach den<br />
Regelungen für die im gleichen Betrieb beschäftigten ArbeitnehmerInnen;<br />
15
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
• Die Einrichtung von Praktikumsstellen muss vom Betriebsrat bzw. Personalrat<br />
genehmigt werden;<br />
• Eine Vergabe von Arbeits- und Ausbildungsplätzen gekoppelt an ein vorher zu<br />
absolvierendes Praktikum muss unterbunden werden; in der Regel sind solche<br />
Praktika nachträglich als reguläres Ausbildungs-/Beschäftigungsverhältnis zu<br />
bewerten.<br />
• Wir erwarten, dass die SPD, ihre Gliederungen, Fraktionen und Abgeordneten<br />
PraktikantInnen nur nach den oben genannten Regeln beschäftigen. Der<br />
Parteivorstand gibt hierfür einen Leitfaden heraus.<br />
Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass insbesondere eine gesetzlich festgeschriebene<br />
Befristung und Mindestvergütung von Praktika die wirkungsvollsten Maßnahmen gegen den<br />
Missbrauch von PraktikantInnen als reguläre Beschäftigte darstellen. Wir erwarten vom SPDgeführten<br />
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass es noch in dieser Wahlperiode eine<br />
entsprechende Initiative ergreift.<br />
Erwerbstätige Menschen wünschen sich sichere Beschäftigung, gute Arbeitsbedingungen<br />
sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in ihrer Tätigkeit. Wir <strong>Jusos</strong> wollen uns<br />
politisch dafür einsetzen, dass diese berichtigten Ansprüche der Beschäftigten erfüllt werden.<br />
Jeder Mensch hat das Recht auf gute Arbeit. Insbesondere junge Menschen müssen auf eine<br />
sichere Perspektive und garantierte Entwicklungsmöglichkeiten bauen können. Die<br />
Gewerkschaften und die betriebliche Mitbestimmung sind in vielen Bereichen nicht mehr<br />
alleine in der Lage, für alle Beschäftigten menschenwürdige Arbeitsbedingungen<br />
durchzusetzen. Deshalb fordern wir politische Regulierung für die unterschiedlichen Bereiche<br />
prekärer Beschäftigung ein und setzen uns für die Umsetzung unserer Positionen ein.<br />
16
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
A11 - BZ Nord-NDS<br />
Keine Spaltung in Beschäftigte erster und<br />
zweiter Klasse<br />
Hintergrund:<br />
Keine Branche wächst derzeit so schnell wie die Leiharbeit. Etwa die Hälfte aller neu<br />
geschaffenen Stellen im Jahr 2006 ist in diesem Bereich entstanden.<br />
Flexible Beschäftigungsform oder Notlage des Normalarbeitsverhältnisses? Diese Frage kommt<br />
bei dem Thema Leiharbeit ganz schnell auf. Politik und Wirtschaft propagierten „Zeitarbeit“ in<br />
den letzten Jahren immer wieder als das Mittel um Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu<br />
bringen. Seit 1972 ist Leiharbeit in Deutschland gesetzlich geregelt. Eine große Mehrheit vor<br />
allem in den großen Industriegewerkschaften war sich über lange Zeit einig in der Weigerung,<br />
Tarifverträge mit der Leiharbeitsbranche abzuschließen. Es sollte keine Abweichung von den<br />
erkämpften Standards abgeschlossen werden. Man befürchtete, damit eben jene<br />
Unternehmensstrategien zu stärken, die darauf zielen, reguläre Festanstellungen zugunsten<br />
von Leiharbeitskräften zurückzudrängen und die Kernbelegschaften immer mehr unter Druck<br />
zu setzen. Genauso wenig wollte man dazu beitragen, Belegschaften durch den Einsatz von<br />
Leiharbeitern zu fragmentieren und damit das zentrale gewerkschaftliche Druckmittel Streik<br />
zu gefährden. Die gewerkschaftliche Ablehnung hat denn auch über lange Zeit in etlichen<br />
Betrieben Leiharbeit erschwert. Zunächst in Übereinstimmung mit Parteien, staatlicher<br />
Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsrecht war Leiharbeit nicht nur bei Gewerkschaften verpönt,<br />
sondern auch politisch unerwünscht. Bis 1967 war sie gänzlich verboten, um dann 1972 im<br />
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz streng reglementiert erlaubt zu werden. Seitdem sind die<br />
Schutzbestimmungen des Gesetzes auf Betreiben von Branche und entleihenden<br />
Unternehmen sukzessive gelockert und abgebaut worden.<br />
Seit 1990 nehmen Gewerkschaften und SPD eine pragmatische Haltung gegenüber der<br />
Leiharbeit ein. Unternehmen suchen zunehmend jenseits des Normalarbeitsverhältnisses nach<br />
Flexibilisierungsmöglichkeiten, um z.B. auf Veränderungen im Arbeitsvolumen reagieren zu<br />
können. Der Einsatz von Leiharbeitskräften erspart den produzierenden Unternehmen<br />
aufwändige Such- und Entlassungskosten. Das Beschäftigungsverhältnis hat allerdings eine<br />
ganz besondere Charakteristik. Der Arbeitsplatz befindet sich im Entleihbetrieb. Die geleistete<br />
Arbeitskraft ist also faktisch an die Einheit „Entleihbetrieb“ gebunden. Die Entlohnung und das<br />
soziale Gefüge der KollegInnen sind dem/r Betroffenen aber nur schwer zugänglich, denn der<br />
Arbeitgeber ist die Verleihfirma. Von dieser Art der Beschäftigung verspricht man sich eine<br />
17
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
höhere Flexibilität der Unternehmen. Die Handlungskontexte von Beschäftigten in solchen<br />
atypischen Arbeitsformen erreichen eine neue Qualität; Unsicherheitszonen vergrößern sich in<br />
hohem Maße, Arbeitsqualität, Entlohnung und Sozialintegration sind Faktoren auf die kein<br />
Einfluss mehr genommen werden kann. Eine Integration oder Teilhabe an<br />
Entscheidungsprozessen kann nicht stattfinden. Mitbestimmung ist hier gar nicht erst möglich.<br />
Grundsätzlich gilt die Mitbestimmung nach BetrVG, für Beschäftigte der Verleihbranche<br />
erweist sich die Wahl eines Interessenvertreters als schwierig, da die Arbeit ausschließlich in<br />
anderen Firmen geleistet wird und die Branche außerdem von einer hohen personellen<br />
Fluktuation geprägt ist. Somit entfremdet sich der/die Arbeiter/in nicht nur von dem Produkt,<br />
sondern zunehmend von der Arbeitsleistung im Allgemeinen. Die einzige Größe die zwar<br />
versucht wird zu beeinflussen, jedoch von der einzelnen Person abhängig ist, ist die<br />
Arbeitskraft. Die Faktoren Zeit und Qualität werden von dem zuständigen Weisungsbefugten<br />
(Entleiher) festgelegt, oft auch ohne Wissen seines Überlassungsvertragspartners. Dieser hat<br />
weder den Einblick in die Arbeit noch Möglichkeiten, über das AÜG hinaus, Einfluss zu nehmen.<br />
In Zeiten der beschleunigten und finanzgetriebenen Kapitalentwicklung hat sich die Flexibilität<br />
zum Schlüsselwort für das betriebliche Überleben hervorgetan. Politik und Wirtschaft sahen<br />
sich gezwungen mehr Druck auf den Arbeitsmarkt auszuüben und begannen zahlreiche<br />
Reformen. Doch Flexibilisierung von Arbeit ist nicht notwendigerweise immer und für alle<br />
Beteiligten ein positiver Prozess. Zuletzt hatten die rot-grüne Bundesregierung mit der Hartz-<br />
Kommission Leiharbeit auch mit dem Instrument „Personal Service Agentur“ (PSA) zentralen<br />
Stellenwert für die Arbeitsmarkt-Reformen zugewiesen. Nachdem die PSA nicht den vom SPD<br />
Arbeits- und Wirtschaftsminister Clement versprochenen Effekt gebracht haben, kann dieser<br />
Versuch als gescheitert betrachtet werden. Mit Hilfe „vermittlungsorientierter Leiharbeit einen<br />
größeren Teil der Arbeitslosen wieder in Dauerbeschäftigung zu bringen“, ist nicht gelungen.<br />
Wesentliche Schutzbestimmungen wie Begrenzung der Überlassungshöchstdauer,<br />
Befristungsverbot, Wiedereinstellungsverbot, Synchronisationsverbot wurden gestrichen. Mit<br />
dem Misserfolg der Personal Service Agenturen ist aber nur die von der Arbeitsmarktpolitik<br />
geförderte Variante der Leiharbeit gescheitert. Als Branche insgesamt erlebt sie seit Jahren<br />
einen enormen Aufschwung, der zunächst als Zuwachs von Arbeitsplätzen auf allen Seiten<br />
Beifall finden könnte. Erst ein zweiter, kritischerer Blick gibt Aufschluss über die Gründe für<br />
diesen Boom.<br />
Schon die Bezeichnung an sich ist umstritten. Der Begriff „Zeitarbeit“ wird von der Branche<br />
selbst favorisiert. Er klingt modern und wird mit Flexibilität verbunden. Die Gewerkschaften<br />
sprechen dagegen von „Leiharbeit“. Der Begriff beinhaltet schon eine Kritik, indem verdeutlicht<br />
wird, dass hier Menschen wie Dinge verliehen werden. Flexibilität durch Leiharbeit ist für die<br />
Arbeitskräfte in aller Regel erzwungene Anpassung. In der Betriebswirtschaftslehre wird auch<br />
der Begriff „Personal-Leasing“ verwendet. Hier steht eine Flexibilisierung der Kosten im<br />
18
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Vordergrund der Betrachtung, wie bei den anderen Produktionsfaktoren auch. Der juristische<br />
Begriff schließlich lautet „Arbeitnehmerüberlassung“. Er kennzeichnet das Dreiecksverhältnis<br />
zwischen dem Arbeitgeber, der hier als Verleiher auftritt, indem er seine ArbeitnehmerInnen<br />
einem Dritten, dem Entleiher, für eine bestimmte Zeit überlässt. Diese Überlassung wird in<br />
einem Überlassungsvertrag geregelt. Die Leiharbeitskraft bleibt beim Verleihunternehmen<br />
beschäftigt, unterliegt aber für die Zeit des Einsatzes dem Direktionsrecht der Entleihfirma.<br />
Dabei gilt das Betriebsverfassungsgesetz auch für die LeiharbeitnehmerInnen, nach drei<br />
Monaten Einsatz bekommen sie automatisch auch ein aktives Wahlrecht im Entleihbetrieb.<br />
Aktuelle und historische Entwicklung<br />
Derzeit sind rund 2,4% der sozialversicherungspflichtigen Jobs Leiharbeitsverhältnisse. Das<br />
klingt nicht viel. Wenn man sich allerdings den Anstieg der Leiharbeit in der Gesamtwirtschaft<br />
ansieht, wird schnell klar, dass Handlungsbedarf besteht. Mitte Juni 2007 gab es laut<br />
Bundesagentur für Arbeit rund 731.000 LeiharbeiternehmerInnen. Der Maschinenbau, eine<br />
Branche die zur Zeit konjunkturell boomt, führt diese Bilanz mit 58.000 Leiharbeitskräften an.<br />
Von 2005 bis 2006 stieg die Zahl der Leiharbeitnehmer um 34%. Und von Mitte 2006 bis Mitte<br />
2007 legte sie noch mal um über 20% zu. Aber auch der Einsatzbereich hat sich in geringem<br />
Maße verschoben. LeiharbeiterInnen werden weiterhin tendenziell in Großbetrieben<br />
eingesetzt. Während sie früher aber fast ausschließlich im Fertigungsbereich eingesetzt<br />
wurden, finden sich die Arbeitsplätze auch in Verwaltungen und im Ingenieurwesen wieder.<br />
Doch wofür werden sie letztendlich eingestellt? Auf die Frage, mit welchen Mitteln sie auf<br />
Auslastungsschwankungen reagieren, gaben die meisten Unternehmen Überstunden,<br />
Arbeitszeitkonten, Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung und befristete<br />
Arbeitsverträge an. Erst an sechster Stelle wird Leiharbeit genannt. In der Praxis fügt sich die<br />
Form der Leiharbeit jedoch hervorragend in die üblich genannten Flexibilisierungsmaßnahmen<br />
ein.<br />
Es ist jedoch unschwer nachvollziehbar, dass aus gewerkschaftlicher Perspektive nicht in die<br />
Loblieder der Branche eingestimmt wird. Skeptisch muss man gegenüber dem Versprechen<br />
neoliberaler Arbeitsmarktpolitik, Leiharbeit für viele Arbeitslose zur Brücke in eine<br />
Festanstellung mit Langfristperspektive zu machen, bleiben. In einer sich neu formierenden<br />
Welt mit oft prekärer Arbeit bleibt es nicht aus sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.<br />
Das Bild von Arbeit und Bedingungen an diese hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark<br />
gewandelt. Wachsender Wohlstand für den Großteil der Beschäftigten und ein ausgebautes<br />
Sozialsystem mit hohen Standards entwickeln sich langsam zur Geschichte. Dieses scheinbar<br />
unerschütterliche „Modell Deutschland“ mit seinem sozialen Kompromiss zwischen Kapital<br />
und Arbeit zeigt seit geraumer Zeit Risse, die fortwährende Massenarbeitslosigkeit in Zeiten<br />
der Globalisierung hat den „Rheinischen Kapitalismus“ zu mindestens in Frage gestellt. Die<br />
19
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
über Jahre erkämpften Rechte und Standards der abhängig Beschäftigten sind bedroht. Gründe<br />
und Interessen für solche Umwälzungen sind benennbar: Arbeitsmärkte werden durch<br />
globalisierte Finanzregime, die Kapital in Internet-Geschwindigkeit global flüssig halten, für<br />
Produktion und Absatz weltweit mobilisiert und gegeneinander in Stellung gebracht,<br />
Standortentscheidungen werden in ungekannter Schnelligkeit für nahezu beliebige Orte auf<br />
dem Globus getroffen und bei Aussicht auf noch höhere Rendite auch wieder verworfen.<br />
Zeigen nationale, regionale oder lokale Arbeitsmärkte nicht die geforderte Kombination<br />
profitabler Merkmale, sehen sie sich vom Entzug der jeweiligen Arbeitsplätze, d.h. dem Abzug<br />
des Kapitals bedroht (vgl. Bochum: Opel, Nürnberg: AEG usw.). Standorte und ihre<br />
Belegschaften werden erpressbar, der Druck auf bislang gesichert scheinende Löhne,<br />
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen wächst, Standortsicherungen oder<br />
Beschäftigungsgarantien lassen sich – wenn überhaupt – nur noch befristet für<br />
Kernbelegschaften erreichen. Jedwede Form der Flexibilisierung wird zur Voraussetzung für<br />
den Verbleib der Arbeitsplätze. Angst wirkt disziplinierend und lässt auch merklich geringere<br />
Bezahlung, weniger Absicherung und schlechtere Arbeitsbedingungen noch akzeptabel<br />
erscheinen. So wirkt Prekarisierung auf das ganze Gefüge von Beschäftigung. Entscheidend für<br />
das nach wie vor schlechte Bild von Leiharbeit ist die prekäre Wirklichkeit dieser<br />
Arbeitsverhältnisse. Daran haben auch die Tarifverträge nichts geändert. Gerade in den letzten<br />
Jahren, seit mit dem verschärften Druck auf Arbeitslose die Devise „jede Arbeit ist besser als<br />
keine“ durchgesetzt wurde, haben sich die Bedingungen im Bereich gewerblicher Leiharbeit für<br />
Geringqualifizierte stark verschlechtert. Aus der in Brüssel seit langem diskutierten EU<br />
Richtlinie wurden die Grundsätze „equal pay / equal treatment“ für LeiharbeiterInnen in die<br />
Neufassung des AÜG übernommen, wonach LeiharbeitnehmerInnen zu gleichen Bedingungen<br />
beschäftigt werden sollen wie die ArbeitnehmerInnen im jeweiligen Entleihbetrieb. Was wie<br />
die Erfüllung aller gewerkschaftlichen Forderungen aussah und auch entsprechend in die<br />
Medien lanciert wurde, erwies sich jedoch als schöner Schein, denn das Gesetz gestattete<br />
zugleich, per Tarifvertrag von diesen Prinzipien abzuweichen. Als erster nutzte ein regionaler<br />
Leiharbeitgeber-Verband die neuen Möglichkeiten und schloss einen Tarifvertrag zu äußerst<br />
schlechten Bedingungen mit der „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit<br />
und Personal-Service-Agenturen“ ab. Somit gerieten die DGB-Gewerkschaften in Zugzwang.<br />
Damit nicht auch alle anderen Arbeitgeber diesem Tarifvertrag beiträten, mussten sie selbst<br />
aktiv werden und in Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden eintreten. Nach einer<br />
solchen Vorlage war es natürlich sehr schwer überhaupt noch einen besseren Abschluss<br />
organisieren zu können. Mit den Branchenverbänden BZA (große Leiharbeitsunternehmen)<br />
bzw. dem IGZ (mittelständisch) saßen auf der anderen Seite des Tisches Interessen, denen der<br />
schwache gewerkschaftliche Organisationsgrad und damit die geringe Durchsetzungsmacht<br />
der DGB-Tarifgemeinschaft in der Leiharbeit nicht unbekannt waren. Nach einigem<br />
Vorgeplänkel, bei dem die ungleichen Kräfteverhältnisse schon deutlich wurden, schloss die<br />
20
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Tarifgemeinschaft der DGB-Gewerkschaften im Mai 2003 einen Tarifvertrag mit dem IGZ ab,<br />
im Juni 2003 mit dem BZA.<br />
Somit gab es eine flächendeckende Standardisierung der Arbeitsentgelte und anderer<br />
Arbeitsbedingungen im Sektor Leiharbeit. Des Weiteren wurde aber die tendenzielle<br />
Benachteiligung der Leiharbeitskräfte festgelegt. Es gibt zwar hin und wieder Verleihfirmen,<br />
die über den üblichen Tarif zahlen, allerdings bedeuteten die abgeschlossenen Verträge eine<br />
Festlegung der Lohnungleichheit von Stammbelegschaft und Leiharbeitskräften. Der<br />
Einstiegslohn der untersten Lohngruppe im Leiharbeitsbereich ist wenig existenzsichernd. Der<br />
Tarifvertrag zwischen dem christlichen Gewerkschaftsbund und der mittelständischen<br />
Vereinigung der Zeitarbeitsfirmen für Ostdeutschland sieht einen Lohn von 5,60 Euro vor. Dies<br />
entspricht einem monatlichen Entgelt von rund 850 Euro. Der Tatbestand der Lohnarmut liegt<br />
nach Zahlen der IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) im Osten bei 1.034 Euro.<br />
Ein politischer Einschnitt waren vor allem die Hartz-Reformen. Nie wurden seit der ersten<br />
Fassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 1972 die rechtlichen Grundlagen der<br />
Zeitarbeit so gravierend verändert wie mit der Novellierung 2003. In dieser Neufassung steckt<br />
eine neue Definition der arbeitsmarktpolitischen Funktion von Leiharbeit. Mit Inkrafttreten des<br />
derzeit gültigen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) zum 1.1.2003 entfielen wesentliche<br />
Beschränkungen der Leiharbeit. Mit ihnen hatte einerseits verhindert werden sollen, dass der<br />
Verleihbetrieb das unternehmerische Risiko auf die Leiharbeitskräfte abwälzt. Andererseits<br />
sollten Stammbelegschaften davor geschützt werden, durch Leiharbeitskräfte ersetzt zu<br />
werden.<br />
1. Die Beschränkung der Überlassungshöchstdauer (= Einsatzzeit beim Entleihbetrieb)<br />
wurde schrittweise verlängert: von 3 auf 6 Monate (ab 1985), von 6 auf 9 Monate (ab<br />
1994), von 9 auf 12 Monate (ab 1997), von 12 auf 24 Monate (ab 2002). Ab 2003 gibt es<br />
keine Beschränkung mehr.<br />
2. Das Befristungsverbot, mit dem befristete Beschäftigungsverhältnisse zwischen<br />
Verleiher und Leiharbeitskraft sowie Kettenarbeitsverträge untersagt waren, entfällt<br />
nun ebenfalls.<br />
3. Das Wiedereinstellungsverbot, das es der Zeitarbeitsfirma untersagte, innerhalb von<br />
3 Monaten nach (durch Kündigung des Verleihers) beendetem Arbeitsverhältnis die<br />
Arbeitskraft wieder einzustellen, wird im neuen AÜG aufgehoben. Ursprünglich sollte<br />
damit gesichert werden, dass das Arbeitsverhältnis zum Verleiher den Arbeitseinsatz<br />
beim Entleiher überdauert.<br />
4. Das Synchronisationsverbot, das es dem Verleiher untersagte, die Dauer des<br />
Beschäftigungsverhältnisses mit der Leiharbeitskraft auf die Zeit der erstmaligen<br />
Überlassung an einen Entleiher zu beschränken, wird gestrichen.<br />
21
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Auch das gesetzliche Verbot von Wiederholungsbefristung greift nicht, da Leihfirmen nach<br />
Ablauf einer gewissen Pause oft die gleiche wieder einstellen.<br />
Ausblick und Anforderungen<br />
Nach Angaben des IAB wächst Leiharbeit rasant und vor allem in den Betrieben, in denen sie<br />
vorher schon intensiv genutzt wurde. Leiharbeit ist besonders im verarbeitenden Gewerbe und<br />
hier besonders in der Metallindustrie verbreitet. Der "Klebeeffekt", also der Anteil der<br />
LeiharbeitnehmerInnen, die in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernommen werden,<br />
ist mit ca. 13 Prozent gering. Die Bundesregierung stellte in ihrem zehnten Bericht über<br />
Erfahrungen bei der Anwendung des AÜG fest; „dass es sich nicht immer um zusätzlich neue<br />
Arbeitsplätze handelt. Besonders bei Großbetrieben sind Tendenzen erkennbar,<br />
Stammpersonal durch Leiharbeitskräfte zu ersetzen. Zum Teil werden MitarbeiterInnen<br />
entlassen, um sie über hauseigene Verleihfirmen zumeist zu ungünstigeren Tarifbindungen in<br />
den alten Betrieb zurück zu entleihen“. Es konnten noch zahlreiche weitere Mängel festgestellt<br />
werden. „So führt der häufige Wechsel des Einsatzortes nicht selten zu Problemen bei der<br />
Erstattung von Fahrtkosten oder Verpflegungsmehraufwand.“ Zudem sind damit nicht nur<br />
zusätzliche körperliche, sondern auch soziale Belastungen verbunden, wie eine Integration im<br />
Entleihbetrieb bei kurzer Überlassungsdauer nicht stattfindet.<br />
Die Europäischen Sozialpartnerverhandlungen zur Leiharbeit sind im Frühjahr 2001 gescheitert.<br />
Die Gewerkschaften hatten EU-weit von den Arbeitgebern gefordert, einen<br />
Gleichbehandlungsgrundsatz hinsichtlich der Entlohnung der Leiharbeitnehmer in einer<br />
europäischen Sozialpartner-Vereinbarung anzuerkennen. Die Verhandlungen waren Ende<br />
März an der Weigerung der Arbeitgeber gescheitert, diesen Grundsatz anzuerkennen. Dabei<br />
war in 10 von 15 Mitgliedsstaaten der Union die Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern mit<br />
den Beschäftigten im Einsatzbetrieb schon weitgehend in Gesetz oder Tarifvertrag verankert.<br />
Diesen Grundsatz als Mindeststandard auf europäischer Ebene festzuschreiben, hätte damit<br />
nur der bereits weitgehend gängigen Praxis in der Mehrzahl der europäischen Mitgliedstaaten<br />
entsprochen. Auch in Ländern mit liberalen Regelungen zur Arbeitnehmerüberlassung hat der<br />
Gleichbehandlungsgrundsatz hinsichtlich des Entgeltes meist einen festen Stellenwert.<br />
Bereits 2002 hat die EU eine Richtlinie zum Schutz von Leiharbeitskräften vorgelegt. Die Länder<br />
konnten sich bis heute nicht auf gemeinsame Standards verständigen. Zuletzt scheiterte eine<br />
Einigung an Deutschland und Großbritannien im Dezember 2007. Dieser geänderte Vorschlag<br />
sah eine Umsetzungszeit von zwei Jahren, mit einer Überprüfung der Anwendung nach fünf<br />
Jahren vor. Das Argument der politischen Rechten, in Deutschland sei Leiharbeit viel strikter<br />
geregelt als in anderen EU-Staaten, trifft nicht zu. In den Niederlanden gibt es eine klare<br />
Regelung, dass überlassene ArbeitnehmerInnen so zu bezahlen sind wie vergleichbare Kräfte<br />
22
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
im Einsatzunternehmen. Nach einem bestimmten Zeitraum ist die Leiharbeitsfirma dazu<br />
verpflichtet, den/die Arbeitnehmer/in dauerhaft zu beschäftigen.<br />
Leiharbeit ist ein sinnvolles Instrument, wenn die Kernfunktionen beachtet werden. Zur Zeit ist<br />
dies noch eine besondere Art der Beschäftigung, die allerdings zahlreiche negative<br />
Begleiterscheinungen hat. Wir verlangen deshalb Nachbesserung und unterstützen den<br />
Gewerkschaftsrat in seinen Forderungen zur Arbeitnehmerüberlassung.<br />
Equal Pay/Treatment<br />
In vielen Unternehmen geht es beim Einsatz von Leiharbeit längst nicht mehr um die<br />
Abdeckung von Auftragsspitzen oder den Ausgleich saisonaler Auftragsschwankungen,<br />
sondern um systematische Kostensenkung durch Lohndumping. Der Unterschied der<br />
Jahresgehälter zwischen Leiharbeitern und Stammbelegschaft beträgt bis zu 20 000 Euro. Ein<br />
Beitrag zur privaten Altersvorsorge liegt nicht im Budget; Altersarmut ist vorprogrammiert.<br />
Nach Erhebungen des DGB im Rahmen des „Index Gute Arbeit“ ist die Gruppe der<br />
Geringverdiener unter Leiharbeitern wesentlich größer als unter Festangestellten. Rund 60 %<br />
der Leiharbeiter und fast 95 % der LeiharbeiterInnen verfügen über ein monatliches<br />
Bruttoeinkommen von weniger als 1500 Euro, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Unter<br />
Festangestellten verdienen nur 30 % der Männer und 48 % der Frauen ähnlich wenig. Auch der<br />
Urlaubsanspruch der Leiharbeitskräfte ist oftmals geringer.<br />
Weiterbildung findet bei ArbeitnehmerInnen in atypischer Beschäftigung nur sehr wenig statt.<br />
Insgesamt kostet das Unternehmen eine Leiharbeitskraft wesendlich weniger als eine<br />
zusätzliche Facharbeitskraft. Dies erhöht den Druck auf die Stammbelegschaft und löst damit<br />
eine Abwärtsspirale bei den Arbeitsbedingungen aus. Die Unterschiede in den<br />
Arbeitsbedingungen sind nicht auf betriebliche oder persönliche Merkmale, wie Qualifikation<br />
oder Alter, zurückzuführen, sind also unmittelbar mit dieser Art der Beschäftigung gekoppelt.<br />
Die Selbsteinschätzung gibt einen klaren Aufschluss über Arbeitsbedingungen. „Gute Arbeit“<br />
gibt es nur für 2% der Leiharbeitskräfte und 56% bewerten sie schlicht als schlecht. Befristete<br />
Beschäftigte bewerten ihre Arbeit deutlich besser als Leiharbeitskräfte, obwohl sich auch hier<br />
im Vergleich zu unbefristet Beschäftigten ein negativer Gesamtindex herauskristallisiert.<br />
Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss so geändert werden, dass nach einer von den<br />
Tarifpartnern des Entleihbetriebes festzulegenden angemessenen Einarbeitungszeit für<br />
Leiharbeitnehmer die gleiche Bezahlung und die gleichen Arbeitsbedingungen gelten wie für<br />
Stammarbeitskräfte. Von dieser Regel soll dann nicht mehr durch Tarifvertrag abgewichen<br />
werden können.<br />
23
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Gleichstellungsgrundsatz<br />
Das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes gilt auch für ArbeitnehmerInnen! Wir akzeptieren<br />
keine Spaltung zwischen Stammbelegschaft und LeiharbeitnehmerInnen. Weder bei<br />
Entgeltberechnung noch bei betrieblichen Leistungen wie Betriebsrente oder Weiterbildung.<br />
Der Gesetzgeber muss Klarheit bei den Gleichbehandlungsgrundsätzen von §9 Nr.2 AÜG<br />
herstellen. Eine betriebliche Abweichung darf nur unter Beachtung des Günstigkeitsprinzips<br />
erfolgen.<br />
Verbot von Ablösesummen und Zeitlimits<br />
Es ist sicherzustellen, dass Leihbeschäftigte jederzeit von einem entleihenden Betrieb in die<br />
Stammbelegschaft übernommen werden können. Ablösesummen oder Zeitlimits durch das<br />
Verleihunternehmen sind daher strikt zu verbieten<br />
Maximale Verleihzeit<br />
Die Überlassung von ArbeitnehmerInnen muss wieder befristet werden. Heute ist es möglich,<br />
reguläre Arbeitsplätze unbefristet durch Leiharbeit zu ersetzen. Dies wird dem eigentlichen<br />
Sinn von Leiharbeit, der Abfederung von Produktionsspitzen, aber nicht gerecht. In diesem<br />
Zusammenhang muss ebenso die Möglichkeit geschaffen werden, dass LeiharbeiterInnen bei<br />
einer Überschreitung der Fristen das Recht auf eine Festanstellung bekommen.<br />
Quotenregelung<br />
Forderungen der Gewerkschaft nach einer Höchstquote für LeiharbeitnehmerInnen in einer<br />
Belegschaft müssen politisch unterstützt werden. Für kleine und mittlere Betriebe sind<br />
Ausnahmeregelungen zu finden. In jedem achten Betrieb, der Leiharbeit nutzt, sind bereits<br />
mehr als 20% der Beschäftigten Leiharbeitskräfte. (Stand 02.08)<br />
Synchronisations-, Befristungs- und Wiedereinstellungsverbot<br />
24
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Leiharbeitsunternehmen müssen verpflichtet sein ArbeitnehmerInnen dauerhaft zu<br />
beschäftigen und nicht das Arbeitsverhältnis an die Dauer des Verleihvertrages zu koppeln<br />
oder den gleichen Arbeiter nach einer Flautensaison wieder einzustellen. Es liegt in der Natur<br />
der Sache, dass es eine Nichteinsatzzeit für den Arbeitnehmer gibt. Dieses Risiko darf nach § 11<br />
Abs.4 AÜG auch nicht auf den Arbeitnehmer umgeschichtet werden. Die Überbrückungskosten<br />
sind Bestandteil des Verrechnungssatzes mit den Entleihbetrieben.<br />
Mindestlohn im Arbeitnehmerentsendegesetz (auch für ausländische<br />
Betriebe)<br />
Die Leiharbeitsbranche muss in den Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes<br />
aufgenommen werden. Ziel ist die Allgemeinverbindlicherklärung des existierenden<br />
Mindestlohn-Tarifvertrages, der zwischen den Tarifvertragsparteien abgeschlossen wurde. Am<br />
30. Mai 2006 hat die Tarifgemeinschaft des DGB mit BZA und IGZ einen<br />
Mindestlohntarifvertrag abgeschlossen. Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch<br />
Dumpingabschlüsse der so genannten christlichen Gewerkschaften und der sich<br />
abzeichnenden Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU ist eine untere Grenze der Entlohnung<br />
unabdingbar. Der Mindestlohntarifvertrag kann jedoch erst wirken (auch für ausländische<br />
Leiharbeitsbetriebe), wenn die Leiharbeitsbranche in den Geltungsbereich des Arbeitnehmer-<br />
Entsendegesetzes aufgenommen wird.<br />
Grundsätzlich fordern wir die Einführung eines allgemeinen, gesetzlichen Mindestlohns, der<br />
dann auch für die Leiharbeitsbranche gilt.<br />
Mitbestimmung<br />
Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in den Entleihbetrieben müssen gestärkt werden,<br />
insbesondere bezüglich der Kontrolle eines ordnungsgemäßen Einsatzes der<br />
LeiharbeitnehmerInnen und des Umfangs und der Dauer der Leiharbeit im Betrieb. Dem<br />
Entleiherbetriebsrat muss bei Verstößen des Verleihers gegen Bestimmungen des AÜG, gegen<br />
§ 9 Nr. 2 und beim Einsatz auf Stammarbeitsplätzen, ein Zustimmungsverweigerungsrecht<br />
nach § 99 Abs. 2 BetrVG eingeräumt werden.. Denn wenn im Betrieb ein befristetes oder<br />
unbefristetes Arbeitsverhältnis möglich ist muss dies bevorzugt in Betracht gezogen werden.<br />
Daneben ist § 14 AÜG dahin zu ergänzen, dass bei Betriebsvereinbarungen im Entleiherbetrieb<br />
zwingend das Günstigkeitsprinzips gelten muss. Des Weiteren muss die Anzahl der<br />
Leiharbeitskräfte zur Mandatsberechnung des Betriebsrates des Entleihunternehmens zählen,<br />
denn Betriebsräte sind für alle ArbeiterInnen in ihrem Unternehmen zuständig.<br />
25
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Bei hoher Fluktuation von LeiharbeiterInnen im Betrieb könnte die Berechnung der<br />
Betriebsratsgröße über die Zugrundelegung des jährlichen Durchschnitts geschehen.<br />
Weiterbildung für LeiharbeiterInnen<br />
Leiharbeitsfimen sollen über eine Lohnsummenumlage zur Finanzierung eines<br />
Weiterbildungsfonds für Leiharbeiter herangezogen werden. Vorbilder sind die Niederlande,<br />
Italien, Spanien, Portugal und Frankreich.<br />
Außerdem fordern wir eine grundsätzliche Neubestimmung der Begriffe<br />
„Betriebszugehörigkeit“ und „ArbeitnehmerInnen“. Durch Leiharbeit dürfen keine originären<br />
Rechte von ArbeitnehmerInnnen ausgehöhlt oder abgeschwächt werden. Deshalb muss der<br />
Einsatz von Leiharbeit in bestreikten Betrieben verboten sein.<br />
Arbeitsschutz<br />
Auch im Bereich des Arbeitsschutzes besteht Nachholbedarf. So zeigt eine Untersuchung, dass<br />
über 60 % der LeiharbeitnehmerInnen Lärm ausgesetzt waren, doppelt so viele wie bei den<br />
Stammbeschäftigte. So wird Arbeits- und Gesundheitsschutz oft vernachlässigt, obwohl die<br />
Tätigkeiten der LeiharbeitnehmerInnen im Durchschnitt belastender sind. Regelmäßige<br />
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen finden fast gar nicht statt. 58 % werden nicht<br />
einmal über Gefährdungs- und Schutzmaßnahmen informiert. 35 % bekommen eine<br />
mangelhafte Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Von der Bundesregierung wurde<br />
festgestellt: „Leiharbeitnehmer sind erfahrungsgemäß wegen der häufig wechselnden<br />
Arbeitsplätze, den damit zwangsläufig verbundenen unterschiedlichen Arbeitsanforderungen<br />
und veränderten Arbeitsabläufen einer höheren Gefährdung ausgesetzt als die Arbeitnehmer,<br />
die regelmäßig an ihnen bekannten Einsatzorten arbeiten. Dies erfordert höhere<br />
Anstrengungen bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes.“ Da der Arbeitgeber für den Schutz<br />
zuständig ist, aber das Entleihunternehmen die Arbeitsbedingungen festlegt, können sich<br />
Forderungen nur an beide Vertragspartner richten.<br />
26
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
B<br />
Bildungs- und Forschungspolitik<br />
B 1 – Bundesvorstand<br />
Bildung: Gerecht und Gut!<br />
Die Bundesregierung veranstaltet dieses Jahr am 22. Oktober einen groß angekündigten<br />
„Qualifizierungsgipfel“ in Dresden. Mit diesem inszenierten Event versucht<br />
Bundesbildungsministerin öffentlichkeitswirksam die magere Bilanz ihrer Amtszeit zu<br />
verdecken.<br />
Bildungspolitisch hat die große Koalition wenig Konkretes vorzuweisen. Die wenigen positiven<br />
Initiativen mussten von der SPD gegenüber der Union hart durchgesetzt werden. Trotz<br />
Kanzlerinnen-Reden über die „Bildungsrepublik“ – die gravierenden Mängel des<br />
Bildungssystems werden von dieser Bundesregierung nicht angegangen. Im Vorfeld des<br />
Qualifizierungsgipfels ist für uns <strong>Jusos</strong> der Zeitpunkt gekommen, die bildungspolitische<br />
Regierungspolitik zu beurteilen.<br />
Bildung in Deutschland aktuell<br />
Der Bildungsbericht der Bundesregierung 2008 hat wieder einmal gezeigt: Das Bildungssystem<br />
in Deutschland ist hochgradig sozial selektiv und qualitativ schlecht. Diese lange bekannte<br />
Gewissheit wird mit jedem Bildungsbericht aufs Neue bestätigt. Doch das Problem wird nicht<br />
durch Wegsehen gelöst. Deshalb ist es in einem ersten Schritt wichtig, die Fakten genauer zu<br />
betrachten.<br />
o<br />
o<br />
Trotz der Investition von Milliarden im Bereich der frühkindlichen Bildung<br />
stehen in den westdeutschen Bundesländern noch immer nicht ausreichend<br />
Plätze zur Verfügung. Die Versorgungsquote liegt (in Westdeutschland) nur bei<br />
mageren 10%.<br />
Das gegliederte Schulsystem führt bei viel zu vielen Schülerinnen und Schülern<br />
zu Perspektivlosigkeit. Insbesondere der Hauptschulabschluss ist kaum<br />
geeignet, jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu eröffnen. Außerdem<br />
verlassen noch immer viel zu viele SchulabgängerInnen die Hauptschule ohne<br />
Abschluss. 2006 waren es rund 76000.<br />
27
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
o Rund ein Viertel der SchulabgängerInnen stecken in sinnlosen und<br />
überflüssigen Warteschleifen. Diese wirken demotivierend und führen zu meist<br />
zu keinem qualifizierenden Schul- und Berufsabschluss. Die Zahl der<br />
StudienanfängerInnen steigt trotz steigender Anzahl der Studienberechtigten<br />
nicht. Ursache hierfür sind flächendeckende Zulassungsbeschränkungen als<br />
Folge zu geringer Studienkapazitäten. Zusätzlich verstärkt wird diese<br />
Entwicklung durch die abschreckende Wirkung allgemeiner Studiengebühren,<br />
wie sie in den unionsgeführten Ländern eingeführt worden sind.<br />
o Nur ein Prozent der zugelassenen Studierenden haben ihre<br />
Hochschulzugangsberechtigung über eine berufliche Bildung erworben, obwohl<br />
es in jedem Bundesland unterschiedlich ausgestaltete Verfahren gibt, durch das<br />
auch beruflich Gebildeten die Aufnahme eines Studiums ermöglicht wird. Dies<br />
zeigt: Durchlässigkeit ist faktisch nicht vorhanden.<br />
o Die Weiterbildungsausgaben der Bundesagentur für Arbeit aber auch der<br />
Wirtschaft sinken seit Jahren.<br />
Diese Zahlen sind Kennzeichen eines schlecht funktionierenden Systems. So abstrakt diese<br />
Zahlen auch klingen mögen, was sie bedeuten ist dramatisch. Das sozial selektive und<br />
qualitativ schlechte Bildungssystem zerstört in Deutschland jedes Jahr die Perspektive von<br />
tausenden jungen Menschen. Auch ihnen werden viele Chancen verbaut. Bildung verkommt zu<br />
einem knappen Gut. Bildung als Möglichkeit zur Emanzipation, Bildung als Selbstzweck verliert<br />
immer mehr an Bedeutung und wird sogar belächelt. Wir <strong>Jusos</strong> wissen: dies ist falsch. Ohne<br />
eine qualitativ hochwertige Bildung für alle, ohne einen Stopp der sozialen Selektivität werden<br />
Perspektiven zerstört und Bildung wird nur noch als Voraussetzung zum Nachgehen einer<br />
anspruchsvolleren Erwerbstätigkeit angesehen. Dies beeinträchtigt nicht nur das einzelne<br />
Individuum, sondern wirkt negativ auf die gesamte Gesellschaft: Denn eine Gesellschaft, in der<br />
Bildung nur noch als Qualifikation begriffen wird, aber selbst im Hinblick auf diesen Aspekt<br />
nicht funktioniert, verliert die Fähigkeit zur kritischen Reflexion und stumpft ab.<br />
Nicht labern! Handeln!<br />
Über die Bewertung des Bildungssystems herrscht bei allen relevanten politischen Akteuren<br />
weitgehende Einigkeit: Das Bildungssystem ist schlecht und bedarf dringend Verbesserungen.<br />
Alle wesentlichen politischen Akteure, auch die Union unter Führung von Angela Merkel,<br />
bekennen sich zur Notwendigkeit einer solchen Verbesserung und werden deshalb<br />
bildungspolitisch aktiv.<br />
28
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Als Antwort auf die bestehenden Probleme im Bildungssystem geht Angela Merkel auf<br />
„Bildungsreise“, um dann anschließend im Herbst einen „Qualifizierungsgipfel“ abzuhalten<br />
und eine „Bildungsrepublik Deutschland“ zu fordern. Bisher fiel Angela Merkel vor allem<br />
dadurch auf, dass sie sich verbal politischen Themen verschrieb und auf die besondere<br />
Bedeutung aufmerksam machte, dann gut aussehende Bilder produzierte, um dann das Thema<br />
unvollendet schnell wieder fallen zu lassen. Vor diesem Hintergrund lässt sich schnell erahnen,<br />
welche Konsequenzen die Aktivitäten der Kanzlerin auch dieses Mal nur entfalten werden.<br />
Doch die Aktivitäten der Union sind nicht nur heuchlerisch und unehrlich. Bei der Betrachtung<br />
der Aktivitäten in einzelnen bildungspolitischen Bereichen wird schnell klar, dass die derzeitige<br />
Bildungspolitik nicht dazu geeignet ist, die Bildungssituation nachhaltig zu verbessern.<br />
Stattdessen drohen durch sie eher die Ungerechtigkeiten im Bildungssystem verfestigt zu<br />
werden.<br />
Bildungskompetenzen für den Bund<br />
Die Union war es, die in den zähen Verhandlungen im Vorfeld der Föderalismusreform I, massiv<br />
den Abbau von Bildungskompetenzen für den Bund gefordert hat. Nachdem sich die SPD<br />
weigerte, diesen Schritt mitzugehen, hat die Union das gesamte Projekt blockiert und es so<br />
schließlich doch geschafft, ihren parteipolitischen Kopf durchzusetzen. Bei den letzten<br />
verbliebenen (schwachen) Kompetenzen des Bundes, der Kompetenz zur Regelung der<br />
Studienabschlüsse und Hochschulzugänge1, sperrt sich die Union ebenfalls. Die SPD will<br />
einheitliche Studienabschlüsse und Hochschulzugänge, die Union möchte diese<br />
Bundeskompetenz nicht gebrauchen. Diese Aspekte müssen bei der Bewertung der<br />
bildungspolitischen Aktivitäten der Kanzlerin mitberücksichtigt werden. Ihre Partei möchte<br />
keine gemeinsamen Kraftanstrengungen des Bundes und aller Bundesländer. Die<br />
Bundesländer werden darin unterstützt – allein, damit sich die einzelnen Landesregierungen<br />
profilieren können - ihr eigenes Bildungs-Süppchen zu kochen. Es ist daher schlicht unehrlich<br />
und heuchlerisch, wenn Frau Merkel nun mit großen Worten nun in diesem Politikfeld verbal<br />
aktiv wird.<br />
Solange dies nicht geschehen ist, fordern wir <strong>Jusos</strong> einheitliche Schul- und Studienabschlüsse,<br />
in welchen die bundesweite Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Auch wenn die<br />
Bildungskompetenzen bei den Ländern liegen, darf dies auf keinen Fall einen Unterschied in<br />
den Anforderungen der Schulen und Universitäten zur Folge haben.<br />
1<br />
Eine „Abweichungskompetenz“, d.h. der Bund kann eine einheitliche Regelung erlassen, die Länder<br />
können aber ein abweichendes Gesetz erlassen.<br />
29
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Bildungspolitik für alle, nicht nur für eine Elite!<br />
Das bildungspolitische Grundverständnis der Union ist vor allem auf die Förderung von Eliten<br />
ausgerichtet. Deutlich wird dies – neben zahlreichen verbalen Bekundungen – auch am Beispiel<br />
Studienfinanzierung: Nachdem die Bundesministerin für Bildung und Forschung Annette<br />
Schavan, die zu Amtsantritt das BAföG als „Auslaufmodell“ bezeichnete, im Jahr 2007 noch<br />
eine Niederlage erlitt, als die SPD die Erhöhung der BAföG-Sätze durchsetzen konnte,<br />
verwirklicht sie aktuell wieder stärker ihre eigenen bildungspolitischen Vorstellungen. Feilschte<br />
sie bei den Verhandlungen über die BAföG-Erhöhung noch um jede Million, die den<br />
förderungsbedürftigen Studierenden nicht (!) zur Verfügung gestellt werden sollte, waren und<br />
sind für die Förderung von so genannten „Begabten“ kontinuierliche Erhöhungen der<br />
finanziellen Mittel problemlos möglich. So wurde die Anzahl der mit einem Stipendium<br />
geförderten Studierenden zwischen 2005 (11.000 StipdentiatInnen) und 2008 (16.400) um ca.<br />
50% erhöht. Für die Förderung einiger weniger werden also umfangreiche Mittel bereitgestellt,<br />
während ein Großteil der jungen Menschen, die ein Studium beginnen wollen oder bereits<br />
studieren, auf Einkünfte aus Nebenjobs angewiesen sind, weil das BAföG nicht ausreicht oder<br />
vermutlich aus finanziellen Gründen zunächst einmal überhaupt kein Studium aufnehmen.<br />
Gleichzeitig haben die unionsregierten Länder erhebliche neue finanzielle Belastungen durch<br />
die Einführung von Studiengebühren verursacht. Dies alles führt dazu, dass Bildung immer<br />
stärker den ohnehin schon Privilegierten vorbehalten bleibt.<br />
Die SPD unterstützt diesen Trend der Elitenförderung. Zwar sieht sie die Förderung von Eliten<br />
nicht als alleinentscheidend an und kämpft parallel (siehe die letzte BAföG-Erhöhung) auch für<br />
die Förderung von sozial Schwächeren. Sie unterstützt aber genauso alle Programme zur<br />
„Spitzenförderung“.Wir <strong>Jusos</strong> fordern einen verbindlichen Rechtsanspruch auf<br />
Studienfinanzierung für alle, weg von einem elitären Stipendienmodell. Es gibt keine Eliten,<br />
sondern nur Leute, die von besonders günstigen Umständen (frühe Förderung, kulturelles<br />
Kapital usw.) profitieren. Wir wollen, dass alle gleichermaßen Zugang zu guter Bildung<br />
erhalten.<br />
Frühkindliche Bildung ausbauen!<br />
Eine frühzeitige Förderung von Kindern fördert ihre Zukunftschancen, ihre Integration und<br />
sorgt für eine langfristige Sicherung der Gleichstellung. Durch eine qualitativ hochwertige<br />
vorschulische Bildung und durch soziales Lernen in Kindertageseinrichtungen können<br />
außerdem unterschiedliche Voraussetzungen der Kinder, die durch unterschiedliche soziale<br />
Familienhintergründe bedingt sind, ausgeglichen werden. Zudem wirkt sich ein Ausbau der<br />
30
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
frühkindlichen Bildung positiv auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auf die<br />
Beschäftigung aus.<br />
Die Union pflegt bei der Frage der Kinderbetreuung noch immer ihr traditionelles<br />
Familienverständnis. Zwar war es verhältnismäßig fortschrittlich, dass sich die<br />
Familienministerin der Union, Ursula von der Leyen, für einen Ausbau der Betreuungsplätze<br />
von Kindern unter 3 Jahren einsetzte, bei der Diskussion um das Elterngeld zeigte sich jedoch,<br />
dass die Union ihre traditionellen Rollenvorstellungen nicht überwunden hat, indem sie sich<br />
einer Einführung von „Partnermonaten“, die einen Anreiz für die Betreuung von Kindern durch<br />
beide Elternteile bedeutete, widersetzte. Dass jedoch überhaupt die Grundbereitschaft<br />
besteht, die frühkindliche Bildung zu verbessern, ist eine begrüßenswerte Entwicklung. Die SPD<br />
setzt sich ebenfalls sehr massiv für den Ausbau der frühkindlichen Bildung ein. Gegen den<br />
Widerstand der Union konnten sie einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten<br />
Lebensjahr ab dem Jahr 2013 durchsetzen. Dies führt zu einem massiven Ausbau der<br />
Betreuungskapazitäten.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> begrüßen diese erfreuliche Entwicklung. Sie geht uns aber nicht weit genug. Auch im<br />
Bereich der frühkindlichen Bildung gilt: Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern<br />
abhängen, wir fordern deshalb eine vollständige Gebührenfreiheit von Kindertagesstätten und<br />
Kindergärten. Im Übrigen kommt es für uns nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die<br />
Qualität der Bildung an. Hier fordern wir insbesondere eine bessere Ausbildung der<br />
ErzieherInnen. Für uns ist zudem klar: Wenn man durch eine frühe Förderung unterschiedliche<br />
Voraussetzungen ausgleichen will, darf Kinderbetreuung nicht nur freiwillig stattfinden. Wir<br />
fordern deshalb einen verpflichtenden Kindergartenbesuch ab dem dritten Lebensjahr.<br />
Die Gliedrigkeit des Schulsystems auflösen: Für die Gemeinschaftsschule!<br />
Die Aufteilung der GrundschülerInnen nach der vierten bzw. nach der sechsten Klasse auf die<br />
verschiedenen Schulformen ist eine der wesentlichsten Selektionsstufen im deutschen<br />
Bildungssystem. Der Bildungsweg der SchülerInnen wird bereits in einem Alter festgelegt, in<br />
dem sie noch stark von der Erziehung durch die Eltern geprägt sind. Die Kinder von Eltern, mit<br />
eher geringer Bildung und wenig Einkommen, haben es damit deutlich schwerer, Zugang zu<br />
höherer Bildung durch eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, als Kinder aus bildungsnäheren<br />
und einkommensstärkeren Familien. Damit reproduziert das mehrgliedrige Schulsystem<br />
gesellschaftliche Ungleichheiten immer wieder aufs Neue. Mit der Einführung der<br />
Gesamtschule ist in einigen Bundesländern ein erster Einbruch in das dreigliedrige Schulsystem<br />
gelungen. In der Folge hat sich die Bildungsbeteiligung von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund und bildungsfernen Milieus erhöht.<br />
31
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Konservativen halten weiterhin an einem gegliederten Schulsystem fest. Eine Einteilung<br />
junger Menschen auf Haupt- und Realschulen, Gymnasien für Privilegierte und Sonderschulen<br />
entspricht einem elitären Weltbild. Die aus dieser Differenzierung entstehenden<br />
gesellschaftlichen Strukturen sollen bewusst beibehalten und nicht aufgelöst werden. Eine<br />
solche Politik zielt bewusst darauf ab, Menschen vom Zugang zu höherer Bildung abzuhalten<br />
und ist inakzteptabel.<br />
Die SPD kämpft für die Einführung der Gemeinschaftsschule. Aber auch die Chancen, die sich<br />
aus einer solchen richtigen Politik eröffnen, die nebenbei auch bei der Bevölkerung immer<br />
mehr Sympathie erhält, werden durch Inkonsequenz und Unehrlichkeit vertan. Zunächst ist in<br />
diesem Zusammenhang die Tatsache zu nennen, dass die SPD nicht offensiv genug für diese<br />
Politik eintritt. Stattdessen wirkt es mitunter so, als wolle sie diese Forderung durch<br />
umschreibende Formulierungen wie „Eine Schule für alle!“ kaschieren. Viel schlimmer noch ist,<br />
dass die SPD ihre Politik da, wo sie es könnte, nicht umsetzt. In Berlin hätte sie die Möglichkeit<br />
zusammen mit der Linkspartei die Gemeinschaftsschule einzuführen, in Rheinland-Pfalz<br />
könnte sie es sogar alleine. Geschehen ist in beiden Ländern zu wenig. Diese Unehrlichkeit und<br />
Inkonsequenz führt – nicht zu Unrecht – zu massiver Unglaubwürdigkeit. Besonders<br />
kritikwürdig sind Bestrebungen, innerhalb entgegen den Beschlüssen des Hamburger<br />
Parteitages ein zweigliedriges System zu etablieren.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> wollen diese soziale Selektion auflösen und das mehrgliedrige Schulsystem<br />
abschaffen! Wir fordern stattdessen die Einführung einer Gemeinschaftsschule, in der alle<br />
SchülerInnen gemeinsam unterrichtet werden. Wie internationale Vergleichsstudien zeigen,<br />
haben in einer solchen Schulform sowohl leistungsschwächere als auch leistungsstärkere<br />
SchülerInnen einen größeren Bildungserfolg als in einem differenzierten Schulsystem. Wir<br />
<strong>Jusos</strong> wollen, daher die flächendeckende Einführung von Gemeinschaftsschulen. Der Erfolg der<br />
Gemeinschaftsschule ist bewiesen, wir brauchen keine Modellprojekte und keine Tests mehr.<br />
Die SPD steht daher in der Pflicht, wann immer sie Regierungsverantwortung in einem<br />
Bundesland trägt, die Umstellung der Schulstruktur voranzutreiben.<br />
Für eine Öffnung der Hochschulen!<br />
BildungspolitikerInnen aller Parteien fordern die Ausweitung der Kapazitäten an den<br />
Hochschulen, damit mehr Studierende einen Studienplatz erhalten können. Dies hat allerdings<br />
noch keine Auswirkungen auf die Realität. Dadurch, dass in erster Linie die Bundesländer für<br />
die Zulassungsregelungen und die Finanzierung der Studienplätze zuständig sind, wird die<br />
Frage der Kapazitäten zu sehr von fiskalischen Gesichtspunkten geleitet. Durch die Einigung<br />
32
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
auf eine anteilsmäßige Finanzierung neuer Studienplätze durch den Bund im Rahmen des<br />
Hochschulpakts ist zumindest die Hoffnung entstanden, dass die Studienplätze real steigen.<br />
Für uns <strong>Jusos</strong> ist klar: Alle müssen das Studium aufnehmen können, das sie möchten. Ein<br />
Bildungssystem kann nicht gerecht sein, solange es Menschen, die ein Hochschulstudium<br />
absolvieren könnten und das auch möchten, die Perspektive eines Hochschulstudiums verbaut.<br />
Deshalb fordern wir den massiven Ausbau der Studienplatzkapazitäten und den Abbau aller<br />
Zulassungsbeschränkungen. Stattdessen muss das Beratungssystem der Hochschulen<br />
verbessert werden, damit potentielle Studierende selbst besser einschätzen können, ob und<br />
wenn ja, welches Studium für sie geeignet ist.<br />
Uns ist bewusst, dass ein solches Ziel aufgrund jahrzehntelanger Unterfinanzierung der<br />
Hochschulen nicht von heute auf morgen umzusetzen ist. Kurzfristig fordern wir daher eine<br />
Beseitigung der gröbsten Ungerechtigkeiten. Im Rahmen des Hochschulpakts II müssen Bund<br />
und Länder erneut einen massiven schrittweisen Ausbau der Kapazitäten der Hochschulen<br />
beschließen und durchführen. Bei den Zulassungsregelungen fordern wir bundesweit<br />
einheitliche Regelungen, damit innerhalb eines ungerechten Systems SchülerInnen einzelner<br />
Bundesländer nicht auch noch besonders benachteiligt werden. Außerdem muss die Öffnung<br />
der Hochschulen für Personen mit beruflicher Bildung vorangetrieben werden.<br />
Lippenbekenntnisse sind hier nicht genug. Wir wollen, dass im Rahmen einer beruflichen<br />
Ausbildung die Allgemeinbildung einen höheren Stellenwert erlangt. Die Fähigkeiten, die<br />
Menschen im Rahmen einer Berufsausbildung erwerben, müssen sich in der Berechtigung<br />
widerspiegeln, ein Hochschulstudium aufnehmen zu dürfen.<br />
Aufgrund der Einführung des gestuften Studiensystem mit den zwei Abschlüssen - Bachelor<br />
und Master - kommt es jedoch nicht nur auf die erste Zulassung zur Hochschule an, also für<br />
einen Bachelor-Studiengang, sondern auch auf den Übergang zum Master. Denn hierfür hat die<br />
Kultusministerkonferenz im Jahr 2003 beschlossen, dass neben einem Bachelor-Abschluss noch<br />
besondere Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen, um einen Master-Studienplatz zu<br />
erhalten. Die besonderen Zulassungsvoraussetzungen können zum Beispiel eine gewisse<br />
Abschlussnote, eine zusätzliche Prüfung oder auch schlicht eine Übergangsquote sein. Dies<br />
führt dazu, dass viele Bachelor-AbsolventInnen die Hochschule verlassen müssen, obwohl sie<br />
eigentlich einen Master-Abschluss machen möchten. Das entspricht nicht der Idee des<br />
Bologna-Prozesses. Die gestuften Studiengänge sollten das Studium flexibler machen, nicht zu<br />
einer Ausdünnung des Studiums führen. Wir fordern deshalb einen Rechtsanspruch auf einen<br />
Master-Studienplatz für alle Bachelor-AbsolventInnen.<br />
Hochschulen auch sozial öffnen!<br />
33
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wenn es um die Partizipation an Bildung geht, darf man nicht nur auf die formelle Zulassung<br />
achten. Genauso wichtig ist es, die finanziellen Voraussetzungen für die Teilhabe an Bildung zu<br />
schaffen. Niemand darf aufgrund fehlender finanzieller Voraussetzungen von Bildung<br />
ausgeschlossen werden. Für die Union ist diese Problematik nicht existent. Sie setzt voll auf die<br />
Förderung Hochbegabter. Die Teilhabe an Bildung von Personen mit niedriger sozialer Herkunft<br />
ist für sie nicht relevant. Deshalb belässt sie es dabei durch verzinste Kredite die theoretische<br />
Möglicheit zu schaffen, an Bildung teilzuhaben. Kredite schrecken aber junge Menschen von<br />
der Aufnahme eines Studiums ab, weil mit ihnen die Aussicht auf eine erhebliche<br />
Verschuldung beim Start ins Berufsleben verbunden ist. Außerdem sind sie ungerecht. Durch<br />
sie werden die Studierenden mit einkommensschwächeren Eltern aufgrund der fälligen<br />
Zinszahlungen gegenüber solchen aus einkommensstärkeren Familien benachteiligt.<br />
Die SPD erkennt die Problematik durchaus. Sie hat gemeinsam mit <strong>Jusos</strong> und Juso-<br />
Hochschulgruppen für eine Erhöhung der Elternfreibeträge beim BAföG gekämpft und für eine<br />
Erhöhung der Bedarfssätze. Sie hat sich hier gegenüber der Union durchgesetzt.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> fordern, dass es nicht bei dieser einmaligen Erhöhung bleibt. Die Erhöhung war<br />
notwendig, weil die BAföG-Sätze jahrelang nicht an die allgemeine Preisentwicklung angepasst<br />
wurden, also real gesunken sind. Deshalb fordern wir kurzfristig, dass die BAföG-Sätze<br />
automatisch an die allgemeine Preisentwicklung angepasst werden. Doch darüber hinaus ist<br />
auch das das BAföG-System an sich problematisch: es ist elternabhängig. Deshalb haben<br />
immer wieder viele keinen BAföG-Anspruch, obwohl ihre Eltern kaum in der Lage sind, ihre<br />
Kinder finanziell zu unterstützen. Dieses Problem ist strukturell, denn es wird immer wieder<br />
Studierende geben, die genau in diesem Bereich liegen. Deshalb fordern wir langfristig eine<br />
bedarfsdeckende, elternunabhängige Studienfinanzierung in Form eines Vollzuschuss.<br />
Die Selektion nicht verschärfen – Studiengebühren verhindern!<br />
Sämtliche unionsgeführten Bundesländer haben Studiengebühren eingeführt. In allen anderen<br />
Bundesländern würde sie Studiengebühren einführen, wenn es die dafür erforderlichen<br />
Mehrheiten gebe. Die Union will durch Studiengebühren die soziale Selektion verschärften.<br />
Durch Studiengebühren wird Bildung zu einem knappen Gut, das man sich nur so sparsam wie<br />
möglich, also nur in dem Umfang, wie es für die Qualifikation für einen Beruf notwendig ist,<br />
durch Bezahlung verschafft. Das widerspricht unserem Bildungsverständnis. Studiengebühren<br />
führen außerdem dazu, dass sich viele überhaupt kein Studium mehr leisten können, oder nur<br />
durch einen Kredit finanzieren könnten, der wiederum eine zusätzliche finanzielle Belastung<br />
nach dem Einstieg in den Beruf bedeutet und deshalb viele von der Aufnahme eines Studiums<br />
abhält.<br />
34
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die SPD steht glaubhaft für die Nicht-Einführung bzw. die Abschaffung von Studiengebühren<br />
ab dem ersten Semester. Wo immer die SPD an einer Landesregierung beteiligt ist, hat sie dort<br />
die Einführung allgemeiner Studiengebühren verhindert. Hervorzuheben ist hier, die<br />
Abschaffung der (Langzeit-) Studiengebühren in Hessen durch die hessische SPD unter Führung<br />
von Andrea Ypsilanti als erstes und wichtigstes Projekt nach ihrem Wahlerfolg.<br />
Auch wenn die SPD für die Nichteinführung bzw. Abschaffung von Studiengebühren kämpft,<br />
wird durch die Befürwortung von Langzeitstudiengebühren durch große Teile der SPD das<br />
grundsätzlich positive Bild getrübt. Beispielsweise hat Rheinland-Pfalz trotz SPD-geführter<br />
Regierung ein als „Studienkonten“ bezeichnetes System von Langzeitstudiengebühren<br />
eingeführt. In anderen Bundesländern fordern sozialdemokratische Bildungspolitiker völlig<br />
offen Langzeitstudiengebühren. Diese Positionierung ist aus zwei Gründen fatal: Erstens wird<br />
auch durch ein solches System Bildung zu einer Ware gemacht, für die grundsätzlich bezahlt<br />
werden muss. Lediglich die konkreten Folgen werden durch die Gewährung einiger kostenloser<br />
Semester abgemildert. Das ändert jedoch nichts am Grundansatz, der damit ein Einfallstor für<br />
jedwede Form der Behandlung von Bildung als Ware und Wirtschaftsgut ist. Zweitens ist diese<br />
Forderung auch strategisch fatal, denn sie verhindert, dass die SPD als die „Partei gegen<br />
Studiengebühren“ wahrgenommen wird. Im hessischen Landtagswahlkampf, in dem die SPD<br />
gegen jedwede Form von Studiengebühren gekämpft hat, hat diese Positionierung zu einem<br />
sehr guten Bild bei Studierenden oder potentiell Studierenden geführt und damit maßgeblich<br />
zum Erfolg der SPD beigetragen. Da eine solch konsequente Ablehnung von Studiengebühren<br />
jedoch nicht in der gesamten Partei verbreitet ist, wird die SPD nicht als „Anti-<br />
Studiengebühren-Partei“ wahrgenommen.<br />
Wir fordern deshalb, dass die SPD in Zukunft geschlossen gegen jedwede Form von<br />
Studiengebühren eintritt. Bildung darf nicht zur Ware werden. Bildung ist ein öffentliches Gut,<br />
das öffentlich über ein gerechteres Steuersystem finanziert werden muss.<br />
Bologna richtig umsetzen – das Bachelor- /Master-System reformieren!<br />
Die Umstellung der Studienstruktur im Zuge des Bologna-Prozesses auf die Abschlüsse<br />
Bachelor und Master kann – richtig umgesetzt – viele Vorteile für Studierende mit sich bringen.<br />
Bildungsbiographien können beispielsweise flexibilisiert werden, indem beispielsweise<br />
zwischen dem BA und dem MA eine Zeit lang etwas anderes gemacht wird, die Möglichkeiten,<br />
ein Studium im Ausland aufzunehmen könnten erhöht werden usw.<br />
Die Realität sieht jedoch anders aus. Nicht nur, dass der Zugang zum Master begrenzt ist, auch<br />
die Qualität vieler Studiengänge ist mangelhaft. Anstatt neue Studiengänge zu konzipieren<br />
35
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
wurden nämlich vielerorts die Inhalte der bisherigen Studiengänge in die neue Studienstruktur<br />
gestopft. Eine messbar deutlich nach oben geschnellte Arbeitsbelastung verbunden2 mit<br />
einem enormen psychischen Stress, der bei vielen Studierenden ernsthafte Spuren zurücklässt<br />
und die AbbrecherInnenquoten steigen lässt, sind die Folge. Ein solches Studium erfüllt seinen<br />
Zweck nicht mehr. Statt in ihrem Studium aufzugehen, empfinden viele das Studium nur noch<br />
als ein für die berufliche Laufbahn notwendiges Übel. Selbstverwirklichung, politisches oder<br />
soziales Engagement neben dem Studium bleiben auf der Strecke. Ursache dieses Problems ist<br />
zum einen eine chronische Unterfinanzierung der Hochschulen und zum anderen die<br />
Unfähigkeit vieler Hochschulgremien, vernünftige Studiengänge zu konzipieren. Dies betrifft<br />
Länder, in denen Union oder SPD frü die Hochschulpolitik verantwortlich sind gleichermaßen.<br />
Deshalb wollen wir eine Reform des Bologna-Prozesses. Die Politik muss hinsichtlich der<br />
Umsetzung der Studiengänge klare Vorgaben bezüglich der Arbeitsbelastung und<br />
Strukturierung der Studiengänge machen. Ebenso sind der zunehmenden Verschulung und<br />
Formalisierung (Anwesenheitslisten etc.) des Studiums entgegen zu wirken. Gleichzeitig<br />
müssen den Hochschulen die hierfür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt<br />
werden.<br />
Beim Übergang vom Bachelor zum Master wurde eine neue Gläserne Decke eingezogen.<br />
Frauen nehmen deutlich seltener als Männer nach ihrem Bachelor-Abschluss einen<br />
Masterstudiengang auf. Hier müssen Politik und Hochschulen geeignete Maßnahmen treffen,<br />
um Frauen und Männern einen gleichen Zugang zu Bildung zu ermöglichen; ein<br />
Rechtsanspruch auf einen Master-Studienplatz wäre dafür ein erster Schritt.<br />
Bildung geht nicht zu Ende – Für ein Recht auf Weiterbildung<br />
Wir leben in einer Zeit, in der der ökonomische Druck der Wirtschaft auf die Beschäftigten<br />
zunimmt. Massenarbeitslosigkeit erhöht die Bereitschaft vieler, auch unzumutbare<br />
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Gleichzeitig verfolgen Unternehmen eher kurzfristige<br />
Interessen. Im Bereich der Bildungspolitik hat dies die negative Konsequenz, dass Menschen<br />
ihrer persönlichen Weiterbildung im Vergleich zur Erwerbs- und Reproduktionsarbeit eine eher<br />
geringe Priorität einräumen. Wir <strong>Jusos</strong> sehen deshalb die Tarifparteien und – im Hinblick auf<br />
eine Mindestsicherung – auch den Staat in der Verantwortung, einen Weiterbildungsanspruch<br />
für alle Beschäftigten herzustellen. Die Union ist beim Thema Weiterbildung vollständig ihren<br />
Wirtschaftsflügel verfallen und setzt auf private Finanzierung. Die SPD hat die Bedeutung von<br />
2<br />
Nähere Ergebnisse hierzu zeigt die Studierbarkeitsumfrage der Studierendenvertretung der Humboldt-<br />
Universität in Berlin, die die Arbeitsbelastung in den neuen Studiengängen erfasst hat. Infos unter<br />
www.studierbarkeit.de.<br />
36
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Weiterbildung durchaus erkannt. Bei ihren Forderungen und ihrer Durchsetzung ist sie aber<br />
nicht konsequent und offensiv genug.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> fordern deshalb weiterhin die staatliche Garantie eines Mindestumfangs von einem<br />
Tag Weiterbildungsanspruch pro Monat Betriebszugehörigkeit, der durch Tarifverträge<br />
erweitert werden kann. Da Weiterbildung aktuell zudem zumeist privat finanziert wird, was<br />
die Inanspruchnahme von Weiterbildung für ArbeitnehmerInnen unattraktiv bis unmöglich<br />
macht, fordern wir die Einführung einer Arbeitsversicherung.<br />
Auch die Möglichkeit des zweiten Bildungswegs darf bei Weiterbildung nicht außer Acht<br />
gelassen werden.<br />
Es ist dringend notwendig auch hier eine finanzielle Unterstützung zu gewährleisten, sowie<br />
den Anspruch auf Bildungsurlaub in diesem Rahmen zu erweitern und Aktionen zu starten, die<br />
den Zweiten Bildungsweg als Chance für mehr Bildung in das öffentliche Bewusstsein rücken.<br />
Aus diesem Grund fordern wir eine einheitliche elternunabhängige BAföG-Förderung über den<br />
gesamten Bildungsabschnitt Zweiter Bildungsweg inklusive folgendem Studium ein, auch<br />
wenn das konsekutive Masterstudium erst nach dem 30. Lebensjahr aufgenommen wird.<br />
Des Weiteren wollen wir das bundeseinheitlich der derzeit bestehende Anspruch auf<br />
Bildungsurlaub explizit auf die (Abitur-)Prüfungen des Zweiten Bildungswegs ausgeweitet wird<br />
und in diesem Zusammenhang der Anspruch auf Bildungsurlaub nicht erst ab einer<br />
bestimmten Anzahl von Beschäftigten, sondern jeder und jedem zu steht, egal wie viele in dem<br />
Betrieb arbeiten.<br />
Außerdem müssen Lösungen entwickelt werden, die nicht nur auf den ersten Bildungsweg<br />
abzielen, sondern Wege aufzeichnen, wie die Besonderheiten in den Ansprüchen des Zweiten<br />
Bildungsweges in bestehende und neu entwickelte Bildungskonzepte integriert werden<br />
können.<br />
Über die expliziten Chancen und den Reformbedarf des Zweiten Bildungswegs muss eine<br />
öffentliche Debatte geführt werden.<br />
Berufliche Bildung<br />
Im Bereich der beruflichen Bildung ist die Bundesregierung ideen- und weitgehend initiativlos.<br />
Und das, obwohl dies der Bildungsbereich ist, wo der Bund mit dem BBIG nach der<br />
Föderalismusreform noch über die größten Kompetenzen verfügt. Der Bund versucht nicht<br />
einmal ernsthaft die quantitativen und qualitativen Probleme der beruflichen Bildung in<br />
Deutschland anzugehen. Auf die Ausbildungsplatzmisere gibt es neben dem gescheiterten<br />
Ausbildungspakt nur immer wieder neue Sonderprogramme wie z.B. den Ausbildungsbonus,<br />
die zwar in Einzelfällen wirken mögen, die aber keine systematische Lösung der Probleme<br />
37
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
bieten. Vor allem aber führen sie dazu, die Unübersichtlichkeit im Übergangssystem zwischen<br />
Schul- und beruflichen Ausbildungssystem weiter zu erhöhen. Wir fordern von der SPD-<br />
Bundestagsfraktion und den sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern endlich etwas<br />
gegen den systembedingten Mangel an Ausbildungsplätzen zu unternehmen und eine<br />
Ausbildungsplatzumlage einzuführen.<br />
Auch auf die Qualitätsprobleme im Ausbildungssystem gibt es keine wirksamen Initiativen der<br />
Regierung. Stattdessen handelt die Bundesbildungsministerin fahrlässig, wenn es um die<br />
Zukunft des Berufsbildungssystems geht. Der Prozess zum EQR und seine nationale Umsetzung<br />
würde ein Handeln erfordern, das die Stärke der deutschen Berufsausbildung – die<br />
Beruflichkeit – garantiert. Eine unverantwortliche kleinteilige Modularisierung konnte zum<br />
Glück verhindert werden, doch wirkliche Initiativen auch auf europäischer Ebene, um die<br />
Zukunftsfähigkeit der deutschen Berufsausbildung im integrierten europäischen Arbeitsmarkt<br />
zu gewährleisten, fehlen bisher.<br />
Wir fordern von der SPD ein klares Bekenntnis zu einer qualitativ hochwertigen<br />
Berufsausbildung für alle SchulabsolventInnen. Wir lehnen deshalb zweijährige<br />
Schmalspurausbildungen ab und fordern, dass sie zukünftig vom Bundesarbeitsminister nicht<br />
mehr genehmigt werden.<br />
Für mehr Entschlossenheit in der Bildungspolitik<br />
Diese Beispiele verdeutlichen ein Grundproblem der SPD in der Bildungspolitik. Sie hätte die<br />
Möglichkeit, sich gegenüber der Union, die bildungspolitisch offensiv ihr klar elitäres<br />
Gesellschaftsverständnis durchsetzen möchte, abzugrenzen. Gerade bei denjenigen<br />
WählerInnen, die grundsätzlich für die SPD zu gewinnen wären, würde eine solche Abgrenzung<br />
sehr positiv aufgenommen werden. Diese Chance wird aber durch einen inkonsequenten<br />
bildungspolitischen Kurs verspielt. Die SPD müsste konsequent für vollständige Durchlässigkeit<br />
im Bildungssystem, eine qualitative Verbesserung des Bildungssystems und den Abbau sozialer<br />
Hürden eintreten, also sozialdemokratische Bildungspolitik betreiben. Stattdessen tut sie dies<br />
nur ansatzweise und macht darüber hinaus keinerlei Anstalten, sozialdemokratische<br />
Bildungspolitik umzusetzen. Dies führt dazu, dass das Bildungssystem ungerecht bleibt bzw.<br />
seine Ungerechtigkeit noch erhöht wird und die SPD zusätzlich eine wichtige<br />
Profilierungschance ungenutzt lässt.<br />
Die reale Ausgestaltung der SPD-Bildungspolitik erweckt zudem den Eindruck, dass sie sich<br />
faktisch von einem wirklich emanzipatorischen Bildungsverständnis mehr und mehr<br />
verabschiedet. Zwar kommuniziert sie ein solches Verständnis natürlich weiterhin verbal nach<br />
außen und betont etwa, dass Bildung keine Ware werden darf. Betrachtet man aber die<br />
faktische Politik, sieht man, dass teilweise Langzeitstudiengebühren befürwortet werden, die<br />
38
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wichtigkeit eines bedarfsdeckenden BAföGs nicht anerkannt und die Hochschulbildung auf<br />
eine Berufsausbildung reduziert wird. Dies wird mittelfristig dazu führen, dass sich Bildung<br />
mehr und mehr an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert. Dies jedoch wäre eine fatale<br />
Entwicklung, die tendenziell zu einer Entmündigung der BürgerInnen führt. Nur die<br />
Sozialdemokratie kann diese Entwicklung, die von Konservativen und Liberalen eher forciert<br />
wird, aufhalten. Deshalb muss die SPD endlich einsehen, dass halbherzige „Abwehrkämpfe“ zu<br />
nichts führen. Stattdessen sollte sie sich endlich voll auf sozialdemokratische Bildungspolitik<br />
besinnen und mit ganzem Einsatz für ein qualitativ hochwertiges und sozial gerechtes<br />
Bildungssystem kämpfen. Es ist zudem ein Gebot der Demokratie, dass die SPD alle Versuche,<br />
eine irgendwie festgelegte Elite zu fördern entgegen wirkt und stattdessen konsequent in allen<br />
Bildungsbereichen sicherstellt, dass allen Menschen der Zugang zu einer qualitativ<br />
hochwertigen Bildung ermöglicht wird.<br />
B 2 - BZ Nord-NDS<br />
BILDUNG = BUNDESSACHE<br />
Es ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Bildung unabhängig von der Herkunft für<br />
alle gleichermaßen zugänglich ist. Der deutsche Bildungsföderalismus, der den Ländern nach<br />
der Föderalismusreform noch einmal erweiterte Kompetenzen in Fragen der Bildung einräumt,<br />
steht diesem Gleichheitsprinzip entgegen. Deshalb muss die Bildungskompetenz von den<br />
Ländern zum Bund übertragen werden. Ein bundesweites Zentralabitur, das auf einheitlichen<br />
Prüfungen beruht, lehnen wir dabei ab. Stattdessen muss die Eigenverantwortung der Schulen<br />
gestärkt werden, damit bundeseinheitliche Normen eine an den örtlichen Gegebenheiten<br />
orientierte Umsetzung erfahren.<br />
Antragsbegründung<br />
Die Aufteilung von Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen muss immer nach<br />
dem Grundsatz der Subsidiarität erfolgen, Kompetenzen den staatlichen Ebenen zugestanden<br />
werden, deren Handeln die wirkungsvollste Umsetzung leisten kann. Im Falle der Bildung<br />
besteht, ausgehend vom Subsidiaritätsprinzip, ein massiver Reformbedarf. Mit der 2006<br />
beschlossenen Föderalismusreform haben die Länder die nahezu vollkommene Kompetenz in<br />
Bildungsfragen erhalten. Der Bund verfügt lediglich noch über Rechte im Bereich der<br />
Hochschulzulassung, der Hochschulabschlüsse und dem betrieblichen Teil der beruflichen<br />
Bildung. Anstatt sich sinnvolle bundeseinheitliche Bildungsstandards zum Ziel zu setzen,<br />
wurde der einzigartige deutsche Bildungsföderalismus noch einmal gestärkt. Der UN-<br />
39
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Sonderberichterstatter für Bildung, Vernor Muñoz, kritisierte bei seiner Bestandsaufnahme<br />
2006 neben dem dreigliedrigen Schulsystem vor allem die weitreichenden<br />
Länderkompetenzen. Der deutsche Bildungsföderalismus stehe vor allem der Vergleichbarkeit<br />
und der Mobilität entgegen. Tatsächlich hat die Bildungskompetenz der Länder dazu geführt,<br />
dass sich in Deutschland 16 eigenständige Bildungssysteme mit jeweils eigenen<br />
Schulstrukturen, Lehrplänen, Lehrerausbildungen und Besoldungen entwickelt haben. Der<br />
deutsche Bildungsföderalismus, welcher für die meisten ausländischen Beobachter nur schwer<br />
nachzuvollziehen ist, bringt spürbare Nachteile mit sich. Angefangen bei einem Umzug von<br />
einem Bundesland in ein anderes. Bei Eltern mit schulpflichtigen Kindern kann sich als Problem<br />
ergeben, dass die Kinder mit einer anderen Schulform konfrontiert werden (Beispiel: Wechsel<br />
vom Gymnasium in die Orientierungsstufe) oder dass sie sich aufgrund unterschiedlicher<br />
Lehrpläne auf einem anderen Wissensstand befinden als ihre Mitschüler. Auch im<br />
Hochschulbereich ergeben sich Probleme in der Flexibilität. Hier erschwert der Föderalismus<br />
beispielsweise gemeinsame Studiengänge von Hochschulen aus unterschiedlichen Ländern.<br />
Gerade von der Wirtschaft wird im Globalisierungsprozess mehr Mobilität und Flexibilität<br />
gefordert. Eine Abschaffung des Bildungsföderalismus würde daher nicht nur Einschränkungen<br />
für Schüler und Studenten beseitigen, sondern wäre zugleich ein wirtschaftlich kluger Schritt.<br />
Ein weiteres Problem des Bildungsföderalismus ist die mangelnde Vergleichbarkeit der<br />
Abschlüsse, sowohl im schulischen als auch im Hochschulbereich. Mit der Initiierung des<br />
Bologna-Prozesses haben sich die EU-Regierungschefs darauf verständigt, vergleichbare<br />
Bildungsstandards innerhalb der Union zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden u.a. die<br />
Bachelor- und Master-Studiengänge beschlossen. Stellt man das deutsche Bildungssystem dem<br />
Bologna-Prozess gegenüber, so ergibt sich der offensichtliche Widerspruch zwischen dem<br />
Bemühen um Einheit einerseits und dem Beharren auf Unabhängigkeit andererseits. Ein Beleg<br />
für die ungleiche Wertigkeit gleicher Abschlüsse innerhalb Deutschlands ist, dass einige<br />
Unternehmen bei gleichen Abschlüssen offenkundig Bewerber aus bestimmten Bundesländern<br />
anderen vorziehen.<br />
Die Erkenntnis, dass Deutschland langfristig nur durch einheitliche Bildungsstandards im<br />
internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig sein kann, hat sich offenbar auch auf<br />
Länderebene durchgesetzt, jedoch nicht zu den entsprechenden Konsequenzen geführt. Statt<br />
der Abgabe von Bildungskompetenzen an den Bund haben die Länder die<br />
Kultusministerkonferenz (KMK) ins Leben gerufen, welche aufgrund des Prinzips der<br />
Einstimmigkeit jedoch zumeist nur wenig konkrete Rahmenrichtlinien auf Grundlage des<br />
kleinsten gemeinsamen Nenners beschließt. Dass es auch bei der Föderalismusreform 2006<br />
nicht zu einer weitgehenden Übertragung der Bildungskompetenz auf den Bund gekommen<br />
ist, lässt sich nicht zuletzt mit dem Stellenwert der Bildung als letzte bedeutsame<br />
Länderdomäne begründen.<br />
40
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Berufung auf kulturelle Traditionen darf nicht dazu führen, dass notwendige Anpassungen<br />
an eine veränderte Realität blockiert werden. Der Verweis auf die Sicherung der kulturellen<br />
Vielfalt ist generell fragwürdig, da die Bundesländer bis auf wenige Ausnahmen keine<br />
historisch gewachsene Einheit darstellen und somit zu hinterfragen ist, ob es überhaupt so<br />
etwas wie eine niedersächsische, nordrhein-westfälische oder sachsen-anhaltinische Kultur<br />
gibt. In diesem Zusammenhang ist weiterhin fraglich, ob die Schaffung eines dreigliedrigen<br />
oder eingliedrigen Schulsystems oder die unterschiedliche Besoldung von Lehrkräften als<br />
Ausdruck kultureller Individualität betrachtet werden können.<br />
Ein weiteres Argument gegen das föderale Bildungssystem, das von Befürwortern auch als Pro-<br />
Argument angeführt wird, ist der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Bildungssystemen.<br />
Die finanziellen Voraussetzungen der Länder sind so unterschiedlich, dass der Wettbewerb für<br />
die finanzschwachen zermürbend ist. Auch der Wettbewerb zwischen den Schulbuchverlagen<br />
ist zu hinterfragen, wenn sich die Schüler am Ende mit mehr als einem Dutzend verschiedener<br />
Bücher den in großen Teilen gleichen Lernstoff aneignen.<br />
Zuletzt sei noch dem Argument, ein einheitliches Bildungssystem führe zu einer<br />
Einheitsmeinung, das Beispiel Frankreichs entgegengesetzt, wo einheitliche Lehrpläne der<br />
Entwicklung einer kulturellen und politischen Vielfalt nicht entgegengestanden haben..<br />
Betrachtet man die Schullandschaft in Deutschland, so kann man gar feststellen, dass die<br />
meisten Landesregierungen in den letzten Jahren keine Anstrengung unterlassen haben, die<br />
Schulen durch strenge Richtlinien in ihrer Eigenverantwortung zu beschneiden. Die Lösung für<br />
eine Stärkung der schulischen Selbstverwaltung liegt also nicht in der Beibehaltung der<br />
Bildungskompetenz der Länder, sondern in einer Stärkung der kommunalen Schulträger und<br />
der Schulen selbst.<br />
Ziel einer notwendigen Reform des Bildungswesens muss es sein, bundeseinheitliche<br />
Bildungsziele zu formulieren ohne den Schulen ihren individuellen Gestaltungsspielraum auf<br />
dem weg dorthin zu nehmen.<br />
41
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
B 12 - BZ Hannover<br />
Stoppt „McKita“ – Keine Förderung von<br />
kommerziellen Kita-Anbietern mit<br />
öffentlichen Mitteln<br />
Wir <strong>Jusos</strong> bekennen uns zu der in vielen Kommunen vorhandenen Trägerlandschaft von Kitas<br />
durch den Staat und an dem Gemeinwohl orientierten Kita-Betreibern wie AWO, Kirchen,<br />
Elterninitiativen und Vereinen. Hierzu gehören auch von Betrieben eingerichtete Kitas. Die<br />
Zulassung und Finanzierung von ausschließlich kommerziel Kita-Betreibern lehnen wir<br />
hingegen ab. Die Gliederungen der SPD und die Fraktionen im Landtag und Bundestag sowie<br />
unsere RegierungsvertreterInnen in der Bundesregierung werden aufgefordert, sich dafür<br />
einzusetzen, dass die von der Bundesfamilienministerin vorgeschlagene Bezuschussung privatgewerblicher<br />
Kita-Anbieter mit öffentlichen Mitteln verhindert wird.<br />
Begründung<br />
Die Bundesfamilienministerin plant, dass zukünftig die Länder entscheiden dürfen, ob sie auch<br />
gewerbliche Betreiber für staatlich geförderte Kindertagesstätten zulassen. Diese Pläne<br />
werden von uns <strong>Jusos</strong> abgelehnt. Bisher ist die Trägerschaft einer Kindertagesstätte in<br />
Niedersachsen an die Anerkennung als „Freier Träger der Jugendhilfe“ gebunden. Nach<br />
Aussage der Ministerin sei eine ausreichende Kita-Versorgung vor allem im Krippenbereich nur<br />
mit kommerziellen Trägern zu erreichen. Dieser Ansicht muss widersprochen werden. Mit<br />
ausreichender finanzieller Unterstützung durch Bund und Land sind kommunale und bewährte<br />
freie Träger durchaus in der Lage, ein ausreichendes und hochwertiges Kita-Angebot<br />
vorzuhalten. Viele Städte wie z. B. Hannover oder Göttingen sind ein gutes Beispiel dafür, dass<br />
eine finanzschwache Kommune eine hervorragende Kinderbetreuung aufbauen kann.<br />
Auch die von allen Seiten gewünschte Förderung von Betriebskindertagesstätten war unter<br />
den bisherigen Bedingungen gut möglich. Freie anerkannte Träger der Jugendhilfe, die damit<br />
professionelle pädagogische Standards erfüllen, haben bisher in Zusammenarbeit mit<br />
Privatunternehmen hervorragende Kinderbetreuungsangebote geschaffen.<br />
Die Konkurrenz von kommerziellen Anbietern um die öffentliche Finanzierung gefährdet<br />
langfristig die Existenz der bewährten freien Kita-Träger, weil es zu einem<br />
Verdrängungswettbewerb kommen kann. Die Kontrolle der pädagogischen Qualität, wie sie<br />
über Leistungs- und Budgetverträge durch die Kommunen mit den freien Trägern erfolgt, wäre<br />
42
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
bei kommerziellen, auf Profit ausgerichteten Anbietern schwierig. Außerdem wären<br />
Niedriglöhne für die Betreuungskräfte zu befürchten.<br />
Die Betreuung und Bildung von Kindern ist eine öffentliche Aufgabe. Sie darf nicht<br />
kommerzialisiert werden!<br />
43
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
C<br />
Chancengleichheit & Sozialpolitik<br />
C 1 neu – Bundesvorstand<br />
Für eine linke Sozialpolitik – Zum „Fordern<br />
und Fördern“ beim Arbeitslosengeld II<br />
Ein Kernstück der neoliberalen Ideologie, die in den letzten zehn Jahren hegemonial war, ist der<br />
Gedanke, dass man die Krise am Arbeitsmarkt zumindest abdämpfen kann, wenn man auf die<br />
Erwerbslosen nur genug Druck ausübe. „Fordern und Fördern“ heißt die Devise, dank derer der<br />
„versorgende Sozialstaat“ abgeschafft und „moderne Arbeitsagenturen“ geschaffen werden<br />
sollten. Das Grundprinzip, nachdem die Massenarbeitslosigkeit personifiziert und zu einem<br />
individuellen Versagen umdefiniert wird, setzt darauf, das Individuum zu aktivieren, damit es<br />
sich fit für den Markt macht.<br />
Für die Sozialdemokratie ist es – trotz oder gerade wegen des eigenen Beitrages zu den<br />
Reformen - angezeigt, eine vorläufige Bestandsaufnahme dieses Systemumbaus vorzunehmen.<br />
Das Ergebnis ist verheerend.<br />
Anders als gedacht und gewollt führt das Prinzip des „Fordern und Fördern“ nicht zu hoch<br />
qualifizierten, hoch flexibilisierten und hoch motivierten Personen, sondern zu gebrochenen<br />
Menschen. Nicht selten leiden die Betroffenen darunter, ihre Arbeitslosigkeit nicht als<br />
gesellschaftliches Problem sonders als individuelles Versagen wahrzunehmen.<br />
Kernstück der Arbeitsmarktreformen, die unter Agenda 2010 in die Geschichte eingegangen<br />
sind und noch heute Partei und Gesellschaft beschäftigen, war die Idee des „Fordern und<br />
Fördern“. Eine Bestandsaufnahme muss folglich auch genau dort anfangen.<br />
Zur Idee des Förderns<br />
Auf der Seite des Förderns stehen in erster Linie materielle Leistungen wie die Grundsicherung<br />
oder Angebote zur Aus- und Weiterbildung. Letztere beschränken sich abhängig von den<br />
kommunalen Gegebenheiten häufig auf Bewerbungstrainings. Eine direkte soziale Förderung<br />
in Hinsicht auf prekäre Lebensbedingungen geschieht nicht, außer man zählt die Aufforderung,<br />
44
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
sich bei externen Beratungsangeboten zu melden, hinzu. Somit entsteht eine enorm<br />
problematische Situation, wenn die Fachkräfte beim Jobcenter aufgrund spezifischer<br />
psychosozialer Problematiken des/der BedarfsempfängerIn an die Grenzen des<br />
Maßnahmenangebots stoßen sowie selbst für eine soziale Beratung in dieser Form nur<br />
marginal ausgebildet wurden. Eine bedarfsgerechte Beratung im Zusammenhang mit<br />
tatsächlichen und angebrachten Fördermechanismen wird durch Sanktionsmechanismen<br />
abgelöst, denen auch die ausführenden Fachkräfte selbst machtlos gegenüber stehen, ja sogar<br />
sich selbst in einem solche Falle als „Opfer des Systems“ betrachten. Im Zusammenspiel mit<br />
den oft mangelhaften Lebensbewältigungsmechanismen der KlientInnen wirken Druck und<br />
Zwang eher exklusionsbeschleunigend als integrierend.<br />
Das über die eigenen Fähigkeiten definierte Selbstwertgefühl der BedarfsempfängerInnen, das<br />
oft in Jahrzehnten der Erwerbsarbeit angesammelt wurde, wird systematisch zerstört.<br />
Schließlich und endlich ist nicht der Verlust des Arbeitsplatzes das Problem, sondern der<br />
Mensch. Die erworbene berufliche Qualifikation ist unbrauchbar (Umschulung), die soziale<br />
Kompetenz mangelhaft (psychologische Beratung) und die Selbstdarstellung katastrophal<br />
(Bewerbungstrainings).<br />
Am Ende können die Betroffenen nicht mehr zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung<br />
unterscheiden. Negative Erfahrungen prägen das Selbstbild, was oft zu destruktiven Blockaden<br />
führt. Jede weitere staatliche Aktivierungsmaßnahme wird nur als nächste individuelle<br />
Defizitanalyse verstanden.<br />
Hinzu kommen die vielfältigen Sanktionen und Druckmittel der Arbeitsagenturen und der<br />
damit verbundene finanzielle Absturz, der zu einer weiteren (nicht nur gefühlten) Exklusion<br />
führt.<br />
Durch viele Teile der Agenda-Politik wurden gesellschaftliche Probleme individualisiert und<br />
zum persönlichen Defizit umdefiniert. So richtig das Ziel ist, Menschen nicht allein zu lassen,<br />
durch Qualifizierungsangebote und sonstige Unterstützung auch neue Perspektiven jenseits<br />
des alten Erwerbsverhältnisses zu schaffen, so falsch und gefährlich ist es, den Staat nur noch<br />
als Fitnessstudio für den Arbeitsmarkt zu begreifen und Arbeitslosigkeit zum individuellen<br />
Problem zu verklären.<br />
Besondere Probleme im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit<br />
In den letzten Jahren hat sich im Verlauf der Umsetzung des SBG II gezeigt, dass entgegen allen<br />
Annahmen ein Großteil der BedarfsempfängerInnen im ALG II – Bezug verbleibt und in<br />
Arbeitsmarkt-integrativen Maßnahmen seine Runden zieht. Dies widerspricht eindeutig den<br />
erwarteten Anforderungen an die Reform: Es ist leider Fakt, dass die derzeit angewandte<br />
45
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
„Aktivierungspolitik“ und darin enthaltene Instrumente wie „1-Euro-Jobs“ für die meisten<br />
BedarfsempfängerInnen nicht zu einer regulären Arbeit führen, sondern gerade die Gruppe der<br />
Langzeitarbeitslosen sich immer mehr auf den Dauerbezug von Transferleistungen einrichten<br />
muss.<br />
Die sogenannten „Vermittlungshemmnisse“ der BedarfsempfängerInnen sind so heterogen<br />
und multifaktoriell begründet, dass es schwer ist, sie in allgemeinen Kategorien<br />
zusammenzufassen. Dennoch geschieht dies in der ARGE bzw. den im SGB II genannten<br />
Vermittlungsorganisationsformen. Grundlage hierfür ist die bereits erwähnte<br />
Aktivierungsthese, die Arbeitslosigkeit und auch die Schuld daran individualisiert; andere<br />
Faktoren, wie die immer schneller voranschreitende Entwertung von Bildungsabschlüssen oder<br />
Rationalisierungsbestrebungen der Unternehmen werden ausgegrenzt.<br />
Die Agentur für Arbeit weist ihre MitarbeiterInnen an, die im Bezug stehenden BürgerInnen in<br />
Kategorien einzuteilen, die sich auf die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt beziehen.<br />
Gemäß diesen Betreuungsstufen werden die Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog<br />
herausgegriffen, der für die Region zur Verfügung steht. Dabei ist zu beachten, dass<br />
kofinanzierte Maßnahmen bzw. Maßnahmen der Agentur immer belegt sein müssen, d.h.<br />
offene Stellen gefüllt werden müssen, egal ob die/der betroffene HilfeempfängerIn für die<br />
spezifische Maßnahme geeignet oder gewillt ist.<br />
Zur Idee des Forderns<br />
Die Instrumente des Förderns korrespondieren mit der Idee des Forderns. Es wurde und wird<br />
suggeriert, dass ein Großteil der arbeitslosen Menschen nicht arbeiten wolle und deshalb über<br />
Sanktionen dazu gezwungen werden müsse. Der stärkere Druck gegenüber arbeitslosen<br />
Menschen ist Ausdruck von Nützlichkeitserwägungen. Wer nicht bereit ist, sich nach seinen<br />
Fähigkeiten und Möglichkeiten in die Gesellschaft einzubringen – wobei „Einbringen“ stets mit<br />
Erwerbsarbeit gleichgesetzt wird – soll auch kein bzw. wenigstens weniger Geld bekommen.<br />
Die rot-grüne Arbeitsmarktpolitik war in der Folge nicht nur Ausdruck einer Debatte, die ihre<br />
widerlichste Erscheinung in der „Sozialschmarotzer-Diskussion“ gefunden hat, sondern hat der<br />
Ausbreitung von Nützlichkeitsgedanken Vorschub geleistet.<br />
Was hier letztlich geschieht, ist die Aufkündigung humanistischer Grundprinzipien, die ihren<br />
Ausdruck u.a. in der Menschenwürdegarantie in Art. 1 Abs. 1 GG gefunden hat. Jeder Mensch<br />
hat in diesem Land eine Existenzberechtigung, unabhängig von seiner nach welchen Kriterien<br />
auch immer definierten Nützlichkeit. Dieses Recht, was z.B. auch in einen<br />
verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein „sozio-kulturelles Existenzminimum“ mündet, ist in<br />
46
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
keinerlei Weise an die Erwerbsfähigkeit oder -bereitschaft gekoppelt, sondern einzig an die<br />
Kategorie „Mensch“.<br />
Marktprinzipien wie Nützlichkeit und Verwertbarkeit auf Menschen anzuwenden, hat<br />
gravierende gesellschaftliche Konsequenzen. So wächst die Abwertung gegenüber<br />
Langzeitarbeitslosen dramatisch wie Umfragen zeigen. Knapp die Hälfte der in der Studie, die<br />
von Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld) unter dem Titel „Deutsche Zustände“<br />
2007 herausgegeben wurde. Befragten sind der Auffassung, dass Arbeitslose in Wirklichkeit gar<br />
nicht an einem Job interessiert seien. Ein Drittel der Befragten sagt, dass sich unsere<br />
Gesellschaft Menschen, die nicht mehr nützlich sind, nicht mehr leisten könne. Dies bedeutet,<br />
dass Marktkriterien von Nützlichkeit und Effizienz zunehmend auf das Zusammenleben von<br />
Menschen übertragen werden. Drei Viertel der Befragten gaben an, sich darum zu bemühen, in<br />
zwischenmenschlichen Kontakten abzuwägen, was ihnen der Kontakt zu der jeweiligen Person<br />
gibt. 33, 3 % vertraten, dass sich die Gesellschaft unnützliche Menschen nicht mehr leisten<br />
könne und fast 40 % sind sich darin einig, dass in unserer Gesellschaft zu viel Rücksicht auf<br />
Versager genommen werde.<br />
So alarmierend diese Zahlen sind, so zeigen sie deutlich, dass unsere Gesellschaft nicht mehr<br />
nur in wirtschaftlicher Hinsicht als Marktwirtschaft betrachtet werden muss. Der Begriff der<br />
„Marktgesellschaft“ scheint zunehmend angebracht, weil Kriterien wie Nützlichkeit,<br />
Verwertbarkeit und Effektivität mehr und mehr Eingang in soziale Zusammenhänge<br />
bekommen. Dieser Entwicklung muss die Sozialdemokratie vehement entgegen treten.<br />
Politische Konsequenzen<br />
Aus den skizzierten Entwicklungen müssen politische Konsequenzen gezogen werden, und<br />
gerade die Sozialdemokratie steht hierbei in Verantwortung. Die SPD ist es, die für soziale<br />
Gerechtigkeit, für den Aufstieg ärmerer Bevölkerungsgruppen und für eine politische<br />
Interessensvertretung alle jener, die keine große Lobby und kein großes Vermögen im<br />
Hintergrund haben, steht. Dieser Anspruch darf nicht aufgegeben werden. Ganz im Gegenteil:<br />
Die SPD muss hier für einen konsequenten, selbstkritischen und mutigen Kurs stehen, denn<br />
gerade in diesem Bereich hat die SPD in den letzten Jahren an Glaubwürdigkeit verloren.<br />
1. Förderung braucht Arbeitsplätze<br />
Die beschriebenen Entwicklungen machen deutlich: Fördern macht nur Sinn, wenn das<br />
angestrebte Ziel vorhanden ist. Selbstverständlich ist, dass Menschen nur weiterqualifiziert<br />
47
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
werden, wenn sie dieses auch möchten. Einen Zwang zur Arbeit oder zur „Förderung“ lehnen<br />
wir ab. Ist dies nicht der Fall, führt dies ausschließlich zur Frustration der betroffenen Personen<br />
und verkehrt sich damit ins Gegenteil. Sich die Förderung von Arbeitslosen auf die Fahne zu<br />
schreiben und sich gleichzeitig nicht darum zu kümmern, dass es auch Arbeitsplätze gibt,<br />
macht eben keinen Sinn. Und trotz Aufschwung muss zur Kenntnis genommen werden, dass<br />
dieser nicht überall ankommt. Im Juli 2008 waren in Deutschland immer noch 3,21 Millionen<br />
Menschen arbeitslos. Davon beträgt die Zahl der Langzeitarbeitslosen 37 %. Zentral bei<br />
jedweder Idee des Förderns muss sein, dass die betroffenen Menschen selber über ihre<br />
zukünftige Tätigkeit entscheiden können. Arbeit ist ein zentraler Faktor für die Teilhabe am<br />
gesellschaftlichen Leben und ein wichtiger Punkt wenn es um die Gestaltung des eigenen<br />
Lebens geht.<br />
Aufgrund dieser wichtigen Rolle ist der Staat in der Verantwortung am Ziel der<br />
Vollbeschäftigung festzuhalten. Ein wichtiger Punkt in der Beschäftigungspolitik bleibt für uns<br />
deshalb der öffentliche Beschäftigungssektor, neben der Tatsache, dass die Wirtschaft durch<br />
umfassende Maßnahmen in die Pflicht zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit genommen<br />
werden muss. Viele gesellschaftliche Aufgaben werden heute den einzelnen Menschen<br />
aufgebürdet, weil sie am Markt zu wenig Profit erwirtschaften. Diese Aufgaben im Zuge eines<br />
öffentlichen Beschäftigungssektors anzubieten, würde vielen Menschen eine neue Perspektive<br />
ermöglichen und die Lebensqualität der Gesamtgesellschaft erhöhen. Und die Förderung und<br />
Qualifizierung von Arbeitslosen würde in vielen Fällen nicht ins Leere laufen.<br />
2. Das Sanktionssystem abschaffen<br />
Der Sanktionskatalog in § 31 SGB II sieht mehrere Stufen der Sanktionierung vor. In einer ersten<br />
Stufe kann es eine Kürzung von 30 % des Regelsatzes geben, wenn der Betroffene z.B. eine<br />
Eingliederungsvereinbarung nicht abschließt oder seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.<br />
Erscheint der/die Betroffene nicht bei einem ihm auferlegten Termin wie z.B. ärztlichen<br />
Untersuchungen kann eine Kürzung von 10 % erfolgen. Bei der ersten wiederholten<br />
Pflichtverletzung erfolgt eine Kürzung um 60 % und danach um 100 %. Erwähnung muss dabei<br />
finden, dass auch die Fortsetzung eines unwirtschaftlichen Verhaltens trotz Belehrung die<br />
Sanktionierungen in Gang setzen kann. Nicht nur die Frage, nach welchen Kriterien das<br />
bestimmt werden soll, sondern ebenso der Widerspruch zu dem Bild eines selbstbestimmten<br />
und freien Bürgers drängt sich in dieser Formulierung auf.<br />
Die Existenzberechtigung eines jeden Menschen findet seinen Niederschlag u.a. in dem<br />
verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein Existenzminimum. Das Existenzminimum liegt<br />
derzeit mit dem ALG II – Regelsatz bei 351 Euro. Es widerspricht jedweder Logik, auf der einen<br />
Seite zu behaupten, man bräuchte 351 Euro um die elementarsten Dinge wie Essen, Trinken,<br />
48
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Körperhygiene etc. bewerkstelligen zu können, und Menschen, die nicht genügend<br />
Bewerbungsschreiben vorweisen können oder womöglich eine psychologische<br />
Beratungsstunde vermieden haben, sollen mit einem bis zu 100 % gekürzten Regelsatz über die<br />
Runden kommen. Außerdem muss politisch dem Einzug von Nützlichkeitserwägungen in<br />
zwischenmenschliche Beziehungen entgegengewirkt werden. Wer im Grundgesetz die Würde<br />
des Menschen postuliert, der muss auch dafür einstehen, dass kein Mensch in diesem Land<br />
unter dem Existenzminimum lebt, aus welchen Gründen auch immer. Sanktionen, die ein<br />
Leben unterhalb des Existenzminimums bedeuten, darf es nicht geben.<br />
3. Ende der Diskriminierungen von jungen Menschen<br />
Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unterliegen im SGB II<br />
insbesondere an zwei zentralen Punkten einer Ungleichbehandlung.<br />
Nach § 20 Abs. 2 a SGB II brauchen sie die Zustimmung des kommunalen Trägers um das<br />
Elternhaus zu verlassen. Haben sie diese nicht und ziehen trotzdem aus, wird ihr Regelsatz um<br />
80 % gekürzt. Das stellt nicht nur eine eklatante Ungleichbehandlung dar, sondern<br />
widerspricht auch der Idee eines selbstbestimmten Lebens für jeden Menschen.<br />
Liegt eine Voraussetzung nach § 31 Abs. 1 bis 4 SGB II vor, setzt sich nicht das sonstige<br />
Sanktionssystem in Gang, sondern sie bekommen umgehend nur noch Leistungen nach § 22<br />
SGB II, d.h. Leistungen für Unterkunft und Heizung. Bei Wiederholung erfolgt die Kürzung um<br />
100 %. Begründet wird diese Ungleichbehandlung damit, dass junge Menschen nach § 3 Abs. 2<br />
SGB II bevorzugt vermittelt werden und einer besseren Betreuungsrelation unterliegen.<br />
Unabhängig davon, dass die unverzügliche Vermittlung von jungen Menschen eventuell noch<br />
als Anspruch aber auf keinen Fall als Realität beschrieben werden kann, gibt es keinen<br />
sachlichen Grund für eine derart eklatante Ungleichbehandlung in so einer elementaren Frage<br />
wie der Befriedigung existentieller Bedürfnisse.<br />
Bei Menschen bis zu 25 Jahren entscheidet sich in der Regel viel hinsichtlich der Frage, was das<br />
Verhältnis zur Gesellschaft, zur Erwerbsarbeit etc. angeht. Deshalb ist es richtig, bei<br />
Jugendlichen darum zu kämpfen, dass sie Chancen auf gute Bildung, gute Ausbildung und gute<br />
Arbeit bekommen. Die verschärften Sanktionen führen jedoch zum Gegenteil, weil sie<br />
Jugendlichen vermitteln, sich anzupassen und für den Arbeitsmarkt verwertbar zu sein oder<br />
weniger Geld, d.h. weniger wert zu sein. Die speziellen Sanktionen für Jugendlich müssen<br />
endlich ersatzlos gestrichen werden. Genauso wichtig ist es aber auch, dass junge Menschen<br />
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, so darf zum Beispiel die Mitgliedschaft in<br />
einem Sportverein nicht zur unüberwindbaren Hürde werden.<br />
49
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
4. Leichter Einstieg in den ALG II – Bezug<br />
Ein Übergang in den Bezug des Arbeitslosengeldes II darf nicht mit bürokratischen Hürden wie<br />
bisher versehen sein, so dass ein Großteil der Hilfebedürftigen erst gar keinen ALG II – Antrag<br />
stellt und damit die eigene soziale Situation maßgeblich verschlechtert.<br />
Der Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen darf nicht durch kostenintensive<br />
Verwaltungsakte und Formularterror verstellt werden und muss für jede/n BürgerIn<br />
gleichberechtigt zugänglich sein. Gerade im Bereich der Existenzsicherung ist dies immanent<br />
wichtig.<br />
5. Regelsatz erhöhen<br />
Anfang 2008 waren 10,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von Leistungen des<br />
Arbeitslosengeldes II (ALG II) abhängig. Betroffene erhalten im Rahmen des Arbeitslosengeldes<br />
II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Leistungen zur Sicherung des<br />
Lebensunterhalts setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Zunächst zahlt die jeweilige<br />
Kommune den tatsächlichen Aufwand für Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus deckt die<br />
Agentur für Arbeit über die steuerfinanzierten Regelleistungen zur Sicherung des<br />
Lebensunterhalts weitere Bedarfe ab. Dies betrifft einmalige Anschaffungen wie Elektrogeräte,<br />
aber auch laufende Bedürfnisse für Ernährung, Kleidung, Energie und Teilnahme an der<br />
Gesellschaft. Die volle Regelleistung beträgt derzeit 351 € pro Monat. Dies ist der ALG II-<br />
Regelsatz für Erwachsene. Die Höhe des Regelsatzes ist bei der Einführung des ALG II anhand<br />
von Annahmen über den monatlichen Bedarf festgelegt worden. Der Regelsatz ist an die<br />
Rentenentwicklung gebunden. Jährlich steigt das ALG II zum 01. Juli prozentual mit der<br />
Rentenerhöhung.<br />
Jedoch entspricht die Rentenentwicklung in keinem Fall einem Ausgleich der Inflation. In der<br />
Rentenberechnung spielen ganz andere Faktoren wie der Demographieausgleich und die<br />
Lohnentwicklung eine Rolle. Der Rentenwert als Maßstab für die Erhöhung des ALG II führt<br />
daher in jedem Jahr zu einem realen Kaufkraftverlust bei den EmpfängerInnen. Der Regelsatz<br />
von 351 € reicht zur Bedarfdeckung weiterhin nicht aus. Bereits die laufenden Ausgaben für<br />
Ernährung Kleidung und Energie verbrauchen den monatlich zur Verfügung stehenden Betrag.<br />
Auf Elektrogeräte und andere größere Haushaltsausgaben anzusparen, ist darüber hinaus nicht<br />
möglich. Eine gesellschaftliche Teilhabe fällt vollkommen aus.<br />
Der monatliche Regelsatz muss dem sozio-kulturellen Existenzminimum entsprechen. Der ALG<br />
II- Regelsatz muss die laufenden Kosten und einmaligen Anschaffungen abdecken und darüber<br />
hinaus die Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben ermöglichen. Deshalb muss der<br />
50
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
ALG II-Regelsatz deutlich angehoben werden. Eine Neufestlegung muss sich an dem wirklichen<br />
Bedarf orientieren. Die Höhe des Regelsatzes ist eine politische Entscheidung. Der Bundestag<br />
soll den ALG II-Regelsatz so erhöhen, dass dieser den wirklichen Bedarf deckt. Der Bundestag<br />
passt den Regelsatz jährlich an.<br />
Wohnkosten wie auch Wohnnebenkosten müssen während des Bezuges durch die Agentur für<br />
Arbeit übernommen werden und zur monatlichen Auszahlung addiert werden. Die<br />
Bewilligungsgrenzen hierfür müssen weit angehoben werden. So muss sich die Grenze zur<br />
Übernahme der Mietkosten beispielsweise dynamisch an den durchschnittlichen regionalen<br />
Mietkosten orientieren und kann aufgrund der Besitzstandswahrung im Einzelfall auch<br />
darüber liegen. Zu den Nebenkosten müssen auch Energiekosten und v.a. Stromkosten und<br />
Warmwasserbereitung zählen. Die Bewilligungsgrenze für den Energieverbrauch muss sich<br />
ebenfalls dynamisch am regionalen Durchschnitt des privaten Energieverbrauchs orientieren.<br />
Durch die Agentur für Arbeit müssen Schulungen über Energiesparmaßnahmen und<br />
Maßnahmen zum Umweltschutz angeboten werden und den BedarfsempfängerInnen auch<br />
der Raum zur Durchführung solcher Sparmaßnahmen eingeräumt werden.<br />
6. Einen eigenen Regelsatz für Kinder<br />
Anfang 2008 erhielt jedes siebte Kind in Deutschland Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II.<br />
Kinder erhalten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 Prozent, bis zur Vollendung des 25.<br />
Lebensjahres 80 Prozent des Regelsatzes für Erwachsene. Dieser Betrag soll alle Ausgaben von<br />
Ernährung, Kleidung und Körperpflege bis zu Bildung und Gesundheit decken.<br />
Tatsächlich besitzen Kinder jedoch höhere Bedürfnisse als sie durch die anteilige Regelleistung<br />
abgedeckt werden. Gerade in der Phase des Heranwachsens benötigen Kinder und Jugendliche<br />
eine gesunde und ausgewogene Ernährung und häufig neue Kleidung. Zudem bildet der<br />
anteilige Regelsatz im ALG II den Bedarf für Lernmaterialien und weitere Bildungsausgaben wie<br />
Nachhilfe nicht ab. Auch zusätzliche Gesundheitsausgaben, die von der gesetzlichen<br />
Krankenversicherung nicht übernommen werden, sind nicht berücksichtigt.<br />
Wir fordern daher die Einführung eines eigenen Regelsatzes für Kinder. Dieser muss den<br />
vollständigen Bedarf von Kindern und Jugendlichen abdecken. Zusätzlich zu den Kosten für<br />
Ernährung und Kleidung müssen daher Bildungsausgaben vollständig enthalten sein. Diese<br />
umfassen insbesondere auch alle Lernmaterialien und die Teilnahme an der Schulspeisung.<br />
Darüber hinaus soll eine Einmalzahlung für die Anschaffung von Lernmitteln zum<br />
Schuljahresbeginn erfolgen.<br />
Ferner fordern wir, die flächendeckende Einführung der Lernmittelfreiheit!.<br />
51
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Außerdem fordern wir die Bezahlung eines Schulstarterpakets, frühkindliche Förderung durch<br />
verpflichtende und kostenfreie Kinderbetreuung, gesundheitliche Vorsoge- und<br />
Untersuchungsmaßnahmen im Kindergarten, Einführung der integrierten Gesamtschule im<br />
Ganztagsbetrieb, Ernährungskunde als Unterrichtsfach, kostenfreies Mittagessen, für alle<br />
Kinder und Jugendliche, verpflichtende Eltern-LehrerInnen–Gespräche und spezielle<br />
Ausbildungsförderungsprogramme für sozialbenachteiligte Jugendliche.<br />
7. Verstärkung der Hilfemaßnahmen für Langzeitarbeitslose – Mehr Zeit zur<br />
Lebensbewältigung<br />
Die BedarfsempfängerInnen des SGB II sind meist größeren Lebenskrisen bzw. krisenhaften<br />
Lebensverhältnissen unterworfen. Entsprechend benötigen diese BürgerInnen mehr Zeit für<br />
sich, reagieren auf zu hohe Anforderungen mit längerer Krankheit. Sie benötigen<br />
Unterstützung und Hilfe am Arbeitsplatz, wie auch bei persönlichen Problemen bis hin zur<br />
Bewältigung von alltäglichen Hürden wie z.B. bürokratischen Vorgängen. Hier ist ein Verbund<br />
von Fürsorge-Systemen gefragt. Angefangen von aufsuchender sozialer Arbeit (z.B.<br />
Hausbesuche) bis hin zu freiwilligen Beratungsangeboten verbunden mit der medizinischen<br />
Versorgung.<br />
Auch Begleitung in Arbeit und Unterstützungsangebote am Arbeitsplatz (v.a. nach dem Ende<br />
einer längeren Arbeitslosigkeit) müssen stärker ausgebaut und ggfs. neu im<br />
Integrationsprozess implementiert werden.<br />
Die Agentur für Arbeit hat für einen solchen Fürsorge-Verbund innerhalb jeder Kommune zu<br />
sorgen, diesen aufzubauen, aufrecht zu erhalten und durchgehend sinnvoll zu ergänzen.<br />
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen, wie<br />
Arbeitsprojekte zur beruflichen und sozialen Rehabilitation, müssen verstärkt ausgebaut und<br />
gefördert werden. Hieran hat sich maßgeblich die Wirtschaft zu beteiligen.<br />
Ein schrittweiser Abbau der Vermittlungshemmnisse zusammen mit einer engen sozialen<br />
Betreuung ermöglicht die neue Grundsteinlegung für ein zukünftiges Erwerbsleben.<br />
Unbedingte Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist die verstärkte<br />
Beteiligung der KlientInnen am eigenen Hilfeprozess. Die derzeitige Verfahrensweise läuft dem<br />
zuwider und stellt eine Entmündigung der Hilfebedürftigen dar.<br />
Die durch das SGB II implementierte und in der Öffentlichkeit weiterhin propagierte<br />
Individualisierungsthese der Arbeitslosigkeit muss öffentlich endgültig als widerlegt<br />
angesehen werden, nachdem sie sozialwissenschaftlich bereits unzählige Male entkräftet<br />
wurde. Dieser Umstand muss sich folglich auch in der Gesetzgebung widerspiegeln.<br />
52
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
8. 1-Euro-Jobs abschaffen / reguläre Jobs im öffentlichen Sektor<br />
wiederbeleben / Förderstellen schaffen!<br />
Viele Menschen sind in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (sog. 1-Euro-<br />
Jobs) beschäftigt, in denen sie trotz aller Kontrolle meist Arbeiten nachgehen, die über<br />
„zusätzliche und gemeinnützige Hilfsarbeiten“ hinausgehen. In GeBeGe’s (Gemeinnützigen<br />
Beschäftigungsgesellschaften) wird diese Entwicklung ad absurdum geführt. BürgerInnen<br />
verrichten 1-Euro-Jobs wie Gebäudereinigung oder HausmeisterInnendienste mit 30<br />
Wochenstunden, die sie genauso über öffentliche Stellen erfüllen könnten. Letztere wurden<br />
allerdings in den letzten Jahren nachweislich abgebaut. Diese Entwicklung muss umgekehrt<br />
werden.<br />
1-Euro-Jobs bilden einen weiteren Auswuchs prekärer Arbeit auf dem Arbeitsmarkt und müssen<br />
abgeschafft werden. Dagegen müssen Arbeitsstellen im öffentlichen Sektor wieder ausgebaut<br />
werden, so dass der Raubbau der letzten Jahre beendet und endlich wieder ausgeglichen wird.<br />
Denn gerade in diesem Sektor wurde nachweislich reguläre Beschäftigung verdrängt. Im<br />
Übrigen sind spezielle Förderstellen für Langzeitarbeitslose zu entwickeln, in denen durch eine<br />
pädagogische, medizinische und psychologische Betreuung und Qualifizierung ein an die<br />
jeweiligen Bedürfnisse angepasste Arbeitssituation geschaffen wird.<br />
9. Zumutbarkeit<br />
Nach den Vorgaben des Sozialgesetzbuches II (SGB II) ist EmpfängerInnen des<br />
Arbeitslosengeldes II jede Arbeit zumutbar. Auch dann, wenn sie Ausbildung und früherer<br />
Beschäftigung nicht entspricht, wenn sie deutlich weiter entfernt ist, als der letzte Arbeitsort<br />
und, wenn die Arbeitsbedingungen schlechter sind, als bei der letzten Tätigkeit. Lehnen die<br />
Betroffenen die Aufnahme oder Fortführung zumutbarer Arbeit, Ausbildung oder<br />
Arbeitsgelegenheit ab, greifen die Sanktionsmechanismen. Stufenweise wird dann die<br />
monatliche Zuwendung gekürzt.<br />
Die betroffenen Menschen müssen folglich Beschäftigungen aufnehmen, die weder den durch<br />
ihre Qualifikation berechtigten Wünschen und Erwartungen entspricht, eine Tätigkeit in der<br />
Nähe des persönlichen Lebensmittelpunktes ermöglicht, noch gute Arbeitsbedingungen<br />
gewährleistet. Tatsächlich vermittelt die Agentur für Arbeit auch in prekäre<br />
Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit, Befristung und Niedriglohn bzw. geringfügige<br />
Beschäftigung. Die Zumutbarkeitskriterien des ALG II fördern also prekäre Beschäftigung, da<br />
die Betroffenen diese annehmen müssen oder ansonsten sanktioniert werden. Gleichzeitig de-<br />
53
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
qualifiziert eine solche Politik Arbeitslose, wer länger fachfremd arbeitet, schafft später kaum<br />
noch den Sprung zurück in den Beruf, in dem er ausgebildet wurde.<br />
Wer zudem sein Lebensort zwangsweise verlassen muss, verliert darüber hinaus seine sozialen<br />
Netzwerke. Befristete persönliche Beziehungen werden zur Normalerfahrung der Betroffenen.<br />
Damit wird eine Chance auf Reintegration zusätzlich erschwert.<br />
Die Zumutbarkeitskriterien müssen verändert werden. Die Agentur für Arbeit soll in „Gute<br />
Arbeit“ vermitteln. EmpfängerInnen des ALG II dürfen nicht gezwungen werden, eine Arbeit<br />
gegen ihren Willen anzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Beschäftigung nicht<br />
ihrer Qualifikation entspricht, sehr weit entfernt ist und die Arbeitsbedingungen schlechter<br />
sind als in der vorherigen Tätigkeit. Die Ablehnung darf nicht zu finanziellen Einbußen führen.<br />
Aber auch im Bereich des SGB III muss sich etwas ändern. Entsprechend den genannten<br />
Forderungen müssen auch hier die Zumutbarkeitskriterien verändert werden: beispielsweise<br />
die Regelungen zur Verlagerung des Wohnsitzes im §121 SGB III.<br />
10. Mehr ArbeitnehmerInnenrechte für ArbeitsvermittlerInnen<br />
Ein Betreuungsverhältnis von 1:250 – Befristete Verträge – Umsetzungsnot der Vorgaben der<br />
Arbeitsagentur (z.B. Sanktionszahlen) – keine oder eine wirkungslose MitarbeiterInnen-<br />
Vertretung: All das ist Alltag für die SachbearbeiterInnen der ARGEn bzw. der im SGB II<br />
genannten Vermittlungsorganisationsformen. Oft fehlt sogar die nötige Ausbildung, um<br />
überhaupt mit der Klientel Beratungsgespräche führen zu können. ARGE-MitarbeiterInnen, die<br />
ihren Beruf mit viel Engagement betreiben und den BedarfsempfängerInnen wirklich helfen<br />
wollen – beispielsweise durch Verzögerung von Sanktionen oder aufwendige Vermittlungsund<br />
Beratungsarbeit – werden zwischen persönlichen Grenzen und dem systemischen Druck<br />
der Agentur zerrieben.<br />
Insgesamt miserable Zustände, die v.a. den Menschen schadet, denen eigentlich geholfen<br />
werden soll: den ALG II – BezieherInnen. Die Ansprüche, die bei der Umsetzung der Hartz IV –<br />
Reform formuliert wurden, können in keinster Weise umgesetzt werden. Die Agentur für Arbeit<br />
selbst ist eine Institution, die ihre MitarbeiterInnen unter miserablen Umständen arbeiten<br />
lässt.<br />
Runter mit der Fallzahl – hoch mit den Angestelltenzahlen: Dies gilt als Fundament für eine<br />
erfolgreiche Arbeitsvermittlung, da nur so eine tatsächliche Beratung und Betreuung<br />
gewährleistet werden kann.<br />
54
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mehr Zeit und Freiraum für Beratung und soziale Hilfe: Vorgaben oder Anhalte, wie lange ein<br />
Beratungsgespräch dauern darf, darf es nicht geben.<br />
Viele engagierte ArbeitsvermittlerInnen verzweifeln an der derzeitigen Fördersystematik. Sie<br />
bemerken, dass sie ihren KlientInnen nicht wirklich helfen können und versuchen mancherorts<br />
kreativ Wege zu gehen, die nicht der von der Agentur vorgegebenen Vermittlungspraxis<br />
entsprechen. Vielfach widersprechen sie auch der geforderten Sanktionspraxis und wenden<br />
dieses Mittel der „Aktivierung“ nur selten an. Diese engagierten VermittlerInnen sehen sich<br />
einem höheren systemischen Druck ausgeliefert als ihre „angepassten“ KollegInnen. Sie<br />
werden in MitarbeiterInnengesprächen aufgefordert, mehr zu sanktionieren, die<br />
Maßnahmeplätze besser zu belegen oder die eine oder andere Handlungsweise abzustellen.<br />
Dies stellt in keinster Weise eine professionelle Verfahrensweise dar. Gerade<br />
ArbeitsvermittlerInnen müssen individuell an die Bedürfnisse der BedarfsempfängerInnen eine<br />
berufliche Integration planen und begleiten können und dürfen nicht durch institutionellen<br />
Druck eingeschränkt werden. Wir widersprechen eindeutig dieser Praxis in der<br />
Arbeitsvermittlung und fordern mehr Freiraum für die MitarbeiterInnen. Damit dieser Freiraum<br />
vollständig und sinnvoll genutzt werden kann, ist jedoch eine berufliche Professionalisierung<br />
der VermittlerInnen dringend notwendig.<br />
Professionelle Ausbildung und Vorbereitung auf den Berufsalltag:<br />
Sozialpädagogische Einflüsse in der Arbeit mit und der Beratung von Langzeitarbeitslosen sind<br />
nicht zu übersehen. Diese müssen sich auch in der Ausbildung, Berufsvorbereitung und<br />
ständigen Weiterbildung (z.B. Sozial-Trainings) bemerkbar machen. Eine reine<br />
Verwaltungsausbildung, wie sie vielfach vorliegt, ist bei weitem nicht hinreichend. Zudem ist<br />
eine regelmäßige Supervision einzuführen.<br />
Keine befristeten Arbeitsverträge mehr:<br />
Die ArbeitsvermittlerInnen selbst andauernd in einer unsicheren Arbeitssituation zu belassen,<br />
ist nicht hinnehmbar. Dies hat weitreichende negative Auswirkungen auf ihre Arbeit.<br />
Befristungen in deren Arbeitsverträgen müssen der Vergangenheit angehören.<br />
11. Abschaffung der Bedarfsgemeinschaften<br />
Die derzeitige Verfahrensweise im Hinblick auf die Einteilung der HilfeempfängerInnen in<br />
Bedarfsgemeinschaften und damit der Beschneidung der einzelnen Ansprüche muss<br />
abgeschafft werden. Durch eine solche Einteilung wird eine gegenseitige Abhängigkeit<br />
innerhalb eines Haushaltes erzeugt, die dem Bild einer modernen, emanzipierten Gesellschaft<br />
55
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
zuwider läuft und eine Diskriminierung von Frauen weiter vorantreibt. Vermögen und<br />
Einkünfte innerhalb eines Haushaltes sind zu trennen.<br />
Den damit zusammenhängenden Veränderungen insbesondere für Familien muss mit<br />
geeigneten Mitteln entgegnet werden, so dass vor allem eine ausreichende Versorgung der<br />
Kinder sichergestellt ist.<br />
Zudem dürfen Kinder und Jugendliche (U25) in keinster Weise für die Arbeitslosigkeit ihrer<br />
Eltern zur Verantwortung gezogen werden, schon gar nicht monetär. Ein Fall von<br />
Arbeitslosigkeit in der Familie darf nicht zur Armutsfalle für die ganze Familie werden.<br />
12. Vermittlung<br />
Bei der Agentur für Arbeit sind feste BetreuerInnen für die LeistungsempfängerInnen<br />
zuständig, oft FallmanagerInnen oder persönliche AnsprechpartnerInnen (pAp) genannt.<br />
HilfeempfängerInnen werden im ersten Beratungsgespräch in mehrere Betreuungsstufen<br />
eingeteilt, die sich auf die Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt beziehen, beispielsweise:<br />
integrationsfähig – Förderungsbedarf – Stabilisierungsbedarf – integrationsfern. Die/ der<br />
Betreuer/in führt also mit der/ dem Betroffenen eine Art Standortbestimmung nach dem<br />
Vorbild eines Profilings durch. Anhand eines Fragenkatalogs ordnet die/ der Vermittler/in den<br />
so genannten „Kunden“ einer Personengruppe zu. Während die KlientInnen der niedrigsten<br />
Betreuungsstufe nach Einschätzung der Vermittlerin bzw. des Vermittlers meist schnell und<br />
ohne spezifische Förderung zurück auf den Arbeitsmarkt finden, sollen bei den höheren<br />
Betreuungsstufen erst integrative und aktivierende Maßnahmen ergriffen werden. Die höchste<br />
Betreuungsstufe genießt paradoxerweise meist die geringste Beachtung. Anstatt hier verstärkt<br />
eine Förderung und Sozialberatung anzusetzen, wird eine Integration in den Arbeitsmarkt<br />
bereits als aussichtslos betrachtet. Für jede Kundengruppe steht eine Auswahl von<br />
Instrumentengruppen, so genannten „Handlungsprogrammen“, und einzelner standardisierter<br />
Instrumente, den Produkten, zur Verfügung. Diese werden wie bereits anfangs erwähnt aus<br />
einem Maßnahmenkatalog meist rausgefischt, ohne dass eine Bedarfsorientierung geprüft<br />
wurde. Maßnahmen müssen gem. den Weisungen der Agentur besetzt werden mit wenig<br />
Rücksicht auf die Bedürfnisse und Wünsche der BedarfsempfängerInnen.<br />
Zunächst ist die Zuordnung der Betroffenen in Kundengruppen natürlich höchst subjektiv, ein<br />
Fragebogen spiegelt oftmals nicht die Realität wieder. Das wesentliche Problem besteht in<br />
Verbindung mit der vorschnellen Einteilung in Betreuungsstufen darin, dass diese<br />
Kategorisierung einem Individualisierungsgrundsatz absolut entgegen läuft. Zudem bestehen<br />
56
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
in der Praxis wenige bis gar keine Ausstiegsmöglichkeiten für die BedarfsempfängerInnen<br />
innerhalb der Betreuungsstufen.<br />
Wir lehnen diese Logik der Fördersystematik bei der Agentur für Arbeit ab. Statt der<br />
Kategorisierung in Betreuungsstufen und der Anwendung standardisierter Fördermaßnahmen<br />
fordern wir eine individuelle Beratung und Förderung für die Betroffenen ein. Ziel einer<br />
gerechten wie sinnvollen Vermittlungstätigkeit muss es sein, jeden Menschen so zu fördern,<br />
dass er eine Beschäftigung aufnehmen kann, die er gerne macht und die ihm eine<br />
Existenzgrundlage sichert.<br />
13. Privatvermögen / Besitzstandswahrung<br />
Privatvermögen und -eigentum dürfen nicht durch eine Lebenskrise wie Arbeitslosigkeit<br />
bedroht werden. Die aktuelle Verfahrensweise innerhalb des SGB II geht bis hin zum Verkauf<br />
von Lebensversicherungen unter Wert. So gerät die fragile soziale Stabilität der<br />
BedarfsempfängerInnen noch weiter ins Wanken, sie werden noch einmal zusätzlich<br />
diskriminiert. Die Schuldenspirale wird weiter angekurbelt.<br />
Mit dieser Verfahrenweise muss Schluss sein! Hierzu gehört auch die Abschaffung von<br />
Zwangsumzügen, die beispielsweise dadurch hervorgerufen werden, dass die schon vor der<br />
Arbeitslosigkeit bezogene Mietwohnung nicht der derzeitigen Bewilligungsnorm entspricht<br />
und aufgrund dessen von der zuständigen Behörde nicht oder nicht vollständig unterstützt<br />
wird. Dies wird zu einer gefährlichen Schuldenfalle für die Betroffenen.<br />
Auch Wohneigentum muss über den bisherigen Grenzen gesichert bleiben. Eine eventuelle<br />
Schuldentilgung des Hauskredits darf nicht zur Schuldenfalle werden, wobei die Agentur für<br />
Arbeit unterstützend tätig werden muss.<br />
Arbeitslosigkeit darf keinen sozialen Abstieg bedeuten.<br />
57
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
C4 - LV Berlin<br />
Solidarität statt Kampf der Generationen<br />
Scheinargumente für den Sozialabbau<br />
Die Debatten über den demografischen Wandel und Generationengerechtigkeit bedrohen<br />
heute viele der sozialstaatlichen Errungenschaften. Die teilweise mit Scheinargumenten<br />
geführten Debatten und die vermeintlich dahinter steckenden Katastrophen sollen bei<br />
Diskussionen um den Sozialstaat herhalten. Leider haben auch innerhalb der politischen Linken<br />
neoliberale Argumentationsstrukturen Einzug gehalten. Wir JungsozialistInnen müssen<br />
Antworten auf die wirklichen Herausforderungen des demografischen Wandels finden und die<br />
Deutungshoheit über den Begriff Generationengerechtigkeit durch eine solidarische<br />
Interpretation gewinnen. Diese muss die dringenden Fragen zukünftiger Generationen, wie<br />
einer lebenswerten Umwelt, einer funktionierenden Demokratie und vor allem einem intakten<br />
Sozialstaat, in den Fokus rücken. Gerechtigkeit ist für uns <strong>Jusos</strong> keine Verteilungsfrage<br />
zwischen jung und alt. Gerechtigkeit ist in erster Linie eine Frage der Verteilung zwischen arm<br />
und reich. Es geht also zuerst um die Einkommens- und Vermögensverteilung – unabhängig<br />
vom Alter. Daran entscheiden sich auch die Möglichkeiten sozialer Teilhabe. Wir wollen keine<br />
Umverteilung von der älteren Generation zur jüngeren Generation, sondern eine Umverteilung<br />
von reichen zu ärmeren Menschen und von Kapitaleinkünften zu Arbeitseinkommen. Wir<br />
setzen der Diskussion über Generationengerechtigkeit die Solidarität der Generationen<br />
entgegen.<br />
Herausforderung Demografie<br />
Die Bevölkerungsstruktur einer Gesellschaft ist von vielen Faktoren abhängig. Direkt wird sie<br />
u.a von der Geburtenrate, der Lebenserwartung und den Aus- und Einwanderungsbewegungen<br />
bestimmt. Diese Größen sind dabei nicht statisch sondern von politischen Entscheidungen<br />
beeinflussbar. Soziale Faktoren, Lebens- und Teilhabechancen und die Werte einer Gesellschaft<br />
haben einen großen Einfluss und können wiederum von politischen Entscheidungen<br />
maßgeblich geprägt werden.<br />
Dabei zeichnet sich die Debatte in der Öffentlichkeit durch ihre einseitige Fokussierung auf die<br />
angeblich, durch die Emanzipation der Frau bedingte, zu niedrige Geburtenrate und der<br />
gesteigerten Lebenserwartung in Deutschland aus. Gebetsmühlenartig wird dazu regelmäßig<br />
wiederholt, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr RentnerInnen finanzieren<br />
müssten.<br />
58
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Viele andere Aspekte werden ausgespart:<br />
• Auch mehr Kinder und Jugendliche würden mehr Kosten für die Gesellschaft bedeuten.<br />
• Mehr Erwerbstätige in guter Arbeit, eine höhere Frauenerwerbsquote sowie eine<br />
verstärkte Zuwanderung können den Mindereinnahmen im System entgegenwirken.<br />
• Produktivitätssteigerungen könnten auch zu Mehreinnahmen innerhalb der<br />
Sozialversicherungssysteme führen und diese entlasten<br />
Mehr Solidarität in der Generationengerechtigkeitsfrage<br />
Mit der, von neoliberaler Seite als Kampfbegriff missbrauchten, „Generationengerechtigkeit“<br />
wird versucht, die soziale Ungleichheit zwischen den Generationen zu verorten. Die<br />
Ungleichheit innerhalb der Generationen zwischen den sozialen Schichten wird hingegen als<br />
nicht-existent dargestellt bzw. die ständige Verschärfung der sozialen Schieflage verharmlost.<br />
Anstelle des zentralen Problems der generellen Ungleichheit bei der Einkommens- und<br />
Vermögensverteilung wird ein Generationenkonflikt, also ein „Krieg der Generationen“<br />
propagiert. Damit versucht man die politische Konfliktlinie zwischen Kapital und Arbeit<br />
zwischen die Generationen zu verschieben, um die Gesellschaft für einen widerstandslosen<br />
Umbau des Sozialstaates nach neoliberalem Vorbild zu gewinnen.<br />
Die aktuelle Debatte im Zuge der Föderalismusreform II um eine Schuldenbremse ist nur ein<br />
Beispiel, wie unter dem Deckmantel der Generationengerechtigkeit der Staat entmachtet und<br />
interventionistische Politik delegitimiert werden soll. Umverteilung innerhalb der Klasse von<br />
Alt nach Jung oder andersrum ist der falsche Weg! Die politische Linke darf sich von der<br />
eigentlichen Gerechtigkeitsfrage nicht abbringen lassen: der sozialen Gerechtigkeit.<br />
Behauptung I: Unsere Sozialversicherungssysteme sind mit ihren<br />
bisherigen Leistungen nicht mehr finanzierbar!<br />
Forderungen nach einer Verschlankung der Sozialversicherungssysteme gehen zur Lasten der<br />
zukünftigen Generationen, denen dadurch eine marode Versorgung hinterlassen wird. Eine<br />
solche Entwicklung hilft nur denen, die sich eine private Vorsorge leisten können.<br />
Das Problem der Sozialversicherungssysteme liegt für uns nicht auf der Ausgaben- sondern auf<br />
der Einnahmenseite. Anstatt Leistungen zu kürzen oder in die private Vorsorge abzuschieben<br />
und so die soziale Absicherung weiter dem Markt zu überlassen, muss die Einnahmenseite<br />
erweitert werden. In den letzten Jahren wurden vor allem die ArbeitgeberInnen von<br />
Beitragszahlungen entlastet – vor allem dadurch, dass immer mehr Leistungen aus dem<br />
Leistungskatalog der gesetzlichen Sozialversicherungen herausgenommen wurden und nun<br />
von den ArbeitnehmerInnen zusätzlich privat abgesichert werden müssen. Diese<br />
59
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Fehlentwicklung muss dringend korrigiert werden. Private Versicherungsformen, mittels<br />
Kapitaldeckung organisiert, sind gerade nicht den gesetzlichen umlagefinanzierten<br />
Sozialversicherungen überlegen. Die kapitalgedeckten Systeme funktionieren nur<br />
augenscheinlich stabil, da sie gleich mehrfach selektiv wirken. Sie schließen Personen mit<br />
geringem Einkommen und schlechtem Gesundheitszustand aus. Somit versichern die privaten<br />
Versicherungsunternehmen zu einem überwiegenden Teil lediglich „gute Risiken“. Wir halten<br />
diesen ungerechten Versicherungsvarianten unsere solidarischen Systeme entgegen, die es<br />
ermöglichen allen BürgerInnen einen Schutz vor elementaren Lebensrisiken zu bieten.<br />
Die paritätische Finanzierung zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen hat sich –<br />
auch aus Gerechtigkeitserwägungen – bewährt und muss schnellstens wieder hergestellt<br />
werden. Hinzu kommt, dass sich SpitzenverdienerInnen der Solidarität durch eine Flucht in<br />
private, kapitalgedeckte Versicherungen entziehen können. Das Kernproblem der<br />
Sozialversicherungen ist also ein Verteilungsproblem: Die ArbeitgeberInnen wurden durch die<br />
letzten Reformen einseitig entlastet, während die ArbeitnehmerInnen mit niedrigen und<br />
mittleren Einkommen durch in Folge von Leistungskürzungen zusätzlich notwendig gewordene<br />
private Absicherungen einseitig mehr belastet werden. Anstatt Leistungen aufgrund des<br />
Arguments zu geringer Einnahmen zu kürzen, muss zunächst die Beitragsbasis nach dem<br />
Prinzip der BürgerInnenversicherung ausgeweitet und die Beitragsbemessungsgrenzen stark<br />
erhöht werden. Die solidarische BürgerInnenversicherung schließt nicht nur neue<br />
Personengruppen wie Selbständige oder Beamte mit ein, sondern auch Einkommensarten wie<br />
die aus privaten Kapitalerträgen, welche sozialversicherungspflichtig werden müssen.<br />
Für uns <strong>Jusos</strong> bedeutet eine solidarische Gesellschaft aber auch, dass jedeR nur soviel in die<br />
Sozialversicherungssysteme einzahlt, wie es sein/ihr Gehalt hergibt. Deshalb wollen wir<br />
prüfen, ob progressive Sozialversicherungsbeiträge oder Freibeträge bei den Sozialabgaben<br />
sinnvoll sind, um untere Einkommensgruppen zu entlasten und höhere Einkommensgruppen<br />
stärker zu belasten. Private Vorsorge darf nicht Teil des Sozialsystems sein. Der Sozialstaat<br />
muss jedem Menschen, egal ob er oder sie es sich leisten kann privat vorzusorgen, eine gute<br />
Versorgung bieten. (Arbeits-) Unfälle, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, die Versorgung eines<br />
Menschen darf nicht vom eigenen Geldbeutel abhängen. Von privaten Vorsorgepflichten sind<br />
gerade sozialschwache Teile unserer Gesellschaft betroffen, da hier die eigene Vorsorge nicht<br />
möglich ist. Eine gute Versorgung, die alle allgemeinen Lebensrisiken versichert, muss auch in<br />
Zukunft Teil des staatlichen Sozialsystems sein.<br />
Behauptung II: Die Kürzungen der Leistungen aus der<br />
Arbeitslosenversicherung waren nötig, um diese auch für künftige<br />
Generationen zu sichern!<br />
60
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Prozesse von Arbeit und Wirtschaft haben sich in den letzten zwanzig Jahren nachhaltig<br />
und unumkehrbar gewandelt.<br />
Die Politik hat es in der Vergangenheit versäumt, diesem Wandel gerecht zu werden, und die<br />
Arbeitslosenversicherung an die geänderten, nicht mehr linearen Erwerbsbiographien<br />
anzupassen. Eine Absicherung muss heutzutage Brüche in Erwerbsbiographien absichern,<br />
anstatt Sozialabbau weiter voran zu treiben und den Druck auf ArbeitnehmerInnen weiter zu<br />
erhöhen.<br />
Gute Arbeit bedeutet für uns die Überwindung vom reinen Mittel zum Leben hin zur<br />
Selbstverwirklichung. Gute Arbeit ist also erst dann erreicht, wenn Arbeit selbst das erste<br />
Lebensbedürfnis geworden ist und es gilt: JedeR nach seinen/ihren Fähigkeiten, jedeR nach<br />
seinen/ihren Bedürfnissen. In unserer Gesellschaft ist gesicherte Arbeit vielmehr auch ein<br />
wichtiger Schlüssel zu aktiver Teilhabe an der Gesellschaft, unter Anderem deshalb lehnen wir<br />
Ansätze wie das Grundeinkommen ab. Die zunehmende Prekarisierung sorgt für steigenden<br />
Druck innerhalb der ArbeitnehmerInnen, der zunehmend auch unter der<br />
ArbeitnehmerInnenschaft geschürt wird.<br />
Durch die sich schnell wandelnden Anforderungsprofile verlieren erworbene Qualifikationen<br />
schnell an Wert. Deshalb stellt Weiterbildung für uns ein Kernelement staatlicher Aufgaben im<br />
Bereich der Arbeitsmarktpolitik dar. Die Qualifizierung der ArbeitnehmerInnen muss aktiv und<br />
fortlaufend in das Erwerbsleben integriert werden, nicht erst im Falle der Arbeitslosigkeit.<br />
Weiterbildung muss als Teil der allgemeinen Qualifizierung staatlich garantiert werden.<br />
Flexible Arbeitszeitkonten können helfen, Weiterbildung ins Berufsleben zu integrieren und<br />
Leih- und Zeitarbeit zu minimieren. Selbständige Beschäftigung ist nicht gleichbedeutend mit<br />
Krisenresistenz. Auch die Gruppe der Selbständigen bedarf deswegen des sozialstaatlichen<br />
Schutzes. Die derzeitige Arbeitslosenversicherung schließt nur abhängig Beschäftige ein. Eine<br />
an die aktuelle Erwerbssituation angemessene Absicherung muss auch Selbstständige<br />
berücksichtigen.<br />
Der demographische Wandel muss als Chance für eine umfassende Gleichstellung der<br />
Geschlechter genutzt werden. Durch den Rückgang an männlichen Facharbeitskräften<br />
erweitern sich die Möglichkeiten für Frauen – auch in ehemals männerdominierten<br />
Tätigkeitsfeldern - Fuß zu fassen. Um diese Entwicklung zu verstetigen, muss sie auch politisch<br />
unterstützt werden. Dabei geht es den <strong>Jusos</strong> in erster Linie darum, die Gleichstellung und<br />
Emanzipation von Frauen weiter voranzutreiben, indem Frauen die gesellschaftliche Teilhabe<br />
durch Arbeit in allen Bereichen ermöglicht und gefördert wird. Tatsache ist aber, dass große<br />
Teile der Reproduktionsarbeit nach wie vor von Frauen erledigt werden, eine gleichmäßige<br />
Arbeitsteilung der Geschlechter besteht nicht. Um die Frauenerwerbsquote zu erhöhen, muss<br />
folglich auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden. Kinder dürfen nicht<br />
länger zum zwangsläufigen Karriereknick führen, der Wiedereinstieg ins Berufsleben auf<br />
61
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
gleicher Stufe muss besser abgesichert werden. Dazu gehören aber auch flexible Arbeitszeiten<br />
und allgemeine Arbeitszeitverkürzungen, die Männern und Frauen Familie und Beruf parallel<br />
zueinander ermöglichen.<br />
Für uns <strong>Jusos</strong> bietet die Arbeitsversicherung eine Antwort auf diese Herausforderungen. Die<br />
Arbeitsversicherung bietet zudem die Chance, bestehende Förderungen wie BAFöG, Elterngeld<br />
oder das Arbeitslosengeld in eine Versicherung zu integrieren.<br />
Behauptung III: Um im Alter gut leben zu können, müssen wir alle länger<br />
arbeiten und vor allem privat vorsorgen!<br />
Das bisherige Rentensystem baut auf einem Generationenvertrag auf, demzufolge die Kinder<br />
ihre Eltern im Alter versorgen. Das aktuelle Problem scheint dabei zu sein, dass es zu wenige<br />
Erwerbstätige gibt, die zu viele nicht mehr Erwerbstätige versorgen müssen. Viele<br />
RentnerInnen leben schon heute in Armut. In der Altersarmut zeigt sich das gravierende<br />
Problem des deutschen Rentensystems: Das Rentensystem sichert insbesondere<br />
GeringverdienerInnen oder Menschen mit unterbrochener Erwerbsbiografie keinen<br />
existenzsichernden Rentenanspruch. Menschen mit geringen Einkommen müssen heute mit<br />
der Gewissheit leben, auch im Alter nahe am Existenzminimum zu leben. Das bisherige<br />
Rentensystem basiert folglich nicht auf Solidarität innerhalb der Generation, sondern auf durch<br />
einkommensabhängige Beitragszahlungen erworbene individuelle Rentenansprüche. Durch<br />
die Riesterreform wurde die paritätische Finanzierung der Rentenversicherung endgültig<br />
aufgekündigt. Ein Ziel der Reform war es, ein Ansteigen der Rentenversicherungsbeiträge auf<br />
über 20 Prozent zu verhindern. Dies wurde durch den in die Rentenanpassungsformel<br />
integrierten ‚Nachhaltigkeitsfaktor’ erreicht, der langfristig dazu führen wird, dass das<br />
Nettorentenniveau sinkt. Die so entstehende Versorgungslücke soll durch eine staatlich<br />
subventionierte zusätzliche private und Altersvorsorge – der sogenannten ‚Riester-Rente’ –<br />
geschlossen werden. Die Folge ist, dass der ArbeitgeberInnenanteil auf einen Anteil von<br />
maximal 10 Prozent eingefroren wurde, zum ArbeitnehmerInnenanteil von 10 Prozent aber<br />
zusätzlich eine private Altervorsorge hinzukommt, an deren Finanzierung sich die<br />
ArbeitgeberInnen nicht beteiligen. Die junge Generation ist also nicht entlastet worden,<br />
sondern trägt lediglich den ArbeitgeberInnenanteil der Beitragssteigerung mit.<br />
Was bleibt, ist eine reine Umverteilung von den ArbeitnehmerInnen zu den ArbeitgeberInnen.<br />
Das Problem ist also nicht der Sozialstaat. Das Problem ist der Rückzug von Unternehmen und<br />
Vermögenden aus der solidarischen Finanzierung des Sozialstaats. Deshalb wurden gerade die<br />
einkommensschwachen Haushalte durch die Riester-Umstellung besonders belastet, da sie<br />
wegen fehlendem Vermögen und zu geringem Einkommen, um die ergänzende private<br />
Rentenversicherung zu finanzieren, unter der faktischen Rentenkürzung besonders leiden und<br />
62
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
nicht privat vorsorgen können. Die Antwort darauf kann nur in einer Rückkehr zu einer<br />
solidarischen Finanzierung liegen.<br />
Oft leben diese Menschen zudem in der Angst im Falle von Arbeitslosigkeit auf ALG II Niveau zu<br />
rutschen, was den Verlust von Ersparnissen bedeuten kann. Da diese Regelung nicht<br />
wohlhabende RentnerInnen, sondern insbesondere Alleinerziehende trifft, muss die Grenze der<br />
vor der Anrechnung auf das ALG II sicheren Ansparungen deutlich angehoben werden. Gerade<br />
für Frauen, die im Vergleich zu Männern immer noch deutlich weniger verdienen, ist das Risiko<br />
im Alter in Armut zu leben deutlich angestiegen.<br />
In den letzten Jahren gelang es nicht, bei Tarifverhandlungen den Verteilungsspielraum voll<br />
auszuschöpfen, also Lohnsteigerungen in Höhe der Produktivitätssteigerung zuzüglich der<br />
Inflationsrate durchzusetzen, mit der Folge sinkender Realeinkommen. Ein kapitalgedecktes<br />
System bietet hierbei keinen Fortschritt auf dem Weg zu einem solidarischen Rentensystem. In<br />
erster Linie unterscheidet es sich von seiner ganzen Art kaum von dem bisherigen<br />
Umlagesystem, die private Vorsorge des/r Einen ist der Wohnungskredit des/r Anderen.<br />
Allerdings ist ein durch die Finanzmärkte gestütztes System immer von mehr Risken belastet,<br />
für die im Zweifel der Staat einspringen muss. Die derzeitige Finanzmarktkrise mit den<br />
Milliardenabschreibungen zeigt eindrucksvoll, wie hoch diese Risiken sind. Eine Umstellung hin<br />
zu einem kapitalgedeckten System bedeutet zudem, dass dem staatlichen System Geld<br />
entzogen wird, das stattdessen in den internationalen Finanzmarkt fließt. Wir <strong>Jusos</strong> lehnen<br />
eine weitere Teilprivatisierung der gesetzlichen Rentenversicherung ab.<br />
Der Staat muss dort aktiv umverteilen, wo keine eigene Vorsorge möglich ist und die eigenen<br />
Anwartschaften nicht für ein würdiges Leben im Alter reichen. Der Sozialstaat muss allen<br />
Menschen durch eine über dem Existenzminimum liegende Mindestrente ein würdiges Leben<br />
im Alter ermöglichen.<br />
Am Prinzip der beitragsfinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung halten wir fest. Wir<br />
wollen aber die Solidarität in der Rentenversicherung stärken. Dazu möchten wir nach dem<br />
Prinzip der Bürgerversicherung weitere Einkommensarten zur Finanzierung heranziehen. Wir<br />
halten aus diesem Grund eine verstärkte zusätzliche Finanzierung der Renten über<br />
Steuermittel für sinnvoll und gerecht.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> möchten die gesetzliche Rentenversicherung zu einer verlässlichen Alterssicherung<br />
für alle Erwerbstätigen ausbauen und deshalb alle Erwerbstätige – also z.B. auch Beamte und<br />
Selbstständige – einbeziehen. Die gesetzliche Rentenversicherung muss es grundsätzlich allen<br />
Leistungsempfängern ermöglichen, im Alter ihren gewohnten Lebensstandard fortzuführen –<br />
sie muss verhindern, dass der Renteneintritt gleichbedeutend mit einem sozialen Abstieg wird.<br />
Bei der Berechnung der Rentenansprüche müssen Aus- und Weiterbildungszeiten, Eltern- und<br />
Pflegezeiten u.ä. genauso wie Erwerbszeiten berücksichtigt werden.<br />
Eine aus den Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung finanzierte Mindestrente, die<br />
deutlich über dem Existenzminimum liegt, muss dafür Sorge tragen, dass Menschen mit<br />
63
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
geringem Einkommen oder zu kurzen Einzahlungszeiten im Alter nicht in Armut leben. Die<br />
Rentenzahlungen für Menschen, die keine eigenen Rentenansprüche erworben haben, sollten<br />
aus Steuermitteln finanziert werden.<br />
Behauptung IV: Mit dem demografischen Wandel droht der<br />
Zusammenbruch der Pflegesysteme. Um dies zu verhindern, muss die<br />
Gesellschaft diese Aufgabe gemeinsam tragen!<br />
Pflegearbeit wird in den Familien meist von Frauen erledigt, ganz egal ob es sich um die<br />
eigenen Angehörigen handelt oder die des Partners. Das bedeutet eine dreifache Belastung.<br />
Durch zweimalige Unterbrechung der Einzahlung in das Rentensystem durch Kinderbetreuung<br />
und Pflege sowie eine meist schlechter entlohnte Arbeit, die oft nicht oder nicht ausreichend<br />
sozial absichert, steigt das Risiko später in Armut zu leben, deutlich an. Dies begünstigt eine<br />
Abhängigkeit vom Mann/ Partner.<br />
Der enorm ansteigende Pflegebedarf der nächsten Jahre darf deshalb nicht allein von Frauen in<br />
Familien getätigt werden. Pflegearbeit muss in höherem Maß auch von Männern getätigt<br />
werden, was ein Umdenken der Gesellschaft erfordert. Die Finanzierung des steigenden<br />
Pflegebedarfs darf nicht nur beitragsfinanziert durch ArbeitnehmerInnen und<br />
ArbeitgeberInnen finanziert werden. Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe braucht auch<br />
einen wachsenden Anteil an Finanzierung aus dem allgemeinen Steueraufkommen.<br />
Um gute Pflege gewährleisten zu können, muss die Ausbildung von Pflegekräften qualitativ<br />
verbessert und Pflege langfristig professionalisiert werden. Die mangelnde Qualität der<br />
professionellen Pflege, wie sie heute in vielen Pflegeheimen anzutreffen ist, geht neben der<br />
häufig fehlenden Ausbildung auch auf die massive Überlastung des Pflegepersonals zurück.<br />
Schichtarbeit, eine zu geringe Personaldecke und eine viel zu geringe Entlohnung führen oft zu<br />
psychischer und physischer Überlastung. Die Leidtragenden sind hier neben dem<br />
Pflegepersonal und dessen Angehörigen vor allem die Pflegebedürftigen. Eine optimale<br />
Versorgung dieser Menschen ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht gegeben. Deshalb<br />
muss der Beruf des/der PflegerIn sowohl in seinem gesellschaftlichen Ansehen als auch in der<br />
Entlohnung und den darüber hinausgehenden Arbeitsbedingungen aufgewertet werden und<br />
der Personaleinsatz erhöht werden. Auch Pflegebedürftige haben ein Anrecht auf gute Pflege<br />
und ein menschenwürdiges Leben! Die Qualität von Pflege darf dabei nicht nur aus Sicht der<br />
pflegenden Angehörigen und der sozialstaatlichen Organisation aus betrachtet werden.<br />
Wichtig ist auch die aktive Einbeziehung der zu Pflegenden. Ziel ist es, eine möglichst<br />
weitgehende Autonomie der Gepflegten über ihre eigenen Lebensumstände zu bewahren oder<br />
wiederherzustellen. Dies beinhaltet den Erhalt von Autonomie trotz gesundheitlicher<br />
Einschränkungen ebenso wie Autonomie gegenüber entmündigender Pflege, gleich ob diese<br />
64
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
durch anonyme Heim- und Pflegestrukturen oder die "gut gemeinte Entmündigung" im<br />
Rahmen der eigenen Familie geschieht.<br />
Menschen, die ihre Angehörigen selber betreuen, müssen in der Regel ihre berufliche Tätigkeit<br />
einschränken oder ganz aufgeben. Nicht nur aus Sicht der Betroffenen, sondern auch für die<br />
Sozialsysteme stellt dies ein Problem dar. Private PflegerInnen, die auf diese Art und Weise<br />
ihren Arbeitsplatz verlieren, zahlen keine Sozialversicherungsbeiträge mehr. Über den<br />
momentanen Verdienstausfall hinaus, erleiden sie auch Nachteile im Hinblick auf ihre<br />
Rentenansprüche. Darüber hinaus leidet auch die Solidargemeinschaft, da die<br />
Sozialversicherungsbeiträge fehlen. Außerdem muss Pflege, die in der Familie verrichtet wird,<br />
nicht zwangsläufig liebevoller sein. Ursachen sind hierfür keinesfalls fehlende Zuneigung,<br />
sondern vielmehr eine 24 Stunden dauernde Belastung der pflegenden Personen ohne die<br />
Möglichkeit abzuschalten. Soziale Kontakte gehen verloren, der Widereinstieg ins Berufsleben<br />
ist meist nur schwer möglich. Um diese Problemlagen zu verhindern oder zumindest zu<br />
minimieren, müssen vielfältige Angebote geschaffen werden, um eine optimale Versorgung<br />
der zu pflegenden Person und der betroffenen Angehörigen sicher zu stellen.<br />
Wir fordern die Anrechnung von familiär erbrachten Pflegeleistungen für die Rente. Dazu<br />
gehört aber auch eine von staatlicher Seite angebotene Pflegeberatung für Angehörige, die<br />
auch über Alternativen zur familiären Pflege informiert.<br />
Langfristig muss der Weg hin zu professioneller, qualitativ hochwertiger Pflege führen. Der<br />
Staat hat hierbei die Pflicht, Pflegeplätze in ausreichender Zahl zu Verfügung zu stellen und<br />
ambulante Pflege sowie innovative Pflegeformen wie (kommunale) Pflegeagenturen,<br />
Alterswohngemeinschaften, Demenzwohngemeinschaften, betreutes Wohnen oder<br />
Mehrgenerationenhäuser aktiv zu fördern. Dazu gehört auch die steuerliche Begünstigung von<br />
HauseigentümerInnen, die ihre Immobilien an solche Einrichtungen vermieten. Pflege soll<br />
nicht zwangsläufig innerhalb der Familie sondern qualitativ hochwertig in der Gesellschaft<br />
stattfinden. Ein Platz in einem Pflegeheim darf nicht länger vom Geldbeutel des/r<br />
Pflegebedürftigen oder dem der Kinder abhängen. Der Staat muss auch hier durch<br />
Umverteilung allen Menschen ein würdiges Leben im Alter ermöglichen.<br />
Behauptung V: Nur ein auf Wettbewerb basierendes Gesundheitssystem<br />
ist in der Lage die ansteigenden Kosten, verursacht durch den<br />
demografischen Wandel, noch zu retten!<br />
Die Kostensteigerungen in den letzten Jahren im Gesundheitswesen vor allem auf den<br />
medizinisch-technischen Fortschritt zurückzuführen. Um eine qualitativ hochwertige<br />
Versorgung der Versicherten zu ermöglichen – und nicht nur einen Mindestleistungskatalog<br />
abzudecken – ist es erforderlich diese Ausgabensteigerungen im solidarischen System zu<br />
65
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
finanzieren. Auch die Veränderungen in der Arbeitswelt, der stetig wachsende Druck auf<br />
ArbeitnehmerInnen und die zunehmende Prekarisierung der Arbeit sind als Ursachen zu<br />
benennen. Auch die Ausgaben für Kinder und Familienversicherungen werden bewusst aus den<br />
Statistiken herausgelassen, um das Problem der Kostensteigerungen auf die älteren<br />
Generationen zu schieben. Im Zusammenhang mit Kostensteigerungen im Gesundheitswesen<br />
müssen auch die Pharmakonzerne in die Betrachtung einbezogen werden, die durch eine<br />
einseitige Profitausrichtung die Preise für Medikamente stetig erhöhen. Diese Preiserhöhungen<br />
werden vor allem durch so genannte Scheininnovationen (me-too Präparate) und lange<br />
Patentlaufzeiten hervorgerufen.<br />
Gerade im Bereich der Krankenversicherung zeigt sich das Dilemma des Sozialsystems am<br />
Allerdeutlichsten. Die, die es sich leisten können und zudem gesund sind in privaten Kassen<br />
versichert. Die gesetzlichen Kassen können diesen Einnahmenverlust nur durch erhöhte<br />
Beiträge abfedern.<br />
Gesundheit ist in Deutschland ein Indikator von Wohlstand, wer arm ist wird häufiger krank.<br />
Die gesetzlichen Kassen müssten folglich mit weniger Geld mehr Versorgung leisten. Eine<br />
solidarische Versicherung im Gesundheitssystem ist mit den privaten Kassen nicht möglich.<br />
Deshalb streben wir mittelfristig die Abschaffung der privaten Krankenversicherung an. Die<br />
Änderungen infolge der letzten Gesundheitsreform haben die, sowieso schon kaum<br />
vorhandene, Solidarität innerhalb des Gesundheitssystems auch innerhalb der gesetzlichen<br />
Kassen untergraben. Durch neue Wahltarife wird Umverteilung von Alten/ Kranken hin zu<br />
Gesunden betrieben. Wer gesund ist zahlt weniger, kranke Menschen werden für ihr Leiden<br />
noch finanziell benachteiligt. Die traditionelle Beitragssolidarität ist aufgelöst. Für uns <strong>Jusos</strong><br />
bleibt die Antwort auf die Probleme im Gesundheitssystem die solidarische<br />
BürgerInnenversicherung, nach der sich alle BürgerInnen, vor allem auch BeamtInnen und die<br />
Besserverdienenden, die sich bislang mit privaten Krankenversicherungen dem Solidarsystem<br />
entziehen, in den gesetzlichen Krankenversicherungen versichern müssen. Das System der<br />
paritätischen Finanzierung durch ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen bleibt dabei<br />
bestehen. Die Beitragshöhe bemisst sich allein am Einkommen des/r Versicherten und<br />
entspricht somit der individuellen Leistungsfähig. Das Prinzip der Versicherungsäquivalenz<br />
besteht auch in der Sozialversicherung nicht in seiner ökonomischen Reinform. Grundsätzlich<br />
ist es aber notwendig, um eine Mehrheit für die solidarische Finanzierung der<br />
Sicherungssysteme zu erhalten. Dies gilt für SpitzenverdienerInnen ebenso wie für Menschen<br />
mit geringem Einkommen.<br />
Dazu ist es jedoch notwendig, Fehlentwicklungen der letzten Jahre wieder rückgängig zu<br />
machen. Durch die Praxisgebühr werden insbesondere Menschen in einer prekären sozialen<br />
Lage davon abgehalten, im Krankheitsfall eine/n ÄrztIn aufzusuchen. Vermeintlich fallen<br />
dadurch Kosten für das Gesundheitssystem weg, tatsächlich steigen die Kosten jedoch<br />
dramatisch an, wenn Krankheiten zu spät diagnostiziert und behandelt werden. Um diese<br />
66
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Prozesse umzukehren, muss innerhalb des Gesundheitssystems das Augenmerk auf der<br />
kostenlosen Vorsorge liegen. Dazu gehören flächendeckende Impfungen genauso wie<br />
Krebsvorsorge oder ausreichende krankengymnastische Behandlungen.<br />
Für uns <strong>Jusos</strong> muss weiterhin der soziale Aspekt von Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt<br />
stehen. Standardisierte Abrechnungsprozesse in Form von Fallpauschalen führen zu einer<br />
Enthumanisierung der Gesundheitsversorgung und belasten ÄrztInnen und PatientInnen<br />
gleichermaßen. Krankheit und Genesung darf nicht innerhalb bestimmter Prozesse berechnet<br />
werden, wo jede Abweichung von der Norm zu Rechtfertigungsdruck auf Seiten der ÄrztInnen<br />
oder zu frühen Entlassungen der PatientInnen führt.<br />
Wie auch im Bereich der Pflege ist das Personal im Gesundheitswesen deutlich überlastet. Eine<br />
Krankenschwester, die im Nachtdienst für eine Station verantwortlich ist, und auf der anderen<br />
Seite ihre Familie nicht von ihrem Lohn versorgen kann, gerät schnell an die Grenzen der<br />
Belastbarkeit. Studien im Gesundheitswesen belegen eindeutig, dass psychische Erkrankungen<br />
aufgrund von steigender Überlastung deutlich zunehmen. Auch in der ÄrztInnenschaft,<br />
insbesondere im Bereich der Krankenhäuser, kann nicht mehr von „guter Arbeit“ gesprochen<br />
werden. Gerade im Osten Deutschlands herrscht in den ländlichen Regionen eine dramatische<br />
medizinische Unterversorgung, da ÄrztInnen und Schwestern/Pfleger für deutlich mehr Arbeit<br />
deutlich weniger Gehalt verdienen. Die Bereitschaft in die unterversorgten Regionen zu gehen,<br />
ist dementsprechend gering. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen kann in diesem<br />
Zusammenhang keine Rede sein. Die Arbeitsbedingungen für das gesamte medizinische<br />
Personal sind insbesondere in Krankenhäusern insgesamt unzumutbar. Die Arbeitsbelastung<br />
ist oft nahe oder liegt sogar über den gesetzlich zulässigen Höchstgrenzen. Gleichzeitig ist die<br />
Bezahlung vergleichsweise niedrig. Wir wollen, dass auch für Pflegepersonal und ÄrztInnen<br />
eine normale Arbeitswoche mit vollem Ausgleich aller Überstunden und eine angemessene<br />
Bezahlung gelten.<br />
Behauptung VI: Haushaltskonsolidierung ist die erste Priorität für eine<br />
generationengerechte Politik.<br />
In den letzten Jahren wurde das Argument der Generationengerechtigkeit dazu genutzt, den<br />
Abbau der Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden und die Vermeidung der Aufnahme<br />
von neuen Krediten zur ersten Priorität zu machen. Sozial gerechte und „nachhaltige“ Politik,<br />
die kommende Generationen nicht belastet, wäre nur dann möglich, wenn ein ausgeglichener<br />
Haushalt erreicht werden könne.<br />
Dieses Konsolidierungsargument wurde vor allem für die Rechtfertigung von Einsparungen im<br />
Bildungs- und Sozialsektor, der Erhöhung der Mehrwertsteuer und Privatisierungen genutzt,<br />
gleichzeitig wurden Möglichkeiten zur Umverteilung von oben nach unten verschenkt und<br />
teilweise sogar im Gegenteil Besserverdienende entlastet, indem direkte Steuern<br />
67
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
(Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Ansenkung des Spitzensteuersatzes) für sie zum Teil<br />
drastisch gesenkt wurden.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> lehnen diese Politik ab. Für uns kann die Haushaltskonsolidierung nicht die erste<br />
Priorität politischen Handels sein! Zwar ist die Staatsverschuldung sowohl für die heutigen, als<br />
auch für die kommenden Generationen eine Belastung. Ein schwacher Staat ohne jegliche<br />
politische Gestaltungsmöglichkeiten, von Privaten zugrunde gerichtete Infrastrukturen, ein<br />
desolates Bildungswesen und um sich greifende Armut ist für kommende Generationen aber<br />
ein viel schwereres Erbe. Die Haushaltskonsolidierung-um-jeden-Preis-Politik muss ein Ende<br />
haben!<br />
Wenn sich Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung bieten, muss klar sein: Konsolidierung<br />
kann nicht bedeuten, dass notwendige, wichtige und sinnvolle Ausgaben vernachlässigt<br />
werden. Sozialdemokratische Haushaltspolitik heißt nicht, dass der Staat nicht sparsam mit<br />
seinen finanziellen Ressourcen umgehen soll. Bei überflüssigen oder gar schädlichen Ausgaben,<br />
wie zum Beispiel Rüstungsausgaben, kann durchaus eingespart werden. In der Vergangenheit<br />
wurde jedoch in der Regel genau an den falschen Stellen (z.B. Sozialstaat, Bildung) gespart. Das<br />
darf nicht so fortgesetzt, sondern muss rückgängig gemacht werden. Dazu ist es auch<br />
notwendig, dass Einnahmen an den richtigen Stellen erhöht werden. Die Staatsausgaben<br />
müssen durch gerecht verteilte Steuerbelastungen ausgeglichen, Umverteilungsspielräume<br />
genutzt werden. Die Steuerbelastung von Besserverdienenden und Unternehmen muss<br />
steigen, die von Geringverdienern sinken. Darüber hinaus dürfen in einer angespannten<br />
Haushaltslage die direkten Steuern nicht gesenkt werden.<br />
Die letzten Jahrzehnte haben eindrucksvoll gezeigt, dass vor allem Privatisierungen kein<br />
probates Mittel zur Konsolidierung sind, sondern lediglich einmalig Geld in die öffentlichen<br />
Kassen spülen, sich jedoch mittel- und langfristig sowohl als finanzielle Verlustgeschäfte für<br />
den Staat erweisen, als auch die für alle wichtigen Infrastrukturen gefährden und zugrunde<br />
richten. Heutige und kommende Generationen brauchen funktionierende und gut ausgebaute<br />
Infrastrukturen zu angemessenen Preisen. Zudem kann der Staatshaushalt von den Einnahmen<br />
aus staatlichen Infrastrukturunternehmen profitieren, die Verschleuderung von<br />
Staatseigentum für kurzfristige Haushaltskalkulationen ist ein Raubbau am Gemeinwohl. Die<br />
Privatisierungswelle der vergangenen Jahre und Jahrzehnte muss ein Ende haben, die wenigen<br />
Infrastrukturen, die noch in staatlichem Besitz sind, müssen das auch bleiben. Statt weiterhin<br />
zu privatisieren, müssen Möglichkeiten zur Wiederverstaatlichung genutzt werden, auch wenn<br />
dafür kurzfristig hohe Neuverschuldungen in Kauf genommen werden müssen.<br />
Behauptung VII: Auf dem Arbeitsmarkt tobt ein Kampf der Generationen.<br />
Alle Generationen stehen auf dem Arbeitsmarkt zurzeit vor großen Problemen. Für<br />
SchulabgängerInnen werden von den Betrieben längst nicht genügend Ausbildungsplätze zur<br />
68
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Verfügung gestellt, viele warten jahrelang auf eine Stelle, die Zahl der AltbewerberInnen steigt.<br />
Der Ausbildungspakt hat daran kaum etwas geändert, die Steigerung der zur Verfügung<br />
stehenden Ausbildungsplätze bleibt sogar hinter den in ihm festgehaltenen Erwartungen<br />
zurück. Diejenigen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, werden immer häufiger nicht<br />
übernommen und haben zum Teil große Probleme den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden.<br />
Ältere wiederum sind statistisch wesentlich häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Der<br />
Wiedereinstieg in ihren Beruf ist für diese ArbeitnehmerInnen wesentlich schwerer, viele<br />
Unternehmen stellen ausschließlich jüngere Menschen ein, die häufig für weniger Geld<br />
arbeiten.<br />
Der Arbeitsmarkt geht zudem noch viel zu wenig auf die Bedürfnisse von älteren Menschen<br />
ein. Es muss klar sein: Nicht jede Form von Arbeit kann in jedem Alter verrichtet werden. Für<br />
ältere ArbeitnehmerInnen muss altersgerechte Arbeit geschaffen werden, die diese körperlich<br />
meistern können und die auf ihre Bedürfnisse eingeht. Gleichzeitig müssen Programme wie die<br />
Altersteilzeit weiter gefördert werden. Menschen und ihre Arbeitsplätze sind unterschiedlich.<br />
Der Eintritt in das Rentenalter muss flexibel gestaltet werden und sich den Bedürfnissen jeder<br />
Arbeitnehmerin/jedes Arbeitnehmers anpassen. Ein flexibeler Eintritt in die Rentenzeit muss<br />
ermöglicht werden, verschiedene Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, manche<br />
Menschen möchten früher aus dem Erwerbsleben aussteigen, andere möchten länger arbeiten,<br />
für alle diese Menschen muss es Möglichkeiten geben, dann in die Rentenzeit einzusteigen,<br />
wenn es für sie angemessen ist. Gleichzeitig muss ein Missbrauch dieser für<br />
ArbeitnehmerInnen geschaffenen Flexibilität durch die Betriebe verhindert werden. Ein Abbau<br />
von Arbeitsplätzen, indem Druck auf ArbeitnehmerInnen ausgeübt wird, sich früher verrenten<br />
zu lassen, muss verhindert werden.<br />
Generell hat die Verunsicherung aller ArbeitnehmerInnen, unabhängig von ihrem Alter, in den<br />
letzten Jahren stark zugenommen. Diese Verunsicherung darf von niemandem dazu genutzt<br />
werden, im Sinne des Begriffes der Generationengerechtigkeit ältere und jüngere Menschen<br />
auf dem Arbeitsmarkt gegeneinander auszuspielen. Das Problem darf nicht sein, dass – je nach<br />
Perspektive – die Älteren oder die jüngeren den jeweils anderen die Stellen wegnehmen, oder<br />
mehr verdienen oder für zu wenig Geld arbeiten, sondern dass es zu wenig gute Arbeit gibt und<br />
die Betriebe nicht dazu bereit sind, ihre ArbeitnehmerInnen angemessen zu bezahlen. Der<br />
Arbeitsmarkt kann – genauso wie die gesamte Gesellschaft - nur mit einem Miteinander der<br />
verschiedenen Generationen funktionieren.<br />
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels klagen immer mehr ArbeitgeberInnen über<br />
den angeblich daraus resultierenden Fachkräftemangel. In einer immer älter werdenden<br />
Gesellschaft gäbe es in Zukunft zu wenige fähige ArbeitnehmerInnen für die Betriebe. Dieser<br />
Fachkräftemangel ist aber nicht eine Folge des Demografischen Wandels, sondern ein<br />
hausgemachtes Problem. Die Betriebe verbauen sich selbst jede Chance auf zukünftige<br />
Fachkräfte, wenn sie sich aus ihrer ureigenen Verantwortung ziehen und nicht ausbilden. Hier<br />
69
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
müssen die Unternehmen wieder in die Pflicht genommen werden. Wir fordern eine<br />
Ausbildungsplatzumlage, alle Betriebe, die nicht ausbilden, müssen in einen Ausbildungsfond<br />
einzahlen, mit dem dann nicht nur Betriebe, die mehr ausbilden unterstützt werden können,<br />
sondern auch Alternativen zur dualen Ausbildung wie rein schulische Ausbildungen finanziert<br />
werden können.<br />
Außerdem müssen männlich dominierte Arbeitsbilder überwunden und Frauen endlich<br />
gleichgestellt in den Arbeitsmarkt integriert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die<br />
Chancen, die mit der verringerten Anzahl an männlichen Facharbeitskräften verbunden sind,<br />
konsequent genutzt werden. Zurzeit befinden sich die Frauen die arbeiten, noch immer<br />
überdurchschnittlich häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen, erhalten noch immer im<br />
Durchschnitt ein Viertel weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen und haben in den<br />
Betrieben noch immer geringere Aufstiegschancen, obwohl sie weder schlechtere noch<br />
niedrigere Bildungsabschlüsse haben als Männer. Damit werden sie, obwohl sie arbeiten, noch<br />
immer in Abhängigkeitsverhältnisse zu ihren, möglicher Weise vorhandenen, Partnern<br />
gedrängt, die sich durch entsprechend ihrer Einkünfte niedrige Renteneinkünfte bis in die<br />
Rentenzeit fortsetzten. Um es Frauen zu ermöglichen, gute Arbeitsplätze zu erhalten und ihre<br />
Aufstiegschancen zu erhöhen, fordern wir die Einführung einer Quote in der Wirtschaft.<br />
Behauptung VIII: Akademikerinnen bekommen zu wenig und zu selten<br />
Kinder und schaden damit den Sozialsicherungssystemen.<br />
Familienstrukturen sind als sozial und kulturell erlernte Strukturen veränderbar und sie haben<br />
sich in den letzten Jahren auch stark verändert. Dabei vollzieht sich der Wandel von<br />
Rollenzuschreibungen unterschiedlich schnell und in unterschiedlichem Ausmaß. Als <strong>Jusos</strong><br />
begrüßen wir den Wandel von tradierten Rollenzuschreibungen, die Frauen in unserer<br />
Gesellschaft strukturell in nahezu allen Lebensbereichen diskriminieren, hin zu einer<br />
emanzipativen selbstbestimmten Lebensführung von Frauen und Männern auch in familiären<br />
Zusammenhängen. Dieser Wandel ist jedoch gesellschaftlich nicht unumkämpft, die Versuche<br />
konservativer PolitikerInnen und MeinungsmacherInnen, die Zeit zurückzudrehen, müssen wir<br />
als feministischer Richtungsverband bekämpfen.<br />
Noch immer lebt der größte Teil der Bevölkerung in traditionellen Familienstrukturen (oder<br />
strebt diese an) mit einem i.d.R. männlichen Hauptverdiener und einer i.d.R. weiblichen<br />
Nebenverdienerin. Damit kommt der Frau bestenfalls die Rolle der Zuverdienerin zu,<br />
Abhängigkeiten vom Ehemann/Freund werden, auch durch die niedrige Entlohnung und die<br />
fehlende soziale Absicherung, strukturell gefestigt. Wir <strong>Jusos</strong> wollen, dass diese<br />
Abhängigkeitsstrukturen aufgelöst werden.<br />
Neben einem traditionellen Familienbild konnten sich in den letzten Jahren auch andere<br />
Formen des Zusammenlebens etablieren. Homosexuelle PartnerInnenschaften, feste<br />
70
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Lebensgemeinschaften mit zwei voll erwerbstätigen PartnerInnen, Alleinerziehende,<br />
familienähnliche Wohngemeinschaften, Singlehaushalte etc. werden zunehmend anerkannt.<br />
Besonders häufig werden jedoch Menschen, aus diesen Gruppen mit Problemen konfrontiert:<br />
So finden sich beispielsweise Alleinerziehende in einer finanziell hoch problematischen<br />
Situation und die Betreuung der Unter-3-Jährigen ist in der Bundesrepublik kaum<br />
gewährleistet. Um Männern und Frauen gleichermaßen und gleichgestellt den doppelten<br />
Lebensentwurf zu ermöglichen, fordern die <strong>Jusos</strong> eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, den<br />
qualitativen und quantitativen Ausbau von ganztägigen Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch<br />
für Unter-3-Jährige ebenso wie den Ausbau der außerhäuslichen Pflegemöglichkeiten.<br />
Reproduktionsarbeit darf nicht länger alleinige Angelegenheit von Frauen bleiben.<br />
Der demografische Wandel ist keine der Hauptursachen für den Wandel von<br />
Familienstrukturen aber neue Rollenbilder wirken sich auf das Zusammenleben von<br />
Generationen, die Bevölkerungsstruktur und soziale und wirtschaftliche Aspekte unserer<br />
Gesellschaft aus. Durch den demografischen Wandel müssten Frauen eigentlich bessere<br />
Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt haben und durch ihre gute Ausbildung auch den<br />
Weg in die Führungsetagen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft finden. Dies ist nach wie<br />
vor nicht der Fall, Frauen befinden sich häufiger in prekären Jobs ohne soziale Absicherung und<br />
in Bereichen ohne Aufstiegsmöglichkeiten als Männer; mittlere und höhere Führungsetagen<br />
bleiben für Frauen, die verantwortungsvolle Aufgaben wahrnehmen wollen, immer noch<br />
weitgehend verschlossen. Dadurch zeigt sich einmal mehr, dass es sich im Arbeitsmarkt um<br />
tradierte und fest verankerte Strukturen handelt, die Frauen benachteiligen. Diese Situation<br />
kann nur verbessert werden, wenn wir diese Strukturen, z.B. mit einer verbindlichen Quote für<br />
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aufbrechen.<br />
Insbesondere Akademikerinnen wird oft vorgeworfen, sie würden zu wenige Kinder<br />
bekommen. Diese Argumentation impliziert, dass AkademikerInnenkinder die „besseren“<br />
Kinder sind. Damit einher geht die Annahme, dass sich der Bildungsstand vererbt. Eine solche<br />
Argumentation kapituliert vor der sozialen Spaltung in unserem Land. Als JungsozialistInnen<br />
wollen wir alle Kinder, egal aus welchem sozialen Milieu und Umfeld, bestmöglich fördern und<br />
ihnen eine umfassende Bildung ermöglichen. Wir brauchen nicht mehr Kinder in der<br />
Bundesrepublik, wir müssen uns aber um alle Kinder besser kümmern, unabhängig von sozialer<br />
Herkunft oder Religion. Als <strong>Jusos</strong> lehnen wir eine Bevölkerungspolitik ab und setzen uns für<br />
eine emanzipierte und emanzipatorische Familienpolitik ein.<br />
Behauptung IX: Durch die Konzentrationsprozesse der Bevölkerung in<br />
Städten können Infrastruktureinrichtungen im ländlichen Raum nicht<br />
mehr finanziert werden.<br />
71
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mittlerweile wohnen ca. 50% der Menschen in der Bundesrepublik in Städten. Wie stark<br />
Landstriche und Städte vom demografischen Wandel und von Wegzügen betroffen sind und<br />
darauf reagieren müssen, variiert im Bundesgebiet enorm.<br />
Insbesondere west- und süddeutsche Großstädte mit guten Arbeitsmarktchancen verlieren<br />
kaum an EinwohnerInnen und können eventuelle Verluste durch Zuzüge aufgrund ihrer<br />
Attraktivität ausgleichen. Hier stellen sich weniger Fragen des Rückbaus als vielmehr der<br />
Gentrifikation und insbesondere des Filtering-Down. Da EinwohnerInnen, die es sich leisten<br />
können, schnellstmöglich Problembezirke verlassen, kommt es zunehmend zu einer<br />
Konzentration sozialer Problemlagen in diesen Bezirken. Die „Durchmischung“ dieser Stadtteile<br />
geht sukzessive zurück, soziale Spannungen fokussieren sich in diesen Bereichen und sind<br />
schwerer aufzufangen. Lösungen können hier im Rahmen des Quartiersmanagements und<br />
durch Strategien der Sozialen Stadt gefunden werden.<br />
Die größeren Städte in den neuen Bundesländern müssen sich mit dem Rückgang von<br />
Bevölkerungszahlen auseinandersetzen, der demografische Wandel und der Wegzug<br />
zahlreicher Menschen seit 1990 sind hier spürbar. Durch den Rückbau von „Neubau“gebieten<br />
und die Umgestaltung von Siedlungsstrukturen versuchen die Städte ihre Attraktivität zu<br />
erhöhen und mit der veränderten Situation umzugehen.<br />
Noch schwieriger gestaltet sich die Situation in strukturschwachen und/oder ländlichen<br />
Gebieten, insbesondere wenn Siedlungen nicht in der Nähe von Mittelzentren oder größeren<br />
Städten liegen. Besonders drastisch zeichnet sich diese Entwicklung in ostdeutschen ländlichen<br />
Gebieten ab. Oft vergessen wird bei der Debatte um diese Gebiete, dass auch hier<br />
ArbeitnehmerInnen, SchülerInnen und Kinder gibt. Zwar ist die Bevölkerung in diesen Gebieten<br />
durchschnittlich älter als in anderen Bereichen, auch die Bedürfnisse Jüngerer müssen jedoch<br />
beachtet werden. Dabei geht es nicht darum, eine Generation gegen die andere auszuspielen,<br />
vielmehr müssen Konzepte erarbeitet werden, die eine gleiche Teilhabe aller an der<br />
Gesellschaft ermöglichen.<br />
Bei Infrastrukturbelangen sind zahlreiche Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens<br />
betroffen. So müssen Mehr-Generationenhäuser oder Mehr-Generationen-Wohnanlagen<br />
ebenso wie alternative Wohnmodelle (z.B. Alters-WG´n) auch in strukturschwachen Regionen<br />
angeboten werden. Kleinteilige Modelle sind flexibler zu gestalten und können leichter den<br />
jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Auch im Pflegebereich sind solche dezentralen<br />
Strukturen stärker zu fördern. Oft kann in strukturschwachen Bereichen kaum noch die<br />
Gesundheitsversorgung gewährleistet werden: monatelange Wartezeiten in weit entfernten<br />
Städten sind mittlerweile in etlichen Regionen der Republik die Regel und nicht die Ausnahme.<br />
FachärztInnen stellen ihre Kompetenz kaum im ländlichen Raum zur Verfügung. Von<br />
gleichwertigen Lebensverhältnissen kann hier keine Rede mehr sein. Der quantitative Ausbau<br />
von ÄrztInnenhäusern, auch in kleinen Städten oder Dörfern muss gefördert werden, auch das<br />
Gemeindeschwestermodell kann eine Option zu einer verbesserten Versorgung darstellen. Um<br />
72
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
die Erreichbarkeit von Kleinzentren besser zu bewerkstelligen, muss der ÖPNV die<br />
sozialräumliche Struktur stärker berücksichtigen. Als Zielgruppe des ÖPNV müssen<br />
SeniorInnen, Kinder, Jugendliche und Frauen stärker in den Blick genommen werden, der<br />
vollzeitangestellte Mann verfügt auch im ländlichen Raum i.d.R. über ein eigenes Auto und legt<br />
den Weg zur Arbeit auf diese Weise zurück.<br />
Durch den Rückgang von SchülerInnenzahlen werden zunehmend Schulen geschlossen. Dies ist<br />
der falsche Weg! Zumindest die Grundschulzeit müssen Kinder wohnortnah unterrichtet<br />
werden, wenn nötig durch das Zusammenlegen mehrere Jahrgänge. Durch die Etablierung von<br />
Gesamtschulen könnte zukünftig auch in strukturschwachen Regionen ein wohnortnaher<br />
Unterricht auch in höheren Klassen gewährleistet werden. Schulgebäude sollten darüber<br />
hinaus stärker als sozio-kulturelle Zentren wahrgenommen werden, in denen die Menschen<br />
zusammenkommen können. Kulturelle Angebote, z.B. durch Kooperationen mit Theatern aus<br />
der Umgebung, können hier ihren Raum finden. Schule muss sich öffnen!<br />
Daneben könnten Kindertagesstätten Schulräume zur Betreuung der Kinder erhalten, auch im<br />
ländlichen Raum müssen Kinderbetreuungsmöglichkeiten bestehen, um so Frauen und<br />
Männern einen doppelten Lebensentwurf zu ermöglichen.<br />
Eine generationengerechte Infrastrukturpolitik reagiert auf den demografischen Wandel mit<br />
dezentralen Lösungsstrategien, die allen Generationen gerecht werden und sie nicht<br />
gegeneinander ausspielen. Eine Leuchtturmpolitik, die sich nur auf wenige Gebiete<br />
konzentriert, lässt Menschen in anderen Regionen im Stich. Dies kann nicht Ziel<br />
jungsozialistischer Politik sein.<br />
Behauptung X: Bei weniger Kindern muss auch weniger in das<br />
Bildungssystem investiert werden.<br />
Seit Anfang der 1990er Jahre ist auch in Berlin ein deutlicher Rückgang der Anzahl der<br />
Neugeborenen zu beobachten. Dies gilt insbesondere für den Ostteil der Stadt, wo die<br />
Geburtenrate in der Folge der politischen Wende geradezu eingebrochen ist. So verzeichnete<br />
das Statistische Landesamt im Jahr 1990 noch rund 37.500 Geburten in Berlin, im Jahr 1991<br />
waren es nur noch rund 30.500 Neugeborene. Dies bedeutet einen Rückgang um fast 20%<br />
innerhalb nur eines Jahres. In anderen ostdeutschen Bundesländern war der Rückgang aber<br />
noch erheblich größer – so zum Beispiel in Sachsen, wo er rund 50% betrug. Seit 1991 liegt die<br />
Anzahl der Neugeborenen in Berlin weitgehend konstant bei rund 29.000 Kindern. Dabei hat<br />
sich der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund auf mehr als 25% eines Altersjahrgangs<br />
erhöht. Dies stellt auch besondere Anforderungen an die Bildungspolitik. Der Rückgang der<br />
Geburten bedeutet zeitversetzt auch einen Rückgang der SchülerInnenzahlen. Konkret<br />
bedeutet dies, dass zwischen 1997 und 2007 in Berlin die Zahl der SchülerInnen von rund<br />
410.000 auf knapp 350.000 zurückgegangen ist. Dies entspricht einem Rückgang von rund 15%,<br />
73
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
der wegen der zeitlichen Verzögerung in den nächsten Jahren aber noch größer werden dürfte.<br />
Dies wird deutlich, wenn man nur die Entwicklung der Zahl der SchulanfängerInnen<br />
betrachtet: Gab es 1997 noch fast 34.000 ErstklässlerInnen, so waren es im Schuljahr<br />
2006/2007 nur noch etwas mehr als 24.000. Dies bedeutet einen Rückgang von rund 30%. Dies<br />
liegt aber nicht nur an der demografischen Entwicklung, sondern wurde durch die<br />
Abwanderungen aus Berlin im Laufe der 1990er Jahre erheblich verstärkt. Da die Verteilung der<br />
SchülerInnen nach der Grundschule auf die verschiedenen Schulformen weitgehend konstant<br />
geblieben ist, ist bereits in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Rückgang der Zahl<br />
der AbiturientInnen und somit der potenziellen StudienanfängerInnen zu rechnen. Dies<br />
erscheint vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen und einem „Studierendenberg“<br />
wenig plausibel. Für uns <strong>Jusos</strong> ist eine umfassende Bildung Voraussetzung für eine<br />
emanzipatorisch-kritische Persönlichkeitsenwicklung. Deshalb muss eine umfassende Bildung<br />
für alle ermöglicht werden. Berufsqualifizierung ist für uns nur ein Aspekt von Bildung. Durch<br />
die bestehenden Zugangsbeschränkungen und sozialen Hürden werden die wenigen noch<br />
geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren den Weg an die Hochschulen nicht finden.<br />
Zusätzlich zu den sinkenden Geburtenraten und entsprechender Abnahme der<br />
SchülerInnenzahlen steuern wir bei gleichbleibender Studierquote auf einen horrenden<br />
Fachkräftemangel zu. Auch wenn das Verhindern eines Fachkräftemangels für uns nicht der<br />
Hauptgrund für eine Verbesserung des Bildungssystems ist, müssen wir diesen Umstand für<br />
uns nutzen. Entsprechend kann und muss die demographische Entwicklung als Druckmittel<br />
benutzt werden, um unsere Forderung nach einem durchlässigen Bildungssystem endlich<br />
durchzusetzen. Denn nur wenn wir es schaffen, mehr Menschen eine<br />
Hochschulzugangsberechtigung erwerben zu lassen und ihnen ein Studium zu ermöglichen,<br />
werden wir dem Fachkräftemangel entgegen wirken können.<br />
Allerdings darf man dabei nicht vergessen, wie lange es dauert, bis sich der Einbruch der<br />
Geburtenzahlen auf den verschiedenen Ebenen des Bildungssystems niederschlägt. Denn der<br />
Geburtenjahrgang von 1991 stellt erst im Jahr 2010 den Großteil des Abiturjahrgangs. Einen<br />
Vorgeschmack auf die anstehenden Entwicklungen geben die diesjährigen Diskussionen um<br />
einen drohenden Mangel an Auszubildenden, wobei im Bereich der Beruflichen Ausbildung die<br />
so genannten AltbewerberInnen und der gestiegenen Anteil an AbiturientInnen, die<br />
demografischen Auswirkungen überlagern.<br />
Bisher ist der Zugang zu Bildung stark begrenzt. SchülerInnen werden beispielsweise bereits<br />
nach der Grundschule faktisch durch „Einteilung“ auf Haupt- oder Realschule vom Erwerb der<br />
allgemeinen Hochschulreife ausgeschlossen, der Zugang zum Studium ist restriktiv gestaltet<br />
und droht durch die Einführung von Bachelor und Master noch verschärft zu werden und auch<br />
im Bereich der beruflichen Bildung sind die Kapazitäten zu gering. Deswegen fordern wir einen<br />
Ausbau der Bildungskapazitäten und eine Abschaffung aller Zugangsbeschränkungen. Jede<br />
und jeder hat das Recht optimal gefördert zu werden und die Bildung in Anspruch zu nehmen,<br />
74
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
die er/sie möchte. Um trotzdem eine Qualitätsverbesserung (z.B. kleinere Klassen, individuelle<br />
Betreuung, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund) zu erreichen fordern wir<br />
deshalb eine massive Erhöhung der Bildungsausgaben.<br />
Darüber hinaus besteht in diesem gesellschaftlichen Wandlungsprozess die Chance,<br />
progressive Schulkonzepte wie Gemeinschaftsschulen und jahrgangsübergreifende<br />
Lernformen durchzusetzen. Dies ist besonders im ländlichen Raum dringend notwendig, um<br />
eine gute Schulversorgung für die geringere Anzahl von SchülerInnen zu gewährleisten. Haben<br />
sich diese Konzepte erst einmal etabliert, könnte es auch leichter werden, sie im städtischen<br />
Raum umzusetzen und damit das gegliederte Schulsystem zu überwinden. Dabei reicht die<br />
Einführung eines zweigliedrigen Schulsystems mit Gymnasium und "Restschule" nicht aus, da<br />
damit die Probleme der sozialen Selektion nicht überwunden, sondern weiter fortgeschrieben<br />
werden. Vielmehr müssen wir so bald wie möglich zu Gemeinschaftsschulen kommen, die<br />
diese Selektionsmechanismen nicht mehr beinhalten. Damit verbunden ist ein Mehr an<br />
Chancengleichheit für alle, was über das Bildungssystem hinaus auch eine Zunahme an<br />
sozialer Mobilität nach oben bedeutet und damit eine große Chance für die gesamte<br />
Gesellschaft darstellt.<br />
Behauptung XI: „Der letzte Deutsche“ – unser Volk stirbt aus!<br />
Die im Demografie-Diskurs immer wieder aufgestellte Behauptung, dass Deutschland auf<br />
lange Sicht, die arbeitsfähige Bevölkerung ausgeht, hat mehrere Ebenen und wird auf<br />
unterschiedliche Art und Weise geführt. Während also ein Teil der WirtschaftsvertreterInnen<br />
sich vor den Konsequenzen der selbstverschuldeten Fachkräftemangel durch gezielte<br />
Einwanderung von „nützlichen AusländerInnen“ drücken wollen, benutzen andere den Diskurs,<br />
um mit der völkischen Parole vom sterbenden Volk oder vom „Raum ohne Volk“<br />
nationalistische Stimmungen zu machen. Dabei wird ignoriert, dass einer seit Jahrzehnten<br />
stetig steigenden Produktivität der deutschen Wirtschaft kontinuierlich abnehmende<br />
Beschäftigtenzahlen in den Unternehmen gegenüberstehen. Dies bedeutet, dass mit immer<br />
weniger arbeitenden Menschen immer mehr produziert wird. Da ein Ende dieser Entwicklung<br />
nicht abzusehen ist, bestehen gerade aus ökonomischer Sicht keinerlei Notwendigkeiten zu<br />
einer Erhöhung der Geburtenrate.<br />
Während in den 70er Jahren eine solche Agitation in der Öffentlichkeit kaum vorstellbar war,<br />
ist eine biologistisch begründete Bevölkerungspolitik nun offen gesellschaftlicher Konsens.<br />
Notwendig für diese Bevölkerungspolitik ist die Verfügungsgewalt über den Frauenkörper. Den<br />
Frauen wird in dieser Diskussion häufig die eigene Sexualität abgesprochen, indem sie als<br />
biologische Reproduzentinnen der Nation instrumentalisiert werden. Vermittelt wird dies mit<br />
der Forderung nach einer Stärkung der Familie als „Keimzelle der Nation“ mit tradierter<br />
Rollenverteilung.<br />
75
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Neben der rassistischen Angst der Mehrheitsgesellschaft „auszusterben“, befürchtet man von<br />
den als völkisch zugeschriebenen „Anderen“ „übernommen“ zu werden. Dies manifestiert sich<br />
zum Beispiel im institutionalisierten Rassismus der deutschen Asylgesetzgebung, welcher von<br />
einer Mehrheit der Gesellschaft getragen wird. Diese Abschottungspolitik wird auch auf<br />
europäischer Ebene durch ein dichtes Netz an Abschiebeknästen und mit einer eigenen dazu<br />
gegründeten „Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen<br />
der Mitgliedsstaaten“ insbesondere auch mit deutscher Hilfe forciert.<br />
Auch die Debatte über die eine neue Form der Integrationspolitik in Deutschland zeichnet sich<br />
durch Angst und Vorurteile gegenüber den hier lebenden Menschen anderer Herkunft aus.<br />
Anstatt das menschlichen Lebens an sich als höchstes Gut zu erachten, müssen sich gerade<br />
ZuwanderInnen aus nicht europäischen Ländern einem menschenverachtenden<br />
Nützlichkeitsdenken unterwerfen. Die Ungerechtigkeit wird dadurch noch verschärft, dass den<br />
wenigsten ZuwanderInnen die Bildungs- und Berufsabschlüsse, die sie in ihren Heimatländern<br />
erworben haben, in Deutschland anerkannt werden. Sie sind daher gezwungen, als ein Heer<br />
von billigen Arbeitskräften für Industrie und Gewerbe in eher gering qualifizierten Berufen zu<br />
arbeiten. Parallel dazu wird die Einwanderung von gut ausgebildeten und „sofort einsetzbare<br />
Arbeitskräften“ beschleunigt. Diese Verwertungslogik ist nicht nur menschenverachtend,<br />
sondern in zweifacher Sicht kontraproduktiv. Erstens würde man den wirtschaftlich schon<br />
schwächeren Ländern die Fachkräfte entziehen und zweitens die Integrationspolitik, in der<br />
Annahme, dass man „fertige Arbeitskräfte importiert“ weiterhin vernachlässigt.<br />
Wir JungsozialistInnen lehnen jede Art von nationalistischer Bevölkerungspolitik kategorisch<br />
ab. Wir wollen in einer Welt ohne Grenzen leben, in der kein Mensch irgendwo „illegal“ ist. Wir<br />
wollen das „Aussterben“ nicht durch Migration kompensieren, sondern fordern das Grundrecht<br />
auf globale Migration bedingungslos ein!<br />
Behauptung XII: Gefahr „RentnerInnendemokratie“: ältere Generation<br />
„plündern“ die Jüngeren „aus“.<br />
Zurzeit wird oft über die Gefahr der RentnerInnen-Demokratie oder die Regierung der „Alten“<br />
geredet. Prompt melden sich „Demokratieexperten“ aus dem RCDS mit der Forderung nach<br />
einer Veränderung des Wahlrechts: Den unproduktiven Bevölkerungsgruppen, darunter auch<br />
RentnerInnen, soll das Stimmgewicht bei Wahlen, je nach Nützlichkeit, gemindert werden.<br />
Wieder ein sinnloser Diskurs, wie die in der Vergangenheit vom JU-Vorsitzenden angestoßene<br />
Debatte, um das Nichtbezahlen von künstlichen Hüftgelenken bei über 85-jährigen.<br />
Eine Gefahr für unsere Demokratie besteht gewiss, die hat aber sicher nichts mit dem<br />
demografischen Wandel zu tun, Ältere machen nicht automatisch Lobbypolitik für ihre eigene<br />
Generation. Die Probleme sind die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft in die<br />
abgehängte Unterschichten und den Wohlhabenden, die Missachtung des Wunsches nach<br />
76
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
mehr sozialer Gerechtigkeit seitens mehr als drei Viertel der Gesellschaft und die immer weiter<br />
greifende Sachzwanglogik in allen Parteien, die den Menschen Glauben macht, dass Politik und<br />
somit die Demokratie nichts bewegen kann.<br />
Ist die Frage nach dem Glauben an die Demokratie nicht eine der wichtigen, berechtigten<br />
Fragen, wenn es darum geht, zukünftigen Generationen eine intakte Gesellschaft zu<br />
hinterlassen? Ein vermeintlich schuldenloser Staat ohne Demokratie wird den zukünftigen<br />
Generationen sicher nicht lieber sein, als andersrum, denn der Wert der Demokratie ist nicht in<br />
Geld zu messen!<br />
77
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
D<br />
Daseinsvorsorge & Gesundheitspolitik<br />
D 1 - Bundesvorstand<br />
Privatisierung – Mittel von gestern,<br />
Gestaltungstod von morgen<br />
Wir <strong>Jusos</strong> streiten für eine Gesellschaft, in der allen Menschen gleichen Zugang haben zu<br />
denjenigen Gütern und Dienstleistungen, die für ein Leben in Selbstbestimmung notwendig<br />
sind. Wir sind überzeugt, dass der Staat nicht nur vermeintliche Kernaufgaben, also Sicherheit<br />
und Schutz des Staates und seiner Bürger selbst, übernehmen muss. Kern unseres<br />
Verständnisses von Staat ist auch seine Aufgabe, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu<br />
sorgen. Diesem Auftrag wird er unter anderem dann gerecht, wenn Aufgaben in öffentlicher<br />
Verantwortung und unter demokratischer Kontrolle und Gestaltung übernommen werden.<br />
Vollprivatisiert ins 21. Jahrhundert? Eine Bestandsaufnahme<br />
In den vergangenen Jahren wurde diese Funktion des Staates zunehmend ausgehöhlt. Auf<br />
allen Ebenen wurden in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere seit den 1990er Jahren<br />
öffentliche Güter und Aufgaben privatisiert, also aus der öffentlichen Hand in private<br />
Verfügungsgewalt übertragen. Dahinter stand und steht zum Teil die Vorstellung, privatrechtliche<br />
Organisationsformen seien Garant für die effizientere und günstigere Erbringung<br />
der jeweiligen Aufgabe. Vor allem aber dienten insbesondere Veräußerungen öffentlicher<br />
Güter dazu, kurzfristig finanzielle Mittel in den Haushalt der jeweiligen föderalen Ebene zu<br />
spülen.<br />
In der BRD geriet der Vorgang der Privatisierung von Staatseigentum durch die sogenannte<br />
zweite Postreform, durch die im Jahr 1994 die Deutsche Bundespost in ihren Bestandteilen<br />
Postdienst, Postbank und Fernmeldedienst jeweils in die Rechtsform der AG überführt und<br />
damit zunächst formell privatisiert wurde, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Tatsächlich<br />
wird materiell in Deutschland seit Ende der 50er Jahre privatisiert, indem Unternehmen und<br />
Unternehmensanteile aus Staatseigentum veräußert werden.<br />
78
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die große Welle der Privatisierungen rollt indes in der Tat seit den 1990er Jahren. Auf<br />
Bundesebene kam es in dieser Zeit zu vielen Vollprivatisierungen, unter anderem der Berliner<br />
Industriebank AG, der Deutschen Außenhandelsbank AG, der Deutschen<br />
Stadtentwicklungsgesellschaft AG, der Gemeinnützigen Deutschen Wohnungsbaugesellschaft<br />
AG, der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH (Rest in 2006), der Autobahn Tank & Rast AG<br />
und der Bundesdruckerei GmbH. Die Privatisierung von VIAG und VEBA zur heutigen EON AG<br />
zog sich ebenso über mehrere Jahre hin wie die Privatisierung der ehemaligen Bundesbahn.<br />
Zudem wurden große Teile des Staatseigentums der DDR nach der Wiedervereinigung durch<br />
die Treuhandanstalt veräußert. Auch in den Ländern und ganz besonders in den Kommunen<br />
standen die Zeichen auf Privatisierung, die weit über den formellen Vorgang der Umwandlung<br />
eines Eigenbetriebs in privat-rechtliche Rechtsformen hinausging. Betroffen waren alle<br />
Bereiche, darunter Wasserversorgung, Entsorgung von Abwasser und Müll, Krankenhäuser,<br />
ÖPNV, Verkehrsprojekte, sozialer Wohnungsbau und Sport- und Kultureinrichtungen.<br />
Insbesondere die europäische Integration setzte die Rahmenbedingungen für ein politisches<br />
Klima, das Privatisierungen nicht nur als zulässig, sondern darüber hinaus als gewünscht und<br />
wirtschafts- und ordnungspolitisch geboten erschienen ließ. Zwar kam und kommt der<br />
Europäischen Gemeinschaft keine eigene Kompetenz zur Frage der Organisation von Aufgaben<br />
der Daseinsvorsorge zu. Doch sowohl die auf Liberalisierung angelegten Römischen Verträge<br />
als auch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza zur europäischen Einigung mit<br />
ihrer Ausrichtung auf Binnenmarkt und Wettbewerb waren so angelegt, dass die Europäische<br />
Gemeinschaft und später Union die Rolle als Motor der Privatisierung übernahm.<br />
Währungsunion und Finanzmarktintegration trugen weiter dazu bei, die Ziele Deregulierung<br />
und Flexibilisierung zu schärfen und umzusetzen. Auch die Kommission und der Europäische<br />
Gerichtshof förderten diese Entwicklung durch deutliche Positionierungen zur Anwendung der<br />
Wettbewerbsregeln auf staatlich wahrgenommene Aufgaben, die die öffentliche<br />
Daseinsvorsorge erheblich unter Druck setzte.<br />
Im europäischen Vergleich nahm die große Privatisierungswelle in den 1980er Jahren in<br />
Großbritannien ihren Anfang, das in kurzer Zeit den überwiegenden Teil der<br />
Staatsunternehmen wie Telekommunikation, Gas und Transportwesen veräußerte. Zwischen<br />
1985 und 1996 erzielte England dadurch Privatisierungserlöse von über 100 Milliarden US-<br />
Dollar. Länder wie Frankreich oder Deutschland zogen später nach.<br />
Die Motive der jeweiligen Privatisierungsakteure sind vielfältig. Wohl immer ist das Interesse<br />
und die Argumentation darauf gerichtet, durch Veräußerungserlöse finanzielle Mittel in den<br />
jeweiligen Haushalt zu spülen und damit - freilich nur kurzfristige - Handlungsspielräume der<br />
öffentlichen Hand zu sichern bzw. zu erschließen. In der Erklärung nach außen sind es oft<br />
Sanierungs- und Modernisierungserfordernisse, die in der Darstellung durch Private besser und<br />
effizienter umgesetzt werden können. Dahinter stehen vielfach jedoch zugleich ein<br />
79
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
missverstandenes Subsidiaritätsprinzip im Sinne des Privat vor Staat (Bsp. Banken und<br />
Verkehr), ein hohe Durchsetzungsfähigkeit privater Lobbyisten (Bsp. Ver- und Entsorgung) oder<br />
der Wunsch einzelner Entscheidungsträger nach einem teuren Prestigeobjekt (Bsp.<br />
kommunales "Spaßbad").<br />
Die Welle bricht - Widersprüchliche Tendenzen<br />
Neuerdings jedoch hat die Entwicklung ihre bis dahin weitgehend gleichförmige Bewegung<br />
eingebüßt. Auf vielen Ebenen und in unterschiedlicher Ausprägung mehrt sich die Erkenntnis,<br />
dass die Privatisierung öffentlicher Güter und Aufgaben keine adäquate Lösung<br />
gesellschaftlicher Herausforderungen darstellt, dass Verkaufserlöse nur kurzfristig die<br />
öffentlichen Kassen erleichtern, umgekehrt aber erhebliche materielle und immaterielle Werte<br />
aus der Hand gegeben werden, dass der Markt nicht automatisch alles besser, günstiger und<br />
bürgerfreundlicher anbieten kann. Deshalb mehrt sich insbesondere in den Städten und<br />
Gemeinden der Widerstand gegen Privatisierungen öffentlichen Eigentums - häufig mit Erfolg,<br />
wie Bürgerbegehren und -entscheide gegen Verkäufe von Stadtwerken etc. beweisen.<br />
In jüngster Zeit mehren sich Beispiele, in denen Städte und Gemeinden nicht nur - zum Teil in<br />
interkommunaler Zusammenarbeit - neue öffentliche Aufgaben erschließen, sondern auch<br />
vormals privatisierte Einrichtungen in die öffentliche Hand zurückholen. Rekommunalisiert<br />
wird insbesondere in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Abfallwirtschaft,<br />
Straßenreinigung und Bauhöfe. Insbesondere die Einführung der Doppik als Methode der<br />
kommunalen Haushaltsführung hat die Voraussetzung geschaffen, die Gemeinden nach<br />
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten handeln zu lassen. Gekoppelt mit den vielfach<br />
schlechten Erfahrungen durch die Privatisierung sowie dem Wunsch und der Notwendigkeit,<br />
neue und kontinuierliche Einnahmen zu erschließen, führt dies zu einem Umdenken in den<br />
Kommunen.<br />
Doch wenn bereits von Trendwende und kippender Stimmung gegen die Privatisierung<br />
gesprochen wird, ist dies verfrüht. Auch viele Kommunen privatisieren weiterhin. CDU- und<br />
CDU/FDP-regierte Bundesländer bringen durch geplante oder bereits in Kraft getretene<br />
Gesetzesänderungen die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden in Bedrängnis. Und nicht<br />
zuletzt: Allen Widerständen der Öffentlichkeit zum Trotz werden weitere Privatisierungen in<br />
Ländern und Bund auch mit sozialdemokratischer Unterstützung durchgesetzt - das Beispiel<br />
Deutsche Bahn ist dabei eines der eklatantesten.<br />
Der derzeitige Trend ist daher allenfalls widersprüchlich zu nennen. Privatisierung und ihre<br />
Folgen bleiben also Feld politischer Auseinandersetzung.<br />
80
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Formen und Folgen von Privatisierung<br />
Privatisierung bezeichnet als Schlagwort die Übertragung öffentlicher Güter oder Aufgaben<br />
und die Verantwortung dafür auf Private, häufig durch Veräußerung. Hinter dem Oberbegriff<br />
verbergen sich jedoch verschiedene Formen von Privatisierung, die zum Verständnis<br />
voneinander zu trennen sind, auch wenn sie in der Praxis häufig gleichzeitig auftreten.<br />
Formelle Privatisierung bezeichnet die Änderung der Rechtsform einer ursprünglich öffentlichrechtlich<br />
organisierten Einrichtung, also etwa die Umorganisation der städtischen<br />
Wasserwerke in eine Stadtwerke GmbH. Damit muss nicht eine Veräußerung einhergehen, so<br />
dass die Gemeinde auch die hundertprozentige Eigentümerin sein kann. Hier werden oft<br />
Argumente der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zur Begründung der Umwandlung<br />
angeführt. Entscheidend für die politische Bewertung einer formellen Privatisierung sind<br />
Transparenz und Kontrolle der Entscheidungen im dann privatrechtlichen Unternehmen sowie<br />
die Einhaltung von Standards insbesondere im Bereich der Rechte und Entlohnung der<br />
Beschäftigten.<br />
Durch die sogenannte Finanzierungsprivatisierung werden private Mittel zur Finanzierung<br />
bestimmter öffentlicher Aufgaben oder Güter herangezogen. Darunter fallen<br />
Kommunalkredite und viele Modelle des Public-Private-Partnership. Diese Form der<br />
Privatisierung muss differenziert betrachtet werden: Public-Private-Partnership wird in der<br />
politischen Diskussion all zu gerne, häufig auch von Teilen der SPD, als der neue dritte Weg<br />
zwischen traditioneller Eigenerbringung einer Leistung durch den Staat einerseits und der<br />
vollständigen Privatisierung andererseits angepriesen, von dem alle Beteiligten nur profitieren<br />
könnten. Public-Private-Partnership ist jedoch kein neuer Weg, sondern häufig nur der<br />
kompromissfähige Zwischenschritt zu einer vollständigen PrivatisierungWie weitgehend sie<br />
ist, hängt entscheidend davon ab, wie durch sie die Eigentumsverhältnisse, die<br />
Verfügungsbefugnis und die Kontrolle über das betreffende Gut ausgestaltet werden.<br />
Unter funktionaler Privatisierung versteht man die Übertragung einer bisher öffentlichen<br />
Aufgabe an private Dritte oder auch das Zulassen weiterer Anbieter neben der öffentlichen<br />
Hand auf einem dadurch entstehenden Markt. Es ist das Feld der zentralen<br />
Auseinandersetzung um Privatisierung, denn hier wird der Kampf darum ausgetragen, welche<br />
Aufgaben und Güter öffentlich angeboten und dem Markt entzogen werden müssen und<br />
welche im Wettbewerb von Staat und Privat oder rein privatwirtschaftlich organisiert denkbar<br />
sind. Es geht hier um die elementare Frage der Definitionshoheit über den Begriff der<br />
Öffentlichen Daseinsvorsorge und das Verständnis von Staat und seinen Aufgaben, an dem<br />
sich jungsozialistische und sozialdemokratische Vorstellungen von konservativen und liberalen<br />
abgrenzen.<br />
81
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Materielle Privatisierung schließlich bedeutet Verkauf und Übereignung von staatlichen<br />
Gütern an Private, was sowohl ganze Einrichtungen als auch nur Unternehmensteile oder -<br />
anteile umfassen kann. Hierunter fällt auch das sogenannte Sale-and-lease-back, bei dem eine<br />
öffentliche Sache veräußert, übereignet und sodann zum Gebrauch vom neuen (privaten)<br />
Eigentümer gemietet wird - damit ist es mehr als Finanzierungsprivatisierung, weil für die<br />
Mittel, die in die öffentliche Kasse fließen, das Eigentum an einem öffentlichen Gut<br />
aufgegeben wird.<br />
Insbesondere funktionale und materielle Privatisierung zeitigen vielfältige Folgen, deren<br />
Gegenwert meist in nicht mehr als einer kurzfristigen Erleichterung des öffentlichen Haushalts<br />
besteht. Bei umfassender aber auch bei einer nur teilweisen Privatisierung verbleiben nur die<br />
defizitären Bereiche in der öffentlichen Hand, weil an diesen kein privatwirtschaftliches<br />
Interesse besteht. Das sind regelmäßig jedoch diejenigen Einrichtungen, die von besonderer<br />
Bedeutung für Chancengleichheit auch im Bereich von Bildung, Kultur und Sport haben.<br />
Quersubventionierungen zu deren Gunsten sind dann nicht mehr möglich, weil Einrichtungen<br />
fehlen, die die dafür erforderlichen Mittel erwirtschaften. Die öffentliche Hand selbst bringt<br />
sich um ihre Handlungsspielräume durch Verlust regelmäßiger Einnahmen und um die Mittel<br />
und Einrichtungen zur Gestaltung.<br />
In den privatisierten Bereichen fehlt es vielfach an Transparenz und Kontrolle, die<br />
Arbeitsbedingungen verschlechtern sich, und nicht selten werden die Preise entgegen<br />
anderslautender Absicht nicht niedriger, sondern höher. Und obwohl der Wettbewerbsgedanke<br />
regelmäßig Rechtfertigung von Privatisierungen ist, entwickeln sich in der Folge Monopole und<br />
Oligopole, die - Beispiel Energiesektor - den Markt zum Nachteil von Leistung, Kosten und<br />
zukunftsfähiger Weiterentwicklung der Versorgung beherrschen.<br />
Von Privatisierung betroffen: Privat vor Staat vor Chancengleichheit<br />
Beispiel Sparkassen<br />
In Deutschland ist eine Debatte um die Privatisierung des Sparkassenwesens im Gange, die<br />
insbesondere von CDU- und FDP-geführten Landesregierungen befeuert wird.<br />
Charakteristisch für das Deutsche Bankwesen ist die sog. „Drei-Säulen-Struktur“, die im<br />
Kreditwesengesetz (KWG) geregelt ist. Danach bestehen Genossenschaftsbanken<br />
(Kreditgenossenschaften und genossenschaftliche Zentralbanken), öffentlich-rechtliche<br />
Institute (Sparkassen und Landesbanken) und Kreditbanken (Private Geschäftsbanken).<br />
82
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sind die Landesbanken und die Sparkassen. In Deutschland<br />
gibt es rund 500 Sparkassen. Für den Geschäftsbetrieb der meisten Sparkassen gilt das<br />
Regionalprinzip: Das Geschäftsgebiet einer Sparkasse bildet im Allgemeinen das Gebiet ihres<br />
kommunalen Trägers. Sparkassen sind in Deutschland im Regelfall Anstalten des öffentlichen<br />
Rechts. Träger einer Sparkasse ist in diesem Fall eine kommunale Gebietskörperschaft (Stadt,<br />
Landkreis) oder ein kommunaler Sparkassenzweckverband (Zusammenschluss mehrerer<br />
kommunaler Gebietskörperschaften zum gemeinsamen Betreiben einer Sparkasse).<br />
Sowohl historisch als auch in der derzeitigen Struktur übernehmen die Sparkassen Aufgaben<br />
der Daseinsvorsorge: Die Sparkassen wurden meist im 19. Jahrhundert gegründet, um ärmeren<br />
Teilen der Bevölkerung die (sichere) Möglichkeit zu eröffnen, zwecks Risikovorsorge im Alter<br />
oder bei Krankheit Kapital zurückzulegen. Die Institute unterlagen aus diesem Grund strengen<br />
Geschäftsbeschränkungen, die sich im Laufe der Jahrzehnte nach und nach aufgelockert haben.<br />
Heutzutage sind die Sparkassen in ihrem Status mit dem einer Universalbank vergleichbar.<br />
Hauptaufgabe der Sparkassen ist es, der Bevölkerung Möglichkeiten zur sicheren und<br />
verzinslichen Geldanlage zu bieten und die örtlichen Kreditbedürfnisse zu befriedigen. Die<br />
Sparkassen stellen die Versorgung der Bevölkerung ihres Geschäftsgebietes mit geld- und<br />
kreditwirtschaftlichen Leistungen sicher. Sie fördern zudem die allgemeine Vermögensbildung.<br />
Die Institute sind dem Gemeinnutz verpflichtet, doch nicht gemeinnützig im steuerlichen Sinn.<br />
Im Gegensatz zu privaten Banken ist bei Sparkassen grundsätzlich die Erzielung von Gewinn<br />
nicht der Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Leitmotiv ist die Gemeinwohlorientierung. Ein<br />
erzielter Gewinn wird, soweit er nicht durch Rücklagenbildung im Vermögen der Sparkasse<br />
verbleibt, an den Träger (Zweckverband, Landkreis, Stadt) ausgeschüttet oder von der<br />
Sparkasse direkt für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. Förderschwerpunkte sind<br />
Schulen, das regionale Gemeinwesen, Natur und Umwelt sowie Jugend und Sport. Viele<br />
Sparkassen haben zudem Stiftungen gegründet, die vielfach karitative Zwecke fördern. Zudem<br />
sind Sparkassen Arbeitgeber mit sicheren Arbeitsverhältnissen und hoher Ausbildungsquote<br />
und stellen im Gegensatz zu vielen privaten Bankern auch Schulabgänger mit Fachoberschulund<br />
Fachhochschulreife ein.<br />
Die Aufgabenerfüllung der Sparkassen gerät durch die zunehmend scharfen<br />
Privatisierungsforderungen unter Druck. Während die Vorhaben bei den geplanten<br />
Veräußerungen der Landesbanken unschwer erkennbar sind, erfolgt der Privatisierungsangriff<br />
auf die Sparkassen versteckter, nämlich schrittweise: So soll nach dem Willen etwa der<br />
nordrhein-westfälischen Landesregierung zukünftig das Trägerkapital Sparkassen im<br />
städtischen Haushalt ausgewiesen werden. Auch wenn das Trägerkapital zunächst nicht<br />
handelbar ist, ist die erste Grundlage für künftige Privatisierungsmaßnahmen gelegt. Zudem<br />
ist die Gemeinnützigkeitsbindung von Sparkassenausschüttungen im Visier der<br />
Gesetzesreform - auch dies kann als Stellschraube pro Privatisierung enttarnt werden, denn<br />
83
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
andere Begründungen sind gerade im Hinblick auf den eigentlichen Auftrag der Sparkassen<br />
und ihrer öffentlich-rechtlicher Träger nicht denkbar.<br />
Auch im Bankenwesen zeigt der Blick zum europäischen Privatisierungsvorreiter<br />
Großbritannien die konkreten Folgen von Privatisierung: Ab 1980 wurde mit der Fusion und<br />
dem Verkauf der Sparkassen eine weit verzweigte Infrastruktur lokal verankerter<br />
Kreditinstitute aufgegeben – mit negativen Konsequenzen für Bevölkerung und Wirtschaft in<br />
den Regionen vor Ort. Der Wettbewerb ist reduziert, weil die Sparkassen fehlen. Drei Millionen<br />
Briten haben kein Girokonto mehr, d.h. sind vom bargeldlosen Zahlungsverkehr<br />
ausgeschlossen.<br />
Ohne ein Girokonto sind Menschen aber von vielen Dienstleistungen abgeschnitten. Kaum ein<br />
Arbeitgeber ist noch bereit, seinem Arbeitnehmer eine Lohntüte auszuhändigen, keine Miete<br />
wird bar entrichtet. Bareinzahlungen auf fremde Konten sind wiederum vielerorts mit<br />
Gebühren belastet und benachteiligte Bevölkerungsteile zusätzlich. Auch staatliche<br />
Transferleistungen stellen auf ein Girokonto des Leistungsempfängers ab.<br />
Für uns <strong>Jusos</strong> sind die Sparkassen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, denn:<br />
• sie gewährleisten ortsnah die geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der<br />
Menschen und sind dabei nicht hauptsächlich Gewinnerzielung angelegt,<br />
• sie sind Partner der regionalen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes und des<br />
Handwerks,<br />
• sie unterstützen Kommunen bei Maßnahmen der Strukturpolitik<br />
• sie fördern gemeinnützige Vorgaben im Sport-, Kultur- Sozial- und Jugendbereich.<br />
Bei einer Privatisierung von Sparkassen blieben die regionale Wirtschaft, die Kunden, das<br />
bürgerschaftliche Leben, viele Vereine und gemeinnützige Initiativen, die ohne das große<br />
finanzielle Engagement der Sparkassen nicht mehr existieren könnten, auf der Strecke. Mit<br />
einem Wegfall des Geschäftsstellennetzes einhergehen würde ein massiver Abbau von<br />
Arbeitsplätzen. Gerade die Verankerung in der Fläche ist aber für die Versorgung weiter Teile<br />
der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen unabdingbar.<br />
Beispiel Wohnungswirtschaft<br />
Die Wohnung gehört wie Nahrung und Kleidung zu den Grundbedürfnissen des Menschen. In<br />
der öffentlichen Daseinsvorsorge spielt sie daher eine besondere Rolle. Der Staat muss<br />
bezahlbaren Wohnraum vorhalten, um allen Bevölkerungsteilen ein menschenwürdiges Leben<br />
mit Rückzugsmöglichkeit in eigene Räume zu ermöglichen. Das gilt umso mehr in Gebieten, in<br />
84
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
denen der private Wohnungsmarkt ein adäquates Angebot für alle Einkommensgruppen nicht<br />
zur Verfügung stellt.<br />
Durch sozialen Wohnungsbau kann die öffentliche Hand zudem ihren Gestaltungsauftrag<br />
erfüllen und den Anforderungen besonderer Lebenslagengerecht werden, indem sie etwa<br />
barrierefreie Wohnungen oder auch preiswerten Wohnraum für Auszubildende und<br />
Studierende schafft.<br />
Von 1949 bis Ende 2006 stellte dazu der Bund auf Grundlage des Art. 104a Abs. 4 GG i.V.m.<br />
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) den Ländern Finanzhilfen in wechselnder Höhe zur<br />
Verfügung. Im Zuge der Föderalismusreform I ist die soziale Wohnraumförderung in die<br />
Gesetzgebungskompetenz der Länder übergegangen. Für die Jahre 2007 bis 2013 zahlt der<br />
Bund noch jährlich ca. € 518 Mio. Kompensationsleistungen an die Länder, danach soll die<br />
Notwendigkeit dieser Transferleistungen überprüft werden.<br />
Soziale Wohnungsbaubestände wurden in den letzten Jahren in Ländern und Kommunen im<br />
großen Stil veräußert - zumindest dieser Trend ist ungebrochen. Zu verlockend sind aus Sicht<br />
der Handelnden die hohen Einnahmen beim Verkauf kompletter Gesellschaften (sei es im<br />
Ganzen oder in Einzelteilen) an private Investoren, die auf einen Schlag den Haushalt aus den<br />
langjährigen Engpässen und Überschuldungen herausführen können.<br />
Doch so groß wie die Einnahmen sind die Gefahren der Veräußerung. Auch wenn die neuen<br />
Eigentümer kaufvertraglich häufig auf gewisse soziale Aspekte und Bindung an bestehende<br />
Vorgaben verpflichtet werden, liegt darin keine tragfähige Absicherung. Kein Investor kauft<br />
Wohnungsbestände und investiert in Sanierung und Modernisierung, wenn er sich keinen<br />
Gewinn erwartet. Tausende Mieterinnen und Mieter vormals in öffentlichem Eigentum<br />
stehender Wohnungen sehen daher in einem Kernbereich ihrer Lebensführung einer<br />
ungewissen Zukunft entgegen. Ebenso unklar ist, mit welchen Mitteln Länder und Kommunen,<br />
die ihre Bestände verschleudert haben, die ihnen obliegenden Gestaltungsaufträge erfüllen<br />
sollen.<br />
Wir sagen: Die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraumes für alle gehört zu den Aufgaben des<br />
Staates! Nur wenn die öffentliche Hand selbst über Bestände verfügt, kann er wirklichen<br />
sozialen Wohnungsbau betreiben und zugleich andere Aufgaben zur Gestaltung<br />
gesellschaftlichen Zusammenlebens erfüllen. Nicht zuletzt ist die öffentliche Hand als Inhaber<br />
von Wohnungsgesellschaften Auftraggeber für die Bauwirtschaft und kann damit<br />
entscheidende wirtschaftliche Impulse gerade auf kommunaler und regionaler Ebene setzen.<br />
85
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Beispiel ÖPNV<br />
Nach dem Regionalisierungsgesetz ist „die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der<br />
Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr [...] eine Aufgabe der<br />
Daseinsvorsorge“. Bis auf das Landesgesetz zum ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern wird der<br />
Begriff der Daseinsvorsorge im Bezug auf den ÖPNV in allen Gesetzen der Bundesländer<br />
ausdrücklich genannt. In Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein<br />
gehört die Bereitstellung des ÖPNV jedoch (nur) zu den freiwilligen Aufgaben im Bereich der<br />
kommunalen Selbstverwaltung.<br />
Am ÖPNV zeigt sich deutlich der Wandel vom Leistungs- zum Gewährleistungsstaat. Der ÖPNV<br />
wird zwar häufig noch als kommunaler Eigenbetrieb organisiert, doch vielerorts bestellt die<br />
Kommune bereits nur noch eine Leistung wie den ÖPNV, und ein privates Unternehmen<br />
erbringt dann diese. Der ÖPNV arbeitet zu ca. 70 % kostendeckend, im ländlichen Raum ist<br />
dieser Prozentsatz jedoch noch weitaus geringer. Insbesondere private Anbieter sehen sich<br />
häufig vor der Aufgabe, dem Anspruch, hohe Gewinne zu erwirtschaften, und gleichzeitig ihren<br />
am Gemeinwohl orientierten Aufgaben, wie dem Ausbau und der Wartung von Schienen und<br />
Verkehrswegen, gerecht zu werden. Dieses Spannungsverhältnis wird häufig zu Lasten der<br />
Fahrgäste gelöst - vor allem durch steigende Tarife; Kosten werden zudem durch ein dünneres<br />
Streckennetz und schlechtere Taktungen gespart.<br />
Doch auch Kommunen sparen mit dem Argument der leeren Kassen immer mehr ein. Hinzu<br />
kommt der Druck von der EU-Ebene, die eine größere Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV<br />
verlangt. Bisher wurde die Eigenwirtschaftlichkeit in gewissen Maßen durch eine interne<br />
Querfinanzierung gewährleistet. Die Einnahmen aus stark frequentierten Linien und Strecken<br />
wurden mit den Defiziten aus weniger stark frequentierten Linien und Strecken verrechnet.<br />
Vielfach halfen Verkehrbetrieben, die Teil der örtlichen Stadtwerke sind, auch die Gewinne der<br />
anderen Sparten (Gas, Wasser, etc.).<br />
Durch die EU-Rechtsprechung und die Liberalisierung des Energiesektors der vergangenen<br />
Jahre ist in diesen Bereich Bewegung gekommen. Denn zum einen standen bzw. stehen die<br />
Stadtwerke unter einem enormen Privatisierungsdruck, zum anderen zwangen Urteile des<br />
EuGH die Kommunen dazu, darüber nachzudenken, ob eine Ausschreibung ihrer einzelnen<br />
Strecken geboten sein würde, was dazu geführt hätte, dass attraktive Strecken mit<br />
Gewinnmöglichkeit an Private Anbieter gegangen wären und die unattraktiven durch die<br />
vormals kommunalen Betriebe hätten bestückt werden müssen. Auf Grund der Option<br />
kurzfristiger Mehreinnahmen werden jedoch genau diese gewinnbringenden Strecken<br />
vermehrt an private Unternehmen verkauft.<br />
86
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wir <strong>Jusos</strong> begrüßen daher die Tendenz auf europäischer Ebene, bei der Ausschreibung von<br />
Strecken, das sogenannte „bundling“ zuzulassen, also die Verknüpfung von attraktiven und<br />
weniger attraktiven Linien bei der Vergabe. Zudem ist eine Kommune nach europäischem<br />
Recht berechtigt, bei Ausschreibungen bestimmte Standards festzuschreiben (tarifliche<br />
Entlohnung, Umweltstandards in Bussen, etc.). Damit erhält sich die Kommune zumindest den<br />
Einfluss auf die Bedingungen der Leistungserbringung. Zum Teil werden private Mitbieter<br />
dadurch sogar ausgeschaltet, weil dies die Attraktivität der Übernahme schmälert.<br />
Auch bei der Organisation von ÖPNV in kommunaler Verantwortung gilt aber für uns:<br />
Eigenwirtschaftlichkeit ist nicht das entscheidende Kriterium! Weder müssen<br />
Beförderungsentgelte so hoch sein, dass sie kostendeckend sind, noch dürfen wenig<br />
gewinnbringende Strecken und Linien eingespart werden. Zentrales Ziel ist Mobilität für alle,<br />
zu erschwinglichen Preisen.<br />
Die <strong>Jusos</strong> lehnen Privatisierungen von kulturellen Einrichtungen ab. Mit dem Argument<br />
„leerer“ Kassen und stak belasteter Haushalte werden die Ausgaben für Kultur stets immer<br />
wieder diskutiert und in Frage gestellt und in Folge dessen häufig stark gekürzt. Kulturelle<br />
Einrichtungen und ihre Angebote wie Theater, Museen und Opern müssen allen Menschen,<br />
unabhängig vom Einkommen, gleich gut zugänglich sein. Privatisierungen führen zu der<br />
Übertragung von Marktmechanismen auf kulturelle Angebote und einer damit<br />
einhergehenden Ausrichtung auf das „zahlungskräftige Publikum“. Die Kulturlandschaft der<br />
Verwertungslogik des Marktes ausgeliefert werden. Kulturelle Angebote sind keine Ware mit<br />
einem „Marktwert“. Über die öffentliche Hand muss sichergestellt werden, dass jedem und<br />
jeder der Zugang zu einem flächendeckendem, qualitativ hochwertigem, verlässlichen,<br />
vielfältigen und bezahlbaren Kulturangebot ermöglicht wird. Neben dem finanziellen Aspekt<br />
wird der Zugang zu Kultur häufig durch eine subjektive Hemmschwelle erschwert. Breite<br />
kulturelle Bildung, beispielsweise durch Schulen, und eine Auswahl an möglichst<br />
niedrigschwelligen Kulturangeboten können hier Abhilfe schaffen. Wie im „Hamburger<br />
Programm“ formuliert, stehen wir weiterhin für eine deutliche Förderung von kulturellen<br />
Aktivitäten und Angeboten ein. Professionelle Arbeit, aber auch Engagement von Laien im<br />
kulturellen Bereich müssen unterstützt und gefördert werden. Dazu gehören sowohl ideelle als<br />
auch finanzielle Hilfeleistungen.<br />
Was wir gegen Privatisierung haben - den Gegentrend stärken<br />
Der Glaube der Menschen daran, dass Privatisierung und Wettbewerb zugleich weniger<br />
Bürokratie und günstigere Preise bedeuten, ist weitgehend aufgebraucht. Die Versprechungen<br />
der Privatisierer haben sich nicht erfüllt, stattdessen sind für den Staat die<br />
87
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Handlungsspielräume enger, für die Menschen die Preise vielfach höher und für die<br />
Beschäftigten die Arbeitsbedingungen schlechter geworden. Beschäftigte privater Betriebe, die<br />
vormals öffentliche Aufgaben übernehmen, erhalten regelmäßig weniger Lohn als Beschäftigte<br />
im öffentlichen Dienst, wie die jüngste Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation belegt.<br />
Privatisierte Bereiche sind zudem häufig demokratiefreie Räume.<br />
Deshalb lehnen wir die Privatisierungswellen der letzten Jahre in Bund, Ländern und<br />
Kommunen ab. Aufgaben und Güter der Daseinsvorsorge gehören in öffentliche<br />
Verantwortung, unter demokratische Kontrolle und müssen am Gemeinwohl orientiert sein. So<br />
können wirtschaftliche Prozesse gesteuert, neue Felder erschlossen und Innovationen<br />
gefördert werden. Marktkräfte allein können nicht die notwendigen Dienstleistungen und den<br />
Zugang zu ihnen sicherstellen. Deshalb muss der Staat auf allen Ebenen an der Bereitstellung,<br />
Regulierung, Organisation, Finanzierung und Förderung solcher Dienstleistungen stark<br />
beteiligt sein.<br />
Wir stellen uns der Devise des Privat vor Staat entgegen, denn wir wollen die elementaren<br />
Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Selbstbestimmung des Einzelnen<br />
nicht dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen. Wir wollen Handlungs- und<br />
Gestaltungsspielräume zurückgewinnen, weil sich nur Reiche einen schwachen Staat leisten<br />
können.<br />
Das Interesse, der Bedarf und die Akzeptanz öffentlicher Aufgaben wächst. Zudem hat sich die<br />
Erkenntnis, dass die entscheidenden Impulse für Innovation und industriellen Umbau nicht nur<br />
vom Markt ausgehen, in manchen Bereichen schon durchgesetzt: Eine neue ökologische<br />
Industriepolitik ist nicht denkbar ohne die Langfristorientierung durch Staat und eine stärkere<br />
Gewichtung öffentlicher Träger.<br />
Deshalb sind wir überzeugt: Die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen ist<br />
eine der zentralen Aufgaben des Staates, um Chancengleichheit zu verwirklichen. Dabei<br />
umfasst die Öffentliche Daseinsvorsorge diejenigen Bereiche, in denen Marktversagen<br />
behoben werden muss. Sie dient damit als Instrument, um kapitalistische Verwerfungen<br />
zumindest teilweise auszugleichen.<br />
Öffentliche Daseinsvorsorge muss sich daher an folgenden Kriterien orientieren:<br />
• gleichberechtigter, diskriminierungsfreier Zugang aller Bürgerinnen und Bürger,<br />
• flächendeckendes, an qualitativen Standards orientiertes, dauerhaftes und<br />
verlässliches Angebot zu angemessenen Preisen,<br />
• demokratische Kontrolle und öffentliche Verantwortung.<br />
Um öffentliche Daseinsvorsorge zu stärken, braucht es Alternativen zur Privatisierung:<br />
88
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wir rekommunalisieren die Daseinsvorsorge!<br />
Die Beispiele aus Städten und Gemeinden können Schule machen. Das System der<br />
Haushaltsführung eröffnet neue Handlungsoptionen, weil zurückgekaufte Einrichtungen als<br />
Vermögenswerte bilanziert werden. Theoretisch muss dies sogar den Rückkauf durch<br />
Darlehensaufnahme ermöglichen. Rekommunalisierte Betriebe garantieren den Gemeinden<br />
fließende Einnahmen, neue Gestaltungsräume und demokratischen Einfluss. Zugleich liegt<br />
darin der erste Schritt, Monopole dezentral aufzubrechen.<br />
Eine Rekommunalisierung der Daseinsvorsorge bedarf aber auch einer Stärkung der<br />
kommunalen Finanzen. Hierdurch können kommunale Handlungsspielräume wieder<br />
zurückgewonnen und neu erschlossen werden<br />
Wir wollen einen Staat als Pionier!<br />
Die makroökonomische Bedeutung der wirtschaftlichen Betätigung des Staates (insbesondere<br />
der Kommunen) ist groß: Sie ist ein Mittel der Investivpolitik, sie fördert Wertschöpfung und<br />
entfaltet Beschäftigungswirkung. Neue Felder im Bereich ökologischer, sozialer und kultureller<br />
Dienstleistungen zu erschließen, stärkt den Staat in seiner Pionierrolle und ist das Mittel, einer<br />
ge-winnorientierten Kurzfristperspektive eine langfristige Perspektive des qualitativen<br />
Wachstums entgegen zu setzen und zugleich Innovationsmotor zu sein.<br />
Wir stärken die Daseinsvorsorge in Europa!<br />
Die Auseinandersetzung um den Begriff der Öffentlichen Daseinsvorsorge ist für den<br />
europäischen Kontext vor allem im Hinblick auf die Wettbewerbsordnung zentral. Die Frage,<br />
was "Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" sind, wird auch auf dieser Ebene geführt.<br />
Das Europäische Parlament fordert seit langem Rechtssicherheit in diesem Punkt, um vor allem<br />
Kommunen ihr Handeln zu erleichtern. Um den grundlegenden Anforderungen und Kriterien<br />
an öffentliche Daseinsvorsorge zu genügen, setzt sich die Fraktion der SPE für eine<br />
größtmögliche Vielfalt bei der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen auf kommunaler<br />
Ebene ein. Definition, Organisation und Ausgestattung der öffentlichen Daseinsvorsorge soll<br />
den Mitgliedstaaten vorbehalten bleiben.<br />
Wir fordern ein besseres Vergaberecht!<br />
Die Ausschreibungspflicht bestimmter Aufgaben ist geltendes Recht. Wenn der Staat Aufträge<br />
vergibt, muss er nicht zugleich auch ihre Vorstellungen von Standards und die Kontrolle<br />
darüber aus der Hand geben. Die Vergabe von Aufgaben kann die öffentliche Hand an die<br />
Erfüllung von ökologischen und sozialen Standards, an eine bestimmte Entlohnung und die<br />
Gleichstellung der Geschlechter knüpfen. Dafür müssen die notwendigen bundes- und<br />
landesrechtlichen Normen erlassen werden. Das europäische Vergaberecht ermöglicht dies seit<br />
langem, es wird Zeit, dass das deutsche Vergaberecht nachzieht!<br />
89
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wir denken in Alternativen!<br />
Daseinsvorsorge muss nicht notwendigerweise unter direkter Beteiligung des Staates erbracht<br />
werden. Diese Vorstellung widerspräche unserem Verständnis von Staat, der nicht per se das<br />
Gute tut. Zudem übernimmt bereits jetzt der sogenannte intermediäre Sektor einen großen<br />
Teil der öffentlichen Aufgaben. Insbesondere im Bereich der sozialen Dienste, der<br />
Gesundheitswirtschaft und der Betreuung bieten Kirchen, Wohlfahrtsverbände,<br />
Selbsthilfegruppen und Initiativen Leistungen an. Sie sind überwiegend nicht gewinnorientiert<br />
und auf staatliche Förderung finanziell und strukturell angewiesen. Wir <strong>Jusos</strong> wissen, dass hier<br />
wichtige Aufgaben verantwortlich übernommen werden. Aus unserer Sicht stellt dies einen<br />
positiven Aspekt des Subsidiaritätsprinzips dar, weil gerade in kleineren Einheiten viel<br />
Innovationspotenzial steckt. Kleine Einheiten können dem einzelnen Menschen und daher<br />
unserer Vorstellung von der Möglichkeit pluraler Lebensentwürfe häufig besser gerecht<br />
werden. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn dieser Bereich nicht der demokratischen<br />
Regulierung und Kontrolle entzogen und die Finanzierung auch aus öffentlichen Mitteln<br />
gesichert ist.<br />
<strong>Jusos</strong> denken weiter: Für uns sind auch neue Formen von Gemeinwirtschaft als zusätzliche<br />
Alternative zur öffentlicher Daseinsvorsorge und privater Organisation denkbar. Die<br />
Demokratisierung aller Lebensbereiche schließt auch eine Ausweitung von Selbstverwaltung<br />
durch ArbeitnehmerInnen, VerbraucherInnen und KundInnen mit ein.<br />
Die Stimmung kippt! In Bund, Ländern und Gemeinden gibt es immer dann, wenn es konkret<br />
wird, deutliche Mehrheiten gegen Privatisierungsvorhaben. Kommunalpolitiker fordern ein<br />
stärkeres Gewicht der kommunalen Daseinsvorsorge - und handeln entsprechend. Auf<br />
europäischer Ebene geht die Auseinandersetzung um die Dienstleistungen von allgemeinem<br />
Interesse weiter und wird von der SPE-Fraktion im Europäischen Parlament im Sinne einer<br />
Stärkung geführt. Wir <strong>Jusos</strong> stellen uns an die Seite derjenigen, die Privatisierung erkannt<br />
haben als Mittel von gestern, das zum Gestaltungstod von morgen führt. "Privatisierung is'<br />
nicht" - diese Botschaft gehört auch in künftige Wahlprogramme der SPD.<br />
90
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
D 2 - Bundesvorstand<br />
Falsche Weichenstellung bei der Bahn<br />
I.<br />
Die Bundesregierung hat beschlossen, angesichts der Finanzmarktkrise den ursprünglich für<br />
den 27. Oktober 2008 geplanten Börsengang der Deutschen Bahn AG zu verschieben. Wir <strong>Jusos</strong><br />
begrüßen, dass die Bahn jetzt nicht weit unter Wert verschleudert werden soll. Eine<br />
Verschiebung alleine reicht aber nicht: Wir <strong>Jusos</strong> halten die Kapitalprivatisierung der Bahn für<br />
einen politischen Fehler – der Börsengang muss endgültig abgesagt werden! Wir werden die<br />
nun gewonnene Zeit nutzen, um gemeinsam mit unseren Bündnispartnern die<br />
Bahnprivatisierung doch noch zu verhindern.<br />
Schon der auf dem Hamburger Bundesparteitag gefundene Kompromiss war (im Nachhinein<br />
gesehen) eine strategische Fehlentscheidung. Der Kompromiss, Teile der Bahn mit<br />
stimmrechtlosen Vorzugsaktien (so genannte „Volksaktien“) zu veräußern, wurde von den<br />
PrivatisiererInnen in unserer Partei nie akzeptiert.<br />
Das nun vom Parteirat beschlossene und von Bahn und Bundesregierung umgesetzte<br />
Privatisierungsmodell entspricht dem vom Bundesfinanzministerium nur wenige Tage nach<br />
dem Hamburger Parteitag präsentierten Holdingmodell. Es erfüllt nicht einmal die vier<br />
zentralen Kriterien des Parteitagsbeschlusses: Private Investoren werden deutlichen Einfluss<br />
auf die Unternehmenspolitik der Bahn erhalten, es werden ausschließlich Stammaktien mit<br />
Stimmrecht ausgegeben, der Erhalt des integrierten Konzerns ist nicht gewährleistet und die<br />
Infrastruktur wird nicht in Bundeseigentum überführt, sondern wird Eigentum der Deutschen<br />
Bahn AG sein.<br />
Verkehrspolitisch gibt es keine stichhaltigen Argumente, die für eine Kapitalprivatisierung<br />
sprechen. Schon jetzt zeigen sich in der Unternehmenspolitik der Deutschen Bahn AG die<br />
Auswirkungen des anstehenden Börsengangs. Dies zeigt sich daran, dass die Bahn seit Jahren<br />
ihr Steckennetz ausdünnt, dass sie in den letzten fünf Jahren trotz Milliardengewinne sechs<br />
Preiserhöhungen durchgeführt hat und laufend ihren Service verschlechtert. Die jüngsten<br />
Ankündigungen zur Preiserhöhung im kommenden Dezember sowie die Einführung einer<br />
Servicepauschale bei Bedienung am Schalter haben zu Recht Empörung ausgelöst.<br />
Das Verfahren war vor dem Hintergrund der innerparteilichen Demokratie nicht akzeptabel.<br />
Der Beschluss entsprach weder überwiegenden Meinung der Parteibasis noch der Mehrheit der<br />
Bevölkerung. Die SPD hat ihre Glaubwürdigkeit als eine Partei, die die öffentliche<br />
Daseinsvorsorge garantiert, verloren. Die SPD hat so leichtfertig ein inhaltliches<br />
Profilierungsthema vertan, das für die Sozialdemokratie im Parteienwettbewerb zum<br />
Alleinstellungsmerkmal hätte werden können. Die SPD wurde zur Partei, die gegen die<br />
91
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mehrheit ihrer Mitglieder und gegen die Mehrheit der Bevölkerung die Bahnprivatisierung<br />
durchsetzte.<br />
II.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> haben uns bereits beim Bundeskongress 2007 in Wolfsburg eindeutig ablehnend zur<br />
geplanten Kapitalprivatisierung der Deutschen Bahn AG positioniert. Mit unserer Kampagne<br />
„Bahnprivatisierung: Is’ nicht!“ haben wir versucht, die Bahnprivatisierung zu verhindern.<br />
Dieses Ziel haben wir offensichtlich nicht erreicht.<br />
Auch wenn wir unser politisches Ziel leider nicht erreicht haben, hatten wir mit der Kampagne<br />
auch Erfolge. Die Kampagne hat gezeigt, dass wir <strong>Jusos</strong> auch kurzfristig kampagnenfähig sind –<br />
und zwar bundesweit und auf allen Ebenen der Partei. Wir <strong>Jusos</strong> kämpften in zahlreichen<br />
Ortsvereinen und Unterbezirken, in fast allen Bezirks- und Landesverbänden und natürlich auf<br />
Bundesebene. Es gelang uns auf zahlreichen Landesparteitagen und in SPD-Landesvorständen,<br />
Beschlüsse gegen eine Privatisierung der Bahn durchzusetzen.<br />
Und wir haben nicht alleine gekämpft, sondern gemeinsam mit unseren BündnispartnerInnen<br />
im Bündnis „Bahn für Alle“. Die gemachten Erfahrungen bei der Zusammenarbeit in einem<br />
breiten Bündnis kann für weitere politische Auseinandersetzungen genutzt werden. Das<br />
Bündnis „Bahn für Alle“ war ein erfolgreiches Labor für den Austausch unterschiedlicher<br />
politischer Kulturen, das Auffinden neuer Kampagnenwege und der Schaffung neuer<br />
gesellschaftlicher Bündnisse. Zu wünschen wäre, dass diese Struktur die Zusammenarbeit<br />
sogenannter alter und neuer sozialer Bewegungen auch bei anderen politischen Themen<br />
stärkt.<br />
Neben diesen organisatorischen und bündnispolitischen Erfolgen konnten wir aber auch im<br />
Kampf gegen Privatisierungen Erfolge erzielen. Mit der Kampagne gegen die<br />
Bahnprivatisierung ist es gelungen, die PrivatisierungsbefürworterInnen in der<br />
Berichterstattung in die Defensive zu drängen. In den Medien wurde lange Zeit sehr<br />
wohlwollend und parteiisch über die Bahnprivatisierung berichtet. Im Laufe der Kampagne<br />
gelang es immer stärker, privatisierungskritische Argumente zu etablieren und die öffentliche<br />
Debatte mit Sachkenntnis und klaren Botschaften zu dominieren. Die noch vor kurzem<br />
dominante neoliberale Privatisierungsideologie hat so ihre Deutungshoheit verloren. Dies wird<br />
Folgen haben. Steigender Druck auf die Beschäftigten der Bahn, Preiserhöhungen und<br />
Einschränkungen des Schienenverkehrs werden in Zukunft mit der Bahnprivatisierung in<br />
Verbindung gebracht werden. Ein Prozess permanenter kollektiver Bewusstseinsbildung wurde<br />
so in Gang gesetzt, die Privatisierungsideologie in der öffentlichen Debatte zurückgedrängt.<br />
Das gibt Mut für die Abwehr weiterer Privatisierungsvorhaben und bei der Auseinandersetzung<br />
um die Rekommunalisierung von Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge.<br />
92
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
III.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> haben bis zum Schluss gegen die Bahnprivatisierung gekämpft. Doch mit gezielten<br />
Fehlinformationen, mit einer Vermischung von Sach- und Personalfragen gelang es den<br />
PrivatisierungsbefürworterInnen um Steinbrück und Hansen die Bahnprivatisierung und ihre<br />
Eigeninteressen innerparteilich durchzusetzen. Dieser politische Fehler lässt sich kurzfristig<br />
nicht korrigieren, der Börsengang von 24,9 Prozent der „ML AG“ lässt sich vorerst nicht mehr<br />
verhindern.<br />
Der Schienenverkehr ist und bleibt für uns <strong>Jusos</strong> unverzichtbarer Bestandteil der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge, seine Zukunft darf nicht den Renditeinteressen privater Investoren<br />
ausgeliefert werden. Deshalb haben wir folgende Forderungen:<br />
- Die Teilprivatisierung der Deutschen Bahn AG muss aufgrund aktueller Entwicklungen<br />
ausgesetzt werden. Bei einer Bahnprivatisierung im aktuellen Börsenumfeld drohen<br />
Mindereinnahmen in Milliardenhöhe. Die Zeit der Aussetzung muss genutzt werden, um<br />
nochmals grundsätzlich über die Bahnprivatisierung zu diskutieren.<br />
- Wenn sich der Börsengang in dieser Wahlperiode trotz unseres Widerstandes nicht<br />
verhindern lässt, dann muss die SPD eine über 24,9 Prozent hinausgehende<br />
Privatisierung verhindern. Dazu fordern wir <strong>Jusos</strong> eine klare und eindeutige Festlegung<br />
im Bundestagswahlprogramm und im Falle einer erneuten Regierungsbeteiligung im<br />
nächsten Koalitionsvertrag. Wir <strong>Jusos</strong> stehen weiterhin für eine Bahn im vollständigen<br />
öffentlichen Eigentum.<br />
- Der Bund muss endlich seine Aufgabe als (Mehrheits-) Eigentümer der Bahn ernsthaft<br />
wahrnehmen und seine Interessen – und die Interessen der Allgemeinheit – gegenüber<br />
der Deutschen Bahn AG und ihrem Management durchsetzen. Dazu müssen auch die<br />
Aufsichtsratsmandate mit geeigneten Personen besetzt werden.<br />
- Die Bahnprivatisierung darf nicht grundlegende Vertretungsrechte der<br />
ArbeitnehmerInnen aushebeln. Vor einem Börsengang muss sichergestellt sein, dass die<br />
bisher geltende 50-Prozent-Beteiligung von ArbeitnehmerInnenvertreterInnen im<br />
Aufsichtsrat nicht nur für die rund 2.500 Beschäftigte der DB ML gilt, sondern auch für die<br />
115.000 Beschäftigte in den Tochterunternehmen der DB ML.<br />
- Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung muss transparent und öffentlich gemacht<br />
werden. Da die Bundesregierung in der Vergangenheit oft genug gezeigt hat, dass sie<br />
nicht willens (bzw. nicht in der Lage ist), die Bahn zu steuern, sollte der Bundestag über<br />
diese Vereinbarungen entscheiden.<br />
93
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
- Spätestens wenn private Investoren bei der Bahn einsteigen, muss der<br />
Schienenfernverkehr politisch reguliert werden. Keine Region darf vom Fernverkehr<br />
abgekoppelt werden.<br />
94
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
E<br />
Europa<br />
E 1 – Bundesvorstand<br />
Europa verändern – Die Alternative heißt<br />
soziale Gerechtigkeit<br />
I. Wie steht es um Europa vor der Wahl?<br />
Am 7. Juni 2009 findet zum siebten Mal die Direktwahl des Europäischen Parlamentes statt. In<br />
2009 sind erstmals die Bürgerinnen und Bürger aller 27 EU Mitgliedsstaaten aufgerufen das<br />
neue Parlament zu wählen - so viele waren es noch nie. Blickt man zurück auf die Geschichte<br />
Europas ist dies ein historischer Moment. Nachdem hunderte Jahre Krieg, Vertreibung und<br />
Zerstörung das Leben auf dem europäischen Kontinent prägten, tragen die Mitgliedstaaten der<br />
EU heute ihre Konflikte untereinander friedlich aus. Dennoch steht Europa vor großen<br />
Herausforderungen. Die gescheiterten Referenden in Frankreich, den Niederlanden und zuletzt<br />
in Irland sind Ausdruck einer länger anhaltenden Vertrauenskrise der Bürgerinnen und Bürger<br />
in das europäische Projekt. Dies zeigt auch die geringe Wahlbeteiligung bei den Europawahlen.<br />
Zwar hätte der Vertrag von Lissabon zu mehr Demokratie und mehr Macht für das Europäische<br />
Parlament geführt. Er wird aber vor der Europawahl nicht mehr in Kraft treten. Deswegen mag<br />
Europa zwar in der Krise sein, aber ein Ende des europäischen Projektes ist das noch nicht. Auch<br />
ohne Lissabon hat Europa eine Zukunft!<br />
Den europäischen Parteien ist es bisher nicht gelungen in europapolitischen Themen zu<br />
polarisieren und die unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft Europas hervorzuheben.<br />
Gab es Ende des letzten Jahrzehnts noch eine linke Mehrheit unter den Regierungen der<br />
Mitgliedsstaaten der EU und im Europäischen Parlament ist diese hin zu einer übermächtigen<br />
Mehrheit der Konservativen und neo-liberalen Kräfte gekippt. Auch wenn bisher selbst mit<br />
einer linken Mehrheit Projekte wie das Soziale Europa nicht entschlossen genug angegangen<br />
wurden, ist dies unter den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen unmöglich geworden. Daher<br />
brauchen wir wieder eine linke Mehrheit im Europäischen Parlament, um ein anderes Europa<br />
zu schaffen. Dies geht nur mit einer starken Sozialdemokratischen Partei Europas der SPE. Wir<br />
wollen diese Partei zur Mitgliederpartei ausbauen und ein klares linkes Profil für diese Partei<br />
entwickeln und mit einem gemeinsamen Wahlprogramm zur Europawahl antreten. Wir<br />
95
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
verstehen die Europawahl als Chance verlorenes Vertrauen in Europa und in die SPD und die<br />
SPE zurück zu gewinnen. Die Europawahl ist daher eine Chance verlorenes Vertrauen in Europa<br />
und in die SPD zurück zu gewinnen.<br />
Gründe für die Vertrauenskrise<br />
Die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger ist derzeit, dass Europa nur der<br />
wirtschaftlichen Integration seiner 27 Mitgliedsstaaten dient. Politische Integration mit einem<br />
wirklichen demokratischen Anspruch oder gar soziale Integration fehlt bisweilen nahezu<br />
vollständig. Angesichts eines weiteren Auseinanderdriftens von Arm und Reich, zunehmend<br />
prekären Beschäftigungsverhältnissen und Massenarbeitslosigkeit verlieren die Menschen das<br />
Vertrauen in dieses Europa. Sie halten aber nicht die europäische Idee an sich für falsch,<br />
sondern die derzeitige Politik der EU.<br />
Beschäftigung und Wachstum nehmen zu, trotzdem geht es vielen Menschen schlechter. Die<br />
Jobs die geschaffen werden, sind häufig prekäre Beschäftigungsverhältnisse. D.h. es wird ein<br />
Lohn gezahlt, der nicht zum Leben reicht, die Verträge sind befristet oder es ist ein<br />
Leiharbeitsverhältnis. Dies ist wahrlich kein Problem, das auf Deutschland begrenzt ist. Es ist<br />
längst in allen anderen EU Mitgliedsstaaten zu einer Realität geworden. Insbesondere junge<br />
Menschen sind davon betroffen.<br />
Zur gleichen Zeit stehen in der EU Liberalisierung und Marktfreiheiten immer noch an erster<br />
Stelle der politischen Agenda. Die Dienstleistungsrichtlinie ist ein Beispiel dafür. Der Handel<br />
mit Dienstleistungen führt dazu, dass die öffentliche Daseinsvorsorge unter Privatisierungsund<br />
Liberalisierungsdruck gerät. Die Auswirkungen sind vor allem auf kommunaler Ebene zu<br />
spüren. Eine klare Definition für Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und die<br />
Ausklammerung dieser aus der Dienstleistungsfreiheit fehlen nach wie vor in der EU.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> wollen uns mit den Verhältnissen nicht zufrieden geben und kämpfen unter dem<br />
Motto „die Alternative heißt soziale Gerechtigkeit“ an der Seite der SPD für ein anderes, ein<br />
sozialeres Europa. Wir sind uns der Herausforderung bewusst im Superwahljahr 2009 mit<br />
vielen Landtags-, Kommunal- und schließlich der Bundestagswahl einen Europawahlkampf zu<br />
bestreiten. Dies bietet aber auch eine Chance das Thema Soziale Gerechtigkeit nicht nur als<br />
96
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
lokales oder nationales Thema zu sehen, sondern diese Idee zu europäisieren. Gemeinsam<br />
wollen wir daher bis zum 7. Juni 2009 und darüber hinaus für ein Europa kämpfen, das die<br />
folgenden Bedingungen erfüllt:<br />
‐ Wir wollen ein soziales und demokratisches Europa, das Mindestbedingungen im<br />
Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrecht, sowie Mindestsozialstandards garantieren<br />
kann und Finanzmärkte effektiv reguliert!<br />
‐ Wir wollen ein Europa des Friedens, das den ersten Schritt ergreift und Abrüstung<br />
umsetzt.<br />
‐ Wir wollen in keiner Festung Europa mehr leben, ein Grundrecht auf Asyl in ganz<br />
Europa und eine gerechte und multilaterale Handelspolitik!<br />
II.<br />
Wir wollen ein soziales Europa<br />
Vorfahrt für soziale Themen!<br />
In der derzeitigen europäischen Politik herrscht eine Art Vorfahrt für mehr Marktfreiheit,<br />
Deregulierung und Privatisierung vor. Diese Logik muss durchbrochen und um eine Regelung<br />
für eine gleichberechtigte Vorfahrt für soziale Themen ergänzt werden. Somit müssen alle<br />
politischen Entscheidungen aller EU Institutionen daraufhin überprüft werden, ob sie zum<br />
Abbau von Arbeitslosigkeit, zur sozialen Integration und anderen sozialen Fortschritten<br />
beitragen können. Dies wird ergänzt durch eine Pflicht für eine sozialpolitische<br />
Folgeabschätzung für neue Gesetzesvorhaben der EU. Nur durch eine grundsätzliche<br />
Neuorientierung der EU Politik wird es gelingen ein soziales Europa zu verwirklichen. Wir<br />
fordern daher die Aufnahme einer solchen Sozialklausel in den EU Vertrag!<br />
Mehr und bessere Jobs für Europa sowie eine effektive Regulierung der<br />
Finanzmärkte!<br />
Wir brauchen mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa durch Investitionen in Bildung<br />
und Ausbildung. Dafür ist zunächst aber eine stabile gesamtwirtschaftliche Lage notwendig.<br />
97
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die globale Finanzmarktkrise, die zuletzt durch den teilweisen Zusammenbruch des US<br />
Immobilienmarktes ausgelöst wurde, hat allen vor Augen geführt wie schnell durch<br />
internationale Verflechtung auch in Europa Arbeitsplätze und Einkommen in Gefahr geraten.<br />
Daher ist es notwendig ein stabiles staatlich reguliertes Finanz- und Bankensystems zu haben.<br />
Europa muss sich darüber hinaus auch global für eine effektivere Regulierung der<br />
Finanzmärkte und Finanzmarktinstrumente einsetzen. Gesamtwirtschaftliche Stabilität heißt<br />
auch, dass auftretende Krisen möglichst schnell überwunden werden. Bei einem<br />
konjunkturellen Abschwung ist es daher wichtig, dass der Staat ein Investitionsprogramm<br />
auflegt, um drohenden Arbeitsplatz- und Einkommensverlust zu verhindern. Hierzu bedarf es<br />
eines flexiblen Wachstums- und Stabilitätspaktes auf europäischer Ebene, der den<br />
Mitgliedsstaaten die Flexibilität gibt auch eine vergleichsweise hohe kurzfristige<br />
Neuverschuldungspolitik zu verfolgen. Diese Politik muss ergänzt werden durch ein Handeln<br />
der Europäischen Zentralbank, das sich nicht nur am Ziel der Preisstabilität, sondern auch an<br />
den Zielen eines hohen Wachstums und der Vollbeschäftigung orientiert. Wir fordern daher<br />
eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes für mehr fiskalische Flexibilität und eine<br />
Europäischen Zentralbank die auch dem Ziel der Vollbeschäftigung und des möglichst hohen,<br />
qualitativen Wachstums verpflichtet ist!<br />
Schaffung sozialer Mindeststandards in ganz Europa!<br />
Das „race to the bottom“ um möglichst niedrige Sozial- und Arbeitsbedingungen in Europa<br />
bringt etablierte Sozialsysteme in Europa zunehmend unter Druck. Verstärkt wird diese<br />
Tendenz durch eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, der diesen Wettbewerb<br />
noch weiter anheizt, als begrenzt. Somit sind beispielsweise Tariftreueklauseln in öffentlichen<br />
Vergabegesetzen nichtig, wenn sie die Dienstleistungsfreiheit in Europa behindern. Einer<br />
solchen Entwicklung muss Einhalt geboten werden durch die Schaffung sozialer<br />
Mindestnormen. Daher fordern wir die Einführung eines europäischen Mindestlohns, der sich<br />
am jeweiligen nationalen Durchschnittslohn orientiert. Wir fordern darüber hinaus die<br />
Einhaltung einer Höchstarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche in ganz Europa ohne so<br />
genannte „opt-out“ Klausel, die es einigen Mitgliedsstaaten erlaubt auch höhere Arbeitszeiten<br />
gesetzlich zuzulassen. Durch eine Obergrenze von 40 Stunden erhöht sich die Produktivität der<br />
ArbeitnehmerInnen. So werden sich die gesundheitliche Situation und die Arbeitsbedingungen<br />
für viele ArbeitnehmerInnen in Europa deutlich verbessern. Außerdem brauchen wir eine<br />
Mindestbesteuerung von Unternehmen in Europa. Dafür ist eine einheitlich<br />
Bemessungsgrundlage und ein Mindeststeuersatz nötig. Ein soziales Europa braucht die<br />
Einhaltung bestimmter sozialer Mindestbedingung!<br />
98
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Für ein demokratisches Europa und klare einklagbare Grundrechte<br />
Brüsseler Politik wird bisweilen als Bürokratie und top-down Politik wahrgenommen. Nach wie<br />
vor wird in der Kommission der Illusion eines unabhängig von parteipolitischen Positionen<br />
existierenden europäischen Allgemeininteresses angehangen. Europa muss daher mehr<br />
Demokratie wagen und in seinen vertraglichen Grundlagen fest verankern, sonst verliert es<br />
seine Legitimität. Das Parlament muss wie im Lissabonner Vertrag vorgesehen mehr<br />
Mitspracherecht und Entscheidungsrecht in Sachen Budget, Kommission und bei der<br />
Gesetzgebung erhalten. Um demokratische Mitbestimmung zu stärken, reicht jedoch die<br />
Stärkung des Parlaments nicht aus. Wir brauchen europäische einklagbare Grundrechte. Es<br />
muss erreicht werden, dass es einen verbindlich geschriebenen Grundrechtskatalog gibt. Nur<br />
so ist transparent und eindeutig bestimmt, auf welche Rechte die BürgerInnen sich berufen<br />
können. Die Grundrechte- Charta muss verbindlich werden und die Möglichkeit des<br />
Rechtsweges eröffnen. Wir <strong>Jusos</strong> sind überzeugt, dass ein soziales Europa auch ein<br />
demokratisches Europa sein muss!<br />
Mitbestimmung in Europa ausbauen!<br />
Ein Soziales Europa kann nur mit starken und handlungsfähigen Gewerkschaften verwirklicht<br />
werden. Dafür brauchen wir eine institutionelle Stärkung der Mitbestimmung und der<br />
Gewerkschaften in den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Ein Mindestniveau<br />
beim Streikrecht und die Gründungsfreiheit für Gewerkschaften müssen in allen EU Staaten<br />
eingehalten werden. Dies sind die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation<br />
ILO, die nach wie vor nicht allen 27 EU Staaten umgesetzt sind. In sogenannten europäischen<br />
Kapitalgesellschaften (SE) muss Mitbestimmung in Anlehnung an das deutsche Modell<br />
ermöglicht werden. Hinzukommt der Ausbau und die institutionelle Stärkung der<br />
Eurobetriebsräte EBR. Die entsprechenden europäischen Regelungen müssen dahin gehend<br />
überarbeitet werden. Sie müssen auch sicherstellen, dass transnationale<br />
Kollektivvereinbarungen rechtsverbindlich werden. Wir fordern daher mehr Mitbestimmung in<br />
transnationalen europäischen Unternehmen und Konzernen!<br />
Öffentliche Daseinsvorsorge erhalten und ausbauen!<br />
Auf allen politischen Ebenen erleben wir eine Zunahme von Privatisierungen ehemaliger<br />
öffentlicher Einrichtungen. Die Auswirkungen bekommt man vor allem auf der kommunalen<br />
Ebene zu spüren, wo Bäder geschlossen werden oder der Bus kaum noch zu bezahlen ist. Ein<br />
99
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Grund für die Zunahme der Privatisierungen ist die Politik der rechtliberalen Parteien in der<br />
Europäischen Union. Hier wird definiert, was so genannte „Dienstleistungen von öffentlichem<br />
Interesse“ sind. Dienstleistungen, die nicht „von öffentlichem Interesse sind“ unterliegen<br />
bestimmten Wettbewerbsregelungen. So darf der Staat bspw. diese Dienstleistungen nicht<br />
mehr alleine erbringen, sondern muss auch private Anbieter zu lassen. Dies erhöht in vielen<br />
Fällen den Privatisierungsdruck auf bestimmte Einrichtungen. Ist eine ehemalige öffentliche<br />
Institution erst einmal privatisiert, steigen schnell die Preise oder unrentable Einrichtungen<br />
werden geschlossen. Eine breite Definition der Dienstleistungen von öffentlichem Interesse ist<br />
daher nötig. Für uns <strong>Jusos</strong> gehören dazu neben der Versorgung mit Energie und Wasser und<br />
der Entsorgung von Abfall eine Verkehrsinfrastruktur einschließlich der Transportmittel, ein<br />
Gesundheitssystem und soziale Sicherung im Allgemeinen, Bildung, Wohnraum und<br />
Wohnungsbau, Bank- und Kreditwesen, Sport- und Kultureinrichtungen und weitere<br />
Dienstleistungen ökologischer und kultureller Art. Wir fordern die genannten Dienstleistungen<br />
als Dienstleistungen von öffentlichem Interesse zu definieren und diese vor Privatisierung<br />
europaweit zu schützen!<br />
Für eine bessere Gleichstellungspolitik in Europa!<br />
Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt nicht überall in Europa. Im Gegenteil noch<br />
immer sind es Frauen die systematisch weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Das<br />
gilt auch, wenn Mann und Frau dieselbe Arbeit verrichten. Dies ist umso erstaunlicher als, dass<br />
längst eine EU Gleichstellungsrichtlinie existiert, die das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit<br />
zum europäischen Standard macht. Dieser Standard wird jedoch nach wie vor unterlaufen. Es<br />
ist daher notwendig die Gleichstellungsrichtlinie in den EU Mitgliedsstaaten konsequenter<br />
umzusetzen. Dabei muss auf europäischer Ebene der Druck auf die Mitgliedstaaten erhöht<br />
werden, die bisher die Richtlinie nicht oder nur teilweise in nationales Recht umgewandelt<br />
haben. Darüber hinaus fordern wir die Einführung von Quoten von mindestens 40 % für die<br />
Führungsebene von großen Unternehmen. Nur wenige Frauen sitzen heute in den wenigen<br />
Führungspositionen europäischer Unternehmen. Das liegt nicht daran, dass Frauen für solche<br />
Jobs nicht qualifiziert sind, sondern weil sie systematisch an der Erlangung solcher Postionen<br />
gehindert werden. Eine solche Quotenregelung wurde bereits erfolgreich in Norwegen<br />
eingeführt. Ein soziales Europa muss die Gleichstellung der Geschlechter sicherstellen und die<br />
konsequente Umsetzung der Gleichstellungsrichtlinie in Europa verfolgen!<br />
Für eine EU Haushaltspolitik mit Zukunft<br />
100
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Noch immer übersteigen die EU-Ausgaben für Landwirtschaft die Investitionen in Bildung und<br />
Ausbildung um ein Vielfaches. Zur gleichen Zeit ist der Bedarf in der EU für Investitionen in die<br />
Infrastruktur (Strom, Mobilität, Daseinsvorsorge, soziale Sicherungssysteme, Bau von Schulen)<br />
vor allem in den neuen EU Mitgliedsstaaten deutlich gestiegen. Daher muss sich diese<br />
politische Schwerpunktsetzung in der EU Haushaltspolitik deutlich ändern! Um unserem Ziel<br />
der gleichwertigen Lebensverhältnisse in ganz Europa näher zu kommen und um Dumping zu<br />
verhindern sowie den Strukturwandel sozial zu gestalten ist einen Umwidmung der<br />
Agrarmittel in Strukturfördermittel nötig. Desweiteren müssen die bereitstehenden<br />
Forschungsmittel der EU erhöht werden und verstärkt in Zukunftstechnologien wie bspw.<br />
Technologien zur Gewinnung erneuerbarer Energien investiert werden. Gleichzeitig sollen die<br />
Mittel für Aus- und Weiterbildung erhöht werden. Wir <strong>Jusos</strong> fordern, dass die bisherigen<br />
Landwirtschaftsbeihilfen in großem Umfang zu Strukturfördermittel umgewidmet werden.<br />
III.<br />
Europa muss für Frieden stehen!<br />
Abrüstung muss im Zentrum der gemeinsamen Europäischen Außenpolitik<br />
stehen!<br />
In den letzten Jahren fand ein Politikwechsel statt, von einer immer nur versprochenen<br />
Abrüstung, hin zu einer offenen Aufrüstung. Der Rüstungswettlauf hat bereits begonnen.<br />
So planen die USA seit einigen Jahren an ein Raketenschild, das die Vereinigten Staaten vor<br />
Langstreckenraketen schützen soll. Dafür sollen Außenposten in Europa entstehen: In<br />
Tschechien soll ein Frühwarnsystem installiert werden; in Polen werden US-Abwehrraketen<br />
stationiert. Wir <strong>Jusos</strong> sagen nein zu einem US-Raketenschild und einem erneuten<br />
Rüstungswettlauf.<br />
Aber auch im Vertrag von Lissabon, dem letzten großen Versuch die EU zu reformieren, fand<br />
sich folgender Satz „Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten<br />
schrittweise zu verbessern.“. Schon eingerichtet wurde deshalb die Agentur für die Bereiche<br />
Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung und Rüstung. Alle ihre<br />
Ziele, nämlich Rüstungsforschung und Entwicklung effizienter zu gestalten, einen<br />
Europäischen Markt für Rüstungsgüter zu schaffen und durch eine langfristige Bedarfsplanung<br />
Rüstungsbestände zu optimieren, sorgen effektiv für eine Aufrüstung Europas. Wir brauchen<br />
keine Agentur für Rüstung, sondern ganz im Gegenteil wir fordern eine Agentur für Abrüstung.<br />
101
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
In der Rüstungsproduktion steht Europa mit an der Spitze: Deutschland, Großbritannien und<br />
Frankreich gehören zu den fünf größten Rüstungsnationen bei der Produktion von<br />
konventionellen Waffen. Die 34 größten Rüstungsfirmen Westeuropas verkauften 2006<br />
Rüstungsgüter im Wert von 92,1 Milliarden $. Allein der Umsatz den EADS 2006 mit dem<br />
Verkauf von Rüstungsgütern erzielte betrug 12,6 Mrd. $.<br />
Aber nicht nur in der Produktion ist Europa leider vorne mit dabei, sondern auch in der<br />
Aufrüstung. Im Jahr 2007 gaben die Europäer 370 Milliarden US Dollar für Rüstungsgüter aus.<br />
Auch hier belegt Europa nach den USA den zweiter Platz. Wir brauchen eine Politik die<br />
Abrüstung wirklich umsetzt. Wir brauchen eine strengere Kontrolle für Rüstungsgüter.<br />
Fast 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gibt es weltweit noch immer über 32.000<br />
atomare Sprengköpfe, über 900 Atomwaffen lagern in Europa. Aus den Folgen des ersten<br />
Abwurfs der Atombombe über Hiroshima am 6. August 1945 wurde nichts gelernt. Ungefähr 80<br />
Prozent der bis dahin unbeschädigten Stadt wurden zerstört und über 150.000 Menschen<br />
sofort getötet. Weitere 110.000 Menschen starben innerhalb weniger Wochen an den Folgen<br />
der radioaktiven Verstrahlung, zahlreiche weitere an Folgeschäden in den Jahren danach. Einen<br />
Atomkrieg kann niemand gewinnen. Den atomaren Erstschlag weiter als militärische<br />
Möglichkeit zu diskutieren, zeugt von Menschenverachtung. Wenn Europa glaubwürdig in<br />
Abrüstungsverhandlungen auftreten will, muss es den ersten Schritt machen. Es reicht nicht<br />
andere Staaten wie z.B. Nordkorea oder den Iran – vollkommen zu Recht - an den Pranger zu<br />
stellen.<br />
Europa muss ein Zeichen setzen und Atomwaffenfreie Zone werden. Keine Atomwaffen für<br />
niemanden!<br />
Friedliche Konfliktlösung nicht nur in Sonntagsreden<br />
Die Prävention von Konflikten wird immer mehr reduziert auf Gespräche und offizielle<br />
Tagungen und damit Stück für Stück in der Öffentlichkeit als wirkungslos und ineffektiv<br />
dargestellt. Prävention ist nicht Dialog, sondern soll Dialog ermöglichen. Prävention schafft ein<br />
Umfeld in dem es möglich ist Konflikte gewaltfrei zu lösen. Prävention bedeutet z.B.,<br />
internationale Gesetze zu schaffen und dieses auch mit Leben zu füllen, in dem sie eingehalten<br />
werden. Dazu muss die UN handlungsfähiger werden. Abrüstungsverträge müssen von allen<br />
Staaten eingehalten werden. Prävention bedeutet auch, dass eine gerechte<br />
102
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Weltwirtschaftsordnung angestrebt wird, von der alle Menschen profitieren. Dieses Ziel muss<br />
sich auch in der europäischen Außenpolitik- aber insbesondere bei entwicklungspolitischen<br />
Projekten wieder finden. Wir fordern hier einen Politikwechsel.<br />
Wir arbeiten an einem Europa das sich wirklich für friedliche Konfliktlösung einsetzt.<br />
IV.<br />
Wir wollen in keiner Festung Europa leben!<br />
Fluchtgründe bekämpfen<br />
Mit dem Thema Migration wird Angst geschürt. Migranten werden für Kriminalität und<br />
sozialen Abstieg verantwortlich gemacht. So werden oft die Migranten bekämpft und nicht die<br />
wirklichen Gründe für die Flucht. Wir arbeiten für ein Europa, das die Fluchtgründe bekämpft:<br />
Europa muss an einer gerechten Weltwirtschaftsordnung mitbauen. In der gemeinsamen<br />
Außenpolitik muss sich die EU für die Verankerung sozialer und ökologischer Standards<br />
weltweit einsetzen und Investitionen in die soziale Infrastruktur fördern. Das gilt für die<br />
Verhandlungen auf der Ebene der Welthandelsorganisation (WTO) genauso wie für die<br />
zwischenstaatlichen Abkommen, welche die EU im Zuge ihrer Partnerschaftspolitik abschließt.<br />
Ein wichtiger Baustein für mehr Gerechtigkeit weltweit ist die Frage von „Menschenwürdiger<br />
Arbeit“, die auch von europäischen Firmen im Ausland umgesetzt werden muss.<br />
Auch das Klima unserer Erde verändert sich und hat die fortschreitende Zerstörung unserer<br />
natürlichen Lebensgrundlagen zur Konsequenz. Diese Zerstörung wiederum führt immer<br />
offensichtlicher zu sozialer Ungerechtigkeit und einer Minderung der Überlebenschancen von<br />
großen Teilen der Weltbevölkerung. Somit ist zunehmende Umweltverschmutzung und<br />
Klimaveränderung ein immer wichtiger werdender Fluchtgrund. Um nur einige Auswirkungen<br />
aufzuzählen: die Wüste wächst und beraubt viele Menschen ihrer Lebensgrundlagen, viele<br />
Menschen haben keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser oder erkranken schwer an den<br />
Folgen von Smog. Die EU muss diese Probleme ernst nehmen und dafür Lösungen in ihrer<br />
Außenpolitik erarbeiten, z.B. durch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs oder<br />
alternativer Energiegewinnung weltweit. Wir fordern ein Europa, das Hunger, Armut<br />
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und die Zerstörung der Umwelt weltweit bekämpft.<br />
103
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wir wollen ein Ende der Festung Europa<br />
Die Grenzen Europas wurden zu einer Festung ausgebaut. Mit der Drittstaatenregelung kann<br />
die EU Flüchtlinge, die über ein angeblich sicheres Land in die EU einreisen, dorthin zurück<br />
abschieben. Als so genannte Drittstaaten gelten auch Libyen, Marokko oder Mauretanien. Mit<br />
dem Ziel möglichst viele Flüchtlinge davon abzuhalten Europa auch nur zu betreten, werden<br />
hier Länder zu sicheren Demokratien erklärt die keine sind, mit fatalen Folgen für die<br />
Flüchtlinge. Seit 2004 koordiniert die europäische Agentur Frontex die europäischen<br />
Außengrenzen. Flüchtlingsboote werden von Frontex schon im internationalen Gewässer<br />
aufgebracht und in afrikanische Küstenländer zurück verfrachtet.<br />
Dies sind nur zwei von vielen Beispielen wie die EU sich gegen Flüchtlinge abschottet. Diese<br />
Politik unterstützt vor allem die organisierte Kriminalität ohne deren Hilfe nur wenige es heute<br />
noch schaffen die EU überhaupt zu betreten. Diese Politik bekämpft die Flüchtlinge und nicht<br />
die Fluchtgründe. Diese Politik führt mit zu den tausenden von Toten an der Europäischen<br />
Grenze.<br />
Eine Gemeinschaft bestehend aus 27 Demokratien, die sich der Einhaltung der Menschenrechte<br />
verpflichtet hat, muss diese Werte auch an ihren Grenzen umsetzen. Wir brauchen sichere<br />
Wege in die EU für Flüchtlinge.<br />
Im Haager Programm hat sich die EU vorgenommen bis 2010 ein gemeinsames Asyl-System zu<br />
schaffen. Alle bisherigen Vorschläge in diesem Bereich zeigen deutlich, dass es nicht darum<br />
geht ein wirkliches Grundrecht auf Asyl zu verankern. Vielmehr steht im Vordergrund die Frage,<br />
wohin mit den Flüchtlingen, welches Land muss sie aufnehmen. Der Mittelpunkt des<br />
gemeinsamen EU-Asyl muss für uns ein anderer sein: eine sichere Möglichkeit nach Europa zu<br />
kommen für die verfolgten Menschen und ein faires Asylverfahren für alle. Wir kämpfen für ein<br />
europäisches Grundrecht auf Asyl.<br />
Die Würde des Menschen ist unantastbar und dennoch werden Flüchtlinge in vielen Fällen in<br />
Europa als Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie werden in Camps untergebracht, zu denen<br />
keine NGO und kein Rechtsanwalt Zugang hat (Italien), sie dürfen in vielen Fällen nicht mal<br />
entscheiden was sie essen wollen (Deutschland), oder landen in überfüllten<br />
Massenunterkünften die nicht die hygienischen Mindeststandards erfüllen. Dies steht im<br />
Gegensatz zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung die einen "Anspruch auf eine<br />
Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich<br />
104
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen Leistungen der<br />
sozialen Fürsorge gewährleistet" (Art. 25) einfordert.<br />
Wir fordern eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen. Eine gemeinsame<br />
europäische Flüchtlingspolitik muss hier Standards setzen.<br />
Die Frage nach der Nützlichkeit von Migranten wird innerhalb der EU zu oft unwidersprochen<br />
gestellt. So subventioniert die EU auf der einen Seite Anti- Einwanderungsspots in<br />
verschiedenen afrikanischen Ländern, die junge Auswanderungswillige davon abhalten sollen<br />
sich auf den Weg Richtung EU zu machen. Auf der anderen Seite wird an einer Blue Card für<br />
Höchstqualifizierte gearbeitet. Allerdings soll auch diese Card an einen Arbeitsplatz gebunden<br />
werden, bei längerer Arbeitslosigkeit droht die Abschiebung. Nur wer ein Gehalt bezieht, dass<br />
dreimal so hoch ist wie der Mindestlohn/der gültige Sozialhilfesatz soll eine Chance auf die<br />
Karte haben. Wir werden uns weiterhin gegen jede Debatte über die Nützlichkeit von<br />
Menschen stellen. Zuwanderung ausschließlich für Hochqualifizierte ist mit uns nicht zu<br />
machen.<br />
V. Unser Europa-Wahlkampf<br />
Wir <strong>Jusos</strong> führen einen eigenständigen Wahlkampf. Wir wollen deutlich machen, dass es<br />
soziale Alternativen zu der jetzigen Ausgestaltung Europas gibt. Mit den drei Themen „Soziales<br />
Europa“, „Europa des Friedens“ und „Keine Festung Europa“ kämpfen wir für bestimmte<br />
politische Projekte.<br />
Jenseits dieser konkreten Projekte setzen wir uns für die Vision der Vereinigten Staaten von<br />
Europa ein. Konkrete politische Projekte und Mut zur Vision - beides muss in unserem<br />
Wahlkampf deutlich werden. Wir führen unseren Wahlkampf in kritischer Solidarität mit der<br />
SPD. Zentral ist dabei, dass wir keinen Jubelwahlkampf machen werden, sondern einen<br />
inhaltlichen Jugendwahlkampf unter unserer Führung im Willy-Brandt-Haus bestreiten<br />
werden. Dabei werden wir eigenständig, lautstark und kämpferisch auftreten. Denn für Europa<br />
gilt: Europa verändern. Die Alternative heißt soziale Gerechtigkeit.<br />
105
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
F<br />
Frieden und Internationales<br />
F 1 – Bundesvorstand<br />
Stoppt die wahren Massenvernichter –<br />
Kleinwaffen umfassend abrüsten<br />
Einleitung<br />
Bis zu 800.000 Menschen verlieren jährlich ihr Leben durch den Einsatz von Kleinwaffen. Damit<br />
ist diese Waffenkategorie zweifellos die Waffengattung, durch deren Einsatz weltweit die<br />
meisten Opfer zu beklagen ist. Während über die Beschränkung und den Abbau von atomaren,<br />
biologischen und chemischen Waffen bereits seit Jahrzehnten verhandelt wird, sind<br />
Kleinwaffen und leichte Waffen ein relativ neues Thema auf der Agenda der<br />
Rüstungskontrolle. Dabei gelten sie aufgrund ihrer leichten Verfügbarkeit und Handhabung als<br />
die eigentlichen Massenvernichtungswaffen in Gewaltkonflikten. Kleinwaffen sind weit<br />
verbreitet und leicht zu beschaffen und kommen deshalb in Krisen und Konflikten häufig zum<br />
Einsatz. Trotz der großen Gefahr, die von dieser Waffengattung ausgeht, schreiten<br />
Abrüstungsbemühungen nur sehr langsam voran. Verschiedene Faktoren beeinflussen die<br />
Wirkung von Kleinwaffen. Abrüstungsansätze müssen die Faktoren, die die Verbreitung von<br />
Kleinwaffen begünstigen, in Betracht ziehen.<br />
Faktor - Anzahl an Waffen<br />
Weltweit hat sich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Kleinwaffen geändert. Die Zahl<br />
der Kleinwaffen hat sich stark vergrößert. Besonders die Zahl der Waffen in zivilem Besitz ist<br />
gestiegen. Etwa 650 Millionen Kleinwaffen befinden sich weltweit in zivilem Besitz. Das sind<br />
rund 75 Prozent aller registrierten Waffen. Allein die Bürger der USA haben 270 Millionen.<br />
Insgesamt gibt es mindestens 875 Millionen Kleinwaffen auf der Welt — dies entspricht dem<br />
Gesamtwert aller zivilen, militärischen und für die Strafverfolgung bestimmten Kleinwaffen.<br />
Zivilisten beschaffen sich zunehmend schlagkräftigere Waffen. Die Beziehung zwischen Pro-<br />
Kopf-Vermögen und Waffenbesitz zeigt eindeutig, dass sich mit steigendem Volksvermögen<br />
auch der Schusswaffenbesitz erhöht, solange keine gesetzlichen Regelungen dieser<br />
106
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Entwicklung entgegenstehen. Die Proliferation von zivilen Schusswaffenbeständen wird sich in<br />
voraussehbarer Zukunft deshalb wahrscheinlich nicht verringern. In den meisten Ländern<br />
befindet sich die Mehrheit aller Schusswaffen nicht in Regierungsbesitz, sondern in zivilen<br />
Händen. Bei den meisten Auseinandersetzungen kommen keine Waffen aus Regierungsbesitz<br />
zum Einsatz. Obwohl die Forschung über die Gefahren, die von zivilen als auch staatlichen<br />
Kleinwaffen ausgehen, weiterer systematischer Untersuchungen bedarf, wird deutlich, dass<br />
zivile Schusswaffenbestände das Kleinwaffenphänomen in immer größerem Maße<br />
beeinflussen. Die Umsatzsteigerung am Verkauf ziviler Kleinwaffen ist zum Teil auf geänderte<br />
Gesetze, die den legalen Handfeuerwaffenbesitz vereinfachen, zurückzuführen.<br />
Faktor - Lizenzproduktion<br />
Produktion mit und ohne Lizenz setzt den Erwerb von Produktionstechnologie durch einen<br />
Hersteller voraus, der diese Technologie vorher nicht besaß. Obwohl dies nicht unbedingt zu<br />
einer allgemeinen Steigerung der produzierten Waffenzahlen führen muss, bedeutet es jedoch<br />
eine Weitergabe von Produktions-Know-how an eine größere Anzahl von Akteuren. Mit der<br />
Verbreitung dieser Fachkenntnisse steigt das Risiko, dass Kleinwaffen in die falschen Hände<br />
geraten. Einmal weitergegeben kann transferiertes Produktions-Know-how nicht mehr<br />
zurückgeholt werden. In der Weitergabe der Technologie liegt ein hohes Risiko für die<br />
Abrüstungsbemühungen. Bereits heute lässt sich ein Trend in den Empfängerländern<br />
erkennen, in eigene Produktionsmöglichkeiten von Kleinwaffen zu investieren. Lässt sich eine<br />
Reduktion der Waffenmenge politisch in den Herstellerländern durchsetzen, versiegt der<br />
Nachschub in Empfängerländern, können diese ihn durch lokale Produktion ersetzen.<br />
Die meisten Lizenzabkommen betreffen die Herstellung von militärischen Gewehren,<br />
Sturmgewehren, Karabinern, Handfeuerwaffen und Maschinengewehren. Die lizenzierte<br />
Produktion von Munition und leichten Waffen ist relativ selten. Der Grund dafür ist, dass die<br />
Munitionsherstellung normalerweise nicht auf komplexen Verfahren beruht und nur geringe<br />
Forschungs- und Entwicklungskosten benötigt, die leicht von Lizenzgebühren und Royalties<br />
(Nutzungsgebühren) überschritten werden können. Dies hat zur Folge, dass die<br />
Munitionsherstellung relativ unkontrolliert ablaufen kann.<br />
Die Bundesrepublik Deutschland verbietet den Transfer von Produktionstechnologien in<br />
Länder, in denen bewaffneter Konflikt herrscht oder der Ausbruch eines solchen Konflikts<br />
bevorsteht. Auf regionaler Ebene untersagt der EU Code of Conduct ihren Mitgliedstaaten,<br />
Herstellungslizenzen an Länder zu vergeben, denen vorher bereits eine derartige Lizenz von<br />
einem anderen EU-Staat verweigert wurde.<br />
107
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Faktor - niedrige Preise<br />
Niedrigere Waffenpreise erhöhen das Risiko, dass ein Bürgerkrieg ausbricht, unabhängig von<br />
anderen Faktoren der Konfliktwahrscheinlichkeit. Je wirksamer die Regulierungsmaßnahmen<br />
eines Landes sind, desto höher sind die Waffenpreise. Länder mit durchlässigeren Grenzen<br />
haben in der Regel niedrigere Waffenpreise. Dies gilt besonders für Länder in Afrika, wo poröse<br />
Grenzen es den Lieferanten erlauben, der Nachfrage schnell zu begegnen. In der Regel fallen<br />
Waffenpreise in einem Land, dessen Nachbarn ihre militärischen Ausgaben erhöhen,<br />
vermutlich wegen der daraus resultierenden Waffenproliferation. Überschusswaffen in Post-<br />
Konflikt-Szenarien tragen dazu bei, dass Waffenpreise niedrig bleiben. Sie erhöhen auch für<br />
geraume Zeit noch die Wahrscheinlichkeit, dass in der Region neue Konflikte ausbrechen.<br />
Faktor - Neubeschaffung durch Militär - Überschussweitergabe<br />
Der Anschaffung neuer Waffen wohnt eine kritische Dynamik inne: neue Einkäufe verlegen<br />
Überschussbestände. Dieser Überschuss an vorhandenen (gebrauchten) Waffenbeständen<br />
wird hauptsächlich an die ärmeren Staaten der Welt weitergeliefert, die wohlhabenderen<br />
Staaten verlassen sich in ihrer Mehrheit lieber auf neue Waffensysteme. Entscheidend ist, dass<br />
die Produktion von neuen Kleinwaffen und der Handel mit vorhandenen Beständen<br />
voneinander abhängen. Dieser Effekt zwischen der Waffen-Beschaffung der reichen Staaten<br />
und den dadurch ausgelösten Notwendigkeiten, sich von vorhandenen Beständen zu trennen,<br />
setzt sich zu den ärmeren Käufern fort. Einige der bedeutendsten Käufer haben für die<br />
kommenden zehn bis 15 Jahre umfangreiche Einkaufsprogramme angekündigt. Diese Einkäufe<br />
werden den Handel mit vorhandenen, überschüssigen Beständen anregen.<br />
Werden die überschüssigen Lagerbestände nicht durch freiwillige Zerstörung aus dem Umlauf<br />
gezogen, werden diese Waffen voraussichtlich die Bestände der ärmeren Staaten der Welt<br />
verstärken, also in Länder gelangen, in denen die Sicherheit oft ungenügend ist, deren<br />
Regierungen häufig instabil sind, und in denen bewaffnete Konflikte häufiger vorkommen.<br />
Faktor - Munitionsschieberei<br />
In Ländern mit prekärer Sicherheitsarchitektur, wo Korruption zum Alltag gehört, beschaffen<br />
sich nicht-staatliche Akteure Munition häufig auf illegale Weise aus den Beständen staatlicher<br />
Sicherheitskräfte. Dieses Verhalten steht im direkten Gegensatz zu sukzessiven und<br />
anhaltenden Entwaffnungsinitiativen, die bewaffnete Konflikte in diesen Ländern stoppen<br />
sollen. Das Problem der Munitionsschiebereien muss deshalb verstärkt frontal angegangen<br />
108
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
werden, wenn Sicherheitskräfte davon abgehalten werden sollen, zur bewaffneten Gewalt<br />
beizutragen.<br />
Faktor - Transfer<br />
Transfers von Kleinwaffen, leichten Waffen und Munition werden häufig nicht legal oder<br />
verantwortungsbewusst gehandhabt, auch wenn ihr Transport vorab ordnungsgemäß<br />
angemeldet wurde. Auch genehmigte Transfers können gegen internationales Recht und<br />
Gewohnheitsrecht verstoßen — einschließlich Menschenrechts- oder Konfliktbezogene<br />
Normen. Transfers können, durch Diebstahl oder Umleitungen der Waffen zu unautorisierten<br />
Empfängern, auch ein erhöhtes Risiko einschließen oder sogar verantwortungslos sein. Daher<br />
fallen auch illizite* Transfers unter von Regierungen autorisierte Transporte, wenn z.B. in<br />
Empfängerländer geliefert wird, die bewiesenermaßen eine negative Bilanz auf dem Gebiet der<br />
Menschenrechtsverletzungen haben, selbst in bewaffnete Konflikte verwickelt sind, oder bei<br />
denen das Risiko der Entwendung erheblich ist. Geheimhaltungsmaßnahmen seitens vieler<br />
Regierungen verhindern oft die Feststellung, ob exportierende Staaten verantwortungsvoll<br />
handeln, wenn sie Kleinwaffenlieferungen in Länder autorisieren, die derart erhöhte Risiken<br />
darstellen. Es muss ganz klar auf die Verantwortung des Staates verwiesen werden,<br />
Waffentransfers zu unterlassen, die zum Missbrauch führen könnten.<br />
Mindestens 60 Staaten genehmigten im Zeitraum 2002–2004 in 36 Länder Waffenlieferungen,<br />
die man durchaus als verantwortungslos einstufen könnte. Der Diebstahl von mehreren<br />
hunderttausend Kleinwaffen, die von den Vereinigten Staaten in den Irak transferiert wurden,<br />
sowie von zehntausenden Schuss Munition, die seit 2003 von südafrikanischen<br />
Friedenssicherungstruppen an Burundi geliefert wurden, demonstrieren eindrucksvoll, dass<br />
eine politische Notwendigkeit nach höherem Verantwortungsbewusstsein und für<br />
Maßnahmen besteht, die sicherstellen können, dass die Bemühungen, Konflikte zu beheben,<br />
nicht unabsichtlich unterlaufen werden. Gegen UN-Waffenembargos, die für alle UN-<br />
Mitglieder rechtsverbindlich sind, wird routinemäßig verstoßen, wie sich 2006 an<br />
regierungsautorisierten, aber heimlichen Waffentransfers in den Libanon, nach Somalia und in<br />
den Sudan darstellen lässt.<br />
* Begriffsdefinitionen<br />
Autorisierte Transfers sind Transfers, die von mindestens einer Regierung autorisiert<br />
wurden.<br />
109
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Unverantwortungsvolle Transfers, also Graumarkt-Transfers, sind Transfers, die zwar<br />
von einer Regierung autorisiert, die aber trotzdem von zweifelhafter Legalität sind—<br />
wenigstens in Bezug auf internationales Recht (erhebliches Risiko des Missbrauchs),<br />
oder in einem anderen Sinn verantwortungslos (erhebliches Risiko der Entwendung<br />
und Weiterleitung an unautorisierte Bezieher).<br />
Illegale Transfers sind synonym mit Schwarzmarkt-Transfers. Beide Begriffe<br />
bezeichnen Transfers, die von keiner Regierung autorisiert wurden.<br />
Illizite Transfers umfassen sowohl verantwortungslose als auch illegale Transfers<br />
(Grau-/Schwarzmarkt).<br />
Heimliche Transfers sind solche, bei denen Regierungen ihre Beteiligung verbergen—<br />
meist, aber nicht immer, weil sie illizit sind.<br />
Faktor - Transferkontrollen<br />
Die Verhinderung von illizitem* Kleinwaffenhandel hängt von der Kontrolle legaler Transfers<br />
ab. Mangelndes Verantwortungsbewusstsein bei legalen Transporten öffnet immer wieder Tür<br />
und Tor für illegale Aktivitäten. Deswegen muss das Verantwortungsbewusstsein der<br />
handelnden Parteien bei legalen Transfers deutlich erhöht werden, solange ein komplettes<br />
Verbot des Waffenverkaufs an Privatleute noch nicht umgesetzt werden kann.<br />
Nichtstaatliche Akteure<br />
Die Frage, ob Transfers von Klein- und leichte Waffen an nichtstaatliche Akteure verboten<br />
werden sollten, ist ein heftig umstrittenes Thema.<br />
Eine Meinung besagt, dass nichtstattliche Akteure, die von der jeweiligen Regierung ihrer<br />
Heimatstaaten nicht autorisiert sind, Waffen zu importieren, Grund zu größerer Beunruhigung<br />
darstellen.<br />
Einige Regierungen bestehen jedoch nach wie vor darauf, dass in bestimmten Fällen auch ein<br />
Waffentransfer an nicht autorisierte nichtstaatliche Akteure gerechtfertigt sei.<br />
110
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Verantwortlichkeit<br />
Die existierenden Verpflichtungen, denen die Staaten auf dem Gebiet der Kleinwaffentransfers<br />
unterliegen, sind bereits sehr umfangreich. Zu den relevanten, verbindlichen Rechtsnormen<br />
gehören direkte Transferbeschränkungen, sowie die Regel, dass Staaten sich einer Verletzung<br />
des internationalen Rechts ‚mitschuldig’ machen, wenn sie sich in Waffentransfers betätigen,<br />
ohne ein bekanntes (oder erkennbares) Risiko des Missbrauchs zu berücksichtigen.<br />
Die Staaten müssen weiterhin darauf hingewiesen werden, diese Regelungen einzuhalten. Um<br />
den Druck zu erhöhen, müssen Verstöße schärfer geahndet werden. Ein Mittel hierzu ist das<br />
UN Feuerwaffenprotokoll.<br />
Das UN Feuerwaffenprotokoll<br />
Das UN Feuerwaffenprotokoll nimmt zwei Bereiche der Transferproblematik in Angriff. Zum<br />
einen versucht es den illegalen Handel mit Schusswaffen zu unterbinden, indem es die<br />
zwischenstaatliche Strafverfolgung erleichtert. Zum anderen verpflichten sich<br />
Unterzeichnerstaaten an Privatleute verkaufte Waffen zu kennzeichnen und eine Datenbank<br />
über die Verkäufe zu führen. So können in Zukunft Verkäufe die zu anderen als den vorgesehen<br />
Zielen gelangen, nachgewiesen werden. Hierbei setzt das Protokoll auf zwischenstaatliche<br />
Aktivitäten. Als Kontrollinstrument fungiert die gegenseitige Überwachung. Staaten, die<br />
Zweifel an der Korrektheit der Waffengeschäfte eines anderen Unterzeichnerstaates haben,<br />
können ein Sanktionsverfahren einleiten, dass bis zum Internationalen Gerichtshof führt.<br />
Allerdings können Unterzeichnerstaaten die Internationale Gerichtsbarkeit explizit<br />
ausschließen. Damit versucht das Feuerwaffenprotokoll, den Druck auf verantwortungsvolles<br />
Handeln beim legalen Transfer zu erhöhen. Die Wirksamkeit dieses Kontrollmechanismus<br />
muss sich allerdings erst noch erweisen. Insbesondere das Element der zwischenstaatlichen<br />
Kontrolle könnte zu Problemen führen. Beim Biowaffenabkommen waren die Erfahrungen mit<br />
dem Kontrollsystem der gegenseitigen Anzeige eher unbefriedigend. Eine internationale<br />
Kontrollorganisation wie die Atomenergiebehörde erreicht einen höheren Wirkungsgrad und<br />
birgt weniger diplomatischen Sprengstoff.<br />
Das Feuerwaffenprotokoll ermöglicht einige Fortschritte. Besonders die Europäische Union hat<br />
den Prozess vorangetrieben und die Regelungen bereits in EU Gesetzgebung übernommen.<br />
Jedoch haben viele Staaten, wie die GUS und die USA bis dato noch nicht ratifiziert. Ob die<br />
Markierung von Waffen jedoch tatsächlich zu einer Reduzierung des Kleinwaffenbestandes<br />
führt, ist zu bezweifeln.<br />
111
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Faktor – Interessenpolitik<br />
Die Verbreitung von Kleinwaffen hat auch politische Ursachen. Nicht selten werden Waffen an<br />
unsichere Staaten geliefert, weil diese Staaten zeitweise als Bündnispartner betrachtet<br />
werden. Dies war nicht zuletzt während des Ost-West Konflikts ein wichtiger Weg zur<br />
Verbreitung von Kleinwaffen, aber auch nach dem 11. September hat die USA gezielt eine<br />
Bündnispolitik verfolgt, die die Lieferung von Kleinwaffen an ihre Bündnispartner in bei der<br />
Durchsetzung ihrer globalen Interessen, einschließt.<br />
Die Waffenkontrolle im Inland, die nachweislich Auswirkungen auf<br />
Kleinwaffenabrüstungsbemühungen hat, konnte wegen Druck aus den Nationalstaaten nicht<br />
Teil der gegenwärtigen internationalen Abkommen zur Kleinwaffenbegrenzung werden.<br />
Forderungen<br />
Langfristig fordern wir den Verzicht auf Kleinwaffen in Privatbesitz weltweit<br />
Der einzig sichere Schutz gegen den Einsatz von Kleinwaffen ist der vollständige Verzicht auf<br />
die Herstellung, den Handel und Besitz von Kleinwaffen weltweit. Damit ein solches Szenario<br />
Realität werden kann, sind viele Schritte von Nöten. Gerade die Milliarden bereits im Umlauf<br />
befindlicher Waffen stellen dabei in großes Hindernis dar.<br />
Grundsätzlich wollen wir, dass Kleinwaffen nicht mehr von Privatleuten benutzt werden<br />
können. Die Verwendung innerhalb staatlicher Gewalt soll auf den Polizeieinsatz beschränkt<br />
bleiben und dort streng reglementiert werden.<br />
Die Herstellung von Kleinwaffen wäre demzufolge allein für den Polizeigebrauch zulässig. Sie<br />
sollte nicht Teil der Privatwirtschaft sein, sondern staatlicher Hoheit obliegen, damit illegale<br />
Verkäufe verhindert werden können. Der Weiterverkauf von Kleinwaffen kann nur erfolgen,<br />
wenn im Empfängerland eine Verwendung im Polizeidienst sichergestellt werden kann.<br />
Unser Ziel ist eine Welt ohne Kleinwaffen. Leider sind die aktuellen politischen Debatten um<br />
Kleinwaffen weit davon entfernt, dass eine solche Forderung in Kürze Realität werden kann.<br />
Wir halten deshalb an unseren langfristigen Forderungen fest, ohne darauf zu verzichten kurzund<br />
mittelfristige Schritte in die richtige Richtung einzufordern.<br />
Während sich auf der deklaratorischen Ebene der internationalen Regime zur<br />
Kleinwaffenabrüstung einiges getan hat, kommt die Umsetzung nur schleppend in Gang. Trotz<br />
der Einigung auf politisch verbindliche Standards, mangelt es an Sanktionsmöglichkeiten und<br />
112
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
einer der rechtlichen Verpflichtung der Staaten die Aktionsprogramme in nationale<br />
Gesetzgebung zu übernehmen. Zudem müssen neben der konkreten Kleinwaffenkontrolle<br />
auch die Ursachen für die Nachfrage nach Kleinwaffen bekämpft werden. Deshalb braucht eine<br />
wirksame Kleinwaffenbekämpfung den Kampf gegen Armut, Unterentwicklung, mangelnde<br />
Staatlichkeit und das organisierte Verbrechen.<br />
Mittel- und Kurzfristig fordern wir<br />
Waffenmenge reduzieren<br />
Die Bemühungen der Vereinten Nationen gegen den illegalen Handel mit Kleinwaffen müssen<br />
stärker auf das Ziel ausgerichtet werden, die Zahl im Umlauf befindlicher Kleinwaffen zu<br />
reduzieren. Der Versuch, Kleinwaffen nicht in die Hände von Kriegsparteien gelangen zu lassen,<br />
reicht nicht aus. Auch die Verringerung ihrer absoluten Menge ist nötig. Bereits im Umlauf<br />
befindliche Kleinwaffen in Privatbesitz müssen eingesammelt und vernichtet werden. Solche<br />
Programme sind abhängig von dem Willen zur Entwaffnung oder Anreizen zur<br />
Entwaffnungsbereitschaft und kosten Geld. Die vereinten Nationen benötigen hier die<br />
Unterstützung der Industrienationen und Herstellerländer.<br />
Aufbauend auf dem EU Konzept für „Disarmament, Demobilisation and Reintegration“ von<br />
2006, was auf eine Entwaffnung von Konfliktparteien in regionalen Konflikten abzielt, kann<br />
die Europäische Union hierbei eine wichtige Rolle übernehmen.<br />
Die Bundesregierung sollte den Verteidigungsetat ab 2009 um 10 Prozent abzusenken und die<br />
frei werdenden Gelder in Konversionsinitiativen und Abrüstungsmaßnahmen sowie in die<br />
Stärkung der Kapazitäten der zivilen Konfliktbearbeitung investieren.<br />
Waffen verteuern – Entwaffnungsprogramme auch finanziell stärken<br />
Staaten, die das Ziel einer reduzierten Kleinwaffenverbreitung unterstützen, sollten versuchen,<br />
die Einkaufspreise für Waffen zu erhöhen. Je billiger eine Waffe zu haben ist, desto größer ist<br />
die Chance, dass sie sich massenhaft verbreitet. Eine Verteuerung von Waffen kann<br />
beispielsweise durch eine erhöhte Besteuerung von Waffenverkäufen erreicht werden. Die<br />
eingenommenen Steuern könnten in Entwaffnungsprogramme reinvestiert werden. Auch im<br />
Rahmen der Abrüstungsbemühungen der Vereinten Nationen sollte eine Finanzierungsoption<br />
für Entwaffnungsprogramme entwickelt werden. Die Herstellerländer müssen ihrer<br />
besonderen Verantwortung dabei gerecht werden.<br />
113
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wirksamere Transferkontrollen<br />
Kurzfristig muss die Wirksamkeit von Handelsverboten mit Krisenregionen drastisch erhöht<br />
werden. Auch über Umwege dürfen keine Waffen in Krisengebiete gelangen. Hierbei kann eine<br />
Stärkung im Kampf gegen das organisierte Verbrechen hilfreich sein, wie sie im UN<br />
Feuerwaffenprotokoll vorgesehen ist. Das UN Feuerwaffenprotokoll muss so schnell wie<br />
möglich von weiteren Staaten ratifiziert und umgesetzt werden. Die Bundesregierung sollte<br />
auf Staaten, die das Protokoll bis dato nicht ratifiziert haben, wie z.B. die USA und die GUS,<br />
diplomatischen Druck ausüben.<br />
Mittelfristig könnten die Annahme eines generellen „Non-Transfers“ Gebots innerhalb eines<br />
internationalen Rahmens mit der Möglichkeit gewisser Ausnahmen in „hard cases“, die klar<br />
von der internationalen Gemeinschaft definiert werden, ein Weg sein, auf ein generelles<br />
Transferverbot von Kleinwaffen zuzuarbeiten.<br />
Zum anderen müssen aber auch mögliche Schlupflöcher, um Handelsbeschränkungen zu<br />
umgehen, dringend gestopft werden. Die Kennzeichnungspflicht von in den Privatbesitz<br />
verkauften Kleinwaffen kann nur wirksam sein, wenn die Kennzeichnungsmerkmale<br />
fälschungssicher sind und eine Verfolgung von Verstößen gegen diese Regelungen konsequent<br />
eingefordert wird.<br />
Die vereinten Nationen können die Wirksamkeit des Feuerwaffenprotokolls stärken, indem sie<br />
ein internationales Regimes für die Registrierung und Nachverfolgung von Kleinwaffen unter<br />
dem Dach der Vereinten Nationen einrichten, statt dies in der Verantwortung der Einzelstaaten<br />
zu belassen. Die illegale Produktion, Handel und die ungehinderte Verbreitung von<br />
Kleinwaffen können dadurch besser bekämpft werden.<br />
Die Bundesregierung kann durch die rechtsverbindliche Umsetzung der bislang nur politisch<br />
verbindlichen Entscheidungskriterien und Maßstäbe des EU-Verhaltenskodex für<br />
konventionelle Waffenausfuhren und einen unverzüglichen Stopp der Gewährung von<br />
Staatsbürgschaften für Rüstungsexportgeschäfte ein Signal setzen, die weltweite Verbreitung<br />
deutscher Rüstungstechnologie drastisch zu erschweren.<br />
Verschärfte Transferkontrollen für Lizenzverfahren<br />
Besonderes Augenmerk gilt der Herstellung von Waffen in Lizenzverfahren.<br />
114
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
• Abkommen, die den Waffenexport in unsichere Staaten reglementieren, müssen auf<br />
den Export von Herstellungs-Know-how ausgeweitet werden.<br />
• Auch für die Munitionsherstellung müssen Lizenzverfahren eingerichtet werden, um<br />
die unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern.<br />
• Der ursprüngliche Transfer von Lizenzabkommen muss besser kontrolliert werden,<br />
damit Technologiediebstahl verhindert wird.<br />
Der EU Code of Conduct, der den EU-Staaten untersagt, Herstellungslizenzen an Länder zu<br />
vergeben, denen bereits in von einem EU Land die Herstellung untersagt wurde, muss auf die<br />
ganzen Vereinten Nationen ausgeweitet werden, um effektiv gegen Waffenproliferation<br />
vorzugehen.<br />
Weiterverkäufe stoppen<br />
In den nächsten Jahren stehen bei einer Reihe von Armeen neue Waffenkäufe an. Altwaffen<br />
dürfen keinesfalls weiterverkauft, sondern müssen vernichtet werden. Selbiges gilt für<br />
konfiszierte Waffen und solche, die aus Abrüstungsaktionen nach der Beendigung von<br />
Kriegshandlungen stammen. Gerade auf die größeren Waffenverkäufe, die in den nächsten<br />
Jahren in einigen Ländern stattfinden, müssen wir größeres Augenmerk legen, und politischen<br />
Druck zur vollständigen Vernichtung der Altwaffen aufbauen.<br />
Prävention stärken<br />
Die Forschung und Entwicklung von Abrüstungsinitiativen muss gestärkt werden. Wir fordern<br />
die Bundesregierung dazu auf, eine unabhängige Expertengruppe zu berufen, die für die<br />
Bundesregierung und den Deutschen Bundestag die gegenwärtigen und zukünftigen<br />
Herausforderungen für die Rüstungskontrolle und Rüstungsminderung systematisch<br />
untersucht und die Vorschläge unterbreitet, wie durch präventive Maßnahmen der<br />
Abrüstungsprozess gestärkt werden können. Die Fälschungssicherheit von<br />
Waffenkennzeichnungen könnte ein erstes Forschungsprojekt sein.<br />
Auf Europäische Ebene könnte die Europäische Rüstungsagentur zu einer Abrüstungsagentur<br />
umgewidmet werden und diese Aufgabe als Alternatives Projekt betreuen.<br />
115
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
F 2 – Bundesvorstand<br />
Decent Work Weltweit<br />
Probleme und Herausforderungen<br />
Globalisierung<br />
Eine globalisierte Wirtschaft ist kein neues Phänomen. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
war die wirtschaftliche Verflechtung durch internationale Handels- und Finanzströme weit<br />
fortgeschritten. Auch die derzeit zu beobachtende Krisenhaftigkeit des Kapitalismus kann nicht<br />
überraschen. Beispielsweise lösten im Jahre 1929 unter anderem Kapitalflucht und der<br />
Börsencrash in New York eine Weltwirtschaftskrise aus. Heutzutage tritt die Globalisierung als<br />
Beschleunigung des Prozesses wirtschaftlicher Verflechtung auf, der von Deregulierung,<br />
Deinstitutionalisierung und Voluntarisierung von Arbeitsstandards begleitet wird. Daraus<br />
ergeben sich besondere Herausforderungen an eine nationale und internationale Regulierung<br />
und Institutionalisierung von Arbeitsstandards, um soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen.<br />
Lateinamerika ist auf dem Weg eigene, neue Wege im Umgang mit globaler<br />
Wirtschaftsentwicklung zu suchen. In immer mehr Ländern dieser Region gibt es<br />
linksgerichtete Regierungen, zuletzt durch den Machtwechsel in Paraguay und der<br />
Regierungsübernahme Fernando Lugos. Dabei ist zu erkennen, dass in den verschiedenen<br />
Staaten höchst unterschiedlich definiert wird, was „links“ bedeutet. Einerseits streiten die<br />
Regierungen von Venezuela, Bolivien, Ecuador oder Kuba für deutlich antiliberale Praktiken und<br />
fordern die drastische Zurücknahme von Deregulierungsmaßnahmen, vor allem im Bereich der<br />
Agrarwirtschaft. Zu den regionalen Wortführern zählen Hugo Chávez und Evo Morales, die mit<br />
der ALBA (Alternativa Bolivariana para la América) ein Vertragssystem zwischen Kuba, Bolivien<br />
und Venezuela aus der Taufe gehoben haben, welches auf Solidarität, einer Wiederbelebung<br />
des Naturaltauschs – vor allem des venezolanischen Erdöls – und einer Absprache bei<br />
Investitionsplänen basiert, denen eine staatszentrierte Logik zugrunde liegt. Demgegenüber<br />
stehen die Regierungschefs Cristina Fernández de Kirchner in Argentinien, Michelle Bachelet in<br />
Chile, Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien, Tabaré Vázquez in Uruguay oder Alan García in Peru.<br />
Sie stehen für eine demokratisch-pragmatische Linke, die ebenfalls nach Alternativen zum<br />
Neoliberalismus sucht, die Vorstellung einer industriellen Koordinierung mit<br />
planwirtschaftlichem Charakter, wie es die ALBA vorsieht, aber ablehnt. Vor allem Brasilien ist<br />
im Hinblick auf seine Wirtschaftswachstumsrate und das Handelsvolumen daran interessiert,<br />
Exporte zu vereinfachen und deren Regulierung zu liberalisieren. Als zehntgrößte<br />
116
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Volkswirtschaft der Welt sind die Interessen auf dem Weltmarkt deutlich von einer<br />
Entwicklung zum „Global Player“ bestimmt und man sieht sich von Ideen der ALBA eher<br />
beschränkt.<br />
Historisch gesehen hat die Integration der lateinamerikanischen Wirtschaft in<br />
Regionalsysteme und globale Märkte große Wenden hinter sich. Nach der Befreiung des<br />
Subkontinents im 19. Jahrhundert von den bis dahin herrschenden Kolonialmächten wandten<br />
sich die neu entstandenen Staaten einer kontinentalen Integration zu, die eine größere<br />
Unabhängigkeit in der Welt bedeuten sollte. Schon damals wurden neben stark politischen<br />
auch wirtschaftliche Bestrebungen zur Einführung einer Zollunion betrieben, auch wenn die<br />
Entstehung einer „Patria Grande“ als Staatenverbund letztendlich eine Utopie blieb.<br />
Wirtschaftliche Erwägungen wurden während und nach dem Zweiten Weltkrieg stärker in den<br />
Mittelpunkt der Anstrengungen um Kooperationsmodelle gestellt. Integration sollte als<br />
„Instrument zur Positionierung im Globalisierungsprozess“ gesehen werden. In den 50er und<br />
60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden regionale Industrialisierungspläne mit massiver<br />
Steuerung und damit einhergehender Abschottung nach außen erstellt, die eine<br />
wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten Region begünstigen sollten. Allerdings scheiterte<br />
die hoch ambitionierte Zielstellung vor allem an Streitigkeiten über die Standorte von<br />
Industrieansiedlungen. Unter den Militärdiktaturen wurde eine Wende hin zu einem radikalen<br />
neoliberalen Modell vollzogen. Märkte wurden geöffnet, Staatsunternehmen verkauft und<br />
Arbeitsrechte dereguliert Die Zeit endete mit der Ölkrise, stagnierendem<br />
Wirtschaftswachstum, steigenden Zinsen und einer damit verbundenen Verschuldung. Anfang<br />
der 1980er Jahre wurde die neue Idee des offenen Regionalismus zum marktwirtschaftlichen<br />
Reformmodell in Lateinamerika. Dies bedeutete zunächst eine Kehrtwende in der<br />
Regionalpolitik der Länder, begünstigte aber das Wiederaufleben der Idee von<br />
Bündnissystemen. Beispiel dafür ist die Gründung des Mercosur 1991 als Verband, der sich<br />
sowohl regional stark macht, als auch auf die neuen Bedingungen der Globalisierung Antwort<br />
zu finden versucht. Dabei stand die Integration der Wirtschaft neben den subregionalen<br />
Kooperationen mit Nachbarn im Zusammenhang mit verstärkter Eingliederung in die<br />
Weltwirtschaft. Es konzentrierte sich alles zunehmend auf die globalen Märkte, Strukturaufbau<br />
innerhalb der Bündnisse stand derweil nicht auf der Tagesordnung.<br />
Bis in die 1990er Jahre sind die Ansätze des offenen Regionalismus als Schwerpunkt geblieben,<br />
vor allem wenn es um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Handel<br />
und bei der Attraktivitätssteigerung für ausländische Investoren geht. Die bestehenden<br />
Integrationsblöcke blieben aber als Raum für gemeinsame Verhandlungspositionen, um so<br />
auch vermehrten Einfluss in den multilateralen Verhandlungen weltweit zu garantieren.<br />
117
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mit der Herausbildung der beiden Alternativen ALBA (Bolivarianische Alternative für die Völker<br />
unseres Amerika) und der Unasur (Union Südamerikanischer Nationen), einer demokratischgemäßigten<br />
Verbindung auf Initiative Brasiliens, sind in den letzten Jahren verschieden große<br />
Abstände zum Regionalismus geschaffen worden: ALBA setzt wieder vermehrt auf regionale<br />
Integrationsprojekte und stößt dabei, auch im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit den<br />
Industrialisierungsplänen der 1950er Jahren, auf wenig Gegenliebe der lateinamerikanischen<br />
Partner. Die am 23. Mai 2008 gegründete Unasur hat es sich zum Ziel gesetzt, soziale<br />
Ungleichheit und Armut zu bekämpfen und langfristig eine der EU vergleichbare regionale<br />
Integration zu erreichen. Mittelfristig werden aber zunächst Probleme gelöst werden, wie das<br />
Verhältnis zu Mercosur und Andenpakt. Der Beitritt Venezuelas unter Chávez wird weitere<br />
Spannungen bringen.<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die lateinamerikanische Region seit langem<br />
versucht, ein geeignetes Konzept für die Integration in die globalen Weltmärkte zu finden. Mit<br />
den neuen linksgerichteten Regierungen scheint Bewegung in die Debatte zu kommen – die<br />
Rolle des Mercosur und der kleineren Bündnisse sind aber noch nicht vollständig definiert.<br />
Informeller Sektor<br />
Die Beschäftigungsrate im informellen Sektor in den Ländern der so genannten Dritten Welt<br />
verharrt auf hohen Stand, wenn sie nicht sogar steigt. In Lateinamerika betrifft dies im<br />
Durchschnitt ungefähr die Hälfte aller Beschäftigten. Dies birgt eine Vielzahl von Problemen,<br />
die gravierende Auswirkungen auf die sozioökonomische Situation der Länder haben.<br />
Vor allem im Dienstleistungsgewerbe ist die Zahl derer sehr hoch, die ohne formalen<br />
Arbeitsvertrag und ohne die damit oftmals verbundene staatliche soziale Absicherung<br />
arbeiten. Diese Art von Beschäftigung herrscht in den so genannten Kleinen und Mittleren<br />
Unternehmen (PYME) vor, die von Familien betrieben werden. Sie ist rechtlich weder geregelt,<br />
noch begründet sie einen Anspruch auf Leistungen des Staats in Form von Renten-, Krankenoder<br />
Berufsunfähigkeitsversicherung. Eine niedrige Organisationsebene, kleinere<br />
Produktionserträge und die Beschäftigung von Familienangehörigen ist charakteristisch für<br />
solche Beschäftigung, die in den Staaten Mittel- und Südamerikas eine Größe angenommen<br />
hat, die nicht mehr überschaubar ist.<br />
Probleme gibt es einerseits bei den Beschäftigten im informellen Sektor selbst. Sie sind auf ihr<br />
Privatkapital angewiesen, können sich wirtschaftlich nicht weiter entwickeln und sind<br />
vollkommen auf sich selbst angewiesen. Sie gehören oft zur gesellschaftlichen Unterschicht,<br />
haben keine sicheren Einkommensperspektiven und leben oft in prekären Wohnverhältnissen.<br />
118
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Eine Integration in die zumeist nur rudimentär und überwiegend privat finanzierten sozialen<br />
Sicherungssysteme der Staaten findet praktisch in keiner Weise statt. Sie sind im Krankheitsfall<br />
oder der Berufsunfähigkeit auf Eigenkapital angewiesen, welches meist nicht vorhanden ist.<br />
Somit birgt die Beschäftigung im informellen Sektor ein hohes Risiko unter die Armutsgrenze<br />
zu fallen.<br />
Für den Staat bedeutet der informelle Sektor Einnahmeausfälle und fehlende<br />
Kontrollmöglichkeiten. Abgaben der Bürgerinnen und Bürger durch Sozialbeiträge und Steuern<br />
gehen verloren, woraus folgt, dass Sozialsysteme am fehlenden Geld scheitern. Die<br />
Exportwirtschaft wird durch die starke Konzentration des informellen Sektors auf den<br />
Binnenmarkt geschwächt, es fehlt an Kapital für Technologie und Investitionen. Die fehlende<br />
Kapitalakkumulation des Staates verhindert somit Wachstum und Wohlstand der Gesellschaft.<br />
Gleichzeitig ist der informelle Sektor für viele Menschen die einzige Chance am Arbeitsleben<br />
teilzuhaben. Wichtig ist es deshalb, informelle Beschäftigung zu bekämpfen und nicht die<br />
informell Beschäftigten.<br />
Arbeitslosigkeit und Arbeitsmigration<br />
Dank des anhaltenden Wachstums der Wirtschaft in den lateinamerikanischen Staaten ist die<br />
Armut und damit eng verbunden die Arbeitslosenquote seit 1990 stetig gesunken. Laut der<br />
Lateinamerika-Wirtschaftskommission Cepal der Vereinten Nationen schafften im Jahr 2006<br />
mehr als 14 Millionen Menschen den Sprung über die Armutsschwelle. Im Zeitraum 2003-2007<br />
erreichte Lateinamerika im Durchschnitt ein Wirtschaftswachstum von 4,5%. Dies ist vor allem<br />
dem hohen Preisanstieg bei Exportschlagern wie Soja, Silber und Kupfer zu verdanken.<br />
Argentinien konnte die Arbeitslosenquote von 17 auf 10% verringern, Peru, Chile, Ecuador,<br />
Honduras minderten die Zahlen um mindestens 5 Prozentpunkte.<br />
Auf der anderen Seite ist nirgendwo anders auf der Welt die Spalte zwischen Arm und Reich<br />
höher als in Mittel- und Südamerika. Während beispielsweise Arbeiter in Mexiko nicht mehr als<br />
2 Dollar Gehalt am Tag zur Verfügung haben, verdient der reichste Mann der Welt, wohnhaft in<br />
Mexiko, rund 45000 Dollar pro Minute. Damit entspricht sein Vermögen satten 7% des<br />
mexikanischen Bruttoinlandprodukts!<br />
Beobachter der Vereinten Nationen appellieren angesichts des starken Wirtschaftswachstums<br />
und der guten Konjunktur weiter an die Staaten, die Schere zu schließen und<br />
Arbeitsbeschaffungsprojekte zu starten. Staaten wie Venezuela unter Hugo Chávez bemühen<br />
sich mit Armutsprogrammen auch darum, den informellen Sektor zu formalisieren und<br />
staatliche Sozialprogramme zu installieren. Zuletzt hat Chile wichtige Schritte in Richtung<br />
119
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Rentenreform und Absicherung getan und das private Rentenversicherungssystem<br />
abgeschafft, das Altersarmut und soziale Ungleichheit nicht nur nicht verhinderte, sondern im<br />
Gegenteil verschärfte. Im Juli 2008 trat an seine Stelle ein steuerfinanziertes Mischystem aus<br />
privater und staatlicher Altersvorsorge, deren Leistungen aus Grundrente, Invaliditätsrente und<br />
Rentenzuschüssen bestehen.<br />
Sicherlich ist eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von „nur“ 10% eine positive<br />
Errungenschaft der letzten Jahre. Dennoch sind weiterhin große Probleme im Rahmen der<br />
Armutsbekämpfung zu erkennen. Vor allem in Staaten mit schlechter Entlohnung und<br />
fehlender staatlicher Unterstützung ist Arbeitsmigration ein Thema. Immer noch versuchen<br />
tausende Menschen die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika zu<br />
überwinden, um in den USA bessere Arbeit zu finden.<br />
Imperialistische Freihandelspolitik<br />
Seit Jahren wird von den Vereinigten Staaten von Amerika der Versuch unternommen, eine<br />
gesamtamerikanische Freihandelszone (ALCA) zu schaffen. Mit dem teils radikalen Links-<br />
Schwung in den lateinamerikanischen Staaten ist dies in weite Ferne gerückt. Vor allem, aber<br />
nicht nur, weil sich Venezuela weiterhin weigert, solche Kooperationsabkommen zu<br />
unterzeichnen.<br />
Umso mehr gewinnt für die USA eine bilaterale Handelspolitik an Bedeutung. Nach dem<br />
chilenisch-bus-amerikanischen Freihandelsabkommen (TLC) von 2003 und den hierauf<br />
folgenden Verträgen mit Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua und Costa Rica wächst<br />
der Druck auf andere Staaten, eine Zusammenarbeit nicht weiter zu verweigern.<br />
Die gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA ist unterdessen zu einem – so die Meinung<br />
von Beobachtern und Experten – Abkommen á la carte verkommen. Nach einem Treffen im USamerikanischen<br />
Miami ist es seit Januar 2005 jedem Land selbst überlassen, welche<br />
Vertragsbestandteile es für sich übernimmt, die Wirkung ist für die USA fatal gering. Zuletzt<br />
kamen die Verhandlungen über die ALCA beim dem Gipfel von Mar del Plata ins Stocken, weil<br />
mehrere Staaten zentrale Vertragsbestandteile ablehnten.<br />
Verlängerte Werkbank für den Welthandel<br />
Freie Produktionszonen (ZFI) sind kein auf Lateinamerika beschränktes Phänomen. Seit den<br />
1970er Jahren bis heute werden sie von neoliberaler Seite Entwicklungsländern im<br />
internationalen Standortwettkampf empfohlen. Freie Produktionszonen haben sich auf die<br />
120
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Übernahme von einem oder zwei Arbeitsschritten in der Produktionskette spezialisiert. Die<br />
Rohstoffe oder das Vorprodukt können zollfrei eingeführt werden, sie werden dann vor Ort<br />
weiterverarbeitet und können anschließend zollfrei ausgeführt werden. Als zusätzlicher Anreiz<br />
werden von den Regierungen oftmals befristete Steuernachlässe angeboten und auch die<br />
Fabriken stehen schon zum Einzug bereit. Freie Produktionszonen prägten auch den Begriff von<br />
der verlängerten Werkbank.<br />
In Lateinamerika dominieren die ZFI noch heute die Exportwirtschaft in Mittelamerika,<br />
insbesondere in Honduras, El Salvador, Guatemala und Nicaragua. Die Textilindustrie ist mit<br />
Abstand das wichtigste Zugpferd dieser Freihandelszonen. In den Maquilas der Textilindustrie<br />
arbeiten vor allem junge Frauen unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zu<br />
Niedriglöhnen. Dennoch geraten die Mittelamerikanischen Maquilas immer mehr unter Druck,<br />
in China sind die Löhne noch niedriger. Dies zeigt die Schwäche dieses Modells. Die ZFI bietet<br />
keinen Raum für Entwicklungen und Innovationen, die Länder bleiben konstant auf dem Level<br />
der 1970er Jahre. Zudem begeben sie sich in eine Abhängigkeit von westlichen<br />
Industrieländern, denn so einfach eine Betriebsansiedelung möglich ist, genauso schnell und<br />
einfach ist eine Absiedelung. Dieser ständige Druck führt dazu, dass Gewerkschaften kaum Fuß<br />
fassen können und dass Arbeitsrechte ständig zur Disposition stehen.<br />
Dies zeigt, dass sich trotz der Bewegung in Lateinamerika einige Regionen nicht<br />
weiterentwickelt haben. Damit Lateinamerika endlich den Sprung schafft, muss eine andere<br />
Entwicklungsstrategie von der EU zugelassen werden. Die Freien Produktionszonen sind nicht<br />
der richtige Weg.<br />
Ungleichbehandlung und Diskriminierung<br />
Die Ursachen für Ungleichbehandlung sind vielfältig, besonders am Arbeitsmarkt wird diese<br />
deutlich. Zu den Hauptfaktoren und besonderen Herausforderungen gehören die Bekämpfung<br />
von Armut und sozialem Ausschluss auf dem Arbeitsmarkt. Die bisherige wirtschaftliche<br />
Dynamik den Ländern Lateinamerikas hat es nicht vollbracht einen Großteil der Bevölkerung in<br />
formale und faire Arbeitsverhältnisse zu bringen. Nach wie vor schaffen Arbeitslosigkeit,<br />
Unterbeschäftigung und niedrige Löhne einen sozialen Ausschluss von den Arbeitsmärkten, der<br />
gemeinsam mit einer fehlenden sozialen Sicherung wiederum eng verknüpft ist mit Armut und<br />
Diskriminierung. Dieser Zirkel aus prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen ist nur schwer zu<br />
durchbrechen.<br />
Obwohl in den letzen Jahren Gesetze zur Gleichberechtigung gegen Ungleichheit und<br />
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der ethnischen Herkunft verabschiedet<br />
121
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
wurden, herrschen Ungerechtigkeiten vor, die oft mit Faktoren einhergehen, die wiederum<br />
Strukturen sozialer Ausgrenzung, ökonomischer Integration und Armut bedienen. In<br />
Lateinamerika gehören 40 Prozent der Bevölkerung indigenen oder afrikanischen<br />
Volksgruppen an. Sie bilden auch aufgrund ihrer Herkunft die ärmsten Bevölkerungsanteile. So<br />
sind in Honduras beispielsweise 87 Prozent der indigenen Bevölkerung Analphabeten, die<br />
Brasilianer afrikanischer Herkunft arbeiten vorrangig in prekären Arbeitsverhältnissen und in<br />
Peru verdient ein Arbeiter gemischter Abstammung 70 Prozent weniger als ein „weißer<br />
Arbeiter“, während ein indigener Arbeitnehmer noch einmal 40 Prozent weniger Lohn erhält.<br />
Besonders junge Menschen, die zum Teil mittlerweile die Mehrheit an Arbeitskräften bilden,<br />
sind von einer zukunftsträchtigen Arbeitswelt ausgeschlossen. Sie finden sich vielmehr oft in<br />
prekären Arbeitsverhältnissen wider bzw. sind von einer hohen Arbeitslosigkeit betroffen.<br />
Gender<br />
Frauen – und dabei im Besonderen die indigenen und farbigen Frauen – sind überwiegend in<br />
informellen Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Hinzu kommt, dass sie in Sektoren arbeiten, in<br />
denen die niedrigsten Löhne gezahlt werden, die niedrigste soziale Sicherheit und die geringste<br />
Möglichkeit der Interessenartikulation und -organisation bieten. Obwohl sich die Zahl von<br />
Frauen in urbanisierten Räumen in der Arbeitswelt Lateinamerikas stetig seit 1990 bis 2002 von<br />
43 auf 49 Prozent erhöht hat, stehen sie noch immer strukturellen Schwierigkeiten gegenüber<br />
in ein Arbeitsverhältnis einzutreten und dieses zu halten. Obwohl die Emanzipation der Frau<br />
mit ihrer Beteiligung am Arbeitsleben einherging, herrschen noch immer soziale und<br />
ökonomische Ungleichheit. Forderungen nach gleicher Bewertung der gearbeiteten Arbeit, das<br />
Überkommen einher gebrachter Geschlechterrollen und der Verteilung der häuslichen<br />
Pflichten und Aufgaben auf beide Geschlechter sind aktueller denn je. Frauen verdienen noch<br />
immer vielfach weniger als Männer. So verdienten Frauen im Jahr 2000 noch immer nur 66<br />
Prozent des Gehaltes ihres männlichen Arbeitskollegen trotz einer möglicherweise besseren<br />
Ausbildung. Um die Gehaltslücke ausgleichen zu können, bedarf es einer vier Jahre längeren<br />
(Schul-) Ausbildung der Frau. Die Herausforderung einer gleichberechtigten<br />
Arbeitsmarktpolitik verlangt neutrale Instrumente, welche die Ungleichheit nicht noch<br />
verstärken soll.<br />
Die Partizipation der Frauen in Ländern Lateinamerikas in der Arbeitswelt hat nicht<br />
zwangsläufig auch zu einer veränderten Stellung in den Familien geführt. So verändern sich<br />
traditionelle Geschlechterrollen nur allmählich und somit auch deren Aufgaben innerhalb der<br />
Familien.<br />
122
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die besonderen Bedürfnisse und der Schutz von werdenden Müttern sowie nach der Geburt am<br />
Arbeitsplatz sind oft nur unzureichend durchgesetzt.<br />
Häufig werden Frauen und Kinder Opfer sexueller Gewalt und Ausbeutung. Die Realität von<br />
sexueller Belästigung und Gewalt sowie von Sklaverei und Menschenhandel. Im Bereich der<br />
Prostitution sind das keine Ausnahmen und bedauerliche Randphänomene, sondern Ausdruck<br />
und Folge der miserablen Stellung von Frauen und Kindern in der Wirtschafts- und Arbeitswelt<br />
vieler armer Staaten, auch in Lateinamerika.<br />
Decent Work umsetzen!<br />
Die Formalisierung von Arbeitsverhältnissen<br />
Die zentrale Herausforderung einer Formalisierung von Arbeitsverhältnissen ist eine<br />
nachhaltige Armutsbekämpfung und die Integration in bzw. Schaffung sozialer<br />
Sicherungssysteme. Um dieses Ziel zu erreichen muss im Mittelpunkt der Bemühungen eine<br />
Institutionalisierung der Arbeitsverhältnisse stehen. Oftmals bestehen in den einzelnen<br />
Ländern fortschrittliche Rechtsordnungen. Der Unterschied zwischen gesetztem Recht und der<br />
Rechtswirklichkeit ist aber fast immer eklatant. Trotzdem sind rechtliche Vorkehrungen zum<br />
Schutz informell Beschäftigter in jedem Fall ein Ansatzpunkt, wenn er auch allenfalls nur am<br />
Anfang stehen kann. Die Bemühungen zu einer Formalisierung sind auch darauf gerichtet, das<br />
Steueraufkommen in den betroffenen Staaten zu erhöhen. Nur so kann die Staatsquote erhöht<br />
werden und wichtige Grundrechte wie Bildung, Gesundheit und soziale Sicherung als<br />
öffentliche Güter bereitgestellt werden. Gleichzeitig müssen die Regierungen ihre<br />
Deregulierungspolitik stoppen und die Praxis beenden, ehemals im öffentlichen Dienst<br />
Beschäftigte in prekäre Arbeitsverhältnisse zu drängen. Gesetze gegen Leiharbeit müssen<br />
verabschiedet und implementiert werden.<br />
Staaten dürfen Arbeitsschutznormen nicht nur beschließen, die Rechte der ArbeitnehmerInnen<br />
müssen staatlicherseits durch Inspektionen überprüft werden. Entsprechende<br />
Arbeitsrechtsnormen sind die Voraussetzung für ein geregeltes Verfahren zur Inspektion. Die<br />
Kapazitäten für solche Inspektionen müssen gestärkt und VertreterInnen der Beschäftigten<br />
beteiligt werden.<br />
So genannte Mikrounternehmen beschäftigen einen großen Teil der in der informellen<br />
Ökonomie tätigen ArbeitnehmerInnen. In den Ländern Südamerikas arbeiten im Durchschnitt<br />
65% der Beschäftigten in Mikrounternehmen ohne Arbeitsvertrag. Das gilt ebenso für die<br />
Landwirtschaft und den häuslichen Sektor. Die notwendigen Investitionen in reguläre<br />
123
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Arbeitsverhältnisse können sie sich zu einem überwiegenden Teil nicht leisten. Sie können<br />
durch Mikrokredite unterstützt werden, um Kapazitäten und Kenntnisse aufzubauen, um<br />
reguläre Arbeitsverhältnisse zu schaffen.<br />
Sozialversicherungen für alle ArbeitnehmerInnen und ihre Angehörigen<br />
Zu „Guter Arbeit“ (Decent Work) gehört die Absicherung elementarer Lebensrisiken. Sind<br />
arbeitende Menschen und ihre Angehörigen von Armut und Elend bedroht, ist eine solidarische<br />
Gesellschaft als Grundbedingung für Frieden oft nicht vorhanden. Eine Absicherung<br />
elementarer Risiken für alle Menschen ist grundlegendes Menschenrecht und muss von allen<br />
Gesellschaften und Staaten oder ggf. von regionalen oder globalen Kooperationen umgesetzt<br />
werden. Wo sie nicht vorhanden sind, müssen in Lateinamerika nachhaltige staatliche<br />
Sicherungssysteme zur Kranken-, Invaliden-, Unfall- und Altersrentenversicherung eingeführt<br />
werden.<br />
Gleichberechtigung in der Arbeitswelt<br />
Die Nichtdiskriminierung ist einer der vier Hauptaspekte der Kernarbeitsnormen der ILO und<br />
betrifft auf den Arbeitsmärkten der so genannten „Dritten Welt“ vor allem die Rechte von<br />
aufgrund ihres Geschlechts diskriminierten Frauen. Es muss hier wie überall eine<br />
Arbeitsumgebung geschaffen werden, die ihnen gleiche Chancen und Entlohnung bietet, die<br />
ihnen spezifisch passenden Gesundheitsschutz bietet. Schwangerschaft ist ein<br />
frauenspezifisches „elementares Risiko“, dem überall durch Mutterschutz und<br />
Kündigungsschutz begegnet werden muss, um Diskriminierung zu verhindern. Mutterschaft<br />
führt in den patriarchal strukturierten Gesellschaften weltweit zu einer Mehrfachbelastung der<br />
Frauen. Erziehung muss mehr als gemeinsame Aufgabe der Geschlechter und als Aufgabe der<br />
gesamten Gesellschaft behandelt werden, entsprechende Hilfen und Betreuungseinrichtungen<br />
sind staatlicherseits zu fördern und einzurichten.<br />
Die Lohndiskriminierung ist weltweit zu bekämpfen und abzuschaffen, von diesem alten Ziel<br />
sind wir nach wie vor weit entfernt.<br />
Frauen sind häufiger von informellen Arbeitsverhältnissen betroffen. Sie sind seltener<br />
organisiert bzw. in wichtigen Positionen in Organisationen wie Gewerkschaften oder auch<br />
Unternehmen. Darum sind ihre Belange häufig nicht im Blickfeld der verhandelnden und<br />
entscheidenden Personen. Diesem Defizit muss mit Quotierungen und inhaltlicher Gender<br />
Mainstreaming Politik begegnet werden.<br />
124
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Frauen müssen Zugang zu allen Bereichen der Arbeitwelt und allen (Aus-) Bildungswegen<br />
bekommen. Hierzu muss Politik und Gesellschaft darum kämpfen alte Rollenvorstellungen und<br />
diskriminierende Strukturen in den patriarchalen Gesellschaften abzuschaffen.<br />
Frauen leisten nicht nur unterbezahlte und besonders prekäre Arbeit, z.B. in Heimarbeit oder<br />
als Hausangestellte. Frauen arbeiten weltweit auch vielfach UNBEZAHLT, weil typische<br />
Frauentätigkeiten (reproduktive Arbeit) nicht als berufliche Beschäftigung organisiert sind.<br />
Menschenhandel und sexualisierter Gewalt – auch im wirtschaftlichen Bereich - muss<br />
staatlicherseits konsequent der Kampf angesagt werden und entsprechend das staatliche<br />
Gewaltmonopol zurückerobert werden.<br />
Nationale und überregionale Integration von Gewerkschaften<br />
Die Gewerkschaften in Lateinamerika gerieten im Zuge neoliberaler Reformen im letzten<br />
Jahrzehnt nicht nur politisch in die Defensive, sondern litten auch unter einer strukturellen<br />
Schwäche: Der geringe Organisationsgrad mit zudem rückläufigen Mitgliederzahlen,<br />
Zersplitterung und dem Fehlen eines schlagkräftigen Dachverbandes führten zu einer nur noch<br />
untergeordneten Rolle der Gewerkschaften in einigen lateinamerikanischen Ländern.<br />
Die Internationale Gewerkschaftslandschaft befindet sich im Umbruch: Seit der Gründung des<br />
Internationalen Gewerkschaftsbundes im Jahr 2006 stehen traditionelle<br />
Gewerkschaftsorganisationsformen auf dem Prüfstand, neue regionale Verbünde befinden<br />
sich in der Gründung.<br />
Erst die Amtsübernahme von mehr und mehr linken Regierungen eröffnete den<br />
Gewerkschaften neue Handlungsspielräume, sodass schließlich Verhandlungen über eine neue<br />
regionale Dachorganisation des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) für Lateinamerika<br />
aufgenommen werden konnten.<br />
Die beiden Hauptakteure sind die Organización Regional Interamericana de Trabajadores<br />
(ORIT) und die Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) – zwei Organisationen, deren<br />
Beziehung in der Vergangenheit hauptsächlich von Konkurrenz und Konflikten geprägt war.<br />
Neben organisatorischen Fragen, nach Finanzen oder der Zusammensetzung des zukünftigen<br />
Vorstands, stehen vor allem grundsätzliche Fragen im Zentrum der Verhandlungen, zum<br />
Beispiel nach regionalen Politikansätzen und ausreichender Präsenz in der Fläche.<br />
125
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Auf der politischen Agenda des neuen Dachverbandes wird zwangsläufig die Umsetzung der<br />
ILO Kernarbeitsnormen ein Thema sein, da es in diesen Bereichen in ganz Lateinamerika noch<br />
große Defizite gibt, der Bereich Kinderarbeit sei hier besonders zu nennen.<br />
Ein Ziel zu erreichen gelingt selten allein. Nicht nur in der Politik bedarf es überregionaler wie –<br />
nationaler Zusammenarbeit. Gerade auch für die sozialen Bewegungen und besonders die<br />
Gewerkschaften. Multinational agierenden Konzernen müssen transnational agierende<br />
Gewerkschaften entgegentreten, um die Interessen der ArbeitnehmerInnen effektiv vertreten<br />
zu können. Einen Orientierungsrahmen für ganz Lateinamerika bietet der MERCOSUR.<br />
Voraussetzung hierfür ist die effektive Organisation auf unteren Ebenen. Ziel muss es sein, die<br />
lateinamerikanischen Gewerkschaften zu unterstützen.<br />
Nur durch Konkretisierung und Vernetzung der bestehenden und berechtigten Forderungen<br />
kann es zu ihrer Umsetzung kommen. Zudem kann so die Zielgruppe gezielter angesprochen<br />
und ein höherer Organisationsgrad der Gewerkschaften erreicht werden. Dies wiederum<br />
erhöht die Schlagkraft.<br />
Mit dem entsprechenden Druck und internationaler Unterstützung werden die<br />
ArbeitnehmerInnenrechte in Lateinamerika nicht mehr zu ignorieren sein können.<br />
Regeln für die Globalisierung<br />
Um den jetzigen Privilegiertenkreis zu durchbrechen und Teilhabe für alle zu erreichen, bedarf<br />
es klarer Regeln für die Globalisierung. Es gilt Alternativen jenseits von Privatisierung und<br />
Deregulierung aufzuzeigen und eine Entwicklung in Richtung Demokratie, Freiheit und der<br />
Verwirklichung des Rechts auf Wohnung, Nahrung, Bildung, angemessene Arbeit und<br />
Umweltschutz möglich zu machen.<br />
Wir fordern eine Abkehr von der bisherigen imperialistischen Freihandelspolitik der<br />
Industrienationen. Anstatt die bisher unterprivilegierten Länder mit Unterstützungsleistungen<br />
„ruhig zu stellen“ geht es vielmehr darum eine gerechte neue Weltwirtschaftsordnung zu<br />
schaffen. Die Verfügung der Bevölkerung über die Ressourcen, Rohstoffe und<br />
Produktionsmittel muss Grundlage für diese neue Weltwirtschaftsordnung sein.<br />
Dennoch soll dies zunächst keine Abkehr von den laufenden Unterstützungsbestrebungen<br />
bedeuten, sondern vielmehr den Fokus verstärkt auf den Aufbau von demokratisch<br />
legitimierten Finanz- und Sozialstrukturen in den unterprivilegierten Ländern lenken.<br />
126
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Hierbei darf „Demokratisierung“ nicht zur Legitimation jedweder Handlungen werden, viel<br />
wichtiger ist es, auf eine internationale Umsetzung der Menschenrechte und eine Etablierung<br />
von gerechtem Sozial- und Arbeitsrecht hinzuarbeiten.<br />
Vormachtbestrebungen einzelner Staaten der Welt, darunter auch Deutschland, und die<br />
daraus resultierenden Konfliktsituationen können nur von einer starken und reformierten UNO<br />
eingedämmt werden. Auch Problemlagen der Gesundheits-, Anti-Drogen- und<br />
Flüchtlingspolitik können nur noch in den verschiedenen internationalen Verbünden geregelt<br />
werden.<br />
Deutschland muss hier eine positive Rolle spielen und sich sowohl auf europäischer- als auch<br />
auf internationaler Ebene für den Vorrang ziviler Mittel einsetzen.<br />
Im Sinne der internationalen Solidarität muss es unser Ziel sein ökonomische, soziale und<br />
kulturelle Aspekte der globalen Ordnung gleichberechtigt und gerecht zu behandeln und<br />
gestalten.<br />
Einklagbarkeit von sozialen Rechten (intern. Sozialgericht)<br />
Um die Forderung nach sozialen Rechten international vertreten zu können, muss deren<br />
Einklagbarkeit möglich gemacht werden. Hierfür bedarf eines Internationalen<br />
Sozialgerichtshofes (ISG), der nach dem Modell des Internationalen Strafgerichtshofes<br />
funktioniert.<br />
Die alleinige Schaffung eines solchen Gerichtshofs bringt jedoch nicht den erhofften Nutzen,<br />
wenn dieser nicht mit umfangreichen Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet ist und diesen über<br />
die effektive Unterstützung der Vereinten Nationen kein Nachdruck verliehen werden kann.<br />
Nur mit einer derartigen Institution wird es möglich sein, nachhaltig Druck auf multinational<br />
agierende Konzerne auszuüben und so unterdrückte und ausgebeutete Menschen zu ihrem<br />
Recht kommen zu lassen.<br />
Der ISG wird ein wichtiges Mittel sein, auf die Unanfechtbarkeit von Menschen-, Sozial- und<br />
Umweltrecht aufmerksam zu machen. Zudem würde er mit entsprechender Kopplung an ein<br />
internationales Exekutivorgan entscheidend die Handlungsmacht der Vereinten Nationen<br />
erhöhen.<br />
127
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
ECOSOC stärken<br />
Um die Stellung der UN zu stärken bedarf es einer Reform ihrer Institutionen und Strukturen.<br />
Über die Tatsache hinaus, dass über eine Neustrukturierung des Sicherheitsrates entschieden<br />
werden muss, muss die Handlungsmacht der Vereinten Nationen vor allen Dingen in sozialen<br />
Fragen gestärkt werden. Anstatt lediglich Handelsblockaden zu erheben müssen die UN Mittel<br />
erhalten Forderungen nach Menschen- und Sozialrechten bindend durchzusetzen und<br />
Konfliktsituationen weitestgehend friedlich zu lösen. Der Wirtschafts- und Sozialrat der<br />
Vereinten Nationen (ECOSOC) muss ein deutlich stärkeres Gewicht bekommen und Wege und<br />
Instrumente erhalten, Forderungen wie die Milleniumsziele o.ä. effektiv durchzusetzen.<br />
Wichtige Richtschnur im Kampf für international gültiges Arbeitsrecht sind die internationalen<br />
Kernarbeitsnormen („Core Labour Standards“, CLS), die von der „International Labour<br />
Organisation“ (ILO) festgelegt wurden. Hinter ihnen darf kein Unternehmen zurückbleiben.<br />
Hierbei handelt es sich um fundamentales Arbeitsrecht welches vor allen in Entwicklungs- und<br />
Schwellenländern dringend umgesetzt werden muss. Besonders westliche Konzerne, die ihre<br />
Standorte verlagern erfahren ihre Profitsteigerung vor allen Dingen aus Nichteinhaltung der<br />
CLS. Um öffentlich Druck auszuüben ist dementsprechend auch Engagement in Deutschland<br />
von Nöten. Wir <strong>Jusos</strong> streben deshalb eine Kampagne an, CLS bekannt zu machen und auf eine<br />
ungleiche Weltordnung und die entscheidende Bedeutung internationalen Arbeitsrechts<br />
aufmerksam zu machen.<br />
128
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
G<br />
Gleichstellungspolitik<br />
G 1 - Bundesvorstand<br />
Gleichstellung – jetzt!<br />
Die heutige Gesellschaft ist noch immer eine patriarchal geprägte Gesellschaft. Trotz der<br />
großen Erfolge der Frauenbewegung, die sich in entsprechenden Rechtsvorschriften, aber auch<br />
in einer gesellschaftlichen Öffnung niedergeschlagen haben, sind wir noch immer auf dem<br />
Weg zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft, in der sich Lebenswege nicht an der<br />
Geschlechtergrenze entscheiden.<br />
Die Wirkungsmechanismen innerhalb unserer Gesellschaft, die Frauen gleichen Zugang zu<br />
Macht und Einfluss, aber auch (zu bestimmten Bereichen) der Erwerbsarbeit verwehren, sind<br />
subtiler geworden. Deshalb ist die gläserne Decke für viele zuerst Fiktion, dann aber -<br />
spätestens mit eigenen Kindern – Realität.<br />
Arbeit bildet einen wichtigen Baustein zur gesellschaftlichen Integration und Partizipation.<br />
Diese Möglichkeit darf niemandem auf Grund seines/ ihres Geschlechtes, seiner /ihrer<br />
Herkunft, der sexuellen Orientierung und seines / ihres Lebensentwurfes, beispielsweise als<br />
(allein-) erziehendeR Vater oder Mutter, pflegendeR AngehörigeR etc. verwehrt bleiben. Gute<br />
Arbeit ist für uns <strong>Jusos</strong> ein fundamentales Recht eines jeden Menschen. Arbeit und das damit<br />
verbundene Einkommen sichert in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, einerseits ein<br />
weitgehend freies, selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen zu können, andererseits<br />
Anerkennung zu erfahren und an relevanten (sozialen oder produktiven) gesellschaftlichen<br />
Prozessen und Auseinandersetzungen direkt zu partizipieren/ beteiligt zu sein.<br />
Die Diskriminierung von insbesondere Frauen vollzieht sich auf dem Arbeitsmarkt auf<br />
verschiedenen Ebenen:<br />
Strukturell werden Frauen durch die Aufteilung in bezahlte und unbezahlte Arbeit<br />
benachteiligt und systematisch ausgegrenzt. Gleichzeitig findet durch die horizontale<br />
Segmentierung des Arbeitsmarktes, d.h. die Aufteilung von Berufen in typisch männliche und<br />
typisch weibliche und damit verbunden unterschiedliche monetäre Bewertung, sowie die<br />
vertikale Machtverteilung innerhalb der Berufsgruppen, weitere Diskriminierung statt. Die<br />
129
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
„weibliche“ Arbeit, die am Markt erbracht wird, wird niedriger bewertet und so entstehen<br />
ungleiche Zugangschancen zu gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und darüber vermittelt<br />
politischer Macht.<br />
Dabei werden Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt in doppelter Hinsicht strukturell<br />
diskriminiert: als Frau und als Migrantin. Zur Kategorie „weibliche Arbeit“ tritt die Ethnisierung<br />
von Arbeitssegmenten die ebenfalls mit einer geringen gesellschaftlichen und daraus<br />
resultierenden geringen monetären Bewertung einhergeht<br />
Diese Mechanismen greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig. Will man diese<br />
Mechanismen und Praktiken aufbrechen, so muss man auf den verschiedenen Ebenen<br />
ansetzen, jedoch nicht mit bloßen Einzelmaßnahmen, sondern mit einem Gesamtpaket,<br />
dessen Einzelreformen gegenseitig verstärkend wirken und nur in der Verzahnung wirksam<br />
Diskriminierung abbauen. Dabei darf jedoch nicht, wie in den letzten Jahren vielfach auf<br />
Bundesebene praktiziert, allein die familienpolitische Dimension im Vordergrund stehen.<br />
Gleichstellung geht weit über den privaten Bereich hinaus, hat ihre eigenen Instrumente und<br />
muss gleichzeitig als Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen angewendet werden.<br />
Der Diskriminierung ein Ende setzen – Gleichstellung verwirklichen.<br />
1) Private Arbeit fair teilen<br />
Arbeit(szeit) fairteilen<br />
Erwerbs- und Reproduktionsarbeit sind zwischen den Geschlechtern noch sehr unterschiedlich<br />
verteilt.<br />
Noch immer stecken hauptsächlich Frauen beruflich zurück, um Arbeit in Hauhalt und für die<br />
Familie zu leisten. Noch immer ist es zu meist das Problem der Frauen, Berufstätigkeit und<br />
Haushalt zu vereinbaren sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sichern.<br />
Reproduktionsarbeit ist Voraussetzung von Erwerbsarbeit. Auch darum ist die Erwerbsarbeit<br />
zwischen den Geschlechtern sehr unterschiedlich verteilt. Die durchschnittliche<br />
Erwerbsarbeitszeit von Frauen liegt mit 30,8 Stunden pro Woche knapp 10 Stunden unter<br />
denen der Männer (40,2) Stunden3.<br />
Bei der Teilzeitarbeit zeigt sich die größte Diskrepanz zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit<br />
von Frauen und Männern, 85 % der Teilzeitarbeitenden sind weiblich. Besonders auffällig dabei<br />
3 Mikrozensus 2004.<br />
130
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
ist, dass vor allem arbeitende Frauen mit Kindern eine Beschäftigung im Teilzeitmodell wählen.<br />
28% der Paarhaushalte wählen das Vollzeit (Mann)/Teilzeit (Frau)-Modell, nur 3% praktizieren<br />
dieses unter umgekehrten Vorzeichen Mehr als die Hälfte aller arbeitenden Frauen mit Kindern<br />
arbeiten in dieser Form, in anderen Ländern, beispielsweise in Portugal oder Finnland, sind es<br />
nur 7 – 8 Prozent. Hier wird deutlich: Der recht hohen Erwerbsbeteiligung von Frauen in<br />
Deutschland steht ein recht geringes Arbeitsvolumen von Frauen in bezahlter Arbeit<br />
gegenüber. Studien zeigen, dass die Vollzeiterwerbstätigkeit bei Frauen zu Gunsten von<br />
Teilzeitarbeit gesunken ist.<br />
Dies ist nicht nur für die eigenständige Versorgung von Frauen heute problematisch, sondern<br />
wirkt sich auch auf die Lohnersatzleistungen (ALG I und Elterngeld), aber auch besonders auf<br />
die Rentenansprüche aus.<br />
Fragt man Frauen und Männer nach ihren Wunscharbeitszeiten, so liegen diese bei 37<br />
Wochenstunden bei den Männern und bei 27 (West) bzw. 34 (Ost) Wochenstunden bei den<br />
Frauen. Gefragt nach dem bevorzugten Modell nennen viele Frauen das Vollzeit<br />
(Mann)/Teilzeit(Modell) (IAB Werkstattbericht 2002). Diese Wünsche sind zum einen zwar für<br />
die Orientierung politischer Vorschläge wichtig, sie spiegeln aber auch gesellschaftliche<br />
Realitäten und Rahmenbedingungen ( wie z. B. unzureichende Betreuungsmöglichkeiten und<br />
lange Arbeitswege) wieder, an denen sich Frauen und Männern bei ihren Antworten in<br />
Umfragen orientieren.<br />
• Erwerbsarbeit gerecht verteilen/ Geschlechtergerechtes Zweiverdiener-<br />
Innenmodell.<br />
Um die Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern gerechter aufzuteilen bedarf es<br />
einer staatlich flankierten (Wochen)-Arbeitszeitverkürzung. So kann zum einen den<br />
Wünschen von Frauen und Männern entsprochen werden, weniger zu arbeiten und<br />
zum anderen mehr ist es möglich, gesellschaftliche Gleichheit und Partizipation zu<br />
verwirklichen. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass Arbeitszeitverkürzung<br />
über Flexibilisierung zu Gunsten der ArbeitnehmerInnen genutzt wird, sondern zu<br />
einem Gewinn an Zeitsouveränität führt. Tarifliche und betriebliche Modelle, die<br />
über die staatliche allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit hinaus gehen, sichern<br />
dieses ab und verlagern die Verhandlungen über Arbeitszeit von der<br />
repressionsanfällige individuelle Ebene auf die betriebliche bzw.<br />
tarifpartnerschaftliche. Bestrebungen einer Arbeitszeitverlängerung ist auf allen<br />
Ebenen entschieden entgegen zu treten.<br />
• Diskussionen über Zeitsouveränität weiterführen.<br />
131
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Weitere Modelle, die mehr Zeitsouveränität in Bezug auf längere Lebensphasen<br />
(Arbeitszeitkonten u.ä.) schaffen, sind zu diskutieren und unter einem<br />
gleichstellungspolitischen Blickwinkel zu bewerten.<br />
Ein weiteres Indiz für die ungleiche Verteilung von Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit zeigt<br />
sich bei der Betrachtung des Arbeitsstunden- und Überstundenvolumens auf Vollzeitstellen.<br />
Vor allem in der Familiengründungsphase, also zwischen Ende zwanzig und Ende dreißig<br />
Jahren, geht die Schere beim Überstundenvolumen zwischen Mitarbeiterinnen und<br />
Arbeitnehmern massiv auseinander. In dieser Zeit ist bei Arbeitnehmerinnen durchschnittlich<br />
ein deutlicher Einbruch in der Arbeitszeit festzustellen. Dies hat Auswirkungen sowohl auf die<br />
Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit, also von bezahlter und unbezahlter Arbeit, als auch<br />
auf Karrierewege und die damit verbundenen Entgelteinbußen. Überstundenregelungen sind<br />
durch die Begrenzung der Wochenhöchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz sowie in Richtlinien<br />
der europäischen Union zu finden, die jüngst die mögliche Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden<br />
heraufgesetzt hat. Dies hat weder etwas mit einer Förderung von Gleichstellung noch mit<br />
Guter Arbeit zu tun.<br />
Überstunden regulieren. Auch aus gleichstellungspolitischen Gründen treten wir für eine<br />
Regulierung von Überstunden ein. Die Anzahl der Überstunden pro Woche muss stärker als<br />
bisher beschränkt werden. Außerdem ist ein Ausgleich in Freizeit, der höher liegt als die Anzahl<br />
der Überstunden in einer bestimmten arbeitswissenschaftlich fundierten Frist zu<br />
gewährleisten.<br />
Auf dem Weg zu einer Neubewertung aller Arbeit ist die paritätische Verteilung von<br />
Reproduktions- und Produktionsarbeit auf beide Geschlechter unabdingbar. Bei der<br />
Umstrukturierung in einen geschlechtergerechten Arbeitsmarkt darf das Augenmerk nicht<br />
einseitig auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelegt werden, dennoch ist dies ein nicht zu<br />
vernachlässigender Aspekt. Nur wenn der Arbeitsmarkt familienfreundlich gestaltet wird,<br />
können alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebensentwürfen zu gleichen Teilen auf<br />
ihm partizipieren.<br />
Die gleiche Partizipation beider Geschlechter an Arbeit – was sowohl die unbezahlte, als auch<br />
bezahlte Arbeit einschließt – ist eine wichtige Voraussetzung einer gleichberechtigten<br />
Gesellschaft. Um die paritätische Aufteilung von Erwerbs- und Hausarbeit voranzutreiben,<br />
bedarf es struktureller und gesellschaftlicher Veränderungen:<br />
Das von der Großen Koalition eingeführte Elterngeld hat Perspektiven zu einer gleicheren<br />
Verteilung der Erziehungsarbeit und in der Folge auch der Erwerbsarbeit zwischen den<br />
132
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Geschlechtern geschaffen. Allerdings ist die Aufteilung der Eltern(geld)zeit immer noch stark<br />
zu Ungunsten der Frauen verzerrt. Der Beitrag der Männer beschränkt sich häufig lediglich auf<br />
die zwei vorgeschriebenen „Vätermonate“, während Frauen weit überwiegend die restlichen 12<br />
Monate auf ihre Erwerbstätigkeit verzichten. Die Koppelung des Elterngeldes an das zuvor<br />
erzielte Einkommen hat die Einkommensausfälle verringert, die durch den Verzicht des (wegen<br />
der traditionellen Einkommensverteilung) häufig besser verdienenden Vaters auf<br />
Erwerbstätigkeit entstehen. Dadurch sind die Anreize, die Erziehungsarbeit zu Ungunsten der<br />
Mutter aufzuteilen, verringert worden. Wir <strong>Jusos</strong> begrüßen die Zunahme der Elterngeldanträge<br />
von Vätern, allerdings reichen die bisher erzielten Fortschritte nicht aus.<br />
Außerdem hat die mit dem Elterngeld verbundene Absenkung des Erziehungsgeldes zum<br />
jetzigen Sockelbetrag teils massive soziale Auswirkungen im Bereich der GeringverdienerInnen<br />
und nicht erwerbstätigen Eltern gehabt. Das Elterngeld ist daher auch immer aus sozialen<br />
Gründen kritisch zu sehen, da es die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufmacht.<br />
Das Elterngeld muss dringend weiterentwickelt werden, um eine weitere Gleichverteilung der<br />
Erziehungsarbeit zu schaffen. Wir fordern daher:<br />
• 50/ 50 – Aufteilung der Elternzeit: Die Elternzeit muss paritätisch zwischen beiden<br />
Elternteilen aufgeteilt werden, sofern nicht ein Elternteil alleinerziehend ist. Nur wenn<br />
beide Elternteile die gleiche Zeitdauer in Anspruch nehmen, wird das Elterngeld<br />
vollständig gezahlt. Diese stärkere Verpflichtung erleichtert insbesondere Männern, sich<br />
gegen tradierte Rollenzu-sprechungen des Umfeldes und des Arbeitsmarktes<br />
durchzusetzen und sich an der Familienarbeit zu beteiligen. Um den Eltern die<br />
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, fordern wir, dass gebührenfreie<br />
Kinderbetreuung ab der Geburt angeboten wird.<br />
• Anhebung des Berechnungssatzes: Da auf Grund struktureller Mechanismen und<br />
der geschlechterspezifischen Berufswahl noch immer das männliche Elternteil häufig<br />
der Hauptverdiener ist, muss die Vergütung von 67 Prozent des Einkommens der<br />
letzten zwölf Monate auf 80 Prozent angehoben werden.<br />
• Höhere Grundvergütung des Elterngeldes: Um einkommensschwächere Eltern,<br />
StudentInnen und andere wenig oder nicht erwerbstätige Eltern nicht zu<br />
benachteiligen, fordern wir <strong>Jusos</strong> darüber hinaus, die Aufstockung des Grundbetrages<br />
des Elterngeldes.<br />
Zu einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört viel mehr als die Finanzierung der ersten<br />
vierzehn Monate. Denn die Entscheidung für ein Kind hängt von vielen Faktoren ab. Unsichere<br />
Arbeitsverträge mit kurzer Laufzeit ohne ausreichenden Kündigungsschutz sowie eine<br />
zunehmende projektbezogene Einstellung auf Honorarbasis verhindern beständige und<br />
133
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
langfristige Lebensplanungen von Männern und Frauen. Die wirtschaftlich häufig geforderte<br />
Flexibilität kann das Aufbauen längerer und somit tendenziell kinderreicherer Beziehungen<br />
erschweren und die Angst davor, nach der Elternzeit nicht mehr vollkommen in den alten Beruf<br />
einsteigen zu können, dadurch den Anschluss an Technik und Betrieb verloren zu haben oder<br />
zukünftig mit einem Kind nicht mehr in vergleichbaren Positionen eingestellt zu werden,<br />
erschweren die Integration verschiedener Lebensentwürfe und die Realisierung eines Lebens<br />
mit Erwerbstätigkeit und Kindern.<br />
• Ausbau und Gebührenfreiheit der Kinderbetreuung: Um die Realisierung eines<br />
Lebensentwurfes, in dem Erwerbstätigkeit und Familie vorkommen, zu ermöglichen<br />
und beiden Geschlechtern die Möglichkeit zur Partizipation durch Arbeit zu geben,<br />
müssen gebührenfreie, flächendeckende, an (Schicht-)Arbeitszeiten orientierte und<br />
qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote ab Null geschaffen werden.<br />
• Professionalisierung vormals privater Arbeit: Durch die Zunahme der<br />
Frauenerwerbsquote wird der Bedarf an qualifizierter Kinderbetreuung und<br />
Haushaltsunterstützung immer größer, da vor allem Frauen sich noch immer vor der<br />
Aufgabe sehen, den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern. Gleichzeitig<br />
werden immer mehr Menschen immer älter, so dass ein erhöhter Nachfragebedarf an<br />
Pflegekräften entsteht. Hierbei gibt es allerdings das Problem der Ethnisierung von<br />
Haushaltsarbeit: personen- und sachbezogene Dienstleitungen von<br />
Haushaltsarbeiterinnen, in (fast ausschließlich) rechtlich nicht abgesicherten<br />
Beschäftigungsverhältnissen, werden zu einem erheblichen Teil von Migrantinnen<br />
erbracht. Diese Arbeitssituation ist prekär. Gerade in diesem Arbeitsbereich findet die<br />
Unterstellung der Eignung von Frauen durch so genanntes weibliches Arbeitsvermögen,<br />
in Kombination mit Nationalstereotypen, die fachliche Qualifikation unterstellen,<br />
Anwendung. Die Konsequenz sind neuartige Ungleichheitsverhältnisse, in denen sich<br />
geschlechts- und ethnizitätspezifische Diskriminierungen und Ungleichheiten<br />
gegenseitig verstärken. In Deutschland sind diese Berufe noch immer vergleichsweise<br />
schlecht angesehen. Dies muss sich ändern! Darüber hinaus muss familiär geleistete<br />
Pflegearbeit stärker als bisher entlohnt und angemessen bei der Berechnung der<br />
Rentenzeiten berücksichtigt werden. Professionalisierung heißt auch, dass<br />
haushaltsnahe Dienstleistungen verstärkt durch einen öffentlichen Sektor angeboten<br />
werden und somit bisher private unentgeldliche Arbeit bezahlt und sozial abgesichert<br />
wird. Dadurch entstehen Freiräume für die Einzelnen In anderen Ländern, z.B. in<br />
Dänemark, gibt es bereits Modelle wie care- und service Zentren. Hier gilt es, mit<br />
eigenen Konzepten anzusetzen und diese weiter zu entwickeln. Wichtig hierbei ist, dass<br />
auch Haushaltsnahe Dienstleistungen Ausbildungsberufe sind und entsprechender<br />
Qualifikation bedürfen.<br />
134
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
• Ausbau der Pflegezeit: Der Arbeitsmarkt muss flexibler werden, neben der<br />
Möglichkeit zu „Sabbaticals“, muss auch stets die Möglichkeit bestehen, relativ<br />
kurzfristig auf Veränderungen im privaten Umfeld zu reagieren ohne gänzlich aus dem<br />
Arbeitsmarkt heraustreten zu müssen.<br />
Hausfrau- und Ernährermodell ab- und Gleichberechtigung schaffen<br />
Das Sozialsystem in Deutschland stützt die traditionelle Rollenverteilung zwischen den<br />
Geschlechtern. Um Erwerbs- und Reproduktionsarbeit gleichsam auf die Geschlechter zu<br />
verteilen, bedarf es struktureller Reformen. Durch die Beibehaltung des Ehegattensplittings,<br />
die abgeleitete Versicherung der Ehegattin / des Ehegattens und ähnlicher Instrumentarien<br />
werden Anreize zur Erwerbsarbeit insbesondere von Frauen vernichtet. Die Herabwürdigung<br />
von Frauenerwerbstätigkeit als Zuverdienst und kleines Taschengeld für die Familie halten wir<br />
<strong>Jusos</strong> für völlig veraltet. Dazu fördert und verstärkt dieses Modell die Lohnunterschiede<br />
zwischen Männern und Frauen. Denn das Ehegattensplitting rechnet sich vor allem dann,<br />
wenn eine große Lohndifferenz zwischen den Ehepartnern besteht und bestärkt zusätzlich<br />
Personalchefs/-chefinnen in ihrem Bild, dass eine Frau mit Kindern nur mitverdient,<br />
wohingegen ein Mann mit Familie diese ernähren muss. Dies spiegelt sich in den Gehältern<br />
deutlich wider.<br />
Das klassische Ernährermodell mit Zuverdienerin muss endlich ausgedient haben!<br />
• Strukturelle Hemmnisse der Gleichstellung abschaffen: Wir fordern daher die<br />
Abschaffung des Ehegattensplittings zu Gunsten einer Individualbesteuerung sowie<br />
die Abschaffung der abgeleiteten Versicherung des Ehegattens / der Ehegattin. Beide<br />
Geschlechter müssen individuell auf dem Arbeitsmarkt konsequent sozial,<br />
ökonomisch und in allen Bereichen ohne Diskriminierung integriert sein.<br />
• Eigenverantwortung von EhepartnerInnen stärken. Darüber hinaus muss die<br />
Eigenverantwortung des Ehegattens / der Ehegattin gestärkt werden. Wir begrüßen<br />
daher die Reform des Unterhaltsrechts. Mit dieser wurde die Lebensstandardklausel<br />
weitgehend abgeschafft, damit ist sicherlich ein Anreiz für beide Ehepartner gesetzt,<br />
nicht auf ihre finanzielle Eigenständigkeit zu verzichten, um sich im Falle einer<br />
Scheidung, nicht all zu weit vom vorherigen Lebensstandard zu entfernen. Wir<br />
weisen weiter darauf hin, dass die Abschaffung der Lebensstandardklausel sich<br />
jedoch erst bei der Abschaffung des Ehegattensplittings voll positiv auswirken kann.<br />
• Anrechnung von Rentenansprüchen. Auch wenn die Professionalisierung weiter<br />
Teile der Reproduktionsarbeit unser Ziel ist muss kurzfristig der unbezahlten Arbeit,<br />
135
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
die zu meist von Frauen geleistet wird, Rechnung getragen werden, beispielsweise in<br />
der verstärkten Anrechnung der Rentenansprüche. Denn die schlechte oder nicht<br />
erfolgte Entlohnung für bestimmte Tätigkeiten führt nicht nur zu gegenwärtigen<br />
Problemen, wie der finanziellen Abhängigkeit von der/ dem PartnerIn, sondern auch<br />
zu zukünftigen. Da Rentenansprüche in Deutschland durch Beitragsfinanzierung<br />
erworben werden, sind vor allem Frauen im Rentensystem durch geringere Löhne, ein<br />
geringeres Arbeitsstundenvolumen und häufige Unterbrechungen der<br />
Erwerbsbiografie benachteiligt. Daraus resultiert häufig Altersarmut. Menschen, die<br />
während ihrer Erwerbsbiografie systematisch benachteiligt wurden, dürfen dies<br />
nicht und dann in vielleicht noch härterer Form im Alter zu spüren bekommen.<br />
Auch das Private ist politisch<br />
Auch wenn der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen für mehr Selbstbestimmung und<br />
Wahlfreiheit schaffen kann, so sind dies zum einen häufig Angebote um ein bestimmtes<br />
gesellschaftliches (Rollen)bild zu stärken, zum anderen bleibt noch immer viel Raum für private<br />
Entscheidungen, die althergebrachten Rollenmustern Vorschub leisten. Wer letzten Endes trotz<br />
gleich aufgeteilter Arbeitszeit und ggf. Haushaltsunterstützung welche Hausarbeit erledigt,<br />
bleibt der freien Entscheidung jedes Einzelnen überlassen.<br />
Jedoch kann die Gesellschaft versuchen, für diesen Bereich ein Bewusstsein zu schaffen, so<br />
dass bestimmte Praktiken nicht einfach übernommen, sondern reflektiert und gegebenenfalls<br />
geändert werden können.<br />
• Unentgeltliche Arbeit sichtbar machen. Zusätzlich zum regulären BIP soll ein BIP<br />
berechnet werden, was die unentgeltliche Arbeit mit abbildet.<br />
Die Reproduktion von traditionellen Geschlechterrollen erfolgt meist durch die Orientierung an<br />
Vorbildern z.B. in der eigenen Familie oder aus den Medien. Die Sozialisation in Schule als auch<br />
in der Familie und dem persönlichen Umfeld tragen dazu bei, dass bestimmte Handlungen<br />
reproduziert werden oder aber auch neue Handlungsformen entstehen.<br />
Um hier eine verstärkte Reflektion zu fördern und eine Abkehr von Rollenbildern zu<br />
unterstützen, fordern wir<br />
• dass Geschlechterrollen in Kindertagesstätten, Schule, Ausbildung und Hochschule<br />
hinterfragt und zu ihrer Überwindung beigetragen wird; die Lehrenden sind<br />
entsprechend auszubilden.<br />
136
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
• dass Angebote in der Elternberatung gemacht werden, wie Kinder abseits<br />
traditioneller Geschlechterrollen erzogen werden können.<br />
• dass die Vermittlung von Rollenbildern durch die Medien kritisch diskutiert und die<br />
Darstellung alternativer Lebensentwürfe eingefordert wird.<br />
2) Segregation des Arbeitsmarktes nach männlichen und weiblichen<br />
Berufen aufheben und Vergeschlechtlichung von Berufen rückgängig<br />
machen<br />
Schon vor Einsetzen der Industrialisierung gab es eine Ungleichverteilung der Arbeit, die häufig<br />
mit physiologischen Unterschieden begründet wurde. Doch mit der Trennung des Arbeitsortes<br />
vom Wohnort entstanden zwei stark verschiedene Lebensbereiche. Zum einen die Arbeit und<br />
die Produktion von Gütern und zum anderen das Private und darin die Reproduktion des<br />
Lebens. Der Frau wurde die Reproduktionsarbeit zugewiesen, dem Mann die Lohnarbeit. Die<br />
Reproduktionsarbeit erfüllt im kapitalistischen System wichtige Aufgaben: sie stabilisiert und<br />
reproduziert das System und die dafür notwendigen Botschaften, Werte und Pflichten. Sie ist<br />
daher notwendige Voraussetzung für Erwerbsarbeit.<br />
Die klassische Teilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern zeigt sich noch heute auf dem<br />
Arbeitsmarkt. So sind Frauen heute vor allem in den Bereichen erwerbstätig, die zur klassischen<br />
Reproduktionsarbeit gezählt werden bzw. dieser stark ähneln. Männliche Arbeitnehmer<br />
arbeiten in diesen Bereichen eher selten. Über 80 Prozent der Erwerbstätigen im Gesundheitsund<br />
Sozialwesen sind beispielsweise Frauen und im Erziehungswesen stellen sie knapp zwei<br />
Drittel der Beschäftigten. Bezeichnend in diesem Kontext ist auch, dass ca. die Hälfte aller<br />
Akademikerinnen im Schulwesen tätig ist. Die im Reproduktionsbereich anfallenden Arbeiten<br />
werden zu meist gesellschaftlich wenig wertgeschätzt, bieten kaum oder wenig<br />
Aufstiegschancen und werden vergleichsweise gering entlohnt. Im Falle der Hausarbeit, die zu<br />
einem Großteil von Frauen geleistet wird, der Pflege bedürftiger Angehöriger oder der<br />
Erziehung der eigenen Kinder wird geleistete Arbeit oft überhaupt nicht entlohnt.<br />
Berufswahl – noch immer geschlechtsspezifisch<br />
Bei der Wahl eines Berufes spielt die traditionelle Rollenverteilung häufig eine entscheidende<br />
Rolle. So wählen Frauen noch immer Berufe, die ihnen als gut vereinbar mit ihrer Rolle als<br />
137
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Hausfrau und Mutter erscheinen. Wohingegen viele Männer sich für Berufe entscheiden, die<br />
sich dazu eignen eine Familie zu ernähren.<br />
Im Gegensatz zu Männern wählen Frauen ihre Ausbildungsberufe aus einem sehr viel<br />
geringeren Spektrum. Über die Hälfte aller Frauen entscheiden sich für einen der zehn<br />
beliebtesten Ausbildungsberufe, zu denen vor allem Berufe des Dienstleistungssektors<br />
gehören. Bei Männern ist es nur ein gutes Drittel. Auch die Auswahl der Studienrichtung unter<br />
studierenden Frauen ist eher eingeschränkt.<br />
Um die geschlechtsspezifische Auswahl von Berufen zu durchbrechen, bedarf es bestimmter<br />
Instrumente. Wir <strong>Jusos</strong> fordern daher:<br />
• Sensibilisierung von Lehrerinnen und Lehrern/ Förderung von verschiedenen<br />
Interessen der SchülerInnen: In der Schule wird der Grundstein dafür (mit-<br />
)gelegt, worin junge Menschen ihre Interessen und auch ihre Stärken sehen. Die<br />
Aufgabe der Schule ist es, ein vielfältiges und nicht geschlechtsspezifisches<br />
Interesse zu schaffen, Mädchen und Jungen ihr „Können“ auch in als „untypisch“<br />
empfundenen Bereichen hervorheben und sie darin zu bestärken, dieses Wissen<br />
und Können auszubauen.<br />
• den Ausbau von Maßnahmen wie „Girls Day“ und „Boys Day“: Durch den<br />
Ausbau von Maßnahmen wie des „Girls Day“ bzw. „Boys Day“ soll jungen Menschen<br />
die Gelegenheit gegeben werden, in geschlechterstereotypisch ungewöhnliche<br />
Berufe hineinzuschauen und somit den Horizont ihres Berufswahlspektrums zu<br />
erweitern. Die jährliche Durchführung des „Girls Day“ bzw. „Boys Day“ muss<br />
verpflichtend sein und darf nicht nur auf eigenem Engagement der SchülerInnen<br />
bauen. Dabei darf es jedoch nicht sein, dass Mädchen an diesem Tag bloß durch<br />
Betriebe geschleust werden. Eine eingehende Beratung und Begleitung des Tages<br />
ist notwendig, als auch eine Einbettung in den Unterricht im entsprechenden<br />
Jahrgang. Einen Boys Day halten wir nicht nur bezüglich einer Erweiterung des<br />
Berufswahlspektrum für wichtig, sondern geschlechtsspezifische Berufswahl findet<br />
von beiden Geschlechtern statt. Für einen Boys Day müssen zusätzliche finanzielle<br />
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist dabei, zu beachten, dass die<br />
Hinzunahme des „Boys Day“ nicht zur Tradierung von geschlechtertypischer<br />
Berufswahl führt. Es muss kontrollierbar bleiben, wer welchen Beruf besucht. „Girls<br />
Day“ und „Boys Day“ terminlich zu trennen, könnte dafür eine Lösung bieten.<br />
• Verbindliche Regelungen für den MINT- Bereich. In den Bereichen Mathematik-<br />
Informatik-Naturwissenschaften und Technik sind Frauen noch immer<br />
unterrepräsentiert. Die bisherigen Anstrengungen des Bundesministeriums auf<br />
138
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
diesem Gebiet sind von Aufklärung und freiwilliger Selbstverpflichtung geprägt.<br />
Auch für diesen Bereich gilt: Nur verbindliche Zielvorgaben schaffen es, den<br />
Frauenanteil zu erhöhen. Eine Zielquotierung heißt, dass die Beweislast, beim<br />
Unternehmen liegt. Sie müssen nachweisen, warum sie die Zielquotierungen nicht<br />
erfüllen können.<br />
• Zielquotierungen bei Ausbildungsplätzen. Ein ähnliches Modell wäre auf<br />
Ausbildungsplätze anzuwenden, um die geschlechtsspezifische Berufswahl aufzubrechen<br />
und Betriebe in den Einstellungsverfahren zu sensibilisieren.<br />
• Verbesserte Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit: Noch immer ist die<br />
Berufsberatung von Rollenstereotypen geleitet. Dies muss durchbrochen werden,<br />
um ein größeres Spektrum an Berufen und Studiengängen in das Blickfeld der<br />
Schulab-gängerInnen zu rücken. Jungen Männern und Frauen müssen Alternativen<br />
zu den geschlechtsstereotypischen Ausbildungsberufen aufgezeigt werden sowie<br />
Zuspruch und Hilfe darin erhalten, auch geschlechtsuntypische Wege<br />
einzuschlagen. Auch in der Job-Vermittlung lassen sich die BeraterInnen zu oft von<br />
Geschlechterstereotypen leiten, bestimmte Jobs werden Frauen oder Männern<br />
aufgrund überkommener Rollenvorstellungen gar nicht erst angeboten.<br />
Arbeitsangebote müssen zukünftig geschlechtsneutral den Arbeitssuchenden<br />
angeboten werden. Dazu müssen BerufsberaterInnen sensibilisiert und qualifiziert<br />
werden.<br />
Die schwierige Situation auf dem Ausbildungsmarkt und das mangelnde Angebot an<br />
Ausbildungsplätzen wirkt sich insbesondere negativ auf Frauen aus, obwohl diese zumeist die<br />
besseren Schulabschlüsse vorweisen können und auch bei der Suche eines Ausbildungsplatzes<br />
zumeist aktiver und flexibler sind als ihre männlichen Altersgenossen. Besonders erschreckt,<br />
dass vor allem diejenigen Frauen, die in eine Ausbildung in einer überwiegend männlich<br />
dominierten Branche ergreifen wollen, Schwierigkeiten haben, dort einen Ausbildungsplatz zu<br />
erhalten.<br />
Eine Konsequenz aus dem schlechten Lehrstellenangebot ist, dass vor allem Frauen häufig eine<br />
rein schulische Ausbildung wählen, sich mit ihrer Zweit- oder Drittwahl zufrieden geben oder<br />
aber die Zeiten in so genannten „Warteschleifen“ an Berufsschulen überbrücken, die nicht<br />
berufsqualifizierend wirken. Bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund gestaltet sich die<br />
Ausbildungslage im Dualen System noch schlechter als bei Frauen deutscher Herkunft.<br />
Ungeachtet der verbesserten Bildungsabschlüsse ist der der Anteil jungen Frauen mit<br />
Migrationshintergrund in einer Dualen Ausbildung seit Mitte der 1990er Jahre rückläufig.<br />
139
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Hier werden schon beim Übergang zwischen Schule und Arbeitsmarkt grundlegende<br />
Ungleichheiten geschaffen, die sich im späteren Erwerbsleben auswirken.<br />
• Ausbildung für alle. Wir fordern daher die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage,<br />
eines Rechts auf Ausbildung und Verbesserung der schulischen Ausbildung: Wir <strong>Jusos</strong><br />
räumen der Schaffung von Ausbildungsplätzen im Dualen System oberste Priorität ein,<br />
doch dort, wo Ausbildungsplätze fehlen, muss auf eine zweite Säule, die schulische<br />
Ausbildung, zurückgegriffen werden.<br />
Vergeschlechtlichung von Berufen rückgängig machen<br />
Berufe sind geschlechtlich besetzt. Damit verbunden ist auch eine Abstufung der Berufe nach<br />
gesellschaftlichem Ansehen und in der Entlohnung sowie den Aufstiegsmöglichkeiten.<br />
Historisch hat sich die Identifikation von Berufen mit einem bestimmten Geschlecht als<br />
wandelbar erwiesen. Früher galt der Sekretär als typisch männlicher Beruf, als ein Berufstand<br />
mit hohem Ansehen und damit verbunden auch mit relativ guter, also hoher Entlohnung. Je<br />
mehr Frauen in diesen Bereich vorstießen, desto geringer wurde zum einen das Ansehen und<br />
zum anderen die Entlohnung. Heute gehört der SekretärInnenberuf meist in der<br />
unspezifizierten Form zu den niedrig entlohnten Berufsgruppen. Nur noch bestimmte<br />
SekretärInnen, wie der/ die GeneralsekretärIn einer Partei, der / die UN-SekretärIn u.ä. sind mit<br />
hohem Ansehen und Entgelt verbunden – und zumeist von Männern besetzt. Dies ist nur ein<br />
Beispiel, ähnliches ließe sich an vielen anderen Berufen aufzeigen.<br />
Sogenannte Frauenberufe bzw. Männerberufe werden jedoch nicht nur durch die Dominanz<br />
eines Geschlechtes konstruiert, sie werden auch teilweise vor dem Hintergrund der<br />
Legitimation aufgrund biologischer Faktoren geschaffen. So wird die Eignung des „weiblichen<br />
Wesens“ z.B. für Pflege- und Sorgearbeit, aus der natürlichen Gebärfähigkeit, abgeleitet. Auch<br />
die sogenannten typischen Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, Empathie oder soziale<br />
Kompetenz allgemein, leisten einer solchen Einteilung Vorschub. Damit einhergeht, dass<br />
gesellschaftliche eine Bewertung dieser Fähigkeiten vorgenommen wird. Zwar werden soziale<br />
Kompetenzen immer wichtiger, jedoch werden die harten Kompetenzen wie<br />
Durchsetzungsfähigkeit, Rationalität usw. eher den Männern zugeschrieben und in<br />
Entscheidungen bei denen es um die Auswahl von Führungspersonal geht, höher bewertet. Alle<br />
Stereotypen schränken Menschen in ihrer Entfaltung ein. Viele Frauen und Männer wollen und<br />
können überkommenen Rollenvorstellungen nicht entsprechen und leiden unter diesen<br />
gesellschaftlichen Anforderungen. Die Arbeit am Menschen wird durchgängig, auch in den<br />
Berufsbildern der Tarifparteien, geringer bewertet als die Arbeit an Maschinen und technischen<br />
140
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Apparaturen. Dies mit fatalen Folgen für die Entlohnung von Frauen, die den Pflegebereich<br />
beispielsweise dominieren.<br />
Schritte hin zu einer Auflösung der Vergeschlechtlichung von Berufen:<br />
• Berufsbilder erweitern. Die Berufsbilder müssen so erweitert werden, dass hier eine<br />
höhere Bewertung der Arbeit am und für Menschen stattfindet. Allgemein müssen sie<br />
auf ihre geschlechtsspezifischen Wirkungsmechanismen hin überprüft werden (siehe<br />
unten).<br />
• Parität schaffen. Eine annähernde Parität von Frauen und Männern in einem<br />
bestimmten Beruf wirkt der geschlechterstereotypen Besetzung von Berufsbildern<br />
entgegen. Deshalb muss bei gleicher Eignung das unterrepräsentierte Geschlecht<br />
zwingend eingestellt werden.<br />
• Ausbildungsberufe: Die unterschiedlichen Arbeitsfelder auf denen Frauen und<br />
Männer arbeiten, bedürfen unterschiedlicher Qualifikation. Frauen arbeiten häufig im<br />
Dienstleistungssektor. Hier wird häufig auf eine formale und zertifizierte Ausbildung<br />
verzichtet und stattdessen un- oder angelerntes Personal in häufig prekären<br />
Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt wird. Die Schaffung von Ausbildungsberufen<br />
mit festen Berufsbildern und der daran orientierten Lohneinstufung verhindern prekäre<br />
Beschäftigung. So kann zum einen ein ausreichender Lohn gesichert werden als auch<br />
eine Aufwertung von Dienstleistungsberufen stattfinden. Zusätzlich muss z.B. im<br />
Erziehungs- und Pflegebereich auch zur besseren Qualifizierung der ArbeitnehmerInnen<br />
stattfinden. Dies bedeutet nicht zwingend ein Hochschulstudium als Ausbildung,<br />
gezielte Fortbildungen sind hier ebenso denkbar.<br />
• Bewerbungen neutralisieren. Um einer ersten, auf Vorurteilen basierenden Auswahl<br />
von BewerberInnen vorzubeugen, sind Bewerbungen ohne Angabe des Namens, des<br />
Geschlecht, aber auch der Nationalität und ohne Bild zu stellen.<br />
3) Die Hälfte der Macht den Frauen<br />
Die gleichberechtigte Beteiligung von Männern und Frauen an Macht und Einfluss ist<br />
Voraussetzung für Gleichstellung und eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Leider sind wir<br />
auch in den gesellschaftlichen Eliten noch weit davon entfernt.<br />
141
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
52,7 % der SchulabgängerInnen mit Hochschulberechtigung sind Frauen (2006), bei den<br />
StudienanfängerInnen sind es dann 49,2% (2006)4, bei den AbgängerInnen ähnlich viele. Durch<br />
die Einführung zulassungsbeschränkter Bachelor- und Masterstudiengänge ist im Hochschulund<br />
Wissenschaftssystem eine weitere gläserne Decke eingezogen worden, die zu einem<br />
deutlichen und immer früheren Rückschritt in der Bildungsbeteiligung von Frauen führt.<br />
Stellen bei den Studienanfängerinnen und -anfängern eines Bachelors Frauen rund die Hälfte<br />
aller Studierenden, so sind es bei den Masterstudentinnen und -studenten nur noch ein gutes<br />
Drittel.<br />
Eine C4-Professur hatten 2004 lediglich knapp 10% inne5.<br />
• Quotenregelungen im Wissenschaftsbetrieb: Wir <strong>Jusos</strong> fordern die Einführung<br />
einer verbindlichen Quote. Der Prozentsatz der Promoventinnen, wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiterinnen Juniorprofessorinnen und Habilitandinnen in den einzelnen<br />
Fachrichtungen muss mindestens dem Prozentsatz der weiblichen AbsolventInnen der<br />
jeweiligen Studiengänge entsprechen. Bei der Besetzung von Professuren ist eine<br />
Frauenquote von mindestens 40-Prozent anzustreben<br />
• Geschlechterparitätisch besetzte Berufungskommissionen<br />
• Gender Mainstreaming im Wissenschaftssystem: Instrumente des Gender<br />
Mainstreamings wie beispielsweise dem Gender-Budgeting müssen verbindlich<br />
Anwendung finden, so muss die Vergabe von Landes- und Drittmitteln für Forschung<br />
und Lehre verbindlich an Gender-Aspekten gekoppelt sein.<br />
In der Wirtschaft sieht es noch schlimmer aus. 45% der Beschäftigten insgesamt sind Frauen, in<br />
der obersten Leitungsebene sind es dann noch 25 % (West 23%, Ost 30%) (siehe Graphik Frauen<br />
in Betrieben der Privatwirtschaft). Und wenn man in die DAX-30 Vorstände schaut, findet sich<br />
insgesamt eine Frau! Unter den 160 Aktiengesellschaften der wichtigsten deutschen<br />
Börsenindizes sind nur in 16 Vorständen Frauen vertreten, der Frauenanteil beträgt damit<br />
gerade einmal 2,5%, meist sind jedoch bloße Männerrunden anzutreffen. In den Aufsichtsräten<br />
zeigt sich ein ähnliches Bild: Immerhin beträgt die Frauenquote in mitbestimmten<br />
Unternehmen 10,5%, davon 124 ArbeitnehmerInnenvertreterinnen und 27 Vertreterinnen der<br />
AnteilseignerInnen. Dahingegen liegt die Quote in nicht mitbestimmten Betrieben bei lediglich<br />
3%.6 In anderen Ländern zeigt sich ein deutlich anderes Bild, insbesondere in Norwegen, wo<br />
2004 verbindliche Quoten für Aufsichtsräte eingeführt wurden. Von Kompetenzverlust in den<br />
Räten, ein oft gehörtes Argument gegen die Quotierung, jedoch keine Spur. Diejenigen<br />
4 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/080/1608015.pdf<br />
5 http://www.boeckler.de/pdf/impuls_2005_20_2.pdf<br />
6 Marion Weckes: Geschlechterverteilung in Aufsichtsräten und Vorständen 2008.<br />
142
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Unternehmen mit den meisten Frauen in den Spitzengremien kamen auf einem Gewinn, der<br />
über 48% über dem Durchschnitt lag.7<br />
Unter Rot-Grüne wurde aufgrund ähnlicher Zahlen Ende der 90er, über ein<br />
Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft diskutiert. Nach großen gesellschaftlichen<br />
Diskussionen und Gegenwind aus der Wirtschaft wurde aus dem Gesetz 2001 die<br />
„Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der deutschen<br />
Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der<br />
Privatwirtschaft“. Eine freiwillige Vereinbarung, deren Wirksamkeit alle zwei Jahre überprüft<br />
werden sollte und deren „solange“ Klausel dafür sorgen sollte, dass bei nicht erfolgreicher<br />
Umsetzung weitere Initiativen der Bundesregierung ergriffen werden.<br />
Es besteht weiterhin aktiver Handlungsbedarf. Freiwillige Vereinbarungen stoßen zum einen<br />
an ihre Grenzen und zum anderen kann der Prozess hin zu einer Gleichstellung durch<br />
verbindliche Vereinbarungen beschleunigt werden. In anderen Ländern ist dies bereits Realität.<br />
In den USA überwachen staatliche Stellen die Umsetzung der Gleichstellungspläne in<br />
Unternehmen, in der Schweiz haben Frauenverbände ein Verbandsklagerecht, in Norwegen<br />
wurde gerade trotz des bereits vergleichsweise hohen Anteils von Frauen in<br />
Führungspositionen ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft verabschiedet mit<br />
verbindlichen Quoten für Frauen in Aufsichtsräten mit starken Sanktionen. An qualifizierten<br />
Frauen, die die Anforderungen an die entsprechenden Ämter erfüllen, mangelt es nicht.<br />
• Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Wir halten an der Forderung nach<br />
einem effektiven Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft fest, das sich an den<br />
folgenden Leitlinien orientieren muss:<br />
- Klare Vorgaben zur Förderung der Chancengleichheit durch effektive Zielvorgaben für<br />
die Vergabe von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie verbindliche<br />
Gleichstellungspläne in Betrieben.<br />
- Quotenregelungen von mindestens 40 % für die Führungsebene von großen<br />
Unternehmen<br />
- Gleichstellungsbeauftragte mit effektiven Rechten und Kompetenzen, die<br />
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen initiieren und kontrollieren.<br />
- Bessere Rechte bei konkreten Benachteiligungen, wie z.B. ein diskriminierungsfreies<br />
Auswahlverfahren bei Einstellungen und Beförderungen.<br />
7 SZ 25.3.2008.<br />
143
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
- Wirksame Sanktionen durch ein Verbandsklagerecht für Frauenverbände und<br />
Gewerkschaften sowie Sanktionen bei Verstößen gegen vereinbarte<br />
Gleichstellungsziele.<br />
- Die Bindung der öffentlichen Auftragsvergabe an Maßnahmen zur Chancengleichheit<br />
– vorerst unter Berücksichtigung der europäischen jüngsten Rechtsprechung.<br />
- Eine Gleichstellungskommission auf Bundesebene in Anlehnung an internationale<br />
Vorbilder.<br />
- Effektive Regelungen zur Beseitigung von Lohndiskriminierung und zum Schutz vor<br />
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.<br />
• Veränderung der Europäischen Rechtslage. Die Bindung von öffentlichen<br />
Aufträgen an Tariftreue oder Gleichstellungsanforderungen muss möglich sein.<br />
Dahinter muss die Gewährleistung unternehmerischer Freiheiten zurückstehen.<br />
Deshalb fordern wir die europäische Gesetzgebung auf, auf eine Veränderung der<br />
entsprechenden Rechtsvorschriften in den Verträgen hinzuarbeiten.<br />
• Staat als Vorbild. In den Unternehmen, in denen der Staat bei der Besetzung von<br />
Aufsichtsräten mitbestimmt, muss zwingend eine Mindestquotierung von 40%<br />
eingehalten werden. Nur so kann bereits jetzt glaubwürdig Gleichstellung umgesetzt<br />
werden.<br />
Der Öffentliche Dienst als Vorbild – Gleichstellung erreicht?<br />
Der Bund und auch die einzelnen Bundesländer besitzen seit Anfang/ Mitte der 1990er Jahre<br />
eigene Gleichstellungsgesetze für den Öffentlichen Dienst, die unterschiedlich weitgreifende<br />
Regelungen aufstellen. Nach § 8 des Gleichstellungsgesetzes für Bundesbehörden<br />
beispielsweise gilt, dass Frauen, sofern sie in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert sind, bei<br />
der Vergabe von Ausbildungsplätzen, der Einstellung, Anstellung und beruflichem Aufstieg bei<br />
gleicher Qualifikation bevorzugt zu berücksichtigen sind, es sei denn in der Person eines<br />
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Und auch Führungspositionen sind als<br />
Teilzeitstellen auszuschreiben. Doch trotz Gleichstellungsgesetze können wir auch im<br />
öffentlichen Dienst nicht von Gleichstellung sprechen. Es zeigt sich auch im Öffentlichen<br />
Dienst eine klare Trennung der Geschlechter. Auch wenn in der Quantität eine ungefähre<br />
Parität der Geschlechter festzustellen ist, zeigt sich doch in vielen Behörden, dass ein Großteil<br />
der Frauen in Teilzeitmodellen arbeitet und die meisten Frauen im einfachen bzw. mittleren<br />
Dienst eingruppiert sind. Darüber hinaus ist der geteilte Arbeitsmarkt auch vielerorts<br />
kennzeichnend für den Öffentlichen Dienst. So arbeiten viele Frauen (im höheren Dienst)<br />
144
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
insbesondere in geschlechterstereotypisch eher weiblich zu geordneten Bereichen wie<br />
Gesundheit, Soziales und Kultur, wohingegen in den Bereichen der Hoheitsaufgaben, wie<br />
Finanzen und Inneres wenig Frauen in Führungspositionen zu finden sind. Mit den<br />
Gleichstellungsgesetzen für den öffentlichen Dienst ist eine gute Ausgangsbasis für die<br />
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt gegeben, doch steht die tatsächliche Gleichstellung noch<br />
aus.<br />
• Quotenregelung. Wir <strong>Jusos</strong> fordern daher eine konsequentere Einstellung des<br />
unterrepräsentierten Geschlechtes, eine Quotenregelung in allen Bundesländern für<br />
die Vergabe von Ausbildungsplätzen sowie von Beförderungen und finanzierten<br />
Weiterbildungen, während der Arbeitszeit. Insbesondere der Unterrepräsentation<br />
eines Geschlechtes auf Führungspositionen muss konsequent entgegengewirkt<br />
werden. Nur so kann der öffentliche Dienst seiner Vorbildfunktion gerecht werden!<br />
• Gender-Mainstreaming. Gender-Kompetenz in den Verwaltungen muss noch<br />
stärker und über alle Hierarchiestufen hinweg, ausgebaut werden. Prinzipien wie<br />
Gender-Mainstreaming mit Instrumenten wie dem Gender-Budgeting und Gender-<br />
Check müssen überall Anwendung finden!<br />
• Ausschreibungen und Gleichstellung verbinden. Wir fordern das die Aktivitäten<br />
und Erfolge eines Unternehmens in der Gleichstellung als ein wesentliches Kriterium<br />
zur Auftragsvergabe herangezogen wird.<br />
• Geschlechtergerechte Sprache durchsetzen. Alle öffentlichen Dokumente sind<br />
geschlechtergerecht zu formulieren. Die Umsetzung ist zu kontrollieren.<br />
4) Bewertung der Arbeit erneuern<br />
Lohndiskriminierung entgegen wirken<br />
In Deutschland beträgt der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern durchschnittlich<br />
22%. Dieser Unterschied ist teilweise auf Strukturmerkmale wie geschlechtsspezifische<br />
Unterschiede in der Ausbildung, in Beruf und der Tätigkeit, den Erwerbsjahren und ähnlichem<br />
zurückzuführen. Doch rechnet man alle diese Strukturdaten heraus, bleibt noch immer ein<br />
unerklärter Teil der Einkommensunterschiede, die lediglich dem Geschlecht zuzuschreiben sind<br />
und damit einen Diskriminierungstatbestand darstellen.<br />
145
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre so stellt man fest, dass im Westen<br />
Deutschlands die Gehaltsschere zumindest nicht weiter auseinander ging, wohingegen dies in<br />
den östlichen Bundesländern leider festzustellen war. Auch dahingehend findet offensichtlich<br />
eine Angleichung der Bundesländer statt, jedoch in die falsche Richtung.<br />
Je älter die Beschäftigten sind, desto größer ist der Lohnunterschied. Während Frauen im Alter<br />
von bis zu 24 Jahren etwa 7,8 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen, wächst<br />
die Differenz bei der Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren bereits auf 17,5 Prozent an. Der<br />
Einkommensrückstand wird bei Frauen ab 55 Jahren besonders deutlich: Sie verdienen rund<br />
26,7 Prozent weniger.8 Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen ist das<br />
Qualifikationsniveau von jüngeren Frauen höher und erziehungsbedingte<br />
Berufsunterbrechungen spielen hier nur eine untergeordnete Rolle. Bei älteren Frauen wirkt<br />
sich dies, d.h. erziehungsbedingte Berufsunterbrechung und die damit verbundenen<br />
Karrierenachteile stärker aus. Aber selbst bei gleichen Berufsjahren nimmt der Lohnunterschied<br />
zu, je mehr Berufsjahre beide Geschlechter aufzuweisen haben.<br />
Der Niedriglohnsektor ist in den letzten Jahren, auch dank der Reformen von Rot-Grün eine<br />
Wachstumsbrache. Dies ist jedoch in keinem Fall positiv zu bewerten, folgt daraus doch, dass<br />
nicht existenzsichernde Löhne und prekäre Tätigkeiten mit all den negativen Konsequenzen für<br />
sowohl die jetzige Lebensführung als auch die zukünftige soziale Absicherung.<br />
Von den vollzeitbeschäftigten GeringverdienerInnen sind 60% Frauen, d.h. ihr<br />
Bruttoeinkommen lag unter 1779 € (West) bzw. 1323€ (Ost).9 Unter den Frauen arbeitet fast<br />
jede dritte, bei den Männern nur jeder 10. im Niedriglohnbereich.10 Zusammengenommen mit<br />
den oben geschilderten geringeren Arbeitszeiten heißt das, dass Frauen in viel geringerem<br />
Maße in der Lage sind, sich eine finanziell selbstständige Existenz aufzubauen.<br />
• Mindestlohn. Daher setzen wir uns für einen gesetzlichen, branchenunabhängigen<br />
Mindestlohn von mindestens 7,50€ ein. Da insbesondere Frauen im<br />
Niedriglohnsektor arbeiten profitieren sie davon überproportional und die<br />
Gehaltsdifferenz wird verringert.<br />
• Niedriglohnsektor regulieren und langfristig abschaffen. Für eine Regulierung<br />
des Niedriglohnsektors und eine Abschaffung der Minijobs.<br />
8 Onlineumfrage der HBS.[ http://www.boeckler-boxen.de/3736.htm]<br />
9 IAB Juni 2008.<br />
10 Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen 2007.<br />
146
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Tarifverträge diskriminierungsfrei gestalten<br />
Der Grundsatz „Gleiches Entgelt bei gleichwertiger Arbeit“ ist aufgrund europäischer wie<br />
nationaler gesetzlicher Vorschriften (Entgeltrichtlinie, Vertrag von Nizza, BGB § 612)<br />
theoretisch eingelöst. Dennoch führen viele betriebliche und tarifvertragliche Praktiken dazu,<br />
dass Entgeltdiskriminierung stattfinden. So tragen Tarifverträge dazu bei, dass<br />
Entgeltdiskriminierung nach dem Geschlecht stattfindet. Vergleicht man z.B. die<br />
Berufsbeschreibung einer Schreibkraft mit der einer LagerarbeiterIn, so zeigt sich eine klare<br />
Unterbewertung der Schreibkraft. Bei dieser ist als Anforderung lediglich der Punkt<br />
„abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder gleichwertige Ausbildung, auch erworben<br />
durch mehrjährige anderweitige Qualifikation“ aufgeführt. Wohingegen bei dem/ der<br />
LagerarbeiterIn folgende Punkte zu finden sind<br />
„Vorkenntnisse aufgrund aufgabenbezogener Unterweisung oder Einarbeitung, fallweise<br />
längere Berufspraxis; erhöht Anforderungen an Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit; erhöhte,<br />
fallweise große Belastung unterschiedlicher Art; erhöhte Verantwortung für Betriebsmittel<br />
und/ oder Arbeitsprodukt“. Aus diesen unterschiedlichen Beschreibungen ergibt sich bei einem<br />
Entgelt für die Schreibkraft von 1.715,77€ (2001) und 2.042,16 € (2001) für den/ die<br />
LagerarbeiterIn eine Differenz von 326,39€. Der These, dass auch eine Schreibkraft fallweise<br />
großer Belastung ausgesetzt ist oder aber auch sie erhöhte Verantwortung trägt (z.B. wenn sie<br />
dafür Verantwortlich ist, wichtige Briefe fristgerecht an die richtigen EmpfängerInnen zu<br />
versenden), würde kaum jemand wiedersprechen. Doch tauchten genau diese Beschreibungen<br />
in der Tätigkeitsbeschreibung nicht auf und begründen damit Entgeltungleichheit.<br />
- Berufsbilder überarbeiten. Die Tarifparteien sind aufgefordert, die Berufsbilder auf<br />
ihre geschlechtsspezifische Wirkung überprüfen und entsprechend einem<br />
geschlechtsneutralen Berufsbild umarbeiten.<br />
- Geschlechtsneutrale Bewertungsverfahren. Bei der Bewertung von Arbeit<br />
müssen geschlechtsneutrale Bewertungsverfahren eingesetzt werden. In der Schweiz<br />
beispielsweise wurde dazu bereits ein arbeitswissenschaftlich fundiertes System<br />
entwickelt. Nun ist es an den TarifpartnerInnen ein ähnliches diskriminierungsfreies<br />
System zur Arbeitsbewertung auch für Deutschland zu entwickeln und einzusetzen.<br />
147
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
5) Offene Diskriminierung? Offensiv bekämpfen!<br />
Neben diesen mehr oder weniger versteckten Diskriminierungen sind offene Diskriminierung<br />
und Sexismus ein großes Problem in unserer Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Auch<br />
wenn sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch das Beschäftigtenschutzgesetz sowie das<br />
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geregelt werden, besteht in diesem Bereich noch akuter<br />
Handlungsbedarf. Der geschlechtergerechter Arbeitsmarkt muss frei von versteckter und<br />
offener Diskriminierung sein. Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist eine<br />
unterschiedliche Behandlung auf Grund des Geschlechtes nur zulässig, sofern das Geschlecht<br />
die unverzichtbare Bedingung wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit bildet. Auf Grund der<br />
schon länger in Deutschland geltenden Beweislastumkehrung in diesen Fällen trägt der<br />
Arbeitgeber/ die Arbeitgeberin im Prozess die Darlegungs- und Beweislast. Das ist eine<br />
grundsätzlich positiv zu bewertende Handhabung, da diese durch die erleichterte<br />
Beweislastführung, tendenziell ermutigend wirkt, eine Anzeige zu erstatten. Doch muss auch<br />
hier der bzw. die Diskriminierte die Diskriminierung als eine solche erkennen und dann auch<br />
wirklich zur Anzeige bringen.<br />
Häufig werden Diskriminierung und sexuelle Belästigungen als Lappalie, Spaß oder persönliche<br />
Überempfindlichkeiten von außen, aber auch von den Betroffenen selber abgewertet. Aus<br />
Angst vor negativen Konsequenzen wie Spott der Kolleginnen und Kollegen, Verlust des<br />
Arbeitsplatzes oder des eigenen Ansehens schweigt ein Großteil der Betroffenen. Im<br />
geschlechtergerechten Arbeitsmarkt sehen wir <strong>Jusos</strong> keinen Platz für sexistische Sprüche und<br />
Witze, unerwünschten Körperkontakt und zweideutige Einladungen. Sexuelle Belästigung von<br />
Frauen ist ein eindeutiger Machtmissbrauch des dominierenden Geschlechtes. Um diesem<br />
vorzubeugen, muss schon frühzeitig ein Problembewusstsein bei allen Geschlechtern<br />
geschaffen werden.<br />
• AGG weiterentwickeln. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geht uns <strong>Jusos</strong><br />
nicht weit genug. Neben der Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes, wird darin<br />
auch Diskriminierung auf Grund der ethnischen Herkunft, der Religion, der<br />
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität<br />
verboten. Doch müssen schärfere Sanktionen bei erfolgter Diskriminierung folgen<br />
können.<br />
• Weiterentwicklung auf europäischer Ebene. Die Ausdehnung der<br />
Antidiskriminierungsrichtlinie auf das Zivilrecht wird momentan u.a. von<br />
Deutschland blockiert. Eine starke EU-Richtlinie würde das AGG auf europäischer<br />
Ebene absichern und allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, ihre<br />
148
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof einzuklagen. Der umfassende<br />
Diskriminierungsschutz für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrem Alter,<br />
einer Behinderung, ihrem Glauben oder ihrer sexuellen Orientierung ist ein<br />
Menschenrecht. Wir <strong>Jusos</strong> unterstützen die Initiative „Ganz Europa ohne<br />
Diskriminierung“ und fordern die Bundesregierung auf, ihre Blockadehaltung<br />
aufzugeben.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> begrüßen außerdem den Beschluss des Europäischen Parlaments, Sexismus und<br />
Rollenstereotype aus den Medien zu verbannen und fordern die Verbindlichkeit dieser<br />
Richtlinie für alle Mitgliedsstaaten. Wir fordern die Bundesregierung auf Kampagnen zu<br />
entwickeln, die gegen sexistische Beleidigungen und entwürdigende Darstellungen von Frauen<br />
und Männern in der Werbung und im Marketing vorgehen.<br />
6. Fazit<br />
Gelichberechtigung und Gleichstellung ist möglich. Viele Vorschläge liegen bereits auf dem<br />
Tisch. Ein Gesamtkonzept für Gleichstellung muss endlich vom Bundesfrauenministerium<br />
aufgegriffen und in Angriff genommen werden. Fast alle Ministerien sind in ihren Politiken<br />
davon betroffen und müssen ihrerseits Gesetzesinitiativen anstrengen. Nur so kann es<br />
gelingen, geschlechtsspezifische Diskriminierung abzubauen. Aber auch die Tarifparteien sind<br />
aufgefordert ihren Beitrag zu leisten. Zu Guter letzt obliegt es auch allen gesellschaftlichen<br />
Institutionen das Geschlechterverhältnis zu reflektieren und zu verändern. Nicht zu letzt auch<br />
bei uns selbst.<br />
149
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
J<br />
Justiz- und Innenpolitik<br />
J 1 – Bundesvorstand<br />
Autoritärem Gesinnungsstrafrecht<br />
entgegentreten: § 129 a, b abschaffen!<br />
Vorab<br />
Die Versuche, politische Opposition zu kriminalisieren und mithilfe der Justiz mundtot zu<br />
machen, gab und gibt es in zahlreichen Ländern immer wieder. Aussagekräftig über den<br />
Zustand der Freiheitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit eines Landes ist der Umgang mit politisch<br />
Andersdenkenden.<br />
Justizförmige Verfahren beinhalten immer die Selbstbeschränkung von Macht, da der Ausgang<br />
offen ist. In autoritären Systemen fehlt diese Selbstbeschränkung und die Ergebnisse von<br />
politischen Verfahren stehen von vorneherein fest. Einer freiheitlichen Ordnung, in der<br />
Demokratie und Freiheit durch entsprechende rechtsstaatliche Absicherung gewährleistet sind,<br />
läuft dieses zu wider.<br />
Der § 129 a, b StGB stellt für uns ein Beispiel für Gesinnungsstrafrecht dar, dass unseren<br />
Vorstellungen an rechtsstaatlicher Absicherung in einer freiheitlichen Demokratie nicht<br />
gerecht wird. Deshalb fordern wir die Abschaffung des § 129 a, b StGB.<br />
Worum geht es?<br />
Bestraft wird nach § 129 a StGB, wer eine terroristische Vereinigung gründet oder unterstützt,<br />
in ihr Mitglied ist oder für sie wirbt. Maßgeblich ist der Zweck der Vereinigung, terroristische<br />
Taten zu begehen. Dabei reicht es aus, wenn dies nicht der Hauptzweck ist, sondern lediglich<br />
als notwendig angesehen wird, um andere weitergehende Ziele zu erreichen.<br />
Werden die geplanten Delikte verwirklicht, sind sie durch andere Straftatbestände bereits<br />
erfasst. Der zusätzliche Strafgrund wird mit der besonderen Gefährlichkeit, die sich aus der<br />
organisierten Struktur der Gruppe ergebe, begründet. Demnach stellen bereits die<br />
150
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Organisationsdelikte im Vorbereitungsstadium der eigentlichen Tat, noch vor Versuchsbeginn,<br />
ein Verbrechen dar.<br />
Bedeutsam sind insbesondere auch die weitreichenden Ermittlungsmaßnahmen der §§ 101 a ff<br />
StPO, die an den Verdacht einer Strafbarkeit aus § 129 a StGB anknüpfen. Diese greifen damit<br />
bei dem Verdacht der hier bezweckten Straftat zum einen früher als bei Verdacht einer<br />
„einfachen“ Begehung der Tat. Zum andern sind hier weitreichendere Maßnahmen möglich als<br />
bei der tatsächlichen Begehung der Tat. Zu den Sonderbefugnissen gehören die Post- und<br />
Telekommunikationsüberwachung, langfristige Observationen, Einsatz von V-Leuten und<br />
verdeckten Ermittlern, geringere Verteidigerrechte, Postkontrollen, die Rasterfahndung, der<br />
große Lauschangriff hinsichtlich von Wohnungen etc. Oftmals wird zunächst nach §§ 129, 129 a<br />
StGB ermittelt, was umfangreiche Ermittlungen beinhaltet, um dann lediglich „normale“<br />
Straftaten anzuklagen. Es liegen damit massive Eingriffe durch die Ermittlungsmaßnahmen der<br />
§§ 101 a ff StPO in die Grundrechte der Betroffenen und Dritter vor, die mit dem Verdacht der<br />
Strafbarkeit nach § 129 a StGB ermöglicht werden. Er fungierte als<br />
„Einschüchterungsparagraph“, der mit Hausdurchsuchungen, erleichternde<br />
Untersuchungshaft und höheren Kontrollmöglichkeiten bei den Betroffenen und ihrem Umfeld<br />
nicht selten zu Verängstigung und in den seltensten Fällen zu tatsächlichen Verurteilungen<br />
führte. In den Jahren 1980 bis 1996 kam es zu mehr als 6000 Verfahren. In der gesamten Zeit<br />
kam es jedoch lediglich zu sechs Urteilen, die sich ausschließlich auf den § 129 a StGB stützten.<br />
In 95 % der Verfahren kommt es noch nicht einmal zur Anklage. Dass die Kriminalisierung der<br />
Betroffenen existenzbedrohend sein kann, ist offensichtlich. Traumatische Folgen bei<br />
Hausdurchsuchungen, Ermittlungen am Arbeitsplatz, monatelange Überwachungen und<br />
zuletzt die Untersuchungshaft als massivste Einschränkung individueller Freiheit mit der Nicht-<br />
Möglichkeit der Erwerbsarbeit, der Nicht-Existenz bei Familie, Kindern und Freunden können<br />
sich massiv auf die betroffenen Menschen auswirken. Daneben sind solche Verfahren mit<br />
zahlreichen Beschlagnahmen mit den entsprechenden Auswirkungen auf<br />
Redaktionsgeheimnis etc. verbunden.<br />
Rückblick<br />
Die Geschichte der Strafbarkeit von bloßen Mitgliedschaften (sogenannten<br />
Organisationsdelikten) geht ins 18. Jahrhundert zurück. 1798 gab es den ersten Erlass zur<br />
Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, um der Ausbreitung der Französischen<br />
Revolution entgegenzutreten. Dem folgte 1818 eine preußische Verordnung gegen „Geheime<br />
Gesellschaften“ nach, auf dessen Grundlage auch die erste Datei über missliebige Personen<br />
entstand. Im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 gab es dann den § 129, nach dem „die Theilnahme<br />
an einer Verbindung, zu deren Zwecken oder Beschäftigung gehört, Maßregeln der Verwaltung<br />
151
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
oder die Vollziehung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel zu verhindern und zu<br />
entkräften“. Dieser wurde dann im Zusammenspiel hauptsächlich gegen die<br />
Arbeiterbewegung eingesetzt. In der Weimarer Republik wurde der §129 um weitere<br />
Vorschriften ergänzt. Die Möglichkeiten der strafrechtlichen Verfolgung politisch unliebsamer<br />
Personen waren damit vielfältig.<br />
Nach der Zerschlagung des Hitler-Faschismus setzten die Alliierten die<br />
Staatschutzbestimmungen außer Kraft. 1951 wurde dann jedoch ein neues Staatsschutzrecht<br />
beschlossen. Ursprünglich war lediglich die Bildung einer kriminellen Vereinigung strafbar. In §<br />
129 StGB hieß es dann, dass auch die „Unterstützung einer kriminellen Vereinigung“ unter<br />
Strafe steht. Später wurde dem die Tatbestandsalternative des Werbens hinzugefügt. Unter<br />
Unterstützung wird die erfolgreiche Beihilfe zur Gründung bzw. Fortführung einer Vereinigung<br />
verstanden, während die Werbung als erfolglos gebliebener Versuch gewertet werden kann.<br />
Vor dem Verbot der KPD im Jahre 1956 diente der §129 StGB im Zusammenspiel mit § 90 a StGB<br />
(Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung) zur Bekämpfung der KPD und ihrer<br />
AnhängerInnen.<br />
Im Zusammenhang mit der 68er Bewegung wurde der § 129 StGB nicht nur gegen die aus der<br />
APO hervorgegangenen kleinen Gruppen, die dem „bewaffneten Widerstand“ positiv<br />
gegenüberstanden und/oder praktizierten, sondern gegen zahlreiche weitere Personen<br />
angewandt. Das Personal für die Verfassungsschutzämter und der Staatsschutzabteilungen<br />
des BKA wurden drastisch erhöht. 1976 wurde der § 129 a StGB erlassen, der in systematischer<br />
Analogie zum § 129 StGB die Bildung, Werbung und Unterstützung einer terroristischen<br />
Vereinigung unter Strafe stellte.<br />
Faktisch hatte der § 129 a StGB zahlreiche Konsequenzen. Er fungierte als Instrument der<br />
Vereinfachung strafprozessualer Beweisführung. Überall dort, wo eine konkrete individuelle<br />
Beteiligung nicht nachgewiesen werden konnte, konnten Straftaten wie ein Mord über die<br />
Konstruktion einer Vereinigung auch Personen, die der Mitgliedschaft bezichtigt wurden, zur<br />
Last gelegt werden. Der § 129 a stellte die Grundlage für die sogenannten isolierenden<br />
Haftgründe („Isolationshaft“) dar. Er diente als Ermittlungsparagraph, da mit ihm die Polizei<br />
erhebliche strafprozessuale Sonderermittlungsbefugnisse zur Hand bekam.<br />
Im Jahre 1986 wurde die Strafdrohung erhöht und neue Katalogstraftaten dem §§ 129, 129 a<br />
StGB zugefügt. Unter Rot-Grün ist der § 129 b StGB hinzugekommen, der die Mitgliedschaft<br />
oder Unterstützung einer ausländischen Vereinigung unter Strafe stellt. Bei Gruppen<br />
außerhalb Europas muss das Bundesjustizministerium die Strafverfolgungsbehörden zur<br />
Ermittlung ermächtigen. Ein Novum in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte, was die<br />
152
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Verquickung von Strafverfahren und politischer Opportunität auf die Spitze treibt. Gleichzeitig<br />
hat Rot-Grün den § 129 a StGB entschärft, in dem im Falle bestimmter Straftaten die Tat dazu<br />
bestimmt sein muss, dass sie „die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine<br />
Behörde oder internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit<br />
Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen<br />
Grundstrukturen eines Staates...zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und (wenn<br />
sie) durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat...erheblich schädigen<br />
kann“. Darüber hinaus wurde der Begriff des Werbens gestrichen, wenn es sich um reine<br />
Sympathiewerbung handelt.<br />
Unsere Kritik am § 129 a, b StGB<br />
Die Organisationsdelikte stellen einen Fremdkörper im deutschen Strafrecht dar, da sie eine<br />
konkrete Tat des Beschuldigten nicht erforderlich machen, sondern die angebliche Gesinnung<br />
des Beschuldigten ausreichen lassen. § 129 a, b StGB kollidiert mit dem Bestimmtheitsgebot<br />
aus Art. 103 Abs. 2 GG und des Schuld- und Tatstrafrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG.<br />
Die §§ 129, 129 a, b StGB sind Normen des Strafrechts, die „eine Strafbarkeit bereits weit im<br />
Vorfeld des Vorbereitung konkreter strafbarer Handlungen“ (BGH 28, 148, 11.10.1978)<br />
begründen. Handlungen, die im Vorfeld strafbarer Handlungen liegen, sind all jene wie Reden,<br />
Treffen, legale Dinge kaufen, die eben „normalerweise“ keine Strafbarkeit begründen können.<br />
Die Strafbarkeit liegt in einem Stadium, wo ein konkreter Bezug zur Verwirklichung einer<br />
individuellen Rechtsgutbeeinträchtigung nicht vorliegt. Die Abgrenzung zwischen legalem<br />
Handeln und dem Delikt verschwimmt und ist schwer zu bewerkstelligen. Es werden Elemente<br />
des repressiven Strafrechts mit denen der präventiven Gefahrenabwehr vermischt, die in die<br />
Zuständigkeit der Polizei und der Länder fallen.<br />
Solche Normen bedürfen weit gefasste und unbestimmte Rechtsbegriffe. Schließlich führen<br />
nicht konkrete Handlungen in Form von Rechtsverletzungen zur Strafbarkeit, sondern der<br />
konkreten Handlungen unterstellte Sinn. Sämtliche Tathandlungen können als<br />
Anknüpfungspunkt gewählt werden, da das Tatschuldrecht verlassen und lediglich auf den<br />
subjektiven Entschluss des Täters abgestellt wird. Die potentielle Weite des<br />
Anwendungsfeldes, der Mangel an objektiven Tatbestandsmerkmalen und die Konturlosigkeit<br />
begründen weitere Zweifel an der Zulässigkeit dieser Norm.<br />
So wird der Paragraph von vielen als „Schnüffelparagraph“ bezeichnet, weil er sehr<br />
weitreichende Möglichkeiten zur staatlichen Überwachung in einem vom Staat zu<br />
definierenden Personenkreis beinhaltet, gegen die sich der/die Betroffene mangels Kenntnis<br />
153
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
des Verfahrens nicht wehren kann. Allein der Kontakt mit einer verdächtigen Person kann zur<br />
Folge haben, um in die Ermittlungen des Staatsschutzes zu gelangen. Zudem hat der<br />
Generalbundesanwalt die Zuständigkeit und die Verfahren finden vor den<br />
Staatsschutzkammern bzw. –senaten der Oberlandesgerichte statt. Dies hat zur Konsequenz,<br />
dass eine Instanz wegfällt und lediglich die Revision vor dem BGH und keine Berufung möglich<br />
ist. Untersuchungshaft wird darüber hinaus ohne Haftgrund angeordnet. Faktisch haben die §§<br />
129, 129 a, b StGB die Funktion einer Ersatzstrafe durch eine staatliche Repression der<br />
Betroffenen, die an den sonstigen gerichtlichen Verfahrenskontrollen und –sicherungen vorbei<br />
läuft.<br />
Wie weiter?<br />
Die liberalen Kräfte im 19. und 20. Jahrhundert kämpften für eine Begrenzung des<br />
strafrechtlichen Staatsschutzes auf die Verteidigung gegen Angriffe auf die staatliche Ordnung<br />
(Hochverrat) und den Schutz die Integrität (Landesverrat). Die autoritär orientierten<br />
Strömungen machten es sich zum Ziel den Präventivkampf gegen politische Abweichler zu<br />
führen. Dabei wurden nicht selten auf Elemente zurückgegriffen, die vordemokratische<br />
Gesellschaften kennzeichneten, wie z.B. Strafbarkeit weit im Vorfeld konkreter<br />
Rechtsverletzungen, Sonderzuständigkeiten und strafprozessuale Besonderheiten.<br />
Wir sagen, es ist an der Zeit, autoritärem Gedankengut mal wieder deutlich den Kampf<br />
anzusagen. Der § 129 a, b StGB ist Ausdruck autoritären Gesinnungsstrafrechts und gehört<br />
deshalb abgeschafft.<br />
154
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
K<br />
Kampf gegen rechts<br />
K 2 - LV Schleswig-Holstein<br />
Verbot des rechtsextremen Heimattreue<br />
Deutsche Jugend e. V. (HDJ)<br />
Die <strong>Jusos</strong> fordern die Bundesregierung auf, die „Heimattreue Deutsche Jugend e. V.“ zu<br />
verbieten.<br />
Begründung:<br />
Die HDJ ist die wichtigste Vorfeldorganisation der NPD und gilt als Nachfolge-<br />
/Ersatzorganisation der bereits 1994 verbotenen Wiking- Jugend, die ein extrem völkisches,<br />
antisemitisches Weltbild, ohne Furcht vor Konsequenzen öffentlich vertreten hat. Die HDJ ist<br />
die Kaderschmiede für den Parteinachwuchs der NPD, in der Kinder und Jugendliche in Lagern<br />
ideologisch geschult und militärisch zu strammen Neonazis gedrillt werden. Es reicht also nicht<br />
aus der „Heimatreuen Deutschen Jugend e. V.“ die Uniformen zu verbieten, zumal diese das<br />
Uniformverbot längst bewusst nicht ernst nimmt und dieses ignoriert. So lange die HDJ nicht<br />
endgültig verboten ist, wird die HDJ auch weiterhin ihre Uniformen tragen und die<br />
Zuständigkeit wird mal vom Bund als Ländersache oder umgekehrt abgewiesen.<br />
K 6 - LV RLP<br />
Erstklassige Fans tragen kein „Thor<br />
Steinar“<br />
Die <strong>Jusos</strong> sprechen sich dafür aus, das Tragen von Kleidungsstücken, deren Herstellung,<br />
Vertrieb und/oder Zielgruppen in der rechtsextremen Szene angesiedelt sind, flächendeckend<br />
auf Vereinsgeländen, bei Wettkämpfen oder bei Spielbegegnungen zu verbieten. Dies bezieht<br />
sich ausdrücklich auch auf Kleidungstücke aller Marken, die einschlägige rechtsextreme<br />
Versände und Läden beliefern, selbst wenn diese Marken auch in „regulären“ Geschäften<br />
155
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
erhältlich sind. Dieses Verbot soll in Form einer Änderung der Stadionordnungen, gemeinsam<br />
mit den Vereinen, mit Fanprojekten und Fans erreicht werden.<br />
Das Innen-und Jusitzministerium wird aufgefordert, eine ständig zu aktualisierende List mit<br />
betroffenen Marken zu erstellen, die als eine Orientierungshilfe für diese Verbote dienen kann<br />
Wichtig zu erwähnen ist, dass von einem solchen Verbot nur eindeutig rechtsextreme Marken<br />
wie Thor Steinar, Consdaple oder Masterrace fallen, von Nazis instrumentalisierte Marken wie<br />
Lonsdale oder Fred Perry davon jedoch nicht betroffen sein dürfen.<br />
So soll für das Problem rechter Fankultur sensibilisiert werden. Eine mögliche Abwehrhaltung<br />
bei den Fans, wie sie durch das Anstreben von staatlicher Repression zu erwarten wäre, soll<br />
durch das gemeinsame Handeln verhindert werden. Eine mögliche Verbots-Kampagne ist<br />
daher durch Aufklärungsarbeit und gemeinsame Aktionen mit Vereinen, Fans und<br />
Fanprojekten zu begleiten.<br />
Begründung:<br />
Das Problem rechtsextremer Fankultur zeigt sich nicht nur in den unteren Spielklassen. Auch in<br />
Profiligen sehen sich StadionbesucherInnen immer wieder Gruppen und einzelnen Personen<br />
mit eindeutig rechten Marken und Symbolen gegenüber. Dies sorgt nicht nur für ein mulmiges<br />
Gefühl bei nicht rechtsextrem denkenden Menschen, es ist auch Teil eines Normalisierungsund<br />
Integrationsprozesses rechter Kultur und Präsenz in der Gesellschaft.<br />
Sicherlich wird ein Verbot eindeutig rechter Marken das Problem von Neonazis im Stadion<br />
nicht lösen können. Vermutlich wird es auch nicht mehr sein können als ein Symbol. Aber<br />
dennoch und gerade ist es wichtig, Symbole zu setzen und zu zeigen, dass wir rechtes<br />
Gedankengut, rechten Lifestyle und rechtes Auftreten nicht akzeptieren. Und zwar in keinem<br />
Lebensbereich.<br />
Schon einige Profivereine wie Werder Bremen, Borussia Dortmund, St. Pauli oder Mainz 05 sind<br />
den Weg gegangen, in ihren Stadionordnungen das Tragen rechtsextremer Klamotten bei ihren<br />
Veranstaltungen zu verbieten. Leider befinden sie sich damit aber immer noch in der<br />
Minderheit. Wir <strong>Jusos</strong> sehen es als unsere Aufgabe, dieses Thema verstärkt in die Öffentlichkeit<br />
zu tragen und gemeinsam mit Vereinen und Fans zu erreichen die Stadien frei von Nazikleidern<br />
zu halten.<br />
Wichtig zu erwähnen ist, dass von einem solchen Verbot nur eindeutig rechtsextreme Marken<br />
wie Thor Steinar, Consdaple oder Masterrace fallen, von Nazis instrumentalisierte Marken wie<br />
Lonsdale oder Fred Perry davon jedoch nicht betroffen sein dürfen.<br />
156
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
M<br />
Migration & Integration<br />
M 2 - LV NRW, BZ Hessen-Süd<br />
Gleiche Rechte, gleiche Chancen – Die<br />
Integration als eine der Zukunftsaufgaben<br />
in unserem Land begreifen und endlich<br />
angehen!<br />
Die Diskussion um das Thema „Integration“ gehört aktuell zu den heikelsten politischen<br />
Debatten. Mehr als 15 Millionen Menschen in der Bundesrepublik haben einen<br />
„Migrationshintergrund“, sind also selbst im Ausland geboren, oder haben nähere Verwandte,<br />
die dort geboren worden sind. Die Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ist<br />
mittlerweile auch bei vielen Konservativen angekommen.<br />
Mit diesem Konsens geht auch ein Wandel in der Begrifflichkeit einher: der Begriff „Ausländer“,<br />
diente der pauschalen Bezeichnung aller Menschen die nicht bio-deutscher Herkunft waren.<br />
Mittlerweile dominieren die Begriffe „MigrantIn“ oder „Mit Migrationshintergrund“, ohne das<br />
klar ist wer damit gemeint ist: die Menschen die tatsächlich nach Deutschland migriert sind,<br />
ihre Kinder oder Enkelkinder? Wir JungsozialistInnen sind uns der ausgrenzenden und auch<br />
diskriminierenden Wirkung aller dieser Begriffe bewusst, denn das Bestehende wird durch<br />
Begriffe produziert und manifestiert.<br />
Solange Menschen jedoch aufgrund rassistischer Strukturen in unserer Gesellschaft strukturell<br />
benachteiligt werden, ist es unsere Aufgabe dagegen zu kämpfen. Wir sind bemüht die<br />
Deutungshoheit im Integrationspolitischen Diskurs über neue Begrifflichkeit zu erlangen, die<br />
die vermeintliche Differenz nicht reproduzieren.<br />
Trotzdem stellen wir fest, dass sich der Schwerpunkt der Debatte in den letzten Jahren<br />
verschoben hat. Für eine kurze Zeit sah es so aus, als könnte sich tatsächlich eine Diskussion<br />
entwickeln, die eine Perspektive für die Gestaltung der Bundesrepublik als pluraler<br />
Einwanderungsgesellschaft erarbeiten könnte. Bestandteile eines solchen Programms wie<br />
beispielsweise eine nachhaltige Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts unter anderen<br />
durch Hinnahme von Doppelstaatsangehörigkeiten oder auch Maßnahmen zum Abbau<br />
157
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
sozialer Benachteiligungen von Migrantinnen und Migranten wurden jedoch nie in die Tat<br />
umgesetzt.<br />
Stattdessen wird der Diskurs vor allem von der Angst vor „islamistischem“ Fundamentalismus<br />
und Terrorismus, vor (Jugend-) Kriminalität und „Parallelgesellschaften“ beherrscht.<br />
Unabhängig von der starken Fokussierung auf den Islam bleibt die Diskussion über Integration<br />
dabei im Kern eine auf den türkischstämmigen Teil der Migrantinnen und Migranten bezogene<br />
Debatte. Vorurteile und Diffamierungen, die aktuell den Islam treffen wie beispielsweise der<br />
Vorwurf der kulturellen Rückständigkeit und der angeblichen Unvereinbarkeit mit „westlichabendländischen<br />
Werten“ – was auch immer das sein mag – wurden früher bereits auf<br />
Türkinnen und Türken abgeladen. Inhaltlich bietet die Diskussion um eine<br />
„Integrationsfähigkeit“ des Islam daher alt bekanntes in neuem Gewand.<br />
Die Schieflage der Diskussion wird auch am Stichwort „Leitkultur“ deutlich. Meist bleibt unklar,<br />
was der Verwender unter dem Begriff „Leitkultur“ überhaupt meint. „Die“ eine Kultur gibt es in<br />
Deutschland schließlich nicht.<br />
Der schwerreiche Steuerhinterzieher aus dem Nobelvorort wird wohl wenige kulturelle oder<br />
sonstige Vorlieben mit dem Arbeitslosen aus einer anderen Gegend der Stadt teilen. Was hier<br />
die Leitkultur sein soll, weis niemand. Offensichtlich ist, dass soziale Stellung die persönlichen<br />
Einstellungen und kulturellen Praktiken eines Menschen wesentlich stärker beeinflusst, als die<br />
ethnische Herkunft oder die Religionszugehörigkeit.<br />
Hinzu kommt: Definiert man die „Leitkultur“ schlicht mit der durch das Grundgesetz<br />
beschriebene Verfassungsordnung, so wird es wirklich banal. Die fast absolute Mehrzahl der<br />
Menschen in diesem Land respektiert die Verfassung und hält sich an die allgemeinen Gesetze<br />
– unabhängig vom ethnischen Hintergrund. Das ständige Herumreiten auf der Frage nach der<br />
Gesetzes- und Verfassungstreue von MigrantInnen wirkt hier ausgrenzend und verletzend.<br />
Zudem scheint es vielen gerade konservativen PolitikerInnen nicht in den Kopf zu gehen, dass<br />
Menschen durchaus eine, zwei, oder mehrere Identitäten zugleich haben können – sei es als<br />
Facharbeiter, Liebhaber und Fußballfan, oder als Moslem, Deutscher, Fußballfan, Heimwerker<br />
und noch als vieles mehr. Niemand muss sich zwangsläufig entweder als „Deutscher“ oder<br />
„Türke“ fühlen. Und selbst wenn, so sagt dies noch überhaupt nichts darüber aus, welche<br />
konkreten gesellschaftlichen Einstellungen sich daraus ergeben. Ähnlich fragwürdig sind auch<br />
die Diskussionen über sogenannte „Parallelgesellschaften“.<br />
158
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Dass in manchen Stadteilen mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben als in anderen,<br />
ist eine Banalität. „Parallelgesellschaft“ soll dann sein, wenn Menschen mit einem bestimmten<br />
ethnischen Hintergrund sich nur noch in Zusammenhängen aufhalten, in denen alle anderen<br />
denselben ethnischen Hintergrund haben. Nur – auch dies ist banal – entscheidend dafür, wo<br />
jemand wohnt und mit wem jemand den Alltag verbringt ist in erster Linie, zu welcher sozialen<br />
Schicht jemand gehört. Probleme in Stadtteilen entstehen in erster Linie aus Armut und<br />
sozialer Ausgrenzung, und das betrifft die Menschen dort unabhängig von ihrer ethnischen<br />
Herkunft.<br />
Die Diskussion über „Parallelgesellschaften“ ist daher scheinheilig. Sucht man den Kern der<br />
Argumentation vieler Warner vor der „Parallelgesellschaft“, so reduziert sich die<br />
Argumentation oft schlicht auf die Feststellung, in einer bestimmten Gegend wohnten zu viele<br />
„Ausländer“. Dies hat aber mit soziologischen Betrachtungen und tatsächlichen Problemen<br />
nichts mehr zu tun.<br />
Diese Scheinheiligkeit zeigt sich auch am Umgang mit dem Bau von Moscheen. Eigentlich ein<br />
Zeichen dafür, dass sich Menschen dauerhaft einrichten wollen, wird der Bau von Moscheen<br />
oft bekämpft. Auch hier geht es meist weniger um die Frage, ob Muslime in Deutschland leben.<br />
Entscheidend scheint für viele MoscheebaugegnerInnen, dass Muslime auch sichtbar ihren<br />
Glauben leben wollen, und sich nicht mehr mit Hinterhofmoscheen begnügen wollen.<br />
Die eigentliche gesellschaftliche Herausforderung gerät durch diese Debatten vollends in den<br />
Hintergrund: Die Rolle der Mehrheitsgesellschaft – also jener gesellschaftlichen Mehrheit ohne<br />
Migrationshintergrund - wird nicht in den Blick genommen.<br />
Dabei wäre es an der Zeit, über institutionelle Diskriminierungen, beispielsweise im<br />
Aufenthaltsrecht und bei Familienzusammenführungen nachzudenken. Das deutsche<br />
Schulsystem gibt Kindern mit Migrationshintergrund kaum eine Chance, auch auf dem dualen<br />
Ausbildungsmarkt herrscht ethnische Ungleichheit, also strukturelle Diskriminierung von<br />
MigrantInnen. Die Arbeitslosigkeit ist unter Migrantinnen und Migranten deutlich höher. Der<br />
Umgang von Behörden und Polizei mit Migranten ist oft grob und von oben herab.<br />
Trotz der Erkenntnis, dass die Einbürgerung ein deutliches Zeichen eines Menschen dafür ist,<br />
hier in Deutschland auf Dauer seinen Lebensmittelpunkt zu sehen, bleiben die<br />
Einbürgerungsbedingungen hart. Von hier geborenen und beschulten Menschen ohne<br />
deutschen Pass eine Sprachprüfung vor der Einbürgerung zu verlangen, ist eine Erniedrigung.<br />
Hinzu kommt der öffentliche, nur auf tatsächliche oder vermeintliche Defizite der Zuwanderer<br />
fokusierender Diskurs, der die Rolle der Mehrheitsgesellschaft konsequent ausblendet.<br />
Nach wie vor wird der Themenkomplex Integration gerne zu Wahlkampfzwecken benutzt.<br />
Dabei geht es mitnichten darum, um die besten Möglichkeiten zur Herstellung von<br />
Chancengleichheit zu streiten, sondern um die schlichte Bedienung rassistischer Vorbehalte.<br />
159
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Multi-kulturell statt Leitkultur<br />
Die global anstehenden Probleme und Gestaltungsaufgaben setzen Menschen aus<br />
unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Sichtweisen und Problemansätzen voraus.<br />
Wir brauchen multi-kulturelle Ansätze und Vorgehensweisen. Dabei sind die Stärken und<br />
Besonderheiten verschiedener Kulturen zu beachten, zu schätzen und zu nutzen. Wir setzen<br />
uns für die Verbundenheit von Kulturen und Nationen ein und unterscheiden uns damit auch<br />
vom konservativen Ansatz der „Leitkultur“. Integration bedeutet keine uneingeschränkte<br />
Anpassung an bestehende Umstände, sondern die Erneuerung der bestehenden Verhältnisse<br />
durch den Einfluss von außen.<br />
Das Grundgesetzt der Bundesrepubik ist Grundlage für das Zusammenleben unsere Menschen<br />
in unserem Land. Die pauschale Unterstellung, dass viele MigrantInnen sich nicht an das<br />
Grundgesetz halten, lehnen wir ab.<br />
Überhaupt keine Rolle spielt das Sicherheitsbedürfnis der MigrantInnen. Die Medien regierten<br />
verwundert über die heftigen Reaktionen und Spekulationen vieler türkischer Medien nach<br />
dem Hausbrand in Ludwigshafen im Februar 2008. Völlig außer acht blieb dabei, dass in<br />
Deutschland seit Anfang der 1990er Jahren über 130 Menschen durch rechtsextreme Angriffe<br />
getötet wurden, unter anderem auch durch Brandanschläge auf Häuser. Die öffentliche<br />
Diskussion kreist um vermeintlich kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund.<br />
Tatsächlich als Gruppe von Gewalt bedroht sind in Deutschland aber nach wie vor Menschen,<br />
die eben nicht zur gesellschaftlichen Mehrheit gehören. Dem Sicherheitsbedürfnis vieler<br />
MigrantInnen ist durch ein konsequentes auch polizeiliches Vorgehen gegen<br />
Rechtsextremisten Rechnung zu tragen.<br />
Wir wollen uns deshalb bewusst von einer Diskussion abgrenzen, die nur die Migrantinnen und<br />
Migranten als Adressaten von „Maßnahmen zur Integration“ versteht.<br />
Für uns ist vielmehr klar: In erster Linie muss die Mehrheitsgesellschaft ihre Hausaufgaben<br />
machen. Integration wird nur dann gelingen, wenn die gesellschaftlichen Voraussetzungen für<br />
ein gutes Leben für alle Menschen in diesem Land geschaffen sind.<br />
Bildungswesen<br />
Das deutsche Bildungssystem ist so selektiv wie kaum ein zweites in der industrialisierten<br />
Welt. Arbeiterkinder haben deutlich geringere Chancen auf gute Schulabschlüsse als Kinder<br />
wohlhabender Elternhäuser.<br />
160
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Migrantinnen und Migranten sind besonders häufig sozial benachteiligt. Allein deshalb schon<br />
schneiden sie bei den Bildungsabschlüssen wesentlich schlechter ab als der Durchschnitt der<br />
SchülerInnen ohne Migrationshintergrund.<br />
Im Schuljahr 2006/ 2007 besuchten insgesamt 897 700 ausländische Schülerinnen und Schüler<br />
allgemeinbildende Schulen. Der Anteil betrug damit durchschnittlich 9.6 %. In Hauptschulen<br />
liegt der Anteil mit 19,2 % deutlich höher, in Realschulen mit etwa 7,7, % und Gymnasien mit 4,3<br />
% deutlich darunter. Etwa 19.2 % der Schulabsolventen ohne deutschen Paß verlassen die<br />
Schule ohne Abschluss. Das Abitur erreichen lediglich 4,1 %, ein Anteil, der in den letzten 10<br />
Jahren kaum Veränderung erfahren hat. Mit 2,9 % ist der Anteil von Menschen mit<br />
ausländischem Pass, die ihr Abitur in Deutschland gemacht haben, an deutschen Hochschulen<br />
erschreckend gering.<br />
SchülerInnen mit Migrationshintergrund weisen zudem teilweise einen anderen<br />
Förderungsbedarf auf als SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Diesen Bedürfnissen wird<br />
das deutsche Bildungssystem nicht gerecht.<br />
Forderungen:<br />
Bausteine einer erfolgreichen Integration<br />
Wenn uns Integration tatsächlich wichtig ist, müssen wir ebenfalls die Kernfrage beantworten:<br />
Stellen wir hierfür finanzielle Mittel zur Verfügung?<br />
Neben einem notwendigen Umdenken und der Offenheit für Neuerungen steht und fällt an<br />
dieser Frage der Integrationserfolg.<br />
Frühkindliche Förderung<br />
Schwierigkeiten denen SchülerInnen mit Migrationshintergrund begegnen, kann bereits durch<br />
eine gezielte frühkindliche Förderung begegnet werden. Sie setzen frühzeitig in der<br />
Entwicklung der Kinder an, sodass Defizite nicht verstärkt, sondern rechtzeitig behoben<br />
werden.<br />
Die Teilnahme an frühkindlichen Förderungsmaßnahmen ermöglicht zudem eine frühzeitige<br />
Begegnung von SchülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund. Mit dem Ergebnis, dass die<br />
SchülerInnen den Umgang miteinander frühzeitig lernen. Damit diese Förderung alle Kinder<br />
161
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft erreicht fordern wir gebührenfreie Kitaangebote sowie<br />
die Einführung einer Kindergartenpflicht ab dem 3. Lebensjahr.<br />
Die Kindertagestätte als Schnittstelle der Beziehung zwischen Familien und der deutschen<br />
Gesellschaft muss genutzt werden, um weitere Integrationsmaßnahmen durchzuführen. Dabei<br />
sind besonders die Eltern über Projekte und Initiativen anzusprechen. Das von Essen erfolgreich<br />
kopierte Rotterdammer Projekt „Stadtteilmütter“ sollte flächendeckend umgesetzt werden.<br />
Hier bereiten sich Mütter und hoffentlich auch Väter auf die anstehenden Module<br />
(beispielsweise ‚Wir lernen die Uhr, Farben, Tiere etc.‘) vor, damit sie diese mit ihren Kindern in<br />
ihrer Muttersprache üben können, während dies in den Kindergärten auf deutsch spielerisch<br />
gelernt wird. Gleichzeitig werden Eltern zwangsläufig mit anderen Eltern vernetzt.“<br />
Im Gegensatz zur heutigen Situation sind die Kosten für Sprachförderung anteilig von Bund,<br />
Länder und Kommunen zu übernehmen.<br />
Sprachförderung<br />
Die Einführung von Sprachförderung in den Kindertagesstätten ist umzusetzen. Wir wollen,<br />
den Besuch von Kindetagesstätten kostenlos und verpflichtend machen, denn gerade sozial<br />
benachteiligte Kinder (häufig solche von Eltern mit Migrationshintergrund) besuchen keine<br />
Kindergärten. Fehlt der Kindergartenbesuch, können alle dortigen Maßnahmen auch nicht<br />
greifen.<br />
Vermehrt SchülerInnen mit Migrationshintergrund beherrschen die deutsche Sprache nur<br />
fehlerhaft. Die Beherrschung der Sprache ist aber eine notwendige Voraussetzung um<br />
erfolgreich am Schulleben teilnehmen zu können. SchülerInnen die Sprachdefizite aufweisen<br />
müssen zusätzlich sprachlich gefördert werden. Das kann unter anderem durch gezielten<br />
Sprachunterricht sowohl im Kindergarten als auch später in der Schule passieren.<br />
Sprachförderung darf jedoch nicht nur in abgesonderter Form stattfinden, sondern muss<br />
integraler Bestandteil eines jeden (Fach-)Unterrichts sein. Hierbei muss der Ansatz sein die<br />
deutschen sowie die muttersprachlichen Sprachfähigkeiten zu fördern. Dies muss sowohl im<br />
elementarsprachlichen wie auch im fach- und hochsprachlichen Bereich geschehen. Aus<br />
diesem Grund sehen wir in der Sprachförderung eine Aufgabe, die von Institutionen<br />
frühkindlicher Bildung bis in die Sekundarstufe II hineinreicht.<br />
In Schulen, in denen SchülerInnen vornehmlich den gleichen Migrationshintergrund aufweisen,<br />
soll zusätzlicher Unterricht in der Muttersprache ermöglichen Schulinhalte an SchülerInnen zu<br />
vermitteln und sie nicht aufgrund ihrer Sprachdefizite zurückfallen zu lassen.<br />
162
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Sprachförderung von Erst- und Zweitsprache muss institutionsübergreifend erfolgen und darf<br />
sich nicht nur auf die SchülerInnen allein beschränken. Wir <strong>Jusos</strong> unterstützen daher<br />
Programme wie das Modellprojekt „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund“ (FörMig), das auf zweisprachige, institutionsübergreifende Sprachund<br />
Bildungsförderung, die auch die Eltern der SchülerInnen miteinbezieht, abzielt. Die<br />
Finanzierung dieses und ähnlicher Modellprojekte, die bei „Förmig“ beispielsweise momentan<br />
paritätisch von den zehn teilnehmenden Bundesländern und dem Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung getragen wird, darf 2009 nicht ersatzlos auslaufen. Wir <strong>Jusos</strong> fordern<br />
eine Fortführung und Erweiterung solcher Projekte.<br />
Förderung von Zweisprachigkeit<br />
Viele MigrantInnen sind bilingual aufgewachsen oder beherrschen eine andere als die deutsche<br />
Sprache. Die Fähigkeit eine weitere Sprache zu sprechen ist eine hervorragende Kompetenz die<br />
gefördert werden muss. Dabei muss ein Augenmerk auch auf die Ausbildung der<br />
schriftsprachlichen Kompetenz in der Erstsprache gelegt werden.<br />
Die Integration von MigrantInnen sollte nicht zum Verlust zusätzlicher sprachlicher<br />
Kompetenzen führen, sondern im Gegenteil gefördert und erhalten werden. Diese Förderung<br />
kann durch bilingualen und sprachintegrativen Fachunterricht sowie zusätzlichen<br />
Sprachunterricht in der Schule erreicht werden.<br />
Die Vermittlung von Lehrkompetenzen in den Bereichen Zweisprachigkeit und<br />
Sprachförderung muss integraler Bestandteil der LehrerInnenausbildung jeglicher<br />
Fachrichtungen an den Universitäten sowie in der ErzieherInnenausbildung werden. Bereits<br />
ausgebildeten LehrerInnen und ErzieherInnen müssen diese Kompetenzen durch gezielte<br />
Weiterbildungen vermittelt werden.<br />
Diversifizierung der Lehrkörper<br />
Um diese Sprachdefizite zu beheben, brauchen wir sowohl im Kindergarten als auch in der<br />
Schule Personal mit Migrationshintergrund und zusätzlichen qualitativ hohen<br />
Sprachkenntnissen. Die Fähigkeiten dieses Personals können die Integration von MigrantInnen<br />
und die Akzeptanz durch die anderen Kinder und SchülerInnen fördern. Sie können damit<br />
einmal als Ansprechpartner für alle Kinder, Schüler- und LehrerInnen dienen und<br />
gegebenenfalls auf spezielle Probleme von Kinder und SchülerInnen mit<br />
Migrationshintergrund besser eingehen, sowie ihre zusätzliche Sprachkompetenz in die<br />
Vermittlung von Lehrinhalten einbringen.<br />
Darüber hinaus können sie eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen. Insbesondere im<br />
Schulsystem müssen daher LehrerInnen mit Migrationshintergrund bei gleicher Qualifikation<br />
bevorzugt eingestellt werden.<br />
163
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Stärkung der interkulturellen Kompetenz der Lehrer<br />
Mit der Diversifizierung der Lehrkörper muss gleichzeitig eine Stärkung der interkulturellen<br />
Kompetenz von LehrerInnen einhergehen. Die Spannungen die beim aufeinandertreffen von<br />
SchülerInnen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen entstehen können erfordern die<br />
Fähigkeiten der LehrerInnen sie zu erkennen und mit ihnen umgehen zu können. Hier müssen<br />
LehrerInnen vermittelnd und erklärend tätig werden.<br />
Die tatsächliche Präsenz von MigrantInnen in unserer Gesellschaft und ihre Präsenz in den<br />
Schulen erfordert außerdem die Kenntnis der LehrerInnen um die kulturellen Hintergründe<br />
großer Gruppen von MigrantInnen in Deutschland. Diese Kompetenzen müssen LehrerInnen<br />
durch gezielte Weiterbildungen und in ihrer Ausbildung vermittelt werden. Weiter sollten an<br />
Schulen LehrerInnen speziell mit der Aufgabe betraut werden anderen LehrerInnen beratend<br />
zur Seite zu stehen und die Integrationsarbeit in den Schulen zu betreuen.<br />
Abschaffung des Religionsunterrichts<br />
Eine Abschaffung des Religionsunterrichts ist nicht nur auf Grund der Tatsache der Trennung<br />
von Staat und Kirche, sondern aus Gründen der Gleichbehandlung aller Religionen<br />
unumgänglich. Religion soll durch ein gemeinsames konfessionsunabhängiges und neutrales<br />
Fach „Ethik“ ersetzt werden. Dadurch wird nicht nur die Koedukation gefördert sondern auch<br />
Vorurteile abgebaut.<br />
Ein gemeinsames Fach „Ethik“ ist aus unserer Sicht die einzige Lösung, in einer von<br />
verschiedenen Religionen geprägten Gesellschaft gemeinsame Werte, Moral und<br />
Lebensgrundlagen zu vermitteln. Religionsunterricht ist unzeitgemäß und diskriminiert all<br />
diejenigen, in deren Religion kein spezieller Unterricht angeboten wird. Kirche und Staat sind<br />
rechtlich getrennt und dies sollte auch in der Praxis so durchgeführt werden.“<br />
Koedukation<br />
Die Frage ob alle SchülerInnen an Schulveranstaltungen teilnehmen müssen oder die Eltern sie<br />
aus religiösen Gründen entschuldigen dürfen ist geprägt von dem Spannungsverhältnis<br />
zwischen elterlichem Erziehungsrecht und staatlichem Bildungsauftrag.<br />
Die Spannung entsteht dadurch, dass auf der einen Seite SchülerInnen die nicht an diesen<br />
Veranstaltungen teilnehmen die Möglichkeit der vollständigen Teilhabe am Schulleben<br />
verwehrt bleibt.<br />
164
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Auf der anderen Seite durch eine verpflichtende Teilnahme möglicherweise religiöse<br />
Überzeugungen der Schülerin oder des Schülers und der Eltern verletzt werden.<br />
Letztlich überwiegen dennoch der Bildungsauftrag des Staates und die Relevanz einer<br />
Partizipationschance jeder Schülerin und jedes Schülers. Die Teilnahme an<br />
Schulveranstaltungen betrifft einen wichtigen Bereich des Schullebens und ist ein wichtiger<br />
Aspekt für die Integration jeder/s einzelnen Schülerin/Schülers in die Klassengemeinschaft.<br />
Da aber die praktische gewaltsame Durchsetzung der Teilnahme gegen den Willen der<br />
Schülerin und des Schülers unangemessen erscheint müssen die LehrerInnen versuchen die<br />
freiwillige Teilnahme durch einen Dialog mit den Beteiligten zu erreichen.<br />
Repräsentanz von MigrantInnen in Schulbüchern<br />
MigrantInnen sind noch immer in Schulbüchern unterrepräsentiert. Die Personen- und<br />
Gesellschaftsdarstellungen in den Schulbüchern spiegeln die gesellschaftlichen Realitäten<br />
häufig nicht wieder und damit wird den SchülerInnen eine verzerrte Wahrnehmung vermittelt.<br />
Deswegen fordern wir, dass MigrantInnen in Schulbüchern entsprechend ihrer Präsenz in der<br />
Gesellschaft dargestellt werden.<br />
Anerkennung von Schulleistungen/Abschlüssen/Eingliederung von<br />
Schulkindern<br />
Ein weiteres Integrationshindernis stellt die Nichtanerkennung ausländischer Schul- und<br />
Berufsabschlüsse dar. Qualifizierte MigrantInnen können häufig nicht auf ihren bereits<br />
erworbenen Qualifikationen aufbauen, sondern müssen den gesamten Schul- oder<br />
Ausbildungsweg neu bestreiten. Als Folge setzen MigrantInnen häufig ihre Schul- oder<br />
Berufslaufbahn nicht fort, sondern orientieren sich in niedriger qualifizierte Berufe. Um<br />
MigrantInnen den Zugang zum qualifizierten Arbeitsmarkt nicht zu verschließen, sollten<br />
bereits erworbene Qualifikationen anerkannt und mangelnde Fähigkeiten durch punktuelle<br />
Weiterbildungen ausgeglichen werden. Die Anerkennung von Schulabschlüssen ist auch für<br />
SchulerInnen entscheidend, die sich noch im Schulalter befinden. Sie sollten in Klassen mit<br />
gleichaltrigen eingegliedert werden und nicht aufgrund ihres Migrationshintergrundes in eine<br />
niedrigere Klasse oder in eine leichtere Schulform verwiesen werden.<br />
Arbeitsmarkt<br />
Trotz gleich guter formaler Bildung haben MigrantInnen deutlich schlechtere Chancen auf<br />
einen Ausbildungsplatz. Dies führt faktisch zur ethnischen Abschließung in stark<br />
nachgefragten Ausbildungsberufen. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben primär in<br />
165
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
unattraktiven Berufen mit niedriger Entlohnung und geringem Karrierepotenzial gute<br />
Ausbildungschancen. Zudem werden die Jugendlichen über fehlende soziale Netzwerke oder<br />
geringere Einbindung in diese und mittels der Auswahlkriterien der Betriebe, die den sozialen<br />
Hintergrund und die Orientierung berücksichtigen, diskriminiert. Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund werden störende Sozialisationsfaktoren und durch sie bedingte<br />
Verhalten unterstellt, insbesondere unzureichende Kenntnis der „deutschen (Betriebs)Kultur“<br />
und das Fehlen von Fertigkeiten, die außerhalb der Bildungsinstitutionen erworben werden.<br />
Gerade unter jungen Menschen mit Migrationshintergrund ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich<br />
zu jungen Menschen ohne Migrationshintergrund deutlich höher. Sie finden sich deutlich<br />
stärker in schulischen Ausbildungen oder berufsvorbereitenden Maßnahmen wieder.<br />
Dies liegt zum einen daran, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund wesentlich<br />
schlechtere Bildungschancen und damit auch vermehr schlechtere oder keine<br />
Bildungsabschlüsse besitzen. Da die Anforderungen an die formalen Qualifikationen der<br />
Bewerberinnen und Bewerber in den letzten Jahren stets gestiegen sind, folgt hieraus ein<br />
großes Problem für diese Gruppe.<br />
Richtig ist sicherlich, dass der Übergang von der Schule in den Beruf auch dadurch erschwert<br />
wird, dass die Eltern oft nicht mit dem deutschen Schul- und Berufsbildungssystem vertraut<br />
sind. Zudem fehlen meist persönliche Beziehungen zu Betrieben oder Ausbildern, die oft bei<br />
der Suche nach einer Lehrstelle behilflich sind.<br />
Oft fehlt zudem der Blick dafür, welche Berufe eigentlich zu den eigenen Fähigkeiten und<br />
Wünschen am besten passen würden.<br />
Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit auch von Menschen mit Migrationshintergrund bei gleichem<br />
Bildungsstand wie bei Mehrheitsdeutschen höher. Wer einen nicht „deutsch“ klingenden<br />
Nachnamen hat, hat es schon bei der Vorauswahl unter den Bewerbungen schwer.<br />
Für junge Frauen mit Kopftuch kommt das Problem hinzu, das viele Arbeitgeber aus Angst vor<br />
vermeintlich abwehrenden Reaktionen ihrer Kunden von einer Einstellung einer jungen Frau<br />
mit Kopftuch absehen, obwohl diese vielleicht im konkreten Fall die besten Qualifikationen<br />
besitzt.<br />
Zugleich lässt sich beobachten, dass auch im Bereich der höher und hochqualifizierten<br />
Menschen mit Migrationshintergrund die Arbeitslosigkeit höher ist als unter Angehörigen der<br />
Mehrheitsgesellschaft.<br />
Hier lässt sich nicht mehr davon sprechen, dass der Grund für die schlechte Stellung auf dem<br />
Arbeitsmarkt auf den mangelnden schulischen und oder beruflichen Qualifikationen beruht.<br />
166
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Näher liegender ist hier vielmehr, von grundlegenden Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt<br />
auszugehen.<br />
Daher fordern wir:<br />
Der Migrationshintergrund von Menschen darf kein Nachteil auf dem Arbeitsmarkt und bei der<br />
Verwirklichung der eigenen beruflichen Pläne sein!<br />
Die Arbeitsämter müssen gemeinsam mit freien Trägern verstärkt auf Unternehmen zugehen<br />
und Vorurteile abbauen! Wir fordern Kampagne der Arbeitsämter; mit verstärkter<br />
Einbeziehungen der Migrantenselbstorganisationen, die Vorurteile bei Unternehmen abbaut,<br />
und dafür sorgt, dass die Herkunft des Menschen oder seiner Vorfahren keine Rolle bei der<br />
Entscheidung über die Jobvergabe spielt!<br />
Schon in der Schule ist darauf zu achten, dass die Berufsberatung für den Übergang in den<br />
Beruf passend ist, und jungen Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich die ganze<br />
Bandbreite der interessanten Tätigkeiten präsentiert.<br />
Außerdem sollen die Arbeitsagenturen verstärkt Ausbildungsplätze in von MigrantInnen<br />
betriebenen Unternehmen aquirieren!<br />
Ein Mittel und eine Hilfestellung wäre ein Handbuch für von MigrantInnen betriebene<br />
Unternehmen zum Thema „Wie bilde ich jemanden aus?“<br />
Wenn, dann kann der Migrationshintergrund von Menschen eine Ressource sein, ein Nachteil<br />
darf aus ihm nicht gemacht werden!<br />
So kann die Bilingualität der MigrantInnen viel stärker genutzt werden, beispielsweise von<br />
Firmen bei Geschäftsbeziehungen zu den Herkunftsländern der Migranten bzw. von deren<br />
Vorfahren.<br />
Quotenregelung für den Öffentlichen Dienst<br />
Zwar kann der Migrationshintergrund für sich kein Einstellungsgrund sein. Angesichts der<br />
Tatsache, dass Menschen mit Migrationshintergrund in den Berufen des öffentlichen Dienstes<br />
kaum vorkommen, ist aber der Handlungsdruck groß.<br />
Öffentlicher Dienst muss mit gutem Beispiel voran gehen! Der Öffentliche Dienst ist eine der<br />
zentralen Schnittstellen im Alltag zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Eine<br />
167
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
stärkere Beteiligung von Migrantinnen und Migranten im Öffentlichen Dienst hätte zur Folge,<br />
dass Herkunftsdeutsche mit Migrantinnen und Migranten in alltäglichen Situationen stärker in<br />
Kontakt treten würden. Migrantinnen und Migranten könnten sich besser mit der<br />
Mehrheitsgesellschaft identifizieren.<br />
Wir fordern daher die Öffentliche Hand auf, bis zum Jahr 2011 bei den jährlichen<br />
Neueinstellungen mindestens so viele Menschen mit Migrationshintergrund – bei gleicher<br />
Qualifikation wie die anderen Bewerberinnen und Bewerber - einzustellen, wie es ihrem Anteil<br />
an der Bevölkerung des jeweiligen Gebiets entspricht.<br />
Sollte diese freiwillige Quote bis zum Jahr 2011 nicht erreicht werden, so ist eine gesetzliche<br />
Regelung zu finden, die eine einheitliche Definition des Begriffs „Migrationshintergrund“ (etwa<br />
des Statistischen Bundesamtes) zur Grundlage haben muss und die in ihrer Innen- und<br />
Aussenwirkung in einer Weise eingeführt und dargestellt wird, die verhindert, dass es gerade<br />
bei diesem in der Gesellschaft so emotional diskutierten Thema zu<br />
Stigmatisierungserscheinungen kommt.<br />
Begleitend dazu ist ein Förderprogramm aufzulegen, das Menschen mit Migrationshintergrund<br />
gezielt für Tätigkeiten im Öffentlichen Dienst anspricht und gegebenenfalls weitere<br />
Qualifizierungen anbietet. Flankierend dazu müssen Anstrengungen unternommen werden,<br />
die die Stigmatisierungen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund abbauen.<br />
Private Unternehmen, die Menschen mit Migrationshintergrund zumindest entsprechend<br />
ihrem Anteil an der lokalen Bevölkerung entsprechend anstellen, sind bei öffentlichen<br />
Ausschreibungen zu bevorzugen.<br />
Unter der Voraussetzung einer deutlich höheren Ausbildungsquote, welche über Jahre hinweg<br />
für die Steigerung der Lehrstellenanzahl sorgte, ist eine Herabsenkung der Verdienstgrenzen<br />
für qualifizierte Zuwanderer vorzunehmen. Gleichzeitig ist zu verhindern, dass aufgrund dieser<br />
Herabsenkung ein Lohndumping auf Kosten hier lebender Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer stattfindet.<br />
Die klugen Köpfe sind stärker einzubinden, weiterhin sind ausreichend Perspektiven für ihre<br />
persönliche Lebensplanung zu bieten. Dabei hat jeder, der in Deutschland eine abgeschlossene<br />
Hochschulausbildung getätigt hat eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.<br />
Diese gilt auch für seinen engsten Familienkreis. Der Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft<br />
ist ebenfalls unter erleichternden Bedingungen zu gewähren. Alle in Deutschland<br />
ausgebildeten Fachkräfte einzubeziehen.<br />
168
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Zur Lage von Migrantinnen<br />
Migrantinnen werden in Deutschland zweifach diskriminiert: als Migrantin und als Frau.<br />
Bei gleichen Bildungsabschlüssen ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Frauen mit<br />
Migrationshintergrund und einem Hochschulabschluss doppelt so hoch wie unter Frauen ohne<br />
Migrationshintergrund. Unter jungen Frauen mit Migrationshintergrund ohne akademischen<br />
Abschluss ist die Situation noch dramatischer.<br />
Hinzu tritt ein öffentlicher Diskurs, der Frauen mit Migrationshintergrund vor allem eine<br />
Opferrolle zuweist: Das Bild der unterdrückten Frau – das sich zumeist auf die muslimische<br />
Frau konzentriert. Das Kopftuch wird dabei als Symbol zur Unterdrückung der Frauen<br />
instrumentalisiert. Bücher über Zwangsehen füllen die Buchhandlungen. Die Berichterstattung<br />
über sogenannte Ehrenmorde nimmt breiten Raum ein, und schafft es bis in die<br />
Talkshowrunden und Hauptnachrichtensendungen.<br />
Die Diskussion über Unterdrückung, Patriarchat, sowie Zwangsheirat und Ehrenmorde nimmt<br />
momentan einen breiten Raum in der öffentlichen Debatte ein. Ohne Zweifel ist jeder Mord<br />
verwerflich und fürchterlich. Riskant ist bei dieser Debatte allerdings, dass durch<br />
kulturalistische Argumentationen und die Fokussierung auf die „unterdrückte muslimische<br />
Frau“ der Blick auf die realen Probleme der Migrantinnen und eigentlichen Ursachen versperrt<br />
bleibt – mit der Folge der Reproduktion von ethnizitäts- und geschlechtsspezifischen<br />
Stereotypen, die in verzerrte Debatten und falschen Rückschlüssen münden . Zudem werden<br />
Migrantinnen als monolithischer Block dargestellt. So wird der Blick für die diversifizierte<br />
Realität von Migrantinnen verzerrt.<br />
Die spezifischen sozioökonomischen Lebensverhältnisse von Migrantinnen sind für deren<br />
Zukunftschancen entscheidend. Migrantinnen finden sich überproportional oft in<br />
unterprivilegierten Gesellschaftsschichten wieder.<br />
Hinzu kommen zum Teil spezifische Macht- und Gewaltverhältnisse zwischen den<br />
Geschlechtern. Hier wird die ökonomische (und oftmals rechtliche) Abhängigkeit von<br />
Migrantinnen zementiert; und hauptsächlich auf tradierte Geschlechterrollen mit der Frau als<br />
Mutter und dem Mann als Ernährer der Familie festgeschrieben.<br />
Gerade Frauen mit Migrationshintergrund sind von schlechten Arbeitsbedingungen, vor allem<br />
schlechterer Bezahlung sowie der Abschiebung auf Minijobs betroffen.<br />
169
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Dabei gilt es zu erkennen: Die Kritik am islamischen Frauenbild – das die öffentlichen und<br />
politischen Debatten beherrscht – ist im Kern eine Kritik am patriarchalischen Gesellschaftsbild<br />
– das sich auch in allen Religionen und bürgerlich-konservativen Gruppen wiederfindet. Die<br />
Forderung nach einem selbstbestimmten Leben für Frauen, ist eine Forderung, für die auch die<br />
feministische Bewegung in Deutschland seit Jahrzehnten kämpft.<br />
Deutlich wird: Die ohnehin schwierige Ausgangssituation für eine weibliche Emanzipation in<br />
Deutschland verkompliziert sich bei Migrantinnen zusätzlich durch die Diskriminierung, die sie<br />
durch die Mehrheitsgesellschaft als Migrantin erfährt!<br />
Daher fordern wir:<br />
Wer will, dass Frauen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können, muss die realen<br />
Möglichkeiten dafür schaffen!<br />
Die beruflichen Beschäftigungs- und Aufstiegschancen für Frauen mit Migrationshintergrund<br />
müssen verbessert werden! Dies kann nur über einen Abbau von Diskriminierungen vor allem<br />
am Arbeitsmarkt gelingen. Wir fordern daher eine konsequente Anwendung des Allgemeinen<br />
Gleichbehandlungsgesetzes gerade auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere auch Sachen<br />
Entlohnung!<br />
Eine tatsächliche Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt wird sich nur dann herstellen<br />
lassen, wenn innerhalb der Familien ein modernes Geschlechterverhältnis Einzug hält.<br />
Dieses gilt es durch ein flächendeckendes Netz von Betreuungseinrichtungen abzusichern.<br />
Frauen, die im Wege der Familienzusammenführung nach Deutschland kommen, müssen eine<br />
eigenständige und vom Status des Ehemanns unabhängige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis<br />
vom ersten Tag an erhalten.<br />
Denn auch mit Blick auf die Migrantinnen gilt: Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die<br />
männliche überwinden!<br />
Medien und MigrantInnen<br />
In einer Gesellschaft in der die Medien neben der Legislative, der Judikative und der Exekutive<br />
als vierte Gewalt gelten, nehmen die Medien und ihre Berichterstatter eine besondere Rolle bei<br />
der öffentlichen Meinungsbildung ein und tragen eine dementsprechende Verantwortung.<br />
170
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Sie gelten als Sprachrohr der Bürger und zugleich Informant. Sie dienen als Spiegelbild der<br />
Gesellschaft und können deshalb die Bürger näher aneinander bringen, aber sie auch<br />
auseinandertreiben.<br />
Schaut man sich die gängigen Tageszeitungen an, so erkennt man, dass sich bestimmte<br />
Schlagzeilen immer mehr häufen:<br />
• „Die Integration ist gescheitert“<br />
• „MigrantInnen ziehen sich in ihre Parallelgesellschaften zurück“<br />
• „Der Islamismus ist auf dem Vormarsch“<br />
• „Unter den MigrantInnen herrscht ein latenter Deutschenhass“<br />
Durch diese mit Mehrheit negativen Berichterstattungen bildet sich der Leser seine Meinung<br />
und assoziiert zwangsläufig Einwanderung und Integration mit etwas Negativen.<br />
Die positiven Beispiele gehen durch die Menge der negativen Berichterstattungen unter und<br />
die Gesellschaft konzentriert sich stattdessen auf die Verfehlungen.<br />
Die MigrantInnen haben darunter am meisten zu leiden, da sie als die Schuldigen<br />
gebrandmarkt sind.<br />
Einseitige Entscheidungsebenen haben eine einseitige Berichterstattung zur Folge, welchem<br />
entgegengewirkt werden muss.<br />
Denn: Medien können gar kein Spiegelbild der Gesellschaft sein, da sie die Zusammensetzung<br />
dieser gar nicht korrekt wiedergeben!<br />
Es herrscht ein Mangel an Ausgewogenheit zwischen Vertretern der Mehrheitsgesellschaft und<br />
Vertretern der Minderheiten.<br />
Stellen MigrantInnen innerhalb der Gesellschaft einen nicht niedrigen Anteil dar, so gehen sie<br />
bei den Medien nahezu vollkommen unter.<br />
Einige nehmen zwar aktiv am Mediengeschehen teil, doch müssen sie immer wieder als<br />
Positivbeispiel angeführt werden, um so den Mangel ausgleichen zu können<br />
In den letzten Jahren hat sich eine breit gefächerte Szene aus Zeitungen und Zeitschriften<br />
entwickelt, die entweder von ausländischen Unternehmen für Migrantinnen und Migranten in<br />
Deutschland als Zielgruppe entwickelt wurden, oder die von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund in<br />
171
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Deutschland gegründet wurden.<br />
Daher fordern wir:<br />
Mehr Repräsentanz von MigrantInnen in den Medien für eine ausgeglichenere<br />
Berichterstattung!<br />
Hier sind gerade die öffentlich-rechtlichen Sender gefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen.<br />
Es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die als freie JournalistInnen arbeiten, oder<br />
auf dem Weg dahin sind. Es gäbe keine für die Stellen geeigneten MigrantInnen ist ein reine<br />
Schutzbehauptung. Die Fernseh- und Radiosender haben bei ihrer Einstellungspolitik die<br />
Realität der Einwanderungsgesellschaft zu berücksichtigen!<br />
Ergänzend dazu fordern wir mehr journalistische Förderprogramme für MigrantInnen.<br />
Die in den letzten Jahren entstandenen Medien von Migrantinnen und Migranten sind als Teil<br />
der deutschen Medienlandschaft ernst zu nehmen und zu beachten.<br />
Nicht nur die negativen Berichterstattungen dürfen beachtet werden. Positivbeispiele müssen<br />
denselben Raum bekommen. Die verzerrende, stets nur Probleme und Negativbeispiele in den<br />
Vordergrund rückende Berichterstattung muss aufhören!<br />
Zudem gilt: Keine Ethnisierung der Berichterstattung! Die ethnischen Unterschiede dürfen in<br />
den Berichterstattungen keine Rolle spielen. Die wahren Ursachen von sozialer und<br />
gesellschaftlicher Exklusion müssen benannt werden!<br />
Wir fordern, dass die Lebensrealität der Einwanderungsgesellschaft auch in der<br />
Journalistenausbildung ankommt. In Zusammenarbeit u.a. mit Migrantenselbstorganisationen<br />
soll mit den Journalistenverbänden und den Ausbildungsstätten für Journalisten ein Konzept<br />
entwickelt werden, wie angehenden Journalisten ein differenzierter und klischeefreier Zugang<br />
zu den Themen Migration und Integration ermöglicht werden kann.<br />
Politikerstatements tragen zur Verschärfung der Lage bei oder entschärfen diese. Gerade die<br />
sozialdemokratischen Politikerinnen und Politiker sind dazu aufgerufen, durch Wortwahl und<br />
eine sensible Art im Umgang mit dem Thema Integration sowie den Anliegen der Migrantinnen<br />
und Migranten zu einem gesellschaftlichen Klima beizutragen, in dem pauschale Vorurteile<br />
abgebaut und Anerkennung für Migrantinnen und Migranten geschaffen wird.<br />
172
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
In einer von uns gewünschten multikulturellen Gesellschaft hat eine Benachteiligung aufgrund<br />
eines Migrationshintergrunds nichts zu suchen. Die konsequente Umsetzung des Anti-<br />
Diskriminierungsgesetzes ist deshalb zu befolgen. Dabei ist vor allem stärker auf die<br />
gesetzlichen Möglichkeiten hinzuweisen, sodass benachteiligte Menschen über ihre Rechte<br />
ausreichend informiert sind und sich zu wehr setzen können.<br />
Die frühe Begegnung zwischen Kindern mit und ohne eine Migrationsherkunft ist anzustreben.<br />
Vor allem in der Freizeit sollte die Möglichkeit bestehen gemeinsam Zeit verbringen zu können.<br />
Dabei sind öffentliche Angebote im Rahmen der Kinder- und Jugendpflege zu bestehen sowie<br />
Vereinsangebote zu fördern.<br />
Um einen verstärkten interkulturellen Austausch in Vereinen zu schaffen, ist die Förderung von<br />
Vereinsarbeit auszuweiten. Dabei gilt es insbesondere die Vereinsförderung auch unter dem<br />
Aspekt der Integration zu betrachten und auf solche Angebote besonders einzugehen.<br />
Dem noch immer bestehenden Alltagsrassismus ist zu begegnen. Die Gesellschaft muss durch<br />
eine Kampagne gegen diesen sensibilisiert werden.<br />
Kommunale Integration/Institutionen<br />
Damit kommunale Integration erfolgreich ist, braucht es unterschiedliche Maßnahmen:<br />
Um individuelle und maßgeschneiderte Maßnahmen in der Kommune anzubieten, ist eine<br />
Kenntnis der Herkunft der MigrantInnen unabdingbar. Hierzu müssen Daten erhoben werden,<br />
wie sich diese Menschen wo in der Kommune auf die verschiedenen Herkunftsländer und -<br />
regionen verteilen. Wir fordern die Entwicklung differenzierter Integrationskonzepte für<br />
Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und Lebensalter, um zielorientierte<br />
Angebote zu entwickeln, die der Integration tatsächlich förderlich sind. Integration setzt nicht<br />
nur bei Kleinkindern an, sondern setzt sich über die Familien fort bis hin zu<br />
herkunftsspezifischen Angeboten für SeniorInnen.<br />
Vor Realisierung dieses Konzepts muss ohne Frage eine Bestandsaufnahme stehen, die die<br />
finanzielle Situation im Bereich Integration darstellt. Die aktuellen Ausgaben in der Kommune<br />
müssen auf ihren Sinn und Zweckhaftigkeit hin überprüft und eine mögliche Umverteilung<br />
und Neuorientierung analysiert werden. Dennoch werden höhere Ausgaben im Bereich<br />
Integration unabdingbar sein, um erfolgreiche individuelle Maßnahmen realisieren zu können.<br />
Dabei muss aber auch klar sein: Eine gescheiterte Integration kostet um Einiges mehr.<br />
Unser Konzept zur Integration in der Kommune sieht vor, dass die Menschen mit den<br />
verschiedensten Migrationsgeschichten bei der Planung und Umsetzung von Projekten ohne<br />
Einschränkung einbezogen werden. So fordern wir exemplarisch eine Vernetzung und<br />
173
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Zusammenarbeit von Verbänden, Vereinen, Initiativen und Unternehmen zur Initiierung und<br />
Förderung von Projekten.<br />
Gerade Akzeptanz ist ein wichtiger Schritt für die Integration in unsere Gesellschaft. Diese wird<br />
nicht nur in Kindergärten und Schulen, sondern wird auch durch Austausch innerhalb der<br />
Kommune / des Stadtteils vermittelt. Aus diesem Grund fordern wir, dass vermehrt Projekte<br />
initiiert werden, die besonders diesen Austausch fördern. Raum für derartige Projekte ist nicht<br />
nur in Kindergärten oder Schulen zu finden und zu suchen, sondern auch in anderen<br />
Begegnungsstätten, wie z.B. Jugendhäusern oder Sportvereinen. In diesem Zusammenhang<br />
fordern wir den Erhalt und die Förderung von Jugendhäusern und Sportstätten. Gemeinsame<br />
Veranstaltungen im Stadtteil können ein friedliches Zusammenleben und die kulturelle Vielfalt<br />
lancieren und einen interreligiösen Dialog initiieren.<br />
Verwaltung<br />
Es gibt viele Ansatzpunkte, um Menschen mit Migrationsgeschichte das Leben in den<br />
Kommunen zu vereinfachen und somit ihre Integration zu fördern, denn oft nehmen sie nötige<br />
Hilfe nicht an und bleiben mit ihren Problemen alleine in ihrem direkten Lebensumfeld, ohne<br />
zu wissen, dass sich dies auf die nachfolgende Generation auswirkt. Als ersten Schritt fordern<br />
wir die Anstellung von mehrsprachigen MitarbeiterInnen in öffentlichen Einrichtungen, wie<br />
z.B. der Stadtverwaltung, um Sprachbarrieren zu beheben und so eine bessere Ansprache von<br />
Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermöglichen.<br />
Partizipation<br />
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Integration von MigrantInnen ist, ihnen die Teilnahme an<br />
demokratischen Entscheidungen zu ermöglichen. Dazu gehört vor allem die Kommunalwahl,<br />
ebenso aber auch Bürgerentscheide – diese Entscheidungen haben direkt vor Ort<br />
Auswirkungen auf das Leben. Aus diesem Grund fordern wir ein Kommunales Wahlrecht für<br />
alle hier lebenden Menschen, die ihren ersten Wohnsitz seit mindestens vier Jahren in<br />
Deutschland haben.<br />
Darum beteiligen wir <strong>Jusos</strong> uns an der Kampagne „Hier wo ich lebe, will ich wählen!“, die 2007<br />
von der LAGA, AWO, Landesjugendring, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Caritas, Diakonie und<br />
anderen gestartet wurde. Darüber hinaus muss der Ausländerbeirat als eigenständiger<br />
ordentlicher Ratsausschuss installiert werden. Mit diesem Schritt kann sowohl eine<br />
174
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Aufwertung erfolgen als auch eine Animation der Menschen mit Migrationsgeschichte, sich<br />
vermehrt und intensiver für ihre eigenen Belange einzusetzen. Leben im Stadtteil.<br />
Das Erscheinungsbild verschiedener Stadtteile bzw. Bezirke führt häufig dazu, dass Menschen<br />
ohne Migrationsgeschichte in angeblich „bessere“ Gegenden wechseln. Dies erschwert den<br />
MigrantInnen die Integration, da hier kein interkultureller Austausch mehr stattfinden kann.<br />
Wir fordern daher eine Aufwertung dieser Stadtteile durch bauliche Maßnahmen und<br />
Aufwertung und Ausbau von Grünanlagen. Dies dient dem kulturellen Austausch. Durch eine<br />
derartige Aufwertung wird der Stadtteil auch wieder attraktiv für Menschen, die es für<br />
gewöhnlich eher in andere Stadtteile oder Städte zieht. Bei der Planung dieser<br />
Stadtteilaufwertungen stellt die Partizipation von MigrantInnen im Prozess eine wesentliche<br />
Grundbedingung dar. Zudem müssen in diesem Rahmen Überlegungen angestellt werden,<br />
bezahlbaren Wohnraum für Familien zur Verfügung zu stellen.<br />
Neben der baulichen Stadtteilaufwertung sind Begegnungsstätten in den Stadtteilen eine<br />
weitere Möglichkeit, um Integration zu fördern, z.B. in Form eines Cafes oder Treffpunkts mit<br />
diversen Angeboten, wie einer Kinder- und Hausaufgabenbetreuung durch ältere<br />
MitbürgerInnen mit oder ohne Migrationsgeschichte. Derartige Begegnungsstätten sollten mit<br />
multikulturellem Personal ausgestattet sein, um die genannten Sprachbarrieren und andere<br />
Hemmnisse, wie insbesondere Vorurteile, abzubauen.<br />
Dialog mit der Polizei schaffen<br />
Ein besserer Dialog zwischen Polizei und vor allem Jugendlichen mit einer Migrationsherkunft<br />
ist zu ermöglichen. Es sind neue Planstellen bei der Polizei zu schaffen, die vorwiegend für<br />
solche Dialoge zuständig sind. Gleichzeitig ist vermehrt auf Präventionsprojekte Wert zu legen,<br />
um auch vorbeugend Maßnahmen ergreifen zu können.<br />
Im Rahmen der Polizeiausbildung ist auf die Erlernung von interkultureller Kompetenz mehr<br />
Wert zu legen. Insgesamt ist ein besserer Dialog auch in die Arbeit von Streetworkern und<br />
Sozialpädagogen einzubetten.<br />
SeniorInnen<br />
Auch über das Leben im Alter müssen sich Kommunen verstärkt Gedanken machen. Viele<br />
Gastarbeiter kommen jetzt in das Rentenalter. Oft können herkömmliche Alten- oder<br />
Pflegeheime nicht die Ansprüche der SeniorInnen mit Migrationshintergrund gerecht werden.<br />
Gerade SeniorInnen mit muslimischen Glauben haben besondere Ansprüche. Wir fordern, dass<br />
sich die Alten- und Pflegeheime auf diese SeniorInnen einstellen und das Essen speziell<br />
zubereiten, Gebetsräume zur Verfügung stellen und die Hinweisschilder auf verschiedene<br />
175
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Sprachen anbringen. Sinnvoll ist auch das Personal auf dieses Klientel umzustellen und zu<br />
schulen.Politische Partizipation<br />
Von politischen Entscheidungen ist die Mehrzahl der MigrantInnen in der Bundesrepublik<br />
ausgeschlossen.<br />
Dies hat Gründe:<br />
Die Mehrzahl der Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik besitzt keinen deutschen<br />
Pass. Dies führt zu einem weitgehenden Ausschluss von politischen Gestaltungsmöglichkeiten.<br />
Auch Migrantinnen und Migranten mit einer Staatsangehörigkeit der Europäischen Union<br />
können nur bei Europawahlen sowie auf kommunaler Ebene wählen. Von Entscheidungen auf<br />
Bundesebene bleiben auch sie ausgeschlossen.<br />
Zumindest nach ihrem rechtlichen Status können nur Migrantinnen und Migranten, die einen<br />
deutschen Pass besitzen, alle demokratischen Partizipationsrechte wahrnehmen.<br />
Es dominiert in der Öffentlichkeit die Diskussion über Migrantinnen und Migranten die Illusion<br />
von einer Integrationsverweigerung der Mehrheit der MigrantInnen. Dabei ist eine<br />
gleichberechtigte Diskussion über weitere Schritte hin zu einer modernen<br />
Einwanderungsgesellschaft noch lange nicht erreicht. Diese würde vor allem voraussetzen,<br />
dass die Mehrheitsgesellschaft auch bereit ist, Forderungen und Vorwürfe von Seiten der<br />
Migranten ernsthaft zu diskutieren.<br />
Dies ist momentan nicht der Fall. Beispiel ist die Reaktion der meisten Medien auf die Boykott-<br />
Drohung einiger Migrantenselbstorganisation in Richtung auf den „Integrationsgipfel“ der<br />
Bundesregierung im Sommer 2007. Suggeriert wurde, dass die Verbände den angebotenen<br />
„Dialog auf Augenhöhe“ mit der deutschen Politik ablehnen. Nur – ein Dialog auf Augenhöhe<br />
kann erst dann statt finden, wenn alle Beteiligten rechtlich gleichgestellt sind und damit –<br />
zumindest theoretisch – dieselben Zugangsmöglichkeiten zum politischen<br />
Entscheidungsprozess haben wie die Mehrheitsgesellschaft. Dies ist gerade nicht der Fall.<br />
Deutlich wird dies auch, wenn man auf den Auslöser der Boykott-Drohungen blickt: Nämlich<br />
die Verschärfung der Nachzugsrechte zu türkischen Ehepartnern in der Bundesrepublik.<br />
Kurz: Themen, die für den Integrationsprozess von MigrantInnen wichtig sind, werden nur aus<br />
der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft heraus beleuchtet und diskutiert. Dies führt zu<br />
Handlungs- und Lösungsvorschlägen, die einerseits an der Lebensrealität der MigrantInnen<br />
vorbeigehen (Verzerrung der Diskussionen), anderseits aber auch nur an die MigrantInnen<br />
176
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
adressiert sind. Das von vielen MigrantInnen als paternalistische Bevormundung seitens der<br />
Mehrheitsgesellschaft wahrgenommene Verhalten fördert Abgrenzungstendenzen und<br />
behindert zusätzlich die Identifikation mit der Mehrheitsgesellschaft.<br />
Die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten besitzt nach wie vor keinen deutschen Pass. Die<br />
Folge ist ein grundsätzlich unsicherer rechtlicher Aufenthaltsstatus. Das Recht zum Verbleib in<br />
Deutschland hängt vom Wohlwollen der (deutschen) Mehrheitsgesellschaft ab, da die<br />
gesetzlichen Regelungen, die dem Aufenthalt zugrunde liegen, jederzeit wieder geändert<br />
werden können.<br />
Die Diskussion über Integration ist ein Diskurs der Mehrheit über eine weitgehend rechtlich<br />
und sozial schlechter gestellte Minderheit. Anders gesagt: ein Diskurs, den die<br />
Dominanzgesellschaft über die Marginalisierten führt.<br />
Von einem Diskurs auf Augenhöhe kann dann gesprochen werden, wenn der<br />
Migrationshintergrund nicht mehr zugleich rechtliche und soziale Benachteiligung der<br />
Diskutanten bedeutet.<br />
Auch die Repräsentanz von Migrantinnen und Migranten in den etablierten Parteien und<br />
politischen Institutionen ist gering.<br />
Zwar gibt es mittlerweile von der Europa- bis hin zur kommunalen Ebene in allen Parlamenten<br />
deutsche Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Diese bilden aber eine Ausnahme.<br />
Repräsentativ für den Anteil der MigrantInnen an der Gesamtbevölkerung ist dies bei weitem<br />
nicht.<br />
Zwar gibt es mittlerweile gerade auch in der SPD und den <strong>Jusos</strong> eine wachsende Zahl von<br />
Mitgliedern mit Migrationshintergrund. In höheren Funktionen sucht man nach ihnen aber<br />
vergeblich. Ein Blick auf den SPD-Parteivorstand oder den Juso-Bundesvorstand genügt.<br />
Zwar haben mittlerweile viele Unterbezirke und Stadtverbände der SPD und der <strong>Jusos</strong><br />
Arbeitskreise zum Thema Integration eingerichtet.<br />
Dabei muss gelten: MigrantInnen sind weder per se noch alleine für Integrationspolitik<br />
verantwortlich.<br />
177
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Eine Strategie, wie es die Partei und unser Verband schaffen können, tatsächlich allen<br />
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Bundesrepublik unabhängig von ihrer<br />
Herkunft eine politische Heimat zu bieten, existiert nicht.<br />
Für manche jungen Menschen mit Migrationshintergrund ist dies Grund genug, sich in Migrantenselbstorganisationen<br />
zu organisieren. Diese haben unterschiedliche politische, soziale,<br />
kulturelle oder religiöse Ziele. Gemein ist den meisten dieser Organisationen, dass sie ihren<br />
Fokus auf ein Engagement in Deutschland und nicht auf das Herkunftsland ihrer Eltern gelegt<br />
haben, womit sie deutlich ihre Bereitschaft und ihren Anspruch zur politischen und<br />
gesellschaftlichen Teilhabe in Deutschland untermauerten.<br />
Oftmals handelt es sich bei den MSO um relativ neue und wenig finanzstarke Organisationen<br />
ohne rechtlichen Status. Aufgrund des fehlenden rechtlichen Status (im Sinne von rechtlicher<br />
Nichtanerkennung der Organisationen als zivilgesellschaftliche Akteure) beibt ihnen der Weg<br />
zur finanziellen Unterstützung und politischen Anerkennung somit aufrund struktureller und<br />
rechtlicher Hindernisse versperrt. In der Folge müssen diese Verbände stärker als viele<br />
Jugendorganisationen der Mehrheitsgesellschaft ohne hauptamtliche Unterstützung<br />
auskommen, was ihren Aktionsradius wesentlich einschränkt.<br />
Die Verbände leisten wichtige politische Arbeit in Richtung Mehrheits- und<br />
Minderheitsgesellschaft. Sie sind ein potenzieller Bündnispartner für eine fortschrittliche<br />
Integrationspolitik und für die <strong>Jusos</strong> und die SPD.Daher fordern wir:<br />
Die SPD muss die Migrantinnen und Migranten als seriöse Zielgruppe anerkennen. Dies geht<br />
über die Produktion mehrsprachiger Flyer in Wahlkämpfen deutlich hinaus.<br />
Ziel muss sein, Migrantinnen und Migranten in aussichtsreichen Positionen auf die<br />
Wahlvorschläge der SPD für die Parlamente zu bekommen, und ihren Anteil in den Gremien der<br />
Partei zu erhöhen.<br />
Ein erster Schritt wäre, dass die Parteivorsitzenden auf allen Ebenen das Thema Integration auf<br />
die politische Tagesordnung setzen, und deutlich machen, dass sie selbst für eine stärkere<br />
Öffnung der Partei hin zu Menschen mit Migrationshintergrund stehen.<br />
Außerdem muss die SPD endlich einen umfassenden fortschrittlichen Diskurs über Integration<br />
als Querschnittsthema entwickeln und diesen in alle Gremien tragen.<br />
Auch wir JungsozialistInnen müssen dieses Politikfeld und die Menschen in den Fokus unserer<br />
Debatten rücken. Integrationspolitik darf auch bei uns nicht länger Randthema bleiben.<br />
Leitbild wäre hier ähnlich des Gender Mainstreaming das eines „Mainstreaming Integration“.<br />
178
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Des Weiteren fordern wir <strong>Jusos</strong> die kompletten bürgerlichen Rechte für alle Menschen, die<br />
mindestens vier Jahre ihren rechtmäßigen Aufenthalt in der Bundesrepublik haben. Dies<br />
bedeutet die Einführung eines Ausländerwahlrechts auf kommunaler, Landes-, Bundes- und<br />
europäischer Ebene.<br />
Wir fordern eine erleichterte Einbürgerung. Staatsbürgerschaftstests und<br />
Verfassungstreueprüfungen sowie Sprachtests lehnen wir ab!<br />
Wir fordern die doppelte Staatsbürgerschaft: Bei der Einbürgerung ist nicht die Aufgabe der<br />
alten Staatsangehörigkeit zu verlangen!<br />
Wir fordern die finanzielle und politische Aufwertung von Integrationsräten in den<br />
Kommunen!<br />
Wir fordern die finanzielle und politische Aufwertung von Migrantenselbstorganisationen. Sie<br />
sind wichtig um gesellschaftliche und politische Anliegen von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund in die öffentliche Diskussion einzubringen. Gerade für die<br />
Sozialdemokratie können sie Bündnispartner für die Entwicklung von fortschrittlicher Politik in<br />
Deutschland sein.<br />
179
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
N<br />
Nachhaltige Wirtschafts- und Steuerpolitik<br />
N 2 - LV NRW<br />
Finanzmärkte regulieren!<br />
Nachhaltiges Wachstum fördern,<br />
Kurzfristorientierung verhindern!<br />
1. Einleitung<br />
Seit Januar 2008 erleben wir eine der heftigsten Finanzkrisen in der neueren Geschichte.<br />
Kommentatoren wie der ehemalige Präsident der Federal Reserve Bank, Alan Greenspan,<br />
sprechen von der schwersten Finanzkrise seit 1945. Ausgelöst durch eine Immobilienkrise in<br />
den USA infiziert sie Banken und Börsen rund um den Globus.<br />
Die Konsequenz: Derzeit müssen die Steuerzahler und Zentralbanken mehrere Banken mit<br />
Milliardenbeträgen vor dem Zusammenbruch bewahren. Im Frühjahr 2008 stufen<br />
Wirtschaftsforschungsinstitute, die Deutsche Bundesbank, Internationaler Währungsfonds<br />
und EU-Kommission die positiven Wachstumsprognosen von ursprünglich mehr als 2 % auf ca.<br />
1,5% zurück. Die globale Finanzmarktkrise hat die deutsche Realwirtschaft erreicht. Weitere<br />
schwere Konsequenzen sind absehbar.<br />
In dieser Situation werden zwei Kernelemente des finanzgetriebenen Kapitalismus deutlich,<br />
wie er in den westlichen Industriestaaten in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchgesetzt<br />
wurde: grenzenlose Kapitalströme, die häufig selbst die wenigen verbliebenen Regeln<br />
missachten, und die besondere Krisenanfälligkeit dieser Form des Kapitalismus.<br />
Die <strong>Jusos</strong> wollen die aktuelle Krise zum Anlass nehmen, die Entwicklungen zu analysieren und<br />
den Handlungsbedarf sozialdemokratischer Politik aufzuzeigen. Dabei geht es uns nicht um<br />
einen moralischen Fingerzeig, wie ihn Franz Müntefering einst in seiner Heuschreckendebatte<br />
bedeutete. Nötig ist eine nüchterne Analyse. Politische Weichenstellungen haben die Ursachen<br />
dieser Krise ermöglicht. Nun brauchen wir politische Antworten.<br />
180
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
2. Spekulation statt Investition – die fehlgeleitete Dynamik des<br />
finanzgetriebenen Kapitalismus<br />
Die jüngere Wirtschaftsgeschichte ist geprägt von wechselnden Phasen der Deregulierung und<br />
Reregulierung des Finanzsystems. Die letzte große Phase der Deregulierung ist Anfang der<br />
1930er Jahre mit der Großen Depression bzw. dem Untergang der Demokratie in vielen Ländern<br />
beendet worden. Heute weisen bedeutende Politiker und Wirtschaftswissenschaftler,<br />
insbesondere in den USA, auf die besorgniserregenden Parallelen zwischen den 1920er Jahren<br />
und der aktuellen Entwicklung hin. Hieraus lassen sich wichtige Lehren ziehen, wobei die<br />
theoretisch-wissenschaftliche Dimension von der politökonomischen unterschieden werden<br />
muss.<br />
Die fragwürdige theoretische Begründung der Finanzmarktderegulierung<br />
Auf theoretischer Ebene entspringt die Forderung nach Deregulierung der neoklassischen<br />
Annahme, freie Finanzmärkte neigten aus sich heraus zu Effizienz. Diese Annahme galt bis zur<br />
„Keynesianischen Revolution“ Mitte der 1930er Jahre als gesicherte Erkenntnis. Danach wurde<br />
sie für mehrere Jahrzehnte allgemein als widerlegt betrachtet. Erst die „monetaristische<br />
Gegenrevolution“ der 1970er Jahre hat der neoklassischen Effizienzmarkthypothese wieder<br />
Auftrieb verliehen. Sie lässt sich sowohl auf den Unternehmenssektor wie auf den privaten<br />
Haushaltssektor anwenden, d.h. nach dieser Sichtweise werden sowohl unternehmerische<br />
Produktions- und Investitionsentscheidungen als auch private Konsum- und<br />
Sparentscheidungen durch deregulierte Finanzmärkte am besten befördert.<br />
• Unternehmen erzeugen nach dieser Sichtweise genau dann den größten<br />
gesamtgesellschaftlichen Nutzen, wenn sie sich möglichst stark am Shareholder Value<br />
orientieren. Aktienkurse spiegeln demnach die Gewinnerwartungen von Unternehmen<br />
realistisch wieder. Gutes Management wird durch hohe Aktienkurse belohnt,<br />
schlechtes durch niedrige bestraft. Nur freie Aktienmärkte, in denen es keine<br />
regulatorischen Hürden für feindliche Übernahmen und kurzfristige Aktienumsätze<br />
gibt, werden das Management zu einer möglichst effizienten Mittelverwendung mit<br />
entsprechend positiven gesamtwirtschaftlichen Wachstumseffekten disziplinieren.<br />
Weitere Anreize erhalten Manager durch die Koppelung ihrer Vergütung an<br />
Aktienkurse (z.B. durch Aktienoptionen). Hohe Aktienkurse werden Investitionen<br />
stimulieren, niedrige Aktienkurse weisen darauf hin, dass „zu viele“ (ineffiziente)<br />
Investitionen vorgenommen werden. Abweichung der Aktienkurse von den<br />
181
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
„Fundamentalwerten“ ist auf Dauer nicht möglich, da die Marktteilnehmer effizient<br />
mit den vorhandenen Informationen umgehen.<br />
• Ähnliches gilt für die Kreditvergabe (Konsumentenkredite, Hypothekenkredite) an die<br />
privaten Haushalte. In effizienten Kreditmärkten würden Individuen nur dann Kredit<br />
erhalten, wenn die Kreditgeber ihre Fähigkeit zu künftigem Schuldendienst für<br />
ausreichend halten. Auf freien Märkten wird es längerfristig nicht zu einer<br />
unangemessenen Kreditexpansion bzw. zu einer allgemeinen Kreditklemme kommen<br />
können. Vielmehr bedeutet etwa ein Rückgang der Sparquote in Verbindung mit einer<br />
verstärkten Verschuldung der privaten Haushalte, dass von den rationalen<br />
Marktteilnehmern eine positive künftige Produktivitäts- und Einkommensentwicklung<br />
erwartet wird, die die Bedienung der aufgenommenen Schulden ermöglichen wird.<br />
Diese Hypothesen sind theoretisch umstritten und empirisch kaum belegt. Insbesondere<br />
weisen mittlerweile selbst prominente frühe Vertreter des Shareholder Value-Konzepts darauf<br />
hin, dass die Fixierung auf kurzfristige Finanzmarktkennzahlen (Aktienkurs, Gewinn pro Aktie)<br />
zu einer obsessiven Kurzfristorientierung des Managements führt. Empirische Untersuchungen<br />
zeigen, dass Manager in großem Umfang langfristig rentable Investitionen zu Gunsten<br />
kurzfristiger Finanzmarktergebnisse unterlassen. Außerdem führt die mit der<br />
Finanzmarktorientierung verbundene zunehmende Ausschüttung von Gewinnen (Dividenden,<br />
Aktienrückkäufe) dazu, dass den Unternehmen liquide Mittel zur Investitionsfinanzierung<br />
fehlen.<br />
Auch im Bereich der Kreditvergabe an private Haushalte kann eine exzessive<br />
Kurzfristorientierung zu negativen gesamtwirtschaftlichen Effekten führen. Wenn Banker<br />
einen gewichtigen Teil ihrer Vergütung über leistungsbezogene Bonuszahlungen beziehen,<br />
können sie einen Anreiz haben, sehr riskante Kreditvergaben zu veranlassen. Dieses Problem<br />
wird durch die im Zuge der Deregulierung zunehmende Unübersichtlichkeit im Bereich<br />
innovativer Finanzprodukte verstärkt. Außerdem können viele Banken davon ausgehen, im<br />
Ernstfall von der Zentralbank oder der Regierung im Interesse der Finanzsystemstabilität<br />
gerettet zu werden. Die erwartete Vergesellschaftung von Verlusten verführt aber dazu, im<br />
Kampf um private Gewinne übertriebene Risiken einzugehen.<br />
Diese im Kern keynesianischen Ergebnisse sind mittlerweile wieder selbstverständlicher Teil<br />
eines neuen wirtschaftswissenschaftlichen Mainstreams. Da jedoch die<br />
Finanzmarktderegulierung bis jüngst fortschreitet – weitgehend unabhängig von<br />
parteipolitischen Konstellationen –, scheint es notwendig, auch Erklärungen im politischen<br />
Prozess selbst zu suchen.<br />
182
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Finanzmarktderegulierung als Ergebnis von Lobbyismus?<br />
Auf politischer Ebene ist Finanzmarktderegulierung in der Geschichte typischerweise mit einer<br />
wachsenden Einflussnahme entsprechender Lobbygruppen einhergegangen. In den USA waren<br />
die zuständigen Regierungsvertreter sowohl in den 1920er Jahren als auch in der jüngeren<br />
Vergangenheit eng mit dem Bankenwesen verbunden. Beispielsweise war der<br />
wirtschaftspolitische Berater und Finanzminister unter Bill Clinton, Robert Rubin, vor seiner<br />
Tätigkeit in der Regierung stellvertretender Vorstandsvorsitzender der großen Investmentbank<br />
Goldman Sachs. Später wurde er Vorsitzender der Bankengruppe Citigroup. Deren Gründung<br />
war erst möglich geworden, nachdem 1999 eine der wichtigsten Regulierungsmaßnahmen aus<br />
Roosevelts „New Deal“, der Glass-Steagall Act von 1933, abgeschafft worden war. Dieses Gesetz<br />
hatte verhindert, dass Banken sich am Investmentgeschäft beteiligen. Die Deregulierung in<br />
diesem Bereich hat maßgeblich zur Kreditexpansion im Zuge des Booms minderwertiger<br />
Hypothekenkredite in den letzten Jahren beigetragen. Auch der aktuelle US-Finanzminister,<br />
Henry Paulson, war früher Investmentbanker und Vorstandsvorsitzender bei Goldman Sachs.<br />
Auch in Deutschland ist der Einfluss der Finanzbranche auf die Politik unübersehbar. Ehemalige<br />
Minister und Kanzler, gerade auch der rot-grünen Bundesregierung, stehen heute auf den<br />
Gehaltslisten großer Finanzdienstleister wie Hedge Fonds oder Versicherungen.<br />
Zu diesen Prozessen gab es in der Geschichte und gibt es auch heute Gegenbewegungen.<br />
Franklin D. Roosevelt richtete sich mit seinem „New Deal“ ausdrücklich gegen die<br />
Lobbyinteressen der Finanzbranche. Der aktuelle Präsidentschaftswahlkampf in den USA dreht<br />
sich ansatzweise um ähnliche Themen. In Deutschland ist die Gegenbewegung bislang noch<br />
schwach.<br />
Die jüngste Welle der Finanzmarktderegulierung in Deutschland<br />
In Deutschland waren die Maßnahmen der jüngsten Deregulierungsphase im Finanzsystem<br />
besonders weitgehend. Hierzu gehören im weiteren Sinne u.a.:<br />
- 1991: Abschaffung der Börsenumsatzsteuer<br />
- 1997: Abschaffung der Vermögensteuer<br />
- 1998: Legalisierung von Aktienrückkäufen, Managementvergütung über Aktienoptionen<br />
- 2000 und 2008: Senkung der Körperschaftsteuer (von 40 % auf 25 % und dann 15 %) und der<br />
Kapitaleinkommensteuern<br />
- 2001: Subventionierung privater Finanzdienstleister im Zuge der „Riester-Rente“<br />
183
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
- 2002: Senkung der Steuer auf Veräußerungsgewinne bei Kapitalanlagen (von 40 % bzw.<br />
auf 0 % bei Kapitalgesellschaften, durch Halbeinkünfteverfahren bei Privatpersonen)<br />
- 2004: Legalisierung von Hedge Fonds, Aufweichung der Grenzen zwischen<br />
Investmentfonds und Hedge Fonds<br />
- 2007: Zulassung und steuerliche Förderung von REITs (börsennotierte Immobilienfonds)<br />
- 2008: steuerliche Förderung von Private Equity Fonds<br />
Es kann keine Rede davon sein, dass Deutschland durch die Globalisierung zu diesen<br />
Deregulierungs- bzw. Subventionsmaßnahmen gleichsam gezwungen worden wäre. Im<br />
Gegenteil: Maßnahmen wie die Abschaffung der Börsenumsatzsteuer oder der Steuer auf<br />
Veräußerungsgewinne sind im internationalen Vergleich eher ungewöhnlich. Auch die<br />
Steuerleichterungen für Kapitalgesellschaften und Private Equity Fonds erscheinen im<br />
internationalen Vergleich als unnötig und teilweise extrem.<br />
Die Gefahren der Finanzmarktderegulierung und die Notwendigkeit der<br />
Reregulierung<br />
Generell zeigt die Geschichte, dass die Finanzmarktderegulierung ihren Anspruch der<br />
gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsförderung nicht zu erfüllen im Stande ist. In den USA hat<br />
Finanzmarktderegulierung sowohl in den 1920er Jahren als auch in der jüngeren<br />
Vergangenheit zu einer nicht nachhaltigen kreditfinanzierten Finanzspekulation sowie zu einer<br />
starken Zunahme des kreditfinanzierten privaten Konsums geführt. Unternehmen neigen<br />
dazu, ihr Interesse von der realen Investitionstätigkeit auf Finanzinvestitionen (feindliche<br />
Übernahmen, Aktien(rück)käufe, Konsumentenkredite, etc.) zu verlagern.<br />
Typisch für Phasen der Finanzmarktorientierung sind auch die Deregulierung der<br />
Arbeitsmärkte und eine schwache Einkommensentwicklung bei der großen Masse der<br />
Bevölkerung. Allerdings können die privaten Haushalte die Deregulierung des<br />
Kreditvergabegeschäfts sowie den tendenziellen Anstieg von Finanz- und<br />
Immobilienvermögen dazu nutzen, ihren Konsum verstärkt über Kredit zu finanzieren. Allein<br />
dies erklärt, warum in den USA sowohl in den 1920er Jahren als auch in der jüngeren<br />
Vergangenheit der private Konsum zur beherrschenden Stütze der wirtschaftlichen Dynamik<br />
werden konnte, obwohl die realen Einkommen der breiten Masse der Bevölkerung jeweils<br />
stagnierten. Nach der offiziellen Statistik ist die private Sparquote in den USA seit einigen<br />
Jahren sogar negativ.<br />
184
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Eine solche Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Dynamik von kreditfinanziertem Konsum<br />
ist aber nicht nachhaltig und beschwört Finanzkrisen herauf. In den 1930er Jahren folgte somit<br />
auf die Große Depression die Einsicht, dass die Masseneinkommen (Reallöhne) stärker steigen<br />
müssen, damit die Güternachfrage den Angebotskapazitäten folgen kann, ohne dass sich die<br />
privaten Haushalte übermäßig verschulden müssen.<br />
In Deutschland ist es im Bereich der Finanz- und Arbeitsmärkte in der jüngeren Vergangenheit<br />
zu einer weitgehenden Annäherung an das finanzmarktdominierte US-amerikanische System<br />
gekommen. Unternehmen müssen sich immer stärker am Shareholder Value-Konzept<br />
orientieren und führen verstärkt Finanzinvestitionen durch, während die reale<br />
Investitionstätigkeit schwach ist. Insbesondere durch die radikale Abschaffung der Steuer auf<br />
Veräußerungsgewinne bei Kapitalgesellschaften ist die Gefahr feindlicher Übernahmen<br />
besonders groß geworden. Die Unternehmen nutzen zunehmend die neuen gesetzlichen<br />
Möglichkeiten wie Aktienrückkäufe oder Managementvergütung über Aktienoptionen. Durch<br />
die gezielte gesetzgeberische Förderung von Hedge Fonds und Private Equity Fonds werden<br />
auch nicht börsennotierte Unternehmen auf eine permanente Fixierung auf die kurzfristige<br />
Rentabilität festgelegt, da sonst Unternehmensübernahmen drohen.<br />
Anders als in den USA gleichen die privaten Haushalte in Deutschland ihre stagnierenden bzw.<br />
rückläufigen Realeinkommen aber nicht durch eine verstärkte Kreditfinanzierung des Konsums<br />
aus. Im Ergebnis ist die private Binnennachfrage insgesamt (Investitionen und Konsum) seit<br />
Jahren überaus schwach. Zugleich ist das deutsche Finanzsystem Krisen im Ausland in<br />
besonderem Maße ausgesetzt: Da inländischer Privatsektor und Staat kaum<br />
Finanzierungsmittel nachfragen, sind deutsche Banken sehr stark im Ausland engagiert und<br />
waren somit beispielsweise durch die jüngste Hypothekenkrise in den USA in besonderer Weise<br />
betroffen.<br />
Der 2005 nach langer Stagnationsphase einsetzende Aufschwung ist nun durch die<br />
Finanzmarktkrise bedroht. Die Exportdynamik scheint nicht nachhaltig den privaten Konsum<br />
anzuregen. Die Reallöhne sind sogar während des Aufschwungs weiter gesunken – ein Novum<br />
in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Damit längerfristig die binnenwirtschaftlichen<br />
Nachfragekomponenten (v.a. private Investitionen und Konsum) wieder einen regelmäßigen<br />
und kräftigen Wachstumsbeitrag leisten können, sind sowohl eine Reregulierung des<br />
Finanzsystems als auch eine kräftigere Entwicklung der Masseneinkommen sowie eine stärker<br />
wachstumsorientierte makroökonomische Politik notwendig.<br />
3. Finanzmärkte politisch regulieren – in Deutschland, Europa und<br />
global<br />
185
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Vor der eigenen Haustür beginnen: Das deutsche Finanzsystem ist faktisch<br />
unterreguliert!<br />
Die Regulierung des deutschen Finanzmarktes ist im letzten Jahrzehnt von zwei Entwicklungen<br />
getrieben worden. Erstens wurde es den Banken durch die Liberalisierung auf europäischer und<br />
internationaler Ebene ermöglicht, nationale Regulierungen zu umgehen. Dies wurde von der<br />
deutschen Regierung massiv mit voran getrieben. Zweitens ist der nationale<br />
Regulierungsrahmen hauptsächlich auf Basis von Selbstverpflichtungen, „Best Practices“ oder<br />
den allseits beliebten (weil wirkungslosen) „Codes of Conduct“ entwickelt worden. Wir<br />
brauchen auf nationaler Ebene eine klare und durchsetzungsfähige Regulierung. Diese muss<br />
die Umgehung von nationalen Regelungen verhindern und gleichzeitig auf europäischer und<br />
internationaler Ebene eine Reregulierung vorantreiben. Ziel muss es sein, dass das Banken- und<br />
Finanzwesen wieder der realen Wirtschaft und der Vermögensmehrung der Normalverdiener<br />
dient.<br />
Spekulation begrenzen, eine Börsenumsatzsteuer wieder einführen. Hierdurch würden<br />
kurzfristige Vermögensverschiebungen relativ zu langfristigen Anlagen teurer werden. Dies<br />
könnte zur Verringerung spekulativer Kursmanipulation durch Großanleger beitragen. Bis 1991<br />
gab es in Deutschland eine Börsenumsatzsteuer von 1-2,5 Promille des Kurswertes je nach<br />
Wertpapierart. Zwar würde durch die Wiedereinführung einer Börsenumsatzsteuer allein das<br />
Problem der übermäßigen Spekulation längst nicht vollständig beseitigt. Jedoch würde eine<br />
solche Umsatzsteuer gewährleisten, dass Finanzmarktakteure stärker an der Finanzierung<br />
öffentlicher Aufgaben beteiligt würden. Bei einer Wiedereinführung mit einem Satz von 0,5<br />
Prozent wie in Großbritannien würden zusätzlich bis zu 14 Milliarden Euro Steuereinnahmen<br />
generiert werden. Eine Börsenumsatzsteuer ist ein zentrales Instrument um die Volatilität –<br />
also die Transaktionsgeschwindigkeit – der Kapitalmärkte zu reduzieren und ist somit ein<br />
wichtiges Element zur Stabilisierung dieser.<br />
Langfristorientierung fördern, Aktienstimmrecht ändern. Das Aktienstimmrecht sollte in<br />
Abhängigkeit von der Haltedauer ausgeübt werden müssen. Investoren sollten Anreize haben,<br />
langfristig in Aktien zu investieren und im Sinne einer langfristigen Strategie in das<br />
Unternehmen zu wirken. Entsprechend setzen wir uns für ein zeitlich gestaffeltes<br />
Aktienstimmrecht gemäß der Haltedauer der Aktien ein. Dies würde die kurzfristige<br />
Einflussnahme erschweren und es somit Aufsichtsräten und Vorständen ermöglichen, in<br />
längeren Zeithorizonten zu handeln.<br />
186
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Öffentlichen Bankensektor stärken. Durch seine regionale Verankerung sollte es die vorrangige<br />
Aufgabe des öffentlichen Bankensektors sein, für Kredite und Finanzdienstleistungen für kleine<br />
und mittlere Unternehmen sowie ArbeitnehmerInnen zu sorgen. Der öffentliche Bankensektor<br />
ist im vergangenen Jahrzehnt unter erheblichen Liberalisierungs- und Privatisierungsdruck<br />
geraten mit dem Ziel, die Sparkassen als dritte Säule des deutschen Bankensystems zu<br />
schwächen. Dieser Trend ist umzukehren. Öffentliche Banken haben in spekulativen<br />
internationalen Finanzgeschäften nichts zu suchen. Wir brauchen öffentliche Banken, die einen<br />
noch stärkeren Fokus auf lokale und regionale Investitionsfinanzierung legen, anstatt in hoch<br />
riskanten internationalen Spekulationsgeschäften aktiv zu sein. Gerade in Zeiten von<br />
Finanzmarktturbulenzen und drohender Kreditklemme durch die Privatbanken muss der<br />
öffentliche Bankensektor die Funktion eines Puffers erfüllen und dazu beitragen, den<br />
Kreditfluss an gesunde Unternehmen zu verstetigen.<br />
Transparenz steigern. Banken können zurzeit über die Konstruktion von Zweckgesellschaften,<br />
teilweise in Steueroasen wie Luxemburg oder Liechtenstein, riskante Kreditgeschäfte<br />
außerhalb der Bilanzen vollziehen. Die Einrichtung und das Risiko aus solchen<br />
Zweckgesellschaften müssen in den Bilanzen klar ersichtlich sein. Banken mit öffentlichem<br />
Anteil sollten diese verboten werden.<br />
Veräußerungsgewinne besteuern. Die selbst für die Finanzmarktlobby überraschende<br />
Aufhebung der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen durch Rot-Grün ist rückgängig zu<br />
machen. Gerade für institutionelle Anleger kommt es bei Unternehmenskäufen und -<br />
veräußerungen nicht auf das langfristige Engagement im Zielunternehmen an, sondern der<br />
kurzfristige Umschlag von Eigentumstiteln und die damit verbundenen Konsequenzen für die<br />
Unternehmen (s.o.) gehören schlicht zu ihrer Geschäftsstrategie. Und die Gewinne daraus sind,<br />
ebenso wie bei anderen Unternehmen, zu besteuern.<br />
Aktienrückkäufe und kreditfinanzierte Sonderdividenden beschränken. Unternehmen<br />
finanzieren einen Großteil ihrer Investitionen über interne Finanzierungsmittel.<br />
Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen kommen kurzfristig den Aktionären (und ggf.<br />
Managern über an Finanzmarktkennzahlen ausgerichteten Bonuszahlungen) zugute, aber sie<br />
verschlechtern die Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen. Private Equity Fonds streben in<br />
einigen Fällen eine höhere Rendite durch kreditfinanzierte Sonderdividenden an. Diese<br />
Praktiken müssen stärker begrenzt oder verboten werden.<br />
Keine steuerliche Förderung von Hedge Fonds und Private Equity Fonds. Die Aktivitäten dieser<br />
Finanzinvestoren sollten vielmehr stärker kontrolliert und beschränkt werden. Indiskutabel ist<br />
es, wenn das Geschäftsmodell dieser Fonds auf staatlicher Förderung durch<br />
187
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Steuererleichterungen basiert. Die Überschuldung von Zielunternehmen muss verhindert<br />
werden, z.B. durch eine effektive Zinsschranke.<br />
Mindestreserven auf alle Finanz- und Sachaktiva. Hierbei müssten Banken abgestuft nach<br />
jeweiliger Wert- und Risikoentwicklung Mindestreserven bei der zuständigen Zentralbank<br />
hinterlegen. Die Zentralbanken könnten bei einer Zuspitzung der Marktlage diese<br />
Reserveanforderungen antizyklisch variieren und so Anreize zu Spekulation bzw.<br />
Panikreaktionen dämpfen.<br />
Europäische Regeln für einen integrierten Finanzplatz Europa schaffen!<br />
In Europa besteht seit dem Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte 1987 ein Markt<br />
ohne Binnengrenzen, der u.a. die Kapitalverkehrsfreiheit umfasst. Mit zahlreichen Initiativen<br />
hat die EU-Kommission die Durchsetzung dieser Kapitalverkehrsfreiheit durch einheitliche<br />
Marktbedingungen vorangetrieben, seit 1995 insbesondere durch den Financial Services and<br />
Action Plan. Mit der Einführung des EURO 2001 und der Umsetzung der<br />
Finanzdienstleistungsrichtlinie (MifID) 2004 ist ein stark integrierter europäischer Kapitalmarkt<br />
entstanden. Diesem weitgehend liberalisierten Markt steht jedoch eine undurchsichtige<br />
Vielfalt von nationalen Aufsichtsbehörden und Befugnissen gegenüber. Diese<br />
Aufsichtsbehörden werden in einem aufwendigen Ausschusssystem koordiniert. Ihre<br />
unterschiedliche Funktionswiese wird jedoch auch angesichts der aktuellen Krise deutlich:<br />
Während in Spanien die zuständige Zentralbank den Handel mit verbrieften<br />
Immobilienkrediten einschränkte, verzocken sich vor allem deutsche und britische Bankhäuser<br />
auf dem amerikanischen Markt – ohne Einspruch der jeweiligen Aufsichtsbehörden. Hier ist<br />
eine einheitliche europäische Finanzmarktaufsicht gefordert. Sie muss anhand einheitlicher<br />
Regeln (z.B. über Transparenz- und Eigenkapitalvorschriften) Akteure wie Ratingagenturen<br />
sowie in Europa angebotene Finanzprodukte genehmigen und kontrollieren.<br />
Neben der institutionellen Schwäche einer zersplitterten Finanzmarktaufsicht bei immer enger<br />
europäisch agierenden Banken und Anlegern sind auch regulative Maßnahmen zur<br />
Begrenzung der Exzesse auf den Kapitalmärkten nötig. Die Verflechtung der deutschen<br />
Wirtschaft mit dem europäischen Binnenmarkt sowie die Rückwirkungen des Finanzsektors<br />
auf die Realwirtschaft auf eben diesen sind die wichtigsten Gründe für eine stärkere<br />
Regulierung auf europäischer Ebene. So wäre ein System von Mindestreserven, die<br />
Finanzinstitute bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen müssen, wenn sie bestimmte<br />
Finanzgeschäfte tätigen, ein wirksames und variables Instrument, um deren Spekulationssucht<br />
zu bremsen. Auch eine Einschränkung des Weiterverkaufs von Kreditrisiken ist möglich, wenn<br />
etwa durch europäische Bilanzierungsvorschriften mindestens 20% des weiterveräußerten<br />
188
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Forderungsvolumens im emittierenden Institut noch bilanzwirksam (und damit<br />
haftungsrelevant) erfasst werden müssen.<br />
Globale Kooperation beginnen!<br />
Globalisierte Finanzmärkte brauchen gerechte und globale Regeln. Die Zeiten von freiwilligen<br />
Selbstverpflichtungen und internationalem Regulierungsvakuum müssen vorbei sein. Die<br />
internationalen Finanzmärkte müssen wieder dem Menschen und seinem Wirtschaften dienen<br />
und nicht der kurzfristigen milliardenfachen Profitmaximierung einiger weniger. Das was die<br />
Steuerzahler zurzeit in die Stabilisierung der Finanzmärkte geben müssen, ist vorher von den<br />
Bankern in die eigene Tasche gewirtschaftet worden. Gewinne werden privatisiert, Verluste<br />
vergesellschaftet.<br />
Steueroasen aktiv bekämpfen. Die zahlreichen Offshore-Finanzzentren geben<br />
Finanzmarktinvestoren die Möglichkeit, jedwede Regulierung und Transparenz zu unterlaufen.<br />
So werden Risiken versteckt, Steuern hinterzogen und kriminelle Gelder gewaschen. Der<br />
Postkasten hierfür steht zwar juristisch auf irgendeiner Karibikinsel, in Monaco oder<br />
Liechtenstein, Investmentbanken und Anwaltskanzleien steuern diese Geschäfte jedoch von<br />
Frankfurt oder London. Diese Doppelbödigkeit muss beendet, die direkte oder indirekte<br />
Beteiligung an solchen Geschäften international verboten werden. Steueroasen müssen<br />
diplomatisch wie wirtschaftlich sanktioniert werden. Staaten mit eigenen Off-Shore-Zentren<br />
auf dem Territorium, wie Großbritannien, die USA oder Frankreich, müssen diese abschaffen.<br />
Wir brauchen eine Staatengruppe, die sich klar von solchen Praktiken distanziert und<br />
Kapitalverkehrskontrollen für Staaten einführt, die keine anspruchsvolle Regulierung und<br />
Offenlegung vorweisen können oder die solche Offshore-Zentren weiterhin unterstützen.<br />
Unternehmen und Finanzdienstleister, die weiterhin mit solchen Finanzzentren handeln<br />
wollen, müssten höheres Eigenkapital hinterlegen bzw. Sonderabgaben leisten.<br />
Wir halten an der Tobin Tax zur Stabilisierung der internationalen Kapitalmärkte fest und<br />
verbinden die zu erzielenden Steuereinnahmen mit der Finanzierung wichtiger<br />
entwicklungspolitischer Zielsetzungen.<br />
Die zunehmend multipolare Weltordnung mit den aufstrebenden Schwellenländern China,<br />
Indien und Brasilien macht eine neue internationale Koordination der Geldpolitiken<br />
notwendig. Die einseitig manipulierten Wechselkurse zur Förderung nationaler<br />
Exportstrategien, wie etwa durch China, führen zu gefährlichen Verzerrungen im<br />
internationalen Handelssystem. Im Krisenfall sind einzelne Zentralbanken zudem überfordert.<br />
In der aktuellen Krise hat die Koordination der Zentralbanken zwischen Europa und den USA<br />
gezeigt, dass gemeinsames Vorgehen zumindest kurzfristig Stabilisierungserfolge bringt. Ein<br />
international ausgewogenes Währungssystem sollte über den IWF vereinbarte<br />
189
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wechselkurskorridore und Regeln zur koordinierten Intervention auf den Geldmärkten<br />
beinhalten. So können nationale Alleingänge, die in einer globalisierten Wirtschaft oft negative<br />
Folgen haben, vermieden werden.<br />
4. Neuorientierung der makroökonomischen Politik<br />
Die Reregulierung des Finanzsystems muss mit einer angemessenen Makropolitik flankiert<br />
werden. Deutschland bzw. die Europäische Währungsunion liegen hier im<br />
wirtschaftswissenschaftlichen wie –politischen Bereich weit hinter den internationalen<br />
Standards zurück. In so unterschiedlichen Ländern wie den USA, Großbritannien oder<br />
Schweden gilt es als Selbstverständlichkeit, dass die Geld- und Fiskalpolitik einen wichtigen<br />
Beitrag zur konjunkturellen Stabilisierung und damit letztlich zum langfristigen Wachstum<br />
leisten müssen. In Europa setzt das Maastricht-Regime der staatlichen Fiskalpolitik enge<br />
Grenzen. Deutschland bleibt zudem bei den öffentlichen Investitionen systematisch hinter<br />
dem Durchschnitt der entwickelten Industrieländer zurück. Die Europäische Zentralbank<br />
verfolgt eine einseitige Inflationsbekämpfungspolitik, während andere Zentralbanken<br />
ausdrücklich auch Wachstumsziele verfolgen.<br />
Verfehlt ist der Vorwurf, eine expansive Geldpolitik – wie in den letzten Jahren in den USA – sei<br />
verantwortlich für die Entwicklung von Finanzkrisen. In der Vergangenheit war eine expansive<br />
Geldpolitik problemlos mit Finanzsystemstabilität vereinbar, da entsprechende<br />
Regulierungsvorkehrungen verhinderten, dass niedrige Zinsen zur Ausweitung der Spekulation<br />
auf Grundlage hoher Schuldenhebel führten. Erst die Deregulierung des Finanzsystems hat<br />
dazu geführt, dass die Zinspolitik nicht mehr zielgenau auf den realwirtschaftlichen Prozess<br />
durchgreifen kann, sondern perverse Nebeneffekte im Finanzsystem entwickelt (etwa<br />
Liquiditäts- und Solvabilitätskrisen bei privaten Haushalten und Banken im Zuge der<br />
Kreditverbriefung).<br />
Eine Reregulierung des Finanzsystems schafft zwar die Voraussetzung dafür, dass<br />
Unternehmen ihren Fokus wieder stärker auf die realwirtschaftliche Investitionstätigkeit<br />
richten und eine Überschuldung der privaten Haushalte vermieden wird. Letztlich wird die<br />
Investitions- und Kreditnachfrage der Unternehmen sich jedoch nur dann angemessen<br />
entwickeln können, wenn die Unternehmen eine entsprechende Entwicklung der<br />
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und insbesondere der inländischen Konsumnachfrage<br />
erwarten. Daher gilt es, neben einer pragmatischen Geld- und Fiskalpolitik auch wieder zu<br />
einer stabilitätsorientierten Lohnpolitik zu kommen, d.h. der Verteilungsspielraum aus<br />
längerfristigem Produktivitätsfortschritt und Inflation sollte jeweils ausgeschöpft werden,<br />
damit die realen Masseneinkommen im Einklang mit den volkswirtschaftlichen<br />
190
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Angebotskapazitäten wachsen. Deutschland nimmt mit der drastischen Lohnzurückhaltung<br />
der letzten Jahre eine internationale Außenseiterposition ein. Dies erklärt die seit langem<br />
stagnierende Konsumnachfrage.<br />
Wachstum ist kein Selbstzweck. Vielmehr bittet es die Chance, um gesellschaftliche<br />
Verteilungskonflikte zu entschärfen. Auch würde ein kräftigeres Wachstum über einige Jahre<br />
dazu führen, dass sich das politische Klima in Deutschland normalisiert. Die positiven<br />
Verteilungseffekte kräftigen Wachstums sind jedoch kein Automatismus, sondern müssen<br />
weiterhin politisch erkämpft werden. Viele renommierte Wirtschaftswissenschaftler und<br />
Nobelpreisträger aus dem Ausland sind erschrocken darüber, wie sehr die wirtschafts- und<br />
sozialpolitische Debatte in Deutschland auf Strukturreformen und Kürzungen von sozialen<br />
Leistungen fixiert ist.<br />
5. Herausforderungen für uns <strong>Jusos</strong>: einseitige Wirtschafts- und<br />
Finanzpolitik aufbrechen<br />
In der aktuellen Finanzmarktkrise möchten wir <strong>Jusos</strong> aufzeigen, wie ungerecht und wenig<br />
nachhaltig der finanzmarktgetriebe Kapitalismus ist. Längst rufen auch diejenigen nach<br />
staatlichen Eingriffen, die sonst politisches Handeln zur Gestaltung von Wirtschaftsprozessen<br />
ideologisch ablehnen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erleben Stellenstreichungen<br />
trotz Rekordgewinnen. Die Mittelschicht erodiert, immer mehr Menschen sind trotz<br />
wachsenden gesamtwirtschaftlichen Reichtums vom Abstieg bedroht.<br />
Die Einseitigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland gefährdet den sozialen<br />
Zusammenhalt in Deutschland. Die Deregulierung des Finanzsystems spielt hierbei eine<br />
herausragende Rolle. Die Beeinflussung der Regierungsarbeit durch den Lobbyismus der<br />
Finanzbranche ist makroökonomisch schädlich und belastet die Demokratie.<br />
Hier gilt es, in den kommenden Wahlauseinandersetzungen 2009 und 2010 eine gründliche<br />
Analyse und Alternativen aufzuzeigen, die deutlich über eine moralische Geißelung einzelner<br />
Akteure hinausgehen. Mit dieser Positionsbestimmung wollen wir <strong>Jusos</strong> hierzu einen Beitrag<br />
leisten und die Diskussion innerhalb der SPD vorantreiben.<br />
Für uns ist klar: Die Ungerechtigkeit und die Instabilität sind nicht dem Fehlverhalten einzelner<br />
Anleger oder Banken geschuldet, sondern gehören zwingend notwendig in die Logik des<br />
aktuellen Kapitalismusmodells. Daher bedarf es politischer Regulation, um ungerechte und<br />
ineffiziente Auswüchse zu überwinden und Entwicklungen hin zu einem sozial gerechten und<br />
nachhaltigen Wirtschaftsmodell in die Wege zu leiten. Die Richtung der SPD in den<br />
191
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
vergangenen Jahren ist hier dem Diktat der Kapitalmarktlobby und des neoliberalen<br />
Mainstreams gefolgt. Dieser Kurs ist zu korrigieren! Wir brauchen eine funktionale und linke<br />
Antwort auf die Krise des finanzgetriebenen Kapitalismus!<br />
Dabei ist uns bewusst, dass dies nur mit gesellschaftlichen Mehrheiten gelingen kann. Mit<br />
einfachen Parolen und blinder Umverteilung ohne Rücksichtnahme auf die komplexen<br />
wirtschaftlichen Implikationen auf den Finanzmärkten lassen sich weder Mehrheiten noch<br />
funktionale Lösungen für eine solche Politik finden. Diese differenzierte Haltung müssen wir in<br />
der Auseinandersetzung mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie z.B. aus der<br />
globalisierungskritischen Bewegung, oder anderen linken Parteien konstruktiv in die Debatte<br />
einbringen.<br />
Nicht zuletzt ist für uns <strong>Jusos</strong> wichtig, dass die Diskussion sachlogisch auch europäisch und<br />
international in der sozialistischen Bewegung geführt werden muss. Wir begrüßen daher die<br />
Anstrengungen der SPE, auf europäischer Ebene eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte<br />
voranzubringen. Auch wollen wir als <strong>Jusos</strong> innerhalb von ECOSY die Diskussion im Sinne<br />
unserer oben beschriebenen Positionen vorantreiben.<br />
N 6 - LV RLP<br />
Die Unternehmensteuerreform der Großen<br />
Koalition – keine GROSSE Reform! – Flat<br />
Tax – Nein Danke!<br />
Die Große Koalition aus Union und SPD hat eine Unternehmenssteuerreform auf den Weg<br />
gebracht, deren Geist genau dem aktuellen Mainstream in der wirtschaftspolitischen Debatte<br />
entspringt. Mit der Reform wird der Versuch unternommen, allen Lobbygruppen<br />
entgegenzukommen, ohne dabei den Blick objektiver über die Scheuklappen des<br />
vermeintlichen internationalen Steuerwettbewerbs hinaus zu richten.<br />
Steuer- und Abgabenstruktur in Deutschland<br />
Vergleicht man die Steuer- und Abgabenstruktur Deutschlands mit anderen OECD Ländern,<br />
stellt sich heraus, dass der Anteil an Steuern an der Gesamtbelastung in Deutschland<br />
192
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
unterdurchschnittlich ist – stärker hingegen ist der Abgabenanteil. Das Steueraufkommen in<br />
Deutschland ist eher gering.<br />
Jedoch sind die Steuersätze, die tarifliche Belastung, vergleichsweise hoch. Das hat wiederum<br />
negative Anreizwirkungen auf Firmen, die in Deutschland investieren wollen, da diese oftmals<br />
nicht die effektive Abgabenlast im Blick haben (Leuchtturmeffekte), sondern nur die nominalen<br />
Sätze. Zudem führt eine solche hohe tarifliche Belastung11 zu einer hohen Grenzbelastung<br />
gerade zusätzlicher Investitionen von Firmen, die schon am Standort engagiert sind. Hierher<br />
rührt auch die unterschiedliche Bewertung von Steuerbelastungen im internationalen<br />
Vergleich. Im Vergleich des Verhältnisses von tatsächlich gezahlten Unternehmenssteuern zum<br />
BIP liegt Deutschland im unteren Mittelfeld der OECD Staaten. Vergleicht man hingegen eine<br />
standardisierte Investition, die ein Unternehmen in verschiedenen Staaten tätigen kann,<br />
schneidet Deutschland, wegen den hohen tariflichen Belastungen deutlich schlechter ab.<br />
Diesen Unterschied sollte man in der steuerpolitischen Debatte vor Augen haben, statt<br />
Deutschland per se als Hochsteuerland zu bezeichnen.<br />
Die Gewinnbesteuerung von Kapitalgesellschaften besteht in Deutschland aus der<br />
Körperschafts- und Gewerbesteuer und dem zusätzlichen Solidaritätszuschlag. Die<br />
Gesamtbelastung beträgt somit 38,65%, was einen der höchsten Werte der EU darstellt. Jedoch<br />
ist die Bemessungsgrundlage vergleichsweise schmal, was zu den geringen<br />
Effektivbelastungen führt.<br />
Die Forderungen der SPD<br />
Eine aufkommensneutrale Reform der Unternehmenssteuer sollte jedoch oberstes Ziel einer<br />
erneuten Reform der Unternehmensbesteuerung sein. Eine pauschale Entlastung der<br />
Unternehmen, wie sie mit der Reform aus dem Jahre 2001 geschehen ist, lehnte die Parteispitze<br />
ab und wurde dabei von einem eindeutigen Parteiratsbeschluss unterstützt. Eines der<br />
Hauptargumente gegen eine weitere Schmälerung der Steuerneinnahmebasis war, dass es<br />
keinen Automatismus zwischen niedrigere Steuern und der Schaffung neuer Arbeitsplätzen –<br />
das haben uns die letzten Jahre der Steuerreformen der neoliberalen Dekaden gezeigt.<br />
Die Umsetzung sieht aber leider anders aus. Die steuerlichen Belastungen werden auf unter<br />
30% verringert und es werden Steuerausfälle von fünf Milliarden Euro jährlich toleriert. So wird<br />
der Satz der Körperschaftsteuer von nun 25 auf 15 Prozent sinken. Daneben wird eine Senkung<br />
11 Tarifliche Belastung meint den zu zahlenden Steuersatz. Die reale Belastung (Steuerschuld /<br />
Umsatz) ist aber meist geringer, da die Bemessungsgrundlage auf der der Steuersatz angesetzt wird<br />
nicht der komplette Umsatz des Unternehmens ist.<br />
193
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
der Gewerbesteuermesszahl angestrengt. Diese Maßnahmen sollen die Anreize zur<br />
Gewinnverlagerung bei gleichzeitigem Verlustgeltungsmachen verringern.<br />
Deutlich höhere Steuerausfälle<br />
Teile der SPD-Fraktion, der DGB und andere Organisationen weisen jedoch darauf hin, dass die<br />
Ausfälle deutlich höher ausfallen und langfristiger sein könnten. Die im Gesetzentwurf<br />
angepeilten 5 Milliarden Euro Entlastungen für die Unternehmen treffen nur bei voller<br />
Jahreswirkung der Reform zu – also wenn alle Umsetzungen solche Wirkungen entfalten, wie<br />
sie vom Ministerium prognostiziert wird. Diese Prognosen sind zudem sehr unsicher – schnell<br />
wird die 5 Milliarden Hürde gerissen und die Steuerausfälle können deutlich höher ausfallen.<br />
Im Entwurf finden sich denn aber auch deutlich abweichende Größen, welche im<br />
Finanzministerium festgestellt wurden. Die durchschnittliche jährliche Steuererleichterung für<br />
Unternehmen liegt demnach bei 5,946 Milliarden Euro bis zum Jahre 2012. Rechnet man die<br />
durchschnittlich 843 Millionen Euro hinzu, die den Kommunen jährlich entgehen, ist man bei<br />
etwa insgesamt 6,8 Milliarden Euro entgangenen Steuereinnahmen. Die Kommunen werden<br />
für Verluste aus der Gewerbesteuer und den ihn zustehenden Einnahmen aus Steueranteilen,<br />
die im Zuge der Reform verringert werden, auf jeden Fall kompensiert werden.<br />
Was viele kritische Stimmen bereits angemahnt haben, wird in den Ausführungen des<br />
Entwurfs auch sehr deutlich – schnell kann aus den angenommenen 6,5 Milliarden ein viel<br />
größerer Verlust entstehen. Zwar bleibt man bei der Reform im bisherigen System der<br />
Besteuerung und ändert es nicht grundlegend, wie zum Beispiel bei der letzten großen<br />
Steuerreform unter Rot-Grün – aber dennoch gibt es einige erhebliche Störgrößen in der<br />
Rechnung.<br />
Das Wirtschaftswachstum, und damit das Wachstum der steuerlichen Bemessungsgrundlage,<br />
ist sehr positiv prognostiziert. Klar ist: einige wenige Zehntel Prozentpunkte weniger<br />
Wachstum führen zu starken Einnahmeausfällen.<br />
Hier fordern wir <strong>Jusos</strong> die klare Einhaltung des SPD-Parteiratsbeschlusses, der eine<br />
Aufkommensneutralität vorsieht. Langfristig müssen gerade Unternehmen wieder einen<br />
größeren Anteil am Gesamtsteueraufkommen aufbringen. Der Unternehmensanteil ist in den<br />
letzten Jahren zu Lasten des Anteils der Einkommensteuer sowie der indirekten Steuern am<br />
Gesamtaufkommen gesunken. Nur wenn das Gesamtsteueraufkommen angemessen steigt,<br />
kann der Staat seine gesamtgesellschaftlichen Aufgaben auch leisten – ein an die Substanz<br />
gehender internationaler Steuerwettbewerb ist nur kontraproduktiv. Das hier große<br />
194
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Einkommen und Vermögen sowie Unternehmensgewinne stärker herangezogen werden<br />
müssen steht für uns <strong>Jusos</strong> außer Frage.<br />
Fraglich bleibt auch, ob es gerade nach der fatalen rot-grünen Unternehmensteuerreform von<br />
2001 notwendig ist, Personengesellschaften zum Bespiel durch eine<br />
Thesaurierungsbegünstigung12 weiter zu entlasten. In der Realität treten durch die<br />
Veranlagung mit der Einkommenssteuer nur bei sehr großen Personenunternehmen<br />
steuerliche Belastungen jenseits der 38% auf – dann besteht zudem aber auch immer die<br />
Möglichkeit der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft (zum Beispiel einer GmbH). Diese<br />
weitere Entlastung ist schlicht aus politischer Motivation geschehen – eine ökonomische<br />
Notwendigkeit gibt es hingegen nicht. Gar von einer „Mittelstandslücke“ bei dieser Reform zu<br />
sprechen, offenbart schiere Kompetenzlosigkeit.<br />
Den „bereitwillig steuerzahlenden Gutunternehmer“ gibt es schlicht nicht<br />
Wichtiger sind aber die Prognosen, die der Entwurf über die Rückführung von<br />
Unternehmensgewinnen nach Deutschland macht – ob die Unternehmen ein solch hohes Maß<br />
und „Gutmenschentum“ mitbringen und ihre Gewinne zur Freude des Fiskus wieder hier<br />
versteuern, darf als fraglich bewertet werden. Auf jeden Fall ist es eine große Unbekannte.<br />
Die Unternehmensverbände haben bereits angekündigt, bei einigen Maßnahmen des<br />
Entwurfs, die zentral für die Gegenfinanzierung der Steuersatzsenkung sind, nachverhandeln<br />
zu wollen. Ihnen gehen die Entlastungen noch nicht weit genug.<br />
Besondere Kritik üben sie am neuartigen Instrument der Zinsschranke. Sie soll verhindern, dass<br />
Unternehmen Investitionen mittels Fremdkapital im Ausland tätigen und ihre Aufwendungen<br />
im Inland steuerlich mindert geltend machen, ohne dabei aber Erträge im Inland zu versteuern.<br />
Eine im Grunde längst überfällige Reglung, die dem Geschäftsgebaren vieler großer,<br />
international tätiger Kapitalunternehmen einen wirksamen Riegel vorschiebt.<br />
Dieses Instrument muss aber so ausgestaltet sein, dass es greifen kann. Liegt die Schranke zu<br />
hoch, ist sie wirkungslos und die Praktiken gehen ungehindert weiter. Hier wollen die<br />
Unternehmensverbände ansetzen – große Steuerausfälle wären gerade hier vorprogrammiert.<br />
Da der Entwurf auf Kante gezimmert wurde, ist aber auch nicht mehr viel Spielraum, die<br />
Ausfälle einzudämmen. Hier gilt es politischen Druck aufzubauen.<br />
Die deutsche Unternehmenssteuerreform aus Europäischer Perspektive<br />
12 Wenn Personengesellschaften Gewinne wieder im Unternehmen investieren sollen sie<br />
Steuererleichterungen erhalten.<br />
195
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mit der von Roland Koch und Peer Steinbrück ausgearbeiteten Unternehmensteuerreform, ist<br />
man angetreten, das „deutsche Steuersubstrat“ langfristig zu sichern und die nominelle<br />
Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften im Vergleich zu den europäischen NachbarInnen<br />
„wettbewerbsfähig“ zu gestalten.<br />
Das Steuersubstrat, damit ist die Bemessungsgrundlage der Unternehmensteuer gemeint, sei<br />
in Gefahr, da multinationale Unternehmen ihre Gewinne flexibel in andere Länder<br />
transferieren und im Inland steuerfrei bleiben. Verschärfend wirkt noch die Tatsache, dass<br />
Unternehmen ihre Fremdkapitalkosten, also die zu zahlenden Zinsen auf Kredite, im Inland als<br />
Aufwand in der Steuerbilanz abziehen konnten, auch wenn die Investition gar nicht im Inland<br />
stattfand.<br />
Auch befände man sich mit den anderen Mitgliedsstaaten, vornehmlich mit den mittel- und<br />
osteuropäischen (MOE) Staaten in einem Steuerwettbewerb, durch den man gezwungen sei,<br />
die Sätze der Unternehmensbesteuerung zu senken. Dieses Mantra hört man Land auf Land ab<br />
durch alle Polit – Talkshows zu genüge.<br />
Dass beide Ziele mit der jetzigen Reform verfehlt werden könnten und die Reform den<br />
Steuerwettbewerb – das sprichwörtliche „race to the bottom“ – verschärfen könnte, wird dabei<br />
aber nicht mitbedacht.<br />
Steuerwettbewerb geht nicht von neuen Mitgliedsstaaten aus<br />
Als die MOE Staaten der EU beitraten und ihre Unternehmenssteuern knapp unter 20%<br />
festsetzten, taten sie das in erster Linie, um Unternehmen die Ansiedlung schmackhaft zu<br />
machen. Verständlich, denn mit besonders moderner Infrastruktur konnten sie in der Regel gar<br />
nicht und mit hoch qualifizierten Arbeitskräften nur selten werben.<br />
Ein absolut normaler Vorgang in der Erweiterungsgeschichte der EU. So hat Irland in den<br />
1980ern seine Sätze der Unternehmensbesteuerung nach dem EU-Beitritt massiv gesenkt und<br />
die Mindereinahmen durch Mittel der Strukturfonds der EG ausgleichen können. Diese Mittel<br />
wurden dann intensiv in erster Linie für Investitionen im Bildungssystem und in die<br />
Infrastruktur des Landes eingesetzt. Das Ergebnis war ein stabiler Konvergenzprozess Irlands<br />
hin zu den entwickeltsten Ländern der EU. Zwar sind die Sätze der Unternehmenssteuern in<br />
Irland im Vergleich noch niedriger als im Durchschnitt der EU 15 – aber die reale Belastung der<br />
Unternehmen hat durch Erweiterungen der Bemessungsgrundlage zugenommen. Das zeigt<br />
klar, dass gute Infrastruktur auch über Steuern bezahlt werden muss.<br />
196
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Investitionsentscheidung eines Unternehmens orientiert sich bekanntlich nicht allein in der<br />
realen Steuerbelastung, schon gar nicht einzig an der Höhe der nominalen Sätze. Vielmehr sind<br />
harte Standortfaktoren wie der Zustand der Infrastruktur (Verkehrsnetze, Bildung, Verwaltung<br />
etc.) und die Qualifikation der MitarbeiterInnen, die ausschlaggebenden<br />
Entscheidungskriterien. Deshalb ist der Standort Deutschland absolut wettbewerbsfähig, was<br />
man nicht zuletzt auch an der hohen Exportquote ablesen kann. Unverständlich, geradezu<br />
heuchlerisch kommen die Lobbygruppen daher, die die Mär von der zu großen Belastung des<br />
Unternehmenssektors abspulen und im selben Atemzug den Exportweltmeister BRD huldigen.<br />
Wettbewerb wird und darf eben nicht bloß um die Kosten veranstaltet werden – vielmehr<br />
brauchen wir einen Wettbewerb um die Qualität des Standortes.<br />
Die Gefahr besteht darin, dass die neuen Mitgliedsländer den Pfad den Irland seinerzeit<br />
eingeschlagen hatte, nicht mehr nehmen können. Das liegt daran, dass die EU für die zwölf<br />
neuen Beitrittsländer der letzten Erweiterungsrunden etwa dieselbe Mittelhöhe bereitgestellt<br />
hat, als noch zum Beitritt von Portugal und Spanien. De facto haben die MOE Staaten jeweils<br />
nicht genug finanzielle Mittel, um sie in zukunftsorientierte Projekte zu investieren.<br />
In dieser Situation senken nun die hoch entwickelten Länder „Kerneuropas“ ihre nominalen<br />
Steuersätze. Beziehungsweise viel wichtiger, sie senken die absolute Belastung der<br />
Unternehmen. Die logische Konsequenz dieser Politik ist, dass die neuen Mitgliedsstaaten<br />
ihrerseits die Belastungen für Unternehmen weiter senken werden. Sie konnten die Zeit seit<br />
1.1.2005 bzw. 1.1.2007 ja noch nicht nutzen, um in Infrastruktur zu investieren, um so für<br />
Unternehmen attraktiv zu werden. Nicht die neuen Beitrittsländer sind also Motor des<br />
Steuerwettbewerbes, sondern die wirtschaftlich starken Länder der EU sind es!<br />
Die deutsche Haltung hat aber auch zusätzlich Auswirkungen auf die EU 15. So hat Frankreich<br />
unter seinem mittlerweile neuen Präsidenten Nicolas Sarkozy bereits wenige Wochen nach<br />
dem bekannt werden der deutschen Reformpläne angekündigt, seinerseits die Belastungen der<br />
heimischen Unternehmen zu senken. Ein wenig erinnert das an den Preiskampf der<br />
Telefonanbieter – man müsse immer zehn Euro billiger als der Brachenführer sein, so die<br />
Aussagen der KonkurrentInnen der Firma mit dem großen magenta „T“. Diese, von<br />
betriebswirtschaftlichem Kalkül durchsetzte Mentalität, hat sich längst in der steuerpolitischen<br />
Diskussion breit gemacht.<br />
Die Debatte um den Standortwettbewerb geschieht zum großen Teil auch ohne Not. Zwar gibt<br />
es einige prominente Beispiele, in denen Werke in Deutschland geschlossen wurden und in den<br />
MOE Staaten wieder aufgebaut wurden. Dies geschieht aber laut Untersuchungen13 aber viel<br />
13 Vgl. Böckler Impuls 5/2007<br />
197
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
weniger häufig, als in den Medien dargestellt. Sicher wird diese Androhung aber auch immer<br />
gerne von den Unternehmen selbst angeführt, um zum Beispiel Löhne oder<br />
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu drücken. Eine Berichterstattung über Unternehmen,<br />
die sich bewusst hier ansiedeln bzw. wieder zurückgekehrt sind sucht man, trotz anderer<br />
Realität, vergeblich.<br />
Konvergenzprozesse sozial und gerecht gestalten<br />
Vielmehr müsste den „jungen“ EU-Staaten die Möglichkeiten gegeben werden, in ihre<br />
Infrastruktur zu investieren. Dies bedeutet, dass das Budget der EU in der Regionalförderung<br />
bzw. insgesamt größer werden muss.<br />
Schon heute machen die Einnahmen der Besteuerung von Kapitalgesellschaften nur etwa 14%<br />
des Gesamtsteueraufkommens in Deutschland aus – bei gleichzeitigem ständig ansteigenden<br />
Anteil von indirekten Verbrauchssteuern, die sozial degressiv wirken, da der Anteil an<br />
gezahlten Steuern bei kleinere Einkommen größer wird. Bei einer sozialdemokratischen<br />
Steuerreform wäre die Frage angebracht, ob der Anteil, den die Unternehmen am<br />
Steueraufkommen leisten, wirklich groß genug ist, um ihn weiter zu senken. Gerade in<br />
Anbetracht dessen, dass der Steueranteil aus Einkommen aus unselbstständiger Arbeit stetig<br />
gewachsen ist und somit eine direkte Diskriminierung von Lohneinkommen und damit<br />
Lohnarbeit als gesellschaftlicher Wertschöpfung stattfindet. Wenn zentrale Anliegen von<br />
sozialdemokratischer Politik, zum Beispiel der Kinderbetreuung und Ausbau der<br />
Ganztagsschulen, unter einem allgemeinen Finanzierungsvorbehalt gestellt werden, ist es<br />
nicht an der Zeit, über Steuererleichterungen für SpitzenverdienerInnen und Großkonzerne<br />
nachzudenken.<br />
Ein wichtiger Schritt im Sinne einer Harmonisierung der europäischen<br />
Unternehmensbeteuerung ist eine vereinheitlichte Steuerbasis bei gleichzeitigem Festlegen<br />
von Mindeststeuersätzen. Alleine nur die Vereinheitlichung der Steuerbasis, wie sie die<br />
Europäische Kommission ins Auge fast, würde zu einem noch stärkeren Druck und eine<br />
Verschärfung des Wettbewerbes um die niedrigsten Steuersätze führen.<br />
Die Mindestsätze oder Korridore müssen dabei nicht das Minimum der derzeit zu zahlenden<br />
Steuersätze sein. Im Gegenteil – sicherlich ließe sich mit moderat höheren Sätzen mehr Anreize<br />
für die MOE Staaten schaffen, noch mehr in ihre Infrastruktur zu investieren. Dies muss aber<br />
von der europäischen Staatengemeinschaft unterstützt werden, was bislang noch in einem zu<br />
geringen Umfang der Fall ist. In einer so optimal ausgestalten Situation, profitieren von diesen<br />
Regelungen dann alle Beteiligten: Konvergenz hin zu mehr Wohlstand in der gesamten EU.<br />
198
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Deutscher Reformbeitrag wenig zielführend<br />
Dazu trägt die deutsche Unternehmenssteuerreform aber nichts bei. Im Gegenteil -<br />
Deutschland erhöht den Druck auf die neuen Mitgliedsstaaten, ihrerseits die Steuersätze<br />
weiter zu senken. Wenn es ein Ziel der Reform war, die Steuersätze in ein europäisches<br />
Mittelfeld zu bringen, stellt sich die Frage, wie lange sie Mittelfeld bleiben werden, wenn die<br />
nächste Runde der Unternehmensteuersenkungen in den MOE Staaten eingeleitet wird. Und<br />
was dann? Dann bedienen sich FinanzministerInnen - egal welcher Couleur - wieder derselben<br />
Argumenten wie in der jetzigen Diskussion und senken die Steuern abermals.<br />
Wo diese Spirale aufhört vermag man jetzt nicht zu sagen. Fakt ist jedoch, dass dabei<br />
mittelfristig nur die Großunternehmen gewinnen werden. Langfristig aber gibt es jedoch nur<br />
VerliererInnen.<br />
Fehlen den Staaten wichtige Mittel zu Investitionen in die Zukunft z.B. in Bildung, Forschung,<br />
Infrastruktur, Subventionierung von Unternehmen zur Stützung neuer Entwicklungen etc.<br />
steht die viel gepriesene Wettbewerbsfähigkeit Europas, auf die die InitiatorInnen der Reform<br />
hinzielen, auf dem Spiel. Denn Unternehmen investieren nicht in Schulen und Universitäten<br />
und in Schienen- und Straßennetze und viele andere Infrastrukturprojekte, die über ihr<br />
Werksgelände hinausgehen. Die geringere Attraktivität Europas, die daraus folgt, führt zu<br />
geringeren Investitionen, einhergehend mit weniger Arbeitsplätzen und einem geringeren<br />
Wohlstand, womit zum einen ein engerer Verteilungsspielraum und mehr soziale Ungleichheit<br />
verbunden sind.<br />
Ziel einer europäischen Unternehmensbesteuerung<br />
Wir <strong>Jusos</strong> müssen gemeinsam mit unseren PartnerInnen die Diskussionen um eine europäische<br />
Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung dazu nutzen, um die Körperschaftsteuer zu<br />
einer „EU-Steuer“ zu machen. Würden die Einnahmen der Körperschaftsteuer, oder<br />
Steueranteile daraus, dem EU-Budget zufließen, über welches das Parlament die<br />
Erhebungshoheit hat, wären viele Probleme aus sozialdemokratischer Sicht gelöst oder<br />
zumindest eher zu lösen. Der Steuerwettbewerb um die niedrigsten Sätze der<br />
Unternehmensbesteuerung unter den EU-Staaten wäre beendet. Die EU verfügte über ein<br />
eigenes Budget. Da die EU stets betont, dass das eine Prozent des gesamten EU-BIP, welches sie<br />
als Haushalt zur Verfügung hat, bei weitem nicht ausreicht, um die notwendige Strukturpolitik<br />
zu machen, müsste sie entsprechend auch die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer<br />
hochhalten. Eine Minimalsteuer, wäre somit ausgeschlossen.<br />
199
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Auch wenn man den Staaten eine eigene Besteuerung von Körperschaften, zusätzlich zur EU-<br />
Steuer bewilligen würde, wäre der Steuerwettbewerb hin zum Bodensatz wirksam<br />
unterbunden. Unternehmen würden europaweit wieder mehr zur gerechten Finanzierung der<br />
notwendigen Staatstätigkeit herangezogen werden.<br />
Keine Flat Tax für Kapitaleinkommen!<br />
Im Fahrwasser der Unternehmenssteuerreform der Großen Koalition ist eine<br />
Quellabgeltungsteuer auf Kapitalerträge beschlossen worden. So soll ab dem 01.01.2009 eine<br />
Abgeltungssteuer in Höhe von pauschal 25 Prozent auf alle Kapitaleinkünfte ohne<br />
Spekulationsfrist und auf private Veräußerungsgeschäfte eingeführt werden. Bislang werden<br />
Kapitaleinkünfte mit der individuellen Einkommenssteuer versteuert und sind somit auch der<br />
progressiv-umverteilenden Besteuerung unterworfen. Voraussetzung ist, dass diese<br />
Kapitalerträge auch in der Steuererklärung angegeben werden – bleibt das aus, entzieht sich<br />
der/die Steuerpflichtige der Kapitalbesteuerung auf illegaler Weise. Eine Kontrolle seitens der<br />
Finanzämter ist nur unvollständig möglich, da es keine Pflichtmitteilungen/<br />
Kontrollmitteilungen über Kapitalerträge - wie zum Beispiel beim Bezug von Einkommen aus<br />
unselbstständiger Arbeit selbstverständlich - gibt.<br />
Nach der Reform sollen die Finanzinstitute automatisch bei Kapitaleinkünften wie Zinsen die<br />
fällige Steuer an die Ämter überweisen – bei Dividenden sind es die Aktiengesellschaften<br />
selbst. Die Steuerschuld ist bei einer Abgeltungsteuer dann aber auch abgegolten – daher rührt<br />
der Name.<br />
Für BezieherInnen kleiner Kapitaleinkünfte bleibt zwar die Möglichkeit der nachträglichen<br />
Veranlagung, wenn ihr individueller Steuersatz unter 25 Prozent liegt. Auch ist weiterhin die<br />
Erteilung von Freistellungsaufträgen bis zum Sparerfreibetrag möglich. Dieser wurde aber<br />
bereits in den letzten Jahren wiederholt und zum letzten Mal zum 01.01.2007 stark gekürzt.<br />
Quellabgeltungsteuer rückgängig machen!<br />
Durch eine pauschale Abgeltungssteuer gibt man die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit<br />
auf, was eine unserer Grundpositionen der Besteuerung darstellt. Einkünfte aus Arbeit werden<br />
somit gegenüber Kapitaleinkünften weiter diskriminiert.<br />
Wahlziel der SPD bei den Bundestagswahlen 2009 muss sein, die Quellabgeltungsteuer<br />
rückgängig zu machen und stattdessen auf automatisierte Kontrollmitteilungen zu setzen.<br />
200
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Von Seiten der Politik, zu allererst von UnionspolitikerInnen, wurde erfolgreich versucht, ein<br />
Junktim zwischen der Unternehmensteuerreform (2008) und der Einführung der<br />
Quellabgeltungsteuer (ab 2009) zu spannen. Das dürfen wir auf keinen Fall so hinnehmen, das<br />
eine Reformfeld ist nämlich gar nicht zwangsläufig mit dem Gelingen des anderes verknüpft.<br />
Es gilt politischen Druck aufzubauen, hier nachzubessern.<br />
Keine einheitliche Quellsteuer<br />
Ein einheitlicher Steuersatz auf Kapitalerträge von 25% entspricht nicht unseren<br />
Gerechtigkeitsvorstellungen. Der Grundsatz „Starke Schultern tragen mehr“ beziehungsweise<br />
„Vermögende tragen mehr“ zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben bei, muss auch hier<br />
weiterhin gelten.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> erteilen denjenigen eine Absage, die davon reden, eine Quellabgeltungsteuer sei<br />
einfacher und mit weniger Bürokratie bei der Erhebung verbunden.<br />
Das Argument einer Vereinfachung durch die Abgeltungsteuer kann nicht überzeugen, da die<br />
Pläne einen Fortbestand von Sparerfreibetrag und Freistellungsaufträgen sowie ein<br />
Veranlagungswahlrecht und sogar eine Kirchensteuerpflicht trotz angeblicher Anonymität<br />
vorsehen.<br />
Bei Anonymität wird die Anwendung des heute zumindest teilweise umgesetzten<br />
Wohnsitzprinzips bei der Verteilung der direkten Steuern weiter erschwert, die horizontale<br />
Verteilung des Steueraufkommens ist daher verzerrt. Zu befürchten ist eine Verschiebung des<br />
Steueraufkommens zu Ungunsten von Ländern mit geringer Bankendichte oder nur wenigen<br />
ansässigen Kapitalunternehmen.<br />
Es existieren stattdessen bereits praktikable Alternativen zur Quellbesteuerung bei<br />
Beibehaltung des progressiven Leistungsprinzips.<br />
Die automatisierte Übermittlung der Höhe der Kapitalerträge an den Fiskus, die auch schon<br />
diskutiert wurde, aber schnell wieder vom Tisch war, weil KapitaleignerInnen ihre Pfründe zu<br />
sichern wusste, stellt hier eine praktikable und wirksame Möglichkeit dar. Die personelle<br />
Zuordnung erfolgt dabei über die einmalig zugeteilte Steuernummer. Die Banken und<br />
Kreditinstitute hätten damit den gleichen Aufwand wie bei einer Abgeltungssteuer.<br />
Steuerhinterziehung wird genauso verhindert wie beim aktuellen Vorschlag.<br />
Kontrollmitteilungen statt Ungerechtigkeit in der Besteuerung<br />
201
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Warum soll das Finanzamt mittels Kontrollmitteilungen nicht genau wie bei Einkünften aus<br />
unselbständiger Arbeit auch darüber Informationen erhalten, wie viel Kapitalerträge jemand<br />
erhält? Die Antwort: Es gibt keinen Grund.<br />
Man kann verstehen, dass mit der Quellabgeltungsteuer Steuerhinterziehung verhindert<br />
werden soll – nur würde beim derzeitigen Vorschlag noch weniger in Kassen des Fiskus fließen<br />
als in der heutigen Situation. Unter diesen Vorraussetzungen das System der synthetischen14<br />
Einkommensteuer aufzugeben ist blanker Aktionismus, der in die Hände wohlhabender<br />
BürgerInnen spielt, die dann noch weniger zum Gesamtsteueraufkommen beitragen würden.<br />
Außerdem bedeutet es eine weitere Diskriminierung von Einkommen aus unselbstständiger<br />
Arbeit gegenüber Kapitaleinkünften – die Information über die Höhe des Arbeitslohns wird<br />
schon immer ohne an irgendwelche Datenschutzerwägung bloß einen Gedanken zu<br />
verschwenden an die Finanzbehörden weitergegeben.<br />
Den SparerInnenfreibetrag Anfang des Jahres nahezu auf 750€ zu halbieren hat nicht etwa<br />
dazu geführt, dass große KapitaleignerInnen stärker zur Kasse gebeten würden – ganz im<br />
Gegenteil. Diese Maßnahme hat dazu geführt, dass gerade Personen mit einem kleinen und<br />
mittleren Einkommen und wenigen Rücklagen nun jährlich zur Kasse gebeten werden. Ein<br />
weiterer Schritt in diese falsche Richtung wäre die Einführung eines einheitlichen Steuersatzes<br />
auf Kapitalerträge.<br />
Die Profiteuere der Reform<br />
Persönlich profitieren von der Abgeltungsteuer hauptsächlich BezieherInnen sehr hoher<br />
Einkommen, bei denen bisher Kapitalerträge mit dem Einkommensteuerspitzensatz von<br />
47,4815 v.H. belastet werden. Je niedriger das Einkommen ist, desto geringer fällt auch die<br />
Entlastung aus. Liegt die Einkommensteuergrenzbelastung unter 25 v.H. kommt es zu keiner<br />
Verbesserung gegenüber dem Status quo.<br />
Sachlich ist die Steuerentlastung bei denjenigen Kapitalerträgen am höchsten, die bislang nicht<br />
vom Halbeinkünfteverfahren profitieren. Die Auswirkungen der Abgeltungsteuer<br />
unterscheiden sich also je nach persönlicher Einkommenssituation und Struktur des<br />
Anlagevermögens.<br />
Besonders kritisch anzumerken ist, dass die Abgeltungssteuer die Auffassung von<br />
Steuergerechtigkeit in der Bevölkerung verletzt. Es gibt keinen Grund, warum jemand der sein<br />
14 Diese Form der Einkommensbesteuerung macht keinen Unterschied zwischen verschieden<br />
Einkunftsarten. Das zu versteuernde Einkommen wird als Summe aller Einkünfte gebildet und dann<br />
einem progressiven Steuersatz unterworfen.<br />
15 Spitzensteuersatz 42%, 3 % „Reichensteuer“ und Solidaritätszuschlag<br />
202
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Einkommen mit einer vierzigstündigen Arbeitswoche bestreitet, mehr Steuern zahlen sollte, als<br />
jemand, der für sein Zinseinkommen in gleicher Höhe keinen Finger zu rühren braucht.<br />
Wir wollen Steuergerechtigkeit.<br />
Dazu gehört für uns der Grundsatz, dass starke Schultern mehr tragen als schwache, und das<br />
nicht nur absolut, wie im Falle einer einheitlichen Quellabgeltungssteuer, sondern auch relativ<br />
durch mit dem Einkommen steigende Steuersätze.<br />
• Progressivität war bisher das Merkmal der Einkommensbesteuerung und soll es auch<br />
für alle Einkunftsarten bleiben. Kapitalerträge dürfen hier keine Sonderrolle<br />
einnehmen.<br />
• Zu Steuergerechtigkeit gehört auch, dass diejenigen, die Steuern zu zahlen haben, dies<br />
auch tun. Wir fordern die Einführung eines ähnlichen Systems wie bei den Einkommen<br />
durch Erwerbsarbeit auch bei Einkommen aus Vermögen. Verbindliche, automatisierte<br />
Mitteilungen der Kreditinstitute an die Finanzämter sind technisch machbar und<br />
müssen umgehend eingeführt werden.<br />
Eine Senkung der Steuersätze auf Kapitaleinkommen in Deutschland führt keineswegs dazu,<br />
dass im Ausland liegende Vermögen hier versteuert werden. Die AnlegerInnen größerer<br />
Vermögen werden ihr ins Ausland transferiertes Geld nicht wieder zurückverlagern. Ein<br />
Transfer nach Deutschland würde zudem einer Erklärung der Steuerhinterziehung in den<br />
vergangenen Jahren gleichkommen.<br />
Einen Zugriff auf ausländische Konten von hier Steuerpflichtigen hat die Quellabgeltungsteuer<br />
freilich nicht – an der Quelle setzt sie nur an, wenn die dem deutschen Fiskus bekannt ist.<br />
Des Weiteren ist auf die möglichen Auswirkungen auf die Einkommenskonzentration<br />
hinzuweisen. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die deutsche<br />
Einkommensverteilung, trotz des angestrebten Einkommensausgleiches über das Steuer- und<br />
Sozialsystem, stark konzentriert ist und dieses Phänomen nicht zuletzt auf sehr hohe<br />
Kapitaleinkommen zurückzuführen ist. Eine Steuersenkung für die Kapitaleinkommen hätte<br />
daher beträchtliche negative Verteilungswirkungen, mit denen die ohnehin durch<br />
Marktprozesse bedingte Zunahme der Einkommensungleichheit weiter rasant verschärft<br />
würde.<br />
Wechselwirkungen mit der Unternehmsteuerreform<br />
203
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Abgeltungsteuer ist privaten Kapitalerträgen vorbehalten. Werden Erträge aus<br />
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers oder<br />
durch einen „natürlichen“ Mitunternehmer vereinnahmt, kommt es zu einem modifizierten<br />
Teileinkünfteverfahren. Danach sind Dividenden, GmbH-Gewinnanteile und entsprechende<br />
Veräußerungsgewinne zu 60 v.H. in den steuerpflichtigen Gewinn einzubeziehen. Für sonstige<br />
betriebliche Kapitalerträge ergeben sich keine Änderungen.<br />
Unternehmen werden Gewinne also nicht thesaurieren, sondern ausschütten, wenn deren<br />
Wiederanlage in Unternehmen steuerlich diskriminiert ist. Nach der Ausschüttung wird dieses<br />
Geld an die Unternehmen in Form von Darlehen zurückfließen, da Zinsen nur der<br />
Abgeltungssteuer von 25 v.H. zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer unterliegen.<br />
Mit Inkrafttreten der Regelung ist mit erheblichen Verlagerungen von Eigenkapitalfinanzierung<br />
zu Fremdkapitalfinanzierung zu rechnen. Ökonomisch ist dies gerade kontraproduktiv, da die<br />
Engpässe der Unternehmensfinanzierung in Deutschland bei der Eigenkapitalausstattung<br />
liegen.<br />
Diese Regelung steht somit im Widerspruch mit einer weiteren Zielsetzung des<br />
Gesetzentwurfs der Unternehmenssteuerreform, wonach die Fremdfinanzierung von<br />
Unternehmen durch die Einführung einer Zinsschranke eingeschränkt werden soll.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> lehnen Steuererleichterungen nicht per se ab. Doch zum einen müssen<br />
Steuererleichterungen gerade in Anbetracht der zunehmenden Armut und ungleichen<br />
Reichtums- und Einkommensvereilung verteilungspolitisch so wirken, dass diese<br />
Ungleichheiten abgebaut statt vergrößert werden. Zum anderen muss die staatliche<br />
Handlungsfreiheit und insbesondere die des Sozialstaats durch ein entsprechendes<br />
Steueraufkommen gesichert werden. Nettoentlastungen wirken hier kontraproduktiv und<br />
tragen nicht zu einer gesamtgesellschaftlich positiven Wohlstandsentwicklung, sondern nur<br />
zur Akkumulation von Kapital und Vermögen bei einigen wenigen bei.<br />
204
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
R<br />
Resolutionen<br />
R 1 - LV NRW<br />
Moderne sozialdemokratische<br />
Wirtschaftspolitik – der Weg zur Guten<br />
Arbeit<br />
Einleitung<br />
Nach einer lange andauernden wirtschaftlichen Stagnation hat Deutschland in den<br />
vergangenen Jahren eine Phase mit stärkeren Wachstumsraten und einem Rückgang der<br />
Arbeitslosenquote erlebt. Bundesregierung, ArbeitgeberInnen und ein Teil der ÖkonomInnen<br />
bejubeln die Strukturreformen der Agenda 2010 als ursächlich für den neuerlichen Erfolg der<br />
deutschen Volkswirtschaft. Einige Beobachter, wie der Bundesaußenminister Frank-Walter<br />
Steinmeier oder Thomas Straubhaar vom Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Institut, sprechen<br />
sogar von einem neuen deutschen Wirtschaftswunder. Bundeskanzlerin Merkel behauptet:<br />
„Der Aufschwung kommt bei den Menschen an“ und fordert zur Fortsetzung der so genannten<br />
Strukturreformen auf.<br />
Eine nüchterne Betrachtung der materiellen Situation und der allgemeinen Stimmung in der<br />
Bevölkerung lässt jedoch die von interessierter Seite verbreitete Begeisterung an der<br />
gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland in einem anderen Licht erscheinen. Wie eine<br />
aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, ist die Mittelschicht in<br />
Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft. Die politisch umkämpfte „Mitte<br />
der Gesellschaft“ erodiert, während sich in der neuen Unterschicht und in der Klasse der<br />
Superreichen Parallelgesellschaften entwickeln. Diese Tendenz wurde durch die verbesserte<br />
Wachstumsentwicklung der letzten Jahre nicht gebremst: Zum ersten Mal in der deutschen<br />
Nachkriegsgeschichte sind die Reallöhne sogar während einer Aufschwungphase gesunken.<br />
Nach nur etwas mehr als zwei Jahren des Aufschwungs ist dieser nun unter anderem durch die<br />
internationale Finanzmarktkrise bedroht. Dies gilt umso mehr, als Deutschland durch seine<br />
205
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
extreme Exportorientierung in besonderem Maße von der ausländischen Nachfrage abhängig<br />
ist. Die inländische Konsumnachfrage hingegen hat – im Gegensatz zu früheren<br />
Aufschwungphasen – in den letzten Jahren kaum einen Beitrag zum Wachstum geleistet. Dies<br />
kann angesichts der schwachen Entwicklung der realen Masseneinkommen sowie der<br />
Verunsicherung der Menschen durch die effektive Kürzung von wichtigen Sozialleistungen wie<br />
Arbeitslosenunterstützung und Rente kaum überraschen.<br />
Die <strong>Jusos</strong> wollen die aktuelle Diskussion um den Aufschwung zum Anlass nehmen, die<br />
längerfristigen Tendenzen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland genauer zu<br />
analysieren und den Handlungsbedarf sozialdemokratischer Politik aufzuzeigen. In der<br />
wirtschaftspolitischen Debatte bei den <strong>Jusos</strong> und in der SPD herrscht derzeit eine Art Vakuum:<br />
Zwar wächst angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Realitäten vielerorts der Zweifel an<br />
der Agenda-Politik. Andererseits liegt kein konsistentes Alternativprogramm vor, das die<br />
Sozialdemokraten vereinen würde. Zu dieser notwendigen Debatte möchten die <strong>Jusos</strong> mit<br />
dieser Positionierung einen Beitrag leisten. Die <strong>Jusos</strong> sind der Auffassung, dass das im<br />
Hamburger Programm formulierte Ziel der „Guten Arbeit“ nicht allein durch<br />
arbeitsmarktpolitische Reformen im engeren Sinne zu erreichen ist. Vielmehr bedarf es eines<br />
konsistenten wirtschaftspolitischen Gesamtkonzeptes, in dem eine pragmatische<br />
Makrosteuerung eine gewichtige Rolle einnimmt. Im Vergleich zum Ausland ist die Bedeutung<br />
von makroökonomischer Politik in der deutschen Wissenschaft und Politik bisher in<br />
erschreckender Weise unterbeleuchtet.<br />
Tradition sozialdemokratischer Wirtschaftstheorie<br />
Nach neoliberaler Ansicht war die Entlastung der Unternehmen in Deutschland von angeblich<br />
zu hohen Lohnkosten und Steuerabgaben Voraussetzung für den Aufschwung der letzten<br />
Jahre. Um Deutschland dauerhaft zu einer kräftigeren Investitionsdynamik und stärkerem<br />
Wirtschaftswachstum bei geringerer Arbeitslosigkeit zu verhelfen, sei eine weitere Verfolgung<br />
dieses Wegs der Angebotspolitik alternativlos.<br />
Die ausschließliche Fokussierung auf so genannte „Strukturreformen“ widerspricht jedoch den<br />
traditionellen Aussagen sozialdemokratisch ausgerichteter Wirtschaftstheorie. Diese empfiehlt<br />
nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch auf der Grundlage von<br />
makroökonomischen Effizienzüberlegungen eine Lohnpolitik, die den Verteilungsspielraum aus<br />
Produktivitätswachstum und Inflation mittelfristig ausschöpft und zudem über das<br />
Steuersystem gerade die einkommensschwachen Haushalte fördert. Der Grund ist, dass Löhne<br />
aus Sicht der Unternehmen nicht nur Kosten darstellen, sondern gleichzeitig die wichtigste<br />
Grundlage für die private Konsumnachfrage sind. Überdies konsumieren<br />
206
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
einkommensschwache Haushalte einen vielfach größeren Anteil ihres Einkommens als reiche<br />
Haushalte (die Sparquote des ärmsten Zehntels der Deutschen ist negativ, diejenige des<br />
reichsten Zehntels lag 2003 bei über 20%).<br />
Zwar sind für die Unternehmen zweifellos auch Kostengesichtspunkte von Bedeutung. Eine<br />
kräftige Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten (Investitionen) lohnt sich für sie jedoch nur<br />
dann, wenn sie sich einer entsprechend kräftigen Güternachfrage gegenüber sehen. Diese wird<br />
in einem großen Land wie Deutschland vor allem im Inland durch die Binnennachfrage erzeugt:<br />
Allein auf den privaten Konsum entfallen fast 60 % des Bruttoinlandsprodukts.<br />
Weiterer Bestandteil einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik sind neben der<br />
Unterstützung einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik und einem progressiven<br />
Steuersystem der pragmatische Einsatz von makroökonomischer Stabilisierungspolitik (Geldund<br />
Fiskalpolitik). Nur wenn Unternehmen mit einer permanent dynamischen<br />
Nachfrageentwicklung konfrontiert sind, werden sie im Kampf um Marktanteile entsprechend<br />
kräftig investieren, woraus sich wiederum im Zuge des kräftigeren Produktivitätswachstums<br />
positive Angebotseffekte ergeben.<br />
Diese grundlegenden Pfeiler sozialdemokratischer Wirtschaftstheorie sind in der jüngeren<br />
Vergangenheit zu Lasten einer einseitigen Politik der Kostenentlastung für die Unternehmen<br />
vernachlässigt worden.<br />
Erfolge der rot-grünen Wirtschaftspolitik und die Debatte um den<br />
jüngsten Aufschwung<br />
Die angebotsorientierten Reformen der rot-grünen Bundesregierung haben einige wichtige<br />
Verbesserungen erzielt, zum Beispiel durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und<br />
Sozialhilfe. Hierdurch ist die Arbeitsvermittlung effizienter geworden. Jedoch ist es abwegig,<br />
die Strukturreformen als ursächlich für den jüngsten Aufschwung auszumachen. Vielmehr ist<br />
das Auf und Ab von konjunkturellen Boom- und Schwächephasen seit Jahrhunderten Teil des<br />
marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystems. Auch war das Wachstum im jüngsten Aufschwung<br />
in historischer Betrachtung keinesfalls besonders hoch.<br />
Interessanterweise war der Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts während des jüngsten<br />
Aufschwungs (Ende 2004 bis Ende 2007, also nach den „Strukturreformen“) hinsichtlich Verlauf<br />
und Stärke dem vorherigen Aufschwung (Anfang 1998 bis Anfang 2001, also vor den<br />
„Strukturreformen“) sehr ähnlich. Es bietet sich also ein Vergleich dieser beiden<br />
207
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wachstumsperioden an, wie er jüngst vom Institut für Makroökonomie und<br />
Konjunkturforschung systematisch durchgeführt wurde.<br />
Besonders auffällig ist, dass der jüngste Aufschwung in hohem Maße unbalanciert war. Der<br />
reale private Konsum nahm kaum zu, dafür war der Export der wesentliche Wachstumsmotor.<br />
Im vorangegangen Aufschwung waren die Wachstumsbeiträge der verschiedenen<br />
Nachfragekomponenten noch deutlich ausgeglichener gewesen. Erklärt wird die aktuelle<br />
Spaltung zwischen Exportwachstum und binnenwirtschaftlichem Wachstum unter anderem<br />
durch die seit langem schwache bzw. sogar rückläufige Entwicklung der realen Nettolöhne und<br />
-gehälter. Dieser fördert die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte, aber er schwächt die<br />
Konsumnachfrage. Letztere wird zudem durch die zunehmend verbreitete Angst vor<br />
Altersarmut im Zuge der Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung negativ<br />
beeinträchtigt. Als Ergebnis von Umverteilung und Verunsicherung steigt die durchschnittliche<br />
Sparquote in Deutschland in den letzten Jahren gegen den internationalen Trend in den<br />
reichen Industrieländern wieder an.<br />
Zwar ist die Arbeitslosenquote zuletzt tatsächlich deutlich zurückgegangen. Anders als das<br />
Volumen der gearbeiteten Stunden ist jedoch die Zahl der Beschäftigten in diesem<br />
Aufschwung sogar schwächer gestiegen als im letzten. Zudem hat sich auf Grund der<br />
demographischen Entwicklung das Arbeitsangebot verringert, was für sich genommen zu<br />
einem Rückgang der Arbeitslosenquote führt. Ein immer größerer Teil der ArbeitnehmerInnen<br />
befindet sich zudem in prekären Beschäftigungsverhältnissen, z.B. Leih- und Zeitarbeit.<br />
Bundesregierung und ein Teil der Ökonomen hatten prognostiziert, der Aufschwung werde<br />
nach einiger Zeit von der Exportwirtschaft auf den privaten Konsum übergreifen, wenn der<br />
Rückgang der Arbeitslosigkeit die Gesamtkaufkraft der ArbeitnehmerInnen trotz schwacher<br />
Reallohnentwicklung stärkt und bei den Menschen Optimismus und Konsumlaune verbreiten<br />
wird. Hiervon kann jedoch aus den genannten Gründen bislang keine Rede sein. Auch ohne die<br />
aktuelle internationale Finanzmarktkrise wäre es also überaus fraglich gewesen, ob der jüngste<br />
Aufschwung in eine sich selbst tragende binnenwirtschaftliche Expansion mit dynamischer<br />
Konsumnachfrage gemündet hätte. Insgesamt ist nicht zu erkennen, dass die Deregulierung<br />
des Arbeitsmarktes und die Steuersenkungspolitik der letzten Jahre die gesamtwirtschaftliche<br />
Entwicklung entscheidend befördert hätte.<br />
Herausforderung sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik für die Zukunft:<br />
exzessive Lohnzurückhaltung und einseitige Steuersenkungspolitik im<br />
208
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Interesse Deutschlands und der Europäischen Währungsunion stoppen!<br />
Pragmatische Makropolitik entwickeln!<br />
In Zukunft wird es darauf ankommen, durch eine pragmatische Berücksichtigung<br />
nachfrageseitiger Faktoren dauerhaft zu mehr Wachstum und Beschäftigung zu kommen. Der<br />
internationale Vergleich zeigt, dass deutsche Unternehmen kein Wettbewerbsproblem durch<br />
zu hohe Lohnkosten oder eine zu starke Steuerbelastung haben. Im Gegenteil: Die<br />
Lohnentwicklung war in den letzten zehn Jahren vor dem jüngsten Aufschwung schwächer als<br />
in allen anderen Staaten der EU, und die effektive Steuerbelastung für die Unternehmen ist<br />
geringer als in vergleichbaren, makroökonomisch dauerhaft deutlich erfolgreicheren<br />
Industrieländern.<br />
Die Aufrechterhaltung internationaler Wettbewerbsfähigkeit ist im Zeitalter der<br />
Globalisierung eine nicht zu unterschätzende Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Deutschland darf<br />
aber insbesondere in seiner Rolle als größtes Land in der Europäischen Union den<br />
internationalen Lohnzurückhaltungs- und Steuersenkungswettbewerb in Zukunft nicht<br />
unnötig und überdies zum eigenen Schaden weiter vorantreiben! Vielmehr ist eine funktionale<br />
Makrosteuerung Grundlage für langfristigen wirtschaftspolitischen Erfolg.<br />
Um die künftigen Herausforderungen sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik zu erkennen,<br />
wollen wir – jenseits der aktuellen Diskussion um den jüngsten Aufschwung – den Blick auf die<br />
wichtigsten Fehlentwicklungen der Vergangenheit richten.<br />
Abkehr von übermäßiger Lohnzurückhaltung!<br />
Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist der Anteil der Löhne am Volkseinkommen<br />
seit Mitte der 1970er Jahre um etwa 10 Prozentpunkte gesunken. Über die Hälfte dieses<br />
Absinkens ist auf die Lohnentwicklung seit 1993 zurückzuführen. Gleichzeitig war eine zähe<br />
Investitionsschwäche bei hoher Arbeitslosigkeit festzustellen. Zwar lässt sich keine<br />
unmittelbare Kausalität zwischen diesen Beobachtungen ableiten. Dennoch legt ein Blick auf<br />
die Statistik den Verdacht nahe, dass die übermäßige Lohnzurückhaltung in Deutschland auf<br />
Grund der Schwächung der Binnennachfrage makroökonomisch schädlich war.<br />
Häufig wird argumentiert, die Globalisierung erlaube überhaupt keine kräftigen<br />
Lohnsteigerungen mehr. Allerdings kann die Lohnzurückhaltung in Deutschland auch im<br />
internationalen Vergleich nur als überzogen bezeichnet werden. Angaben der Europäischen<br />
Kommission zu Folge sind zwischen 1995 und 2004 die Reallöhne in Deutschland um 0,9 %<br />
209
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
gesunken, während sie im EU-Durchschnitt um 7,4 % gestiegen sind. In Schweden sind die<br />
Reallöhne im gleichen Zeitraum um 25,4 % gestiegen, in Großbritannien um 25,2 % und in den<br />
USA um 19,6 %. Gemessen an den Lohnstückkosten, die die Arbeitskosten ins Verhältnis zur<br />
Arbeitsproduktivität setzen, sieht die Entwicklung ähnlich aus: Deutschland weist die<br />
schwächste Lohnstückkostenentwicklung vergleichbarer EU-Staaten auf.<br />
Auch eine genauere Betrachtung der Lohnstruktur legt die Vermutung nahe, dass die<br />
Arbeitslosigkeit in Deutschland nicht mit zu hohen Löhnen bestimmter Bevölkerungsgruppen<br />
erklärt werden kann. Zahlen der Europäischen Kommission zeigen, dass der Anteil der<br />
Beschäftigten im Niedriglohnsektor bereits im Jahr 2000 über dem europäischen Durchschnitt<br />
lag. Danach ist er weiter deutlich gestiegen.<br />
Das Anwachsen des Niedriglohnsektors kann jedoch nicht in erster Linie mit<br />
Qualifikationsmängeln der ArbeitnehmerInnen erklärt werden. Eine Untersuchung der<br />
Deutschen Bundesbank kam kürzlich zu dem Ergebnis, „dass die Behauptung, in Deutschland<br />
sei die Arbeitsmarktlage der häufig als ‚gering qualifiziert’ eingestuften Personen<br />
außergewöhnlich schlecht, empirisch nicht klar belegbar ist.“ So ist der Anteil der „gering<br />
Qualifizierten“ an den Erwerbspersonen (ArbeitnehmerInnen + Arbeitslose) zwischen 25 und 64<br />
Jahren nach der Statistik der OECD in Deutschland mit nur 13 % im internationalen Vergleich<br />
ausgesprochen niedrig. Zahlreiche anerkannte Studien aus der Arbeitsmarktforschung<br />
beziffern den Anteil von formal qualifizierten Personen im Niedriglohnsektor mit über 60 %.<br />
Selbst junge Akademiker trifft dieses Problem, und ca. 40 % der Hochschulabsolventen sehen<br />
sich vor dem Einstieg in das Berufsleben gezwungen, zunächst mindestens ein Praktikum zu<br />
absolvieren. Generell gilt: Wenn zu wenige Arbeitplätze entstehen, drängen selbst qualifizierte<br />
Personen in prekäre Beschäftigung. Arbeit ist in Deutschland nicht zu teuer.<br />
Regierungen und Parlamente haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die Lohnpolitik, die in<br />
Deutschland in der Hand der Tarifparteien liegt. Sozialdemokraten müssen jedoch Solidarität<br />
mit den Gewerkschaften zeigen, wenn es um eine stabilitäts- und wachstumsfördernde<br />
Lohnpolitik geht, die sich an der langfristigen Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen<br />
Produktivität orientiert. Durch die Deregulierung des Arbeitsmarktes in der Vergangenheit ist<br />
die Verhandlungsposition der Gewerkschaften deutlich geschwächt worden. Unter anderem<br />
durch die Einführung eines Mindestlohnes muss sozialdemokratische Politik den weiteren<br />
Ausbau des Niedriglohnsektors verhindern.<br />
Außerdem sind Reformen in der Bildungspolitik dringend nötig, um Chancengleichheit zu<br />
realisieren, Arbeitslosigkeit zu reduzieren und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten zu<br />
verbessern. Das dreigliedrige Schulsystem ist nicht länger in der Lage, die gewünschten<br />
Bildungserfolge zu gewährleisten. Folglich ist eine Reform des dreigliedrigen Schulsystems hin<br />
210
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
zum integrierten Schulsystem unerlässlich. Individuelle Förderung und kostenlose Bildung von<br />
der U3-Betreuung/Kindergarten bis zur Hochschule sind Garanten für eine höhere<br />
Qualifizierung der Menschen.<br />
Keine weiteren Steuerentlastungen für Unternehmen und Reiche!<br />
Neben den Löhnen sind Steuern ein wichtiger Bestandteil unternehmerischer Kosten. Häufig<br />
wird argumentiert, Deutschland habe hier einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem<br />
Ausland. In der Tat lag die nominale Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland lange<br />
Zeit relativ hoch. Allerdings wurde bereits durch die Unternehmensteuerreform im Jahr 2001<br />
und die verschiedenen Schritte der Einkommensteuerreform bis 2005 der maximale nominale<br />
Grenzsteuersatz auf Unternehmensgewinne (inklusive Gewerbesteuer und<br />
Solidaritätszuschlag) für Kapitalgesellschaften von 51,8 % auf 38,6 % und für<br />
Personenunternehmen von 54,5 % auf 45,7 % gesenkt.<br />
Angesichts der beobachteten makroökonomischen Entwicklung ist es überaus fraglich, ob von<br />
diesen Steuersenkungen positive Wachstumswirkungen ausgegangen sind. Vor allem kann<br />
keine Rede davon sein, dass deutsche Unternehmen nach diesen Steuersenkungen im<br />
internationalen Wettbewerb benachteiligt gewesen wären. In der Tat ist auf Grund zahlreicher<br />
„Steuerschlupflöcher und -gestaltungsmöglichkeiten“ die effektive Steuerbelastung für<br />
deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich gemäß Statistiken von OECD und<br />
Europäischer Kommission als niedrig einzustufen. Deutschland nimmt auch insofern eine<br />
Sonderstellung im internationalen Vergleich ein, als hier der Anteil der von Körperschaften<br />
entrichteten Steuern am Bruttoinlandsprodukt seit den 1970er Jahren gesunken ist. Im EU-<br />
Durchschnitt ist dieser Anteil gestiegen, auch noch während der 1990er Jahre.<br />
Dennoch hat die Große Koalition nun eine weitere Steuerentlastung für Unternehmen und<br />
Kapitaleinkommensbezieher vorgenommen. Die nominale Steuerlast für Körperschaften wird<br />
auf unter 30 % gesenkt, Zinsen und Dividenden werden künftig mit einer einheitlichen<br />
Abgeltungssteuer von 25 % belastet, statt wie zuvor mit dem individuellen<br />
Einkommenssteuersatz nach Maßgabe des Halbeinkünfteverfahrens. Insgesamt droht ein<br />
Steuereinnahmenverlust von 6 – 8 Milliarden Euro pro Jahr.<br />
Genauso wie die Unternehmen beteiligen sich die reichen Privathaushalte zu wenig am<br />
Steueraufkommen. Bemerkenswert sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, wonach<br />
sich der Anteil der Steuern aus Kapitaleinkommen und Vermögen an den gesamten<br />
Steuereinnahmen seit den frühen 1980er Jahren etwa halbiert hat! Gleichzeitig ist die relative<br />
211
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Steuerlast für ArbeitnehmerInnen kontinuierlich gestiegen, was zusätzlich zur sinkenden<br />
Lohnquote die Entwicklung der Masseneinkommen und des privaten Konsums belastet hat.<br />
Ein aktuelles Thema sind die geplanten Entlastungen im Bereich der Erbschaftssteuer. Bereits<br />
das gültige Steuerrecht nimmt in nicht ausreichendem Maße die hohen Vermögen in die<br />
Pflicht. Schätzungsweise werden in Deutschland jährlich 200 bis 250 Milliarden Euro vererbt,<br />
aber nur ein kleiner Bruchteil dieser Vermögenssumme wird zur Berechnung der<br />
Erbschaftssteuer herangezogen. Im internationalen Vergleich wird in Deutschland eine der<br />
geringsten Erbschaftssteuern erhoben. Der Erbschaftssteueranteil am Bruttoinlandsprodukt<br />
beträgt gerade einmal 0,18 %. Der Anteil der Erbschaftssteuer am Gesamteinkommen von<br />
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen beträgt nur 0,5 %. Somit wird Deutschland im<br />
internationalen Vergleich nur von Österreich und der Schweiz unterboten. Andere Länder wie<br />
Frankreich, Großbritannien, Niederlande oder USA weisen doppelt bis teilweise dreifach so<br />
hohe Steuereinnahmen aus Erbschaften und Schenkungen auf.<br />
Die von der Bundesregierung geplante Aufhebung der Erbschaftssteuer für Unternehmen, die<br />
mindestens 10 Jahre weitergeführt werden, ist abzulehnen. Die schon heute existierenden<br />
Steuerentlastungen für Unternehmen bieten keinen Spielraum für weitere<br />
Unternehmensentlastungen und (Erbschafts-)Steuergeschenke. Die diversen Steuersenkungen<br />
der Vergangenheit haben keinen spürbaren positiven Effekt auf die Investitionstätigkeit und<br />
die Konsumnachfrage entfaltet.<br />
Im Fazit sind die gesamtgesellschaftlichen Vorteile der Steuersenkungspolitik der letzten Jahre<br />
überaus zweifelhaft. Die Nachteile sind mehr als deutlich: Die Finanzierungsgrundlage für<br />
öffentliche Investitionen im Bereich der Bildungs- oder Infrastrukturpolitik verschlechtert sich,<br />
Sozialleistungen „müssen“ angesichts „leerer Kassen“ gekürzt werden. Die<br />
Steuervergünstigungen für Unternehmen und Reichen führen unter dem Strich nicht zu mehr<br />
Investitions- oder Konsumnachfrage.<br />
Kostensenkungswettbewerb in der Europäischen (Währungs-)Union<br />
beenden!<br />
„Deutschland greift uns an“. Unter diesem Titel brachte der nationale französische<br />
Radiosender France Inter im Januar 2007 einen Bericht über die Lohn- und Steuerpolitik in<br />
Deutschland. Im europäischen Ausland wird die wiederholte deutsche<br />
„Exportweltmeisterschaft“ vor allem deswegen mit Sorge betrachtet, weil diese zu Recht auch<br />
auf das schwache Lohnwachstum in Deutschland in den letzten Jahren zurückgeführt wird.<br />
Dadurch hat sich ein Wettbewerbsvorteil für deutsche Unternehmen ergeben, der<br />
212
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
insbesondere gegenüber Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion zum Tragen<br />
kommt.<br />
Nach dem Wegfall von innereuropäischen Wechselkursen bedeutet die im Vergleich zum<br />
europäischen Ausland schwache Lohnentwicklung in Deutschland eine reale Abwertung. Wenn<br />
Länder wie Frankreich oder Spanien, in denen die Löhne zuletzt stärker gestiegen sind als in<br />
Deutschland, auf Dauer wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sie ihrerseits ebenfalls<br />
Lohnzurückhaltung üben. Falls Deutschland selbst dann noch an einer exportorientierten<br />
Wachstumsstrategie festhalten will, müsste die Lohnzurückhaltung hierzulande daraufhin<br />
noch stärker ausfallen, damit der ursprüngliche Wettbewerbsvorteil wieder hergestellt wird.<br />
Diese Logik heizt einen Lohnsenkungswettbewerb an, der für die Sozialdemokratie nicht<br />
akzeptabel sein kann.<br />
Besonders problematisch ist es, wenn ein Lohnsenkungswettbewerb vom größten Land in der<br />
Währungsunion forciert wird. Für ein großes Land ist die Binnenwirtschaft relativ bedeutsamer<br />
als die Exportwirtschaft. Gleichzeitig ist die binnenwirtschaftliche Entwicklung eines großen<br />
Landes für die makroökonomische Entwicklung seiner Nachbarländer von großer Wichtigkeit.<br />
Unter einer überzogenen Lohnmoderation zugunsten der Exportwirtschaft (und unter einer<br />
wachstumsfeindlichen prozyklischen Finanzpolitik) leidet daher Deutschland im Speziellen<br />
ebenso wie Europa als Ganzes.<br />
Eine koordinierte solidarische Lohnpolitik in Europa etwa in Form eines einheitlichen<br />
Mindestlohnes erscheint für die nähere Zukunft nicht realistisch. Deutschland darf aber den<br />
Lohnsenkungswettbewerb nicht zum Schaden der eigenen Bürger und der europäischen<br />
Freunde unnötig antreiben.<br />
Dieselbe Logik gilt für die Unternehmenssteuerpolitik. Deutschland darf in Zukunft seine<br />
europäischen Partner nicht mit weiteren Steuersenkungen unter Druck setzen. Hierauf<br />
könnten diese ihrerseits nur mit eigenen Steuersenkungen reagieren; die alte<br />
Wettbewerbssituation wäre wieder hergestellt; ein Steuersenkungswettlauf wäre das<br />
Ergebnis. Das wollen wir Sozialdemokraten nicht!<br />
Anpassung an die internationalen Standards in pragmatischer<br />
Makrosteuerung!<br />
Die makroökonomische Politik in Deutschland bzw. in der Europäischen Währungsunion bleibt<br />
weit hinter internationalen Standards zurück. Ausländische Politiker und Wissenschaftler sind<br />
213
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
immer wieder erstaunt über die Einseitigkeit der wirtschaftspolitischen Debatte in<br />
Deutschland. In so unterschiedlichen Ländern wie den USA, Großbritannien oder Schweden gilt<br />
es als Selbstverständlichkeit, dass die Geld- und Fiskalpolitik einen wichtigen Beitrag zur<br />
konjunkturellen Stabilisierung und damit letztlich zum langfristigen Wachstum leisten muss.<br />
In Europa setzt das Maastricht-Regime der staatlichen Fiskalpolitik enge Grenzen. Deutschland<br />
bleibt zudem bei den öffentlichen Investitionen systematisch hinter dem Durchschnitt der<br />
entwickelten Industrieländer zurück. Die Europäische Zentralbank verfolgt eine einseitige<br />
Inflationsbekämpfungspolitik, während andere Zentralbanken ausdrücklich auch<br />
Wachstumsziele verfolgen.<br />
Nach den vornehmlich angebotsorientierten Maßnahmen der letzten Jahre muss die<br />
Wirtschaftspolitik in Zukunft vor allem die Gestalt einer auf Wachstum ausgerichteten Steuerund<br />
Finanzpolitik annehmen. Mit öffentlichen Investitionen können Arbeitsplätze geschaffen<br />
werden und Impulse für private Investitionen in demokratisch festzulegenden, gesellschaftlich<br />
wünschenswerten Bereichen gegeben werden.<br />
Die hierfür notwendigen Mittel sollten aus einer stärkeren Besteuerung von<br />
Kapitaleinkommen, Vermögen und Arbeitseinkommen insbesondere gut verdienender<br />
MitbürgerInnen bezogen werden. Somit entsteht auch neuer Spielraum für finanzpolitische<br />
Eingriffe zur Verhinderung von Rezessionen. Staatliche Konjunkturpolitik und eine kräftige<br />
öffentliche Investitionstätigkeit bleiben auch im 21. Jahrhundert wichtiger Bestandteil<br />
moderner Wirtschaftspolitik. Hierüber entwickelt sich international zunehmend ein<br />
wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Konsens.<br />
„Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen“: die längerfristigen<br />
Aufgaben der Wirtschaftspolitik nicht aus den Augen verlieren!<br />
Wachstum kann für Sozialdemokraten kein Selbstzweck sein. Natürlich müssen angesichts der<br />
aktuellen Verteilungssituation die Einkommen gerade der Schwächsten in der Gesellschaft<br />
gestärkt werden. Dies geht nur mit Wachstum, wenn gesellschaftliche Verteilungskonflikte<br />
nicht eskalieren sollen. Forderungen nach einem sofortigen Übergang zu einer Strategie des<br />
Negativwachstums, z.B. aus globalisierungskritischen Kreisen, sind daher mit Skepsis zu<br />
begegnen.<br />
Längerfristig muss es aber dennoch Ziel von Sozialdemokraten sein, eine kritische und<br />
grundsätzliche Diskussion darüber anzustoßen, inwieweit Wachstum gesellschaftlich<br />
wünschenswert und ökologisch vertretbar bleibt. Verbesserte Produktionsmöglichkeiten<br />
müssen sich letztlich immer darin legitimieren, dass sie dem einzelnen Menschen dienen,<br />
214
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
indem sie sein Leben angenehmer, sicherer und freier machen. Die langfristige Aufgabe der<br />
jungen Generation wird es sein, die richtige Übersetzung von Produktivitätsfortschritten in<br />
Wachstum, Arbeitszeitverkürzung und Umweltschutz zu definieren.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Wir <strong>Jusos</strong><br />
• Wollen eine intensivere Debatte über alternative wirtschaftspolitische Strategien bei<br />
den <strong>Jusos</strong> und in der SPD<br />
• Sehen im jüngsten Aufschwung keine Bestätigung oder Rechtfertigung der Agenda<br />
2010 bzw. der angebotsorientierten Kostensenkungspolitik<br />
• Stellen fest, dass das Ziel der „Guten Arbeit“ nur durch eine funktionale Makropolitik<br />
erreicht werden kann<br />
• Lehnen Forderungen nach sofortigem Übergang zu einer Strategie des<br />
Negativwachstums ab, aber fordern mittelfristig eine Diskussion über eine<br />
angemessene Umsetzung von Produktivitätsfortschritte in Wachstum,<br />
Arbeitszeitverkürzung und Umweltschutz<br />
• Fordern die Einführung eines Mindestlohns und weiterer Reregulierungen für den<br />
Arbeitsmarkt, insbesondere im Bereich „prekärer Beschäftigungsverhältnisse“ wie Leihund<br />
Zeitarbeit<br />
• Fordern ein integriertes Schulsystem und kostenlose Bildung für alle, um individuelle<br />
Beschäftigungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu verbessern<br />
• Fordern einen größeren Beitrag von Unternehmen und reichen Privathaushalten am<br />
Steueraufkommen insbesondere durch Reformen im Bereich des Spitzensteuersatzes<br />
der Einkommenssteuer und bei der Erbschafts- und Vermögenssteuer<br />
• Fordern den pragmatischen Einsatz konjunkturpolitischer Instrumente wie eine<br />
antizyklische Finanzpolitik von Bund und Land statt Schuldenbremsen für die<br />
öffentlichen Haushalte<br />
215
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
• Fordern eine Erhöhung der Investitionen von Bund, Land und Kommunen auch zur<br />
Stärkung der regionalen Wirtschaft<br />
Fordern eine makroökonomische Koordinierung auf europäischer Ebene durch politischen<br />
Dialog und schließlich durch eine Reform des Vertrags von Maastricht.<br />
R 3 – Bundesvorstand<br />
Abrüstung jetzt!<br />
Deutschland und Frankreich müssen<br />
Vorbilder in der Abrüstungspolitik werden<br />
In einer Rede vor dem diplomatischen Korps in Paris hat sich der französische Präsident Nicolas<br />
Sarkozy für ein starkes Frankreich in einem starken Europa eingesetzt, das in der Lage sein soll,<br />
mit den Vereinigten Staaten auf Augenhöhe umzugehen.<br />
Seine zentrale Forderung bestand darin, durch die Militarisierung Europas ein neues<br />
Mächtegleichgewicht zu schaffen. Dies erfordere eine mächtige Militärpräsenz der<br />
Europäischen Union in der Welt, und dabei müsse Frankreich die Führungsrolle übernehmen.<br />
Sarkozy forderte die weitere Entwicklung der europäischen Rüstungs- und<br />
Sicherheitskapazitäten.<br />
Diesen Aufrüstungsbestrebungen und diesem blinden Nationalismus erteilen die<br />
Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in Deutschland und Frankreich eine klare Absage und<br />
fordern die deutsche Regierung auf, sich diesen Plänen entschieden zu widersetzen.<br />
<strong>Jusos</strong> und MJS kämpfen gemeinsam für ein Europa des Friedens, in dem Abrüstung und nicht<br />
Aufrüstung im Zentrum gemeinsamer Europäischer Außenpolitik steht. Vor allem Frankreich<br />
und Deutschland als größte Rüstungsexporteure Europas sind gefordert, diesen Weg<br />
vorbildhaft zu gehen und das Zeitalter der Abrüstung einzuleiten.<br />
Noch immer lagern 384 Atomsprengköpfe in Frankreich, die Sarkozy als „Lebensversicherung<br />
der Nation“ betrachtet. Doch Atomwaffen sind keine Lebensversicherung, sondern Waffen des<br />
Terrors. Auch in Deutschland lagern im US-Stationierungsort Büchel in Rheinland-Pfalz immer<br />
noch ca. 20 taktische Atomwaffen, die der NATO zur Verfügung stehen. Laut aktuellen<br />
Informationen von Atomwaffenexperten in den USA und in Deutschland sind die bisher<br />
zusätzlichen 130 US-Atomwaffen von dem US-Luftwaffenstutzpunkt Ramstein abgezogen<br />
216
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
worden. Die Bundesluftwaffe hält dort auf dem Atomwaffenstützpunkt Kampfflugzeuge<br />
bereit, um im so genannten »Ernstfall« im Rahmen der nuklearen Teilhabe jene Atomwaffen zu<br />
ihrem Einsatzort fliegen zu können.<br />
Als Beitrag zur weltweiten Abrüstung und um glaubwürdig mit Staaten verhandeln zu können,<br />
die eventuell glauben, Atomwaffen würden ihnen Sicherheit bieten, sollte Deutschland und<br />
Frankreich auf diese Waffen verzichten. Es ist doppelzüngig, von anderen zu verlangen, auf<br />
Atomwaffen zu verzichten, während man selbst noch auf die atomare Abschreckung setzt.<br />
Wir fordern die deutsche und die französische Regierung auf, sich international für einen<br />
Vertrag einzusetzen, der einen Verbot und die Abschaffung aller Atomwaffen vorschreibt. Als<br />
erster Schritt erwarten wir vor allem von der deutschen Bundesregierung, dass sie Einfluss auf<br />
die fünf Atommächte ausübt, um den Nichtverbreitungsvertrags (NPT) zu stärken. Seine Regeln<br />
müssen international eingehalten und das Kontrollregime ausgebaut werden.<br />
Darüber hinaus erwarten wir einen bladigen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> und MJS stehen heute und morgen für eine Friedensmacht Europa. Dafür lohnt es<br />
sich zu kämpfen!<br />
R 4 – Bundesvorstand<br />
Freiheit statt Angst – Gegen den<br />
Überwachungswahn<br />
Im Rahmen des europaweiten Aktionstags „Freiheit statt Angst – Gegen den<br />
Überwachungswahn“ findet am 11. Oktober in Berlin eine Demonstration statt. Die zentralen<br />
Forderungen sind der bessere Schutz der Privatsphäre und die Überarbeitung aller seit dem 11.<br />
September 2001 beschlossenen Sicherheitsgesetze.<br />
Die <strong>Jusos</strong> unterstützen den Demonstrationsaufruf und erklären ihre Solidarität mit den Zielen<br />
der AktivistInnen. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und die SPE-Fraktion im<br />
Europäischen Parlament darüber hinaus auf, im Sinne dieser Ziele zu handeln.<br />
217
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Denn für uns <strong>Jusos</strong> steht fest: Wir wollen die Grundrechte besser schützen, weitere<br />
Einschränkungen verhindern und die bestehenden Einschränkungen bei den Freiheitsrechten<br />
soweit wie möglich rückgängig machen.<br />
Doch stattdessen schränken immer neue Sicherheitsgesetze die persönlichen Freiheitsrechte<br />
ein. Vier aktuelle Beispiele:<br />
• Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung schreibt seit Anfang des Jahres vor, dass die<br />
Verbindungsdaten von Telefon, Handy und E-Mails für sechs Monate bei den<br />
Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden müssen. Festgehalten wird<br />
also, wer mit wem, wann in Kontakt steht.<br />
• Die Europäische Kommission und der Europäische Rat planen eine Datenerhebung<br />
von FlugpassagierInnendaten nach dem Vorbild des Abkommens mit den USA.<br />
• Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und Justizministerin Brigitte Zypries haben<br />
im März den so genannten Terrorfahndungsvertrag zum Datenaustausch zwischen<br />
den USA und Deutschland unterzeichnet.<br />
• Das Kabinett hat diese Woche beschlossen, eine Grundgesetzänderung anzustreben,<br />
die den Einsatz der Bundeswehr im Innern erlaubt. Das ist für uns in keinerlei Weise<br />
akzeptabel und wir werden in der SPD dafür kämpfen, dass diese Änderung mit der<br />
Sozialdemokratie nicht zu machen ist.<br />
In diesem Sinne senden wir der Demonstration solidarische Grüße und werden weiterhin mit<br />
vielen BündnispartnerInnen gegen den Überwachungsstaat und für eine offene und tolerante<br />
Gesellschaft streiten.<br />
218
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
S<br />
SPD - Anforderungen an die Partei<br />
S 1 – Bundesvorstand<br />
Anforderungen an die Aufstellung der<br />
Sozialdemokratie für die Bundestagswahl<br />
2009<br />
Situation der SPD ein Jahr vor der Wahl<br />
Die Sozialdemokratie hat stürmische und schwierige Zeiten hinter sich. In den letzten Monaten<br />
wurde die Außendarstellung vor allem durch einen Machtkampf innerhalb der Parteiführung<br />
und der Auseinandersetzung um die Kanzlerkandidatur 2009 dominiert, gute inhaltliche<br />
Initiativen, so z.B. die Initiative gegen Kinderarmut, blieben so unbeachtet. Der Umgang in<br />
Teilen der Partei war von Misstrauen und Illoyalität geprägt. Der Parteivorsitzende Kurt Beck<br />
konnte sich nicht mehr auf die notwendige solidarische Unterstützung durch alle relevanten<br />
Parteiteile verlassen. Kurt Beck wurden so Entscheidungs- und Handlungsspielräume<br />
genommen, seine Arbeit als Parteivorsitzender wurde unnötig erschwert. Die Illoyalitäten<br />
gegen Beck waren unerträglich und der Sozialdemokratie unwürdig, sie haben nicht zur oft<br />
eingeforderten Geschlossenheit der Partei beigetragen.<br />
Kurt Beck hat den Parteivorsitz in einer Phase übernommen, in der die Partei politisch und<br />
programmatisch ausgelaugt war. In den Regierungsjahren ist die SPD einen Weg gegangen, der<br />
dem neoliberalen Mainstream dieser Jahre entsprochen hat. Der Versuch, über die<br />
Konstruktion einer neuen Mitte und eines aktivierenden Sozialstaats eine Politik zu etablieren,<br />
die mit scheinbar traditionellen Werten und Instrumenten sozialdemokratischer Politik<br />
aufräumte, führte dazu, dass die SPD in großen Teilen ihrer StammwählerInnenschaft an<br />
Vertrauen und Rückhalt einbüßte. Viele traditionelle Wählerinnen und Wähler wanderten ab,<br />
das für unsere Partei bedeutende Verhältnis zu den Gewerkschaften wurde stark belastet.<br />
Innerparteilich wurde diese Politik autoritär und hierarchisch von oben durchgesetzt mit<br />
gravierenden negativen Auswirkungen.<br />
219
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mit dem Hamburger Parteiprogramm hat Kurt Beck in der SPD überhaupt erst wieder eine<br />
tragfähige Basis für die Arbeit der Partei geschaffen. Das Hamburger Programm spiegelt die<br />
Gesamtpartei wider, es ist sicherlich kein Programm der Parteilinken. Mit der Verankerung des<br />
demokratischen Sozialismus bietet es aber auch für die Parteilinke und uns <strong>Jusos</strong> viele<br />
Anknüpfungspunkte. Es bietet eine Grundlage für die inhaltliche Arbeit in den nächsten Jahren,<br />
es ist die Grundlage, um in der SPD über die Regierungspolitik der großen Koalition und der rotgrünen<br />
Vorgängerkoalition hinausgehend eine Politik der sozialen Gerechtigkeit zu entwickeln.<br />
Das neue Grundsatzprogramm gibt vielen SPD-Mitgliedern, die in den letzten Jahren (ver-)<br />
zweifelten neue Hoffnung und Zuversicht.<br />
Auch viele weitere Beschlüsse des Hamburger Parteitags sind ein wichtiges Signal für die<br />
inhaltliche Aufstellung der SPD in den kommenden Jahren. Beispielsweise gelang es, mit den<br />
Beschlüssen zu Guter Arbeit, zu ALG-I-Zahlung für ältere ArbeitnehmerInnen oder zur<br />
Rentenpolitik die bisherige SPD-Regierungspolitik weiterzuentwickeln und deutliche Akzente<br />
für mehr soziale Gerechtigkeit zu setzen. Diese – von Kurt Beck gegen Widerstände<br />
entschieden durchgesetzte – teilweise Abkehr von zentralen Positionen bisheriger SPD-<br />
Regierungspolitik führte mit zu einer merklichen Entspannung des Verhältnisses zu den<br />
Gewerkschaften. Das für die Sozialdemokratie so wichtige Verhältnis zu den Gewerkschaften<br />
hatte gerade unter der Führung von Schröder/Müntefering massiv gelitten, während dieser<br />
Zeit ging viel Vertrauen verloren. Die Beschlüsse des Hamburger Parteitags haben deshalb für<br />
die Zukunft der Sozialdemokratie eine herausragende Bedeutung.<br />
Der Hamburger Parteitag versöhnte große Teile der SPD-Mitglieder und der<br />
Gewerkschaftsführungen mit der Partei, der Parteitag bereitete die Basis, verlorengegangenes<br />
Vertrauen in traditionellen SPD-WählerInnenmilieus zurückzugewinnen. Es war Kurt Becks<br />
Verdienst, dass auf dem Hamburger Parteitag in zahlreichen Punkten Kompromisse gefunden<br />
wurden, in denen sich alle Teile der Partei wiederfinden konnten. Auf dem Parteitag wurden<br />
viele der Entscheidungen mit großer Mehrheit getroffen. Doch ein Teil der Partei hat die<br />
getroffenen Vereinbarungen nach dem Parteitag nie akzeptiert und mitgetragen. Das war<br />
sicher ein Grund für die Entwicklungen einer solch porösen Vertrauensbasis.<br />
Trotz einer jetzt wahrnehmbar größeren Geschlossenheit nach außen: Das Selbstverständnis<br />
der SPD und zentrale strategische Entscheidungen sind nach wie vor ungeklärt. Wir<br />
JungsozialistInnen sind davon überzeugt: Die SPD wird nur als Mitgliederpartei und linke<br />
Volkspartei in der Lage sein, auch längerfristig fortschrittliche soziale Politik umzusetzen.<br />
Im Parteienwettbewerb wird die SPD aus eigener Stärke heraus nur mit dem Profil einer linken<br />
Volkspartei wieder Gestaltungsmacht erringen können. Wir müssen jetzt deutlich machen,<br />
220
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
dass die SPD (wieder) für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit steht. Dazu gehört auch eine<br />
kritische Betrachtung der Regierungspolitik und die Bereitschaft an den Punkten<br />
Veränderungen vorzunehmen, die ungerechte Verwerfungen nach sich gezogen haben. Wir<br />
dürfen kein Milieu abschreiben und müssen gerade für diejenigen ein attraktives<br />
Politikangebot bereithalten, die uns nach der Bundestagswahl 1998 nicht mehr ihr Vertrauen<br />
gegeben haben. Wir brauchen eine klare Ausrichtung auf ArbeitnehmerInneninteressen und<br />
eine Politik für diejenigen, die in der Gesellschaft auf solidarische Unterstützung angewiesen<br />
sind.<br />
Zusätzlich brauchen wir auch ein besonderes Angebot an die junge Generation und Frauen.<br />
Diese Gruppen waren es, die die SPD auch bei den vergangenen Wahlen überdurchschnittlich<br />
gewählt haben. Wir müssen deutlich machen, dass es darum geht, eine Partei der<br />
Emanzipation und Gleichstellung zu sein.<br />
Um neues Vertrauen in verlorengegangenen WählerInnenmilieus zurückzugewinnen, muss die<br />
SPD ihre Politik klar an den Interessen der ArbeitnehmerInnen und nicht an einer diffus<br />
umrissenen bürgerlichen „Mitte“ ausrichten. Die SPD muss Antworten auf die Frage<br />
formulieren, wie im derzeitigen Entwicklungszustand der Gesellschaft soziale Gerechtigkeit<br />
verwirklicht werden kann. Die Aufstellung in Richtung 2009 ist zentral und deshalb wollen wir<br />
uns als <strong>Jusos</strong> frühzeitig in die Debatte einbringen.<br />
Zum Konzept der linken Volkspartei gehört auch ein innerparteilicher Pluralismus mit starken<br />
Parteiflügeln. Die SPD-Politik der letzten Jahre mit ihrer einseitigen Orientierung auf eine so<br />
genannte „Mitte“ hat jedoch das Profil der SPD als linke Volkspartei gefährdet, da oft wider den<br />
Interessen großer Teile der sozialdemokratischen WählerInnenschaft gehandelt wurde.<br />
Als linke Volkspartei wird die SPD nur dann existieren können, wenn sie sich als<br />
Mitgliederpartei versteht. Mitgliederpartei heißt, die Parteimitglieder ernst zu nehmen und in<br />
Willensbildungsprozesse mit einzubeziehen, nicht, sie vor vollendete Tatsachen zu stellen.<br />
Mitgliederpartei heißt, Politik in der Partei und ihren Gremien und Gliederungen, in der<br />
Diskussion mit den Mitgliedern zu entwickeln und vielfältige Partizipationsmöglichkeiten zu<br />
schaffen. Die vielen engagierten SPD-Mitglieder müssen die Möglichkeit haben, in wichtigen<br />
Fragen wirklichen Einfluss auf die SPD-Politik zu nehmen. Ein Rückfall in den alten hierarchischautoritären<br />
Führungsstil wäre für die Mitgliederpartei SPD fatal.<br />
Die SPD lebt davon, dass die Mitglieder eine hohe Identifikation mit ihrer Partei aufweisen und<br />
dass sie stolz auf ihre SPD sind. Dazu gehört aber nicht nur die aus ihrer Sicht richtige oder<br />
zumindest vertretbare Politik und der innerparteiliche Diskurs, die Mitglieder müssen sich als<br />
solche auch geschätzt fühlen. Einer Ausrichtung der Partei, die als bloße Wahlkampftruppe und<br />
221
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Plakateaufsteller gesehen wir, erteilen wir eine Absage. Eine Programmpartei, wie es die SPD<br />
ist, lebt neben dem Diskurs auch vom kulturellen Miteinander und gegenseitigen Respekt.<br />
Die neue Führungsspitze steht vor großen Herausforderungen, der Erfolgsdruck ist für sie –<br />
auch wegen der Art und Weise des Wechsels – sehr groß. Wir <strong>Jusos</strong> werden sehr kritisch<br />
beobachten, ob der neuen Parteispitze wirklich an einem geschlossenen und einigen Auftreten<br />
der Partei gelegen ist. Nach den letzten Entwicklungen ist für uns <strong>Jusos</strong> klar: Geschlossenheit<br />
kann es nur geben, wenn sich die gesamte Partei in der inhaltlichen Ausrichtung wiederfindet<br />
und diese nicht autoritär von oben vorgegeben wird.<br />
Nach wie vor ungeklärt ist, wie sich die SPD strategisch im Fünf-Parteiensystem verordnet. Neu<br />
im parlamentarischen System der Bundesrepublik ist die Etablierung der Linkspartei. Wir <strong>Jusos</strong><br />
haben seit langem vor einer Blockadehaltung und einem künstlichen Antikommunismus<br />
gegenüber der Linkspartei gewarnt und einen sachlichen Umgang mittels einer inhaltlichen<br />
Auseinandersetzung eingefordert. Die Strategie des Ignorierens und Tabuisierens ist<br />
gescheitert. Die SPD darf sich nicht im Fünf-Parteien-System zerreiben lassen, sondern muss<br />
offensiv für ihre Positionen streiten und damit alle anderen Parteien unter Druck setzen.<br />
Mit dem Personalwechsel darf kein programmatischer Rückschritt verbunden sein. An der<br />
inhaltlichen Ausrichtung wird sich in den nächsten Monaten zeigen, ob der SPD mit dem<br />
Personal der Schröder-Regierung wirklich ein erfolgreicher Aufbruch gelingt. Dies fällt uns im<br />
Moment schwer zu glauben.<br />
Für uns ist klar: Die Alternative heißt soziale Gerechtigkeit.<br />
Ansprüche an den SPD-Wahlkampf<br />
Koalitionsaussagen sind erst nach einem Vergleich der politischen Ziele und nach<br />
Sondierungsgesprächen sinnvoll; eine Koalitionsaussage vor einer Wahl ist eine Entmündigung<br />
der WählerInnen. Dazu gehört auch die vorherige Ablehnung einer möglichen Zusammenarbeit<br />
mit einzelnen demokratischen Parteien. Deshalb fordern wir <strong>Jusos</strong> von der SPD, 2009 auf eine<br />
Koalitionsaussage zu verzichten.Erst in den Koalitionsverhandlungen kann es darum gehen,<br />
auszuloten, mit welcher Partei oder mit welchen Parteien wir ein Maximum unserer<br />
Forderungen und Inhalte umgesetzt bekommen. Daran wird sich letztendlich die<br />
Glaubwürdigkeit der SPD entscheiden. Das erwarten die Menschen von uns.<br />
222
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Wir <strong>Jusos</strong> werden für unsere Inhalte und die SPD einen engagierten Wahlkampf führen und<br />
dabei insbesondere unsere AltersgenossInnen ansprechen. Niemand kann dies besser als wir<br />
<strong>Jusos</strong>. Wir <strong>Jusos</strong> haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass wir organisatorisch<br />
gut aufgestellt und kampagnenfähig sind. Auch in den vergangenen Wahlkämpfen waren wir<br />
immer der Aktivposten der Partei, der mit neuen Ideen und viel Engagement Mehrheiten in<br />
unserer Generation gewonnen hat.<br />
Das Vertrauen der jungen Generation kann nur gewonnen werden, wenn bei den Inhalten<br />
sowie bei der Kandidatinnen- und Kandidatenaufstellung die Interessen der jungen Generation<br />
berücksichtigt werden. Wir unterstützen junge, linke KandidatInnen bei ihrer Bewerbung um<br />
ein Bundestagsmandat. Aus diesem Grund nominieren wir stellvertretend die ehemaligen<br />
Vorsitzende der <strong>Jusos</strong> Andrea Nahles, Niels Annen und Björn Böhning als Kandidatin und<br />
Kandidaten für ein Bundestagsmandat und werden sie dabei unterstützen.<br />
Wir stellen aber auch Ansprüche an die SPD. Wir fordern einen transparenten, auf Beteiligung<br />
setzenden Prozess bei der Erstellung des Wahlprogramms. Die SPD muss ihre Politik<br />
gemeinsam diskursiv und unter Einbeziehung der Gliederungen und Gremien entwickeln. Und<br />
wir wollen nicht einfach nur für einen Wahlsieg arbeiten, wir wollen auch mitbestimmen, was<br />
danach passiert. Deshalb stellen wir Anforderungen an ein SPD-Wahlprogramm, mit dem wir<br />
in die Debatten der nächsten Monate gehen wollen.<br />
Für soziale Gerechtigkeit: Unsere Anforderungen an das Wahlprogramm<br />
Das zentrale Problem, dem die Sozialdemokratie begegnen muss, ist die wachsende soziale<br />
Ungleichheit in Deutschland. Wir fordern deshalb von der SPD einen Wahlkampf und eine<br />
Politik mit der zentralen Botschaft soziale Gerechtigkeit ein.<br />
• Soziale Gerechtigkeit heißt Gute Arbeit.<br />
Anliegen der SPD ist es, gute Arbeit Realität werden zu lassen. Dazu gehört der gesetzliche<br />
Mindestlohn von mindestens 7,50 Euro ebenso wie die Regulierung der Leiharbeit.<br />
• Soziale Gerechtigkeit heißt Gleichstellung:<br />
Die SPD setzt sich für echte Gleichstellung in einer geschlechtergerechten Gesellschaft ein.<br />
Dazu gehört die gleiche Teilhabe an Macht und Einfluss von Frauen und Männern. Deshalb ist<br />
ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft notwendig. Auch der immer noch nicht<br />
realisierte Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit muss endlich durch echte<br />
Anstrengungen durchgesetzt werden. Wir wollen eine gerechte Aufteilung von Erwerbs- und<br />
223
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Sorgearbeit und fordern daher die Rückkehr der Arbeitszeitverkürzung auf die politische<br />
Agenda.<br />
• Soziale Gerechtigkeit heißt Chancengleichheit verwirklichen.<br />
Die SPD kämpft für Chancengleichheit. Hierbei spielt der Bildungsbereich eine zentrale Rolle.<br />
Wir wollen einen Ausbau der frühkindlichen Bildung, längeres gemeinsames Lernen und die<br />
Kostenfreiheit des gesamten Bildungsweges und damit auch ein gebührenfreies Studium. Wir<br />
wollen allen Menschen die Chance auf eine Berufsausbildung geben. Deshalb fordern wir ein<br />
individuelles Recht auf Ausbildung.<br />
• Soziale Gerechtigkeit heißt Umverteilung.<br />
Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander. Die Wiedereinführung der<br />
Vermögenssteuer, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer und eine Anpassung der<br />
Einkommenssteuer halten wir für unverzichtbar. Darüber hinaus muss das Ehegattensplitting<br />
endlich abgeschafft werden.<br />
• Soziale Gerechtigkeit heißt die Grundversorgung mit Energie sichern.<br />
Die steigenden Energiepreise zeigen die soziale Dimension von Energiepolitik. Es war ein<br />
Fehler, in diesem Bereich zu privatisieren. Es müssen Maßnahmen entwickelt werden, wie die<br />
Rekommunalisierung von Stadtwerken erleichtert werden kann. Darüber hinaus muss es einen<br />
vergünstigten Einstiegstarif geben. Außerdem ist für uns als <strong>Jusos</strong> klar, dass es keinen Ausstieg<br />
aus dem Ausstieg geben darf: Atomenergie ist keine Alternative.<br />
• Soziale Gerechtigkeit heißt menschenwürdige Absicherung.<br />
Die Verantwortung für Arbeitslosigkeit liegt nicht bei jedem Einzelnen. Sie ist ein<br />
gesellschaftlich verursachtes Problem, das auch gesellschaftlich gelöst werden muss. Deshalb<br />
wollen wir, dass arbeitslose Menschen in unserer Gesellschaft menschenwürdig leben können,<br />
nicht ausgegrenzt werden und ihnen geholfen wird. Dazu müssen wir den Regelsatz erhöhen<br />
und die Sanktionen gegen arbeitslose Menschen abschaffen Um Kinderarmut zu begegnen, ist<br />
ein eigenständiger Regelsatz für Kinder erforderlich. Wir wollen die Arbeitslosenversicherung<br />
in die Arbeitsversicherung umwandeln, um Unterbrechungen in der Erwerbstätigkeit<br />
abzusichern. Im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung muss endlich das Konzept der<br />
solidarischen Bürgerversicherung durchgesetzt werden.<br />
• Soziale Gerechtigkeit erfordert regulierte Finanzmärkte<br />
Die aktuelle Entwicklung an den Finanzmärken zeigt: Das Finanzsystem ist unterreguliert. Es<br />
wird klar, dass Banken nie private Unternehmen sein können. Sie sind immer quasi-öffentlich<br />
und müssen deshalb streng reguliert werden. Die staatliche Rettung von maroden Banken darf<br />
nicht zur Folge haben, dass die Risiken ausschließlich von öffentlichen Haushalten<br />
224
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
übernommen werden, Management und Anteilseigner aber weitgehend ungeschoren<br />
davonkommen. Wir fordern deshalb in diesem Fall die Verstaatlichung der Banken.<br />
• Gerechte Politik bedeutet auch internationale Solidarität<br />
Ein Großteil der Konflikte weltweit gründet sich auch auf soziale Konflikte, auf die ungleiche<br />
Verteilung von Reichtum und Besitz zwischen Nord und Süd, aber auch innerhalb der<br />
jeweiligen Staaten. Soziale und wirtschaftliche Entwicklung kann nur dort stattfinden, wo<br />
Frieden herrscht und umgekehrt Frieden kann nur herrschen wo soziale Ungleichheiten<br />
wirksam bekämpft werden, d.h. der soziale Friede als Ziel angestrebt wird. Deshalb muss eine<br />
Friedenspolitik die nachhaltig sein will, insbesondere soziale Ungleichheiten bekämpfen. Um<br />
diesen sozialen Frieden weltweit voranzutreiben, bedarf es einer internationalen<br />
Umverteilung. Wir fordern endlich eine Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 0,7% des<br />
Bruttonationaleinkommens durchzusetzen. An den Millenniumszielen muss festgehalten<br />
werden, deren Umsetzung lief bisher leider mangelhaft.<br />
• Sozialdemokratie heißt Kampf gegen Rechts<br />
Der Kampf gegen Rechts ist zentral. Dies bedeutet, selbst aktiv zu werden aber auch Projekte<br />
gegen Rechtextremismus finanziell und langfristig abzusichern. Dafür muss sich die<br />
Sozialdemokratie einsetzen, denn antifaschistisches Engagement darf nicht politischen<br />
Konjunkturen unterworfen sein.<br />
• Sozialdemokratie heißt kein Überwachungsstaat<br />
Grund- und BürgerInnenrechte sind Grundlage dafür, dass Menschen sich frei entfalten. In den<br />
letzten Jahren gab es eine Entwicklung hin zu einem stärkeren Überwachungsstaat. Dieser<br />
Entwicklung entgegen zu treten und für eine offene und tolerante Gesellschaft zu werben, ist<br />
Aufgabe der Sozialdemokratie.<br />
Es gibt viel zu tun. Ohne die SPD wird es keinen sozialen Fortschritt geben. Deshalb haben wir<br />
als Sozialdemokratie die Aufgabe, uns darauf zu verständigen, wie die Situation der Menschen<br />
verbessert werden kann. Dies müssen wir konsequent umsetzen.<br />
225
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
T<br />
Thesendiskussion<br />
T 1 - Bundesvorstand<br />
Für eine LINKE der ZUKUNFT<br />
Thesen zu jungsozialistischer Politik<br />
Kapitel I :: Intro<br />
These 01<br />
Voraussetzungen linker Politik heute<br />
Für linke Politik standen die Vorzeichen in den letzten Jahren schlecht. Der realexistierende<br />
Sozialismus war gescheitert und eine Alternative zum Kapitalismus damit scheinbar<br />
diskreditiert. Dem entsprach, dass die Behauptung des „There is no Alternative“- Prinzips<br />
(TINA) der Konservativen von den linken Kräften des Parlamentarismus übernommen und für<br />
das links-liberale Bürgertum als vermeintlich entideologisierte Politikform des einzig<br />
Möglichen serviert wurde.<br />
Auf der anderen Seite wuchs bei vielen links politisch Interessierten die Überzeugung,<br />
Parteipolitik führe zwangsläufig zu Konformismus, Opportunismus und Karrierestreben. Als<br />
Beweis mussten ehemalige 68er herhalten, die sich von alten Idealen abgewandt und diese<br />
nunmehr als spannende Geschichten ihrer Jugend abtaten.<br />
Die Früchte der Politik der scheinbaren Alternativlosigkeit und Sachzwänge sind heute<br />
allgegenwärtig: soziale Spaltung, Armutszunahme, prekäre Beschäftigungssituationen. Viele<br />
Menschen sind nicht mehr bereit, diese Zustände zu akzeptieren. Das bedeutet nicht, dass die<br />
Skepsis junger Menschen gegenüber Parteipolitik abgenommen hat, aber damit haben sich die<br />
Vorzeichen und Chancen für linke Politik geändert.<br />
226
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 02<br />
Wohin wir gehen<br />
Jungsozialistische Politik trägt die Überzeugung, dass der Kapitalismus überwunden werden<br />
muss, um ein freies und gleiches Leben für alle zu verwirklichen. Wir gehen davon aus, dass nur<br />
wenn Freiheit, Gleichheit und Solidarität erkämpft werden, eine menschliche Gesellschaft<br />
verwirklicht werden kann. Wir wissen, dass Freiheit, Gleichheit und Solidarität noch nicht<br />
erreicht sind, sondern der Kampf um sie die Aufgabe der sozialistischen Bewegung ist. Daran<br />
hat sich auch heute nichts geändert. Wir JungsozialistInnen und Jungsozialisten gehen davon<br />
aus, dass jeder Mensch für sich erstrebt, ein vollkommenes Leben zu führen. Unser Ziel bleibt<br />
der demokratische Sozialismus. Die Grundwerte waren der Maßstab, an dem sich<br />
SozialdemokratInnen als Teil der ArbeiterInnenbewegung gemessen haben. Sie sind die<br />
Grundlage für den politischen Erfolg, den die SPD als Partei immer wieder erzielen konnte.<br />
Wir Sozialistinnen und Sozialisten geben uns mit dem Erreichten nicht zufrieden. Wir wollen,<br />
dass es den Menschen besser geht. Daher streiten wir für eine Überwindung der Verhältnisse,<br />
in denen der Mensch ausgebeutet wird und die nach wie vor in historisch wandelbarer Gestalt<br />
fortbestehen.<br />
Den demokratischen Sozialismus zu erreichen, ist dauernde Aufgabe. Ihn exakt zu definieren,<br />
ist unmöglich. Es ist eine unmögliche Aufgabe und nicht wünschenswert, eine Vision bis ins<br />
kleinste Detail aus den heutigen Verhältnissen heraus zu beschreiben. Diese Verhältnisse<br />
werden nicht nur von uns heute geformt, sondern formen auch uns und unsere<br />
Vorstellungswelten. Für uns ist aber wichtig klar zu stellen, dass das derzeitige System ein<br />
System der Ungleichheiten ist und wir deshalb nach anderen Formen des Zusammenlebens<br />
suchen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Kritik am bestehenden System zu formulieren und<br />
aus dieser Kritik die Kraft zu schöpfen, für eine andere gesellschaftliche Verfasstheit zu<br />
kämpfen. Es hilft nicht, wenn ein „ArbeiterInnenführer“, eine „linke Elite“ oder eine<br />
„Avantgarde“ der Gesellschaft ein Modell aufzwingen will. Die Diskussion darüber, wie eine<br />
Gesellschaft anders aussehen kann, sehen wir als Teil unseres Kampfes. Ziel ist eine<br />
demokratische Verständigung über die Frage, wie eine andere Gesellschaft aussehen und<br />
organisiert werden kann. Die Vision ist nur durch Menschen und ihre Überzeugung<br />
verwirklichbar. Daraus ergibt sich jedoch auch, dass jetzt nicht feststeht, was am „Ende“ dieses<br />
Überwindungsprozesses kommt. Sozialismus ist also ein Ergebnis offener demokratischer<br />
Prozesse, die sich an unserem Bild vom Menschen und unseren Grundwerten orientieren.<br />
Mit diesem Papier wollen wir eine innerverbandliche Verständigung über jungsozialistische<br />
Politik erreichen und eine Standortbestimmung über jungsozialistische Politik vornehmen.<br />
227
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Kapitel II :: 40 Jahre „Linkswende“ der <strong>Jusos</strong> – Kontinuität im<br />
Wandel<br />
These 03<br />
Selbstverständnis der <strong>Jusos</strong><br />
Seit der auf dem Münchner Juso-Bundeskongress 1969 mit der demonstrativen Abwahl des<br />
damaligen Bundesvorsitzenden vollzogenen „Linkswende“ verstehen sich die<br />
Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD sowohl als eigenständige linke<br />
Jugendorganisation als auch als sozialistischer Richtungsverband in der SPD. Dieses doppelte<br />
Selbstverständnis prägt die <strong>Jusos</strong> trotz vielfältiger Brüche in den vergangenen Jahrzehnten<br />
auch heute noch.<br />
Trotz aller Differenzen zwischen den verschiedenen Strömungen des Verbandes eint die <strong>Jusos</strong><br />
seit der Linkswende die Überzeugung, dass der „demokratische Sozialismus“ des SPD-<br />
Grundsatzprogramms nur durch eine grundlegende Überwindung der kapitalistischen<br />
Gesellschaftsformation Wirklichkeit werden kann. Dabei gab es im Verband unterschiedliche<br />
Einschätzungen in der Analyse des realexistierenden Kapitalismus, in der Frage der Strategie<br />
antikapitalistischer Gesellschaftsveränderung und in der Bewertung der Rolle der<br />
Sozialdemokratie. Diese Differenzen wurden in äußerst heftigen Flügelkämpfen ausgetragen,<br />
ohne jedoch das gemeinsame sozialistische Selbstverständnis der <strong>Jusos</strong> in Frage zu stellen.<br />
These 04<br />
Die Linkswende und die <strong>Jusos</strong> in den 70er Jahren<br />
Ausgangspunkt der Linkswende der <strong>Jusos</strong> war das Wiederaufbrechen der kapitalistischen<br />
Krisenhaftigkeit in der BRD Mitte der sechziger Jahre, das den Glauben an die immerwährende<br />
Prosperität der „Wirtschaftswunder“-Jahre erschütterte. Im Zuge der antiautoritären<br />
Studierendenrevolte strömten massenhaft junge kritischer Studierende und SchülerInnen in<br />
die SPD. Die Reformeuphorie zu Beginn der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt wirkte<br />
als Katalysator für gesellschaftsverändernde Bestrebungen vor allem in der Jugend.<br />
Nach der vollzogenen Linkswende bildeten sich bei den <strong>Jusos</strong> Anfang der 70er Jahre<br />
unterschiedliche Flügel heraus. Während die „reformsozialistische“ Strömung (im Juso-Jargon<br />
„Refos“) sich die Überwindung des Kapitalismus durch schrittweise „systemüberwindende<br />
Reformen“ durch eine SPD-Regierung vorstellte, beharrten andere Teile der <strong>Jusos</strong> auf einer<br />
„Mindestschwelle der Vergesellschaftung der Produktionsmittel“, unterhalb dieser alle<br />
228
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Reformen der kapitalistischen Gesellschaftsform verhaftet bleiben und immer wieder in Frage<br />
gestellt werden würden.<br />
Unterschiedliche Auffassungen gab es in der Einschätzung des Strukturwandels der<br />
kapitalistischen Gesellschaft. Die im „Hannoveraner Kreis“ zusammengeschlossene Juso-Linke<br />
orientierte sich in ihrer Strategie an der vor allem aus Frankreich übernommenen Theorie des<br />
„staatsmonopolistischen Kapitalismus“ („Stamokap“), die davon ausging, dass sich der<br />
Kapitalismus durch die immer stärkere Konzentration und Zentralisation des Kapitals zu einem<br />
von einigen wenigen Monopolen beherrschten System entwickelt hätte, bei dem sich die<br />
Monopole den formal demokratisch organisierten Staatsapparat zunehmend unterordnen<br />
würden. Gegen diese Theorie wandte sich vor allem die Strömung der „AntirevisionistInnen“,<br />
die einen monopolistischen Strukturwandel der kapitalistischen Gesellschaft bestritten, da<br />
dieser durch die kapitalistische Konkurrenz immer wieder gesprengt werden würde. Aus<br />
diesem Grunde wurde auch die der Stamokap-Theorie immanente Strategie<br />
antimonopolistischer Bündnisse zwischen ArbeiterInnenklasse, nichtmonopolistischen<br />
Kapitalgruppen und kleinbürgerlichen Zwischenschichten verworfen.<br />
Unterschiedliche Auffassungen gab es schließlich in der Einschätzung der Rolle der SPD und in<br />
der Bedeutungszumessung der beiden Seiten der „Doppelstrategie“. Die ReformsozialistInnen<br />
stellten Parteiarbeit in der SPD und Arbeit in sozialen Bewegungen unvermittelt<br />
nebeneinander. Die „AntirevisionistInnen“ hielten die Politik der SPD für unaufhebbar<br />
reformistisch an die kapitalistische Gesellschaftsformation gebunden und sahen deshalb die<br />
zentrale Aufgabe der <strong>Jusos</strong> alleine in der Entfaltung autonomer Gegenmachtpositionen<br />
außerparlamentarischer Basisbewegungen. Die Juso-Linke betrachtete die „Doppelstrategie“<br />
als einen Hebel für die „prinzipiell lösbare Kampfaufgabe“, die SPD zu einer „wirklich<br />
sozialistischen“ Partei zu machen. Mit der Stärkung des in realen Klassenkämpfen wachsenden<br />
sozialistischen Bewusstseins in der ArbeiterInnenklasse würde sich dieses auch in der SPD, die<br />
man als „reformistische Arbeiterpartei“ ansah, durchsetzen.<br />
In den „Herforder Thesen“ zur Arbeit von Marxisten in der SPD von 1980 entwickelte die Juso-<br />
Linke die Theorie des „demokratischen Übergangs zum Sozialismus“, der sich durch das<br />
Bekenntnis zum Mehrparteiensystem, zur garantierten Meinungs- und Organisationsfreiheit<br />
vom Realsozialismus in der Sowjetunion, der DDR und den anderen Ländern in Mittel- und<br />
Osteuropa abhob. Der Untermauerung dieser Unterscheidung diente auch die bei den <strong>Jusos</strong> in<br />
den 80er Jahren verbreitete Rezeption des „Austromarxismus“ in der österreichischen<br />
Sozialdemokratie der Zwischenkriegsperiode.<br />
229
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 05<br />
Die <strong>Jusos</strong> in den 80ern<br />
In den 80er Jahren zeigten sich gesellschaftliche Veränderungen in der kapitalistischen<br />
Gesellschaft selbst: Der wirtschaftlicher Strukturwandel im Zuge der wissenschaftlichtechnologischen<br />
Entwicklungen, die Auflösung traditioneller ArbeiterInnenmilieus im Prozess<br />
der zunehmenden Individualisierung, die Entstehung neuer sozialer Bewegungen jenseits des<br />
unmittelbaren Konflikts zwischen Kapital und Arbeit, die Entstehung der Partei der Grünen.<br />
Diese Entwicklungen zerstörten alte Gewissheiten und führten wie in anderen Teilen der<br />
bundesdeutschen Linken auch bei den <strong>Jusos</strong> zu strategischen Neuausrichtungen. Diese<br />
bezogen sich unter anderem auf ein neues Verständnis des Verhältnisses Ökonomie und<br />
Ökologie, auf die „Zukunft der Arbeit“ (bei der sich Teile des Juso-Verbandes zu einem die<br />
Erwerbsarbeit relativierenden „Recht auf Faulheit“ bekannten) und vor allem – unter dem<br />
Begriffspaar „Sozialismus und Feminismus“ – auf eine neue Bewertung der<br />
Geschlechterverhältnisse für eine emanzipatorische Gesellschaftsveränderung.<br />
Mit der „jugendpolitischen Orientierung“ versuchten die <strong>Jusos</strong> in der zweiten Hälfte der 80er<br />
Jahre eine spezifische Antwort auf die zunehmende Individualisierung im Kapitalismus zu<br />
geben, in der auch ihre Rolle als Jugendverband wieder stärker in den Mittelpunkt der Aktivität<br />
gerückt werden sollte. Strategischer Ausgangspunkt war die Analyse einer im Zuge<br />
verlängerter Ausbildungszeiten sich herausbildenden eigenständigen Jugendphase im<br />
Kapitalismus. Die gewachsenen Lebensansprüche der Jugendlichen wurden als eine<br />
emanzipatorische Potenz begriffen, ihre Verteidigung gegen die kapitalistische Zurichtung als<br />
Hebel zur Gewinnung der Jugendlichen für sozialistische Politik.<br />
These 06<br />
Die <strong>Jusos</strong> in den 90ern<br />
Das Dilemma dieser emanzipatorisch gedachten Neuausrichtungen sozialistischer Strategie bei<br />
den <strong>Jusos</strong> war ihr zeitliches Zusammentreffen mit dem Zusammenbrechen der<br />
realexistierenden Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft im Jahre 1989. Trotz aller<br />
Distanzierung der <strong>Jusos</strong> vom Sozialismus-Modell in Osteuropa, waren auch die <strong>Jusos</strong> von<br />
dessen Zusammenbruch betroffen.<br />
Die Vorstellung einer möglichen grundsätzlichen Alternative zur kapitalistischen<br />
Gesellschaftsform schien insgesamt diskreditiert.<br />
230
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Was in der Juso-Strategiediskussion in der zweiten Hälfte der 80er Jahre als Modernisierung<br />
sozialistischer Politik gedacht war, geriet jetzt unbeabsichtigt zu einem Element der Defensive<br />
sozialistischer Vorstellungen. Schon die als Nachfolge-Projekt der Herforder Thesen gedachten<br />
„53 Thesen des Projekts Moderner Sozialismus“ von 1989 hatten in versuchter Aufhebung des<br />
„Gegensatzes von Reformismus und revolutionärem Sozialismus“ zur zentralen Aufgabe von<br />
SozialistInnen erklärt, sich aktiv reform-politisch „in die nächste Phase kapitalistischer<br />
Entwicklung einzuschreiben“. Nun geriet der Sozialismus in der Grundsatzerklärung der Juso-<br />
Linken von 1991 (in abgewandelter Form auch als Grundsatzerklärung des gesamtdeutschen<br />
Juso-Verbandes 1991 vom Potsdamer Bundeskongress beschlossen) gar zur Aufgabe, „in den<br />
ökonomischen, sozial-kulturellen und politischen Verhältnissen der bürgerlich-kapitalistischen<br />
Gesellschaft die Grundlagen für einen entwickelten Sozialismus so weit wie möglich<br />
auszubauen.“ In dieser Vorstellung verwischten sich die grundlegenden Unterschiede zwischen<br />
kapitalistischer und der sozialistischer Gesellschaft. Und die „jugend-politische Orientierung“<br />
der <strong>Jusos</strong> in den 80er Jahren verwandelte sich in den 90er Jahren mit der Konzeption der<br />
„Jugend-linken“ von einer auf die Gesellschaft gerichteten Strategie zu einem rein<br />
organisationspolitischen Ansatz eines Bündnisses von Jugendverbänden.<br />
These 07<br />
Die <strong>Jusos</strong> in den 2000ern<br />
Die Ende der 90er Jahre und Anfang dieses Jahrzehnts geführte neue Strategiediskussion bei<br />
den <strong>Jusos</strong> unter dem Titel „Neue Zeiten denken!“ versuchte schließlich aufbauend auf den<br />
Debatten von Anfang der 90er Jahre, die sich im Zuge der neuen Kommunikationstechnologien<br />
und der New Economy abermals verstärkende Individualisierung der Gesellschaft, die vor allem<br />
die Jugendgeneration prägt, in einem Ansatz aufzunehmen, in dem „Ansprüche auf eigene<br />
Leistungserbringung“ mit dem Wunsch nach solidarischen Gesellschaftsverhältnissen<br />
miteinander verbunden werden sollten. Damit war dieser Ansatz zugleich Widerspiegelung<br />
und Antwortversuch auf die im Umfeld von Gerhard Schröder für die Politik der rot-grünen<br />
Bundesregierung entwickelten Strategien der „neuen Sozialdemokratie“ mit ihrer Verbindung<br />
von „Innovation und Gerechtigkeit“. Ziel dieser Strategie war es, eine neue Koalition zwischen<br />
Gewinnern und Verlierern der aktuellen gesellschaftlichen und ökonomischen Umbrüche zu<br />
bilden, deren Grundgedanke der der Solidarität sein sollte. Der Begriff der „Leistung“ wurde zu<br />
einem positiv bewerteten Begriff, wobei seine kapitalistische Formbestimmtheit unhinterfragt<br />
blieb. Im sozialdemokratischen Diskurs rund um die Hartz-Gesetzgebung und das Prinzip des<br />
„Fördern und Fordern“ wurden jetzt auch soziale Ansprüche an die Erbringung von<br />
„Gegenleistungen“ der Menschen gebunden. Bei den <strong>Jusos</strong> wurde darüber hinaus über den<br />
Umgang mit veränderten Erwerbsbiographien diskutiert. Grundlage der Analyse war, dass sich<br />
Erwerbsleben verändert und die Menschen nicht mehr ihr ganzes Erwerbsleben im gleichen<br />
231
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Betrieb verbringen. Die Orientierung war dabei auf den Umbau des Sozialstaates gerichtet, um<br />
insbesondere Brüche in den Lebensläufen abzusichern.<br />
These 08<br />
Die <strong>Jusos</strong> heute<br />
Linke Ideen waren in den letzten Jahrzehnten in der Defensive. Mit Versuchen der Relativierung<br />
sozialistischer Positionen und der Anpassung an vermeintliche Sachzwänge hatte auch der<br />
Juso-Verband zu kämpfen. Umso bemerkenswerter ist es, dass trotz all dieser Schwierigkeiten<br />
die <strong>Jusos</strong> mehrheitlich links geblieben sind. Dass sich in den letzten Jahrzehnten sozialistische<br />
Grundvorstellungen der <strong>Jusos</strong> in Form einer die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse<br />
überwindenden Zielorientierung mehrheitlich erhalten haben, dann rührt das auch daraus,<br />
dass die Widersprüche kapitalistischer Logik und der auf ihre systemimmanente Gestaltung<br />
gerichteten Politik der SPD Menschen stets aufs Neue zu Widerstand in Form sozialer<br />
Bewegungen herausfordert. An diesen sozialen Bewegungen waren und sind die <strong>Jusos</strong> immer<br />
wieder beteiligt gewesen: Kampf gegen die Abschaffung des Asylrechts Anfang der 90er Jahre,<br />
Kampf gegen die Militarisierung deutscher Außenpolitik durch die Beteiligung der Bundeswehr<br />
an Auslandseinsätzen, globalisierungskritische Bewegung, Proteste gegen „Hartz IV“ und die<br />
„Agenda 2010“.<br />
Die „Doppelstrategie“ der <strong>Jusos</strong> bestätigt sich auf diese Weise als immer wieder aktualisierter<br />
Impuls, sich nicht mit den bestehenden Verhältnissen abfinden zu wollen, sondern diese zu<br />
verändern.<br />
Als <strong>Jusos</strong> haben wir heute mit Schwierigkeiten in der politischen Organisierung zu kämpfen.<br />
Viele junge Menschen engagieren sich nicht links. Dass sie nicht in der SPD aktiv werden, hat<br />
mit vielen Problemen der SPD zu tun. Gleichzeitig gilt es hierbei aber auch selbstkritisch mit der<br />
politischen Praxis unseres Verbandes zu sein. Ein vielfältiger Verband in der Mitgliedschaft ist<br />
anzustreben und dafür lohnt es zu kämpfen. Gleichzeitig stehen wir vor einem Dilemma: Die<br />
Bedeutungszunahme der sozialen Frage führt dazu, dass sich weniger junge Menschen<br />
politisch engagieren. Viele fühlen sich EinzelkämpferInnen um Praktika, Auslandskenntnisse,<br />
schnelle Abschlüsse etc. und sehen für sich nicht den Weg der kollektiven Organisierung.<br />
Gleichzeitig brauchen wir das Engagement von mehr jungen Menschen, um den Druck auf die<br />
Lebensbiographien durch politisches Handeln in Form von sozialstaatlichen Absicherungen<br />
entgegenwirken zu können.<br />
232
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die tatsächliche Veränderung der bestehenden Verhältnisse erfordert also stets aufs Neue eine<br />
zeitgemäße Analyse der kapitalistischen Gesellschaft und die Entwicklung einer diese<br />
Gesellschaft überwindenden politischen Strategie.<br />
Kapitel III :: Don’t fight the player, fight the game<br />
These 09<br />
Kapitalismus als Totalität<br />
Kapitalismus ist das dominante Strukturprinzip der Gesellschaft. Die ihm innewohnende Logik<br />
und Dynamik der Verwertung durchzieht alle Lebensbereiche und sozialen Beziehungen der<br />
Menschen untereinander.<br />
Diese Totalität des Kapitalismus determiniert auch seine Gegnerschaft. Weder kommunal<br />
verwaltete Schwimmbäder noch das besetzte Haus mit Volksküche untergraben die<br />
Strukturmerkmale der Verwertungslogik. Sie sind im besten Fall erkämpfte Rettungsringe der<br />
Vernunft im Meer der Unvernunft.<br />
Um die inneren Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise hinreichend darstellen zu<br />
können, müssen die strukturierenden Gegensätze näher betrachtet werden. Diese Gegensätze<br />
stellen sich nicht personifiziert dar, sondern müssen als Strukturelemente in ihrer Abstraktheit<br />
begriffen werden. Der Kapitalismus hat bewiesen, dass er sich immer wieder auf neue<br />
Bedingungen einstellen konnte und seine Strukturprinzipien mit neuem Gesicht erhalten<br />
konnte. Die jeweiligen Strukturen spiegeln sich in permanenten Auseinandersetzungen der<br />
AkteurInnen wieder. Die Rolle der AkteurInnen ist durch die historische Konstellation bestimmt<br />
und umgekehrt bestimmen die Auseinandersetzungen der AkteurInnen und die Ergebnisse<br />
dieser Prozesse die Strukturen immer wieder neu.<br />
Kapital und Arbeit als Antagonismus bedingen sich gegenseitig und lassen sich nicht<br />
hierarchisieren. Im Folgenden wird aber versucht, sie einzeln zu charakterisieren.<br />
These 10<br />
Das Kapital<br />
Triebkraft kapitalistischer Gesellschaft ist die Suche nach immer neuen<br />
233
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Verwertungsmöglichkeiten für das eingesetzte Kapital. Dies ist der entscheidende Unterschied<br />
zu nicht kapitalistisch strukturierten Gesellschaften: die Vermehrung des eingesetzten Kapitals<br />
ist das eigentliche Ziel der Produktion. Dabei bildet das Kapital keinen homogenen Block. Im<br />
Gegenteil: unterschiedliche Einzelkapitale stehen in Konkurrenz zueinander und treiben sich<br />
durch die Entwicklung immer neuer Produktionsweisen und Waren gegenseitig an.<br />
Durch Innovation bei Produkten und Produktionsweise ist es möglich, in der Konkurrenz zu<br />
bestehen und überdurchschnittlichen Profit zu erwirtschaften. Daher braucht es einen<br />
wachsenden Kapitalstock, um zumindest mit der durchschnittlichen Produktion mithalten zu<br />
können. Ein Ausbrechen aus dieser Logik bedeutet dabei den Verlust an eigenen<br />
Produktionsmöglichkeiten und damit des eigenen Kapitals. Der eigentliche und logisch<br />
notwendige Zweck der Produktion ist nicht die Bedürfnisbefriedigung, sondern die<br />
Vermehrung des eingesetzten Kapitals.<br />
Diese Entwicklungen geschehen im Kapitalismus weder starr noch linear. Denn die Konkurrenz<br />
der einzelnen Kapitale bringt nicht nur immer wieder Neues hervor, sie führt<br />
notwendigerweise auch zum Zusammenbruch einzelner Kapitalisten, Wirtschaftszweige oder<br />
ganzer Volkswirtschaften. Dies geschieht immer dann, wenn mit den eingesetzten Mitteln<br />
nicht der notwendige Profit erwirtschaftet werden kann und so das im Laufe der Zeit<br />
akkumulierte Kapital nicht mehr der Kapitallogik entsprechend eingesetzt wird. Dieses wird<br />
dann von anderen Kapitalen aufgesammelt und es kommt zu einer zunehmenden<br />
Konzentration der Produktionsmittel. Wenn dies in größerem Umfang geschieht kommt es zur<br />
Machtverschiebung innerhalb der Kapitalfraktionen.<br />
These 11<br />
Die Arbeit<br />
Arbeit besitzt einen Doppelcharakter. Zum einen ist sie lohnabhängige Erwerbsarbeit, die in<br />
Entfremdung und Ausbeutung Tauschwert schafft. Zum anderen ist sie Tätigkeit, die<br />
Gebrauchswerte schafft und durch welche sich die Menschen in produktiver Tätigkeit<br />
selbstverwirklichen können. Denn nur wenn erkannt wird, dass die spezifische Form der Arbeit<br />
im Kapitalismus – die Erwerbsarbeit – diejenige ist, über welche Ausbeutung, Fremdherrschaft<br />
und Last vermittelt wird, kann der Kampf für eine Humanisierung der Erwerbswelt<br />
aussichtsreich aufgenommen werden. Um das Notwendige zu produzieren, ist die Gesellschaft<br />
weiterhin auf Arbeit angewiesen.<br />
Nur durch Arbeit entsteht im Produktionsprozess mehr als die Summe der einzelnen Teile. Im<br />
234
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Kapitalismus nimmt die Arbeit die Form von Lohnarbeit an, durch die Mehrwert geschaffen<br />
werden kann. Gewinn fließt in der Regel nicht denjenigen zu, die ihre Arbeitskraft veräußern,<br />
sondern jenen, welche die Produktionsmittel zur Verfügung stellen.<br />
Arbeit ist Ausbeutung, denn im Kapitalismus haben die ArbeitnehmerInnen lediglich die<br />
formale Freiheit zu entscheiden, wem und zu welchem Preis sie ihre Arbeitskraft verkaufen.<br />
Tatsächlich aber sind sie dazu gezwungen sie zu verkaufen, da sie nicht im Besitz von<br />
Produktionsmitteln sind und nur durch Lohnarbeit ihren Lebensunterhalt sichern können. Im<br />
Kapitalismus haben die ArbeiterInnen die formale Freiheit zu entscheiden, wem und zu<br />
welchem Preis, sie ihre Arbeitskraft verkaufen, sind tatsächlich aber dazu gezwungen, sie zu<br />
verkaufen, da sie nicht im Besitz von Produktionsmittel sind und nur durch Lohnarbeit ihren<br />
Lebensunterhalt sichern können. Dabei treten sie zwangläufig in Konkurrenz um Arbeitsplätze.<br />
Dies ist ein weiteres strukturierendes Element des Kapitalismus.<br />
Über die Stellung innerhalb der Produktion wird jedem seine gesellschaftliche Stellung<br />
zugewiesen, aber auch die Selbstwahrnehmung definiert. Deshalb ist in der kapitalistischen<br />
Gesellschaft Erwerbsarbeit auch für den einzelnen Menschen und die Gestaltung seines Lebens<br />
zentrales Element. Dennoch baut auch der Kapitalismus darauf, dass unentgeldlich<br />
Reproduktionsarbeit geleistet wird, was meist für Frauen eine doppelte Vergesellschaftung<br />
bedeutet.<br />
Im Kapitalismus kommt es nicht auf die Befriedigung der Menschen an, sondern ausschließlich<br />
auf den Profit. Diese Logik breitet sich in allen Lebensbereichen aus. Die gesellschaftlichen<br />
Verhältnisse von Menschen werden zu Verhältnissen von Sachen, die alle dem Wertgesetz<br />
unterliegen. Das System der Lohnarbeit funktioniert nur, wenn die Menschen einerseits durch<br />
ihren Lohn ihre Arbeitskraft reproduzieren können und andererseits sie auch genug „Freizeit“<br />
haben, um ihre Arbeitskraft ausreichend regenerieren zu können. Diese Reproduktionsarbeit ist<br />
notwendige Bedingung für die Funktionsfähigkeit des Kapitalismus.<br />
Die ungleiche Verteilung der Produktionsmittel und der Zwang der Lohnabhängigen, ihre<br />
Arbeitskraft zu verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, ist die Grundlage dafür, dass<br />
der bei der Produktion entstehende Mehrwert nicht ihnen, sondern den<br />
KapitaleigentümerInnen zu Gute kommt. Mehrwert ist der Wert, den ArbeiterInnen durch ihre<br />
Arbeit in ein Produkt stecken und der über den Ersatz für die Arbeitskraft, d.h. den Lohn, und<br />
den Wert der eingesetzten Produktionsmittel hinausgeht. Der systemimmanente<br />
Innovationsdruck zwischen den Unternehmen sorgt dafür, dass die notwendige Arbeitszeit<br />
sinkt. Die Konkurrenz der ArbeiterInnen untereinander beeinflusst die Verteilungsverhältnisse<br />
zugunsten des Kapitals. So besteht die Tendenz dafür, dass der Mehrwert im Verhältnis zum<br />
235
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Lohn der ArbeiterInnen anwächst.<br />
Die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse ist dabei im Kapitalismus nicht festgelegt,<br />
sondern Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, um Bedingung und<br />
Organisation von Arbeit, um die Frage nach Entlohnung und darum, was an Qualifikation und<br />
Reproduktionsarbeit notwendig ist, um die eigene Arbeitskraft herzustellen und zu erhalten.<br />
Zur Arbeit gehört auch der Erhalt der eigenen Arbeitskraft.<br />
Der Erwerbsarbeit kommt dabei in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung für das Selbstund<br />
Fremdbild zu. Vielfach werden gesellschaftlich notwendige Arbeiten, wie Pflege,<br />
Kindererziehung und ehrenamtliches Engagement weder materiell noch immateriell<br />
ausreichend gewürdigt.<br />
These 12<br />
Der Traum vom neutralen Staat<br />
„[I]mmer übersetzt der Staat den objektiven Zwangscharakter der gesellschaftlichen<br />
Reproduktion in politische Form. In Zeiten von Krise und sozialer Unruhe tritt dies krude und<br />
unverbrämt zu Tage; es zeigt sich darüber hinaus in den Präventivstrategien, die darauf<br />
gerichtet sind, die Krise einzudämmen oder besser zu verwalten. Aber es gilt auch für den<br />
‚Normallfall’ einer friedlichen und befriedeten Reproduktion, die innerhalb und vermittels der<br />
Institutionen vor sich geht.“ (Johannes Agnoli)<br />
Im Staat verdichten sich die Kräfteverhältnisse der Klassen, das macht ihn zum Austragungsort<br />
für Kämpfe der widerstreitenden Interessen. „Den“ Staat gibt es nicht. Staatlichkeit ist jeweils<br />
das Produkt der bestehenden gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse. Staat und<br />
gesellschaftliche Verhältnisse zwischen Klassen und Gruppen beeinflussen sich gegenseitig:<br />
Über- und Unterordnung spiegeln sich in den Institutionen und Apparaten des Staates wider,<br />
der Staat selbst nimmt durch seine vielfältigen Handlungsformen Einfluss auf das Gefüge der<br />
Produktions- und Klassenverhältnisse.<br />
Kapitalismus braucht keinen bürgerlichen Rechtsstaat, er kann aber nützlich sein. Demzufolge<br />
ist der Staat nicht nur Rechtsstaat, der einen formalen Rahmen setzt und die Einhaltung dieses<br />
Rahmens durch sein Gewaltmonopol absichert. Im Kapitalismus sind dem Staat bestimmte<br />
Aufgaben zugewiesen.<br />
Staatsbildung und die Existenz von Nationen waren und sind Voraussetzung für die<br />
236
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Funktionsfähigkeit des Kapitalismus. Eine grundlegende Funktion des Staates ist die Sicherung<br />
der Verwertungsbedingungen des Kapitals. Dies geschieht durch ökonomische Tätigkeiten,<br />
Gesetze und das Gewaltmonopol. Auch in der gegenwärtigen Phase ökonomischer<br />
Globalisierung sichert der Staat die neoliberalen Interessen institutionell und ideologisch ab<br />
('innere Sicherheit', Standortfaktoren, 'Festung Europa', Agenda 2010, etc.). Er ist Garant der<br />
materiellen Voraussetzungen der Kapitalakkumulation. Ob Bildung, Infrastruktur oder die<br />
Durchsetzung nationaler Interessen mittels Kriegen, der Staat erfüllt die ihm zugedachte<br />
Funktion als Dienstleister des Kapitals. Er kann auch gar nicht anders. Durch die strukturelle<br />
Abhängigkeit von ökonomischer Prosperität durch die Steuereinnahmen ist es schlichter<br />
Eigennutz, die ökonomische Verfasstheit strukturell gewalttätig und notfalls militärisch<br />
abzusichern.<br />
Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Hier und Jetzt durchaus<br />
Akzentverschiebungen möglich sind. Zu den Basisaufgaben bürgerlicher Rechtsstaaten gehört<br />
der Soziale Frieden ebenso wie die Autobahnzufahrt zum Industriegebiet.<br />
Der Staat ist nicht einfach das Instrument der herrschenden Klasse, die ihrerseits von<br />
Konflikten um die Vorherrschaft geprägt ist, sondern stellt ein Terrain von<br />
Auseinandersetzungen dar. Noch immer ist Staatlichkeit für gesellschaftliche Gestaltung im<br />
kapitalistischen System entscheidend. Wer für eine fortschrittliche Politik kämpft, muss<br />
offensiv in die Auseinandersetzung um die Rolle und die Aufgaben des Staates gehen. Für <strong>Jusos</strong><br />
ist die Bedeutung des Staates daher stets ambivalent.<br />
These 13<br />
Kapitalismus und andere Ungleichheiten<br />
Neben dem Kapitalismus gibt es noch weitere Strukturen, die verhindern, dass Menschen in<br />
dieser Gesellschaft frei und gleich miteinander leben. Patriarchale Strukturen führen dazu, dass<br />
es noch immer ungleiche Verhältnisse zwischen Frauen und Männern gibt. Rassistische und<br />
antisemitische Diskriminierung sind Realität in diesem Land.<br />
Nicht richtig ist es davon auszugehen, dass es sich hier um Wirkmechanismen handelt, die<br />
losgelöst nebeneinander stehen. Die Zuordnung der unbezahlten Reproduktionsarbeit an<br />
Frauen hat einen entscheidenden Anteil an der Stabilität der kapitalistischen Ordnung gehabt.<br />
Rassistische Ideologien wurden benötigt, um imperialistische Kriege gegen andere Länder zu<br />
führen.<br />
Deshalb ist es nötig, nicht nur gegen den Kapitalismus, sondern auch gegen weitere<br />
Ungleichheiten wie Rassismus und Patriarchat zu kämpfen. Entscheidend ist zu verstehen, wie<br />
sich Kapitalismus aktuell, wie sich ein Mechanismus wie das Patriarchat darstellt und in<br />
237
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
welchem Verhältnis sie gegenwärtig zueinander stehen.<br />
Kapitel IV :: Politischer Kampf<br />
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt drauf an, sie zu<br />
verändern.“<br />
(Karl Marx)<br />
These 14<br />
Es hat keinen Sinn zu warten, bis es besser ist<br />
Die Analyse der gesellschaftlichen und ökonomischen Verfasstheit muss schonungslos sein.<br />
Niemandem ist geholfen, wenn unter falschen oder verkürzten Grundannahmen Hoffnungen<br />
auf grundsätzliche Überwindung des Bestehenden geweckt werden.<br />
Im selben Rhythmus mit den zyklischen Krisen des Kapitalismus wird gerade aus Teilen der<br />
Sozialdemokratie regelmäßig entweder der Moral der UnternehmerInnen, vergangener<br />
Prosperitätskonstellationen oder der Gestaltungskompetenz der Politik gedacht. Wenn<br />
dahinter mehr steckt als ein taktisches Argument im aktuellen Diskurs, bricht sich das Ur-<br />
Dilemma der Sozialdemokratie Bahn: Das Denken und Handeln in der oben beschriebenen<br />
Totalität, verbunden mit der Sehnsucht nach Vernunft und Gerechtigkeit.<br />
Als <strong>Jusos</strong> müssen wir die Beschränktheit unseres Handlungsrahmens kennen, um erfolgreich zu<br />
sein. Nur wer weiß, welche Kämpfe man im Bestehenden mit den politischen Mitteln<br />
gewinnen kann, ist vor der Kapitulation in Anbetracht der Wirklichkeit gefeit.<br />
Nur wer versteht, nach welchen Gesetzen der Kapitalismus funktioniert, kann im Hier und Jetzt<br />
für Gestaltungsperspektiven, Reformen und soziale Standards kämpfen. Gleichzeitig wissen<br />
wir, dass dieses System von Menschen gemacht und somit auch von Menschen wieder<br />
überwunden werden kann. Der Behauptung der Alternativlosigkeit dieser<br />
Gesellschaftsordnung werden wir deshalb auf jeder Ebene entgegentreten.<br />
Das ist anstrengend.<br />
Es setzt voraus, dass wir in der Lage sind, neben Schule/Uni/Job, Familie, FreundInnen und dem<br />
Spaß des Lebens und nicht zuletzt neben dem Sog der Partei in Ämter und dem Kleinklein der<br />
Tagespolitik, die Kritik am Grundsätzlichen nicht aufzugeben, den Austausch zu suchen mit<br />
238
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
gesellschaftlichen BündnispartnerInnen und Scheuklappen abzulegen, die gerne den Blick<br />
verstellen.<br />
Aber es lohnt sich, da die Wirklichkeit in all ihrer Unvernunft Menschen braucht, die sich nicht<br />
nur auf die Ebene der Kritik zurückziehen, sondern gegen die alltäglichen Zustände das<br />
solidarische Prinzip setzen und sich nicht zu fein sind, auf allen Ebenen den zähen Kampf um<br />
Akzentverschiebungen zu führen.<br />
These 15<br />
Die SPD<br />
Mit dem Hamburger Programm hat die SPD sich zum demokratischen Sozialismus bekannt. Die<br />
SPD ist derzeit keine sozialistische Partei.<br />
Ohne die SPD wird es jedoch keine progressive Politik in diesem Land geben.Deshalb<br />
engagieren wir uns in der SPD und sind ein Teil von ihr. Wir kämpfen als Jungsozialistinnen und<br />
Jungsozialisten in und um die SPD. Das heißt auch, für progressive Mehrheiten innerhalb der<br />
SPD zu werben.<br />
Dazu gehört aber auch, dass wir offensiv dafür kämpfen, viele andere linke Kräfte von der<br />
Notwendigkeit eines sozialistischen Engagements in der SPD zu überzeugen. Gemeinsam mit<br />
progressiven Kräften wollen wir für unsere Positionen innerhalb der SPD kämpfen.<br />
These 16<br />
Die SPD aktuell<br />
Mit dem Hamburger Programm hast sich die SPD zum demokratischen Sozialismus bekannt. In<br />
den Regierungsjahren ist die SPD einen Weg gegangen, der dem neoliberalen Mainstream in<br />
gefolgt ist.<br />
Der Versuch, über die Konstruktion einer neuen Mitte und eines aktivierenden Sozialstaats eine<br />
Politik zu etablieren, die mit scheinbar traditionellen Werten und Instrumenten<br />
sozialdemokratischer Politik aufräumte und an ihre Stelle scheinbar Modernes setzte, ist in<br />
mehrfacher Hinsicht gescheitert.<br />
Letzten Endes hat sich Rot-Grün der eigenen Basis beraubt, in dem die konkrete<br />
Regierungspolitik diese Basis negierte. Die Grundannahme, die zu dieser Fehleinschätzung der<br />
tatsächlichen gesellschaftlichen Gegebenheiten führte, lag in der Vorstellung, die alte<br />
Klassengesellschaft habe sich überlebt. Die sozialen Gegensätze wurden stattdessen als<br />
239
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Ergebnis unterschiedlicher Leistungsbereitschaft interpretiert. Folgerichtig bestand die<br />
politische Aufgabe darin, Arbeitslose zu „aktivieren“ und, wenn es sein musste, eben auch<br />
durch Sanktionen zur Aufnahme niedrig entlohnter und unsicherer Arbeit zu animieren.<br />
Dadurch hat sich das Verhältnis zu unseren traditionellen BündnispartnerInnen, wie den<br />
Gewerkschaften, enorm verschlechtert. Neue fortschrittliche BündnispartnerInnen wurden mit<br />
der Politik der „Neuen Mitte“ nicht gewonnen. Inhaltlich ist diese Politik offensichtlich<br />
gescheitert. Eine Zunahme sozialer Spaltung, fehlende soziale Aufstiegsmöglichkeiten und eine<br />
unwürdige Behandlung für jene, die in eine soziale Notlage gerutscht sind, sind Entwicklungen,<br />
die am Ende langjähriger SPD-Regierungsbeteiligung stehen.<br />
Innerparteilich hat dieser Weg die Partei zerrissen. Austritte, Frustration, Enttäuschung und der<br />
Verlust der Überzeugung, in dieser Partei Entscheidungen beeinflussen zu können, waren die<br />
Folge. Hinzukam eine Entfremdung zwischen FunktionärInnen und Basis. Gesellschaftlich hat<br />
die SPD in diesen Jahren an Zustimmung eingebüßt. Schlechte Wahlergebnisse und das<br />
massive Sinken der Mitgliederzahl sind Ausdruck dessen. Das Scheitern von Rot-Grün ist damit<br />
auch das Scheitern derjenigen, die linke Theorie- und Strategiebildung bloß als unnützen<br />
Ballast herabgewürdigt haben und sich stattdessen in postmoderner Beliebigkeit ergingen.<br />
Dies heißt konkret und auch mit Blick auf die letzten Jahre sozialdemokratischer<br />
Regierungspolitik: Ja, die Eigenverantwortung des/der Einzelnen ist eine wichtige Säule der<br />
Solidarität und auch der Würde. Aber: Bedingung jeder Forderung nach Eigenverantwortung ist<br />
konsequenterweise, dass der solidarische Staat die Voraussetzungen für eigenverantwortliches<br />
Handeln des Einzelnen schafft. Geschieht dies nicht, verletzt der Staat seine Fürsorgepflicht.<br />
Außerdem: Der Markt macht nicht jede/jeden zum Gewinner, nicht jede gesellschaftlich<br />
wertvolle Tätigkeit wird von ihm nachgefragt. Marktverlierer/innen dürfen für ihre Lage nicht<br />
individuell schuldig gemacht werden, denn ihre Situation ist Folge des Marktversagens. Soziale<br />
Leistungen können deshalb niemals ausschließlich an erbrachte Leistungen der<br />
Empfänger/innen gekoppelt werden! Für uns darf ferner soziale Gerechtigkeit nicht in den<br />
Gegensatz zu sozialer Gleichheit gestellt werden. Die Politik der Senkung staatlicher<br />
Einnahmen vor allem auf Kosten sozialer Leistungen lehnen wir deshalb ab.<br />
Im Zuge der Globalisierung entwickelte sich ein Diskurs um Dritte Wege der Sozialdemokratie,<br />
der versuchte, sozialdemokratische Ziele unter den neuen Bedingungen – globalisierten<br />
Märkten – zu verwirklichen. Wir wissen: Das Suchen neuer Wege sozialdemokratischer Politik<br />
ist immer wieder notwendig. Doch ist aus unserer Sicht entscheidend, dass Veränderungen nie<br />
die drei Grundwerte- die Zieldimensionen -, sondern immer die Instrumente unserer Politik –<br />
die Wege -, betreffen dürfen.<br />
240
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
All jenes hat in der SPD dazu geführt, dass sich zwei Seiten gegenüber stehen: Jene, die ein<br />
„Weiter So“ wollen und jene, die nach einer neuen Politik für soziale Gerechtigkeit suchen.<br />
Dieser Richtungsstreit ist für die Zukunft der Sozialdemokratie entscheidend.<br />
Wir glauben, dass diese Grundsätze in regulierten Märkten auf breite gesellschaftliche<br />
Akzeptanz stoßen. Sie haben uns 1998 zur Regierungsverantwortung gebracht. In den<br />
folgenden Jahren wurde in der SPD jedoch versäumt, eine nachhaltige Diskussion über Wege<br />
und Ziele der sozialdemokratischen Politik – ein neues Grundsatzprogramm – zu erarbeiten.<br />
Die SPD hat mit dem Hamburger Grundsatzprogramm aus dem Jahr 2007 den langen Weg der<br />
Programmdiskussion endlich erfolgreich abgeschlossen. Diesem Programm in den kommenden<br />
Jahren auch Leben einzuhauchen und es in einzelnen Politikfeldern durch zu deklinieren, dazu<br />
wollen wir <strong>Jusos</strong> stets mahnen.<br />
Unsere Linie ist dabei klar: Der SPD muss es gelingen, Antworten auf die Frage zu formulieren,<br />
wie im derzeitigen Entwicklungszustand der Gesellschaft soziale Gerechtigkeit und individuelle<br />
Freiheit verwirklicht und diese konsequent umgesetzt werden können.<br />
Wir sehen es als jungsozialistische Aufgabe an, die Diskussion um die richtigen Antworten auf<br />
allen Ebenen anzufachen und mitzuführen. Es notwendig, hier Druck auf die Partei mit<br />
gezielten Kampagnen und Aktionen aufzubauen. Der politische Streit um die besten Konzepte<br />
in unserer Partei ist dabei ein notweniger Motor, um die Partei weiter zu entwickeln.<br />
Kontroversen beleben die Partei und schwächen sie nicht. Ein Unterdrücken von Debatten<br />
führt im Gegenteil dazu, dass sich Genossinnen und Genossen frustriert zurückziehen. Das darf<br />
es nicht geben. Letzten Endes muss die SPD als linke Volkspartei hier Konzepte vorlegen, die<br />
sich auch in der Regierungspraxis widerspiegeln. Deshalb wissen wir, dass internationalistische<br />
Zusammenarbeit mit SozialistInnen und SozialdemokratInnen aus anderen Ländern unbedingt<br />
ein stärkeres Gewicht bekommen muss, um sozialdemokratische Politik auf den Ebenen zu<br />
verwirklichen, wo sie die stärkste Durchschlagkraft besitzt.<br />
These 17<br />
Die SPD und Parteiensystem<br />
Das deutsche Parteiensystem ist in Bewegung gekommen. Während lange Zeit die<br />
Orientierung auf einer Zwei-Parteien-Koalition lag, erscheint dies zunehmend aussichtslos. Es<br />
besteht allerdings weiterhin die Gefahr einer schwarz-gelben Mehrheit, solange es die SPD<br />
nicht schafft, sich bei Wahlen kontinuierlich über 30% festzusetzen.<br />
Unser Ziel ist es, eine linke Politik mehrheitsfähig zu machen. Dabei können die Entwicklungen<br />
der letzten Jahre nicht unberücksichtigt bleiben. Die Grünen als langjährige Verbündete der<br />
241
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
SPD haben sich zunehmend zu einer bürgerlichen und wirtschaftsliberalen Milieupartei<br />
gewandelt. Wir müssen in Zukunft genau darauf achten, inwieweit wir mit ihnen progressive<br />
Politik real umsetzen können. Die CDU/CSU steht in den meisten Politikfeldern, wie der<br />
sozialen Gerechtigkeit, Innenpolitik oder Antifaschismus, unseren Vorstellungen diametral<br />
entgegen. Eine linke Politik ist mit ihr nicht durchsetzbar. Gleiches gilt für die derzeitige FDP.<br />
Einzige Ausnahme bei einer Zusammenarbeit mit der FDP könnte der Bereich der<br />
BürgerInnenrechte sein, in dem es durchaus Schnittstellen gibt.<br />
Neu im parlamentarischen System der Bundesrepublik ist die Linkspartei. Dies hängt zum<br />
einen mit der besonderen Situation nach der Wende zusammen. Die PDS erfüllte hier eine<br />
besondere Funktion, insbesondere im Osten der Republik. Zum anderen hat die Politik der SPD<br />
unter Schröder und in der Großen Koalition dazu beigetragen, dass sich die Linkspartei<br />
mittlerweile auch im Westen etablieren konnte. Hinzukam der Umgang mit der PDS und der<br />
WASG, der sich durch Scheuklappen und Abschottung auszeichnete und sich so der<br />
inhaltlichen Auseinandersetzung verwehrte. Die Agenda 2010-SPD sorgte durch die konkreten<br />
Auswirkungen ihrer Politik für eine beschleunigte Auflösung bereits angegriffener<br />
Parteibindungen. Eine weitere Auswirkung sozialdemokratischer Regierungspolitik der letzten<br />
Jahre ist der Verlust der Glaubwürdigkeit in vormals sozialdemokratischen Milieus.<br />
Die SPD der Agenda 2010 hat auf der linken Seite des politischen Spektrums viel Platz gelassen,<br />
so dass sich im bundesdeutschen Parteiensystem die Linkspartei entfalten konnte.<br />
Faktisch müssen wir in der mittelfristigen Perspektive mit einem Fünf-Parteien-System<br />
umgehen. Ziel innerhalb dieser Neukonstellation muss es natürlich sein, für eine stärkere SPD<br />
zu kämpfen, aber auch, ein linkes Zukunftsprojekt zu entwerfen und für dessen konkrete<br />
Umsetzung zu kämpfen. Dazu werden wir sowohl mit den noch vorhandenen progressiven<br />
Kräften der Grünen als auch mit denen der Linkspartei eine inhaltliche Auseinandersetzung<br />
beginnen und ausloten, ob diese Parteien für ein solches Projekt bereit sind.<br />
These 18<br />
Gewerkschaften<br />
Die kapitalistische Gesellschaft prägt der Widerspruch von Kapital und Arbeit. Wir stellen uns<br />
als JungsozialistInnen in den durch diesen Widerspruch produzierten Konflikt klar auf die Seite<br />
derjenigen, die darauf angewiesen sind, als Lohnabhängige ihre Arbeitskraft verkaufen zu<br />
müssen. Die Gewerkschaften als Interessensorganisation der Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmer sind damit unser natürlicher BündnispartnerInnen. Eine politische Strategie von<br />
links kann nicht an den Gewerkschaften vorbei definiert werden. Gesellschaftliche<br />
242
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Veränderung kann es nur im Zusammenspiel von Sozialdemokratie und Gewerkschaften<br />
geben.<br />
Allerdings stehen auch die Gewerkschaften vor schwierigen Herausforderungen. Der<br />
zunehmenden Internationalisierung des Kapitals muss eine Internationalisierung der Politik<br />
entgegengesetzt werden. Dies schließt eine konsequente Internationalisierung der<br />
Interessensvertretung von ArbeitnehmerInnen ein. Hier entsteht für jungsozialistische Politik<br />
eine große Chance. Die Chance besteht darin, dass wir die nationalstaatlichen Hemmnisse von<br />
Politik, die in der Vergangenheit auch innerhalb der ArbeiterInnenbewegung immer wieder zu<br />
reaktionären Entwicklungen geführt haben, endlich auflösen können.<br />
Wirkliche internationale Kooperation findet bei Gewerkschaften derzeit nur in seltenen Fällen<br />
statt. Gerade im Zuge von Standortverlagerungen mit der zeitgleichen Verlagerung von<br />
Arbeitsplätzen ist ein nachvollziehbares nationalstaatliches bzw. standortbezogenes Denken<br />
festzustellen. Dies wird eine schwierige Aufgabe. Es führt aber an einem dauernden Versuch<br />
kein Weg vorbei, wenn wir unsere Ideale auch in praktische Politik umsetzen möchten. Deshalb<br />
werden wir uns in Zukunft vehement dafür einsetzen, an einer Internationalisierung der<br />
ArbeiterInnenbewegung zu arbeiten. Wir wollen mehr als einen reinen „Struktur-<br />
Internationalismus“. Wir wollen einen „Internationalismus der Praxis“ entwickeln. Weg von<br />
standortnationalistischen Argumentationsmustern hin zu einer Politik für alle Menschen<br />
unabhängig von Wohnort, Herkunft, Hautfarbe.<br />
Eine immer größer werdende Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern organisiert sich<br />
nicht mehr gewerkschaftlich. Dies betrifft zum einen Prekär Beschäftigte: Sie sind in vielen<br />
Fällen nicht oder nur unwirksam an der betrieblichen Mitbestimmung beteiligt. Eine<br />
gewerkschaftliche Organisierung wird darüber hinaus von vielen ArbeitgeberInnen gezielt<br />
verhindert. Außerdem fühlen sich viele Arbeitslose von den Gewerkschaften nicht angemessen<br />
repräsentiert. Des Weiteren organisieren sich zunehmend starke Berufsgruppen in<br />
Spartengewerkschaften und entziehen sich damit dem solidarischen Arbeitskampf. Der Grund<br />
für diese Entwicklung liegt zum einen in der Veränderung der Arbeitsgesellschaft mit dem<br />
Trend zu atypischen und prekären Arbeitsverhältnissen selbst. Zum anderen aber haben es die<br />
Gewerkschaften in einigen Bereichen auch versäumt, die Interessen der ‚atypisch‘<br />
Beschäftigten oder eben Nicht-Beschäftigten angemessen in ihre strategische Ausrichtung<br />
aufzunehmen. Deutlich ist aber auch, dass es auf der anderen Seite auch Positiv-Beispiele gibt<br />
und der Trend der abnehmenden Mitgliederzahlen gestoppt und sogar ins Gegenteil<br />
umgekehrt werden konnte. Klar ist aber, dass die Gewerkschaften nur dann stark sein können,<br />
wenn sie alle oder zumindest den überwiegenden Teil der Beschäftigten organisieren können.<br />
Wollen die Gewerkschaften weiterhin ein bedeutender gesellschaftlicher Akteur bleiben,<br />
243
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
müssen Antworten auf die Fragen einer besseren politischen und gewerkschaftlichen<br />
Interessenvertretung von prekär Beschäftigten, neuen Berufsgruppen und Arbeitslosen und<br />
auch auf die Herausforderung der internationalen Organisierung gefunden werden.<br />
Gleichzeitig gilt es auch, die Stellung der Gewerkschaften bei der Mitbestimmung und in den<br />
Tarifverhandlungen zu stärken. Wir sehen unsere Aufgaben darin, im Schulterschluss mit den<br />
Gewerkschaften für unsere gemeinsamen Forderungen zu kämpfen und gleichzeitig die<br />
inhaltliche Diskussion über eine zeitgemäße ArbeitnehmerInnen-Organisierung zwischen<br />
<strong>Jusos</strong>, der SPD und den Gewerkschaften in kritischer Solidarität zu führen.<br />
These 19<br />
Soziale Bewegungen<br />
Die Protestformen und die Herangehensweise an politisches Engagement haben sich mit der<br />
studentischen Bewegung von 1968 massiv verändert und erweitert. Die in den Jahrzehnten<br />
nach 1968 entstandenen „Neuen sozialen Bewegungen“ prägen mittlerweile das politische<br />
Geschehen in Deutschland mit.<br />
Das Spektrum politischer Beteiligung ist breiter geworden, und es ist regional sehr<br />
unterschiedlich. Dies ist Ausdruck veränderter Klassenlagen, die sich heute komplexer<br />
darstellen als noch zu Hochzeiten des Fordismus. Die IndustriearbeiterInnenschaft als Kern der<br />
ArbeiterInnenklasse dominiert nicht mehr alleine linkes politisches Engagement. Ein Großteil<br />
der sozialen Bewegungen verfolgen meist nur Teilziele und definieren sich als Ein-Punkt-<br />
Bewegungen (Umwelt-, Friedens- oder Frauenbewegung). Sie können so wesentlich<br />
kampagnen- und ergebnisorientierter Plattformen für gesellschaftliche Beteiligung als<br />
Organisationen wie politische Parteien und auch wir <strong>Jusos</strong> bieten. Wir wollen darum kämpfen,<br />
dass wir wieder Ansprech- und BündnispartnerIn für die AkteurInnen sozialer Bewegungen<br />
werden.<br />
Allerdings sehen wir in der Fokussierung auf nur wenige politische Teilbereiche nicht die<br />
Antwort auf differenziertere Gesellschaften der Gegenwart. Nur wer einzelne Politikbereiche in<br />
gesellschaftliche Zusammenhänge stellt, wird am Ende eine gesamtgesellschaftliche<br />
Perspektive entwickeln können. Nichtsdestotrotz sehen wir auch viele positive Ansatzpunkte<br />
bei den „Neuen sozialen Bewegungen“ und wollen mit ihnen gemeinsam und solidarisch für<br />
unsere Ziele eintreten.<br />
Einerseits bieten sie enormes Know-How auf den Politikfeldern, für die sie sich einsetzen.<br />
Andererseits können wir von ihnen und ihren Aktionsformen und Vorschlägen lernen. Ziel von<br />
uns <strong>Jusos</strong> muss es deshalb sein, in diesen sozialen Bewegungen für eine<br />
244
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
gesamtgesellschaftliche Emanzipation zu kämpfen und deutlich zu machen, dass mit dem<br />
Erreichen von Teilzielen nicht alle gesellschaftlichen Probleme gelöst sind.<br />
Doch nicht jede soziale Bewegung ist per se emanzipatorisch und progressiv. Zum einen<br />
gerieren sich auch reaktionäre Kräfte immer wieder als soziale Bewegungen. Diese müssen wir<br />
aktiv bekämpfen. Zum anderen gibt es soziale Bewegungen, die ein progressives Anliegen<br />
haben, aber in denen reaktionäre Strömungen mitwirken. Nicht selten gleitet z. B. eine<br />
verkürzte Kapitalismuskritik in Antiamerikanismus, Antisemitismus und Nationalismus ab.<br />
Unsere Aufgabe kann es daher niemals sein, Zusammenarbeit mit außerparlamentarischen<br />
Bewegungen nur um der Zusammenarbeit Willen zu suchen. Wir müssen genau prüfen, ob wir<br />
die Kernanliegen dieser Bewegungen mit unseren Idealen vereinbaren können. Es geht darum,<br />
innerhalb der Bewegung für progressive Ansätze und gegen reaktionäre<br />
Argumentationsmuster zu streiten. Das wollen wir in Zukunft offensiv und selbstbewusst tun.<br />
These 20<br />
Die Doppelstrategie<br />
Die Doppelstrategie bleibt zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Das bedeutet für<br />
uns, dass wir uns neben der Parteiarbeit auch in sozialen Bewegungen verankern wollen. Wir<br />
wollen beides miteinander verbinden und zu einem Politikansatz emanzipatorischer<br />
Gesellschaftsveränderung zusammenfügen.<br />
In den letzten Jahren haben sich <strong>Jusos</strong> die Verankerung in den sozialen Bewegungen<br />
vernachlässigt und uns sehr stark auf die Partei fokussiert. Wir haben bei unserem verstärkten<br />
Engagement in der SPD erfahren, dass dieses nicht ausreicht, wenn wir konkret Politik<br />
umsetzen und bestimmen möchten. Es muss deshalb in Zukunft darum gehen,<br />
BündnispartnerInnen im außerparlamentarischen Raum zu suchen und uns in den sozialen<br />
Bewegungen wieder stärker zu verankern.<br />
Dies bedeutet, den inhaltlichen Austausch mit uns nahe stehenden Gruppen zu suchen, in<br />
Bündnissen mitzuarbeiten, verlässlicher Ansprechpartner sein, aber eben auch deutlich und<br />
selbstbewusst für unsere politischen Überzeugungen einzutreten.<br />
Innerhalb der Partei müssen wir deutlich machen, dass wir gegebenenfalls nicht nur<br />
Forderungen als <strong>Jusos</strong> stellen, sondern hinter diesen Forderungen gesellschaftliche Kräfte<br />
stehen. Verlässlich zu sein, heißt auch, gemeinsame Forderungen der Bewegung zu vertreten,<br />
auch wenn wir damit auf innerparteiliche Schwierigkeiten stoßen.<br />
Gerade im Falle von Repression gegen linke Bewegungen haben wir als <strong>Jusos</strong> eine besondere<br />
Verantwortung. Dabei gilt das Prinzip der Solidarität innerhalb der gesellschaftlichen Linken.<br />
245
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Als <strong>Jusos</strong> müssen wir darum kämpfen, dass die SPD den realen Bezug zu den sozialen<br />
Bewegungen wiederherstellt. Es ist auch unsere Aufgabe, beide Seiten wieder in Kontakt<br />
miteinander zu bringen.<br />
Kapitel V :: Gegenwärtige Entwicklungen des Kapitalismus<br />
„Die proletarische Klasse führt ihren Kampf nicht nach einem fertigen, in einem Buch, in einer<br />
Theorie niedergelegten Schema. Der moderne Arbeitskampf ist ein Stück Geschichte, ein Stück<br />
sozialer Entwicklung. Und mitten in der Geschichte, mitten im Kampf lernen wir, wie wir<br />
kämpfen müssen...Das erste Wort der politischen Kämpfer ist, mit der Entwicklung der Zeit zu<br />
gehen und sich jederzeit Rechenschaft abzulegen über die Veränderung in der Welt wie auch<br />
über die Veränderung unserer Kampfstrategie.“ (Rosa Luxemburg)<br />
These 21<br />
Relevante Phänomene<br />
Kapitalismus ist ein dynamisches System. Es verläuft niemals linear oder starr. Es wandelt sich<br />
ständig. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, bestimmte Phänomene gegenwärtiger<br />
Entwicklung zu untersuchen und zu fragen, welche politischen Antworten dies erfordert.<br />
Globalisierung, soziale Polarisierung und eine veränderte Arbeitswelt bestimmen aktuell das<br />
gesellschaftliche Zusammenleben. Diese drei Phänomene gilt es also besonders zu analysieren.<br />
Unterkapitel I :: Globalisierung<br />
These 22<br />
Standortfaktoren<br />
Das neoliberale Versprechen der Globalisierung, allen freien Zugang zum Markt zu gewähren,<br />
wurde nicht erfüllt. Ungleiche Verteilungsstrukturen haben innerhalb und zwischen den<br />
Staaten zugenommen. Auch die Ungerechtigkeit in der internationalen Arbeitsteilung hat<br />
nicht abgenommen. Noch immer sind viele Staaten Rohstofflieferanten für westliche<br />
Industrienationen.<br />
Seit Beginn der Industrialisierung, insbesondere aber in den letzten Jahrzehnten, haben sich die<br />
Kosten für Warentransport und Kommunikation durch technische und politische<br />
Entwicklungen stark reduziert.<br />
246
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Im Rahmen der WTO und ihrer Vorläufer sind Zölle und nicht tarifäre Handelshemmnisse<br />
abgebaut worden. Damit ist die Bedeutung natürlicher Konkurrenzgrenzen zwischen<br />
verschiedenen Standorten gesunken. Die Folge: Produktionskosten können nun unmittelbarer<br />
miteinander verglichen werden.<br />
Die Qualifikation der Beschäftigten für die Entwicklung und Leitung der Produktion nimmt auf<br />
der einen Seite an Bedeutung zu. Auf der anderen Seite werden komplizierte<br />
Produktionsabläufe durch den technischen Fortschritt und Digitalisierung an immer mehr<br />
Standorten möglich. Als Folge dieser Entwicklung sind heute die beeinflussbaren<br />
Standortfaktoren wie Bildung, Infrastruktur, Lohnkosten und Subventionen bedeutsamer als<br />
die natürliche Standortausstattung mit Rohstoffen und Energievorkommen.<br />
Die Globalisierung wird gleichzeitig flankiert durch eine Debatte, die das TINA-Prinzip und die<br />
neoliberale Ideologie zum Dogma erhebt. Diese Debatte dient nur dazu, die dem<br />
kapitalistischen System innewohnenden Systemzwänge zu verschleiern, die nationale<br />
Ökonomien unter einen qualitativ neuartigen Anpassungsdruck an die globalisierten<br />
Standards von Produktivität und Rentabilität setzten.<br />
Allerdings sind der Mobilität Grenzen gesetzt. So kann das Kapital nicht beliebig zwischen<br />
verschiedenen Standorten wählen. Insbesondere bei der Hochwertproduktion muss der Zugriff<br />
auf bestimmte Qualifikationsprofile, Basistechnologien und Infrastrukturen vorhanden sein,<br />
der tatsächlich nicht an allen Orten existent ist. Die wissenschaftlich-technische Entwicklung<br />
schafft damit eine neue Qualität von Kapitalmobilität als auch von Standortabhängigkeit<br />
bestimmter Produktionsschritte. Die freie Austauschbarkeit der Standorte gehört damit zu den<br />
Mythen der Globalisierungsdiskussion. Gleichzeitig ist nicht zu unterschätzen, dass sich die<br />
Möglichkeiten zur Auslagerung durch die beschriebenen Entwicklungen vergrößert haben.<br />
These 23<br />
Finanzmärkte<br />
Die gestiegene Bedeutung der Faktoren Zeit, Geld und Unsicherheit für die Wertschöpfung<br />
führen zu einer neuen Dynamik der aktuellen kapitalistischen Formation. Die Finanzmärkte<br />
konnten einen starken Bedeutungszuwachs verzeichnen und sind mittlerweile stark von der<br />
Güterproduktion entkoppelt. Die Bedingung dafür war der Zusammenbruch der<br />
weltwirtschaftlichen Regulierungssysteme, insbesondere des Bretton-Woods-Regimes, dass<br />
zwischen 1944 und 1973 durch feste Wechselkurse und den US-$ als Weltleitwährung die<br />
247
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
internationalen Handels- und Finanzbeziehungen stabilisiert hat. Auch der Abbau von<br />
Kapitalverkehrskontrollen zählt hier dazu.<br />
Infolge mangelnder Investitionsmöglichkeiten und der daraus entstehenden Unsicherheit<br />
wurden von den Kapitaleignern hoch spekulative Investitionsmöglichkeiten auf den<br />
Finanzmärkten erschlossen und neue Kapitalbeschaffungsinstrumente sind entstanden.<br />
Wegen fehlender Regulierung war es möglich, hoch spekulative Investitionen auf den<br />
Kapitalmärkten zu erschließen und neue risikoreichere Kapitalbeschaffungsinstrumente zu<br />
schaffen. Dadurch haben die Finanzmärkte einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren.<br />
Darüber hinaus hat sich ihre Rolle als Informationsverarbeitungsmaschinen, die Auskunft über<br />
die ertragreichsten Anlagemöglichkeiten über entsprechende Renditekennziffern bieten,<br />
gewandelt. Durch die Durchschlagskraft institutioneller Investoren sind Renditeziele und<br />
konkrete Verwertungsbedingungen nur noch lose gekoppelt. Dabei tritt die eigentliche<br />
Information über die Renditepotenziale einer Anlagemöglichkeit in den Hintergrund. Die<br />
gestiegene Mobilität von Kapital ermöglicht die Nutzung auch von kleinsten Schwankungen<br />
der Profitabilität von Anlagemöglichkeiten, von Informationsvorsprüngen. Was zählt, sind die<br />
Erwartung-Erwartungen auf den Märkten, diese ordnen die Investitionsentscheidungen und<br />
bewirken über ihre gegenseitige Abhängigkeit massive Schneeballeffekte, deren Auswirkungen<br />
ganze Volkswirtschaften über Jahre hinweg ruinieren können. Dadurch hat sich das Verhältnis<br />
von Eigentum und Kontrolle neu ausgerichtet.<br />
Eine Veränderung der Eigentumsstrukturen ist zu beobachten. Dies hat zur Folge, dass sich<br />
auch innerhalb der Unternehmen Entscheidungsstrukturen verändert haben. Eine einseitige<br />
Ausrichtung auf den maximalen kurzfristigen Profit führt dazu, dass nachhaltige und<br />
längerfristige Entwicklungen weniger berücksichtigt werden. Einen weiteren Schub hat diese<br />
Entwicklung durch die Entstehung der „New Economy“ mit ihrem vorläufigen Höhepunkt zum<br />
Jahrtausendwechsel erhalten, da sie hohe Erwartungs-Erwartungen bei niedrigem<br />
Kapitaleinsatz versprochen haben. Die Verschiebung von Eigentum und Kontrolle sowie die<br />
insbesondere der Shareholder Value folgende Logik der derzeitigen kapitalistischen Formation<br />
haben den Druck auf den "Faktor Arbeit" im Produktionsprozess erhöht und zum Wandel der<br />
Arbeitsgesellschaft selbst beigetragen.<br />
These 24<br />
Konkurrenz von Staaten<br />
Die Kräfteverhältnisse haben sich zu Gunsten der KapitaleignerInnen verschoben. Damit hat<br />
der Nationalstaat scheinbar vielfach an Bedeutung verloren. Das transnationale Kapital<br />
reorganisiert die Kapitalakkumulation, bindet sich nicht an einzelne Standorte und zwingt die<br />
248
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Staaten dazu, diese Akkumulationsdynamik durch Deregulierung, Privatisierungen und Abbau<br />
staatlicher Umverteilung zu unterstützen. Dadurch entsteht zunehmender Druck auf<br />
bestehende Standards der Regelungen von Arbeitszeit, Urlaub, ArbeitnehmerInnenrechte und<br />
Mitbestimmung, sowie Steuererhebung und soziale Sicherungssysteme. Auch innerhalb der<br />
EU haben sich die Kräfteverhältnisse zu Gunsten neoliberaler Logiken verschoben.<br />
Gleichzeitig kommen neue Arenen der Aushandlungen hinzu. So ist die nationale zwar<br />
weiterhin die zentrale Arena der Interessensauseinandersetzung, aber zunehmend verlagern<br />
sich Entscheidungen aber auf die exekutive Ebene der „Staatschefs“. Auch innerhalb der EU<br />
geben die Staats- und Regierungschefs immer noch den Ton an, das Parlament verbleibt<br />
weitgehend einflusslos. Dadurch entzieht sich ein Großteil der Entscheidungen der<br />
unmittelbaren Legitimation durch die Bevölkerung. Mit dem Schwinden der demokratischen<br />
Legitimation schwindet auch die Legitimation der weiteren europäischen Entwicklung<br />
insgesamt. Die Verschiebung eines Teils der Macht auf die internationalen und<br />
supranationalen Ebenen führt zu einem Funktionswandel des Staates. Es kann nicht generell<br />
von einem Rückzug des Staates aus der Gesellschaft gesprochen werden, auch wenn sich die<br />
Formen staatlicher Regulierung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche enorm<br />
verändern. Der Staat bleibt Kern dieses neuen Systems mehrerer Ebenen, aber demokratische<br />
Beteiligung wird dabei zurückgedrängt.<br />
Das neoliberale Paradigma des „schlanken Staates“ lässt sich daher lediglich auf den Abbau<br />
von Institutionalisierung im traditionellen Sozialstaat beziehen, nicht jedoch auf die generelle<br />
Zurücknahme staatlicher Interventionspolitik. In anderen Bereichen, zum Beispiel bei innerer<br />
und äußerer Sicherheit, wird die Politik im Staat zunehmend autoritär. Die Sicherung privater<br />
Eigentumsrechte und der Neuaufbau solcher Rechte durch Privatisierung, der verstärkte Druck,<br />
seine Arbeitskraft trotz großer Arbeitslosigkeit auf dem Markt zu verkaufen, sind Ausdruck<br />
einer solchen Politik.<br />
Darüberhinaus geraten die persönlichen Freiheitsrechte zunehmend unter Druck. Seit den<br />
Anschlägen auf das World-Trade-Centre und das Pentagon am 11. September 2001 hat sich die<br />
Sicherheitsgesetzgebung deutlich verschärft. Mit drohender Terrorismusgefahr wird die<br />
rechtsstaatliche Balance zwischen Freiheit der/des Einzelnen und der allgemeinen Sicherheit<br />
verschoben. Der präventive Überwachungsstaat erhält mehr und mehr Einzug. Das ist nicht<br />
hinnehmbar. Vorhandene Unzufriedenheit über zunehmende staatliche Überwachung greifen<br />
wir auf und beteiligen uns mit gesellschaftlichen AkteurInnen am Kampf gegen die<br />
Beschränkung von Freiheitsrechten.<br />
These 25<br />
Vorhandene Spielräume nutzen<br />
249
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Zuerst ist festzuhalten, dass die Gestaltbarkeit im nationalstaatlichen Rahmen nicht<br />
Geschichte ist, sondern die Leugnung dieser Regulierungsebene als Instrument zur<br />
Verhinderung sozialer Gestaltung und Fortschritte eingesetzt wird. Nationalstaatliche<br />
Spielräume müssen weiterhin genutzt werden.<br />
Vor allem muss auf die Standortkonkurrenz der Nationalstaaten mit einer neuen Forme der<br />
internationalen Zusammenarbeit geantwortet werden. Gegen den neoliberalen Trend zur<br />
Deregulierung müssen neue Regulierungsschritte auf nationaler, europäischer und<br />
internationaler Ebene unternommen werden, um politische Gestaltungsfähigkeit<br />
zurückzugewinnen. Dazu zählen wir die Stabilisierung der Wechselkurse und Zinssätze, die<br />
Tobin Tax, Steuerharmonisierung, eine wirksame Kontrolle und Regulation der Kapitalmärkte,<br />
Festlegung sozialer und ökologischer Mindeststandards.<br />
Gesellschaftliche Kräfte müssen mobilisiert werden, um Spielräume gegen die<br />
Durchkapitalisierung und marktförmige Zurichtung aller Lebensbereiche zu erkämpfen. Dabei<br />
geht es um die gesellschaftliche Auseinandersetzung, was dem Markt übertragen wird und<br />
was gesellschaftlich verantwortet werden muss. Die gesellschaftlichen und politischen Kräfte<br />
müssen dabei die Bedingungen der Mehrebenen-Staatlichkeit annehmen, wenn sie<br />
handlungsfähig sein wollen.<br />
Ziel muss es dabei sein, konkrete Bereiche aus der globalisierten Konkurrenzökonomie<br />
herauszulösen und in die Verfügungsgewalt der Gesellschaft zurückzugeben. Der<br />
Standortlogik ist also auch dadurch Widerstand entgegenzusetzen, dass der Zurichtung des<br />
Alltags und der Lebensräume nach den Kriterien globaler Konkurrenz die Menschen ihre<br />
Bedürfnisse entgegenstellen und sich die notwendigen Ressourcen für ein selbstbestimmtes<br />
Leben aneignen.<br />
Wir verstehen Staat und Markt nicht als zwei voneinander abgegrenzte - oder nach<br />
neoliberaler Logik abzugrenzende - Räume. Staatliche Regulierung greift beständig in<br />
wirtschaftliche Prozesse ein, und wird von diesen beeinflusst. Der Staat kann und muss<br />
intervenieren, und zwar in dem Sinne, dass er selbst in wirtschaftliche Prozesse eingreift, sie<br />
eigenständig gestaltet und Impulse setzt. Der Staat wird dadurch zum gestaltenden Akteur der<br />
Ökonomie und überlässt nicht den Markt dem freien Spiel der Kräfte. Er erhält und schafft sich<br />
seine eigene Handlungsfähigkeit. Das ist der Gegenentwurf zum sogenannten schlanken Staat,<br />
der nach neoliberalem Paradigma den Staat sich auf seine behaupteten Kernaufgaben<br />
beschränken lässt.<br />
250
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Unterkapitel 2 :: Der Prekarisierung der Arbeitswelt entgegentreten<br />
These 26<br />
Veränderungen<br />
Die Veränderungen in der kapitalistischen Formation haben sich in einer Umstrukturierung der<br />
Produktion niedergeschlagen. Durch den Glauben an unbegrenztes Wachstum und damit<br />
verbundene Profite war die Produktion früher an den zwei Größen Arbeitszeit und<br />
Arbeitsentgelt ausgerichtet. Heute richtet sich die Produktionsplanung an einem<br />
vorgegebenen Gewinnergebnis aus. Die Arbeitszeit bzw. der Weg zu diesem Ergebnis bleibt der<br />
einzelnen arbeitenden Person überlassen. Dies hat nicht nur Folgen für die innerbetriebliche<br />
Produktionsplanung, sondern manifestiert sich durch innerbetrieblichen Konkurrenz und<br />
Übertragung von Risiko und Managementaufgaben auf die Belegschaft im konkreten<br />
Arbeitsalltag der abhängig Beschäftigten.<br />
Das Leitbild des Normalarbeitsverhältnisses erodiert auch in den Traditionsbereichen der<br />
industriellen Produktion. Sein Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigungsverhältnisse ist<br />
kontinuierlich am Schwinden. Der grundlegende Widerspruch zwischen den Zielen des Kapitals<br />
und der Arbeit tritt in der Zeit der Krise noch offener zu Tage. Ebenso wird durch eine<br />
Aufweichung von Kernarbeitszeiten die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zunehmend<br />
brüchig. Die Ungleichheit in der Verteilung von Arbeit nimmt weiter zu. Während es bei den<br />
Vollzeitbeschäftigten wieder einen Trend zu ansteigenden tatsächlichen Wochenarbeitszeiten<br />
gibt, sind andere gezwungen, in prekären Beschäftigungsformen oder unfreiwilliger<br />
Teilzeittätigkeit weniger zu arbeiten, als sie es sich persönlich wünschen.<br />
Prekarisierte Beschäftigung heißt, dass die Entlohnung oftmals zu gering zum Lebenserhalt ist,<br />
die betriebliche Mitbestimmung oder der Kündigungsschutz eingeschränkt oder nicht gegeben<br />
ist oder es keine ausreichende soziale Sicherung gibt. Die Lebensrealität vieler Menschen ist<br />
davon gekennzeichnet, dass sie sich permanent von einem Auftrag zum nächsten hangeln<br />
müssen, in denen erkämpfte Errungenschaften wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder<br />
Urlaubsgeld nicht der Realität entsprechen. Die ArbeitgeberInnen flexibilisieren die<br />
Beschäftigungsverhältnisse und verlagern auf diese Weise das Unternehmensrisiko zum Teil<br />
auf die ArbeitnehmerInnen. Aufgrund der Regelungen wie beispielsweise zur Leiharbeit gibt es<br />
in vielen Betrieben zudem eine Konkurrenz innerhalb der Belegschaft. Die Gefahr der<br />
Entsolidarisierung wächst. Die ArbeiterInnen werden zum ArbeitskraftunternehmerInnen.<br />
Massenarbeitslosigkeit bewirkt, dass Menschen, die arbeiten können und wollen, vom<br />
251
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Erwerbsleben ausgeschlossen und so gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Arbeitslosigkeit<br />
bedeutet für die Betroffenen nicht nur einen sinkenden Lebensstandard, sondern zunehmend<br />
auch Not und gesellschaftliche Isolation. Schon allein die Bedrohung von Arbeitslosigkeit wirkt<br />
in weite Teile der Gesellschaft und schürt Existenzängste, erhöht den Druck auf<br />
ArbeitnehmerInnenrechte und die Gestaltung von Arbeit.<br />
Auch in geschlechtsspezifischer Hinsicht liegt eine Ungleichverteilung vor. Frauen partizipieren<br />
nach wie vor weniger als Männer an Erwerbsarbeit, erhalten selbst bei gleicher und<br />
gleichwertiger Arbeit eine deutlich geringere Entlohnung als Männer, ihre Aufstiegschancen<br />
sind deutlich niedriger. Frauen sind weit überproportional in Teilzeitarbeit oder geringfügig<br />
beschäftigt und somit von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen.<br />
These 27<br />
Neuorganisation von Interessen<br />
Wir bleiben dabei: Die kapitalistische Ökonomie orientiert sich nicht an den wirklichen<br />
Interessen der Menschen. Sie funktioniert nach der ihr eigenen Verwertungslogik.<br />
Gesellschaftlicher Fortschritt findet dort statt, wo sich diese Ansprüche erfolgreich artikulieren<br />
und durchsetzen. Angesichts von veränderten Beschäftigungsformen müssen wir politisch<br />
daran arbeiten, wie die Interessen derjenigen, die außerhalb klassischer Beschäftigungsformen<br />
arbeiten, vertreten werden können. Die klassische Form: ein Betrieb und eine Gewerkschaft<br />
trifft heute die Lebensrealität vieler ArbeitnehmerInnen nicht mehr. Dabei ist eine<br />
Interessensvertretung all jener dringender denn je. Es gehört zu den Grundbedingungen linker<br />
Politik, auf das (auch oftmals von den Beschäftigten gewollte) Aufbrechen klassischer<br />
Erwerbsbiographien zeitgemäße Antworten zu finden.<br />
These 28<br />
Sozialistische Wirtschaftspolitik<br />
Wir <strong>Jusos</strong> stehen für eine sozialistische Wirtschaftspolitik. Kern dieser Politik ist die<br />
Verelendung der Gesellschaft im jetzigen System zu verhindern und zeitgleich die<br />
kapitalistische Marktwirtschaft zu überwinden.<br />
Linkskeynsianistische Politik ist für uns ein Mittel im jetzigen Wirtschaftssystem die<br />
Verelendung zu verhindern, durch ihren systemstabilisierenden Charakter kann sie jedoch<br />
252
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
nicht ohne zusätzliche Maßnahmen als sozialistische Wirtschaftspolitik bewertet werden.<br />
Kern dieser Politik sind einerseits eine pragmatische Konjunktur- und Wachstumspolitik, und<br />
andererseits eine längerfristige Strategie der Humanisierung des kapitalistischen Systems.<br />
Wir widersprechen der neoliberalen Ansicht, wonach die weitere Entlastung der Unternehmen<br />
in Deutschland von angeblich zu hohen Lohnkosten und Steuerabgaben Voraussetzung für<br />
künftige Wachstumserfolge ist. Die ausschließliche Fokussierung auf so genannte<br />
„Strukturreformen“ widerspricht einer sozialdemokratisch ausgerichteten Wirtschaftstheorie<br />
und -politik. Diese empfiehlt nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch<br />
auf der Grundlage von makroökonomischen Effizienzüberlegungen eine Lohnpolitik, die den<br />
Verteilungsspielraum aus Produktivitätswachstum und Inflation mittelfristig ausschöpft und<br />
zudem über das Steuersystem gerade die einkommensschwachen Haushalte fördert. Zwar sind<br />
für die Unternehmen zweifellos auch Kostengesichtspunkte von Bedeutung. Eine kräftige<br />
Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten (Investitionen) lohnt sich für sie jedoch nur dann,<br />
wenn sie sich einer entsprechend kräftigen Güternachfrage gegenüber sehen.<br />
Weiterer Bestandteil einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik sind der pragmatische<br />
Einsatz von makroökonomischer Stabilisierungspolitik (Geld- und Fiskalpolitik). Nur wenn<br />
Unternehmen mit einer permanent dynamischen Nachfrageentwicklung konfrontiert sind,<br />
werden sie im Kampf um Marktanteile entsprechend kräftig investieren, woraus sich<br />
wiederum im Zuge des kräftigeren Produktivitätswachstums positive Angebotseffekte<br />
ergeben. Die in wirtschaftlichen Schwächephasen unvermeidlich steigenden Haushaltsdefizite<br />
des Staates werden in Phasen kräftigeren Wachstums wieder verringert. Das geldpolitische<br />
Mandat der Europäischen Zentralbank sowie der Stabilitäts- und Wachstumspakt der<br />
Europäischen Union geben bislang wenig Spielraum für stabilisierungspolitische Maßnahmen<br />
und müssen daher entsprechend reformiert werden.<br />
Längerfristig können wir <strong>Jusos</strong> uns jedoch nicht mit einer reformierten Makrosteuerung<br />
zufrieden geben. Wachstum kann für SozialdemokratInnen kein Selbstzweck sein.<br />
Zwar müssen angesichts der aktuellen Verteilungssituation die Einkommen gerade der<br />
Schwächsten in der Gesellschaft gestärkt werden. Dies geht nur mit Wachstum, wenn<br />
gesellschaftliche Verteilungskonflikte nicht eskalieren sollen. Forderungen nach einem<br />
sofortigen Übergang zu einer Strategie des Negativwachstums, z.B. aus globalisierungskritischen<br />
Kreisen, sind daher mit Skepsis zu begegnen.<br />
Längerfristig muss es aber dennoch Ziel von Sozialdemokraten sein, eine kritische und<br />
grundsätzliche Diskussion darüber anzustoßen, inwieweit Wachstum gesellschaftlich<br />
253
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
wünschenswert und ökologisch vertretbar bleibt. Verbesserte Produktionsmöglichkeiten<br />
müssen sich letztlich immer darin legitimieren, dass sie dem einzelnen Menschen dienen,<br />
indem sie sein Leben angenehmer, sicherer und freier machen. Einen hoch aktuellen<br />
Orientierungsrahmen bieten hierbei die „Schlussbetrachtungen über die Sozialphilosophie“<br />
von John Maynard Keynes in seiner „Allgemeinen Theorie“, in der vier mehr oder weniger<br />
langfristige Ziele benannt werden:<br />
1. eine gleichmäßige Einkommensverteilung,<br />
2. internationale Solidarität zur Vermeidung von Wirtschaftskriegen und militärischen<br />
Auseinandersetzungen,<br />
3. die demokratische Steuerung der Investitionstätigkeit in gesellschaftlich gewünschten<br />
Bereichen sowie schließlich<br />
4. die Nutzung des Produktivitätsfortschritts zur Überwindung der materiellen Knappheit und<br />
zur Ermöglichung von individueller Entfaltung auch außerhalb der marktwirtschaftlichen<br />
Güterproduktion.<br />
Der Staat sollte zwar kurzfristig sich in die Besitzverhältnisse der Produktionsmittel einmischen<br />
und durch eine Verstaatlichung der Schlüsselindustrien die Macht des Marktes brechen um<br />
Verelendung zu verhindern. Grundsätzlich ist jedoch eine radikale Demokratisierung der<br />
Wirtschaft unser Ansatz, um die kapitalistische Marktwirtschaft zu überwinden. Die Grundidee<br />
der Genossenschaften, der Besitz der Produktionsmittel durch die Gemeinschaft der<br />
ArbeitnehmerInnen ist das Ziel, welches wir auch auf die restlichen Betriebe übertragen<br />
wollen.<br />
Parallel dazu wollen wir im verstärkten Maße Konsumgenossenschaften<br />
(Stromeinkaufsgemeinschaften) aufbauen, um dadurch Widersprüche des Systems nutzen zu<br />
können, um die Marktprinzipien zu überwinden. Der Staat soll diesen Aufbau von<br />
Konsumgenossenschaften finanziell unterstützen.<br />
These 29<br />
Staatliche Regulierung erkämpfen<br />
Wir sind nicht bereit zuzuschauen, wie sich auf dem Arbeitsmarkt immer mehr unwürdige<br />
Verhältnisse durchsetzen. Hier müssen wir uns in den politischen Kampf für konkrete<br />
staatliche Regulierungen begeben. Ein effektiver Kündigungsschutz, klar definierte<br />
Bedingungen für Praktika, soziale Regulierungen, die helfen, dass reguläre<br />
Beschäftigungsverhältnisse nicht verdrängt werden, das Eindämmen von Leih- und Zeitarbeit<br />
254
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
sowie die soziale Regulierung bzw. langfristige Abschaffung des Niedriglohnbereichs können<br />
wir nur mit politischem Druck erreichen.<br />
Angesichts von Massenarbeitslosigkeit und Produktivitätssteigerungen muss die individuelle<br />
durchschnittliche Erwerbsarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten kontinuierlich verkürzt werden.<br />
Die führt zu einer gerechteren gesellschaftlichen Verteilung von Arbeit und Einkommen (auch<br />
zwischen den Geschlechtern) und trägt zur Beschäftigungssicherung bei. Wohlstandsgewinn<br />
muss auch im Zuwachs an erwerbsarbeitsfreier Zeit gesehen werden. Dies kommt auch dem<br />
Bedürfnis der Beschäftigten nach mehr Zeitsouveränität entgegen.<br />
Unterkapitel 3 :: Gespaltene Gesellschaft<br />
These 30<br />
Soziale Ungleichheit und Kapitalismus<br />
So sehr wir uns in Verband, Partei und Gesellschaft auch anstrengen werden, soziale Gleichheit<br />
werden wir im Bestehenden nie erreichen. Der Kapitalismus produziert dabei die Ungleichheit<br />
nicht mangels besserer Organisation, sondern als Folge seiner ihm innewohnenden<br />
Gesetzmäßigkeit.<br />
Konkurrenz kennt nur GewinnerInnen und VerliererInnen. Der soziale Ausgleich, die Deckelung<br />
allzu großer Lohngefälle oder die Mitbestimmung im Betrieb: All das muss politisch erkämpft<br />
werden, weil es den direkten Verwertungsgesetzen zuwiderläuft.<br />
Die Geschichte hat gezeigt, dass der Kampf für Mitbestimmung, Teilhabe und gerechte Löhne<br />
bisher kein Sargnagel des Systems war. Im Gegenteil. Die Paradoxie des Kapitalismus zeigt sich<br />
genau darin, dass diese empirischen Prosperitätsfaktoren bis aufs Messer bekämpft wurden,<br />
obwohl doch gerade dadurch erst die Akzeptanz des Systems für einen Großteil der Menschen<br />
erreicht wurde.<br />
Keinesfalls darf Konsequenz dessen sein, es auf immer schlechtere Bedingungen – im Sinne der<br />
Verelendungstheorie – geradezu ankommen zu lassen. Es darf auch nicht entmutigen, sondern<br />
soll uns nur zeigen, dass wirkliche Solidarität, Gleichheit und Freiheit nur jenseits des<br />
Kapitalismus Realität werden kann.<br />
255
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 31<br />
Schwindende soziale Sicherheit<br />
Langfristige Arbeitsverträge, streng reglementierte Entlassungsregeln, festgelegte<br />
Arbeitszeiten- und Löhne konstituierten das männliche Normalarbeitsverhältnis als<br />
gesellschaftliche Norm in den reichen entwickelten Industrienationen. Diese Entwicklung<br />
war geprägt durch industrielle Massenproduktion und große staatliche Investitionen. Mit<br />
dem durch die wirtschaftlichen Bedingungen und der ausgeprägten Leistungsorientierung<br />
ermöglichten sozialen Aufstieg war eine beispiellose Ausweitung der beruflichen<br />
Kompetenzen der klassischen Arbeiterklasse verbunden. Gleichzeitig wurden<br />
Teilhabeansprüche entwickelt und ein gewisses Maß an sozialer Sicherung garantiert. Die<br />
Aushandlungsprozesse zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen wurden<br />
zunehmend verrechtlicht und dadurch Sozialdemokratie und Gewerkschaften eingebunden.<br />
Dies waren die Grundpfeiler eines relativen Wohlstands.<br />
Durch die Strukturveränderungen in der Wirtschaft wurde Arbeit stetig prekärer und die<br />
individuelle wirtschaftliche Sicherheit ist durch schlechtere Arbeitsbedingungen und die<br />
Bedrohung von Arbeitslosigkeit abgelöst worden. Gleichzeitig wurden die westlichen<br />
Industrienationen zunehmend von neoliberalen Prinzipen durchzogen, was zum Wandel<br />
vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat geführt hat. Anstatt soziale Sicherheit zu<br />
bieten, wurden die Rechte der ArbeitnehmerInnen zurückgenommen und gesellschaftliche<br />
Risiken auf die Einzelnen übertragen.<br />
Es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch in einer relativen Prospäritätsphase<br />
Unterdrückungsmechanismen wirkten. Alternative Lebensentwürfe konnten sich in der Enge<br />
dieser Prosperitätskonstellation nicht wirklich entfalten, Werte wie Selbstverwirklichung<br />
passten nicht in dieses Gesellschaftsbild. Des Weiteren traten neue Werte, wie das Streben<br />
nach Selbstverwirklichung hinzu. Frauen wurden auf die Rolle der Mutter mit<br />
Hinzuverdienerin-Funktion reduziert.<br />
Für uns <strong>Jusos</strong> kann das politische Ziel unserer Arbeit deshalb nicht bedeuten, lediglich die alten<br />
Regulationsmechanismen wiederzubeleben.<br />
These 32<br />
Folge: Soziale Polarisierung<br />
Die Folge der beschriebenen Entwicklung ist, dass die Seite der ArbeitnehmerInnen zunehmend<br />
in die Defensive geraten ist und es immer schwieriger wurde, soziale Standards zu verteidigen.<br />
256
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
So hat die soziale Ungleichheit rapide zugenommen. Armutsstrukturen verfestigen sich und<br />
sozialer Aufstieg wird immer schwerer möglich. Die Menschen im „oberen“ Drittel haben recht<br />
gesicherte Chancen und Lebensperspektiven. In der „Mitte“ der Gesellschaft ist die<br />
Verunsicherung angekommen. In der Hoffnung auf den langfristigen Erhalt des<br />
Lebensstandards werden immer mehr Einbußen akzeptiert. Dadurch geht der Abwärtstrend für<br />
viele los. Im „unteren“ Drittel verfestigt sich die soziale und gesellschaftliche Abkoppelung.<br />
Gleichzeitig zeichnet die Entwicklung der Einkommen und Vermögen ein klares Bild.<br />
Der Anteil aus Unternehmertätigkeit und Vermögen am Volkseinkommen hat in den<br />
vergangenen Jahren immer weiter zugenommen; im Gegenzug sinkt der<br />
ArbeitnehmerInnenanteil. Die untere Hälfte der Haushalte verfügt insgesamt nur über vier<br />
Prozent des gesamten Nettovermögens. Das reichste Fünftel besitzt rund zwei Drittel. Noch<br />
gravierender ist die Verteilung des Produktivkapitals. Drei Prozent der Bevölkerung besitzen 90<br />
Prozent. Auch die Kluft zwischen Einkommen aus abhängiger Beschäftigung und<br />
Unternehmensgewinnen ist gewachsen. Die Lohnspreizung nimmt vor allem wegen der<br />
wachsenden Zahl der atypisch Beschäftigten zu.<br />
In den 1970er Jahren lebten ein Fünftel der Alleinerziehenden unterhalb der relativen<br />
Armutsgrenze, heute sind es mehr als doppelt so viele. Jeder Achte lebt unterhalb der<br />
Armutsgrenze. Die Verteilungsfrage ist nicht nur die Frage danach, was man sich alles leisten<br />
kann, sondern bestimmt das gesamte Leben der Betroffenen und ihrer Kinder. Dies geht<br />
soweit, dass sogar die Lebenserwartung von der Höhe des Einkommens abhängt.<br />
Das deutsche sozial selektive Bildungssystem befördert diese Entwicklung. In Deutschland<br />
hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen und ethnischen Herkunft ab, wie sonst<br />
nirgendwo. Es besteht in unserer Gesellschaft ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen<br />
Einkommen und Teilhabemöglichkeiten.<br />
These 33<br />
Ein menschenwürdiges Leben für alle<br />
Diese Gesellschaft produziert Armut. Armut führt zum Verlust eines selbstbestimmten Lebens.<br />
Wir kämpfen dafür, dass Armut nicht entsteht. So lange es diese jedoch noch gibt, kämpfen wir<br />
in dieser Gesellschaft dafür, dass jeder Mensch trotzdem menschenwürdig leben kann. Dies ist<br />
gegenwärtig nicht gewährleistet.<br />
Jedem Bürger/jeder Bürgerin ist ein menschenwürdiges Leben unabhängig von seiner<br />
Erwerbstätigkeit zu ermöglich. Menschen, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,<br />
257
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
das es ihnen ermöglicht menschenwürdig zu leben, sind von staatlicher Seite in angemessener<br />
Seite zu unterstützen.<br />
Darüber hinaus muss das Prinzip „Fordern und Fördern“ verändert werden. Das Förderelement<br />
funktioniert oftmals nicht, sondern demoralisiert die Betroffenen. Eine unterstützende Politik<br />
muss die Selbstbestimmung jedes Menschen über eine Tätigkeit in den Mittelpunkt stellen.<br />
Fördern macht nur Sinn, wenn zu etwas gefördert wird, was auch vorhanden ist. Wir wollen<br />
eine Gesellschaft, in der solidarisch und demokratisch über die zu verrichtenden Tätigkeiten<br />
entschieden wird. Eine Fokussierung auf die Notwendigkeit des „Förderns“ dient der<br />
Ablenkung von der Tatsache, dass in Wahrheit viel zu wenige Ausbildungs- und Arbeitsplätze<br />
vorhanden sind. Gleichzeitig gibt es viele öffentliche Aufgaben, die derzeit brachliegen.<br />
Notwendig ist der Ausbau des öffentlichen Beschäftigungssektors.<br />
Das Prinzip des Forderns mit seinem ausufernden Sanktionskatalog wird dem Anspruch an die<br />
Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht gerecht. Druck und Repression<br />
auf jene, die sich sowieso schon in einer schwierigen Situation befinden sind keine Instrumente<br />
linker Sozialpolitik. Vielmehr widersprechen sie den Grundprinzipien des Humanismus.<br />
Die Lebensbedingungen der betroffenen Menschen werden durch Sanktionen und Druck<br />
verschlechtert. Dies muss unterbunden werden.<br />
These 34<br />
Bildungspolitik<br />
Bildung ist für uns ein Wert an sich und wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.<br />
Das kapitalistische System begreift Bildung vor allem als Qualifikation, weshalb immer die<br />
Gefahr besteht, dass Bildung hierauf reduziert wird. Für uns muss dagegen der<br />
emanzipatorisch-kritische Aspekt Maßstab für gute Bildung sein. Auch wenn eine Forderung<br />
nach guter Bildung für alle auf allen Ebenen ein Einsatz für bessere<br />
Verwirklichungsmöglichkeiten im Kapitalismus bedeutet, ist klar, dass Bildung alleine das<br />
Konkurrenzsystem Kapitalismus nicht überwinden wird. Bildung wird auch bestehende<br />
Ungleichheiten niemals abschaffen können, denn die kapitalistische Konkurrenz lebt gerade<br />
von diesen Ungleichheiten. Bildungssysteme können aber durchaus unterschiedlich<br />
durchlässig gestaltet werden. Deshalb ist ihre Reform ein wichtiger Schritt zu stärkerer<br />
Gleichheit, jedoch kein Ersatz sondern lediglich Ergänzung zu einer Sozialpolitik, die für mehr<br />
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft sorgt. Der Weg dahin für uns <strong>Jusos</strong> ist klar: Die<br />
Abschaffung des selektiven Bildungssystems. Weiter muss jegliche Art von Bildung vom 0.<br />
Lebensjahr bis zum Lebensende für alle zugänglich und kostenlos sein.<br />
258
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Bildung ist ein wichtiges Instrument zur Reproduktion von Arbeitskraft, denn für die meisten<br />
Tätigkeiten im Produktionsprozess müssen Qualifikationen erst durch Bildung erworben<br />
werden. Bildung bedeutet aber nicht nur Qualifikation, sondern auch in erster Linie<br />
Hinterfragen und Weiterdenken und ist so für die selbstbestimmte Entwicklung des Menschen<br />
zentral. Bildung ermöglicht also die Teilhabe am Produktionsprozess, ist aber gleichzeitig auch<br />
ein wichtiges emanzipatorisches Instrument. Nur mit neuem Wissen und neuen Fertigkeiten<br />
lässt sich die eigene Unmündigkeit überwinden. Bildung dient damit der Selbstverwirklichung.<br />
Bildung ist in die Logik des kapitalistischen Systems integriert. Solange die meisten Menschen<br />
darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, beeinflusst der Grad an Bildung bzw.<br />
Qualifikation direkt den Preis ihrer Arbeitskraft. Wer über mehr Bildung verfügt, hat auch mehr<br />
Möglichkeiten bei der Gestaltung des eigenen Lebens. Doch auch auf den Inhalt kommt es an:<br />
Nicht jede Art von Wissen und nicht alle Fertigkeiten sind gleich verwertbar. Die Logik des<br />
Kapitalismus fördert deshalb die Tendenz, sich möglichst „marktgerecht“ zu bilden.<br />
Schnittstellen zwischen einzelnen Bildungsabschnitten tragen zudem zur Teilung der<br />
Gesellschaft bei, denn beim Übergang von einer Stufe zur nächsten findet Selektion statt. Der<br />
beschränkte Zugang zu Kinderkrippe und Kindergarten, das dreigliedrige Schulsystem,<br />
fehlende Ausbildungs- und Studienplätze, eine Verkürzung von Studienzeiten und<br />
Verknappung von höheren Studienabschlüssen und stark reglementierte Fort- und<br />
Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen auf jeder Stufe nicht nur neue Ungleichheiten, sondern<br />
reproduzieren auch noch die alten. Dadurch wird Bildung zum vermeintlich objektiven<br />
Rechtfertigungsgrund für vorhandene Ungleichheiten.<br />
These 35<br />
Umverteilung von oben nach unten organisieren<br />
Die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten ist für uns zur<br />
Verwirklichung unserer Gerechtigkeitsvorstellungen notwendig, um Freiheit und Solidarität zu<br />
ermöglichen. Sozialstaat ist ein wesentliches Instrument, um Umverteilung zu organisieren.<br />
Über das Einkommenssteuersystem muss wieder mehr Umverteilung stattfinden. Dafür muss<br />
der Spitzensteuersatz erhöht werden, bei gleichzeitiger Anpassung der Progression, so dass<br />
kleine und mittlere Einkommen nicht stärker belastet werden. Zudem muss die<br />
Erbschaftssteuer ausgebaut, die Vermögenssteuer wiedereingeführt und die Mehrwertsteuer<br />
sozial gerecht gestaltet werden. Insbesondere gilt es des Weiteren auch<br />
Unternehmensgewinne und Finanzspekulationen zur Finanzierung des Gemeinwesens<br />
heranzuziehen.<br />
259
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
In den Sozialversicherungssystemen gibt es einen Trend zur Privatisierung und dem Abbau von<br />
Leistungen. Dem treten wir entgegen. Wir sind für eine solidarische Finanzierung und gegen<br />
eine Leistungsbegrenzung. Unsere Instrumente sind die solidarische BürgerInnenversicherung<br />
und die Arbeitsversicherung, die immer wieder neue Perspektiven schafft für alle.<br />
These 36<br />
Öffentliche Daseinsvorsorge<br />
Die Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge ist in unserem Verständnis eine der<br />
zentralen Aufgaben des Staates, um Chancengleichheit zu erreichen. Dazu gehören Bildung,<br />
Gesundheitsfürsorge, Pflege, Wasser- und Energieversorgung, Verkehrsinfrastruktur,<br />
Kommunikation und Information, Wohnraum, Sparkassen, Umweltschutz, Sicherheit, Sportund<br />
Kultureinrichtungen. TrägerInnen der öffentlichen Daseinsvorsorge können über staatliche<br />
Institutionen hinaus gesellschaftliche, gemeinnützige Kräfte sein. Beispielsweise im Rahmen<br />
alternativer Wirtschaftsformen genossenschaftlich, gemeinnützig organisierte TrägerInnen.<br />
Auch hierfür muss der Staat Freiräume schaffen.<br />
Würden diese Bereiche dem Markt überlassen, könnten viele Menschen ihr Leben nicht würdig<br />
gestalten und wären von der Gesellschaft ausgegrenzt. Deshalb ist es Ziel, dass der Staat den<br />
Zugang für alle zu diesen Schlüsselbereichen garantiert. Wo es erforderlich ist, sprechen wir<br />
uns für eine Vergesellschaftung der Bereiche aus, die nur unter öffentlicher Kontrolle unseren<br />
Ansprüchen entsprechen können. Nur wenn allen Menschen ein gleicher Zugang zu<br />
bestimmten Gütern garantiert wird, sind gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten.<br />
Durch die eigene Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen und Gütern wird das<br />
Allgemeinwohl durch demokratische Kontrolle sichergestellt.<br />
Kapitel V :: Feminismus<br />
These 37<br />
Patriarchat<br />
Die kapitalistische Gesellschaft ist geprägt von Widersprüchen. Unterdrückung und<br />
Ungleichbehandlung gehören zu den prägenden Elementen und zeigen sich in vielfältigen<br />
Erscheinungsformen. Patriarchale Strukturen prägen auch im 21. Jahrhundert die<br />
gesellschaftlichen Verhältnisse unabhängig von Staatsform und Wirtschaftsweise. Es ist nicht<br />
260
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
zu leugnen, dass die Frauenbewegung in den letzten Jahrzehnten viel erkämpft hat. Dennoch<br />
gilt es festzuhalten: Die gesellschaftlichen Machtverhältnisse sind auch über hundert Jahre<br />
nach den Anfängen der Frauenbewegung ungleich zugunsten der Männer verteilt. Die<br />
Erscheinungsformen des Patriarchats sind jedoch bei globaler Betrachtung unterschiedlich<br />
stark ausgeprägt. Selbst in Staaten, in denen Frauen formal gleiche Rechte haben wie Männer,<br />
sind patriarchale Strukturen noch nicht aufgebrochen, geschweige denn überwunden. Die<br />
zentralen Positionen von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Macht werden ganz<br />
überwiegend von Männern besetzt. Frauen werden gesellschaftlich und beruflich nur subtiler,<br />
nicht aber weniger diskriminiert.<br />
These 38<br />
Diskriminierung heute<br />
Die männlich strukturierte Gesellschaft zeigt sich auf sämtlichen Ebenen. Für Frauen ist der<br />
Weg in führende Positionen in Wirtschaft, Forschung und Lehre, Politik und Kirche schwerer.<br />
Sie erhalten weniger Lohn obwohl sie im Vergleich zu Männern gleich- oder besserqualifiziert<br />
sind. Frauen sind weitaus häufiger in Teilzeit, ohne Sozialversicherungspflicht oder in<br />
befristeten Arbeitsverhältnissen zu Niedriglöhnen beschäftigt - vor allem Frauen sind arm<br />
trotz Arbeit. Die Sorgearbeit in der Familie wird immer noch zum größten Teil von Frauen<br />
getragen und ihnen durch die Gesellschaft als scheinbar naturgegeben zugeschrieben. Steuerund<br />
Sozialsysteme sind auf den Mann als Ernährer und Versorger zugeschnitten. Frauen<br />
spielen nur als „Zuverdienerin“ eine Rolle, hier werden Abhängigkeiten gestärkt und nicht<br />
aufgebrochen. Es sind regelmäßig Frauen, die Opfer von Gewalt und Belästigung, von<br />
körperlicher und seelischer Unterdrückung sind. Auch Männer, die dem klassischen<br />
Rollenverständnis nicht entsprechen, sehen sich immer wieder Diskriminierungen ausgesetzt.<br />
Damit wird eine individuelle freie Entfaltung durch patriarchale Strukturen für beide<br />
Geschlechter wesentlich erschwert. Überkommene Rollenbilder und die Zuschreibung<br />
geschlechtsspezifischer Eigenschaften und auch sexueller Orientierung sind längst noch nicht<br />
überwunden. Hinzu kommen ethnizitäts- bezogene Stereotype die Frauen in doppelter<br />
Hinsicht diskriminieren: als Frau und Migrantin.<br />
These 39<br />
Kapitalismus und Patriarchat<br />
Kapitalismus und das Patriarchat sind Herrschaftssysteme, die auf Ungleichbehandlung,<br />
Unterdrückung und Ausbeutung aufbauen. Jedes System, das auf ungleiche Verteilung von<br />
Macht und Wohlstand und Erhalt dieses Zustandes ausgelegt ist, bedient sich des<br />
261
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
patriarchalen Prinzips. Deshalb dienen Kapitalismus und Patriarchat einander als sich<br />
gegenseitig stützende und schützende Prinzipien. Die ungleiche Verteilung und Bewertung von<br />
Produktions- und Reproduktionsarbeit und die damit einhergehende Benachteiligung von<br />
Frauen ist Ausdruck davon.<br />
Eine Gesellschaftsordnung, die das kapitalistische Prinzip überwindet, ist nicht notwendig eine,<br />
in der sich die Frauenfrage erledigt hat. Allerdings kann nur in einer Gesellschaft, die auf<br />
Ausbeutung und Unterdrückung verzichtet, auch Gleichheit der Geschlechter erreicht werden.<br />
Die Gleichstellung der Frauen ist deshalb Teil unseres Kampfes für den Demokratischen<br />
Sozialismus. Der Kampf für den Demokratischen Sozialismus kann aber niemals den Kampf für<br />
die Gleichstellung ersetzen.<br />
These 40<br />
Perspektive<br />
Wir <strong>Jusos</strong> erstreben eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleich, frei und solidarisch<br />
miteinander leben. Wir wollen eine Gesellschaft, in der nicht ein scheinbar männliches Prinzip<br />
das leitende ist. Wir wollen eine Gesellschaft, in der das Geschlecht keine Rolle mehr spielt in<br />
dem Sinne, dass alle Menschen die gleiche Freiheit leben können - ein Leben in<br />
Selbstbestimmung und ohne starre Rollenbilder, unter gleicher Teilhabe an Macht und Einfluss,<br />
ohne geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Sexismus.<br />
Die Gleichheit der Geschlechter ist grundlegende Idee einer auf Emanzipation angelegten<br />
Strategie. Dabei geht es nicht um Negierung von Individualität oder das Ignorieren<br />
unterschiedlicher Betroffenheiten. Nur die Gleichheit von Lebenschancen und<br />
Voraussetzungen schafft jedoch überhaupt erst die Bedingung, um Verschiedenartiges leben<br />
zu können. Die Demokratisierung aller Lebensbereiche und die Überwindung von Ausbeutung<br />
und Unterdrückung sind unsere grundlegenden Ziele. Dazu bedarf es der Veränderung von<br />
Strukturen. Solange die patriarchalen Strukturen nicht überwunden sind, bedarf es zudem<br />
gezielter Instrumente, die die Benachteiligung von Frauen ausgleichen.<br />
These 41<br />
Strategie<br />
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist ebenso prägendes Strukturmerkmal des<br />
Patriarchats wie die geringe Beteiligung von Frauen an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher<br />
Macht. Wir brauchen daher eine sanktionierte Regelung für die Teilhabe von Frauen an<br />
262
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Führungspositionen, die Quote in allen Bereichen ist ein wesentliches Instrument, um<br />
Gleichstellung flächendeckend und praktisch umzusetzen. Wir brauchen ein Steuer- und<br />
Sozialrecht, das individuelle Lebensentwürfe fördert und absichert und nicht das männliche<br />
Familienernähermodell. Eine Privilegierung der Ehe durch das Recht lehnen wir ab. Wir<br />
brauchen eine Arbeitsmarktpolitik, die existenzsichernde Beschäftigung schafft, und einen<br />
Arbeitsmarkt, auf dem gleiche und gleichwertige Arbeit gleich bezahlt wird. Wir brauchen eine<br />
berufliche Bildung, die weder typisch weiblich, noch typisch männliche Berufsbilder produziert.<br />
Die Medienlandschaft ist zu einem großen Teil durch Sexismus und Rollenstereotype geprägt<br />
und somit jedeR täglich damit konfrontiert. Wir fordern, dass Medien sich jenseits dieser Bilder<br />
bewegen müssen, damit bestehende Verhältnisse hinterfragt werden und Sexismus nicht<br />
salonfähig bleibt. Gender-Mainstreaming und Gender-Budgeting müssen als praktizierte<br />
Gleichstellungsmaßnahmen überall Anwendung finden. Wir brauchen eine emanzipatorische<br />
Familienpolitik, in der Elternzeit zwingend von Vätern und Müttern je zur Hälfte übernommen<br />
wird. Der (zeitweilige) Ausstieg aus dem Berufsleben ist ein Risiko für die individuelle<br />
Absicherung und stärkt wiederum innerfamiliäre Abhängigkeiten. Dieses Risiko dürfen<br />
zukünftig nicht mehr hauptsächlich die Frauen tragen.<br />
Verantwortung für Familie und gleiche Chancen im Beruf sind dann für alle möglich, wenn<br />
Arbeitszeiten gerechter verteilt und allgemein kürzer werden.<br />
These 42<br />
Feminismus<br />
Die derzeitigen Debatten um den Feminismus des 21. Jahrhunderts sind zwiespältig.<br />
Es ist gut und richtig, dass - bei früheren und aktuellen Versuchen des Roll-Backs und der<br />
Umkehr der Verhältnisse - Frauenfrage und Feminismus wieder zurück und neu auf der<br />
öffentlichen Tagesordnung sind.<br />
Wir wehren uns jedoch gegen den Versuch, Feminismus auf das Feuilleton zu reduzieren. Dem<br />
Vorhaben, Generationen der Frauenbewegung und des Feminismus gegeneinander<br />
auszuspielen, erteilen wir eine Absage. Unsere Verbündeten finden wir überall da, wo die<br />
Frauenfrage das politische Handeln bestimmt.<br />
Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.<br />
263
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Kapitel VI :: Antifaschismus<br />
These 43<br />
Rechtsextremismus<br />
Der Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster, dessen verbindendes Kennzeichen die<br />
Vorstellung von der Ungleichwertigkeit von Menschen ist. Diese äußern sich im politischen<br />
Bereich in der Affinität zu diktatorischen Regierungsformen, chauvinistischen Einstellungen<br />
und einer Verharmlosung bzw. Rechtfertigung des Nationalsozialismus, einer<br />
Volksgemeinschaftsideologie sowie dem Glauben an die Durchsetzung seiner Vorstellungen<br />
durch Gewalt, sei es durch den starken Staat oder durch eigenes Handeln, wie es im Falle<br />
brennender Asylbewerberheime oder militante Neonazis zu sehen war. Im sozialen Bereich<br />
sind sie gekennzeichnet durch antisemitische, fremdenfeindliche und sozialdarwinistische<br />
Einstellungen.<br />
These 44<br />
Formen des Rechtsextremismus<br />
Rechtsextremismus ist kein ausschließliches Jugendproblem. Das Potential an rechtsextremen<br />
Einstellungen ist in der gesamten Gesellschaft und das heißt auch in sämtlichen Altersgruppen<br />
hoch. Inwieweit es für rechtsextreme Gruppierungen gelingt, dieses abzugreifen, ist<br />
unterschiedlich. Seit der Wiedervereinigung ist allerdings zu beobachten, dass die radikale<br />
Rechte vor allem im Ostteil des Landes in ein Vakuum stoßen konnte, dass durch das Fehlen<br />
progressiver gesellschaftlicher AkteurInnen entstand. Die Wahlerfolge der NPD und die<br />
schleichende Etablierung rechtsextremen Kleidungsstils bei Jugendlichen sind Indiz dafür, dass<br />
rechtsextreme Einstellungen von der sogenannten Mitte der Gesellschaft akzeptiert und von<br />
dieser selbst produziert werden.<br />
Trotz ihres desolaten Zustands ist die NPD eines der größten Probleme in diesem<br />
Zusammenhang. Die öffentlichen Mittel helfen der NPD, ihre Strukturen zu verstetigen.<br />
Daneben wird die Zusammenarbeit mit der militanten Neonaziszene intensiviert. Partei und<br />
„freie Kräfte“ vermischen sich indes sehr stark. So bettet die NPD die von freien Kräften<br />
aufgebauten sozialen Netzwerke gezielt ein und stärkt somit ihre Organisationskraft.<br />
NPD-Kader geraten wegen Körperverletzungs- und Volksverhetzungstatbeständen immer<br />
wieder in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Gebietsweise konnte die NPD ihr Drei-<br />
Säulen-Konzept vom Kampf um die Straße, die Köpfe und die Parlamente umsetzen, dort gibt<br />
264
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
es No-Go-Areas, welche in dem Ausmaß ohne die bestehenden Kameradschaftsstrukturen und<br />
deren Netzwerke nie hätten möglich sein können<br />
Neben dem Fokus auf Nationalsozialismus arbeitet die NPD mit der sozialen Frage, wie zum<br />
Beispiel bei ihren Versuch, auf die globalisierungskritische Bewegung anlässlich des G-8-Gipfels<br />
in Heiligendamm im Jahr 2007 aufzuspringen. Die rechtsextreme Kapitalismuskritik ist keine<br />
Fratze oder Vertuschung, sondern fußt auf der Angst vor einer Gefährdung ihrer Ideologeme<br />
Volk und Nation. Die propagierten völkischen Lösungsansätze sind nicht nur falsch, sondern<br />
bedeuten konsequent gedacht, für viele Menschen das sichere Todesurteil.<br />
These 45<br />
Gegenstrategien<br />
Die wichtigsten Elemente bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus sind die Aufklärung und<br />
die Förderung einer antifaschistischen Gegenkultur. Momentan leidet die öffentlich geförderte<br />
antifaschistische Arbeit darunter, dass sie einerseits politischen Konjunkturen und andererseits<br />
spezifischen haushaltspolitischen Konstellationen unterworfen ist. Damit ist es schwierig, eine<br />
nachhaltige Unterstützung auf die Beine zu stellen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist<br />
aber nur wirkungsvoll, wenn er eine langfristige Strategie verfolgt. Eine Lösung, um die<br />
finanziellen Mittel kontinuierlich zu sichern, ist eine Bundesstiftung für Demokratische Kultur.<br />
Ein gut vorbereites NPD-Verbotsverfahren, der auf staatlich alimentierte NPD-Kader als V-<br />
Leute verzichtet, ist eine Möglichkeit, rechtsextreme Strukturen effektiv zu schwächen.<br />
Kampf gegen Rechtsextremismus heißt vor allem, selbst aktiv zu werden. Diejenigen, die<br />
antifaschistische Politik nicht nur als Lippenbekenntnis vor sich her tragen, sondern in<br />
praktische Politik umsetzen, haben unsere Solidarität. Wir empfinden es als Doppelmoral,<br />
wenn zum einen wie im Rahmen des Aufstands des Anständigen von offizieller Seite zum<br />
Kampf gegen Rechts aufgerufen wird und zum anderen diejenigen, die dann aktiv werden,<br />
Strafverfahren kassieren. Ein Ende der Kriminalisierung antifaschistischen Engagements ist für<br />
uns zwingend. Wir verurteilen die ständigen Diffamierungskampagnen gegenüber<br />
AntifaschistInnen und Linksalternativen, die das Ziel haben, Repression zu legitimieren und<br />
unliebsamen kritischen Projekten die Existenzgrundlage zu entziehen. Grundlage dafür ist das<br />
Konzept des politischen Extremismus, welches von einer „vernünftigen“ politischen Mitte<br />
ausgeht. Dies relativiert sich nicht nur die wachsenden Ungleichheitstheorien, wie Rassismus<br />
und Antisemitismus, in der Gesellschaft sondern setzt zudem Antifaschismus mit Nazismus<br />
gleich.<br />
265
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Daneben gilt es, die Problematik stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu<br />
rücken: Rechtsextremismus ist nicht nur dann dramatisch, wenn die NPD wieder einen<br />
Wahlsieg errungen hat, ein jüdischer Friedhof geschändet wurde oder ein besonders brutaler<br />
Angriff auf MigrantInnen stattgefunden hat. Rechtsextremismus ist ein<br />
gesamtgesellschaftliches und dauerhaftes Problem.<br />
These 46<br />
Rassismus<br />
Rassismus soll vermeintlich oder tatsächlich wahrgenommene Unterschiede als Kriterien für<br />
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe rechtfertigen. Damit geht eine Diskriminierung aufgrund<br />
dieser Zugehörigkeit einher.<br />
Rassismus spiegelt sich in der gesamten Gesellschaft in unterschiedlichen Formen wieder. Sei<br />
es durch Wohlstandschauvinismus und Fremdenfeindlichkeit oder durch verbale Entgleisungen<br />
von Personen des öffentlichen Lebens oder in großen deutschen Zeitungen zu Zeiten<br />
sportlicher Großereignisse wie der Fußballweltmeisterschaft. Insbesondere die<br />
Zuwanderungsdebatte wird immer wieder von rassistischen Zwischentönen, gerade von<br />
PolitikerInnen, überlagert. Rechtspopulistisches Gedankengut versucht zudem besonders über<br />
die direkte Auseinandersetzung vor Ort über Moscheebauten zunehmend Zugang zum Diskurs<br />
der bürgerlichen Mitte zu finden und gezielt vorhandene islamfeindliche Ressentiments zu<br />
nutzen. Wir <strong>Jusos</strong> setzen uns für ein Menschenbild ein, das frei ist von<br />
Nützlichkeitserwägungen. In einer offenen Gesellschaft, so wie wir sie fordern, ist kein Platz für<br />
Diskriminierung und Rassismus. Dafür muss ein offensiver Kampf um das gesellschaftliche<br />
Klima stattfinden.<br />
These 47<br />
Flüchtlingspolitik<br />
Ebenso muss es aber ein Umdenken im staatlichen Umgang mit Flüchtlingen und Menschen<br />
ohne deutsche StaatsbürgerInnenschaft geben. Unser Ziel bleibt eine Gesellschaft ohne<br />
Grenzen. Wir wollen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben dort zu leben, wo sie wollen<br />
und fordern ein globales Recht auf Migration ein. Alles, was dazu beiträgt, dass Menschen<br />
daran gehindert werden, in dieses Land zu kommen, findet unsere Kritik.<br />
Wir wollen, dass das Asylrecht im Grundgesetz wiederhergestellt wird und kämpfen für einen<br />
menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen. Das Schnellverfahren am Flughafen, die<br />
Residenzpflicht und Abschiebegefängnisse sind für uns nicht akzeptabel und gehören<br />
abgeschafft.<br />
266
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 48<br />
Antisemitismus<br />
Im Gegensatz zum Rassismus wird im Antisemitismus das Judentum nicht nur mit<br />
Unterlegenheitsmerkmalen gekennzeichnet, sondern auch als gefährlicher Akteur des<br />
globalen Finanzkapitals gegen das einheimische produktive Kapital gesehen.<br />
Die Shoa mit über sechs Millionen industriell ermordeten Jüdinnen und Juden war ein<br />
unfassbarer, entsetzlicher Tiefpunkt des jahrhundertealten Antisemitismus und eine spezielle<br />
Folge des vor allem in Deutschland seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreiteten<br />
völkischen Antisemitismus. Der Holocaust wurde in seiner vernichteten Qualität erst möglich,<br />
weil die AntisemitInnen das Konstrukt einer „jüdischen Rasse“ schufen, die, im Gegensatz zum<br />
religiösen Antijudaismus, nur durch Vernichtung beseitigt werden könne. Diese Denktradition<br />
gibt es vor allem im deutschen Antisemitismus noch immer.<br />
Antisemitismus ist auch heute noch eine ernstzunehmende Gefahr. Ausdruck finden diese<br />
Überzeugungen zum einen in Opfer-Täter-Verdrehungen, geschichtsrevisionistischen<br />
Meinungen, die vor allem im rechtsextremen Spektrum von der Relativierung des Holocaust bis<br />
zur Leugnung desselben reichen. Weltverschwörungstheorien kursieren, die Jüdinnen und<br />
Juden in den Mittelpunkt dunkler Machenschaften rücken und ihnen als Kollektiv den Griff<br />
nach der Weltherrschaft und Unterdrückung anderer unterstellen. Aber auch außerhalb<br />
ausgewiesener Rechtsextremisten gibt es Aussagen aus der Mitte der Gesellschaft, die<br />
verlangen, die Erfahrungen des Holocaust zu relativieren und einen „Schlussstrich“ unter die<br />
Geschehnisse zu setzen. Für uns existiert eindeutig die Verantwortung dafür zu sorgen, dass<br />
solche Verbrechen nie wieder passieren. Auch heute ist es leider in Deutschland eine Tatsache,<br />
dass Synagogen, jüdische Kindergärten und andere jüdische Einrichtungen von der Polizei<br />
geschützt werden müssen. Daher kann es aus unserer Sicht keinen Schlussstrich geben.<br />
These 49<br />
Antisemitismus in Form von Israelkritik<br />
Innerhalb der politischen Kultur Deutschlands wird offener Antisemitismus nicht mehr als<br />
legitime politische Meinung anerkannt. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein<br />
konsistenter Antisemitismus nach wie vor in der deutschen Gesellschaft virulent ist und der<br />
Antisemitismus statt eines offenen Bekenntnisses zur Judenfeindschaft über andere Ventile<br />
artikuliert wird. So kann Kritik, die am Staate Israel geübt wird, ein Ventil für Antisemitismus<br />
sein. Darüber hinaus sind Vergleiche der israelischen Politik heute mit der<br />
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik der Jahre 1933-45 für uns nicht akzeptabel.<br />
267
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Der Versuch, sich der deutschen Täterrolle zu entledigen, indem überzogene Kritik am Staate<br />
Israel formuliert und im Nahost-Konflikt einseitig Stellung zugunsten der Palästinenser<br />
bezogen wird, ist ein Beispiel für ein solches Ventil. Der Nahost-Konflikt ist weitaus komplexer<br />
und nicht in einfachen schwarz-schweiß-Bildern beschreibbar. Oftmals geht aber die<br />
gesellschaftliche Diskussion gerade in diese Richtung. Gerade aus der deutschen Gesellschaft<br />
werden den Israelis Methoden innerhalb dieses Konfliktes vorgeworfen, die mit der<br />
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik der Jahre 1933-45 assoziiert werden. Darüber<br />
hinaus akzeptieren wir es aber auch nicht, dass sich die deutsche Politik seiner besonderen<br />
Rolle in der Region durch eine einseitige Stellungnahme im Nah-Ost-Konflikt entledigt. Eine<br />
einseitige Stellungnahme zu Gunsten einer der Parteien verfälscht die Tragweite des Konflikts.<br />
Wir sehen unsere politische Verantwortung darin, in der Gesellschaft und vor allem in der<br />
gesellschaftlichen Linken für ein differenziertes Israelbild zu werben. Wir <strong>Jusos</strong> denken weiter<br />
und setzen uns gerade mit unserem Projekt WBC für eine für beide Seiten gerechte, politische<br />
Lösung des Nahost-Konflikts ein. Wir sind für das Existenzrecht Israels und für einen<br />
palästinensischen Staat. Die Zweistaatenlösung ist für uns das politische Ziel, da wir der<br />
Überzeugung sind, dass zwei stabile, demokratische Staaten die grundlegende Voraussetzung<br />
für Sicherheit sind. Gruppierungen, die sich mit der Hamas oder anderen radikalislamistischen<br />
Bewegungen solidarisieren oder das Existenzrecht Israels negieren, stellen für uns keine<br />
BündnispartnerInnen dar. Die Bekämpfung des Antisemitismus muss auch dort mit<br />
Konsequenz geführt werden, wo er sich als scheinbar legitime Kritik am Staat Israel tarnt. .<br />
Antisemitismus ist in allen seinen Formen das Gleiche: eine menschenverachtende,<br />
mörderische Ideologie.<br />
Kapitel VIII ::<br />
Internationalismus - Antimilitarismus<br />
These 50<br />
Internationalismus<br />
Wir <strong>Jusos</strong> sehen uns als sozialistischen, feministischen und internationalistischen<br />
Richtungsverband. Das bedeutet die internationale Arbeit ist Teil der tag täglichen Arbeit des<br />
ganzen Verbandes. Unsere Ideen und unser Kampf hören nicht an den Landesgrenzen auf. Wir<br />
<strong>Jusos</strong> denken international.<br />
Wir arbeiten an einer Bewegung internationaler Solidarität. Wir <strong>Jusos</strong> wissen, dass wir<br />
Veränderungen nur in Kooperation mit anderen fortschrittlichen Organisationen auf regionaler<br />
und internationaler Ebene, erreichen können. Deshalb engagieren wir uns in internationalen<br />
268
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Organisationen wie der IUSY, der ECOSY und mit unserem Projekt WillyBrandtCentrum in<br />
Jerusalem.<br />
Wir setzen uns ein für eine gerechte Weltordnung. Der globale Kapitalismus in seiner heutigen<br />
Form produziert wenige GewinnerInnen und viele VerliererInnen. Eine Produktionsweise die<br />
allein auf Gewinnmaximierung basiert, nimmt keine Rücksicht auf soziale und ökologische<br />
Folgewirkungen und widerspricht damit einer nachhaltigen Entwicklung. Es geht deshalb<br />
darum die Globalisierung nicht nur zu gestalten, sondern diese Welt nachhaltig zu verändern.<br />
Eine andere Welt ist notwendig.<br />
Die Spaltung der Welt konnte bis jetzt nicht überwunden werden. Die Nord-Süd Frage stellt<br />
sich heute immer noch, die zum Millennium ausgerufenen Ziele, die Armut zu halbieren oder<br />
z.B. mehr Menschen den Zugang zu sauberen Trinkwasser zu gewähren, werden aller<br />
Wahrscheinlichkeit nicht eingelöst werden können. Entwicklungshilfe ist deshalb für uns keine<br />
Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbst bestimmtes<br />
Leben in Würde. Nach diesem Ziel muss Entwicklungshilfe ausgerichtet werden und nicht nach<br />
den Interessen der deutschen Wirtschaft, wie das oft der Fall ist.<br />
These 51<br />
Friedenspolitik<br />
Der Kampf gegen die Militarisierung der Gesellschaft stand immer schon im Mittelpunkt<br />
unserer Organisation. Die Anfänge der <strong>Jusos</strong> waren geprägt durch den Kampf gegen den Ersten<br />
Weltkrieg. Gegen den Burgfrieden mit dem Kaiser und den bürgerlichen Parteien und den<br />
aufkommenden Nationalismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß die Parole „Nie wieder<br />
Faschismus! Nie wieder Krieg!“.<br />
Kriege werden nicht aus altruistischen Gründen geführt. Um als SozialistIn und AntmilitaristIn<br />
(wohlgemerkt nicht als PazifistIn) den Charakter einer militärischen Auseinandersetzung zu<br />
bestimmen, müssen die ökonomischen Grundlagen und die weltpolitische Rolle der beteiligten<br />
Staaten sowie der nichtstaatlichen Akteure analysiert werden.<br />
These 52<br />
Militarisierung der deutschen Außenpolitik<br />
Heute im Jahr 2008 sind wir konfrontiert mit einer rasanten Normalisierung des Krieges als<br />
legitimes Mittel der deutschen Politik.<br />
269
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die Strategie der kontinuierlichen Gewöhnung an die weltweiten Bundeswehreinsätze 1992 in<br />
Kambodscha, 1993 in Somalia, 1995 mit der SFOR in Bosnien hatte Erfolg. Die Akzeptanz<br />
gegenüber militärischen Einsätzen stieg in der Bevölkerung mit jedem Mal. Das Ziel<br />
Deutschlands, auf der internationalen Ebene nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch<br />
eine gleichberechtigte Rolle zu spielen, war mit der Beteiligung am Kosovo-Krieg endgültig<br />
erreicht. Der Kosovo-Krieg war ein Wendepunkt der deutschen Außenpolitik, da sich<br />
Deutschland das erste Mal in der Nachkriegs-Ära an einem Angriffskrieg beteiligt hat. Diesen<br />
Kriegseinsatz hat unter Rot-Grün stattgefunden und wurde von Rot-Grün innenpolitisch<br />
durchgesetzt. Dort wurde letztlich erfolgreich versucht, die Zustimmung der Bevölkerung mit<br />
einer besonders bekämpfenswerten Legitimationsstrategie, indem Hitler- und Auschwitz-<br />
Vergleiche über die deutsche Medienlandschaft hinwegrollten, zu erreichen.<br />
Seither geht es nicht mehr um eine Grundsatzfrage, sondern darum ob und wann. Ja zu<br />
Afghanistan und nein zum Irak, so lässt sich kurz die Politik der Sozialdemokratie im Moment<br />
charakterisieren.<br />
These 53<br />
„Neue Kriege“<br />
Legitimiert wird diese Wende durch ein neues Bild des Krieges, das Bild eines sauberen Krieges<br />
soll gezeichnet werden. Man spricht von chirurgischen Eingriffen und zielgenauem Bomben.<br />
Das wahre Gesicht des Krieges soll vertuscht werden.<br />
Oberste Priorität hat es inzwischen nach Außen den Schein zu wahren. Das Risiko von Bildern<br />
toter Soldaten, die das schöne Bild scheinbar ungefährlicher Kriege stören könnten, wird durch<br />
Luftkriege oder durch Vergabe von gefährlichen Aufträgen an private Söldnerfirmen minimiert.<br />
Die Realität sieht anders aus: Es gibt keinen neuen Krieg, kein humanes Gesicht des Krieges. In<br />
mehr als 40 Staaten herrscht derzeit Krieg oder Bürgerkrieg. Das in den Genfer Konventionen<br />
niedergelegte Prinzip der Unterscheidung zwischen SoldatInnen und ZivilistInnen wird in den<br />
heutigen Kriegen weitgehend missachtet. Am Anfang des vorigen Jahrhunderts waren 95<br />
Prozent der Kriegsopfer Soldaten. Inzwischen stieg der Anteil der zivilen Opfer auf 90 Prozent.<br />
Russland und die USA sprechen inzwischen auch offen von Aufrüstung, nachdem jahrelang<br />
unter dem Deckmantel der Professionalisierung von Armeen aufgerüstet wurde. Selbst der<br />
nukleare Erstschlag findet sich in offiziellen Papieren wieder. Auch die Staaten der EU sind<br />
zentral an Aufrüstung beteiligt. Angriffskriege werden heute nicht mehr geächtet.<br />
270
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 54<br />
Bundeswehr<br />
Es fehlt heute an einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Militär. Ziel ist die Schaffung<br />
einer neuen Normalität des Militärs, öffentliche Gelöbnisse sind ein Ausdruck dessen.<br />
In Deutschland wird die Bundeswehr mehr als Friedenshelfer und Brunnenbauer gesehen, als<br />
als das, was sie ist: eine Armee. Das Hamburger Parteiprogramm ist nur voll des Lobes über die<br />
Bundeswehr. Kritische Töne sind unerwünscht. Für uns ist das Militär Teil des Problems und<br />
nicht Teil der Lösung. Wir arbeiten langfristig an einer Welt ohne Militär.<br />
Des Weiteren gilt für uns: jeder hat das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Wir<br />
setzen uns darüber hinaus für die Abschaffung der Wehrpflicht ein.<br />
These 55<br />
Rolle von Entwicklungspolitik<br />
Im Zuge der neuen Militärstrategie wird die Entwicklungspolitik immer mehr in die<br />
Einsatzplanung miteinbezogen.<br />
NGOs übernehmen Stück für Stück militärische Aufgaben, wenn sie sich z.B. um ZivilistInnen in<br />
besetzten Gebieten kümmern.<br />
Entwicklungspolitik wird aber auch als Argument für Kriegseinsätze herangezogen. Der Schutz<br />
von NGOs vor Ort wird zum offiziellen Grund Militär zu stationieren, wie es z. B. in Afghanistan<br />
geschehen ist.<br />
Wir lehnen eine Militarisierung der Entwicklungspolitik ab.<br />
Entwicklungspolitik ist für uns aber mehr als nur Engagement von NGOs. Entwicklungspolitik<br />
steht für uns SozialistInnen unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Dazu gehört nicht nur die<br />
Sicherheit des Landes oder der Region, sondern vor allem die Hilfe beim Aufbau von Strukturen.<br />
Dies bedeuten der Aufbau von Infrastruktur, Wirtschaft und Bildung, sowie die Verbesserung<br />
des Zugangs zu essentiellen Ressourcen wie Wasser, Verbesserung der Gesundheitsversorgung.<br />
Im Zentrum muss die Armutsbekämpfung stehen. Dafür muss die Zivilbevölkerung vor Ort<br />
einbezogen werden. Entwicklungspolitik kann aber nicht nur als Korrektiv der anderen<br />
Politikfelder gesehen werden. Vielmehr ist damit die nachhaltige Durchdringung allen<br />
politischen Handelns mit entwicklungspolitischem Denken gemeint. Vor allem gilt dies für<br />
Europäische Handels- und Agrarpolitik. Deshalb fordern wir fairen Handel, auch mit den<br />
ärmsten Regionen dieser Welt und den Abbau der Agrarsubventionen. Das Ziel muss dabei<br />
echte Armutsbekämpfung, und nicht nur die Steigerung des Wirtschaftswachstums sein.<br />
271
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 56<br />
Nationalismus<br />
Eng verbunden mit der Frage der Militarisierung war und ist die Frage des Nationalismus und<br />
des Chauvinismus. Wir <strong>Jusos</strong> lehnen es ab, uns in unseren Ideen und Zielen auf ein Land zu<br />
beschränken. Unser Ziel bleibt die perspektivische Überwindung von Nation und<br />
Nationalismus.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> sind internationalistisch. Wir verlieren die Folgen von Politik nicht aus dem Blickfeld,<br />
wenn sie die Landesgrenzen überschreite. Wir machen Politik für Menschen – für Menschen<br />
weltweit. Für uns gibt es kein legitimes deutsches Interesse. Wer für Frieden kämpfen will, der<br />
muss auch nein sagen zu Standortwettkämpfen. Wir stehen ein für eine gerechte Welt.<br />
These 57<br />
Prävention<br />
Prävention wird immer mehr degradiert auf Gespräche und offizielle Tagungen und damit<br />
Stück für Stück delegitimiert und als wirkungslos dargestellt. Prävention ist nicht Dialog,<br />
sondern soll Dialog ermöglichen. Prävention schafft ein Umfeld, in dem es möglich ist,<br />
Konflikte gewaltfrei zu lösen. Prävention bedeutet, eine internationale rechtliche Regulierung<br />
zu schaffen und dieses auch mit Leben zu füllen.<br />
Wir stehen für die Fortführung einer aktiven und zivilen Friedenspolitik wie sie in Deutschland<br />
durch Willy Brandt geprägt worden ist. Für uns als <strong>Jusos</strong> ist klar, das Krieg niemals wieder ein<br />
legitimes Mittel der Politik sein darf und treten national wie international für dessen Ächtung<br />
ein.<br />
Wir stehen ein für Systeme der kollektiven Sicherheit, wie die UN. Um diesen Anspruch gerecht<br />
zu werden muss die UN aber handlungsfähiger werden. Wir setzen uns dafür ein, dass mehr<br />
Geld für zivile Konfliktlösung ausgegeben wird als für Aufrüstung und wir kämpfen für die<br />
Ausweitung und Einhaltung von Abrüstungsverträgen im Rahmen der internationalen<br />
Organisationen.<br />
Prävention bedeutet, dass eine gerechte Weltwirtschaftsordnung angestrebt wird, von der alle<br />
Menschen profitieren.<br />
272
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
These 58<br />
Ein soziales Europa<br />
Wir <strong>Jusos</strong> haben als internationalistischer Richtungsverband immer für die Integration der<br />
europäischen Staaten gekämpft. Die Überwindung der europäischen Nationalstaaten war<br />
dabei stets unser Leitbild. Die Nationalstaaten sind noch nicht überwunden, dennoch ist<br />
Europa heute bereits in vielen Bereichen Realität. Europa muss uns <strong>Jusos</strong> aber mehr sein als ein<br />
gemeinsamer Binnenmarkt und eine Wirtschafts- und Währungsunion. Das heutige Europa der<br />
27 Mitgliedsstaaten muss ein soziales Europa sein.<br />
Um eine Abwärtsspirale bei Löhnen und Sozialleistungen in Europa zu verhindern, brauchen<br />
wir soziale Mindestnormen auf europäischer Ebene. Wir <strong>Jusos</strong> fordern daher ein System<br />
europäischer Mindestlöhne, eine europäische Höchstarbeitszeit und eine EU einheitliche<br />
Mindestbesteuerung von Unternehmen durch eine EU-Körperschaftsteuer. Wir fordern darüber<br />
hinaus auch die Demokratisierung der europäischen Wirtschaft durch Mitbestimmung in den<br />
Betrieben. Wir setzen uns daher für die Schaffung Europäischer Betriebsräte ein.<br />
Europa ist nach Innen heute weitgehend ein Europa ohne Grenzen. Nach Außen ist Europa aber<br />
zu einer Festung geworden. Aus Entwicklungsländern ist es nahezu unmöglich geworden, nach<br />
Europa zu reisen, geschweige denn einzuwandern. Diese Entwicklung betrachten wir mit<br />
großer Sorge und fordern daher die Öffnung der Außengrenzen der Europäischen Union.<br />
Der Demokratisierungsprozess der europäischen Union muss fortgesetzt werden, um ein<br />
Europa für die Menschen und nicht für Wirtschaftsinteressen zu schaffen. Wir <strong>Jusos</strong> setzen uns<br />
für die umfassende legislative Kompetenz des Parlamentes ein. Es ist ein demokratisch<br />
legitimiertes Gremium, das die Bürgerinnen und Bürger Europas vertritt und muss deshalb die<br />
Entscheidungsbefugnisse zugesprochen bekommen, anstelle der nur indirekt legitimierten<br />
Exekutivorgane.<br />
Wir <strong>Jusos</strong> haben als internationalistischer Richtungsverband immer für die Integration der<br />
europäischen Staaten gekämpft. Die Überwindung der europäischen Nationalstaaten war<br />
dabei stets unser Leitbild. Die Nationalstaaten sind jedoch noch nicht überwunden, dennoch ist<br />
Europa heute bereits in vielen Bereichen Realität. Ohne die europäische Dimension können<br />
viele Aufgaben wie beispielsweise der Klimawandel gar nicht mehr bewältigt werden. So<br />
stehen die europäischen Staaten vor ähnlichen Problemen, die nur gemeinsam effektiv gelöst<br />
werden können.<br />
273
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Europa muss für uns <strong>Jusos</strong> aber mehr sein als ein gemeinsamer Binnenmarkt und eine<br />
Wirtschafts- und Währungsunion, denn wirtschaftliche und soziale Integration sind zwei<br />
Seiten einer Medaille. Deshalb müssen auch auf europäischer Ebene Systeme des sozialen<br />
Ausgleichs geschaffen werden um den Standortwettbewerb einzudämmen, der soziale und<br />
ökologische Standards ruiniert.<br />
Soziales Europa: Das geht am Besten durch die Solidarisierung der Arbeitnehmerschaft auf<br />
europäischer Ebene. Deshalb fordern wir, Betriebsräte und die arbeitende Bevölkerung in ihren<br />
Rechten zu stärken und Eurobetriebsräte und europäische Gewerkschaften auszubauen. Wir<br />
kämpfen gegen die Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte und fordern stattdessen<br />
Mindestnormen im Arbeitsrecht auf europäischer Ebene. Dazu zählen Mindestlöhne,<br />
Höchstarbeitszeiten und europäische Konten für Leistungsansprüche aus Sozialkassen.<br />
Die EU braucht nach unserem Verständnis eine steuerpolitische Kompetenz um<br />
Steuerdumping innerhalb der Union zu stoppen. Wir setzen daher für Mindeststeuersätze in<br />
der EU ein um eine Harmonisierung der Steuern zu erreichen. Die Geldpolitik der EZB muss<br />
überdacht werden. Wir wollen, dass sich die Geld- und Fiskalpolitik nicht mehr einseitig auf die<br />
Geldwertstabilität konzentriert.<br />
Leider wird Europa, obwohl es für die Öffnung der Grenzen steht, nach Außen immer mehr zur<br />
Festung Europa, anstatt eine multikulturelle Union zu werden. Wir <strong>Jusos</strong> kritisieren daher<br />
scharf die zum Teil unmenschliche Flüchtlingspolitik der EU. Internationale Solidarität sollte<br />
nationale und kontinentale Grenzen überwinden. Entwicklungszusammenarbeit mit anderen<br />
Ländern muss ein größeres Gewicht bekommen.<br />
Wir wollen eine europäische Partei werden! Die SPE soll die Mutterpartei aller europäischen<br />
SozialdemokratInnen werden. Die Forderung nach einer sozialdemokratischen europaweiten<br />
Bewegung darf nicht weiter eine Phrase bleiben. Die SPE muss gestärkt werden. Den<br />
neoliberalen und neokonservativen Kräften, dem durch die Lissabon Strategie zum Selbstzweck<br />
erhobenen Wettbewerbsparadigma und der einseitigen, auf die wirtschaftliche Integration<br />
bezogene Einigung kann nur eine schlagfertige und kraftvolle sozialdemokratische Bewegung<br />
auf Europäischer Ebene entgegen treten. Wir müssen der Vorreiter der Politisierung<br />
Europäischer Politik sein.<br />
274
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Kapitel IX ::<br />
Die Ökologie und die Linke<br />
These 59<br />
Ökologie innerhalb der Sozialdemokratie<br />
In der Vergangenheit waren es in besonderem Maße die <strong>Jusos</strong>, die ökologische Fragestellungen<br />
in die Sozialdemokratie herein getragen haben. Ohne die <strong>Jusos</strong> wäre es fraglich, ob die SPD<br />
heute so vehement für den Atomausstieg kämpfen würde. Doch ist es uns bisher nicht<br />
gelungen, Ökologiepolitik stringent innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Analyse zu<br />
entwickeln. Als SozialistInnen glauben wir nicht daran, dass eine Rückkehr zu einer<br />
„ursprünglichen“ Lebensweise die Lösung des Problems ist. Das stellt vielmehr eine reaktionäre<br />
Antwort auf die drängenden Fragen im Umweltbereich dar. Dies war der Denkfehler vieler<br />
AktivistInnen der Ökologieszene. Mittels solcher Konzepte versucht mittlerweile auch die<br />
politische Rechte an die Umweltbewegung anzudocken.<br />
These 60<br />
Schwierigkeit linker Ökologiepolitik<br />
Linke Umweltpolitik bewegt sich in verschiedenen Spannungsfeldern. Dazu gehört, dass der<br />
technische Fortschritt einerseits einen höheren Lebensstandard, eine höhere Mobilität und<br />
bessere Kommunikation und damit Fortschritt im Interesse der Menschen geschaffen hat.<br />
Andererseits baut dieser technische Fortschritt aber auch auf der Zerstörung der natürlichen<br />
Lebensgrundlagen auf, einer der Quellen des menschlichen Reichtums. Linke Umweltpolitik<br />
muss deshalb darauf abzielen, die technische Entwicklung so weiterzuführen, dass der Erhalt<br />
der natürlichen Lebensgrundlagen verbunden mit weiterem Wohlstand erreicht werden kann.<br />
Dies schließt auch ein, dass die Länder des Südens zum westlichen Lebensstandard<br />
aufschließen können. Umweltpolitik kann und darf nicht als Argument gegen die<br />
Entwicklungschancen der Länder des Südens verwendet werden. Die „Versöhnung“ von<br />
technischem Fortschritt mit der Ökologie ist möglich. Sie setzt aber politisches Handeln voraus.<br />
Marktmechanismen können sie nicht schaffen.<br />
Die umweltpolitischen Folgen dieser Entwicklung können wir allerdings trotzdem nicht außer<br />
Acht lassen. Der globale Klimawandel und der Einfluss der Menschheit auf selbigen ist<br />
heutzutage naturwissenschaftlicher Konsens. Wir können diese Entwicklung nicht mehr<br />
aufhalten, sondern allenfalls abmildern. Um dies zu erreichen, bedarf es gewaltiger<br />
Anstrengungen, bei denen den westlichen Industrieländern als Hauptverursachern bis dato die<br />
primäre Verantwortung zukommt.<br />
275
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Die zu erwartenden Folgen des Klimawandels sind vielfältig und werden verschiedene<br />
Konsequenzen haben. Während die Erwärmung für einige Regionen der Welt zu besseren<br />
landwirtschaftlichen Bedingungen und mehr Niederschlag führen wird, sind für andere<br />
Gegenden verheerende Folgen wie Dürre, Überschwemmung und extreme Wetterereignisse zu<br />
erwarten. Fakt ist, dass die sich entwickelnden Länder im Äquatorbereich die gravierendsten<br />
Konsequenzen der globalen Erwärmung zu ertragen haben werden, obwohl sie minimal zu<br />
dieser beigetragen haben.<br />
Außerdem stehen wir vor der Herausforderung, dass die aufstrebenden Schwellenländer mit<br />
hohen Wachstumsraten ihre Industrialisierung vorantreiben und in immer stärkerem Ausmaß<br />
die lokale und globale Umwelt belasten.<br />
Als Sozialistinnen und Sozialisten stehen wir für eine Umweltpolitik ein, die sich ihrer sozialen<br />
Folgewirkungen bewusst ist und versucht, diese zu vermeiden oder, wo dies nicht möglich ist,<br />
durch Umverteilungspolitik auszugleichen.<br />
Wir fordern für alle das gleiche Recht auf Teilhabe. Dies schließt Mobilität und Teilhabe am<br />
technischen Fortschritt für alle ein, unabhängig von ihrer finanziellen Situation Deswegen<br />
wollen wir, dass für alle Energie bezahlbar bleibt. Wir wissen aber auch, dass durch die<br />
kurzfristige Profitlogik des Kapitalismus politische Handlungslosigkeit in die ökologische<br />
Katastrophe führen würde. Klimaveränderungen und Umweltprobleme sind langfristigen<br />
Zeitspannen unterworfen. Das Klima verhält sich träge, das heißt, Effekte politische<br />
Maßnahmen sind teilweise erst in 30 Jahren spürbar.<br />
Diese langen Zeiträume widersprechen der immanenten Logik des Kapitalismus. Seine zuvor<br />
erwiesene Flexibilität, auf Veränderungen zu reagieren, wird deshalb voraussichtlich im<br />
umweltpolitischen Bereich ins Leere laufen. Das erfordert politische Reaktionen. Dem Staat<br />
kommt die Aufgabe zu, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel zu organisieren<br />
und zu fördern. Die Impulse müssen von links kommen, da sich ansonsten neue<br />
gesellschaftliche und soziale Spaltungen entlang der Ökologiefrage auftun werden. Das<br />
Dilemma sozialistischer Politik ist aber, dass wir bisher noch keine überzeugenden Antworten<br />
von links auf diese Entwicklungen formulieren konnten.<br />
These 61<br />
Linke Ökologiepolitik<br />
Wir wollen eine moderne Umweltpolitik, die sich nicht gegen den technischen Fortschritt<br />
richtet, sondern auf ihn aufbaut und ihn fördert. Wir möchten nicht, dass dies zu<br />
276
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Entwicklungshindernissen für die Weltregionen außerhalb der westlichen Hemisphäre führt.<br />
Das bedeutet aber auch, dass damit die reichen, entwickelten Staaten eine besondere<br />
Verantwortung haben. Trotz aller Diskussionen, dass die Verknappung fossiler Brennstoffe<br />
scheinbar auf den „Energiehunger“ aufstrebender Staaten wie China und Indien<br />
zurückzuführen ist, bleibt festzuhalten, dass der mit Abstand größte pro Kopf<br />
Energieverbrauch immer noch in den entwickelten Industriestaaten erfolgt. Die Folgen spüren<br />
vor allem die Menschen in den armen Regionen dieser Welt. Wir wollen internationale<br />
Abkommen, die zu geringeren CO2-Emissionen und mehr Umweltschutz führen und fordern<br />
eine sinnvolle Gestaltung des globalen Emissionshandel Wir sind uns zugleich aber bewusst,<br />
dass zuallererst Handlungsbedarf bei uns selbst besteht, bevor wir mittels Machtpolitik,<br />
Abkommen und mit dem moralischen Zeigefinger sozialen Fortschritt für Menschen aus<br />
anderen Weltregionen erschweren, indem wir ihnen das verweigern, was wir selbst zuvor für<br />
uns beansprucht haben.<br />
Heutige ökologische Probleme sind sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene immer<br />
stärker Probleme der sozialen Gerechtigkeit und Teilhabe. Der Zugang zu natürlichen<br />
Ressourcen wird kontinuierlich erschwert. Elektrizität, Wärme, saubere Luft und sauberes<br />
Wasser sind in weiten Teilen der Welt Luxusgüter und könnten dies unter Einfluss des<br />
Klimawandels in immer größerem Maße werden. Unser Selbstverständnis als<br />
internationalistischer Richtungsverband gebietet uns, hier mit progressiven Vorschlägen für<br />
eine neue ökologische Gerechtigkeit zu kämpfen.<br />
Die wechselseitigen Abhängigkeiten der globalisierten Welt zeigen sich besonders im Energieund<br />
Rohstoffbereich. Machtpolitisches Kalkül führt häufig zu mangelnder zwischenstaatlicher<br />
und internationaler Solidarität. Wir <strong>Jusos</strong> wollen diesen Zustand der Abhängigkeiten<br />
überwinden.<br />
These 62<br />
Konkrete Handlungsansätze<br />
Wir wollen den technologischen Fortschritt zum Wohle der Menschheit nutzen. Wir müssen<br />
Konzepte dafür entwickeln, wie Technologie nicht kurzfristigen Profiten nutzt, sondern<br />
vernünftig, Energie schonend und den Lebensstandard erhaltend zum Einsatz kommen kann.<br />
Der sich beschleunigende Klimawandel muss bekämpft werden. Deutschland und Europa<br />
kommt hierbei die Pflicht zu, Treibhausemissionen drastisch zu senken. Gleichzeitig haben wir<br />
die finanziellen Möglichkeiten, den ökologischen Umbau unserer Energiewirtschaft und<br />
277
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
unserer industriellen Landschaft voran zu treiben. Notwendig wird eine rasche Steigerung der<br />
Energieeffizienz im privaten, kommerziellen sowie industriellen Bereich.<br />
Bei der Energieerzeugung liegt die Zukunft in den erneuerbaren Energien. Für den Übergang in<br />
das „solare Zeitalter“ basierend auf Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft, nachhaltiger<br />
Biomasse und weiteren fortschrittlichen Energieträgern brauchen wir jedoch<br />
Brückentechnologien. Da wir die risikoreiche und letztendlich teure Atomenergie ablehnen,<br />
verbleiben hierfür einzig die fossilen Energieträger Kohle, Gas und Erdöl.<br />
Um diesen Wandel zu ermöglichen, muss die Energiewirtschaft grundlegend umgestaltet und<br />
in öffentliche Verantwortung überführt werden. Die Erfahrungen mit den liberalisierten<br />
Energiemärkten zeigen, dass diese weder zu ökologischem Fortschritt noch zu günstigeren<br />
Preisen geführt haben. Um eine dezentrale und damit ökologischere Energieversorgung bei<br />
gleichzeitig bezahlbaren Preisen aufzubauen, ist daher eine Verstaatlichung der zentralen<br />
Energieumwandlung und der Übertragungsnetze sowie eine Rekommunalisierung der lokalen<br />
Energieumwandlung, der Energieverteilung und -belieferung notwendig.<br />
Essentieller Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe ist Mobilität. Diese muss für alle<br />
gewährleistet werden. Dabei kommt dem öffentlichen Personennahverkehr eine besondere<br />
Rolle zu. Dieser muss als Element der öffentlichen Daseinsvorsorge erhalten, gefördert und<br />
ausgebaut werden.<br />
Die Bildungsanstrengungen im ökologischen Bereich müssen entscheidend verbessert werden.<br />
Nur wer ausreichend informiert ist, kann am technischen Fortschritt teilnehmen und im<br />
eigenen Interesse einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten. Alle Lebens- und<br />
Wirtschaftsbereiche müssen natürliche Ressourcen auf effizienteste Art und Weise nutzen.<br />
Ökologische Industriepolitik stellt für uns einen richtigen Ansatz dar. Neben der<br />
kontinuierlichen Modernisierung bestehender Wirtschaftszweige müssen zusätzliche<br />
fortschrittliche Technologien von staatlicher Seite aktiv gefördert werden. Die Rolle des Staates<br />
als Pionier ist hierbei von entscheidender Bedeutung.<br />
Wir verwahren uns gegen Maschinenstürmerei in dem Glauben, eine Lösung der<br />
Umweltproblematik sei nur durch den Verzicht auf erreichten Lebensstandard und technischen<br />
Fortschritt möglich. Genauso verwahren wir uns vor einem undifferenzierten quasireligiösen<br />
Glauben, dass technischer Fortschritt automatisch die Lösung der Umweltproblematik mit sich<br />
bringe. Es kommt erstens darauf an, unkalkulierbare Folgen des technologischen Fortschritts zu<br />
benennen und zu begrenzen, und zweitens, den Fortschritt in einem aufklärerischen und im<br />
278
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Sinne der Vernunft zum Wohle der Menschheit zu nutzen. Dies schließt seine<br />
umweltpolitischen Auswirkungen mit ein.<br />
Kapitel IX ::<br />
Zum Finale<br />
These 63<br />
Kollektiv und Individuum<br />
„Alle unsere Bemühungen um Befreiung waren bedingt vom Versuch, die Vorherrschaft der<br />
Autoritäten abzuwerfen und endlich dorthin zu gelangen, wo wir selbst zu urteilen und zu<br />
bestimmen hatten. Dabei gerieten wir immer wieder vor die von oben, die uns erklärten, wir<br />
wüssten nicht, was das Richtige für uns sei und dass deshalb die Führung für uns handeln<br />
müsse...<br />
Dies ist es, was ich sagen wollte. Dass keine Gleichheit vorhanden ist. Dass wir immer, so sehr<br />
wir uns auch um Unabhängigkeit bemühen, auf jemanden stoßen, der uns vorschreibt, was wir<br />
zu tun haben. Dass wir unaufhörlich reglementiert werden. Dass alles, was uns vorgesetzt<br />
wird, noch so richtig sein kann, und dass es doch falsch ist, solange es nicht von uns, von mir<br />
selbst kommt.“ (Peter Weiss)<br />
Sozialistische Politik bei den <strong>Jusos</strong> stellt das Individuum vor Schwierigkeiten, mit denen wir<br />
solidarisch und unterstützend umgehen müssen. SozialistIn zu sein heißt heute, in der<br />
Gesellschaft eine AußenseiterInnenrolle einzunehmen. Viele politische Kämpfe werden aus der<br />
Defensive geführt und/oder verloren. Die Auseinandersetzung mit dieser Schwierigkeit sollte<br />
nicht nur individuell erfolgen, sondern gehört auch zu einer solidarischen gemeinsamen<br />
politischen Arbeit.<br />
Die Praxis sozialistischer Politik hat einen Moment von Befreiung, weil sie zeigt, dass über<br />
Grenzen unserer Gesellschaft hinaus gedacht werden kann. Es zeigt, dass es auch andere<br />
Menschen gibt, die ebenfalls die Verhältnisse überwinden wollen, deren Schranken jedes<br />
Individuum irgendwann im Laufe seines Lebens zu spüren bekommt.<br />
Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kollektive auch Zwang und Druck<br />
ausüben können. Das Spannungsverhältnis von Kollektiv und Individuum ist uns bewusst, kann<br />
jedoch zu keiner Seite aufgelöst werden.<br />
Politik braucht die Organisierung im Kollektiv und braucht das selbstbestimmte Individuum.<br />
Gemeinsam sozialistische Politik zu machen hat auch deshalb ein befreiendes Moment, weil in<br />
ihr bereits auch überwunden werden kann, was wir bekämpfen.<br />
279
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Bewertungen von Menschen nach kapitalistischer Leistungslogik, Ausgrenzung aufgrund<br />
sexueller Orientierung, Sexismus und andere Diskriminierungsformen haben bei uns keinen<br />
Platz.<br />
SozialistInnen in der SPD leben im Widerspruch. In der Partei werden SozialistInnen häufig als<br />
Linksaußen wahrgenommen. Innerhalb der gesellschaftlichen Linken sehen wir uns vielerorts<br />
dem Vorwurf des Opportunismus ausgesetzt. Ersteres birgt die reale Gefahr der Anpassung an<br />
vermeintliche machtpolitische Zwänge. Dabei geht es nicht darum, pauschal Vorwürfe gegen<br />
Individuen zu erheben. Vielmehr müssen wir Strukturen schaffen, in denen dieser Gefahr<br />
begegnet werden kann. Das bedeutet vor allem, verbindliche und kollektive Zusammenhänge<br />
zu schaffen, die dem Anpassungsdruck innerhalb von parteipolitischen Strukturen<br />
entgegenwirken können.<br />
Zweiteres, d.h. der Opportunismusvorwurf, birgt die Gefahr des Rückzugs aus der<br />
gesellschaftlichen Linken. Hier hilft nur die Einsicht in die Notwendigkeit des Austausches und<br />
der Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Bündnispartnern.<br />
Die Auflösung des Widerspruchs lag in der Vergangenheit für einige im Austritt. Das ist ein<br />
Trugschluss. Politisch Handeln in der derzeitigen Gesellschaft kann nicht widerspruchsfrei<br />
erfolgen, weil wir uns auf Regeln, Mechanismen und Bedingungen einlassen müssen, die nicht<br />
die unseren sind. Dies wäre auch in anderen Parteien, Verbänden, Initiativen und Gruppen der<br />
Fall. Ohne ein Eingehen auf die Widersprüchlichkeit sozialistischer Politik im Kapitalismus wäre<br />
jedoch politisches Handeln in der Gegenwart nicht möglich. Deshalb gilt es, in den<br />
Widersprüchlichkeiten tagtäglich darum zu kämpfen, die grundsätzliche Orientierung auf eine<br />
andere Gesellschaft zu erhalten und dennoch im Hier und Jetzt für Veränderungen zu kämpfen.<br />
Wir wollen im Hier und Jetzt zeigen, dass Solidarität möglich ist und in der Überwindung des<br />
Kapitalismus Freiheit, Gleichheit und Solidarität verwirklichen. Wir wissen, dass im<br />
kapitalistischen System ein freies und selbstbestimmtes Leben für alle Menschen nicht möglich<br />
ist. Konkurrenz von Menschen und Staaten, soziale Selektion, eine zunehmende soziale<br />
Polarisierung, das Patriarchat, Diskriminierung, Faschismus: viele gesellschaftliche Realitäten<br />
sind so widerwärtig, dass sie nicht zu ertragen sind.<br />
Uns ermutigt aber unser Ziel, unser Wissen um unsere politische Strategie stimmt uns<br />
zuversichtlich. Politik ist nie alternativlos. Viele Alternativen kennen wir, andere wollen wir<br />
noch entwickeln.<br />
Gemeinsam wollen wir unsere Vision verwirklichen: den demokratischen Sozialismus.<br />
280
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
U<br />
Umwelt-, Energie- und Verkehrspolitik<br />
U 1 – Bundesvorstand<br />
Nachhaltig in die Zukunft<br />
Wir <strong>Jusos</strong> betrachten Klimawandel und Umweltschutz nicht als von anderen Politikfeldern getrennte<br />
Themen. Neben dem Schutz unserer Erde, unseres Lebensraumes und der knapper<br />
werdenden Ressourcen geht es für uns auch ganz explizit um die Einbettung von klima-,<br />
energie- und umweltpolitischen Maßnahmen in eine nachhaltige, zukunftsorientierte<br />
Industriepolitik. Ohne diese Herangehensweise sind notwendige, tiefgreifende Veränderungen<br />
der Energiewirtschaft und der Industrielandschaft nicht vermittelbar. Eine besondere<br />
Bedeutung kommt dabei dem Aspekt der ökologischen Gerechtigkeit zu. Von der kommunalen<br />
über die staatliche bis hin zur globalen Ebene bedeutet dies, dass bei allen klima-, energie- und<br />
umweltpolitischen Forderungen die soziale Gerechtigkeit nicht vergessen werden darf.<br />
Wir wollen beweisen, dass Klima- und Umweltpolitik nicht im Gegensatz zu Wirtschafts- und<br />
Industriepolitik steht. Dem Vorurteil, dass eine ökologische Politik beschäftigungsfeindlich ist,<br />
setzen wir den Ansatz „Klimawandel, Energiewirtschaft und ökologische Industriepolitik“<br />
entgegen. Wir sind keine Umweltbewegung, und wir sind keine Industrielobbyisten. Wir sind<br />
die politische Jugendorganisation, die sich mit einem integrierten Konzept für einen<br />
zukunftssicheren Umbau der Energiewirtschaft und eine nachhaltige ökologische<br />
Industriepolitik einsetzt. Nur so können wir soziale Sicherheit, wirtschaftlichen Erfolg und den<br />
Schutz unser natürlichen Lebensgrundlagen erreichen.<br />
„Agenda 21- der Kampf geht weiter“<br />
1992 unterzeichneten 172 Staaten bereits ein Abkommen zur Entwicklungs- und Umweltpolitik,<br />
welches als Agenda 21 in die Geschichte einging. Dabei ist den auch geblieben, eine<br />
internationale Absichtserklärung von Vorbildcharakter (neben ökologischen Standards sind<br />
auch herausgehende soziale Standards definiert) die von keinem der unterzeichneten Staaten<br />
281
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
wirklich umgesetzt wurde.<br />
In diesem Zusammenhang seien lobenderweise die local-action, agenda 21-Gruppen erwähnt,<br />
die sich zum Ziel gesetzt haben die Ziele der Agenda21 wirkungsvoll im privaten und<br />
kommunalen Umfeld (umfassendes Fair-Trade-Versorgung, Vermeidung von<br />
Flächenversiegelung etc.) zu erfüllen.<br />
Natürlich haben auch wir große Kritik an den Teilen der Agenda 21(Befürworter der Gentechnik<br />
und der Atomenergie), aber es gilt mehr als dringend die positiven Aspekte der Agenda21<br />
endlich umzusetzten. Hierbei müssen wir der gesamten Bundesrepublik, sowie auch den linken<br />
Parteien ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen.<br />
Der globale Klimawandel<br />
Der Klimawandel ist in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen der Politik auf die Agenda<br />
gekommen. Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum globalen Klimawandel, die<br />
eine deutliche Zunahme extremer Wetterereignisse, die Zerstörung von Ökosystemen, ein<br />
Anstieg des Meeresspiegels, Dürren durch die Verknappung von Süßwasser und Hungersnöte<br />
sowie riesige Flüchtlingsströme prognostozieren, sind im IPCC-Bericht der Vereinten Nationen<br />
deutlich geworden. Dies macht Maßnahmen, die einen Anstieg der Temperatur um maximal<br />
2°C begrenzen, notwendig.<br />
Unter den ersten Auswirkungen mussten schon viele Menschen leiden, und viele werden<br />
folgen. Selbst mit größten Anstrengungen ist eine Umkehr dieser Entwicklung<br />
unwahrscheinlich. Aber einem weiteren Anstieg kann noch entgegengewirkt werden. Die<br />
zunehmenden Naturkatastrophen und die Verödung vormals fruchtbarer Flächen treffen vor<br />
allem die Regionen, die am wenigsten zur Verursachung des Klimawandels beigetragen haben.<br />
Der Prozess beschleunigt sich durch die industrielle Aufholjagd immer weiterer<br />
Volkswirtschaften. Der Klimawandel ist aber nicht die einzige Folge 150-jähriger industrieller<br />
Ausbeutung der Natur. Neben Umweltverschmutzung und Artensterben werden für immer<br />
mehr Menschen der schrumpfende Fischbestand und eine Verknappung des Frischwassers zum<br />
existenziellen Problem. Auch die Pro-Kopf Emissionen verschiedener Länder zeigen deutlich,<br />
dass die Industriestaaten verpflichtet sind, sehr weitgehende Klimaschutzanstrengungen zu<br />
unternehmen, bevor sie Ähnliches von den Entwicklungsländern fordern können. Der<br />
Klimaschutz ist also eine globale Aufgabe, dessen Motor Europa sein sollte. In den westlichen<br />
Industriestaaten sind diese Auswirkungen noch kaum zu spüren. Hier sind die Menschen vor<br />
allem durch steigende Energie-, Nahrungs- und Rohstoffpreise betroffen.<br />
Das Klima schützen zu wollen, ist dabei mittlerweile zum Standardschlagwort im Programm<br />
aller deutschen Parteien geworden. Oft wird dahinter aber nur altbekannte Interessenpolitik<br />
282
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
versteckt. Nirgends wird dies so deutlich wie beim Atomenergiefetischismus der Union.<br />
Symbolpolitik hilft jedoch nicht weiter. Wir brauchen ein wirkliches Umdenken in der<br />
Ausgestaltung unserer Gesellschaft. Wir brauchen den Wandel zu einer nachhaltigen<br />
Industriepolitik und zum sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen.<br />
Nachhaltigkeit heißt für uns <strong>Jusos</strong>, Wohlstandsmehrung ökologisch verträglich und sozial<br />
gerecht zu gestalten.<br />
Ein grundsätzlicher Wandel wird nur bei Erhalt und Ausbau des Wohlstandes gelingen.<br />
Nachhaltige Politik kann nur erfolgreich sein, wenn sie nicht gegen die Interessen der<br />
Menschen wirkt. Alle Menschen haben das Recht auf Zugang zu Energie und Ressourcen, es<br />
darf nicht darum gehen, Menschen auszuschließen, sondern Möglichkeiten und Anreize für<br />
einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen zu schaffen. Alle Menschen haben aber auch die<br />
Aufgabe, ihren persönlichen Lebensstil in Bezug auf Mobilität, Bauen und Wohnen, Konsum<br />
und VerbraucherInnenverhalten im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz zu überprüfen. Alle<br />
Klimaschutzmaßnahmen würden wenig Effekt erzielen, wenn nicht die gesamte Gesellschaft<br />
einen aktiven Beitrag leistet. Dem Staat kommt in diesem Zusammenhang die Verpflichtung<br />
zu, den Menschen in diesem Land entsprechende Alternativen aufzuzeigen und diese aktiv zu<br />
fördern. Das Ziel ist eine klima- und umweltschonende Gesellschaft, in der der bisherige<br />
Lebensstandard für alle Menschen erhalten und ausgebaut werden kann.<br />
Dem Klimawandel kann wirklich konsequent jedoch nur begegnet werden, wenn eine<br />
Umstellung der Lebens- und Produktionsweise Hand in Hand mit konsequentem<br />
technologischem Fortschritt geht. Wir wollen eine nachhaltige Wirtschaftspolitik und<br />
ökologische Weiterentwicklung der Industrie. Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze.<br />
Wir brauchen einen nachhaltigen Energiewandel mit realistischem Übergang, in dem<br />
gewährleistet ist, dass die nötige Energie für Private und Unternehmen konstant zur Verfügung<br />
steht. Aktive Klima- und Umweltpolitik bringt neue Arbeitsplätze.<br />
Die Herausforderungen des Klimawandels können nur global gelöst werden. Deutschland und<br />
Europa müssen dabei die Vorreiterrolle einnehmen und immer neue Initiativen starten,<br />
nachhaltiges Wirtschaften voranzutreiben und andere Regionen daran teilhaben zu lassen.<br />
Klimawandel global bekämpfen<br />
Wenn der Klimawandel wirksam bekämpft werden soll, geht dies nur international. Auf dem<br />
Weg zu internationalen Vereinbarungen gilt es, möglichst viele Staaten und vor allem die<br />
Hauptverursacher der Veränderungsprozesse einzubinden und klimawirksame Ergebnisse zu<br />
283
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
vereinbaren. Die Einhaltung dieser Vereinbarungen sind aber nie die Grenze des Machbaren,<br />
sie sind lediglich Mindestverpflichtungen, die es nicht nur zu erreichen, sondern größtmöglich<br />
zu übertreffen gilt.<br />
Auf dem UN-Gipfel in Rio de Janeiro 1992 wurde mit der Klimarahmenkonvention der erste<br />
wichtige Schritt hin zu internationalen Vereinbarungen zum Klimaschutz vollzogen. Das Kyoto-<br />
Protokoll sollte 1997 die Industriestaaten zur Reduktion ihres CO2- und Methanausstoßes<br />
verpflichten. Dies trat jedoch erst 2005 in Kraft, als ausreichend Staaten dieses ratifiziert<br />
hatten. Bisher gibt es noch keine Nachfolgeregelung für die nach 2012 auslaufenden<br />
Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls. Eine verbindliche völkerrechtliche Vereinbarung für die<br />
Intensivierung nach 2012 ist bei der Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich. Dabei kann<br />
ein bloßes Ausweiten des Emissionshandels nicht genügen. Vielmehr gilt es weitere<br />
Reduktionsverpflichtungen zu erzielen. Die <strong>Jusos</strong> fordern die Bundesregierung auf, sich bei der<br />
nächsten Klimakonferenz im Dezember diesen Jahres in Posen, sowie 2009 in Kopenhagen, für<br />
das Zustandekommen eines Post-Kyoto-Protokolls mit verbindlichen, verschärften<br />
Treibhausgasreduktionszielen und einen Sanktionskatalog einzusetzen!<br />
Neben der nachhaltigen Umgestaltung der westlichen Industriestaaten ist die größte<br />
Herausforderung, die Bedürfnisse aufstrebender Wirtschaftsregionen mit dem Klimaschutz zu<br />
verbinden. Wenn diese Regionen durch Klimaschutzvereinbarungen ihr Wachstumspotential<br />
gefährdet sehen, werden sie sich erst gar nicht am Klimaschutz beteiligen.<br />
Die Voraussetzungen für eine wirksame Bekämpfung des Klimawandels müssen daher in den<br />
Industriestaaten geschaffen werden. Sie müssen Vorreiter bei der Verminderung von<br />
Emissionen sein. Dies heißt, Vereinbarungen auch im kleineren Rahmen zu schließen, die über<br />
die bestehenden Verpflichtungen hinausgehen; dabei ist insbesondere die Europäische Union<br />
gefordert. Dies wird nur durch Innovationen und neue technische Möglichkeiten der<br />
Energiegewinnung und Produktion gelingen. Diese neuen Technologien müssen auch allen<br />
anderen Staaten zur Verfügung stehen. Es nützt nichts, wenn die hier durch Windräder<br />
ersetzten alten Kraftwerke anderswo wieder aufgebaut werden. Der Technologietransfer muss<br />
gefördert werden.<br />
Von den durch den Klimawandel verursachten Katastrophen sind insbesondere jene Regionen<br />
betroffen, die kaum zum Klimawandel beigetragen haben und oft nicht die Mittel haben, die<br />
Folgen abzumildern. Deshalb fordern wir die Einrichtung eines internationalen<br />
Klimakatastrophenfonds', der unter dem Dach der UN organisiert werden soll. Die Mittel des<br />
Fonds' haben die Verursacher aufzubringen. Dies bedeutet eine Aufteilung der nötigen Mittel<br />
284
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
proportional zu den Emissionen der Vergangenheit.<br />
Deutschland und Europa als Vorbilder<br />
Klimawandel kann man nicht durch Appelle bekämpfen. Eine Lösung ist es weder, auf<br />
diejenigen zu hoffen, die sich Klimafreundlichkeit leisten können, noch an diejenigen vom<br />
technologischen Fortschritt, Kulturgütern oder Mobilität auszuschließen, die es sich nicht<br />
leisten können.<br />
Wir unterstützen daher die Absichten der Bundesregierung und der EU den CO2-Ausstoss<br />
drastisch zu reduzieren. Dies ist notwendig, um die Erwärmungsobergrenze von 2° Celsius<br />
nicht zu überschreiten. Eine europaweite CO2-Reduktion um 30% bis 2020 und eine weitere<br />
Reduktion um 60 – 80% bis 2050 ist alternativlos und sollte von Deutschland auf allen<br />
politischen und wirtschaftlichen Ebenen unterstützt werden. Wir fordern darüber hinaus, dass<br />
diese Ziele, soweit technisch möglich, noch weiter verschärft werden. Deutschlandweit sollen<br />
alle Kommunen und Wirtschaftsbetriebe im Rahmen ihrer Möglichkeiten hierzu einen<br />
substanziellen Beitrag leisten. Die öffentliche Hand sollte hierbei, bspw. bei der<br />
Modernisierung der Liegenschaften und Fuhrparks, eine Vorbildrolle übernehmen.<br />
Die Teilhabe aller Menschen an Mobilität und insgesamt dem erreichten Lebensstandard muss<br />
gewährleistet bleiben, schon bestehender Ausschluss – gerade von Menschen in den Ländern<br />
des Südens – muss überwunden werden. Dort, wo Preiserhöhungen aus Umweltvorschriften<br />
nicht zu vermeiden sind – zum Beispiel im Zuge des CO2-Emissionshandels oder auch durch<br />
Effizienzvorgaben für bestimmte Produkte – ist ein entsprechender sozialer Ausgleich<br />
vorzusehen. Dies ist grundsätzlich besser möglich, wenn das Ordnungsrecht und nicht<br />
Marktmechanismen oder Lenkungssteuern zur ökologischen Fortentwicklung genutzt werden<br />
Eine sinnvolle Möglichkeit zur Sicherstellung von Zugang zu Elektrizität und Wärme für alle<br />
Bürgerinnen und Bürger ist die Einführung eines Energieeffizienztarifs. Dieser beinhaltet die<br />
Sicherung der Grundversorgung in Höhe von 500 kwh pro Kopf und Jahr zu einem sozial<br />
verträglichen Fixpreis. Der darüber hinaus gehende Energieverbrauch würde dann im Rahmen<br />
eines solchen Tarifs progressiv ansteigen. Im Ergebnis wäre die Grundversorgung für alle<br />
gesichert, und gleichzeitig wäre ein starker Anreiz für Energieeffizienz gegeben. Zur Anbietung<br />
eines solchen Tarifs müssen sowohl die privaten als auch die kommunalen Energieversorger<br />
gesetzlich verpflichtet werden.<br />
Wir wollen den technologischen Fortschritt zum Wohle der Menschheit nutzen. Wir müssen<br />
Konzepte dafür entwickeln, wie Technologie nicht nur kurzfristigen Profiten nutzt, sondern<br />
285
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
vernünftig, energieschonend sowie den Lebensstandard erhaltend und ausbauend zum Einsatz<br />
kommen kann. Dabei reicht es aber nicht, darauf zu warten, bis die Industrie von sich aus<br />
sinnvolle Fortschritte erreicht. Außerdem ist technologischer Fortschritt nicht per se positiv,<br />
alle Erneuerungen gilt es auch auf ihre Gefahren hin zu überprüfen und zu bewerten.<br />
Nachhaltige Industriepolitik und Effizienzsteigerung<br />
Auf Wachstum und Wohlstand können und wollen wir nicht verzichten. Deshalb muss das Ziel<br />
verfolgt werden, Wachstum vom Energie- und Ressourcenverbrauch so weit wie möglich zu<br />
entkoppeln. Ein Rückbau der Industriegesellschaft ist dabei jedoch der falsche Weg.<br />
Ökologische Industriepolitik stellt für uns einen richtigen Ansatz dar. Neben der<br />
kontinuierlichen Modernisierung bestehender Wirtschaftszweige müssen zusätzliche<br />
fortschrittliche Technologien von staatlicher Seite aktiv gefördert werden. Die Rolle des Staates<br />
als Pionier ist hierbei von entscheidender Bedeutung.<br />
Ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Klimawandels ist es, die Energieeffizienz in allen<br />
Bereichen immer weiter zu erhöhen. Neben mehr Forschungsförderung müssen Ausbildungsund<br />
Studienmöglichkeiten in diesen Bereichen ausgebaut werden. Innovationen sind der<br />
Schlüssel zu mehr Energieeffizienz, dafür werden staatliche Investitionen in Forschung nicht<br />
ausreichen. Ein wirkliches Umsteuern zu einem nachhaltigen Wirtschaften wird es nur geben,<br />
wenn die Unternehmen in die Pflicht genommen werden, bei ihren Produkten auf niedrigeren<br />
Verbrauch und nachwachsende Rohstoffe zu setzen. Ein gutes Instrument ist hierfür ein<br />
umfassendes Top-Runner-Programm nach japanischem Vorbild. Das Programm sieht einen<br />
maximalen Energieverbrauch von Produkten bis zu einem bestimmten Zieljahr vor. Als<br />
Grundlage stützt man sich auf die zu dieser Zeit mit marktgängiger Technologie erreichbaren<br />
Energieverbrauche von Elektrogeräten.<br />
Wir wollen den Emissionshandel ausbauen. Gemäß den technischen Möglichkeiten sollen die<br />
Zertifikate weiter verknappt und damit weitere Emissionseinsparungen ermöglicht werden.<br />
Damit werden Investitionen und Innovationen in die Vermeidung von Emissionen durch<br />
wirtschaftliche Anreize belohnt.<br />
Die bisherige Ausgestaltung des Emissionshandels hat zu erheblichen Zusatzgewinnen<br />
insbesondere bei den Unternehmen der Energiewirtschaft und gleichzeitig zu erheblichen<br />
Preissteigerungen geführt. Wir wollen daher von der bisherigen Kostenlosen Vergabe der<br />
Emissionsrechte zu einer Vollversteigerung übergehen. Dadurch werden die Zusatzgewinne<br />
abgeschöpft, ohne dass es zu weiteren Preissteigerungen kommt. Die erzielten Einnahmen aus<br />
der Vollversteigerung sollen dazu genutzt werden, die sozialen Folgewirkungen der durch den<br />
286
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Emissionshandel bedingten Preissteigerungen abzufedern. Besonderes Augenmerk ist dabei<br />
auf ALG-II-BezieherInnen, GeringverdienerInnen, BezieherInnen von niedrigen Renten oder<br />
anderer Sozialleistungen zu legen. Diese Gruppen können häufig die Anschaffung von<br />
modernen, energie- und damit kostensparenden Geräten nicht finanzieren und sind so von<br />
steigenden Energiepreisen besonders betroffen.<br />
Die Gesamtmenge der jährlich zur Verfügung stehenden Treibhausgasemissionen darf nicht<br />
ansteigen, sondern muss kontinuierlich sinken. Dieses System ist verbindlich und muss bei<br />
Missachtung zu Sanktionen führen. Das Grundprinzip ist dabei, dass jedes Unternehmen<br />
verpflichtet ist, für die gesamten Emissionen seiner Anlage Emissionszertifikate zu besitzen.<br />
Diese werden staatlich zugeteilt. Der Faktor wird in den kommenden Jahren weiter verringert.<br />
Das heißt, Unternehmen erhalten für ihre Emissionsmengen nicht mehr die entsprechende<br />
Anzahl an Zertifikaten kostenlos zugeteilt, sondern eine geringere Anzahl. Die Unternehmen<br />
stehen dann vor der Wahl, entweder zusätzliche Zertifikate zu kaufen oder in neue<br />
Technologie zu investieren, um Emissionen einzusparen und keine zusätzlichen Zertifikate<br />
kaufen zu müssen. Emitiert ein Unternehmen weniger, so dass es überschüssige Zertifikate<br />
besitzt, dürfen diese gehandelt werden. Dadurch wird ein hoher Investitionsanreiz gesetzt. Der<br />
Emissionshandel befördert gleichzeitig die Entwicklung neuer Technologien. In der<br />
zukünftigen Wirtschaftswelt, in der CO2-Emittenten höhere Produktionskosten für die CO2-intensive<br />
Wertschöpfung in Kauf nehmen müssen, werden nur die Unternehmen bestehen<br />
können die auf energieeffiziente Produktionswege setzen um ihre Waren zu erzeugen. Diese<br />
Güter werden Absatzmärkte finden, wenn sie einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck (engl.<br />
Carbon Footprint) aufweisen und somit günstiger werden.<br />
Hierbei muss Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen und die bereits erreichten Erfolge<br />
im Aufbau einer EE-Industrie verstetigen. Schon heute arbeiten landesweit mehr als 250.000<br />
Menschen direkt oder indirekt in der Branche der Erneuerbaren Energien. Bis 2020 kann diese<br />
Zahl aufgrund der nationalen und im Besonderen der internationalen Nachfrage nach<br />
innovativen deutschen EE-Produkten auf bis zu 500.000 Beschäftige steigen. Das weltweite<br />
Umsatzpotenzial für EE-Produkte im Jahr 2020 liegt nach Schätzung des DIW bei knapp 300<br />
Mrd. Euro. Durch seine schon jetzt gute Positionierung in dieser Branche wird die deutsche EE-<br />
Industrie von dieser Entwicklung entscheidend profitieren. Neben der Maschinenbau-, Stahl-,<br />
Automobil- und Chemiebranche etabliert sich die EE-Wirtschaft als neue Säule der deutschen<br />
Industriepolitik. Diese Entwicklung begrüßen wir und fordern eine größtmögliche Förderung<br />
dieser zukunftsfähigen Branche.<br />
Weitere Bereiche in denen Deutschland bereits heute an vorderster Stelle im Bereich der<br />
effizienten ökologischen Industrie forscht und produziert sind:<br />
287
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
• Energieeffizienztechnologien<br />
• Recycling- und Abfalltechnologien<br />
• Mobilität- und Verkehrstechnologien<br />
• Wasser- und Abwassertechnologien<br />
• Umwelttechnisches Engineering/Grüne Anlagentechnik<br />
• Life Science/weiße Biotechnologie<br />
• Nanotechnologie<br />
• Ökodesign, Bioplastik und Bioraffinerie<br />
Viel Energie kann auch in Privathaushalten eingespart oder durch regenerative Energiequellen<br />
selbst erzeugt werden. Hier werden enorme Potenziale noch nicht genutzt. Durch Sanierungen<br />
lassen sich über 50 Prozent davon einsparen. Aufklärungskampagnen zur Energie- und<br />
Wasserverbrauchsoptimierung sind ein sinnvoller Schritt, um ein ökologisches Bewusstsein in<br />
der Bevölkerung zu wecken. Um dieses zu beschleunigen, müssen die Förderprogramme zum<br />
Aufbau von Photovoltaikanlagen und zur energetischen Gebäudesanierung fortgeführt und<br />
ausgebaut werden. Dies sind vor allem Maßnahmen, bei denen Bund, Länder und Kommunen<br />
als Vorbilder vorangehen müssen. Um dieses allen Kommunen zu ermöglichen, ist ein<br />
gesondertes Förderprogramm notwendig. Ergänzend sollten gesetzliche bzw.<br />
satzungstechnische Regelungen nach dem Marburger Modell (oder ggf. in einer<br />
abgewandelten Version, wenn dieses juristisch in der konkreten Form nicht möglich ist) in<br />
Angriff genommen werden. In der Marburger Satzung ist vorgesehen, dass ab dem 1. Oktober<br />
2008 alle Neubauten mit Sonnenkollektoren ausgestattet werden müssen. Bei bereits<br />
bestehenden Gebäuden ergibt sich diese Pficht bei einem Anbau bzw. spätestens mit<br />
Austausch der Heizungsanlage bzw. einem neu gedeckten Dach. Diese zwingende Regelung,<br />
die das Werben für ein umweltfreundliches Verbraucherverhalten fankieren soll, ist das<br />
richtige Mittel ein Umdenken zu beschleunigen.<br />
Oft sind die energiesparsamsten Produkte teurer als andere Modelle. Auch wenn diese im<br />
Laufe ihres Gebrauchs Energiekosten einsparen, bleibt der Anschaffungspreis für viele<br />
Verbraucher die entscheidende Größe.<br />
Ökologische Forschungs- und Industriepolitik muss eine neue gesamtgesellschaftliche<br />
Anstrengung werden. Dazu ist eine intensive Bildung und Ausbildung weiter Bevölkerungsteile<br />
in diesem Bereich von Nöten. An Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten<br />
müssen das Wissen und die Erforschung dieser Wissens- und Produktionsfelder entscheidend<br />
verbessert werden. Dort muss auch das Klimabewusstsein und das Bekenntnis zu<br />
Energieeffizienz gelehrt werden.<br />
288
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Nachhaltige Energieerzeugung<br />
Energie ist die Grundvoraussetzung moderner Gesellschaften. Wir stehen bei der<br />
Stromgewinnung für einen umfassenden Wandel zu regenerativen Energien. Wenn die<br />
genannten Ziele bei der Bekämpfung des Klimawandels erreicht werden sollen, bedarf es<br />
großer Anstrengungen. Der großflächige Umbau der Energiewirtschaft hat bereits begonnen:<br />
2007 wurden 14,2% des deutschen Stroms aus Wind, Wasser und Sonne gewonnen. Die<br />
Bundesregierung hat die Vorgabe gegeben den Anteil bis 2020 auf 30 Prozent aufzustocken,<br />
dies kann nur ein Minimalziel sein. Wir wollen einen schnellern Wechsel zu erneuerbarer<br />
Energie. Wir wollen noch in diesem Jahrhundert die fossilen Energieträger vollständig ersetzen.<br />
Die Vorteile von erneuerbaren Energieformen liegen für uns <strong>Jusos</strong> dabei klar auf der Hand:<br />
Viele Potenziale, die die erneuerbaren Energien bieten, sind noch kaum genutzt und erforscht.<br />
Insbesondere die Wirkungsgrade und Speichertechnik gilt es weiter zu verbessern. Vor allem<br />
die Gewinnung in Großanlagen steckt noch in den Kinderschuhen. Die Erneuerbaren Energien<br />
ermöglichen eine weitgehend dezentrale, lokale Energieproduktion. Viele kleine bis<br />
mittelgroße Energieerzeuger können ein dichtes nationales wie internationales Netz bilden.<br />
Dieses ist effizient, kostengünstig, bedarfsgerecht und sicher. Ergänzend sollten an<br />
ausgewählten Standorten in Europa, entsprechend den geographischen Gegebenheiten, EE-<br />
Großanlagen gebaut werden (Gezeitenkraftwerke und Off-Shore Windenergie in Atlantik,<br />
Nord- und Ostsee, sowie große Solarenergieanlagen in Südeuropa und Nordafrika) und mit<br />
einem europäischen Energienetz „Super-Grid“ verbunden werden. Diese EE-Großanlagen, die<br />
virtuell zusammen geschalteten, dezentralen EE-Anlagen und neue Speichertechnologien sind<br />
in der Lage eine saubere, sichere Energieversorgung zu jeder Zeit zu gewährleisten. Hierfür sind<br />
außerdem weitreichende Investitionen in die Energienetze zur Verbindung der<br />
Energieproduktionsstätten mit den industriellen Zentren notwendig.<br />
Wir brauchen einen Mix aus allen Möglichkeiten der erneuerbaren Energie. Sonne, Wind,<br />
Wasser und Erdwärme sind unerschöpfliche Ressourcen. Im Gegensatz zu Kohle, Erdöl und<br />
Uran ist Wind kein endlicher Rohstoff und, da er von der Erde selbst „produziert“ wird,<br />
vollkommen umweltfreundlich. Ein großer Vorteil der Windenergie liegt darin, dass sie überall<br />
eingesetzt werden kann. Sachsen-Anhalt beispielsweise kann mittlerweile 39% des<br />
Strombedarfes mit Windkraft decken und das als Bundesland, das nicht an der Küste liegt.<br />
Moderne Windkraftanlagen sind leistungsstark, leise und effzient. Im Energiemix der Zukunft<br />
spielen sie eine wichtige Rolle. Dabei gilt es regionale Potentiale sinnvoll zu nutzen, nicht<br />
überall wo Platz ist, ist auch ein Windrad sinnvoll. In vielen Regionen ist das Re-Powering das<br />
289
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Mittel der Wahl, um die Leistungsfähigkeit bestehender Anlagen zu vergrößern.<br />
Auch auf Biomasse kann nicht verzichtet werden. Sie bietet gerade auf regionaler Ebene große<br />
Möglichkeiten, mit Biogasanlagen, gekoppelt mit Fernwärmenetzen, Energieautonomie<br />
zumindest teilweise herzustellen. Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energieformen steht<br />
die Biomasse aber nicht unbegrenzt zur Verfügung. Ihre Nutzung zur Energiegewinnung<br />
begegnet zudem häufig ethischen Bedenken, wenn durch die massenhafte Vergasung oder<br />
Verheizung Nahrungsmittel verteuert werden oder in Entwicklungsländern Regenwälder zum<br />
Anbau von Hochenergiepflanzen abgeholzt werden. Biomasse der zweiten Generation, die in<br />
Bioreaktoren aus Haushaltsabfällen, Holzresten und Stroh erzeugt werden kann, stellt jedoch<br />
eine sinnvolle Ergänzung der Primärenergierzeugung dar. Um in diesem Bereich eine<br />
transparente Herkunft der Biomasse zu garantieren, fordern wir einen Zertifizierungsprozess<br />
mit Gütesiegel. Bis ein solcher Prozess in Kraft getreten ist, muss ein Importmoratorium für<br />
Biomasse aus Entwicklungsländern mit Tropenwäldern verhängt werden.<br />
Die Sonne stellt eine nach menschlichen Maßstäben unerschöpfiche Energiequelle dar.<br />
Solarenergie ist praktisch überall verfügbar, moderne Solarzellen erreichen auch bei<br />
bedecktem Himmel noch eine gute Leistung. Photovoltaikanlagen eignen sich besonders zur<br />
dezentralen Energieversorgung. Im Bereich der Solarenergie ist allerdings vor allem die<br />
Solarthermie in den letzten Jahren immer interessanter geworden. Parabolrinnenkraftwerke<br />
bieten hohe Leistungen und können durch Wärmespeicherung rund um die Uhr Strom<br />
erzeugen. Besonders im europäischen Verbund kann Solarthermie ein wichtiger Bestandteil<br />
des Energiemix werden. Das Deutsche Institut für Luft-und Raumfahrt (DLR) geht davon aus,<br />
dass in den Ländern des Mittelmeerraumes bis 2050 fossile Energien weitgehend durch<br />
erneuerbare Energien abgelöst sein werden, wobei die Solarthermie dort mehr als doppelt so<br />
viel Strom produzieren wird wie die anderen regenerativen Energieträger zusammen.<br />
Neben dem klimarelevanten Effekt durch erneuerbare Energieformen bietet dieser Wechsel<br />
noch weitere Chancen. Ein Großteil dieser Energie wird dezentral gewonnen die sowohl<br />
Privaten als auch Kommunen die Möglichkeit bietet, sich von den Energiekonzernen<br />
unabhängig zu machen. Bei der Entwicklung der Sonnen- und Windenergiebranche wird nach<br />
wie vor durch hohe Wachstumsratendeutlich, welches große Arbeitsmarktpotential jetzt und<br />
zukünftig in ihnen steckt.<br />
Der Wechsel zu regenativen Energieträgern ist ein Prozess, der gestaltet werden muss. Für den<br />
Übergang ins solare Zeitalter sind fossile Energieträger deshalb unentbehrlich, um die<br />
Grundlastversorgung zu sichern. Um die Umweltbelastungen durch die Anlagen zu reduzieren<br />
müssen alle bestehenden und besonders die neuen Produktionsstätten konsequent auf<br />
290
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Effizienz und die Verringerung des CO2-Ausstoßes hin modernisiert bzw. geplant werden.<br />
Niedrig-Emissions-Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung/Fernwärme, optimierte Anlagentechnik<br />
und Blockheizkraftwerke sind Technologiebeispiele für eine effektivere Nutzung der fossilen<br />
Energieträger. Dezentrale Blockheizkraftwerke stehen direkt bei den Verbrauchern und<br />
ermöglichen einen wesentlich höheren Wirkungsgrad der Energienutzung als dies von<br />
Großkraftwerken erreicht wird. Die bei der Stromproduktion entstehende Wärmeenergie kann<br />
sofort in den angeschlossenen Wohneinheiten genutzt werden. Bei dezentralen BHKW ist ein<br />
größerer Energiemix möglich, als dies durch ein Großkraftwerk geschehen könnte.<br />
Ein sofortiger Ausstieg aus der Stein- und der Braunkohle ist mit großen Risiken verbunden.<br />
Überließen wir speziell die Schächte der Steinkohle sich selbst, würden sie innerhalb kürzester<br />
Zeit verfallen, eine Wiederverfügbarmachung wäre derart kostenintensiv, dass eine Absage an<br />
die heimische Steinkohle endgültig wäre. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass im Jahr 2012<br />
die sogenannte Optionsklausel bei der Förderung des Steinkohlebergbaus gezogen und der<br />
Förderzeitraum nicht verkürzt wird. Der Wechsel zu regenativen Energieträgern ist ein Prozess,<br />
der Zeit braucht. Für den Übergang sind fossile Energieträger unentbehrlich, um die<br />
Energieversorgung zu sichern. Solange fossile Energieträger genutzt werden, müssen die<br />
Anlagen auch modernisiert und erneuert werden. Wo alte Anlagen ersetzt werden und<br />
Emissionen eingespart werden können, bleibt auch der Neubau moderner Kraftwerke in<br />
Verbindung mit Fernwärmenetzen sinnvoll. Dadurch können auch die Verbraucherpreise<br />
niedriger gehalten werden. Die Verbesserung der Wirkungsgrade und Kraft-Wärme-Kopplung<br />
bieten noch erhebliches Einsparpotenzial. Die Forschung in diesem Bereich lohnt sich, gerade<br />
auch um moderne Anlagen exportieren zu können.<br />
Die vermeintlich viel versprechenden Lösungen zur CO2-Sequestrierung sehen wir kritisch, da<br />
diese Technologie wenig erforscht und ihre Umsetzung daher in naher Zukunft unrealistisch<br />
ist. Durch ausgedehnte CO2-Lagerstätten entstünde eine neue, potentiell verheerende<br />
Endlagersituation. Außerdem widerspricht sie dem Gedanken der Umgestaltung der<br />
Industriegesellschaft. Die Sequestrierung droht zum Vorwand zu werden, um in der<br />
Energiewirtschaft so weiterzumachen wie bisher. Denn: Durch die Sequestrierung - gelinge sie<br />
tatsächlich - wäre das langfristige Festhalten an fossilen Energieträgern die Folge. Auf Grund<br />
deren Endlichkeit und den daraus resultierenden Folgen lehnen wir dies ab.<br />
Die Atomenergie ist für uns keine Alternative. Mit uns gibt es keinen Ausstieg aus dem<br />
Ausstieg. In der gegenwärtigen Debatte um Energiepreise erleben wir wiedereinmal die volle<br />
Breitseite der Mythen der Atomlobby, Atomenergie sei billiger, sicher und unerschöpflich. Wir<br />
wissen, dass dies nicht stimmt. Die Atomindustrie ist massiv gefördert. Schon heute werden<br />
Atomkraftwerke immer wieder, teilweise auch monatelang vom Netz genommen. Auch in<br />
291
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
deutschen Kraftwerken kommt es ständig zu Störfällen, bei denen größere Katastrophen mehr<br />
durch Zufall als durch Vorsichtsmaßnahmen verhindert worden. Nach wie vor gibt es weltweit<br />
keine dauerhafte Lösung für den Atommüll. Und natürlich ist Uran nicht unerschöpflich. Wir<br />
wollen den deutschen Ausstieg als Vorbild zu etablieren und andere davon zu überzeugen, die<br />
Atomreaktoren abzuschalten.<br />
Rolle der Energieversorger<br />
Aktuell spüren die Menschen vor allem die steigenden Energiepreise. Eine Grundversorgung<br />
mit Strom und Wärme muss für jeden bezahlbar bleiben. Deshalb fordern wir neben der<br />
Preisregulierungdie spekulationsbedingte Verteuerung durch Kontrolle und Regulierung der<br />
Strombörse zu beschränken.<br />
Um zu hohen Energiepreisen entgegenzuwirken, muss das Monopol der vier großen<br />
Energiekonzerne gebrochen werden. Hierfür sind zwei Schritte notwendig. Zum einen muss die<br />
kommunale Autonomie gestärkt werden. Dafür muss es wieder mehr Möglichkeiten zur Re-<br />
Kommunalisierung und wirtschaftlicher Eigentätigkeit geben. Eine besondere Rolle muss<br />
hierbei den demokratisch kontrollierten Stadtwerken zukommen. Sie sind der Motor der<br />
dezentralen Energieversorgung und sollten gesetzlich entscheidend gestärkt werden.<br />
Versuche, die Gestaltungsfreiheit der Stadtwerke zu begrenzen, wie dies etwa in NRW mit der<br />
Änderung des § 107 der Gemeindeordnung geschehen ist, lehnen wir ab.<br />
Stadtwerke produzieren Energie nah bei den Menschen, können sich den lokalen<br />
Gegebenheiten am besten anpassen und garantieren Preisstabilität und demokratische<br />
Kontrolle. Energieversorgung, wie auch die Abfallwirtschaft und der ÖPNV, gehören für uns zur<br />
öffentlichen Daseinsvorsorge und sollten jetzt wie zukünftig von den Kommunen bzw. den<br />
kommunalen Verbünden organisiert werden. Eine besondere Rolle kommt dabei dem ÖPNV zu,<br />
der eine umweltschonende Mobilität für alle garantiert. Dieses System sollte ausgebaut,<br />
gefördert und nicht privatisiert werden. Jede Privatisierung engt hier den Handlungsspielraum<br />
unnötig ein. Es gibt bereits erste Beispiele, wo kleinere Siedlungsgebiete aus eigener Kraft<br />
durch gezielte Investitionen in alternative Energien vom „Strom von außen“ unabhängig<br />
geworden sind. Perspektivisch könnten ein Teil der teuren Überlandleitungen mit hohen<br />
Kapazitäten überfüssig gemacht werden; die Störanfälligkeit der Energieversorgung würde<br />
gesenkt.<br />
Als halb-öffentliche Alternative bietet sich eine Kooperation städtischer Betreiber mit<br />
Umweltverbänden an, wie das z.B. bei der Naturstrom AG, einer Ausgründung von<br />
Umweltverbänden in Kooperation mit den Stadtwerken Hannover, bereits geschehen ist.<br />
292
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Daneben beinhaltet unser energiepolitisches Leitbild die Selbstorganisation der<br />
Energieversorgung. Verbraucher schließen sich vermehrt zu Erzeugergemeinschaften<br />
zusammen, die als Verein oder auch als Genossenschaft organisiert sind. Hierbei wird der durch<br />
den Verkauf erzielte Gewinn teilweise sofort wieder in die Erzeugung grünen Stroms aus<br />
Biomasse, Wasser- und Windkraft, sowie Solarenergie investiert. Auch können zum Beispiel<br />
Photovoltaikanlagen von privaten Betreibergemeinschaften auf den Dächern städtischer<br />
Gebäude installiert werden. Auf diese Art und Weise werden öffentliche und private<br />
Bemühungen wirksam gekoppelt.<br />
Wo es keine regionale Versorgung gibt, kann die Einrichtung und Förderung von<br />
Verbrauchsgemeinschaften eine Alternative bieten. Zum anderen müssen die Energienetze in<br />
staatliche Hand überführt werden.<br />
Die oligopole Dominanz der vier großen Energiekonzerne E-On, RWE, Vattenfall und EnBW<br />
schadet sowohl der Energiesicherheit und dem Energiepreisniveau, als auch dem Klimaschutz.<br />
Notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Stromnetz sind seit Jahren überfällig.<br />
Die Trennung von Netz und Erzeugung bzw. Vertrieb ist zudem eine wesentliche<br />
Voraussetzung für einen verbesserten Netzzugang von neuen Anbietern und damit für mehr<br />
Wettbewerb im Strom- und Gasmarkt. Die bisher praktizierte Methode des „Unbundling“ bei<br />
Verzicht auf eigentumsrechtliche Trennung der beiden Sparten hat nicht zu den gewünschten<br />
Ergebnissen geführt. Zudem argumentieren die Netzbetreiber, die erzielbare Rendite im<br />
Netzgeschäft werde durch die Regulierungsbehörden zu niedrig angesetzt, so dass für<br />
entsprechende Investitionen kein externes Kapital zu beschaffen sei. Insofern kann nicht mehr<br />
davon ausgegangen werden, dass die Energieversorger ausreichend Mittel für die<br />
Netzsicherheit und deren Ausbau investieren. Langfristige und strategische Anleger auf<br />
privater Seite und auch die öffentliche Hand, kämen mit den zugelassenen Renditen dagegen<br />
sehr gut aus. Daher ist es auch aus Gründen der Versorgungssicherheit geboten, für eine<br />
eigentumsrechtliche Trennung der Sparten Netz und Erzeugung/Vertrieb zu sorgen.<br />
Der derzeitige mehr als unzureichende Zustand muss durch die Neutralisierung der Stromnetze<br />
überwunden werden. Zu diesem Zweck sollten die deutschen Strom- und Gasnetze in<br />
öffentliche Hand überführt werden. Nur auf diesem Weg wird sichergestellt, dass alle<br />
Wettbewerber faire Zugangsmöglichkeiten zu den Energienetzen haben und ihre Produkte<br />
anbieten können.<br />
Notwendig ist bereits jetzt die zügige Modernisierung und der Ausbau der Energienetze.<br />
Hierbei werden auch neue Leitungstrassen notwendig sein. In diesem Zusammenhang soll sie<br />
die Bedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien durch virtuelle Kraftwerksverbünde<br />
293
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
und dezentrale Energieversorgung verbessern und zugleich den Netzausbau auf das unbedingt<br />
Notwendige begrenzen.<br />
Nachhaltige Mobilität<br />
Mobilität ist eine Grundvoraussetzung einer freien Gesellschaft, aber auch ein<br />
Hauptverursacher von Treibhausgasen. Um in diesem Bereich Klimaschutz voranzutreiben, gilt<br />
es Verkehr und Transport besser zu organisieren, Effizienzsteigerungen in der Antriebestechnik<br />
voranzutreiben und den ÖPNV auszubauen.<br />
Die Bahn ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel. Umso verheerender ist die Entscheidung<br />
der Bundesregierung, sie zu privatisieren. Nichtsdestotrotz muss es das Ziel bleiben, mehr<br />
Verkehr auf die Schiene zu bringen. Insbesondere der Transport von Waren kann über die<br />
Schiene kann noch massiv ausgebaut werden. Der Luftverkehr auf europäischer Ebene muss in<br />
den Emissionshandel miteinbezogen werden.<br />
Der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs ist eines der zentralen Elemente, um die<br />
Emissionen von der Straße zu reduzieren. Der ÖPNV soll dabei auf besonders<br />
umweltfreundliche Antriebstechniken setzen. Um dies zu gewährleisten, müssen weitere<br />
Privatisierungen in diesem Bereich auf jeden Fall verhindert werden. Egal wie groß die<br />
Verbesserungen im Bereich des ÖPNV auch sein werden, er wird den motorisierten<br />
Individualverkehr nicht ersetzen können, gerade in ländlichen Regionen.<br />
Für viele ist das Auto wie kein anderes Produkt Sinnbild für individuelle Freiheit in unserer<br />
Gesellschaft und die Automobilproduktion einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in<br />
Deutschland. Die deutschen Automobilhersteller haben in der Vergangenheit gezeigt, dass<br />
Emissionseinsparung bei ihren Entwicklungen kaum ein Rolle gespielt hat. Es gilt sie dazu zu<br />
verpflichten dies zukunftig zu ändern. Wie erfolgreich dies geschehen kann, hat die Geschichte<br />
des Katalysators gezeigt. Die geplante Festschreibung der Reduzierung des durchschnittlichen<br />
CO2-Emissionen neuer Pkw bis 2012 auf 120g/km ist hierfür der richtige Weg. Nach dem Jahr<br />
2012 mussen diese Grenzwerte weiter gesenkt werden. Des Weiteren sprechen wir uns fur eine<br />
Umstellung der Kfz-Steuer auf den CO2-Ausstoß aus.<br />
Ziel muss sein, einen Individualverkehr sicherzustellen, der so schnell wie möglich vollständig<br />
auf elektrischen Antrieben aufbaut. Die in den letzten Jahren auf dem Markt angekommenen<br />
Hybridantriebe sind hierbei nur der erste Schritt. Auch Biokraftstoffe, so nachhaltig sie auch<br />
erzeugt sein mögen, sind allenfalls eine Brückentechnologie da diese weiterhin Abgase<br />
verursachen. Elektroautos, gespeist aus regenerativen Energien, und die entsprechende<br />
294
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Infrastruktur sind die Zukunft der individuellen Mobilität!<br />
„Global Justice“ - den Rucksack packen<br />
Das wichtigste Zukunftsthema ist die gerechte Aufteilung der Ressourcen, allen voran Wasser.<br />
Wasser ist ein Grundrecht und jeder Mensch muss Zugang zum Wasser besitzen. Aufgrund der<br />
zunehmenden Verschwendung von Wasser fordern und fördern wir ein Maßnahmenpaket um<br />
unnötigen Wasserverbrauch einzudämmen. Der Verbrauch von Wasser muss auch an soziale<br />
Kriterien gekoppelt sein. Die massenhafte Verseuchung und Verschwendung von Grundwasser<br />
durch Industrie und Luxusobjekte (zum Beispiel Golfplätze) darf nicht einfach hingenommen<br />
werden, sondern muss mit hohen Sonderabgaben unattraktiv gemacht werden.<br />
U 8 - BZ Braunschweig, BZ Mittelfranken<br />
Kein Ausstieg aus dem Ausstieg –<br />
Atomkraft ist keine Lösung!<br />
Die <strong>Jusos</strong> in der SPD sprechen uns ohne wenn und aber gegen die Atomkraft aus. Mit uns wird<br />
es keinen Ausstieg aus dem Ausstieg geben! Wir kämpfen mit unserer Politik für eine<br />
nachhaltige und umweltverträgliche Energiepolitik und setzten uns für die Nutzung und<br />
Förderung erneuerbarer Energieformen ein.<br />
Die Atomkraft ist keine Zukunftsenergie, sie ist auch keine Lösung der derzeitigen Probleme,<br />
wie Energiesicherheit, Rohstoffknappheit und gestiegene Rohstoffpreise. Im Gegenteil, die<br />
Atomkraft schafft noch mehr Probleme.<br />
Atomkraft rettet das Klima nicht!<br />
Oft wird in letzter Zeit von der Atomlobby die besondere „klimaschonende Wirkung“ von AKWs<br />
betont und die Aufgabe der Atomkraft darin gesehen, fossile Energieträger abzulösen. Wäre<br />
dies ernsthaft das Ziel, würde eine Verlängerung der Laufzeit bestehender AKW jedoch lange<br />
nicht ausreichen: Allein um zehn Prozent der fossilen Energie bis zur Mitte dieses Jahrhunderts<br />
durch Atomkraft zu ersetzen, müssten weit mehr als 1.000 Atomkraftwerke rund um die Welt<br />
neu gebaut werden (Quelle: BMU). In der Projektion für eine vollständige Ablösung von fossilen<br />
Energieträgern ergibt sich damit laut UN-Umweltprogramm ein weltweiter Bedarf von 4.000<br />
neuen AKWs.<br />
295
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Atomkraft schneidet im Vergleich mit einigen anderen Formen der Energieerzeugung sogar<br />
schlechter beim Klimaschutz ab. Das Argument, Atomkraftwerke seien gut für das Klima, kann<br />
man nur verwenden, wenn man weder die Uranförderung, den nötigen Transport des<br />
Rohstoffes, Bau und Unterhalt des Kraftwerkes die Verteilung des Stroms noch die zusätzliche<br />
erforderliche Wärmeerzeugung berücksichtigt – und dazu noch „klimafreundlich“ einseitig<br />
durch „wenig CO2“ ersetzt. Diese Argumentation ist jedoch mehr als fraglich, da sie engstirnig<br />
und scheinheilig ist. Und die Auswirkungen auch nur eines GAUs auf Umwelt und Klima, sowie<br />
die Enlagerfrage ignoriert diese Argumentation ebenfalls.<br />
Atomkraft ist nicht unerschöpflich!<br />
Auch Atomkraft ist nicht unendlich. Wird die heutige Nutzung beibehalten, reichen die<br />
weltweiten Uranvorkommen noch maximal für 60-70 Jahre (Quelle: Greenpeace und BMU).<br />
Kernenergie ist somit keine zukunftsfähige Energiequelle! Bei einer Intensivierung der Nutzung<br />
wird der Vorrat hingegen nur geschätzte 30-40 Jahre reichen und somit sogar früher erschöpft<br />
sein als andere konventionelle Energiequellen. Bei einer Uranknappheit droht zusätzlich ein<br />
Ressourcenkampf und in der Konsequenz eine immense Preissteigerung, die in der derzeitigen<br />
Diskussion ausgeblendet wird.<br />
Atomkraft ist also keine nachhaltige Energiequelle, und somit auch kein Mittel gegen<br />
steigende Energiepreise.<br />
Atomkraft ist nicht sicher!<br />
Unfälle in Atomkraftwerken passieren nicht nur in Ländern der ehemaligen Sowjetunion, wo<br />
angeblich die veralterte Technik Schuld ist. In den letzten Jahren gab es Unfälle in Schweden<br />
und Frankreich, wo Radioaktivität ausgetreten ist und auch in Deutschland gab es<br />
Zwischenfälle, die leicht in einer Katastrophe hätten enden können. Besonders bei den älteren<br />
Atommeilern ist die Liste der meldepflichtigen Ereignisse laut Bundesumweltamt lang. 2001<br />
kam es zum Beispiel im AKW Brunsbüttel zu einer Wasserstoffexplosion in der Sicherheitszone.<br />
Experten, die den Unfall anschließend im Auftrag des Umweltministeriums untersuchten,<br />
kamen zu dem Ergebnis, dass dieser Unfall bis zur Kernschmelze mit radioaktiver Verstrahlung<br />
hätte führen können, wenn er nur geringfühgig anders verlaufen wäre. Egal wie gut und sicher<br />
die Technik angeblich ist, man kann nie das Risiko eines Super-GAUs ausschließen und dieses<br />
Risiko ist, egal wie klein es auch sein mag, einfach zu groß.<br />
296
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Und selbst ohne Störfall birgt die Atomkraft Gefahren für Mensch und Natur. Atomkraftwerke<br />
belasten durch die Abgabe aufgeheizten Kühlwassers die Flora und Fauna benachbarter Flüsse<br />
teils stark. Ökosysteme geraten so ins Ungleichgewicht und werden nachhaltig geschädigt.<br />
Die Belastung durch Strahlung im Umfeld von Atomanlagen ist signifikant höher als im<br />
normalen Mittel. Als Folge kann in betroffenen Regionen eine deutliche Erhöhung der<br />
Leukämiefälle festgestellt werden.<br />
Wie andere Großkraftwerke auch beeinflussen Atomkraftwerke durch ihre Kühltürme das<br />
Klima der umliegenden Regionen. Generell steigt die Luftfeuchtigkeit, was zu erhöhter<br />
Wolken- und Nebelbildung und dadurch weiter zu reduzierter Sonneneinstrahlung führen<br />
kann. Besonders für die Landwirtschaft können dadurch Schäden entstehen. Neubauten von<br />
AKW können regionale Klimata deutlich verändern.<br />
Hinzu kommt, dass Atomkraftwerke, allein durch ihr Zerstörungspotenzial, theoretisch auch<br />
immer ein lohnenswertes Ziel für Terroranschläge sind.<br />
Atomkraft ist nicht sauber!<br />
Jedes Jahr entstehen in deutschen Atomkraftwerken 400 Tonnen hoch radioaktiver Abfall. Was<br />
mit diesen, über tausende von Jahren strahlenden Abfällen geschehen soll, ist bisher nicht im<br />
Geringsten geklärt. Die Lösung des Endlagerproblems wird in die Zukunft verschoben und der<br />
atomare Müll wird zwischengelagert. Seit Juni 2005 dürfen keine Brennelemente zum Zwecke<br />
der Wiederaufbereitung mehr ins Ausland gebracht werden. Dies führte jedoch nicht zu einer<br />
Reduzierung der Atommüllproduktion sondern füllt die bestehenden Zwischenlager nur<br />
schneller auf. In Deutschland existieren zur Zeit 16 Zwischenlager, davon 12 direkt an den<br />
Atomkraftwerken. Einer Hochrechnung von Greenpeace zufolge werden sich im Jahre 2030<br />
24.000 m³ hoch radioaktiver Müll angesammelt haben, dessen Lagerung und Sicherstellung bis<br />
heute nicht geklärt sind.<br />
Das Zwischen- Endlager Gorleben<br />
Der durchlöcherte Salzstock Gorleben stellt jetzt seit mehr als 25 Jahren die Legitimation dafür<br />
dar, dass in Deutschland Atomenergie produziert werden kann. Er liefert den<br />
Entsorgungsnachweis für die gesamte deutsche Atomenergieproduktion. Bis heute befindet<br />
sich allerdings kein Atommüll in Gorleben. Das Erkundungsberkwerk Gorleben ist unter<br />
Fachleuten sehr umstritten. Es gibt bis zum heutigen Tag eine große Anzahl von Gutachten,<br />
297
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
die die Eignung von Gorleben als Endlager bestreiten. Leider gibt es fast genau so viele<br />
Gutachten, die dem Salzstock Gorleben Endlagereigenschaften bescheinigen.<br />
Allerdings bestärken die Vorfälle im Atommülllager Asse 2 die Bedenken bezüglich der Eignung<br />
Gorlebens als Endlager – auch hier ist schon Wasser eingedrungen.<br />
Das „Atommülllager“ Asse 2<br />
Berichte über die Einsturzgefahr und radioaktive Laugen im Untergrund durchziehen seit<br />
Langem die Schlagzeilen über das sog. Forschungsbergwerk. Asse 2 war angeblich für die<br />
Ewigkeit gebaut und schon nach 40 Jahren am Ende. In der Asse lagern 126.000 Fässer schwach<br />
und mittelradioaktiven Materials. Nach Aussagen der Betreiber war die Asse bisher trocken<br />
und sicher. Zur Zeit fließen aber täglich 12 Kubikmeter Salzlauge in die Asse. Der Zufluss kann<br />
nach Aussage des Betreibers nicht gestoppt werden. In der Salzlauge wurde erstens eine<br />
Strahlenbelastung festgestellt und zweitens bedroht die Salzlauge die Stabilität der Asse im<br />
Allgemeinen, da es zu einem Aufweichen der Wände und Pfeiler führt. Das austreten<br />
radioaktiver Flüssigkeit im Salzstock Asse wirft die Frage auf, ob Salzstöcke die geeigneten<br />
Stätten sind, unseren Zivilisationsmüll die nächsten 1000 Jahre zu lagern. Asse II wird zur Zeit<br />
faktisch zum Endlager, da die Bergung / Rückholung immer unwahrscheinlicher wird. Die<br />
Frage, ob wir der nächsten Generation einen verschuldeten Staat überlassen wollen, wird von<br />
der aktuellen Führungsriege der Politik verneint, dieselben Personen haben jedoch kein<br />
Problem den nächsten 20 Generationen einen riesigen Berg atomaren Mülls aufzubürden.<br />
Atomkraft stärkt Monopole!<br />
Als sozialistischer Jugendverband lehnen wir die Atomkraft auch auf Grund ihrer<br />
monopolistischen Strukturen ab, da sie die Konzentration des Kapitals steigert. Nur große<br />
Konzerne – unterstützt durch den Staat – können Atomkraftwerke bauen. In Deutschland<br />
teilen 4 Betreiber den Markt für Atomstrom unter sich auf. Um ein Atomkraftwerk zu bauen,<br />
muss ein sehr hohes Investitionsvolumen aufgebracht werden, was nur großen Konzernen<br />
möglich ist. Auf der anderen Seite sind dezentrale Energieversorger in der Lage mit weit<br />
geringeren Investitionen Energie zu produzieren. Die Förderung der Atomkraft von Seiten des<br />
Staates ist somit auch ein direkter Beitrag zu gesteigerter Kapitalakkumulation. Dabei ist die<br />
Atomkraft teurer als andere Energiequellen, da ein AKW je installierter Kilowattleistung<br />
fünfmal so viel kostet, wie ein modernes Gaskraftwerk. Ein Atomkraftwerk rechnet sich somit<br />
allein durch staatliche Milliardensubventionen – es lebt von der Übernahme des<br />
Investitionsrisikos durch den Staat. Die Atomkraft wird durch die Konzerne aber trotzdem<br />
gefordert, weil es nach Abschreibung die Eigenschaft hat, nur noch Gewinn zu erwirtschaften,<br />
298
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
der dann in die Taschen der Energiekonzerne fließt. Dies erklärt auch die mit Nachdruck<br />
geführte Kampagne der Atomlobby zur Laufzeitverlängerung. Atomstrom ist eine relativ<br />
bequeme Art und Weise Geld zu verdienen. Denn trotz der überproportional hohen<br />
Investitionskosten liebäugeln die betreffenden Konzerne mit Neubauten. Durch Abschreibung<br />
der Investitionskosten und den zu erwartenden Gewinn ist es eine sehr sichere Investition und<br />
die Gefahren brauchen die Konzerne nicht zu fürchten. Die Versicherung für den Fall eines<br />
Unfalls wird auf die Allgemeinheit abgewälzt, da die Risiken nur zu einem Bruchteil versichert<br />
werden müssen und auch für die Entsorgung der Steuerzahler aufkommt. Allein die<br />
Stilllegungskosten für das Atommülllager Morsleben sollen sich auf 1,5 Mrd. Euro belaufen.<br />
Insofern ist die Atomkraft gerade weil sie so gefährlich ist, eine ideale Kapitalanlage; nirgends<br />
sonst würde der Staat derart für die Risiken aufkommen. Nur bei der Atomkraft sind die Risiken<br />
– von der Verstrahlung einzelner Menschen, über die radioaktive Verseuchung von Flüssen bis<br />
hin zum Super-GAU mit der dauerhaften Verstrahlung ganzer Regionen – derart hoch, dass der<br />
Staat zwangsläufig einspringen muss.<br />
Atomkraft schafft keine Arbeitsplätze!<br />
Atomanlagen haben im Vergleich zu anderen Anlagen wenig Beschäftigte. Allerdings sind<br />
diese Arbeitsplätze besonders sicher, da auch nach der Schließung der Atomkraftwerke noch<br />
ein jahrelanger Rückbau der Anlagen notwendig ist. Vom Atomausstieg sind in Deutschland<br />
über einen sehr langen Zeitraum 38.000 Arbeitsplätze betroffen, im Bereich der erneuerbaren<br />
Energien arbeiteten im Jahr 2006 214.000 Menschen. Schon eine Gegenüberstellung dieser<br />
beiden Zahlen verdeutlicht, dass Kernenergie wesentlich geringere positive Impulse auf den<br />
Arbeitsmarkt ausübt, als dies die erneuerbaren Energien tun. Aus beschäftigungspolitischer<br />
Sicht ist der Totalausstieg aus der Atomenergie mit einem gleichzeitigen Ausbau der<br />
erneuerbaren Energien eine win-win Situation. Dies führt zu einem Anstieg der Beschäftigten<br />
im Bereich der erneuerbaren Energien und macht Deutschland energiepolitisch unabhängiger.<br />
Atomkraft schafft keine Versorgungssicherheit<br />
Während die Atomkraftwerke bisher vor allem als sogenannte Grundlastkraftwerke<br />
funktioniert haben, die den Grundbedarf an Energie bereitstellen und damit das Niveau des<br />
niedrigsten Verbrauchs innerhalb eines Tages abdeckten, wird diese Grundlast heute bereits<br />
ausreichend von Windkraftanlagen abgedeckt. Lediglich an windarmen Tagen muss die<br />
Energieproduktion flexibel ergänzt werden – immer komplementär zum durch Windkraft<br />
erzeugten Strom, sodass sich in der Summe die (konstante) Grundlast ergibt. Atomkraft<br />
erweist sich in dieser neuen Situation als zu unflexibel und wird somit als Grundsicherung<br />
299
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
überflüssig. Für die Absicherung der Spitzen eignet sie sich aufgrund ihrer Trägheit ebenfalls<br />
nicht, zumal in heißen Sommern Atomkraftwerken aufgrund ihres Kühlwasserbedarfs die<br />
Abschaltung droht, wenn das Wasser der Flüsse zu heiß wird. Das zuverlässige Abdecken der<br />
Stromspitzen können nur Kohle und Gas, sowie zunehmend speicherbare Wasserkraft<br />
übernehmen. Atomkraft ist eine Idee von gestern, die den modernen Anforderungen flexibler<br />
Energieversorgung nicht mehr gewachsen ist.<br />
Atomkraft ist nicht friedlich!<br />
Bei der Atomenergie hängen zivile und militärische Nutzung immer direkt und untrennbar<br />
zusammen. Spätestens mit der Erschöpfung der Uranvorräte und dem damit verbundenen<br />
Einstieg in die Plutoniumwirtschaft würde jedes Atomkraftwerk direkt waffenfähiges Material<br />
produzieren. Aber auch schon heute ist durch die sogenannte Wiederaufbereitung von<br />
Kernbrennstoff und Brutreaktoren eine enge Verknüpfung gegeben.<br />
Wer die Verbreitung von Nuklearwaffen unterbinden bzw. diese Waffen langfristig ganz<br />
abschaffen will, muss sich also auch von der sogenannten zivilen Nutzung der Kernenergie<br />
trennen. Diese und die militärische Nutzung der Kernenergie sind lediglich zwei Seiten<br />
derselben Medaille.<br />
Atomkraftwerke helfen den Entwicklungsländern nicht!<br />
Atomkraft kann kein Modell für Entwicklungsländer sein, da ihnen zuerst einmal das Kapital<br />
fehlt, diese Projekte umzusetzen. Doch auch wenn sich ein Investor finden sollte, kommt<br />
Atomkraft aufgrund der Kühlwasserabhängigkeit für heiße Gegenden sowieso nicht in Frage.<br />
Gerade für aufstrebende Schwellenländer, die ihren Energiesektor forciert ausbauen wollen, ist<br />
die Versuchung jedoch zunächst groß. Da sie „auf einen Schlag“ eine große Menge an Energie<br />
erzeugen können. Andererseits möchte niemand gerne eine Anhäufung von AKW in<br />
Krisenregionen erleben. Auch entwicklungspolitisch ist es somit wichtig diesen Ländern<br />
gangbare Alternativen aufzuzeigen. Die Technologieentwicklung ist mittlerweile so weit<br />
fortgeschritten, dass es möglich wird, die Phase der Grundsicherung durch Atomkraft zu<br />
überspringen und sofort auf erneuerbare Energien zu setzen. Besser als der Glaube an diese<br />
Idee ist jedoch ein vorgelebtes Beispiel. Die Symbolwirkung von Deutschland als Industrieland<br />
mit weit überdurchschnittlichem Energieverbrauch, dass auf Atomkraft verzichtet, ist dabei<br />
nicht zu unterschätzen. Schon aus diesem – sicherheits- und entwicklungspolitischen Grund<br />
müssen die Atomkraftwerke abgeschaltet werden.<br />
300
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Atomkraft ist kein Trend und auch nicht unverzichtbar!<br />
Der weltweite Trend zur Atomkraft ist schlicht nicht vorhanden. In Europa sind lediglich 2<br />
AKWs in Planung (Finnland und Frankreich), während 2007 7 AKW vom Netz genommen<br />
wurden. Auch verzichten viele europäische Länder z.B. Dänemark, Österreich, Italien, Estland,<br />
Griechenland, Lettland, Luxemburg, Norwegen und Portugal nach wie vor komplett auf<br />
Atomkraft. Desweiteren planen wie Deutschland ebenfalls Schweden und Belgien sowie<br />
Spaniens sozialistische Regierung den Ausstieg aus der Atomenergie.<br />
Und im Übrigen: Schon heute ist Atomstrom nicht unverzichtbar. Fünf Kernkraftwerke sind<br />
inzwischen ohne sichtbare Konsequenzen zeitweise abgeschaltet worden. Etwa Biblis A, das<br />
vom Herbst 2006 bis zum Frühjahr 2008 sowie von Mai bis September 2008 nicht am Netz war.<br />
Dieser Strom fehlte offensichtlich niemandem.<br />
301
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
I<br />
Initiativanträge<br />
I 3 - LV Berlin<br />
Erbschaftssteuer erhalten –<br />
Umverteilungsspielräume nutzen!<br />
Derzeit befindet sich eine Novellierung des Erbschaftssteuergesetzes im<br />
Gesetzgebungsverfahren. Wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 07.11.2006<br />
zur Frage der Berechnung des Wertes von zu vererbendem Vermögen ist hier eine<br />
verfassungsgemäße Überarbeitung des Erbschaftssteuergesetzes notwendig. In den<br />
vergangenen zwei Jahren kam es zu einer Vielzahl von Verständigungsversuchen innerhalb der<br />
Großen Koalition, wie eine solche Erbschaftssteuerreform aussehen kann. Insbesondere hat die<br />
SPD-Bundestagsfraktion in Vertrauen auf die Zustimmung der Union zur Reform des<br />
Erbschaftssteuerrechtes auch der Unternehmenssteuerreform und damit einer weitreichenden<br />
Entlastung von Unternehmen zugestimmt. Am Donnerstag, 9. Oktober 2008 ist eine weitere<br />
Verhandlungsrunde gescheitert. Die 3. Lesung des Gesetzes soll am 17.10.2008 stattfinden,<br />
einen Tag vor dem Bundesparteitag.<br />
Hinsichtlich des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens fordern wir die CDU/CSU auf, ihren<br />
Widerstand gegen die verfassungsgemäße Neufassung des Erbschaftssteuergesetzes<br />
aufzugeben. Hierbei darf es zu keinen Einbußen hinsichtlich des Steueraufkommens kommen,<br />
auch die angestrebte weitere Privilegierung von Betriebsvermögen ist nicht akzeptabel.<br />
Für uns ist die gerechte Besteuerung ererbten Vermögens ein zentraler Bestandteil eines<br />
solidarischen Steuersystems. Hohe Privatvermögen sind ein besonderes Kennzeichen<br />
individueller Leistungsfähigkeit und sind deshalb gesondert zu besteuern. Mittelfristig ist<br />
deshalb die Erbschaftssteuer auszubauen und für einen höheren Ertrag zu sorgen. Daneben<br />
muss eine verfassungsgemäße Wiedereinführung einer Vermögenssteuer erfolgen. Damit<br />
können dringend benötigte zusätzliche Investitionen der Länder in Bildung und Infrastruktur<br />
ermöglicht werden.<br />
302
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Ohne eine politische Einigung im aktuellen Gesetzgebungsverfahren läuft die Erhebung der<br />
Erbschaftssteuer zum 31.12.2008 aus. Sollte diese Einigung nicht zustande kommen, fordern wir<br />
den Parteivorstand auf, die Koalition mit der CDU/CSU zu beenden.<br />
I 8 - LV NRW<br />
Antworten auf die Finanzmarktkrise:<br />
kurzfristig stabilisieren, danach regulieren!<br />
Nach den turbulenten Ereignissen auf den internationalen Finanzmärkten während den letzten<br />
Wochen ist das Modell des Finanzmarktkapitalismus endgültig diskreditiert. Wachstum,<br />
Beschäftigung und nicht zuletzt der soziale Frieden sind unmittelbar bedroht. Hieraus sind aus<br />
Sicht der <strong>Jusos</strong> zwei Lehren zu ziehen: Kurzfristig müssen die Finanzmärkte zügig stabilisiert<br />
werden, um die schlimmsten realwirtschaftlichen Verwerfungen zu vermeiden. Danach<br />
beginnt dann die eigentliche Aufgabe für sozialdemokratische Politik: Es sind dringend<br />
Maßnahmen zu ergreifen, die künftige Finanzmarktkrisen vermeiden helfen und wieder eine<br />
stabile und sozial progressive gesamtwirtschaftliche Entwicklung ermöglichen.<br />
Einige Notfallmaßnahmen können ohne große Kosten für den Steuerzahler und ohne die<br />
Sozialisierung von Verlusten einzelner Banken durchgesetzt werden. Hierzu gehört zum einen<br />
das Aussetzen von prozyklisch wirkenden Regulierungsmaßnahmen wie die (ohnehin<br />
reformbedürftigen) Eigenkapital-Standards nach Basel II. Ebenso sollte eine weitgehende<br />
Garantie für die Spareinlagen der privaten Haushalte ausgesprochen werden. Bei<br />
Rettungsaktionen einzelner Finanzinstitute muss generell gelten, dass die Aktionäre von in<br />
Schieflage geratenen Finanzinstituten den größten Anteil der Konsequenzen ihres<br />
Fehlverhaltens zu tragen haben. Wenn der Staat faule Schuldtitel aufkauft, muss im Gegenzug<br />
eine Übertragung von Eigentumsrechten an den betroffenen Banken stattfinden. Hierdurch<br />
erhält der Staat die Möglichkeit, von künftigen Gewinnen zu profitieren und kann Einfluss auf<br />
das Management der Banken ausüben. Im Fall von staatlichen Bürgschaften sollte eine<br />
Bürgschaftsgebühr erhoben werden.<br />
Grundsätzlich muss der Staat aber – bei allen moralischen Bedenken – systemrelevante Banken<br />
in Schieflage vor dem Bankrott bewahren: Ein allgemeiner Vertrauensverlust in den<br />
reibungslosen Zahlungsverkehr sowie eine Kreditklemme sind für die Gesellschaft mit noch<br />
höheren Kosten verbunden als die „Rettung“ einzelner Banken!<br />
303
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
Im Gegenzug sind zur Förderung eines endlich wieder sozial fortschrittlichen und<br />
makroökonomisch funktionalen Wirtschaftsmodells nach der Überwindung der Krise<br />
weitgehende Reformen notwendig. Insgesamt geht es darum, den Finanzsektor auf seine<br />
eigentliche Aufgabe zurückzuführen, nämlich die solide Überprüfung von Kreditwürdigkeit,<br />
Kreditvergabe und Überwachung der Kreditverwendung. Finanzalchimie hat hierbei keinen<br />
Platz, sondern das Hauptaugenmerk des Finanzsektors muss auf der Finanzierung von<br />
langfristig ausgerichteten Realinvestitionen liegen. Im Einzelnen sind dabei unter anderem<br />
folgende Maßnahmen zu ergreifen:<br />
- Einführung eines „Finanz-TÜV“, der intransparente und dubiose Finanzprodukte<br />
verbietet und über die Einhaltung von Transparenzstandards wacht<br />
- Rigorose Beschränkung des außerbörslichen und außerbilanziellen Handels<br />
- Regulierung und Aufsicht von Finanzinstituten unabhängig von ihrer Rechtsform,<br />
einschließlich Hedge-Fonds, Investmentfonds, Private-Equity-Fonds<br />
- Wiedereinführung einer Börsenumsatzsteuer bzw. einer umfassenden<br />
Finanztransaktionssteuer zur Verringerung der Spekulationstätigkeit und zur<br />
Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben<br />
- Verstärkte europäische/internationale Kooperation bei der Finanzaufsicht.<br />
I 9 - LV NRW<br />
Aus ökologischen und ökonomischen<br />
Gründen: Komprimierung von<br />
Änderungsanträgen!<br />
Wir fordern die für die Organisation eines Bundeskongresses Verantwortlichen dazu auf,<br />
Änderungsanträge aus ökologischen und ökonomischen Gründen deutlich zu komprimieren.<br />
Alle Änderungsaufträge zu einem Antragsbereich sollen gruppiert und zusammengefügt<br />
werden, um Papier und Geld zu sparen, sowie die Übersicht für die Delegierten zu verbessern.<br />
304
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
I 10 - LV Saarland<br />
Atomstrom = Ökostrom = unverschämter<br />
geht es nicht!<br />
Im Juni 2008 wurden die ersten Meldungen bekann, dass im Niedersächsischen Atommülllager<br />
Asse II nicht alles so läuft, wie es sich die Bürger und Bürgerinnen unserer Republik vorstellen.<br />
Erst nach intensivem Druck der Niedersächsischen SPD wurde eine umfangreiche Untersucung<br />
in Auftrag gegeben, diese sollte die Folgen für Umwelt und Klimaschutz klären. Die<br />
zuständigen Ausschüsse haben auch in der Sommerpause weiter getagt und so langsam lässt<br />
sich das traurige Geschehen erahnen. Die Befürchtungen, die sich im Verlauf der<br />
Ausschussberatungen ergaben, wurden, nach ausführlichen Auswertungen des zur Verfügung<br />
stehenden Materials, noch übertroffen.<br />
Die bis jetzt ersichtlichen, erschütternden Mängel lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
1. Es gab nie eine geeignete, funktionsfähige und sichere „Asse II“.<br />
2. Die Bevölkerung ist über Jahre hinweg über die Voraussetzungen und die<br />
grundsätzliche Eignung des Salzstocks Asse II als Forschungsstandort für schwach- und<br />
mittelradioaktiven Müll getäuscht worden. Die Verantwortlichen für dieses<br />
jahrzehntelange Täuschungsmanöver sind bekannt. Es handelt sich um das HMGU<br />
(Helmholz-Zentrum München für Gesundheit und Umwelt) sowie das LBEG<br />
(Landesbergamt) und das NMU (Niedersächsische Ministerium für Umwelt und<br />
Klimaschutz).<br />
3. Die Laugenzutritte im angeblich trockenen Bergwerk sind bereits seit den 60er-Jahren<br />
bekannt. Der Laugensumpf vor Kammer 12 seit 20 Jahren. Der Umgang mit radioaktiven<br />
Abfällen ist nicht sachgemäß erfolgt, so sind bereits korrodierte und beschädigte Fässer<br />
eingelagert worden. Besonders erschreckt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass<br />
unter Einlagerung hier ein unachtsames Abkippen aus Laderschaufeln verstanden wird,<br />
welches auf Fotos festgehalten wurde.<br />
4. Kommunikation, Steuerung und Kontrolle waren mangelhaft. Defiziente wurden<br />
leichtfertig in Kauf genommen. So fehlt bis heute eine Störfallanalyse. Die<br />
Rechtsgrundlage wurde eigenwillig ausgelegt und die Prüfung nach Atom- und<br />
Strahlenschutzrecht hat in Gänze gefehlt. Maßnahmen erfolgten seit Jahren<br />
305
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
ungenehmigt, Strahlenschutzanweisungen entsprachen nicht den üblichen Standards,<br />
außerdem führten eigenmächtige Baumaßnahmen zu heute unkalkulierbaren Risiken.<br />
5. Der Umgang mit der austretenden radioaktiven Salzlauge erfolgte nicht nach<br />
bestehenden Standards und zu allem Überfluss noch rechtwidrig. Es gibt nachweislich<br />
Kontakt von Lauge mit radioaktiven Abfällen.<br />
Leider ist aufgrund der komplexen Baustruktur davon auszugehen, dass noch längst nicht alle<br />
Mängel der Öffentlichkeit bekannt sind. Fest steht, dass der eingeschlagene Weg zur<br />
lückenlosen Aufklärung richtig und wichtig ist. Die bisher schon aufgedeckten,<br />
schwerwiegenden Missstände lassen keinen anderen Schluss zu, als den, dass der jetzige<br />
Betreiber, die HMGU mit sofortiger Wirkung abgesetzt werden muss. Die Ankündigung vom<br />
04.09.2008, dass die Aufsicht und Betreibung der Asse II künftig durch das BfS (Bundesamt für<br />
Strahlenschutz) erfolgen soll, begrüßen die <strong>Jusos</strong> sehr. Diese Konsequenzen dürfen aber nicht<br />
die Einzigen bleiben. Die Kontrolle und das gesamte Verfahrensmanagement der Asse II<br />
müssen künftig völlig neu gestaltet werden. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir<br />
durch die Erfahrungen, die schon jetzt aus der Asse II gezogen werden können, wieder um<br />
Jahrzehnte zurückgeworfen wurden, ja sogar wieder fast am Anfang stehen. Die Suche nach<br />
einem geeigneten Endlager muss ergebnissoffen, transparent und vor allem zielorientiert<br />
geführt werden. Die Ergebnisse aus der Asse II haben zudem das Salzstock Endlager Gorleben<br />
stark in Zweifel gestellt.<br />
1. Die Aufklärungsarbeiten im Atommülllager Asse II müssen vollständig und ohne<br />
Rücksicht auf unangenehme Entdeckungen fortgeführt werden, hierfür ist vorwiegend<br />
die Landesregierung und ihre angehängten Ministerien verantwortlich. Zudem muss<br />
insbesondere die Betreibergesellschaft dazu gezwungen werden, dass der Vertuschung<br />
der Fakten ein Ende bereitet wird.<br />
2. Die Landesregierung muss ihr Scheitern eingestehen. Sie muss mit sofortigem Beginn<br />
sicherstellen, dass die zukünftigen Arbeiten an der Asse II in höchstem Maß<br />
gewissenhaft, zuverlässig und rechtssicher erfolgen.<br />
3. Die Einlagerung und Lagerung von atomar verseuchtem Material darf nicht mehr nach<br />
den Gesetzmäßigkeiten des Bergrechts geschehen, sondern nach dem Atom- und<br />
Strahlenschutzgesetz.<br />
4. Alle anstehenden Kosten im Bergwerk Asse II und in allen anderen Atommülllagern<br />
müssen ab sofort auf die einlagernden Gesellschaften und Institutionen umgelegt<br />
werden. Der Deckmantel der Forschung zur Entledigung der Beseitigungskosten muss<br />
für die Emittenten fallen.<br />
306
Beschlüsse Bundeskongress 2008, Weimar<br />
5. Der zukünftige Betreiber wird per Gesetz dazu gezwungen, dass er eine lückenlose<br />
Störfallliste zu führen hat. Der Minister wird zudem aufgefordert, vierteljährlich dem<br />
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz in öffentlicher Sitzung über die weiteren<br />
Entwicklungen in der Asse II zu berichten. Die Landesregierung muss ab sofort eine<br />
ordnugnsgemäße Fachaufsicht sicherstellen.<br />
6. Das Versuchsendlager Asse II war und ist keine Forschungseinrichtung, sondern<br />
faktisch ein atomares Endlager. Das weitere Verfahren muss daher nach dem<br />
Atomrecht und seinen Anforderungen gestaltet werden.<br />
7. Mit allen Beteiligten muss ein „Zukunftskonzept Asse II“ entwickelt werden, um<br />
gemeinsam Verantwortung für eine langfristige, sichere und zuverlässige Lösung zu<br />
übernehmen.<br />
8. Ein Einstürtzen der Asse II aufgrund des starken Wassereinbruchs muss verhindert<br />
werden.<br />
9. Die Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll muss nach den Erkenntnissen<br />
aus der Asse II von vorne beginnen. Hierbei müssen alle Gesteinformationen, im<br />
gesamten Bundesgebiet in Betracht gezogen werden. Es kann nicht sein, dass die<br />
Ministerpräsidenten, die am lautesten für die Verlängerung von Atommeilern streiten,<br />
die sind, die bei der Endlagerfrage sagen: „Bei uns aber bitte nicht“.<br />
307