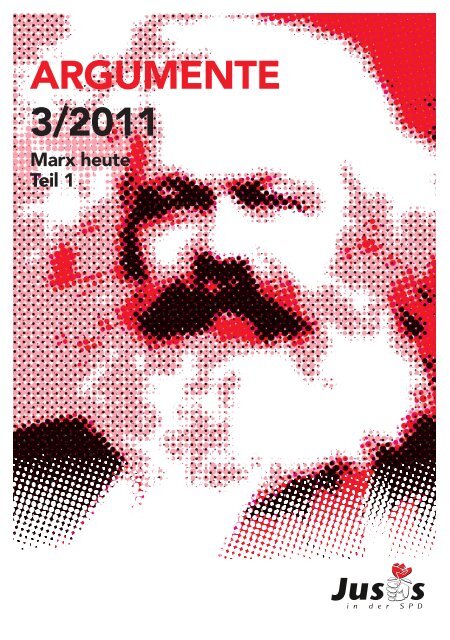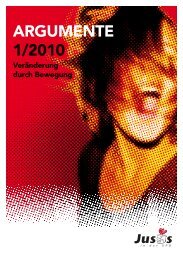Argumente 3 11 Marx heute.pdf - Jusos
Argumente 3 11 Marx heute.pdf - Jusos
Argumente 3 11 Marx heute.pdf - Jusos
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ARGUMENTE<br />
3/20<strong>11</strong><br />
<strong>Marx</strong> <strong>heute</strong><br />
Teil 1
ARGUMENTE<br />
3/20<strong>11</strong><br />
<strong>Marx</strong> <strong>heute</strong><br />
Teil 1<br />
Impressum<br />
Herausgeber Bundesverband der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD beim<br />
SPD-Parteivorstand<br />
Verantwortlich Sascha Vogt und Jan Böning<br />
Redaktion Simone Burger, Matthias Ecke, Ralf Höschele, Thilo Scholle, Jan Schwarz,<br />
Robert Spönemann<br />
Redaktionsanschrift SPD-Parteivorstand, Juso-Bundesbüro, Willy-Brandt-Haus,<br />
109<strong>11</strong> Berlin<br />
Tel: 030 25991-366, Fax: 030 25991-415, www.jusos.de<br />
Verlag Eigenverlag<br />
Druck braunschweig-druck GmbH<br />
Die Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion oder<br />
des Herausgebers wieder.
INHALT<br />
Intro .......................................................................................................................... 4<br />
Von Matthias Ecke, Thilo Scholle und Jan Schwarz, Mitglieder der Redaktion<br />
Magazin<br />
Regeneriert oder politisch ergraut? Die SPD im Herbst 20<strong>11</strong>............................... 7<br />
Von Franz Walter, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Göttingen<br />
Sozialdemokratische Orientierung in der Wirtschaftspolitik.................................13<br />
Von Jan Schwarz, stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender<br />
Schwerpunkt<br />
Das Compagnie-Geschäft <strong>Marx</strong> und Engels….......................................................17<br />
Klaus Körner, Publizist in Hamburg<br />
<strong>Marx</strong> und die Sozialdemokratie – die SPD und <strong>Marx</strong>… ....................................... 23<br />
Von Thilo Scholle und Jan Schwarz, Mitglieder der Redaktion<br />
Care als zentrales Strukturproblem kapitalistischer Vergesellschaftung<br />
und deren feministische Bearbeitung.................................................................... 31<br />
Von Lisa Yashodhara Haller, Universität Kassel<br />
2 Inhalt <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
Staat: Herrschaft? Notwendigkeit? Instrument?<br />
Zur Staatstheorie <strong>Marx</strong>’ und marxistischer Staatstheorie .................................... 38<br />
Von Julian Zado, stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender<br />
Der Wert des Werts ............................................................................................... 44<br />
Von Björn Brennecke<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital...................................................................... 48<br />
Von Tobias Gombert<br />
3
INTRO: MARX HEUTE<br />
Von Matthias Ecke, Thilo Scholle und Jan Schwarz, Mitglieder der Redaktion<br />
Karl <strong>Marx</strong> wurde 1818 in Trier geboren,<br />
und ist 1883 in London gestorben. Er<br />
war Philosoph, Ökonom, Historiker,<br />
Soziologe, Journalist, Politiker und Revolutionär.<br />
Er ist einer der bekanntesten<br />
Menschen der Welt, bis <strong>heute</strong><br />
werden seine Ideen und Schriften kontrovers<br />
diskutiert und weiterentwickelt.<br />
Die Prophezeiung seines ersten Biographen<br />
Franz Mehring hat sich bewahrheitet:<br />
„Sein Name wird durch<br />
die Jahrhunderte fortleben und so<br />
auch sein Werk.“ Dabei ist sein Werk<br />
so unterschiedlich bewertet, wie wohl<br />
kaum ein anderes. Von seinen GegnerInnen<br />
verhasst, aber auch geachtet,<br />
von seinen AnhängerInnen sowohl<br />
nachgebetet, verschiedentlich interpretiert,<br />
als auch immer wieder verworfen.<br />
Er war der bedeutendste Kopf<br />
der ArbeiterInnenbewegung, bis <strong>heute</strong><br />
bezeichnet die SPD die marxistische<br />
Gesellschaftsanalyse als eine ihrer<br />
Wurzeln. Das Verhältnis der SPD zu<br />
Karl <strong>Marx</strong> hat Willy Brandt treffen beschrieben:<br />
"Die Analysen des großen<br />
Denkers waren vielfach richtig. Teile<br />
seines Instrumentariums und seiner<br />
Methode sind auf faszinierende Weise<br />
modern geblieben. Seine Antworten<br />
erwiesen sich vielfach als falsch, seine<br />
Hoffnungen als trügerisch."<br />
<strong>Marx</strong> gilt <strong>heute</strong> vor allem Autor einer Gesellschaftslehre<br />
und Pionier der Ökonomietheorie.<br />
Er wurde vielfach missbraucht,<br />
um Gewaltherrschaften zu legitimieren.<br />
Ihm wurde und wird viel vorgeworfen.<br />
"<strong>Marx</strong> geht es wie der Bibel: Er wird viel<br />
zitiert und kaum verstanden" (Erich<br />
Fromm). Dabei sind es gerade die unterstellten<br />
Vorwürfe, gegen die er sich selbst<br />
am vehementesten ausgesprochen. <strong>Marx</strong><br />
war weder der Autor eines sozialistischen<br />
Systems, noch der Erschaffer einer neuen<br />
Utopie. "Wer ein Programm für die Zukunft<br />
verfaßt, ist ein Reaktionär" (<strong>Marx</strong>).<br />
Er lehnte gerade geschlossene Welterklärungen<br />
ab und missbilligte dogmatische<br />
Ideologien. So ist auch sein Ausspruch „Je<br />
ne suis pas <strong>Marx</strong>iste“ zu verstehen, mit<br />
dem er sich von sich <strong>Marx</strong>isten nennenden<br />
Gruppen distanzierte. Diejenigen, die nur<br />
versuchten, zu verstehen was er aufgeschrieben<br />
hatte verachtete er. Und zwar<br />
nicht nur weil den meisten nicht einmal<br />
das gelang, sondern weil es auch seinen<br />
Überzeugungen im tiefsten widersprach.<br />
Georg Lukács beschrieb dies so: „<strong>Marx</strong>isten<br />
in dem Sinne, in dem <strong>Marx</strong> selbst kein<br />
<strong>Marx</strong>ist war, es nicht sein wollte, gibt es<br />
[...] nicht und kann es nicht geben; das<br />
Schwören auf die Worte der Meister ist das<br />
Schicksal jeder Schule, die eine endgültige<br />
Wahrheit letzter Instanz kennt. Irgendeine<br />
Wahrheit dieser Art kennt der <strong>Marx</strong>ismus<br />
aber nicht. Er ist kein unfehlbares Dogma,<br />
sondern eine wissenschaftliche Methode.<br />
Er ist nicht die Theorie eines Individuums,<br />
der ein anderes Individuum eine andere<br />
und höhere Theorie entgegenstellen könnte;<br />
er ist vielmehr der proletarische Kassen-<br />
4<br />
Intro <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
kampf, in Gedanken gefaßt; er ist aus den<br />
Dingen selbst, aus der historischen Entwicklung<br />
emporgewachsen und wandelt<br />
sich mit ihr; deshalb ist er so wenig ein leerer<br />
Trug wie eine ewige Wahrheit. Dem<br />
entspricht es durchaus, daß es gerade die<br />
»orthodoxen« <strong>Marx</strong>isten gewesen sind,<br />
welche die wissenschaftlichen Resultate,<br />
die einst von <strong>Marx</strong> und Engels gewonnen<br />
worden sind, nach der wissenschaftlichen<br />
Methode dieser Männer zu revidieren verstanden<br />
haben.“<br />
<strong>Marx</strong> wichtigstes Instrument war die<br />
Kritik, aber nicht nur als Selbstzweck, sondern<br />
um die Gesellschaft zu verändern.<br />
Dafür ist es notwendig zu Verstehen, was<br />
die entscheidenden Funktionen und Hebel<br />
der Gesellschaft sind. Ohne die Erkenntnis<br />
über die eigene Rolle in der Gesellschaft<br />
und das Wissen um die Funktionsmechanismen<br />
der Gesellschaft ist keine Emanzipation<br />
möglichen. „Die Menschen machen<br />
ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie<br />
nicht aus freien Stücken, nicht unter<br />
selbstgewählten, sondern unter unmittelbar<br />
vorgefundenen, gegebenen und überlieferten<br />
Umständen.“(<strong>Marx</strong>). In diesem Sinne<br />
ist er auch <strong>heute</strong> noch hoch aktuell. Das<br />
Verständnis über seine Theorien hilft die<br />
Welt zu verstehen. Es geht nicht darum zu<br />
begründen warum <strong>Marx</strong> Recht hatte oder<br />
ihn so zu interpretieren, dass er Recht hat,<br />
sondern seine Methode der Kritik anzuwenden<br />
und die passenden Teile seines Instrumentenkastens<br />
der Erklärungsansetze<br />
zu nutzen um die Verhältnisse unserer Zeit<br />
zu erfassen.<br />
Auch für die <strong>Jusos</strong> war und ist der Bezug<br />
auf <strong>Marx</strong> und seine theoretischen Erben<br />
von Bedeutung. Die <strong>Jusos</strong> verstehen<br />
sich <strong>heute</strong> als sozialistischer, feministischer<br />
und internationalistischer Richtungsverband.<br />
Dies ist das Ergebnis vieler Diskussionen<br />
und Auseinandersetzungen seit der<br />
Linkswende 1969. Dabei waren <strong>Jusos</strong> nie<br />
ein einheitlicher Block, sondern immer bestimmt<br />
von unterschiedlichen analytischen<br />
und strategischen Positionen. Diese schlugen<br />
sich in Strömungen nieder, die auch<br />
auf die Traditionen und Denkansätze der<br />
drei marxistischen theoretischen Stränge<br />
der Sozialdemokratie zu Beginn des Jahrhunderts<br />
aufgriffen. Die Refos bezogen<br />
sich auf Eduard Bernstein, die Antirevisionisten<br />
auf Rosa Luxemburg und die Juso-<br />
Linke auf Karl Kautsky und Rudolf Hilferding.<br />
Diese entwickelten sich weiter und<br />
nahmen auch immer wieder neue Theorieentwicklung<br />
in ihre Programmatik mit auf.<br />
Wer sozialistische Politik gestalten will<br />
kann auf <strong>Marx</strong> nicht verzichten. Dies ist<br />
der Anspruch der <strong>Jusos</strong>. Was dies für <strong>Jusos</strong><br />
bedeutet steht in Potsdamer Grundsatzerklärung<br />
von 1991: „Sozialismus bedeutet<br />
für uns die Befreiung aller Menschen von<br />
Ausbeutung und Unterdrückung, die<br />
Durchsetzung von Freiheit und Gleichheit,<br />
die uneingeschränkte Garantie aller<br />
Menschenrechte und Demokratie in allen<br />
Lebensbereichen. Dieser Sozialismus ist<br />
eine Gesellschaft der Selbstbestimmung in<br />
Solidarität, deren Voraussetzung es ist, "die<br />
freie Entfaltung eines jeden als Bedingung<br />
für die freie Entfaltung aller" (Karl <strong>Marx</strong>)<br />
zu begreifen.“<br />
In diesem Doppelheft der <strong>Argumente</strong><br />
möchten wir euch einen Einblick in die<br />
Ideen von Karl <strong>Marx</strong>, seine historische Bedeutung,<br />
die Weiterentwicklung seiner<br />
Schriften und die Debatten über seine Aktualität<br />
in verschiedenen Politikfeldern<br />
bieten. Die hier versammelten Beiträge<br />
spiegeln eine ganze Bandbreite der an<br />
<strong>Marx</strong>‘ Denken anknüpfenden Theoriestränge<br />
wieder, naturgemäß nicht alle. Der<br />
Pluralismus marxistischer Theoriebildung<br />
5
ist Denkanstoß und Herausforderung zugleich.<br />
Nicht alle hier vertretenen Ansätze<br />
sind zueinander widerspruchsfrei, nicht<br />
alle werden im Juso-Verband vollends geteilt.<br />
Doch gerade diese Fähigkeit, die vielfältigen<br />
Herrschaftsverhältnisse zu analysieren<br />
und durch kritische Theorie der<br />
Gesellschaft zu erklären, ist eine der unverzichtbaren<br />
Stärken des <strong>Marx</strong>‘schen Denkens.<br />
Eine Größe, die die Reichweite seines<br />
Werkes über die historischen<br />
Bedingungen der Entstehungszeit hinauswachsen<br />
lässt. Kritische Gesellschaftstheorie<br />
als Voraussetzung für sozialistische Politik,<br />
das war <strong>Marx</strong> gestern, das ist <strong>Marx</strong><br />
<strong>heute</strong>.<br />
Zu den einzelnen Beiträgen<br />
Klaus Körner gibt einen Einblick in das<br />
bewegte Leben von Karl <strong>Marx</strong>. Er geht<br />
durch die verschiedenen Stationen und<br />
Schaffensphasen in den verschiedenen<br />
Städten Europas. Dabei war sein Leben<br />
geprägt von ständiger Geldknappheit. Einen<br />
Schwerpunkt setzt er auf die Beziehung<br />
zu seinem Partner Fridrich Engels.<br />
Thilo Scholle und Jan Schwarz setzen<br />
sich mit dem Verhältnis zwischen der deutschen<br />
Sozialdemokratie und Karl <strong>Marx</strong><br />
und dem Wiederhall seiner Theorien in<br />
der Partei auseinander. Dabei war die Beziehung<br />
hoch kompliziert. Zeit seines Lebens<br />
begleitete <strong>Marx</strong> die Entwicklung der<br />
deutschen Arbeiterpartei kritisch und<br />
mischte sich ein. In der SPD kam es immer<br />
wieder zu Auseinandersetzungen um die<br />
Interpretation der marxschen Schriften.<br />
Lisa Y. Haller widmet sich den Leerstellen<br />
marxistischer Werttheorien aus Sicht einer<br />
feministischen Ökonomiekritik. Ihr Beitrag<br />
stellt heraus, wie die marxistische<br />
Theorie die Betreuungs-, Erziehungs- und<br />
Fürsorgearbeit vernachlässigt, die Voraussetzung<br />
für kapitalistische Akkumulation<br />
ist. Sie fordert eine Weiterentwicklung<br />
marxistischer Theorie durch einen feministischen<br />
Materialismus, um gerade Fragen<br />
der Vermarktung von Familienarbeit besser<br />
analysieren zu können.<br />
Julian Zado betrachtet die Rolle des Staates<br />
in der Theorie von <strong>Marx</strong> und die Entwicklung<br />
marxistischer Staatstheorie. Er<br />
bearbeitet die Frage, inwieweit Staatlichkeit<br />
eine Notwendigkeit ist und welche<br />
Rolle er als Machtinstrument hat. Er versteht<br />
Staat als Verdichtung von Kräfteverhältnissen<br />
ohne den Kapitalismus nicht<br />
möglich wäre.<br />
Björn Brennecke konzentriert sich auf die<br />
Streitfrage, inwieweit die marxsche Werttheorie<br />
zur Gesellschaftsanalyse überhaupt<br />
geeignet ist. Er stellt die verschiedenen Positionen<br />
dar und kommt zu dem Ergebnis,<br />
dass ein <strong>Marx</strong>ismus ohne Werttheorie seine<br />
schärfste Klinge verliert und alleine<br />
denjenigen dienen würde, die ihre Augen<br />
verschlossen halten wollen, um sich gemütlich<br />
im kapitalistischen System einzurichten.<br />
Tobias Gombert erklärt im ersten Teil seines<br />
Beitrages die Grundlagen der politischen<br />
Ökonomie, wie er sie im „Kapital“<br />
dargestellt hat. Er gibt damit einen Text,<br />
der sowohl Einsteigern die Möglichkeit<br />
bietet erste Verständnisse über die marxistische<br />
Denkweise zu gewinnen, aber auch<br />
<strong>Marx</strong>kennern noch neue Einblicke bieten<br />
kann. Der zweite Teil beschäftigt sich mit<br />
der marxschen Krisentheorie und deren<br />
Weiterentwicklung. <br />
6 Intro <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
REGENERIERT ODER<br />
POLITISCH ERGRAUT?<br />
DIE SPD IM HERBST 20<strong>11</strong><br />
Von Franz Walter, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Göttingen<br />
Magazin<br />
Hat sie sich erholt – die SPD? Schauen<br />
wir auf die Wahlen, die seit dem großen<br />
Desaster Ende September 2009 in<br />
Deutschland stattgefunden haben. In<br />
fünf Bundesländern konnte die SPD<br />
ihre Regierungsposition behaupten. In<br />
drei Bundesländern (Nordrhein-Westfalen,<br />
Hamburg und Baden-Württemberg)<br />
gelangte die SPD aus der Opposition<br />
heraus in das Kabinett. Aus<br />
sozialdemokratischer Sicht eine unzweifelhaft<br />
erfreuliche Bilanz. Indes:<br />
Mit einem kräftigen Ausbau des Wählerfundaments<br />
konnten sich die Sozialdemokraten,<br />
sieht man von den Wahlgängen<br />
in Hamburg und<br />
Mecklenburg-Vorpommern ab, keineswegs<br />
hervortun. Die SPD hielt in Sachsen-Anhalt<br />
und Bremen in etwa ihr<br />
vorangegangenes Ergebnis. Dagegen<br />
hatte sie einen weiteren Rückgang in<br />
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz<br />
(-9,9 Prozentpunkte) Baden-Württemberg<br />
und Berlin zu verkraften.<br />
Sehen wir einmal genauer auf die Bundesländern<br />
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen,<br />
da hier einige Spezifika<br />
der sozialdemokratischen Wähleranatomie<br />
gut deutlich werden. Die Sozialdemokraten<br />
in NRW verschlechterten sich 2010<br />
gegenüber 2005 um weitere 2,6 Prozentpunkte<br />
auf 34,5 Prozent. Die Anteile der<br />
baden-württembergischen Sozialdemokraten<br />
schmolzen 20<strong>11</strong> um zwei Prozentpunkte<br />
auf 23,1 Prozent ab. Die SPD in<br />
NRW steht damit wieder auf den Stand<br />
von 1954. Die Sozialdemokraten im Südwesten<br />
verbuchten 20<strong>11</strong> das schlechteste<br />
Resultat in ihrer Landesgeschichte. Zuwächse<br />
verzeichnet die SPD in beiden<br />
Ländern allein bei den über 60-Jährigen,<br />
einzig bei den Rentnern. Bei den Wählern,<br />
die einen Erwerb nachgingen, fiel die<br />
SPD um knapp vier Prozent zurück. In<br />
der Altersgruppe der 18-44Jährigen war<br />
die Abwendung von der SPD mit einem<br />
Minus von über sechs Prozent am stärksten.<br />
7
Im Kern gilt dieser Entwicklungszug<br />
allgemein, für fast alle Bundesländer. Die<br />
SPD reüssiert bei den Rentner, und sie<br />
stürzt nach 2009 weiter forciert bei den<br />
jungen Wählern, die noch in der Ausbildung<br />
stecken, ab. Im Westen zogen zuletzt<br />
die Grünen daraus ihren Nektar, im Osten<br />
bei denjenigen, die als jung, männlich, gering<br />
gebildet bezeichnet werden, durchaus<br />
die NPD. Und bekanntlich spielt im Wettbewerb<br />
um das junge Elektorat mit den Piraten<br />
nun noch ein weiter, derzeit besonders<br />
attraktiver Anbieter mit. Verändert hat<br />
sich seit 2009 die strukturelle Zusammensetzung<br />
der Wählerwanderungsflüsse. Am<br />
Ende der Großen Koalition verlor die SPD<br />
über drei Millionen Wähler von 2005 an<br />
die Linke und an das Lager der Nichtwähler.<br />
Diese Bewegung hat sich in den letzten<br />
beiden Jahren nicht fortgesetzt. Statt dessen<br />
hat es einen kräftigen Aderlass in<br />
Richtung Grüne gegeben. Kompensieren<br />
konnte dies die SPD durch bemerkenswerte<br />
Zuwächse aus dem altbürgerlichen Lager,<br />
also aus dem Spektrum von CDU und<br />
FDP. Natürlich hat sich dadurch die sozialdemokratische<br />
Wählerschaft im Jahr 20<strong>11</strong><br />
– gerade im Vergleich zu 1998 oder 2002 –<br />
signifikant verändert. Linke und ökologisch-postmaterialistische<br />
Einstellungen<br />
dürften hier deutlich geschwunden sein;<br />
konservative Stabilitäts- und Sicherheitserwartungen<br />
an Resonanz im SPD-Elektorat<br />
gewonnen haben.<br />
Viel Erfreuliches lässt sich auch nicht<br />
auf der Ebene der Mitgliedschaft entdekken.<br />
20<strong>11</strong> fiel die SPD nun auch noch unter<br />
die 500.000-Mitglieder-Marke. Seit<br />
2008 hat die CDU gar einen knappen Vorsprung<br />
bei den Parteizugehörigen. Das<br />
Durchschnittsalter der Sozialdemokraten<br />
liegt 20<strong>11</strong> bei 58 Jahren, diejenigen unter<br />
36 Jahren bilden nicht einmal 10 Prozent<br />
der SPD-Mitgliedschaft. Wie bei den<br />
Wählern so dominieren in der SPD auch<br />
bei den Mitgliedern nunmehr die Rentner<br />
und Pensionäre. Die stärkste Gruppe unter<br />
den aktiv erwerbstätigen Mitgliedern bilden<br />
die Beamten mit 23 %. Arbeiter kommen<br />
nur noch marginal, zumindest unterproportional<br />
vor in der Partei, die lange auf<br />
ihre proletarischen Wurzeln stolz war.<br />
Denkbar ernüchternd fiel bekanntlich<br />
eine Mitgliederbefragung des Willy-<br />
Brandt-Hauses im Frühjahr 2010 aus. Die<br />
Zahl der Ortsvereine war in den vorangegangenen<br />
Jahren erheblich zurückgegangen.<br />
In den verbliebenen lokalen Sektionen<br />
fanden offensive, nach außen gewandte<br />
Aktivitäten kaum noch statt. Die Drähte<br />
zur programmatisch gerne belobigten<br />
Zivilgesellschaft waren weithin gekappt;<br />
regelmäßige Kontakte zu Gewerkschaften<br />
und Umweltverbänden fanden in über<br />
90 % der Ortsvereine nicht mehr statt.<br />
Nun darf man natürlich nicht jede Veränderung<br />
gleich als Krise oder gar Menetekel<br />
brandmarken. Selbst die Mitgliederverluste<br />
und die Organisationserosion der<br />
SPD lassen sich aus einer anderen Perspektive<br />
auch milder bewerten. Derartige<br />
Rückgänge, die in anderen Partei ganz<br />
ähnlich zu beobachten sind, werden vielleicht<br />
zu pauschal für den unvermeidlichen<br />
Niedergang der Volksparteien und aller<br />
Großorganisationen schlechthin in postmodernen,<br />
individualisierten Gesellschaften<br />
gedeutet. Doch sind derartige Interpretationen<br />
zweifelsohne zu stark orientiert an<br />
den extrem hohen Mitgliederzahlen aus<br />
den Zeiten der Überpolitisierung der<br />
1970er und frühen 1980er Jahre. Seither<br />
tragen die Parteien im Grunde ab, was<br />
auch in historischer Perspektive ungewöhnlich<br />
stark akkumuliert worden war.<br />
Jedenfalls haben die Sozialdemokraten<br />
8 Regeneriert oder politisch ergraut? Die SPD im Herbst 20<strong>11</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
auch gegenwärtig noch in etwa so viele<br />
Mitglieder wie in den Ausgangsjahren des<br />
Kaiserreichs oder zu Beginn der 1950er<br />
Jahre - in Zeiten mithin, als die Klassengesellschaft<br />
noch stabil, die sozialmoralischen<br />
Milieus intakt, das kollektive Organisationsverhalten<br />
weit verbreitet war.<br />
Zumal: In der Größe von Organisation<br />
vermittelte sich nicht nur die Stärke, sondern<br />
historisch oft genug auch das Dilemma<br />
der Sozialdemokratie. Auf der einen<br />
Seite sicherte die Organisation zwar die<br />
sozialdemokratische Existenz in Kriegsund<br />
Krisenzeiten. Denn Organisationen<br />
verschwinden nicht so einfach, tragen Beharrungskräfte<br />
in sich, unterscheiden sich<br />
auf diese Weise von spontanen Bürgerbegehren<br />
oder Initiativen, die oft mit großem<br />
Schwung und weitgesteckten Zielen entstehen,<br />
nach Enttäuschungen und Misserfolgen<br />
dann aber ebenso rasch wieder zerfallen.<br />
Auf der anderen Seite aber scheuen<br />
große Organisationen das Risiko, sind vorwiegend<br />
am Selbsterhalt interessiert -<br />
nicht an schwer kalkulierbaren Veränderungen<br />
oder stürmischen Aktivitäten. So<br />
hat zwar die Organisation zu den fast 150<br />
langen sozialdemokratischen Jahren beigetragen,<br />
hat die elementaren Weltbilder und<br />
Zielsetzungen generationenübergreifend<br />
aufbewahrt und weitervermittelt, hat aber<br />
ebenfalls auch die politischen Erstarrungen<br />
und Unbeweglichkeiten der Partei in weichenstellenden<br />
historischen Momenten<br />
mitverursacht. Der Mitglieder- und Organisationsschwund<br />
der letzten Jahre stellt<br />
infolgedessen nicht unbedingt ein Menetekel<br />
für die Sozialdemokraten dar. Nicht<br />
wenige Sozialwissenschaftler und Historiker<br />
haben sogar darauf aufmerksam gemacht,<br />
dass an Mitgliedern kleine Organisationen<br />
oft effizienter und stringenter<br />
agieren als große. „In kleinen, zentripetal<br />
organisierten Gruppen“, so etwa der große<br />
Soziologe Georg Simmel, „werden im Allgemeinen<br />
alle Kräfte aufgeboten und genutzt,<br />
während in großen Gruppen Energien<br />
oft ungenutzt bleiben.“<br />
Bislang allerdings hat sich die SPD<br />
noch nicht mit dem Gedanken angefreundet,<br />
eine kleinere Partei zu werden. Stattdessen<br />
setzt sie in regelmäßigen Intervallen<br />
unverdrossen auf Mitgliederwerbung.<br />
Doch alle verzweifelten Bemühungen, wieder<br />
große Volkspartei zu werden, jede Anstrengung,<br />
Mitgliederscharen - koste es<br />
was es wolle - zu akquirieren, scheinen in<br />
Wirklichkeit wie ziellose Donquichotterien.<br />
Die Sozialdemokraten sollten sich<br />
vielleicht intensiver Gedanken darüber<br />
machen, wo ihr Ort in der postindustriellen<br />
Gesellschaft und im Vielparteiensystem<br />
des 21. Jahrhunderts noch liegen<br />
könnte - diesseits der final beendeten Ära<br />
von weit ausgreifenden Volks- und Mitgliederparteien.<br />
In einer solchen neuen<br />
Konstellation vielfacher Heterogenitäten<br />
und komplexer Allianzen kommt es mehr<br />
denn je auf intelligente und bewegliche<br />
Parteizugehörige an, vor allem: auf politische<br />
Kunst, taktische Beweglichkeit, strategische<br />
Raffinesse - bei einem harten<br />
Kern grundsätzlicher Überzeugungen.<br />
Überhaupt tun sich in der sozialdemokratischen<br />
Debatte zur Organisationsreform<br />
einige Widersprüche auf. Die sozialdemokratische<br />
Parteiführung will und<br />
exekutiert - natürlich - die moderne Wählerpartei,<br />
aber sie will auch die partizipationsgeprägte<br />
Mitmachpartei unterhalb der<br />
Berliner Zentralität. Doch beides geht<br />
schwer zusammen. In der modernen, im<br />
Prinzip medial getakteten Wählerpartei<br />
geht es hochzentralistisch zu; hier beherrschen<br />
die PR-Experten, die Consultants,<br />
Werbefachleute und Politikprofis das Feld,<br />
9
die in kleinen Stäben blitzschnell handeln<br />
müssen, immer den aktuellen demoskopischen<br />
Befund als orientierenden Maßstab<br />
im Auge behalten, die Events inszenieren<br />
und alle Politik personalisieren. Dem partizipationsfreudigen<br />
Mitmachprojekt aber<br />
geht es stärker um Inhalte, um langfristig<br />
angelegte Konzeptionen, an denen geduldig<br />
und argumentativ gearbeitet wird. Die<br />
Partizipationspartei, kurzum, ist also „an<br />
der Sache“ orientiert, dezentral verfasst<br />
und eigensinnig; die moderne Medienpartei<br />
dagegen bewegt sich vorwiegend in den<br />
zyklischen Trends je gegenwärtiger Aufgeregtheiten,<br />
wird zentral dirigiert und kann<br />
sich Widersprüchlichkeiten und Vielstimmigkeiten<br />
nicht leisten. Zumal in Wahlkampfzeiten<br />
- und wann gibt es sie einmal<br />
nicht in Deutschland - haben sich die<br />
Oberkommandierenden der SPD dann<br />
doch bis dato mehr für die leichter kalkulierbare<br />
Medienpartei als für das schwierigere<br />
Partizipationsprojekt entschieden.<br />
Aber wahrscheinlich ist es sowieso ganz<br />
trivial: Zwar wird in schöner Regelmäßigkeit<br />
der Charme der Basisdemokratie entdeckt,<br />
aber natürlich nie ganz freiwillig.<br />
Der Ruf nach mehr Beteiligung ist immer<br />
Ausfluss schlimmer Krisen, schwerer<br />
Wahlniederlagen, deftiger Mitgliederverluste,<br />
vor allem aber Reaktion auf den demoskopisch<br />
akkurat ermittelten Anstieg<br />
der Parteienverdrossenheit im Volke. Und<br />
seit 25 bis 30 Jahren werden die immer<br />
gleichen Rezepte feilgeboten. Partizipation,<br />
mehr innerparteiliche Debatten, Vorwahlen,<br />
offene Listen, größeren Raum für<br />
Quereinsteiger. Zumeist endet der Reformimpetus<br />
allerdings ziemlich rasch, sei es,<br />
weil die jeweils neuen SPD-Eliten letztlich<br />
wie i9hre Vorgänger an mehr Debatten<br />
und größerer Transparenz in Wirklichkeit<br />
ebenfalls kein elementares Interesse hatten,<br />
sei es, weil der Mittelbau und die Mitgliederbasis<br />
die neuen Möglichkeiten keineswegs<br />
so freudig nutzten, wie man erwartet<br />
hatte. Und überhaupt: Im föderalen<br />
Deutschland hält die innerparteiliche Depression<br />
und Selbstkritikdiskussion nach<br />
schlimmen Bundestagswahlniederlagen<br />
nie sonderlich lange an, denn meist steht<br />
schon nach wenigen Monaten ein „kleiner<br />
Machtwechsel“ in den Bundesländern vor<br />
der Tür. Für die SPD geschah dies 2010 in<br />
NRW, 20<strong>11</strong> in Hamburg und BaWü. Dort<br />
verflüchtigt sich dann das Interesse an parteiendogenen<br />
Veränderungen unmittelbar.<br />
Man hat schließlich staatliche Macht, man<br />
muss regieren; alles scheint schließlich bestens.<br />
Die Reform der Organisation stößt<br />
in diesen Bundesländern dann nicht mehr<br />
auf tatkräftige Anhänger, sondern auf pures<br />
Desinteresse.<br />
Überdies: Basisdemokratie birgt Tükken<br />
wie Chancen. Ur- und Vorwahlen<br />
etwa, meist Kernstück und Zauberformel<br />
sozialdemokratischen Reformvorschläge,<br />
sind gewiss nicht gerade der letzte Schrei<br />
innerparteilicher Reformkreationen. Aber<br />
sie mögen doch zu wirksamen Erfahrungen<br />
führen, wenn die Kandidaten der Sozialdemokratie<br />
künftig einen großen demokratischen<br />
Nominierungsprozess durchstehen<br />
müssen. Bei diesen Plebisziten müssen<br />
die Kandidaten früh Profil zeigen -<br />
und nicht erst, wie im Falle von Steinmeier<br />
2009, als plötzliche Spitzenkandidaten im<br />
Bundestagswahlkampf selbst.<br />
Indes, Wählerbindungen lassen sich dadurch<br />
nicht revitalisieren. Und auch das:<br />
Die offene Feldschlacht verschiedener<br />
Kandidaten kann Parteien polarisieren, gar<br />
lähmen. Im Übrigen bringen basisdemokratische<br />
Wahlen das wohlorganisierte System<br />
von Quoten und Proporz durcheinander<br />
- und darin besteht der wirkliche<br />
10 Regeneriert oder politisch ergraut? Die SPD im Herbst 20<strong>11</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
Widerspruch im Auftritt von Sigmar Gabriel.<br />
Er will auf der einen Seite Quotierungen<br />
durchsetzen und auf der anderen<br />
Seite die freie Wahl der Basis (plus Nichtmitglieder)<br />
erreichen. Doch beides passt<br />
nicht zusammen, da die Quotierung - man<br />
hat ausreichend Migranten zu berücksichtigen,<br />
natürlich viele Frauen; real existierende<br />
Arbeitnehmer sollen auch nicht unter<br />
den Mandatsträgern fehlen, junge<br />
Leute haben auf der Liste genügend Plätze<br />
zu bekommen, der ein oder andere Seiteneinsteiger<br />
wäre fürs Image sicher auch<br />
nicht schlecht - die Mitsprache massiv einschränkt,<br />
einschränken muss.<br />
Und gerade das Kraftpaket Sigmar Gabriel<br />
wird sich nicht gerne an die kurze<br />
Leine von Basispartizipatoren legen lassen.<br />
Schließlich will er führen, die Sozialdemokraten<br />
aus alten Stellungen treiben, neue<br />
Themen finden und Projekte schaffen. Er<br />
wird nicht einfach als Reflex der gegenwärtigen<br />
SPD-Mentalität mit all ihren riesigen<br />
Defiziten agieren mögen. Mit einigem<br />
Recht. Allein ein aufregendes Thema und<br />
substantielles Anliegen bewegt Bürger, sich<br />
zu aktivieren. Nicht Organisationsreformen<br />
als solche, nicht Schnuppermitgliedschaften,<br />
nicht Service-Cards oder dergleichen.<br />
Kurzum: Die SPD muss klären, was<br />
sie eigentlich will. Sämtliche Organisationsreformen,<br />
alle neuen Leute an der Spitze<br />
allein werden nicht das Geringste bewegen,<br />
wenn die Partei nicht zu der<br />
Erkenntnis darüber gelangt, wer sie ist, für<br />
wen sie Politik machen will, auf welchem<br />
Wege, zu welchem Ziel - und mit welchen<br />
Weggenossen. Und in dieser Frage ist die<br />
SPD seit 2009 nicht recht vorangekommen.<br />
Nun sollte man die mittlere Zukunft<br />
der Sozialdemokraten natürlich nicht ausschließlich<br />
düster sehen. Schließlich<br />
schleppt auch der Gegner, die andere große<br />
Volkspartei, eine Menge vergleichbarer<br />
und besonderer Probleme mit sich herum.<br />
Auch und gerade bei der Union sind die<br />
über lange Jahrzehnte stabilen und integrierenden<br />
Identitäten - Religion, Heimat,<br />
Brauchtum, Nation, lebenslange Familie,<br />
Antikommunismus - brüchig bzw. unzeitgemäß<br />
geworden. Auch die CDU hat noch<br />
keinen Sinnersatz für ihren Sinnverlust gefunden,<br />
kennt nicht das Programm und<br />
Projekt einer christdemokratischen Politik<br />
in nachchristlichen Gesellschaften. Auch<br />
der Union fehlt der Nachwuchs. Zusammen:<br />
Auch das christdemokratisch-liberale<br />
Lager wird in den nächsten Jahren einen<br />
vergleichbaren Verschleiß an traditionsgestützten<br />
Reserven erleben. Die SPD wird<br />
währenddessen nicht unbedingt ihre Baisse<br />
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts<br />
linienförmig fortsetzen. Renate<br />
Köcher hatte unlängst in einer ihrer monatlichen<br />
Analysen für die FAZ deutlich<br />
gemacht, dass das Anliegen der sozialen<br />
Gerechtigkeit, angemessen Löhne, solide<br />
Renten, Chancengleichheit, eine ordentliche<br />
Gesundheitsversorgung ohne Zwei-<br />
Klassen-Medizin ganz oben in der Erwartung<br />
der Bundesbürger stehen. Das mag<br />
der SPD wieder nutzen.<br />
Im Übrigen ist die SPD in gewisser<br />
Weise tatsächlich Partei der Mitte der bundesdeutschen<br />
Gesellschaft. Nun ist die<br />
Mitte ein durchaus prekärer, politisch keineswegs<br />
unproblematischer Ort. Aber<br />
machtpolitisch birgt er doch unzweifelhafte<br />
Vorzüge. Die Union hat bündnispolitisch<br />
nahezu allein die Freien Demokratenverfügt<br />
(oder eben mangels Masse der<br />
FDP auch nicht), was sie für die Mehrheitund<br />
Machtbildung derzeit auf Länderebene<br />
schon erheblich zurückwirft und ihre<br />
Perspektiven für 2013 verdüstert. Die Sozi-<br />
<strong>11</strong>
aldemokraten haben in dieser Hinsicht einige<br />
Pfeiler mehr im Köcher. Im Übrigen<br />
sind sie in der Tat eine kongeniale Repräsentanz<br />
des fortgeschrittenen mittleren<br />
Lebensdrittels, der 45- bis 60-Jährigen, der<br />
Eltern, Berufstätigen und Steuerzahler<br />
dieser Republik, der geburtenstarken Jahrgänge<br />
der bundesdeutschen Gesellschaft.<br />
Es ist schon bemerkenswert, wie sich das in<br />
höchst konfliktreichen Jahren erlernte<br />
Wahlverhalten dieser Generation für Rot-<br />
Grün biographisch erhalten hat. Nun ist<br />
diese geburtenstarke Kohorte ins Alter gekommen.<br />
Aber in einer massiv ergrauenden<br />
Gesellschaft wie die der Bundesrepublik<br />
wird die Partei der neuen Alten - und<br />
das könnte die SPD gut werden - im Parteienwettbewerb<br />
im Vorteil sein, was allerdings<br />
nicht jeder <strong>Jusos</strong> als rundum beglükkende<br />
Zukunftsaussicht empfinden dürfte.<br />
Und auf eine alternde Gesellschaft passen<br />
auch die sozialdemokratischen Dialektikslogans<br />
von gesellschaftlich-ökonomischen<br />
Fortschritt bei sozialer Sicherheit.<br />
Diese Kombination aus Veränderungszuspruch<br />
und Schutzversprechen missfiel<br />
zwar lange - seit 2008 allerdings mit zunehmend<br />
schwächer werdender Tendenz -<br />
den Meinungs- und Wirtschaftseliten der<br />
Republik, aber sie deckt sich stark mit einer<br />
bemerkenswert schichtübergreifenden Alltagsmentalität<br />
eines Gros der Deutschen<br />
auch im Jahr 20<strong>11</strong>. Die ergrauende deutsche<br />
Gesellschaft dürfte infolgedessen<br />
durchaus einige sozialdemokratische Züge<br />
tragen. Jedoch: Der Zauber des ursprünglichen<br />
sozialdemokratischen Emanzipationsimpetus<br />
wird dort nicht zurückkehren.<br />
l<br />
12<br />
Regeneriert oder politisch ergraut? Die SPD im Herbst 20<strong>11</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
SOZIALDEMOKRATISCHE<br />
ORIENTIERUNG IN DER<br />
WIRTSCHAFTSPOLITIK<br />
Von Jan Schwarz, stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender<br />
Früher war es eine oft wiederholte<br />
Phrase, dass die SPD für soziale Gerechtigkeit<br />
und die CDU für Wirtschaftskompetenz<br />
steht. Beides wurde<br />
und wird durch Umfragen, Wahlergebnisse<br />
und natürlich auch durch Regierungshandeln<br />
immer weiter in Zweifel<br />
gezogen. In der Regierungszeit von<br />
Rot-Grün und später in der Großen<br />
Koalition hat die SPD durch ihre Arbeitsmarkt-<br />
und Sozialreformen das<br />
Vertrauen breiter Wählergruppen verloren,<br />
weil ihr eben die Kompetenz<br />
abgesprochen wurde für soziale Gerechtigkeit<br />
zu sorgen. Die Hilflosigkeit<br />
und Orientierungslosigkeit der CDU<br />
unter Merkel in den Krisen haben eine<br />
ähnliche Auswirkung auf ihre Wählergruppen<br />
- Vertrauensverlust. Ergebnis<br />
dieser Entwicklung ist nicht zuletzt<br />
auch der allgemeine Verlust des Vertrauens<br />
in die Politik, Lösungen zu finden.<br />
Seit der katastrophalen Wahlniederlage<br />
bei der Bundestagswahl 2009<br />
bemüht sich die SPD ihre Kompetenz<br />
im Bereich des Sozialen zurückzuerobern,<br />
auch wenn es immer wieder<br />
kleine Schritte in die richtige Richtung<br />
gegeben hat, ist dies noch nicht gelungen.<br />
Es bleibt abzuwarten, welche<br />
Beschlüsse auf dem Parteitag 20<strong>11</strong> getroffen<br />
werden und wie die Parteispitze<br />
den Positionswandel in der Öffentlichkeit<br />
vertritt.<br />
Für eine erfolgreiche Bundestagswahl<br />
2013 wird aber auch die Rückeroberung<br />
der Deutungshoheit über die soziale Gerechtigkeit<br />
nicht genügen. Es ist absehbar,<br />
dass die Krisen an den Finanzmärkten und<br />
im Euroraum die politische Debatte der<br />
nächsten Jahre bestimmen wird. Und bei<br />
dem derzeitigen planlosen und unverantwortlichen<br />
Handeln der Bundesregierung<br />
ist es eher wahrscheinlicher, dass sich die<br />
Krisen auch wieder auf die Realwirtschaft<br />
ausweiten, als dass es besser wird. Folglich<br />
wird mitentscheidend sein, dass die SPD<br />
Lösungswege aus der Krise aufzeigt und<br />
ihr auch zugetraut wird, diese umzusetzen.<br />
13
In der Vergangenheit wurde Wirtschaftskompetenz<br />
der SPD nicht zugesprochen.<br />
In der Öffentlichkeit wurden lediglich<br />
einzelne Sozialdemokraten, wie<br />
Karl Schiller, Helmut Schmidt, Wolfgang<br />
Clement oder neuerdings auch Peer Steinbrück<br />
als Wirtschaftsfachleute dargestellt.<br />
Der Nachsatz hinter solchen Feststellungen<br />
war dann nicht selten, „aber er ist in der<br />
falschen Partei“. Nun würde ich gerade diesen<br />
Nachsatz nicht uneingeschränkt teilen<br />
und man muss auch bei den unterschiedlichen<br />
Personen sehr stark unterscheiden. So<br />
ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied,<br />
ob man aus der Partei austritt und<br />
offen Werbung für CDU und Atomlobby<br />
macht, oder innerhalb der Regierung und<br />
seiner Partei eine bestimmte Politik durchsetzt.<br />
Gemein ist ihnen aber, dass sie mit<br />
ihrer Wirtschaftspolitik immer wieder auf<br />
starken Widerspruch in der SPD gestoßen<br />
sind. Wenn es nun darum geht Vertrauen<br />
in die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik<br />
zu gewinnen muss erst einmal geklärt<br />
werden, was darunter verstanden wird,<br />
denn es wird leider immer wieder Wirtschaftskompetenz<br />
mit Wirtschaftsnähe<br />
verwechselt.<br />
Ein Satz von Gerhard Schröder beschreibt<br />
sehr gut das Verständnis von<br />
Wirtschaftspolitik unter neoliberaler Hegemonie:<br />
„Es gibt keine linke oder rechte,<br />
sondern nur gute oder schlechte Wirtschaftspolitik.“<br />
Da bleibt natürlich noch<br />
eine Frage offen, wer denn nach welchen<br />
Maßstäben eine Beurteilung abgibt. Und<br />
das waren vor allem die Wirtschaftsbosse<br />
selber, wenn sie zufrieden waren, handelte<br />
es sich um eine gute Wirtschaftspolitik<br />
und die beiden wichtigsten Kennzahlen<br />
waren und sind der Verlauf des DAX, egal<br />
wodurch Kurssteigerungen ausgelöst wurden<br />
und die Arbeitslosenzahl, egal welche<br />
neuen Jobs entstanden sind. Dies spiegelte<br />
sich auch immer wieder im Regierungshandeln<br />
der SPD wieder: Massive Steuersenkungen,<br />
gerade für Unternehmen, Deregulierung<br />
der Finanzmärkte,<br />
Privatisierung, Liberalisierung des Arbeitsmarktes<br />
und Sozialabbau sind nur einige<br />
Beispiele dafür. Damit wird deutlich, dass<br />
es sich nicht um eine Aufhebung der Möglichkeit<br />
handelte, in linke und rechte Wirtschaftspolitik<br />
zu unterscheiden, sondern<br />
dass es eine politische Entscheidung war,<br />
sich einzig und allein auf Angebotspolitik<br />
zu beschränken. Als einzige Begründung<br />
wurde nur immer wiederholt, dass es dazu<br />
keine Alternative gäbe. Die Politik der<br />
SPD hat sich damit dem neoliberalen<br />
Zeitgeist untergeordnet und die Phase der<br />
Entstaatlichung mitbestimmt. Dies war<br />
vor allem dem Glauben geschuldet, dass<br />
Politik keine Handlungsmöglichkeiten<br />
mehr habe. Mit der Politik die daraus resultierte<br />
wurde die Handlungsfähigkeit der<br />
Staaten dann auch tatsächlich immer weiter<br />
eingeschränkt und die Macht der<br />
Märkte gestärkt.<br />
Erst mit der Finanzkrise 2008 und der<br />
folgenden Wirtschaftskrise ist dieser Zeitgeist<br />
aufgebrochen. Auf einmal drohte das<br />
Chaos an den Finanzmärkten die komplette<br />
Weltwirtschaft in den Abgrund zu reißen<br />
und selbst den fundamentalsten<br />
Marktfetischisten blieb nichts anderes<br />
mehr übrig, als nach der Hilfe der Staaten<br />
zu rufen und plötzlich war die Verstaatlichung<br />
von Banken der Weg. Es wurde intensiv<br />
über die Regulierung der Finanzmärkte<br />
und das Ende des Neoliberalismus<br />
gesprochen. Doch viel ist davon nicht übrig<br />
geblieben, es ist bis <strong>heute</strong> bei Lippenbekenntnissen<br />
geblieben. Obwohl es für viele<br />
Forderungen mittlerweile breite Mehrheiten<br />
in der Gesellschaft gibt, kamen sie<br />
14<br />
Sozialdemokratische Orientierung in der Wirtschaftspolitik <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
nicht durch. Dies zeigt, dass die neoliberale<br />
Ideologie nicht überwunden ist, sondern<br />
lediglich ihr Erscheinungsbild geändert<br />
hat. Ihr Kern ist und bleibt die Zurückdrängung<br />
des Staates. Bis zur Krise war der<br />
Hebel dafür das Versprechen, dass der freie<br />
Markt zu besseren Ergebnissen führt, als<br />
wenn der Staat sich einmischt. Nun ist daraus<br />
ein anderes Argument geworden, die<br />
Staaten müssen sich einschränken, weil sie<br />
aufgrund ihrer Verschuldung keine andere<br />
Möglichkeit mehr hätten, als zu sparen und<br />
sich dem Diktat der Rating-Agenturen zu<br />
unterwerfen. Damit wird die Rettung der<br />
Banken und dem Vermögen ihrer Eigentümer<br />
zum wichtigsten Argument, die bestehenden<br />
Verhältnisse zu erhalten.<br />
Es ist nun die Aufgabe der SPD, deutlich<br />
zu machen, dass es doch eine Alternative<br />
gibt. Wirtschaftspolitik darf sich eben<br />
nicht darauf beschränken, nur einen Rahmen<br />
zu setzen und den Weg für private<br />
Profite freizuräumen. Denn auch in der<br />
Wirtschaftspolitik ist die entscheidende<br />
Frage, für wen und für welche Interessen<br />
man etwas erreichen will.<br />
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität<br />
sind die Ziele, die wir mit unserer Wirtschaftspolitik<br />
verwirklichen wollen. Wir<br />
wollen eine Gesellschaft, in der alle am<br />
Wohlstand und dessen Produktion gerecht<br />
und selbstbestimmt beteiligt sind. Die<br />
Herausforderungen unserer Zeit kann<br />
nicht mit Stückwerk begegnet werden. Finanz-,<br />
Wirtschafts- und Eurokrise, zunehmende<br />
Verteilungsungerechtigkeit innerhalb<br />
einzelner Länder, aber auch global,<br />
Prekarisierung der Arbeitswelt und der<br />
Klimawandel können nur bewältigt werden,<br />
wenn bei den Lösungsansätzen alle<br />
Ebenen, von der Kommune bis hin zu den<br />
internationalen Institutionen, einbezogen<br />
werden. Wenn wir wirklich etwas bewegen<br />
wollen, hilft uns das Ausmalen einer<br />
Wunschgesellschaft nicht weiter. Wir setzen<br />
auf kollektive Lösungen und ein solidarisches<br />
Miteinander bei der Bewältigung<br />
der Probleme, Individuen können alleine<br />
die Gesellschaft nicht verändern, uns geht<br />
es gerade um die gemeinsame Lösung der<br />
Probleme, um damit die Voraussetzung für<br />
eine solidarischere Gesellschaft zu schaffen.<br />
Die Bedingungen dafür sind ein Bekenntnis<br />
zur Zentralität der Erwerbsarbeit,<br />
dem Primat der Politik und der staatlichen<br />
Handlungsfähigkeit, sowie der Wille, alle<br />
Lebensbereiche und damit auch die Wirtschaft<br />
zu demokratisieren und umzuverteilen.<br />
Im Antragspaket zum diesjährigen Parteitag<br />
finden sich Ansätze, die in diese<br />
Richtung gehen. Aber alles steht und fällt<br />
mit der Entscheidung darüber, wie ernsthaft<br />
das Bekenntnis zur Handlungsfähigkeit<br />
des Staates verfolgt wird. Der Wille,<br />
die Finanzlage der Kommunen zu verbessern,<br />
Bildungschancen zu eröffnen, in Infrastruktur<br />
zu investieren, Nachhaltigkeit<br />
zu fördern und die Energiewende zu gestalten,<br />
alleine reicht nicht aus, wenn alle<br />
Vorhaben auf Grund der fehlenden Finanzen<br />
verschoben oder zur Symbolpolitik<br />
verkommen.<br />
Die Probleme, vor denen wir <strong>heute</strong> stehen,<br />
sind leider auch das Ergebnis von der<br />
Politik sozialdemokratischer Regierungen,<br />
nicht nur in Deutschland. Mit den Rezepten<br />
der vergangenen Jahre werden die Krisen<br />
nicht gelöst, sondern nur verschlimmert.<br />
Ziel einer sozialdemokratischen<br />
Wirtschaftspolitik muss es sein, die Kräfteverhältnisse<br />
wieder so zu verschieben, dass<br />
das Primat der Politik greift und zum Vorteil<br />
der großen Mehrheit der Menschen<br />
eingesetzt wird. Mit den Beschlüssen auf<br />
dem Parteitag hat die SPD große Schritte<br />
15
in diese Richtung gemacht. Noch vor einem<br />
Jahr wäre nicht daran zu denken, dass<br />
relevante Steuererhöhungen zur Finanzierung<br />
der Bildung und Kommunen beschlossen<br />
sowie die Riesterrente infrage<br />
gestellt wird. Um als SPD Wirtschaftskompetenz<br />
glaubhaft zu besetzen, muss sie<br />
dies auch mit dem richtigen Personal verbinden.<br />
Endscheidend ist eben nicht, wer<br />
das Lob der Spitzen aus den Wirtschaftsverbänden<br />
bekommt, sondern wer bereit<br />
ist, dieser einseitigen Interessenpolitik entgegenzutreten<br />
und wirklich etwas zu verändern.<br />
l<br />
16<br />
Sozialdemokratische Orientierung in der Wirtschaftspolitik <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
DAS COMPAGNIE-<br />
GESCHÄFT MARX UND<br />
ENGELS<br />
Von Klaus Körner, Publizist in Hamburg<br />
Schwerpunkt<br />
Im August 1844 hatten sich der 26-jährige<br />
Karl <strong>Marx</strong> und der zwei Jahre jüngere<br />
Friedrich Engels in einem Pariser<br />
Café verabredet, um über gemeinsame<br />
journalistische Projekte zu sprechen.<br />
In Paris traf sich in jener Zeit die<br />
europäische intellektuelle Szene, die<br />
in der Revolution von 1848/49 eine<br />
Rolle spielte. Engels hat über das Treffen<br />
später im Kommuniqué-Stil berichtet:<br />
„Dabei stellte sich unsere vollständige<br />
Übereinstimmung auf allen<br />
theoretischen Gebieten heraus, und<br />
von da an datiert unsere gemeinsame<br />
Arbeit.“ Daraus entstand eine<br />
über fast 40-jährige Zusammenarbeit,<br />
wie es sie in der deutschen Geistesgeschichte<br />
kein zweites Mal gibt. Soweit<br />
daraus allerdings gefolgert wurde, zwischen<br />
beiden hätte ein vollständiger<br />
Gleichklang bestanden, ist das so<br />
nicht zutreffend.<br />
<strong>Marx</strong>, Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts<br />
aus Trier, hatte schlechteste Erfahrungen<br />
mit dem preußischen Staat gemacht. Für<br />
viele Rheinländer, die die Zeit der napoleonischen<br />
Herrschaft als Aufbruch in eine<br />
modernere Welt, Gleichberechtigung der<br />
Juden, einem modernen Zivilrecht und<br />
Geschworenengerichten empfunden hatten,<br />
war der Anschluss an Preußen ein<br />
Rückschritt.<br />
<strong>Marx</strong> hatte in Bonn und Berlin Rechtswissenschaft<br />
und Philosophie studiert und<br />
war in diesem Fach 1841 promoviert worden.<br />
Doch sein erstes Vorhaben, sich zu habilitieren<br />
war daran gescheitert, dass die<br />
Regierung seinem Förderer Bruno Bauer<br />
1842 die Lehrbefugnis entzogen hatte. Als<br />
Chefredakteur der liberalen Tageszeitung<br />
„Rheinische Zeitung“ musste er 1843 erneut<br />
die Segel streichen, weil die Regierung<br />
das Blatt verboten hatte. „In Deutschland<br />
kann ich nichts mehr anfangen“, hatte<br />
er seinem Berliner Freund Arnold Ruge<br />
geschrieben.<br />
In Paris gab er gemeinsam mit Ruge<br />
1844 die Zeitschrift „Deutsch-Französi-<br />
17
sche Jahrbücher“ heraus. In seinen Beiträgen<br />
arbeitete <strong>Marx</strong> sich noch an den Themen<br />
ab, die ihn Berlin beschäftigt hatten,<br />
Religionskritik und Auseinandersetzung<br />
mit Hegel. Als sogenannter Linksheglianer<br />
fasste <strong>Marx</strong> seine Religionskritik in dem<br />
berühmten Satz zusammen: „Religion ist<br />
das Opium des Volkes.“ Und seine „Kritik<br />
der Hegelschen Rechtsphilosophie“ endete<br />
mit der Feststellung, nur eine Revolution<br />
könne Deutschland auf die Höhe der Zeit<br />
bringen.<br />
Schon von seiner Herkunft war Engels<br />
sehr viel positiver auf den preußischen<br />
Staat eingestimmt. Er stammte aus einer<br />
wohlhabenden protestantischen Unternehmerfamilie.<br />
Sein Vater besaß eine Bauwollspinnerei<br />
in Barmen mit einer Zweigstelle<br />
in Manchester. Ein Jahr vor dem Abitur<br />
hatte Vater Engels seinen Sohn aus der<br />
Schule genommen. Nach einer kaufmännischen<br />
Lehre in Bremen schickte er ihn<br />
nach Manchester. Zwischen diesen Stationen<br />
lag der einjährige Militärdienst in Berlin.<br />
Schon als Kaufmannsgehilfe in Bremen<br />
hatte Engels sich, durch Bücherstudium<br />
zum Atheisten gewandelt, als kritischer<br />
Feierabendjournalist bestätigt. Während<br />
des Militärdienstes in Berlin hatte er Kontakt<br />
zu den Linksheglianern bekommen<br />
und schrieb für <strong>Marx</strong>’ Jahrbücher den Beitrag<br />
„Umrisse der Kritik der Nationalökonomie“.<br />
Ökonomie war für <strong>Marx</strong> das neue<br />
große Thema. Aus seiner Pariser Zeit<br />
stammen die später entdeckten „Ökonomisch-philosophischen<br />
Manuskripte“. Einer<br />
der Zentralbegriffe ist die Entfremdung<br />
des Arbeiters durch die<br />
Arbeitsteilung in der Industrie.<br />
Wie die angestrebte Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>Marx</strong> und Engels aussehen sollte,<br />
blieb etwas im Unklaren, denn Engels war<br />
noch bei der väterlichen Firma in der<br />
Pflicht und die „Deutsch-Französischen<br />
Jahrbücher“ wurden nach einem Doppelheft<br />
eingestellt. Es war den beiden Herausgebern<br />
nicht gelungen, neben Heinrich<br />
Heine französische Autoren für die Mitarbeit<br />
zu gewinnen. In Frankreich war die erste<br />
Ausgabe unverkäuflich und die für<br />
Deutschland bestimmten Exemplare wurden<br />
an der Grenze beschlagnahmt. Gegen<br />
<strong>Marx</strong> erging in Preußen ein Haftbefehl<br />
wegen Aufrufs zum Hochverrat. Einen gewissen<br />
Ersatz bot die Mitarbeit an der Pariser<br />
Emigrantenzeitung „Vorwärts“, für<br />
die auch Engels aus Barmen schrieb. Doch<br />
der preußischen Regierung war auch das<br />
ein Dorn im Auge. Auf ihren Antrag verbot<br />
die französische Regierung 1845 die<br />
Zeitung und wies die Mitarbeiter aus.<br />
Familie <strong>Marx</strong> - Karl <strong>Marx</strong> hatte seine<br />
langjährige Verlobte aus Trier Jenny von<br />
Westphalen vor der Ausreise nach Paris geheiratet<br />
- floh nach Brüssel, der damals liberalsten<br />
Stadt in Europa. Die folgenden<br />
drei Jahre waren ihre glücklichste Zeit. Sie<br />
hatten noch Geld aus der Mitgift von Jenny<br />
und einen Verlagsvorschuss für ein geplantes<br />
wissenschaftliches Ökonomie-<br />
Buch. Sie meinten, in einer großen Zeit<br />
unmittelbar vor einer Revolution zu leben.<br />
In Brüssel erwartete Jenny ihr zweites Kind<br />
und ihre Mutter hatte ihr die Haushaltsgehilfin<br />
Helene Demuth nach Brüssel geschickt.<br />
Engels gelang es, seinen Vater davon<br />
zu überzeugen, dass er vor seiner<br />
kaufmännischen Arbeit noch eine Sozialgeschichte<br />
Englands schreiben müsse,<br />
nachdem sein Buch „Die Lage der arbeitenden<br />
Klasse in England“, in dem er seine<br />
Manchester-Erfahrungen zu Papier gebracht<br />
hatte, auch bei der preußischen Regierung<br />
gut aufgenommen worden war. Er<br />
konnte daher <strong>Marx</strong> nach Brüssel folgen.<br />
18<br />
Das Compagnie-Geschäft <strong>Marx</strong> und Engels <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
Beide engagierten sich in linken Arbeiterund<br />
Handwerkervereinen - und schoben<br />
ihre Buchprojekte bald beiseite. Wichtiger<br />
schien ihnen noch eine Abrechnung mit<br />
den deutschen Philosophen der Gegenwart<br />
zu sein, „Die deutsche Ideologie“. Heraus<br />
kam ein umfangreiches Manuskript, das<br />
kein Verleger drucken wollte. In der „Deutschen<br />
Ideologie“ findet sich im Kapitel<br />
über den Materialisten Feuerbach die umfassendste<br />
Darstellung der <strong>Marx</strong>’schen Geschichtsphilosophie<br />
und Ideologiekritik,<br />
die er je geschrieben hat: Treibende Kraft<br />
der Geschichte ist nicht die Kritik, sondern<br />
die Revolution. Die Gedanken der herrschenden<br />
Klasse einer Epoche sind die<br />
herrschenden Gedanken. Die Existenz revolutionärer<br />
Gedanken setzt die Existenz<br />
einer revolutionären Klasse voraus.<br />
Engels veröffentlichte später aus <strong>Marx</strong>’<br />
Nachlass die Thesen über Feuerbach, die<br />
mit der berühmten <strong>11</strong>. These enden: „Die<br />
Philosophen haben die Welt nur verschieden<br />
interpretiert, es kommt aber darauf an,<br />
sie zu verändern.“<br />
Um die Welt zu verändern engagierten<br />
sich <strong>Marx</strong> und Engels im Bund der Gerechten,<br />
einem linken Handwerkerbund,<br />
zu dessen Zentrale in London sie schon<br />
vorher Kontakt hatten. Sie setzten die Umbenennung<br />
in Bund der Kommunisten<br />
durch. Als die Zentrale in London <strong>Marx</strong><br />
dazu aufforderte, aus den vorliegenden<br />
Entwürfen ein Programm zu verfassen, erklärte<br />
er sich sofort bereit. Binnen weniger<br />
Tage schrieb der das „Kommunistische<br />
Manifest“ nieder. Als das Manifest Ende<br />
Februar oder Anfang März 1848 in London<br />
gedruckt wurde, war in Paris und<br />
Wien bereits die Revolution ausgebrochen<br />
und nur wenige Exemplare erreichten den<br />
Kontinent. Dennoch wurde es später zum<br />
wichtigsten politischen Pamphlet der Arbeiterbewegung.<br />
Es zeigt die Sprachgewalt<br />
des Verfassers Karl <strong>Marx</strong>. Der Text beginnt<br />
mit der Eröffnungspassage „Ein Gespenst<br />
geht um in Europa ...“ und endet mit dem<br />
Aufruf zur Revolution: „Die Proletarier<br />
haben nichts zu verlieren als ihre Ketten.<br />
Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier<br />
aller Länder vereinigt euch!“<br />
Anfang März 1848 wurde <strong>Marx</strong> aus<br />
Brüssel ausgewiesen und reiste über Paris<br />
nach Köln. Unverzüglich machte er sich<br />
daran, Geldgeber für die Gründung einer<br />
Zeitung („Neue Rheinische Zeitung“) zu<br />
gewinnen. Die neue Zeitung sollte keine<br />
kommunistischen Ziele propagieren, sondern<br />
für den Erfolg der bürgerlichen Revolution<br />
in Deutschland kämpfen. Die Auflage<br />
der Zeitung mit <strong>Marx</strong> als<br />
Chefredakteur und Engels als seinem<br />
Stellvertreter erreichte schnell ein Mehrfaches<br />
der alten „Rheinischen Zeitung“.<br />
Hauptthemen waren die Halbheiten der<br />
Frankfurter Nationalversammlung. Die<br />
Vertreter sc<strong>heute</strong>n vor dem Griff nach der<br />
politischen Macht zurück. Zuerst wurde in<br />
Wien die Revolution niederschlagen, dann<br />
gewann auch in Preußen die Reaktion<br />
die Oberhand. <strong>Marx</strong> wurde am 16. Mai<br />
1848 aus Preußen ausgewiesen. Engels<br />
hatte sich noch als Soldat in der badischen<br />
Aufstandsarmee engagiert, doch die wurde<br />
vom preußischen Heer vernichtend geschlagen.<br />
Als einziger Zufluchtsort stand den europäischen<br />
Emigranten London offen.<br />
Hier trafen sich <strong>Marx</strong> und Engels wieder.<br />
Wie viele andere sahen sie zunächst den<br />
Aufenthalt in London nur als kurze Zwischenstation<br />
an, bis die Revolution auf dem<br />
Kontinent weitergehe. Doch dann erkannten<br />
sie, dass die Revolution zu Ende war.<br />
Eine neue Revolution könne es nur geben,<br />
wenn die ökonomischen Verhältnisse dafür<br />
19
eif seien, eine große Krise ausbreche. Engels<br />
wurde von seinem Vater als dessen Repräsentant<br />
nach Manchester in die Firma<br />
Ermen und Engels geschickt. Von dort<br />
wollte er <strong>Marx</strong> in London unterstützen.<br />
„Wir zwei betreiben ein Compagniegeschäft“<br />
beschrieb <strong>Marx</strong> später die Zusammenarbeit<br />
mit Engels. <strong>Marx</strong> Hauptarbeitsplatz<br />
war in den nächsten 15 Jahren der<br />
Lesesaal des British Museum. Hier fand<br />
nicht nur ökonomische Theorieliteratur,<br />
sondern auch wirtschafts- und sozialgeschichtliche<br />
Abhandlungen und die Blaubücher<br />
der Fabrikinspektoren, in denen sie<br />
über die Zustände in britischen Fabriken<br />
berichteten. Der Lesesaal war für ihn nicht<br />
nur Forschungsstätte, sondern zugleich<br />
Fluchtort vor der Misere daheim. Die Familie<br />
lebte in einer schäbigen Zweizimmerwohnung<br />
im Stadtteil Soho und litt<br />
unter ständiger Geldnot. Jenny <strong>Marx</strong> hatte<br />
sich von der Heirat einen gehobenen bürgerlichen<br />
Lebenszuschnitt erwartet, wie sie<br />
ihn von Trier her kannte. Jetzt musste sie<br />
bei den Kaufleuten „anschreiben“ lassen<br />
und warten, bis von Engels neues Geld<br />
kam, meist per Post in Form von halben<br />
Banknoten. Manchmal landet alles Verwertbare,<br />
sogar Kleidungsstücke, im<br />
Pfandhaus, so dass <strong>Marx</strong> das Haus nicht<br />
verlassen konnte. Zu einer schweren Ehekrise<br />
kam es als die Hausgehilfin Helene<br />
Demuth von <strong>Marx</strong> schwanger wurde. Als<br />
Helfer in der Not sprang wieder Engels<br />
ein, der bereit war, als Vater des Sohnes zu<br />
gelten, der nach der Geburt zu Pflegeeltern<br />
gegeben wurde.<br />
Eine Möglichkeit für <strong>Marx</strong>, Geld zu<br />
verdienen, bot das Angebot des Chefredakteurs<br />
der damals größten Zeitung der<br />
Welt „New York Daily Tribune“, freier<br />
Mitarbeiter für Europa zu werden. Unter<br />
<strong>Marx</strong>’ Namen sind in den 1850er Jahren<br />
Hunderte von Artikeln erschienen. Anfangs<br />
mussten die Texte wegen <strong>Marx</strong>’<br />
schlechter Englischkenntnisse erst zum<br />
Übersetzen nach Manchester geschickt<br />
werden, bis sie dann von <strong>Marx</strong>’ Ehefrau<br />
Jenny abgeschrieben und versandt werden<br />
konnten. Einen Teil der Aufträge gab<br />
<strong>Marx</strong> einfach an Engels weiter.<br />
Im Gegensatz zu <strong>Marx</strong> in London war<br />
Engels in Manchester voll in die britische<br />
Gesellschaft integriert. Er war als Geschäftsmann<br />
erfolgreich und teilte die Vorlieben<br />
des Bürgertums für Reiten, Fuchsjagden<br />
und den Besuch von Klubs. Nach<br />
Feierabend schrieb er Artikel für <strong>Marx</strong>.<br />
Außerdem wechselte er während seines<br />
fast 20-jährigen Manchesteraufenthalts<br />
mehrfach wöchentlich Briefe mit <strong>Marx</strong>.<br />
Darin ging es um alle möglichen Themen,<br />
von Familienproblemen über Fabrikationsabläufe<br />
und theoretische Fragen bis zu den<br />
ständigen Geldbitten von <strong>Marx</strong>. Wie ein<br />
roter Faden zieht sich die Ermahnung von<br />
Engels, <strong>Marx</strong> möge doch endlich mit „dem<br />
Buch“ also der Analyse des Kapitalismus<br />
fertig werden. Hoffnungsvoll hatte <strong>Marx</strong><br />
am 2. April 1851 geschrieben: „Ich bin soweit,<br />
dass ich in fünf Wochen mit der ganzen<br />
ökonomischen Scheiße fertig bin.“<br />
Tatsächlich dauerte es noch 16 Jahre bis<br />
der erste Band des „Kapital“ 1867 erschien.<br />
Dass <strong>Marx</strong> mit seinem Werk nicht vorankam,<br />
hing mit drei Faktoren zusammen.<br />
„Das Wahre ist das Ganze“ hatte Hegel gelehrt.<br />
Und <strong>Marx</strong> wollte ein Werk aus einem<br />
Guss abliefern. Er konnte sich nicht an die<br />
Ausarbeitung setzen, bevor er nicht alles<br />
relevante Material ausgewertet hatte. Er<br />
glaubte, in der Endzeit des Kapitalismus zu<br />
leben und wollte mit seinem Buch die Revolution<br />
beschleunigen. Als sich 1857 zuerst<br />
in den USA und dann auch in England<br />
20<br />
Das Compagnie-Geschäft <strong>Marx</strong> und Engels <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
der Beginn einer großen Krise abzeichnete,<br />
befürchtete <strong>Marx</strong>, mit seinem Buch zu spät<br />
zu kommen. In Tag-und-Nacht-Arbeit<br />
brachte er seine bisherigen Erkenntnisse zu<br />
Papier. Am 2. April 1867 war es endlich<br />
soweit, dass er seinem Freund Engels, die<br />
Botschaft übermitteln konnte, das 25 Bogen<br />
umfassende Manuskript des ersten<br />
Bandes sei fertig. Er werde es nächste Woche<br />
zum Verleger Otto Meißner nach<br />
Hamburg bringen, es fehle nur noch das<br />
Geld für die Überfahrt. Am 2. September<br />
1867 erschien „Das Kapital. Kritik der politischen<br />
Ökonomie. Erster Band“ in einer<br />
Auflage von 1000 Exemplaren. <strong>Marx</strong> untersucht<br />
im „Kapital“, wie sich seit dem<br />
Mittelalter die Produktivkräfte („Basis“)<br />
entwickelten und sich zugleich Wirtschaftsverfassung,<br />
Staat, Recht und Ideologien<br />
veränderten („Überbau“). Er beschreibt<br />
den großen Widerspruch<br />
zwischen der Ausbeutung und Verelendung<br />
der Arbeiter auf der einen Seite und<br />
der Kapitalakkumulation auf der anderen<br />
Seite, dem gesellschaftlichen Charakter der<br />
Produktion und dem privaten Charakter<br />
der Aneignung. Im berühmten apokalyptischen<br />
24. Kapitel prognostiziert er den revolutionären<br />
Umschlag hin zu einer klassenlosen<br />
Gesellschaft. Man kann das Buch<br />
als historisches, philosophisches oder ökonomisches<br />
Werk deuten, wie es wohl <strong>Marx</strong><br />
getan hätte. Doch die Welt der Wissenschaft<br />
nahm das Buch kaum zur Kenntnis.<br />
In den ersten zwei Jahren wurden gerade<br />
200 Exemplare verkauft. Jenny <strong>Marx</strong> klagte,<br />
wenn die Arbeiter eine Ahnung davon<br />
hätten, wie viel Aufopferung dieses Buch<br />
gekostet hätte, würden sie ihm mehr Beachtung<br />
schenken. Doch auch viele Arbeiterführer<br />
kamen mit der Lektüre nicht<br />
weit. Für sie reichte es zu wissen, dass es ein<br />
wissenschaftliches Buch gab, das den unausweichlichen<br />
Sieg der Arbeiterklasse<br />
nachwies.<br />
Trotz dieser Enttäuschung war <strong>Marx</strong><br />
Ende der 1860er Jahre auf dem Höhepunkt<br />
seines öffentlichen Einflusses. 1864<br />
hatten sich die europäischen Arbeiterorganisationen<br />
zur Internationalen Arbeiterassoziation<br />
zusammengeschlossen (1. Internationale).<br />
<strong>Marx</strong> gehörte ihr nur als<br />
korrespondierendes Mitglied „für<br />
Deutschland“, einen Staat, den es noch gar<br />
nicht gab, an. Er durfte aber das Programm<br />
entwerfen und er verstand es auch mit viel<br />
taktischem Geschick, die Verhandlungen<br />
zwischen den verschiedenen, meist nicht<br />
„marxistisch“ orientierten Fraktionen zu<br />
lenken. 1872 zerbrach die Internationale,<br />
als die Anarchisten eine feindliche Übernahme<br />
versuchten. <strong>Marx</strong> war jetzt Privatmann.<br />
Er hatte keine finanziellen Sorgen<br />
mehr, denn Engels hatte sich 1869 in<br />
Manchester auszahlen lassen und eine<br />
Rente für <strong>Marx</strong> ausgesetzt. Ab 1870 konnten<br />
sich die Freunde fast täglich sehen,<br />
nachdem Engels sich in London eine<br />
Wohnung genommen hatte. Dennoch<br />
zeichnete sich bei <strong>Marx</strong> ein Kreativitätsbruch<br />
ab. Er las und exzerpierte weiterhin<br />
Bücher, schrieb ab nichts Neues, sondern<br />
beschränkte sich auf die Bearbeitung oder<br />
Neuherausgabe alter Texte. Ein britischer<br />
Zeitgenosse beschrieb ihn als einen kultivierten<br />
Gentleman, den man gut für einen<br />
Professor für vergleichende Grammatik<br />
oder Altslawisch halten könne. Die Aufgabe,<br />
<strong>Marx</strong> Ideen zu interpretieren und die<br />
Führer der Sozialdemokratie zu beraten,<br />
ging immer stärker auf Friedrich Engels<br />
über. Als seine geliebte Ehefrau Jenny 1881<br />
starb, verließ auch <strong>Marx</strong> der Lebensmut, er<br />
starb am 14. März 1883. Engels fand sich<br />
nach dem Tode seines Freundes bereit, aus<br />
den Manuskripten die „Kapital“-Bände 2<br />
21
und 3 herauszugeben. Mit seiner Kurzfassung<br />
der <strong>Marx</strong>’schen Ideen in „Die Entwicklung<br />
des Sozialismus von der Utopie<br />
zur Wissenschaft“ schuf Engels eine populäre<br />
Schrift, die der Arbeiterbewegung<br />
Selbstbewusstsein und Siegeszuversicht<br />
vermittelte. Der Beginn der Massenwirksamkeit<br />
von <strong>Marx</strong> lässt sich auf die Begräbnisrede<br />
am 17. März 1883 datieren, in<br />
der Engels verkündete: „Sein Name wird<br />
durch die Jahrhunderte fortleben und so<br />
auch sein Werk!“ l<br />
Werner Blumenberg: Karl <strong>Marx</strong>, rm 76, Reinbek b.<br />
Hamburg 1972<br />
Vincent Barnett: <strong>Marx</strong>, London u. New York 2009<br />
Mary Gabriel: Love and Capital. Karl and Jenny<br />
<strong>Marx</strong> and the Birth of a Revolution, New York<br />
u. London 20<strong>11</strong><br />
Klaus Körner: „Wir zwei betreiben ein Compagniegeschäft“.<br />
Karl <strong>Marx</strong> u. Friedrich Engels, Hamburg<br />
2009<br />
Karl <strong>Marx</strong> Lesebuch, hrsg. v. Klaus Körner, Mmünchen<br />
2008<br />
Karl <strong>Marx</strong>. Friedrich Engels. Studienausgabe in 5<br />
Bänden, hrsg. v. Iring Fetscher, Berlin 2004<br />
Gustav Mayer: Friedrich Engels. Eine Biographie, 2<br />
Bde. Ullstein Buch 3<strong>11</strong>3/4. Frankfurt a. M. u.<br />
Berlin 1975<br />
David McLellan: Karl <strong>Marx</strong>. Leben und Werk,<br />
München 1974<br />
Francis Wheen: Karl <strong>Marx</strong>, München 1999<br />
22<br />
Das Compagnie-Geschäft <strong>Marx</strong> und Engels <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
MARX UND DIE SOZIAL-<br />
DEMOKRATIE – DIE SPD<br />
UND MARX<br />
Von Thilo Scholle und Jan Schwarz, Mitglieder der Redaktion<br />
„Der Demokratische Sozialismus in<br />
Europa hat seine geistigen Wurzeln im<br />
Christentum und in der humanistischen<br />
Philosophie, in der Aufklärung,<br />
in <strong>Marx</strong>scher Geschichts- und Gesellschaftslehre<br />
und in den Erfahrungen<br />
der Arbeiterbewegung.“ 1<br />
„Wir sind durch die Türe getreten, die<br />
auch der Denker <strong>Marx</strong> geöffnet hat.<br />
Für uns bleibt die Freiheit, was sie<br />
auch für ihn war: der kritische Maßstab,<br />
an dem sich jede Ordnung zu<br />
rechtfertigen hat.“ 2<br />
Die Geschichte der Sozialdemokratie ist<br />
ohne die Auseinandersetzungen um die Interpretation<br />
der Ideen von Karl <strong>Marx</strong> und<br />
Friedrich Engels nicht zu verstehen, aber<br />
auch die marxschen Theorien hätte ohne<br />
1 Berliner Programm der SPD, in: Dowe/ Klotzbach,<br />
S. 346 (354).<br />
2 Willy Brandt, Rede anlässlich des 30. Jahrestags<br />
der Eröffnung des Karl-<strong>Marx</strong>-Hauses in Trier,<br />
4. Mai 1977, in: ders., Berliner Ausgabe Band 5,<br />
Die Partei der Freiheit, S. 257 (265).<br />
3 Siehe z.B. die „Herforder Thesen“ von 1980.<br />
4 Siehe Hamburger Programm.<br />
das Aufgreifen in der SPD nie ihre Bedeutung<br />
erlangt. Karl <strong>Marx</strong> war von den Anfängen<br />
der deutschen Sozialdemokratie bis<br />
zu seinem Tode ihr kritischer Begleiter und<br />
Kommentator. Er und Engels standen zu<br />
vielen Parteiführern in regem Briefkontakt<br />
und ließen kaum einen Vorgang unkommentiert.<br />
Gerade in den Briefen von <strong>Marx</strong><br />
und Engels untereinander wird deutlich,<br />
dass sie zumeist unzufrieden mit der Entwicklung<br />
der deutschen Arbeiterpartei waren<br />
und auch von vielen Parteifunktionären<br />
nicht allzu viel hielten.<br />
Bis in die Zeit der Bundesrepublik war<br />
fast jede innerparteiliche Debatte davon<br />
geprägt, wie die marxschen Schriften ausgelegt<br />
werden müssten und inwieweit ihnen<br />
gefolgt werden sollte - von den Auseinandersetzung<br />
der „Lassallianer“ des<br />
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins<br />
mit den „Eisenachern“ der Sozialdemokratischen<br />
Arbeiterpartei (August Bebel und<br />
Wilhelm Liebknecht), der Massenstreikdebatte,<br />
dem „Revisionismusstreit“ an der<br />
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, den<br />
Diskussionen über die (Koalitions-) Politik<br />
der SPD in der Weimarer Republik bis hin<br />
zum Godesberger Programm von 1959.<br />
23
Diese Auseinandersetzungen führten immer<br />
wieder zu Spaltungen der Partei. Aber<br />
auch noch nach dem Wandel von der marxistischen<br />
Klassenpartei zur linken Volkspartei<br />
in den 1950er und 1960er Jahren<br />
blieben viele Ergebnisse der früheren Auseinandersetzungen<br />
wichtig für das Selbstverständnis<br />
der SPD. Gerade bei den <strong>Jusos</strong><br />
spielen die Ideen von <strong>Marx</strong> und deren<br />
Weiterentwicklung seit der Linkswende<br />
von 1969 eine wichtige Rolle. 3<br />
Die SPD sieht in ihrem Parteiprogramm<br />
noch <strong>heute</strong> die marxistische Gesellschaftsanalyse<br />
als eine ihrer Wurzeln<br />
an. 4 Dementgegen gibt es bei vielen Mitgliedern<br />
und in der Öffentlichkeit große<br />
Abwehrreflexe, wenn auch nur der Name<br />
<strong>Marx</strong> in die Debatte geworfen wird. Dabei<br />
wird oft der Bezug auf marxistische Analyseansätze<br />
mit der Befürwortung der osteuropäischen<br />
Gewaltregime gleichgesetzt.<br />
Dies mag aus der Geschichte der deutschen<br />
Teilung und der Ost-West-Konfrontation<br />
heraus zu erklären sein, aber weder<br />
die Leugnung der eigenen Geschichte<br />
noch der Verzicht auf diesen Teil der Identität<br />
als Arbeiterpartei wird dem Anspruch<br />
sozialer Demokratie gerecht. Franz Müntefering<br />
sagte bei der Eröffnung der neuen<br />
Ausstellung des Karl <strong>Marx</strong> Hauses im Juni<br />
2005 in Trier: „Zwischen Karl <strong>Marx</strong> und<br />
der SPD stehen <strong>heute</strong> das Godesberger<br />
Programm und 142 Jahre praktischer Politik.<br />
Das Verhältnis der Partei zum einstigen<br />
Vordenker der Arbeiterbewegung war<br />
immer schwierig, auch anregend, aber nicht<br />
prägend, wenigstens nicht in den Jahren, in<br />
denen wir hier Sozialdemokratie miterleben.“<br />
Nun ist es für die SPD sicherlich<br />
nicht erfolgsversprechend, wieder eine ausschließlich<br />
an <strong>Marx</strong> orientierte Partei zu<br />
werden, aber ebenso wenig ist es zielführend,<br />
die von Müntefering angesprochenen<br />
anregenden Elemente zu verdrängen. Die<br />
Kritik der bestehenden Verhältnisse, die<br />
Frage nach den tatsächlichen Machtstrukturen<br />
in Wirtschaft und Gesellschaft sowie<br />
die Orientierung von Politik auf die Interessen<br />
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
sind gerade in der heutigen Zeit<br />
aktuell.<br />
<strong>Marx</strong> und die frühe Sozialdemokratie<br />
Mit der Industriellen Revolution auf dem<br />
europäischen Kontinent entwickelte sich<br />
auch die deutsche Arbeiterbewegung weiter.<br />
In diese Zeit (1848) fällt auch das bekannteste<br />
Werk von <strong>Marx</strong> und Engels - das<br />
„Manifest der kommunistischen Partei“. 5<br />
Wenige politische Texte haben größere<br />
Wirkung erzielt als dieses „Kommunistische<br />
Manifest“. Für tatsächliches politisches<br />
Handeln der Arbeiterbewegung war<br />
das Manifest aber immer eher ideeller Bezugspunkt<br />
denn praktische Handlungsanleitung.<br />
In Deutschland blieb die Verbreitung<br />
bis zur Jahrhundertwende zudem eher<br />
gering. Wirkliche Massenverbreitung erreichte<br />
es dann nach der Oktoberrevolution<br />
1917 durch die kommunistischen Parteien.<br />
Einflussreich war das Manifest in der<br />
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung<br />
daher vor allem im theoretisch interessierten<br />
Teil. Hier hat es auf Grund seiner prägnanten<br />
Sprache und inhaltlichen Struktur<br />
Einfluss erlangt. Festzuhalten ist: Auch<br />
wenn im Manifest noch lange nicht die<br />
Abgedruckt zum Beispiel in Dowe/ Klotzbach,<br />
S. 55ff.Abgedruckt zum Beispiel in<br />
Dowe/ Klotzbach, S. 55ff.marxsche Theorie<br />
zu vollen Entfaltung gekommen ist -<br />
4 Siehe Hamburger Programm.<br />
5 ‘Abgedruckt zum Beispiel in Dowe/ Klotzbach,<br />
S. 55ff.<br />
24<br />
<strong>Marx</strong> und die Sozialdemokratie – Die SPD und <strong>Marx</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
<strong>Marx</strong> und Engels befanden sich ja noch am<br />
Anfang ihrer Schaffenszeit - so ist es doch<br />
ein beeindruckendes Zeugnis, wie sich eine<br />
materialistische Analyse der bestehenden<br />
Verhältnisse in einer außerordentlich prägnanten<br />
Sprache beschreiben lassen. Der<br />
Standard-Sammelband zur Programmgeschichte<br />
der Sozialdemokratie führt das<br />
Manifest denn auch als ersten Text in der<br />
Sammlung auf.<br />
Mit der Gründung des Allgemeinen<br />
Deutschen Arbeiterverein (ADAV) durch<br />
Ferdinand Lassalle 1863 war die Geburtsstunde<br />
der Sozialdemokratie gekommen.<br />
Dieser war vor allem genossenschaftlich<br />
geprägt und bezog sich nicht wie die von<br />
August Bebel und Wilhelm Liebknecht<br />
1869 gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei<br />
(SDAP) auf marxistische<br />
Theorie. Beide Vereinigungen standen in<br />
Konkurrenz zueinander, die auch noch lange<br />
nach der Vereinigung auf dem Gothaer<br />
Parteitag 1875 anhielt. In dem dort beschlossenen<br />
„Gothaer Programm“ 6 bestimmten<br />
noch die Positionen der Lassallianer,<br />
dementsprechend verheerend fiel die<br />
Kommentierung von <strong>Marx</strong> und Engels<br />
aus. „Ich höre auf, obwohl fast jedes Wort<br />
in diesem dabei saft- und kraftlos redigierten<br />
Programm zu kritisieren wäre. Es ist<br />
derart, daß, falls es angenommen wird,<br />
<strong>Marx</strong> und ich uns nie zu der auf dieser<br />
Grundlage errichteten neuen Partei bekennen<br />
können und uns sehr ernstlich werden<br />
überlegen müssen, welche Stellung wir -<br />
auch öffentlich - ihr gegenüber zu nehmen<br />
haben. Bedenken Sie, daß man uns im<br />
Auslande für alle und jede Äußerungen<br />
und Handlungen der deutschen Sozialdemokratischen<br />
Arbeiterpartei verantwortlich<br />
macht. ... Im Allgemeinen kommt es<br />
weniger auf das offizielle Programm einer<br />
Partei an, als auf das, was sie tut. Aber ein<br />
neues Programm ist doch immer eine öffentlich<br />
aufgepflanzte Fahne, und die Außenwelt<br />
beurteilt danach die Partei. Es<br />
sollte daher keinesfalls einen Rückschritt<br />
enthalten, wie dies gegenüber dem Eisenacher.<br />
Man sollte doch auch bedenken, was<br />
die Arbeiter anderer Länder zu diesem<br />
Programm sagen werden; welchen Eindruck<br />
diese Kniebeugung des gesamten<br />
deutschen sozialistischen Proletariats vor<br />
dem Lassalleanismus machen wird.“ 7<br />
Aber trotzdem begrüßten <strong>Marx</strong> und<br />
Engels die Vereinigung zu einer Partei. So<br />
schrieb <strong>Marx</strong> in einem Brief an Wilhelm<br />
Bracke, der später als „Kritik des Gothaer<br />
Programms“ auch öffentlich bekannt wurde,<br />
neben einer Einzelkritik an fast jedem<br />
Satz des Programms: „Jeder Schritt wirklicher<br />
Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend<br />
Programme. Konnte man also nicht -<br />
und die Zeitumstände ließen das nicht zu -<br />
über das Eisenacher Programm hinausgehn,<br />
so hätte man einfach eine Übereinkunft<br />
für Aktionen gegen den gemeinsamen<br />
Feind abschließen sollen. Macht man<br />
aber Prinzipienprogramme..., so errichtet<br />
man vor aller Welt Marksteine, an denen<br />
sie die Höhe der Parteibewegung mißt.“ 8<br />
Erfurter Programm<br />
Am Gothaer Programm wird deutlich, dass<br />
die Eisenacher um Bebel und Liebknecht<br />
6 Siehe Dowe/ Klotzbach, S. 164ff.<br />
7 Aus einem Brief Engels an August Bebel im<br />
März 1875. MEW. Band 19, 4. Auflage 1973, unveränderter<br />
Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR.<br />
S. 3-9.<br />
8 MEW Band 19, 4. Auflage 1973, unveränderter<br />
Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. S.<br />
13-32.<br />
25
mit ihren marxistischen Ansätzen entgegen<br />
der Annahme von <strong>Marx</strong> und Engels<br />
nicht die Mehrheit in der neuen Partei<br />
stellten. Noch waren die Schriften von<br />
<strong>Marx</strong> und Engels in weiten Teilen der Sozialdemokratie<br />
unbekannt. Die änderte<br />
sich erst nach und nach, erste Popularität<br />
bekamen sie mit der Veröffentlichung von<br />
Friedrich Engels „Antidüring“ 9 und August<br />
Bebels „Die Frau und der Sozialismus“<br />
sowie durch die Gründung der Zeitungen<br />
„Der Sozialdemokrat“ unter Eduard Bernstein<br />
und „Die Neue Zeit“ unter Karl<br />
Kautsky.<br />
Daraus resultierte die Entwicklung zur<br />
marxistischen Klassenpartei, die dann trotz<br />
der Sozialistengesetze auch zur Massenpartei<br />
wurde. Dies schlug sich dann auch<br />
im marxistisch geprägten „Erfurter Programm“<br />
10 von 1891 nieder, das überwiegend<br />
von Karl Kautsky und Eduard Bernstein<br />
verfasst wurde. Zwar stieß auch das<br />
„Erfurter Programm“ nicht auf die bedingungslose<br />
Unterstützung Friedrich Engels,<br />
die Kritik fiel nun aber wohlwollender aus:<br />
„Der jetzige Entwurf unterscheidet sich<br />
sehr vorteilhaft vom bisherigen Programm.<br />
Die starken Überreste von überlebter Tradition<br />
- spezifisch lassallischer wie vulgärsozialistischer<br />
- sind im wesentlichen beseitigt,<br />
der Entwurf steht nach seiner<br />
theoretischen Seite im ganzen auf dem Boden<br />
der heutigen Wissenschaft und läßt<br />
sich von diesem Boden aus diskutieren. ...<br />
Wenn etwas feststeht, so ist es dies, daß<br />
unsre Partei und die Arbeiterklasse nur zur<br />
Herrschaft kommen kann unter der Form<br />
der demokratischen Republik. Diese ist sogar<br />
die spezifische Form für die Diktatur<br />
des Proletariats, wie schon die große französische<br />
Revolution gezeigt hat. Es ist<br />
doch undenkbar, daß unsre besten Leute<br />
unter einem Kaiser Minister werden sollten<br />
wie Miquel.“ <strong>11</strong> Es wurde zur Grundlage<br />
der theoretischen Diskussionen und politischen<br />
Bildung in der Sozialdemokratie<br />
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.<br />
In dieser Zeit war die Theorie der SPD<br />
durch ein sehr starres Verständnis der marxischen<br />
Theorie geprägt, in dem kaum<br />
Raum für Kritik und Weiterentwicklung<br />
war. Kern dieser Dogmatik war die Annahme,<br />
dass die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus<br />
unweigerlich zu seinem Ende führen<br />
würde. Auch wenn dies der Differenziertheit<br />
der Debatten innerhalb Führungsebene<br />
der Partei nicht gerecht wird, war dies<br />
doch das Leitmotiv der großen Mehrheit<br />
der Mitglieder. Dem gegenüber stand eine<br />
politische Praxis, die durchaus auf reale<br />
Verbesserung der Situation der Arbeiter<br />
und Verhandlung mit den herrschenden<br />
Eliten setzte. Dies wird auch in den großen<br />
Auseinandersetzungen innerhalb der<br />
Sozialdemokratie deutlich, die sich um die<br />
Strategie und Rolle der Partei drehten.<br />
Diese Diskussionen waren durch drei<br />
Theoriestränge geprägt, die auch in Zukunft<br />
die Debatten der Linken prägten.<br />
Für diese stehen insbesondere drei Personen<br />
- Karl Kautsky als Vertreter des marxistischen<br />
Parteizentrums, Eduard Bernstein<br />
als Revisionist und Rosa Luxemburg als<br />
Vertreterin des revolutionären Flügels -<br />
wieder.<br />
Der Revisionismussstreit<br />
Bevor diese Differenzen offen im „Revisionismusstreit“<br />
ausgetragen wurden stritt<br />
9 Abgedruckt z. B. in: MEW, Band 20.<br />
10 Dowe/ Klotzbach, S. 171ff.<br />
<strong>11</strong> MEW Band 22, 3. Auflage 1972, unveränderter<br />
Nachdruck der 1. Auflage 1963, Berlin/DDR. S.<br />
225-240.<br />
26<br />
<strong>Marx</strong> und die Sozialdemokratie – Die SPD und <strong>Marx</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
man um die Rolle der Partei. 12 Kautsky sah<br />
alleine die Existenz der Partei und deren<br />
Wachstum als Wert an sich an, die er nicht<br />
durch offensive Aktionen gefährden wollte<br />
und stattdessen auf das Hineintragen des<br />
Klassenbewusstseins in das Proletariat<br />
setzte. Bernstein wollte die Partei nutzen,<br />
um das Proletariat zu bündeln und es zu<br />
Erfolgen auf dem parlamentarischen Weg<br />
führen, während Luxemburg vor allem auf<br />
die praktischen Erfahrungen der Massen<br />
in der Revolution setzte.<br />
Der „Revisionismusstreit“ hatte seinen<br />
Ausgangspunkt in Eduard Bernsteins<br />
Schrift „Die Voraussetzungen des Sozialismus<br />
und die Aufgaben der Sozialdemokratie“,<br />
in der er die Abschaffung des Kapitalismus<br />
durch Klassenkampf als durch die<br />
Realität als überholt sah, da dieser sich als<br />
krisenfest und anpassungsfähig erwiesen,<br />
so dass die SPD nur im Rahmen der bestehenden<br />
Produktionsweise durch Sozialreformen<br />
Verbesserungen für die Arbeiter<br />
und eine allmähliche Angleichung des Lebensstandards<br />
erreichen könne. Diese Ansicht<br />
mündete in seinem Ausspruch: „der<br />
Weg ist mir alles, das Ziel ist mir nichts.“<br />
Dem stellte sich sowohl die Parteilinke unter<br />
Luxemburg entgegen, die an der revolutionären<br />
Überwindung des Kapitalismus<br />
durch die Massen festhielt, als auch das<br />
marxistische Zentrum um August Bebel<br />
und Karl Kautsky entgegen.<br />
Der Streit zwischen den Freunden<br />
Bernstein und Kautsky drehte sich vor allem<br />
um die unterschiedliche Bewertung<br />
des Zustandes des Kapitalismus aus der<br />
dann auch verschiedenen Strategien folgten.<br />
So stellte Kautsky fest, es sei „jeder ein<br />
Revolutionär, der dahin strebt, dass eine<br />
bisher unterdrückte Klasse die Staatsgewalt<br />
erobert. Er verliert diesen Charakter<br />
nicht, wenn er diese Eroberung durch soziale<br />
Reformen, die er den herrschenden<br />
Klassen abzuringen versucht, vorbereiten<br />
und beschleunigen will. Nicht das Streben<br />
nach sozialen Reformen, sondern die ausgesprochene<br />
Beschränkung auf sie unterscheidet<br />
den Sozialreformer vom Sozialrevolutionär.“<br />
Dieser Streit loderte bis zur Verabschiedung<br />
des Godesberger Programms<br />
nicht nur weiter, sondern brach auch immer<br />
wieder offen aus und führte zur Spaltung<br />
der deutschen Sozialdemokratie.<br />
Während die Gründung der USPD noch<br />
Folge der Politik des „Burgfriedens“ im Ersten<br />
Weltkrieg war und alle drei Hauptakteure<br />
der theoretischen Auseinandersetzungen<br />
innerhalb der SPD zu ihr<br />
wechselten, wurde in den ersten Jahren der<br />
Weimarer Republik die endgültige Spaltung<br />
der deutschen Arbeiterbewegung in<br />
unversöhnliche Parteien besiegelt. Teile<br />
kehrten nach und nach in die SPD zurück,<br />
während die KPD sich immer schneller an<br />
die sowjetische KPDSU annäherte und<br />
Sozialdemokratie und Republik bekämpfte.<br />
Das „Görlitzer Programm“ 13 von 1921<br />
war ausgesprochen revisionistisch ausgerichtet.<br />
Allerdings verließ es nicht grundsätzlich<br />
die alten marxistischen Grundlagen.<br />
Das Ziel der neuen Programmatik<br />
war, Wählerinnen und Wähler auch außerhalb<br />
der bisherigen proletarischen Stammwählerschaft<br />
anzusprechen. Die SPD wollte<br />
nunmehr „Partei des arbeitenden Volkes<br />
in Stadt und Land“ sein. Fortan wurden<br />
die Debatten in der SPD durch die Alltagspolitik<br />
und die Frage, wie schnell der<br />
12 Siehe dazu die Dokumente in: Peter Friedemann<br />
(Hrsg.), Materialien zum politischen Richtungsstreit<br />
in der deutschen Sozialdemokratie 1890 –<br />
1917.<br />
13 Dowe/ Klotzbach, S. 187ff.<br />
27
Sozialismus erreicht werden könne geprägt.<br />
In dieser Phase fand aber auch ein<br />
Wandel im Umgang mit den Texten von<br />
<strong>Marx</strong> statt. Zum einen wurden vor allem<br />
auf Initiative sowjetischer Wissenschaftler<br />
viele Schriften von <strong>Marx</strong> und Engels überhaupt<br />
erstmals veröffentlich und zum anderen<br />
wurde nun nicht mehr hauptsächlich<br />
um die Interpretation von <strong>Marx</strong> gestritten,<br />
sondern seine Ansätze weiterentwickelt.<br />
Gerade innerhalb der Weimarer <strong>Jusos</strong> begann<br />
innerhalb des „Hannoveraner Kreises“<br />
wieder eine verstärkte Auseinandersetzungen<br />
mit den Werken von <strong>Marx</strong> und<br />
Engels.<br />
Die Sozialdemokratie in Österreich<br />
hatte im Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie<br />
keine ernsthafte Konkurrenz<br />
durch eine weitere Arbeiterpartei zu befürchten.<br />
Ein Grund dafür lag auch im<br />
stärkeren Zusammenhalt von grundsätzlich<br />
revolutionärer Programmatik und tagespolitischen<br />
Initiativen, wie es im „Linzer<br />
Programm“ 14 von 1926 zum einen und<br />
der sozialdemokratischen Reformpolitik<br />
beispielsweise im „Roten Wien“ andererseits<br />
deutlich wurde. Der „Austromarxismus“<br />
war so auch in der deutschen Sozialdemokratie<br />
einflussreich, einzelne<br />
Personen wie beispielsweise Rudolf Hilferding<br />
machten in der Weimarer Republik<br />
auch in der SPD Karriere.<br />
Dieser Einfluss ist auch im Heidelberger<br />
Programm 15 von 1925 zu finden. Es<br />
war eine Rückkehr zu den marxistischen<br />
Grundpositionen des Erfurter Programms<br />
und ist insbesondere wegen seiner internationalen<br />
Politik und der Forderung nach<br />
den vereinigten Staaten von Europa bedeutend.<br />
Die SPD nach dem 2. Weltkrieg<br />
Nach den Schrecken des zweiten Weltkrieges<br />
wurde die SPD wiedergegründet, bestand<br />
aber nur in der BRD weiter, da sie in<br />
der sowjetisch Besatzungszone mit der<br />
KPD zur SED Zwangsvereinigt wurde. In<br />
der DDR gab es kaum ernsthafte Diskussionen<br />
über marxsche Theorie, sondern nur<br />
Ausarbeitungen zur Analyse des Kapitalismus<br />
im Rahmen der der Vorgaben der jeweiligen<br />
sowjetischen und ostdeutschen<br />
Parteiführung. Der „realexistierende Sozialismus“<br />
ist in diesem Sinne nicht die Umsetzung<br />
marxistischer Ideen, sondern vor<br />
allem dessen Missbrauch zur Legitimierung<br />
von Gewaltherrschaft.<br />
In den ersten Jahren nach der Gründung<br />
der BRD bezog sich die Sozialdemokratie<br />
auf ihre bisherigen theoretischen<br />
Grundlagen in marxistischer Tradition und<br />
stellte in den Mittelpunkt ihrer Forderungen<br />
die Verstaatlichung verschiedener Industriezweige.<br />
Sie stand der Politik Adenauers<br />
mehr als skeptisch gegenüber und<br />
kämpfte gegen die konservative und kapitalistische<br />
Restauration der Bundesrepublik.<br />
Nachdem sich aber keine Wahlerfolge<br />
einstellen wollten, kam es zu einer Diskussion<br />
über die Neuausrichtung der Partei.<br />
Diese wurde mit dem „Godesberger Programm“<br />
16 im Jahr 1959 vollzogen. Zwar<br />
gab es noch Versuche beispielsweise von<br />
Wolfgang Abendroth und Peter von Oertzen,<br />
den marxistischen Analyseapparat für<br />
die Programmatik zu erhalten, diese fan-<br />
14 Auszüge in: Pfabigan, Vision und Wirklichkeit,<br />
S. <strong>11</strong>5ff.<br />
15 Dowe/ Klotzbach, S. 194ff.<br />
16 Dowe/ Klotzbach S. 324ff.<br />
28<br />
<strong>Marx</strong> und die Sozialdemokratie – Die SPD und <strong>Marx</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
den aber kaum Wiederhall auf dem Parteitag.<br />
Die SPD wandelte sich von der marxistischen<br />
Klassenpartei zur linken Volkspartei.<br />
Ironischer Weise kann dies aber nicht<br />
als absolute Abkehr von allen marxschen<br />
Ideen und deren Weiterentwicklung gesehen<br />
werden, sondern stellt in gewisser Weise<br />
eine konsequente Fortschreibung der sozialdemokratischen<br />
Strategie unter den<br />
Voraussetzungen einer demokratischen<br />
Republik dar. So heißt es im Abschlusskapitel<br />
des „Godesberger Programms“: „Die<br />
sozialistische Bewegung erfüllt eine geschichtliche<br />
Aufgabe. Sie begann als ein<br />
natürlicher und sittlicher Protest der<br />
Lohnarbeiter gegen das kapitalistische System.<br />
Die gewaltige Entfaltung der Produktivkräfte<br />
durch Wissenschaft und<br />
Technik brachte einer kleinen Schicht<br />
Reichtum und Macht, den Lohnarbeitern<br />
zunächst nur Not und Elend. Die Vorrechte<br />
der herrschenden Klassen zu beseitigen<br />
und allen Menschen Freiheit, Gerechtigkeit<br />
und Wohlstand zu bringen das war<br />
und das ist der Sinn des Sozialismus. ...<br />
Darum ist die Hoffnung der Welt eine<br />
Ordnung, die auf den Grundwerten des<br />
demokratischen Sozialismus aufbaut, der<br />
eine menschenwürdige Gesellschaft, frei<br />
von Not und Furcht, frei von Krieg und<br />
Unterdrückung schaffen will, in Gemeinschaft<br />
mit allen, die guten Willens sind.“<br />
Mit der APO kamen in den 60er-Jahren<br />
auch wieder marxistische Diskussionen<br />
in die SPD und vor allem in die <strong>Jusos</strong>. 17<br />
Dabei kamen auch wieder die drei grundsätzlichen<br />
Theoriestränge aus den Anfängen<br />
des Jahrhunderts zum Tragen. Diese<br />
entwickelten sich mit den neueren <strong>Marx</strong>interpretationen<br />
und -Fortschreibungen<br />
bis <strong>heute</strong> weiter. 18<br />
Mit dem „Berliner Programm“ von<br />
1989 fand die Bezugnahme auf den <strong>Marx</strong>ismus<br />
auch wieder offiziell Einzug in die<br />
Programmatik der Sozialdemokratie. Dies<br />
galt dabei nicht nur deklaratorisch, sondern,<br />
wie sich in den Kapiteln zur Gesellschaftsanalyse<br />
mit der Bezugnahme auf<br />
den Antagonismus von Kapital und Arbeit<br />
zeigte, auch in den Grundlagen der Analyse.<br />
Die SPD und <strong>Marx</strong> – <strong>heute</strong><br />
Bis <strong>heute</strong> spielen in der Programmatik der<br />
SPD viele theoretische Versatzstücke eine<br />
wichtige Rolle, die sich auch auf <strong>Marx</strong> begründen.<br />
Dieses gilt insbesondere für die<br />
Betonung der Bedeutung der Arbeit und<br />
den Fokus auf die Interessenvertretung der<br />
arbeitenden Menschen. Die Ideen von Karl<br />
<strong>Marx</strong> haben daher auch weiterhin ihren<br />
Platz in der Sozialdemokratie. Die SPD ist<br />
keine marxistische Partei, sie hat viele<br />
Wurzeln und setzt sich aus unterschiedlichsten<br />
Traditionslinien zusammen. Im<br />
aktuellen „Hamburger Programm“ von<br />
2007 heißt es daher, „Sie (die Sozialdemokratinnen<br />
und Sozialdemokraten) verstehen<br />
sich seit dem Godesberger Programm<br />
von 1959 als linke Volkspartei, die ihre<br />
Wurzeln in Judentum und Christentum,<br />
Humanismus und Aufklärung, marxistischer<br />
Gesellschaftsanalyse und den Erfahrungen<br />
der Arbeiterbewegung hat.“ 19<br />
Deswegen bleibt – unabhängig vom<br />
Bezug auf <strong>Marx</strong> - richtig was Wolfgang<br />
Abendroth 1964 über die Ausrichtung der<br />
17 Siehe dazu zum Beispiel das „Hamburger Strategiepapier“<br />
von 1971.<br />
18 Näheres dazu in: Vogt, Juso Linke – 40 Jahre<br />
theoretische Orientierung der <strong>Jusos</strong>.<br />
19 Hamburger Programm der SPD.<br />
29
SPD schrieb: „In Wirklichkeit ist noch<br />
niemals eine bedeutende Reform durch<br />
herrschende Schichten den durch sie beherrschten<br />
Schichten konzediert worden,<br />
wenn sie nicht die Entschlossenheit der<br />
Unterklassen zur Auseinandersetzung mit<br />
den bestehenden Verhältnissen zu befürchten<br />
hatten, wie andererseits die Erzielung<br />
von bedeutenden Reformen auf längere<br />
Sicht den Willen zur Macht in derjenigen<br />
Klasse, die diese Reformen erkämpft hat,<br />
für die Zukunft (und häufig auch aktuell)<br />
nicht schwächt, sondern stärkt, wenn ihr<br />
nur bewußt bleibt, daß sie diese Konzessionen<br />
ihrer Gegner ihrem Kampfwillen zu<br />
verdanken hat. Deshalb lassen sich also<br />
durchaus Reformkämpfe und Reformwillen<br />
in eine auf Umwälzung der gesamten<br />
Gesellschaftsform und ihrer Machtstruktur<br />
gerichtete Bewegung einordnen und<br />
gehören notwendig zu ihrer Strategie,<br />
wenn sie sich ihrer Zielsetzung permanent<br />
bewußt ist. Andererseits wird aber ebenso<br />
notwendig die demokratische Befreiungsbewegung<br />
einer unterdrückten Klasse ihren<br />
Schwung verlieren, wenn sie auf die<br />
Einordnung ihrer einzelnen Teilziele in die<br />
große Konzeption einer geschlossenen, auf<br />
Umwandlung der gesamten Gesellschaft<br />
gerichteten Zielsetzung verzichtet.“ 20 l<br />
20 Abendroth, Aufstieg und Krise der deutschen<br />
Sozialdemokratie, S. 16.<br />
Literatur:<br />
Wolfgang Abendroth, Aufstieg und Krise der deutschen<br />
Sozialdemokratie, Frankfurt/ Main 1964<br />
Ders., Ein Leben in der Arbeiterbewegung. Gespräche,<br />
aufgezeichnet und herausgegeben von B.<br />
Dietrich und J. Perels, Frankfurt/ Main 1976<br />
Max Adler, Ausgewählter Schriften, Herausgeben von<br />
Norbert Leser und Alfred Pfabigan, Wien 1981<br />
Otto Bauer, Eine Auswahl aus seinem Lebenswerk,<br />
Wien 1961<br />
August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Erstausgabe<br />
1879<br />
Eduard Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus<br />
und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Erstausgabe<br />
1899<br />
Christoph Butterwegge, SPD und Staat - <strong>heute</strong>,<br />
Berlin 1979<br />
Dieter Dowe/ Kurt Klotzbach (Hg.), Programmatische<br />
Dokumente der deutschen Sozialdemokratie,<br />
Bonn 2004<br />
Georg Eckert, 100 Jahre Braunschweiger Sozialdemokratie,<br />
Hannover 1965<br />
Iring Fetscher, Der <strong>Marx</strong>ismus - Seine Geschichte in<br />
Dokumenten, München/Zürich 1983<br />
Peter Friedemann (Hrsg.), Materialien zum politischen<br />
Richtungsstreit in der deutschen Sozialdemokratie<br />
1890 - 1917, 2 Bände, Frankfurt/ Main<br />
1977<br />
Horst Heimann/ Thomas Meyer (Hrsg.), Reformsozialismus<br />
und Sozialdemokratie, Bonn 1982<br />
Jungsozialisten in der SPD, Bezirk OWL (Hrsg.),<br />
Herforder Thesen. Zur Arbeit von <strong>Marx</strong>isten in<br />
der SPD, Berlin 1980<br />
Karl Kautsky, Karl <strong>Marx</strong>’s ökonomische Lehren,<br />
Erstauflage 1886<br />
Ders., Die materialistische Geschichtsauffassung,<br />
2 Bände, Erstauflage 1927<br />
Paul Levi, Zwischen Spartakus und Sozialdemokratie.<br />
Schriften, Aufsätze, Reden und Briefe, Frankfurt/<br />
Main 1969<br />
Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, in:<br />
Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, 6 Bände,<br />
Berlin 1970<br />
Karl <strong>Marx</strong> /Friedrich Engels, Werke (MEW)<br />
Franz Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie.<br />
2 Teile, Erstauflage 1897/98<br />
Susanne Miller/Heinrich Potthoff, Kleine Geschichte<br />
der SPD, Bonn 2002<br />
Peter von Oertzen, Demokratie und Sozialismus zwischen<br />
Politik und Wissenschaft, Hannover 2004<br />
Alfred Pfabigan (Hg.), Vision und Wirklichkeit. Ein<br />
Lesebuch zum Austromarxismus, Wien 1989<br />
Sascha Vogt (Hrsg.), Juso Linke - 40 Jahre theoretische<br />
Orientierung der <strong>Jusos</strong>, Dortmund 20<strong>11</strong><br />
30<br />
<strong>Marx</strong> und die Sozialdemokratie – Die SPD und <strong>Marx</strong> <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
CARE ALS ZENTRALES<br />
STRUKTURPROBLEM<br />
KAPITALISTISCHER<br />
VERGESELLSCHAFTUNG<br />
UND DEREN FEMINIS-<br />
TISCHE BEARBEITUNG<br />
Von Lisa Yashodhara Haller, Universität Kassel<br />
1 Einleitung<br />
Der Arbeitsbereich der Betreuung, Erziehung<br />
und Fürsorge, der in der aktuellen<br />
Auseinandersetzung mehrheitlich mit dem<br />
englischen Oberbegriff Care umschrieben<br />
wird, ist unabdingbar für ökonomische<br />
Prozesse, denn Heranwachsende müssen<br />
zunächst betreut, erzogen und umsorgt<br />
werden, bevor sie als Erwachsene an Arbeitprozessen<br />
teilnehmen können. Insofern<br />
ist die Versorgung von Menschen Ausgangspunkt<br />
für jede Form des Arbeitens<br />
und Wirtschaftens. Dieser Umstand wurde<br />
von <strong>Marx</strong> und Engels in ihren Analysen<br />
kapitalistischer Verhältnisse sowie in den<br />
sich daraus entwickelnden Klassenkämpfen<br />
nur unzureichend berücksichtigt. Der<br />
vorliegende Beitrag will auf diese Leerstelle<br />
des <strong>Marx</strong>ismus aufmerksam machen und<br />
darüber hinaus feministische Weiterentwicklungen<br />
marxistischer Theorie aufzeigen,<br />
die dazu beitragen, tagespolitische<br />
Herausforderungen zu erkennen.<br />
2 Die Entstehung divergierender<br />
Ökonomien<br />
Mit dem Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert<br />
ist die zunehmende Aufspaltung<br />
eines bis dato einheitlichen Wirtschaftsbereiches<br />
in divergierende Ökonomien einhergegangen,<br />
die zwar Erleichterungen im<br />
Arbeitsprozess mit sich brachte, deren Organisation<br />
jedoch bis in die Gegenwart<br />
hinein eine Vielzahl von strukturellen Problemen<br />
verursacht hat. Signifikant für die<br />
sich neu formierende kapitalistische Ökonomie<br />
ist, dass nicht nur Land und Produktionsmittel,<br />
sondern überdies auch die<br />
Arbeitskraft in Warenform getauscht wird.<br />
Die Zerstörung bisheriger Arbeits- und<br />
31
Subsistenzformen sowie die Befreiung der<br />
Bevölkerung von feudaler Leibeigenschaft<br />
führt <strong>Marx</strong> als die zwei zentralen Voraussetzungen<br />
zum freien Tausch der Ware Arbeitskraft<br />
an. Das Subjekt marxistischer<br />
Theorie, der doppelt freie Lohnarbeiter, ist<br />
insofern „frei im Doppelsinn, dass er als<br />
freie Person über seine Arbeitskraft als seine<br />
Ware verfügt, dass er andererseits andere<br />
Waren nicht zu verkaufen hat...“ 1 . Dass<br />
<strong>Marx</strong> den doppelt freien Lohnarbeiter<br />
auch frei von der Betreuung, Erziehung<br />
und Fürsorge neuer Arbeitskräfte wägt,<br />
kommt erst im zweiten Halbsatz zum Ausdruck,<br />
„...los und ledig, frei ist [er] von allen<br />
zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft<br />
nötigen Sachen“ 2 . Die Wahl eines Subjektes,<br />
das von zwischenmenschlicher Fürsorgeverantwortung<br />
losgelöst agiert, verwehrt<br />
uns bei der ansonsten aufschlussreichen<br />
Kapitallektüre ausgerechnet die spannende<br />
Auseinandersetzung mit den Grundlagen<br />
kapitalistischer Gesellschaftsformation<br />
und insofern der eigentlichen Voraussetzung<br />
kapitalistischer Produktion. Die Suche<br />
nach diesen Grundlagen nimmt bei der<br />
marxistischen Werttheorie ihren Ausgang.<br />
3 Woher kommt der Wert der Ware<br />
Arbeitskraft?<br />
Im Zuge der doppelten Befreiung des<br />
marxistischen Subjekts durch die Auflösung<br />
feudaler Leibeigenschaft und der<br />
Subsistenzproduktion wurde der Umstand,<br />
dass durch die Aufwendung menschlicher<br />
Arbeitskraft mehr produziert wird, als der<br />
arbeitende Mensch verbraucht, dem<br />
Zweck der Mehrwertgewinnung unterstellt.<br />
Das Mehrprodukt wird zum Mehrwert,<br />
indem die Arbeitszeit, in der die<br />
Lohnarbeitenden ihre Arbeitskraft verausgaben,<br />
diejenige Arbeitszeit überschreitet,<br />
die notwendig wäre, um ihre Reproduktionskosten<br />
3 zu sichern. Die Produktionsmittelbesitzenden<br />
eignen sich diesen<br />
Mehrwert an und akkumulieren ihn. Die<br />
Abschöpfung des Mehrwertes der Arbeitskraft<br />
der Lohnarbeitenden durch die Produktionsmittelbesitzenden,<br />
die bis <strong>heute</strong><br />
jedem abhängigen Lohnarbeitsverhältnis<br />
in der freien Marktwirtschaft zu Grunde<br />
liegt, bezeichnet <strong>Marx</strong> als Ausbeutung. Die<br />
ausgebeuteten Lohnabhängigen haben die<br />
Möglichkeit, gegen die ausbeutenden Produktionsmittelbesitzenden<br />
einen kollektiven<br />
Arbeitskampf zu führen. Solidarisieren<br />
sie sich erfolgreich zum Zweck des Arbeitskampfes,<br />
gewinnen sie die Vormachtstellung<br />
im Arbeitsprozess. 4 Insofern suggeriert<br />
die Kapitallektüre, die Erzeugung<br />
von Mehrwert sei einzig der Aufwendung<br />
der doppelt freien Arbeitskraft der Lohnabhängigen<br />
sowie der Bereitstellung von<br />
Produktionsmitteln von Seiten der Produktionsmittelbesitzenden<br />
zu verdanken.<br />
Die kritische Leserin fragt jedoch, wie<br />
denn der Wert menschlicher Arbeitskraft<br />
entsteht, ohne die doch kein Mehrwert zustande<br />
käme? <strong>Marx</strong> beantwortet diese Frage<br />
kurz und bündig. Den Wert der Ware<br />
Arbeitskraft bestimmt er, wie den Wert an-<br />
1 <strong>Marx</strong>, K., Das Kapital. Kritik der politischen<br />
Ökonomie. Bd.23, Berlin 1980, S. 183<br />
2 <strong>Marx</strong>, K., Das Kapital. Kritik der politischen<br />
Ökonomie. Bd.23, Berlin 1980, S. 183.<br />
3 Unter Reproduktionskosten wird die Gesamtheit<br />
aller Kosten verstanden, die benötigt werden, die<br />
Lebens- und Arbeitskraft von Subjekten zu erhalten<br />
sowie ihre Bedürfnisse zu befriedigen.<br />
Menschliche Bedürfnisse, ebenso wie die Produktionsbedingungen<br />
zu ihrer Befriedigung variieren<br />
historisch-kontextuell vgl. MEW 23: 185.<br />
4 Wegen der Schwierigkeiten bei der Verwandlung<br />
der Warenwerte in Produktionspreise ist von<br />
werttheoretischen Schlüssen auf Lohnhöhen ohne<br />
eine Berücksichtigung der historischen Gesellschaftsformation<br />
abzuraten.<br />
32<br />
Care als zentrales Strukturproblem kapitalistischer Vergesellschaftung und deren feministische Bearbeitung <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
derer Ware auch, „durch die zur Produktion,<br />
als auch Reproduktion, dieses spezifischen<br />
Artikels notwendigen Arbeitszeit.“ 5<br />
Auf die Frage, welche Arbeitszeit denn<br />
notwendig sei, um menschliche Arbeitskraft<br />
zu (re)produzieren, findet die Leserin<br />
im Kapital lediglich einen Verweis auf die<br />
Arbeitszeit, die notwendig sei, um die Reproduktionskosten<br />
zu bestreiten. 6 Eine<br />
konkrete Klärung erhofft sie sich daher von<br />
feministischen Ökonominnen.<br />
4 Wertschöpfungsschwache Arbeit<br />
als Gegenstand der Care Ökonomie<br />
Feministische Ökonominnen haben bezugnehmend<br />
auf Karl Polanyi (1978) herausgearbeitet,<br />
dass die menschliche Arbeitskraft<br />
zwar ähnlich wie die Güter, die<br />
sie produziert, in Warenform getauscht<br />
wird, sich die Herstellung von menschlicher<br />
Arbeitskraft aber dennoch signifikant<br />
von der Herstellung stofflicher Güter unterscheidet,<br />
da sie vornehmlich auf Betreuungs-,<br />
Erziehungs- und Fürsorgeleistungen<br />
beruht. 7 Die Besonderheit der<br />
Betreuungs-, Erziehungs- und Fürsorgearbeit<br />
besteht wesentlich aus der Entwicklung<br />
einer Beziehung zwischen dem Betreuenden<br />
und dem Kind, das betreut,<br />
erzogen und im besten Fall umsorgt wird.<br />
Während bei der Produktion stofflicher<br />
Güter neben der Steigerung des absoluten<br />
Mehrwerts mittels der Verlängerung des<br />
Arbeittages mit Hilfe von effizienzsteigernden<br />
Maßnahmen überdies ein relativer<br />
Mehrwert 8 generiert werden kann, muss<br />
bei der Betreuungsarbeit von der Gewinnung<br />
eines relativen Mehrwertes weitestgehend<br />
abgesehen werden. Denn der relative<br />
Mehrwert wird durch eine<br />
Optimierung erzeugt, zu deren Zweck Arbeitsgegenstände<br />
zunächst in zergliederte<br />
Arbeitsbereiche aufgeteilt und sodann<br />
durch detaillierte Zielvorgaben und eine<br />
exakte zeitliche Begrenzung rationalisiert<br />
werden. Weil der Betreuung jedoch eine<br />
Zeitdimension inhärent ist, kann eine auf<br />
Effizienzsteigerung basierende Rationalisierung<br />
und damit die Gewinnung eines<br />
relativen Mehrwertes nicht uneingeschränkt<br />
gelingen, ohne dass sich der Charakter<br />
der Betreuung und ab einem gewissen<br />
Punkt ihre Qualität verändert. Eine<br />
Stunde Kindesbetreuung bleibt eine Stunde<br />
Kindesbetreuung, auch wenn die Betreuungsperson<br />
die Zeit mit dem Kind unterschiedlich<br />
intensiv nutzen kann. 9<br />
Während die Erziehungsleistung, die im<br />
Rahmen der Betreuung erfolgt, durchaus<br />
durch Zielvorgaben strukturiert und optimiert<br />
werden kann, sind zweitens detaillierte<br />
Zielvorgaben mit einer zeitlichen Begrenzung<br />
der Fürsorge um ein Kind kaum<br />
förderlich, da sich die Fürsorgeleistung in<br />
dem Erziehungsprozess entwickelt. Insofern<br />
ist drittens der Arbeitsbereich der Betreuung,<br />
Erziehung und Fürsorge durch<br />
eine asymmetrische Beziehung zwischen<br />
5 <strong>Marx</strong>, K., Das Kapital. Kritik der politischen<br />
Ökonomie. Bd.23, Berlin 1980, S. 184<br />
6 Bei <strong>Marx</strong> löst sich die zur Produktion der Arbeitskraft<br />
notwendige Arbeitszeit auf in die zur<br />
Produktion dieser Lebensmittel notwendigen Arbeitszeit,<br />
damit ist der Wert der Arbeitskraft bestimmt<br />
durch die zur Erhaltung ihres Besitzers<br />
notwendigen Lebensmittel. MEW 23, S.185.<br />
7 Da die Ware Arbeitskraft niemals vollständig<br />
durch Lebensmittel produziert werden kann,<br />
übersteigt die Arbeit, die nötig ist, um Arbeitskraft<br />
als Ware tauschbar zu machen, grundsätzlich<br />
die durch den Einkauf von Lebensmitteln erzeugten<br />
Reproduktionskosten.<br />
8 <strong>Marx</strong>, K., Das Kapital. Kritik der politischen<br />
Ökonomie. Bd.23, Berlin 1980, S. 334.<br />
9 So kommt eine Beschleunigung der Kindererziehung<br />
zum Zweck der zeitlichen Optimierung der<br />
Betreuung einer Verkürzung der Kindheits- und<br />
Adoleszenzphase gleich.<br />
33
dem Betreuenden und dem Kind gekennzeichnet.<br />
Das Kind ist elementar von der<br />
Fürsorge des Betreuenden abhängig, mit<br />
einer Solidarisierung zwischen den Betreuenden<br />
zum Zweck eines Arbeitskampfes<br />
gegen das zu betreuende Kind ist insofern<br />
nicht zu rechnen, da ein solcher mit der<br />
fürsorglichen Haltung gegenüber den Betreuten<br />
nicht zu vereinbaren wäre. Weil Betreuung<br />
und Fürsorge im Gegensatz zur<br />
stofflichen Warenproduktion die Mehrwertproduktion<br />
und insbesondere die relative<br />
Mehrwertsteigerung kaum ermöglichen,<br />
wird der Wirtschaftsbereich der<br />
Versorgungsleistungen im Gegensatz zum<br />
Wirtschaftsbereich der Güterproduktion<br />
als wertschöpfungsschwach bezeichnet.<br />
Auf Grund der Besonderheit des Arbeitsbereiches<br />
der Betreuung, Erziehung und<br />
Fürsorge sowie der divergierenden Wertschöpfungsstärke<br />
der beiden Wirtschaftsbereiche<br />
können Kinderbetreuung, Erziehung<br />
und Fürsorge nicht vollständig im<br />
Rahmen einer Zeit- und Verwertungsökonomie<br />
funktionieren, wie sie für Lohnarbeit<br />
inzwischen in nahezu allen Branchen<br />
vorauszusetzen ist.<br />
5 Care als zentrales Strukturproblem<br />
kapitalistischer Vergesellschaftung<br />
Hieraus folgt, dass sich Fürsorgearbeit<br />
zwar nicht wertschöpfend im Rahmen kapitalistischer<br />
Produktionsweise organisieren<br />
lässt, und folgend weder angeeignet<br />
noch akkumuliert werden kann, die kapitalistische<br />
Produktionsweise aber gleichwohl<br />
auf die Betreuung, Erziehung und Fürsorge<br />
von Kindern als zukünftige Arbeitskräfte<br />
angewiesen ist. Gesellschaften, die nach<br />
dem Prinzip freier Lohnarbeit organisiert<br />
sind, stehen deshalb vor dem zentralen<br />
Strukturproblem, zum Zweck der Kapitalakkumulation<br />
die Betreuung, Erziehung<br />
und Fürsorge arbeitsfähiger Subjekte jenseits<br />
der kapitalistischen Produktionssphäre<br />
zu gewährleisten. 10<br />
Da Arbeiten der Betreuung, Erziehung<br />
und Fürsorge jenseits des marxistischen<br />
Erkenntnisinteresses lagen, sucht die kritische<br />
Leserin bei der Kapitallektüre vergeblich<br />
nach Kategorien zur Bearbeitung dieses<br />
zentralen Strukturproblems. Klärung<br />
erhofft sie sich daher von feministischen<br />
Wohlfahrtsstaatsforscherinnen.<br />
6 Bearbeitung des Strukturproblems<br />
durch den Wohlfahrtsstaat<br />
Feministische Wohlfahrtsstaatsforscherinnen<br />
haben herausgearbeitet, dass Sozialund<br />
Familienpolitik durch eine partielle<br />
Umverteilung des Lohneinkommens diejenigen<br />
zeitintensiven Arbeiten ermöglichen,<br />
die eine unabdingbare Voraussetzung<br />
für den kapitalistischen Produktionsprozess<br />
darstellen, ohne dass diese profitgenerierend<br />
organisiert werden müssten. Die<br />
Umverteilung von Lohneinkommen bildet<br />
damit die eigentliche Voraussetzung zur<br />
Überführung von Arbeitskraft in freie<br />
Lohnarbeit. Ohne eine Umverteilung von<br />
Lohneinkommen kann die Sicherstellung<br />
der Betreuung, Erziehung und Fürsorge<br />
neuer Arbeitskräfte nicht gewährleistet<br />
werden, ohne neue Arbeitskräfte ist eine<br />
Aneignung von Arbeitskraft nicht möglich,<br />
insofern kann ohne vorausgehende<br />
Fürsorgeleistungen weder Mehrwert generiert<br />
noch vom Kapital akkumuliert wer-<br />
10 Lenhard, G./Offe, C., Staatstheorie und Sozialpolitik.<br />
Politisch-soziologische Erklärungsansätze<br />
für Funktionen und Innovationsprozesse der<br />
Sozialpolitik, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie<br />
und Sozialpsychologie SH 19, 1977, S.106.<br />
34<br />
Care als zentrales Strukturproblem kapitalistischer Vergesellschaftung und deren feministische Bearbeitung <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
den. Die den kapitalistischen Akkumulationsprozess<br />
ermöglichenden Einkommensübertragungen<br />
werden meist privat im<br />
Rahmen von Partnerschaften, Ehe- und<br />
Verwandtschaftsverhältnissen getätigt.<br />
Einkommensübertragungen im familialen<br />
Bereich sind zu einem erheblichen Anteil<br />
über das Unterhaltsrecht reguliert und<br />
werden von staatlicher Seite in Form von<br />
Einkommenssteuerrückzahlungen anerkannt.<br />
Zusätzlich reguliert der Staat das<br />
Wechselverhältnis zwischen unbezahlter<br />
Fürsorge auf der einen und freier Lohnarbeit<br />
auf der anderen Seite durch staatliche<br />
Transferleistungen. Werden diese Transferleistungen<br />
beispielsweise zur außerhäuslichen<br />
Kindesbetreuung eingesetzt, resultieren<br />
die Gewinne der Kindesbetreuungseinrichtung<br />
nicht wie von <strong>Marx</strong><br />
beschrieben allein aus der Ausnutzung der<br />
Arbeitskraft der Erzieherinnen und Erzieher,<br />
sondern überdies aus der sozialstaatlichen<br />
Umverteilung eines bereits produzierten<br />
Mehrproduktes. Die sozialstaatliche<br />
Umverteilung ist damit materielle Voraussetzung<br />
für die Gewährleistung der wertschöpfungsschwachen<br />
Erziehungsarbeit. <strong>11</strong><br />
Da der sozialhistorisch den Frauen zugeschriebene<br />
Arbeitsbereich der Betreuung,<br />
Erziehung und Fürsorge die freie<br />
Lohnarbeit erst in größerem Maßstab berechenbar<br />
und insofern plan- und organisierbar<br />
macht und die hier anfallenden Arbeiten<br />
weiterhin mehrheitlich von Frauen<br />
geleistet werden, bleibt die Analyse des Kapitalverhältnisses<br />
ohne eine Untersuchung<br />
von Geschlechterverhältnissen als zentrale<br />
Produktionsgröße stark verkürzt. Dass diese<br />
Arbeit bei der Erörterung von Lohn,<br />
Preis und Profit dennoch nicht vorkommt,<br />
ärgert nicht nur die Kapitalleserin zunehmend,<br />
sondern führt auch dazu, dass aktuelle<br />
ökonomische und gesellschaftliche<br />
Problemstellungen, die mit den krisenhaften<br />
Entwicklungen im Fürsorge-, Erziehungs-<br />
und Betreuungssektor verbunden<br />
sind, nicht angemessen verstanden werden<br />
können.<br />
7 Die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung<br />
marxistischer Theorie angesichts<br />
der tagespolitischen Herausforderungen<br />
Während aus der Perspektive klassischer<br />
Ökonomen einzig die Erzeugung eines<br />
Produktes Mehrwert schafft, setzt sich<br />
in der bürgerlichen Ökonomie die marxistische<br />
Sichtweise, der Entlohnung als<br />
Voraussetzungzur Erzeugung eines Mehrwertes<br />
durch. Durch den grundsätzlich expansiven<br />
Charakter der kapitalistischen<br />
Akkumulationsdynamik 12 sind sowohl Kapitalisten<br />
Als auch Lohnabgängige infolge<br />
ihrer Abhängigkeit von der Reproduktionskostendeckung<br />
unentwegt damit befasst,<br />
beue Verwertungs- und Entlohnungsmöglichkeiten<br />
für ihre Arbeitskraft<br />
zu generieren. Die hiermit erklärbare Tendenz<br />
zur Vermarktung von Familienarbeit<br />
in der jüngsten Vergangenheit ging Hand<br />
in Hand mit den sozialen Kämpfen der<br />
Frauenbewegung um eine Steigerung der<br />
Frauenerwerbstätigkeit, mit Hilfe derer<br />
ihre Arbeit endlich als wertschaffend sichtbar<br />
werden sollte. Das marxistische Credo,<br />
<strong>11</strong> Vgl. Chorus, S. (20<strong>11</strong>): Care-Seiten in der politischen<br />
Ökonomie, in: Das Argument 292:<br />
Care – eine feministische Kritik der politischen<br />
Ökonomie? Reihe DAS ARGUMENT 53. Jg.<br />
Heft 3/20<strong>11</strong>, S. 398.<br />
12 Luxemburg, Rosa (1981):.Die Akkumulation des<br />
Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung<br />
des Imperialismus. In: Gesammelte Werke,<br />
Berlin 1981, Bd. 5.<br />
35
dass nur Wert schafft was entlohnt wird,<br />
hatte sich bis zu den amtierenden Familienministerinnen<br />
durchgesetzt, die raumgreifende<br />
Reformen im familienpolitischen<br />
Bereich verabschiedeten. Nicht zuletzt unter<br />
den Aspekten europäischer Strukturanpassung<br />
schien es weitblickend, die unentlohnte<br />
Fürsorgearbeit in den Arbeitsmarkt<br />
zu überführen, um hierüber das Bruttoinlandprodukt<br />
zu steigern und die qualifizierte<br />
weibliche Arbeitskraft für wertschöpfungsstarke<br />
Arbeiten freizusetzten.<br />
Da Fürsorgearbeit jedoch nicht vollständig<br />
im Rahmen einer kapitalistischen Produktionsweise<br />
verwertbar ist, steigt angesichts<br />
der Reduzierungen familienpolitischer<br />
Leistungen gesamtwirtschaftlich diejenige<br />
Zeit, in der Frauen Fürsorgearbeiten jenseits<br />
eines wohlfahrtstaatlichen Ausgleichs<br />
nachgehen, um den Fürsorgestandard unserer<br />
Gesellschaft wenigstens zu halten.<br />
Kennzeichnend für tagespolitische Entwicklungen<br />
ist die Inanspruchnahme von<br />
Frauen als freie Lohnarbeiterinnen, ohne<br />
dass diese frei von der Betreuungs-, Erziehungs-<br />
und Fürsorgearbeit wären. Eine<br />
Konsequenz hieraus ist die Mehrbelastung<br />
von Frauen und insgesamt eine Verknappung<br />
und Prekarisierung der gesellschaftlichen<br />
Fürsorgezeit.<br />
8 Fehlende Begriffe für soziale<br />
Kämpfe<br />
Ein zentrales Strukturproblem kapitalistischer<br />
Vergesellschaftung wandelt sich damit<br />
in ein strukturelles Problem von Elternschaft.<br />
Der Versuch einer<br />
marxistischen Erörterung der tiefgreifenden<br />
Veränderungen, denen der bisher unbeachtete,<br />
nicht entlohnte und vornehmlich<br />
von Frauen ausgeführte Tätigkeitsbereich<br />
der Fürsorge unterliegt, scheitert<br />
jedoch immer wieder an den Grenzen<br />
des <strong>Marx</strong>schen Arbeitsbegriffes. Da aufgrund<br />
der Besonderheit der Fürsorgebeziehung<br />
sich die Betreuenden ihrer Fürsorgeverantwortung<br />
gegenüber dem Kind nicht<br />
im Rahmen eines Arbeitskampfes entziehen<br />
können, fragt sich die kritische Leserin,<br />
in welcher Weise Betreuende, Erziehende<br />
und Fürsorgeleistende sich gegen<br />
Kürzungen und Streichungen von Lohnersatzleistungen<br />
zur Kindespflege wehren<br />
können. Bezugnehmend auf die Kapitallektüre<br />
fehlen unserer Leserin allerdings<br />
Begriffe, mit deren Hilfe es ihr möglich<br />
wäre, Betreuungs-, Erziehungs- und Fürsorgearbeit<br />
als „Ausbeutung“ vorwiegend<br />
weiblicher Arbeitskraft anzuprangern. Klärung<br />
erhofft sie sich daher von feministischen<br />
Materialistinnen.<br />
9 Der feministische Materialismus<br />
und die Ausbeutung weiblicher<br />
Arbeitskraft<br />
Feministische Materialistinnen haben darauf<br />
hingewiesen, dass in kapitalistischen<br />
Gesellschaftsformationen unterschiedliche<br />
Ausbeutungs-, Aneignungs- und Abhängigkeitsverhältnisse<br />
bestehen. Die grundsätzlich<br />
unvollständige kapitalistische<br />
Produktionsweise beruht ihrer Konzeptionalisierung<br />
nach keineswegs lediglich auf<br />
abstrakten Tauschvorgängen, sondern setzt<br />
Produktionsweisen jenseits der kapitalistischen<br />
voraus. Während der traditionelle<br />
<strong>Marx</strong>ismus - nach Abschluss der primären<br />
Akkumulation - lediglich die Mehrwertakkumulation<br />
in der freien Lohnarbeit<br />
kennt, existieren nach Auffassung feministischer<br />
Materialistinnen weitere Formen<br />
der ‚primären’ Akkumulation. Die Betreuung,<br />
Erziehung und Fürsorge ist in ihrer<br />
unbezahlten Form in der Regel eine häus-<br />
36<br />
Care als zentrales Strukturproblem kapitalistischer Vergesellschaftung und deren feministische Bearbeitung <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
liche Produktionsweise und in ihrer bezahlten<br />
als wertschöpfungsschwache Form<br />
häufig einem öffentlichen Sektor zugewiesen,<br />
während die als wertschöpfungsstark<br />
geltende, freie Lohnarbeit in der freien<br />
Marktwirtschaft verortet wird. Gegenwärtig<br />
betonen Materialistinnen die historische<br />
Varianz des wechselseitigen Austausch-<br />
und Abhängigkeitsverhältnisses<br />
zwischen den Produktionsbereichen.<br />
Deutlich wird in den Konzeptionalisierungen<br />
feministischer Materialistinnen, dass<br />
Geschlechterverhältnisse einen prägenden<br />
Einfluss auf die Formen der Kapitalakkumulation<br />
besitzen. Die unterschiedlichen<br />
Ausbeutungs-, Aneignungs- und Abhängigkeitsverhältnisse<br />
erfordern insofern verschiedene<br />
Überwindungsstrategien.<br />
10 Ausblick: Viel Platz zum Weiterdenken<br />
- und handeln<br />
Die tagespolitische Herausforderung besteht<br />
insofern in einer Zusammenführung<br />
der interdisziplinären Ansätze einer feministischen<br />
Weiterentwicklung marxistischer<br />
Theorie. Eine derartige Zusammenführung<br />
würde den Raum für die<br />
Konzeptionalisierung verschiedener Strategien<br />
zur Überwindung kapitalistischer<br />
Vergesellschaftung eröffnen. Diese ist angewiesen<br />
auf breite Bündnisse, in denen<br />
sich Abhängige von Lohnersatzleistungen<br />
und Transferleistungsempfangende ebenso<br />
wiederfinden wie freie Lohnabhängige.<br />
Denn nicht zuletzt war, trotz der marxistischen<br />
Schaffung eines bürgerlichen Wertbegriffes,<br />
die Überwindung kapitalistischer<br />
Vergesellschaftung auch das Anliegen von<br />
<strong>Marx</strong> und Engels. l<br />
37
STAAT: HERRSCHAFT?<br />
NOTWENDIGKEIT?<br />
INSTRUMENT?<br />
ZUR STAATSTHEORIE<br />
MARX’ UND MARXISTI-<br />
SCHER STAATSTHEORIE<br />
Von Julian Zado, stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender<br />
Wenn wir <strong>Jusos</strong> Anträge schreiben,<br />
dann enthalten diese meistens Forderungen.<br />
Häufigster Adressat dieser<br />
Forderungen ist der Staat. Das zu<br />
recht, denn der Staat ist einflussreicher<br />
und effektiver Akteur, der zugleich<br />
noch am ehesten zu beeinflussen<br />
ist. Die Bezugnahme auf den Staat<br />
erfolgt dabei überwiegend positiv - so<br />
lehnen wir z.B. Privatisierungen bzw.<br />
Entstaatlichungen ab. Ab der Staat ist<br />
auch für die Bedienung von Lobby-Interessen,<br />
Kriege und Sozialabbau verantwortlich.<br />
Und wollte nicht Karl <strong>Marx</strong><br />
den Staat überwinden? Warum wollen<br />
die <strong>Jusos</strong> ihn dann stärken?<br />
Die „herrschende Meinung“<br />
In der juristischen Literatur zur Staatstheorie<br />
wird der Staat meistens nach der<br />
von Georg Jellinek begründeten sog.<br />
„Drei-Elemente-Lehre“ definiert, nach der<br />
ein Staat durch die Kriterien Staatsgebiet,<br />
Staatsvolk und Staatsgewalt bestimmt<br />
wird. Zentrales Element ist dabei die<br />
Staatsgewalt, unter der eine Form organisierter,<br />
dauerhaft ausgeübter Herrschaft<br />
verstanden wird. 1 Die Gewalt ist es dann<br />
auch, die nach verbreiteter Sichtweise den<br />
Staat ausmacht. Wird nämlich danach gefragt,<br />
wie der Staat mit all seinen Gewaltund<br />
Zwangsmitteln (also Polizeiapparat,<br />
Gefängnisse usw.) gerechtfertigt wird, wird<br />
dies auch <strong>heute</strong> noch häufig auf der Basis<br />
des von Thomas Hobbes propagierten Gewaltmonopols<br />
des Staates beantwortet.<br />
Danach bestehe ohne den Staat ein „Naturzustand“,<br />
in dem alle Menschen nur<br />
egoistisch und rücksichtslos ihre Ziele<br />
durchsetzen wollen - also ein „Krieg aller<br />
gegen alle“. Dieser Zustand soll durch die<br />
Monopolisierung der Gewalt beim Staat -<br />
dem „Leviathan“ - überwunden werden.<br />
Nur der Staat hat das Recht zur Anwen-<br />
1 Schöbener/Knauff, Allgemeine Staatslehre, 2009,<br />
§ 3 Rdnr. 20.<br />
38
dung von Gewalt (Gewaltmonopol) und<br />
sichert auf diese Weise ein friedliches Zusammenleben.<br />
Dieser Grundgedanke prägt<br />
- trotz zahlreicher Weiterentwicklunge<br />
und Einschränkungen - im Kern bis <strong>heute</strong><br />
das juristische Verständnis vom Staat -<br />
welches nur eines von Verschiedenen sein<br />
kann. Das ist zunächst verständlich, weil in<br />
unserer Gesellschaft tatsächlich ein breiter<br />
Konsens darüber herrscht, dass private Gewalt<br />
grundsätzlich verboten sein soll und<br />
nur der Staat Zwangsmittel einsetzen darf.<br />
Doch diese Definition bleibt trotz eines<br />
richtigen Ansatzes zu verkürzt. Erstens<br />
gibt es begründete Zweifel an der Vorstellung<br />
eines Naturzustands der Gewalt.<br />
Neuere anthropologische und psychologische<br />
Forschungen weisen darauf hin, dass<br />
der sog. „Naturzustand“ eher von Kooperation<br />
und Zusammenhalt geprägt ist, während<br />
Gewalt immer nur die Folge von Ausgrenzung<br />
und Isolation ist. 2 Das macht<br />
deutlich, dass der Blick auf staatliche Institutionen<br />
gelenkt werden muss, die Gewalt<br />
und Ausgrenzung (re)produzieren. Das<br />
führt zweitens dazu, dass die normativ unterstellte<br />
„Friedlichkeit“ des Staates hinterfragt<br />
werden muss. Drittens unterstellt die<br />
Rechtfertigung des Staates über das Gewaltmonopol<br />
eine prinzipielle Gleichheit<br />
der Menschen. Tatsächlich unterscheiden<br />
sich die Menschen aber gravierend voneinander<br />
durch die materiellen Voraussetzungen,<br />
die ihnen zur Verfügung stehen. Zwischen<br />
den Menschen bestehen erhebliche<br />
Machtunterschiede. Der Staat verhindert<br />
durch das Gewaltmonopol möglicherweise<br />
- im Grundsatz - die private Anwendung<br />
von Gewalt, ändert aber nichts an Macht-,<br />
Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen.<br />
Dies spricht insofern nicht gegen das<br />
„Gewaltmonopol“ im Sinne eines empirischen<br />
Definitionsmerkmals, wohl aber dagegen,<br />
allein aufgrund des Gewaltmonopols<br />
dem Staat positive Eigenschaften zuzuschreiben.<br />
Materielle Betrachtung des Staates<br />
Was hat das alles mit marxistischer Staatstheorie<br />
zu tun? Es zeigt, warum es notwendig<br />
ist, den Staat kritisch zu hinterfragen.<br />
Wenn allein die Existenz des Gewaltmonopols<br />
den Staat rechtfertigen kann, dann<br />
sind polizeiliche Eingriffsbefugnisse, Gefängnisse<br />
und staatliche Überwachung aus<br />
sich selbst heraus gerechtfertigt. Ist es aber<br />
wirklich so, dass der Staat per se „gut“ ist?<br />
Genau dies hinterfragt marxistische<br />
Staatstheorie.<br />
Karl <strong>Marx</strong> hat selbst keine zusammenhängende<br />
Staatstheorie entwickelt. Bei der<br />
Analyse der kapitalistischen Produktionsweise<br />
hat er aber auch immer wieder Bezug<br />
auf den Staat genommen, aus dem die<br />
Grundzüge <strong>Marx</strong>’ Verständnisses des Staates<br />
gefolgert werden können. <strong>Marx</strong> interpretiert<br />
dabei ausdrücklich nur den kapitalistischen<br />
Staat, der durch die<br />
kapitalistische Produktionsweise geprägt<br />
ist. Vor der Industrialisierung war im Staat<br />
durch das sog. „Lehnswesen“ die politische<br />
und ökonomische Macht nicht getrennt.<br />
Über Lehen und „Frondienste“ 3 wurden<br />
sowohl die landwirtschaftliche Produktion<br />
als auch die politische Macht vermittelt.<br />
Mit dem Beginn der kapitalistischen Produktionsweise<br />
änderte sich dies grundlegend.<br />
4<br />
2 Vgl. Hierzu Bauer, Schmerzgrenze - Vom Ursprung<br />
alltäglicher und globaler Gewalt<br />
3 Persönliche Dienstleistungen von Bauern für ihre<br />
Grundherren (http://de.wikipedia.org/wiki/Frondienste).<br />
4 Hirsch, Materialistische Staatstheorie, 2005,<br />
S. 18 f.<br />
39
Staat als Notwendigkeit<br />
Kennzeichnend für die kapitalistische Produktionsweise<br />
ist das Ausbeutungsverhältnis<br />
zwischen Kapital und Arbeit. Die Ausbeutung<br />
besteht darin, dass sich<br />
Kapitaleigentümer den Mehrwert aneignen,<br />
den ArbeiterInnen durch ihre Arbeit<br />
produzieren. Diese haben mangels Kapital<br />
keine andere Wahl als ihre Arbeitskraft zu<br />
verkaufen. Nach <strong>Marx</strong> setzt dabei der Staat<br />
seine Gewaltmittel ein, „um den Arbeitstag<br />
zu verlängern und den Arbeiter selbst in<br />
normalem Abhängigkeitsgrad zu erhalten.“<br />
5 Der Staat verhindert also, dass sich<br />
die ArbeiterInnen das Eigentum an den<br />
von ihnen produzierten Gütern selbst aneignen.<br />
Dazu schafft er eine Eigentumsordnung,<br />
die er ggf. auch unter Einsatz von<br />
Gewalt (z.B. durch gewaltsame Zwangsvollstreckung)<br />
durchsetzt. Diese Eigentumsordnung<br />
ist deshalb - aus Sicht des<br />
Kapitals - notwendig, weil die kapitalistische<br />
Produktionsweise durch Konkurrenz<br />
funktioniert. Kapitalisten beuten ihre ArbeiterInnen<br />
nicht durch unmittelbare Gewaltanwendung<br />
als Leibeigene aus. Wenn<br />
die ArbeiterInnen aber gegenüber den Kapitalisten<br />
formal frei sind, dann bedarf es<br />
einer dritten Partei, die dafür sorgt, dass die<br />
produzierten Güter den Kapitalisten gehören<br />
- der Staat. Der Staat ist aber auch notwendig,<br />
weil die kapitalistische Produktionsweise<br />
eine Infrastruktur, z.B.<br />
Verkehrswege, Zahlungsmittel usw. erfordert.<br />
Für einen einzelnen Kapitalisten ist es<br />
unwirtschaftlich, diese Infrastruktur zu<br />
schaffen. So existieren formal freie Arbeits-<br />
und Austauschverhältnisse. Nach<br />
<strong>Marx</strong>’ Analyse ist es der Staat, der sicherstellt,<br />
dass sich trotzdem die Kapitalisten<br />
das Eigentum an produzierten Gütern aneignen<br />
können. Er sichert auf diese Weise<br />
den strukturellen Widerspruch zwischen<br />
Kapital und Arbeit ab. Infolgedessen steigt<br />
der Druck auf die Arbeitskräfte. Andreas<br />
Fisahn fasst dies so zusammen: „Die<br />
(Staats)-Gewalt schafft die materiellen Bedingungen<br />
der kapitalistischen Produktion<br />
wie die ideologischen und psychologischen,<br />
sie erzwingt die Disziplinierung der<br />
Arbeit unter die Regelmäßigkeiten der fabrikmäßigen<br />
Produktion.“ 6 Ebenso ist es<br />
Bedingung der kapitalistischen Produktionsweise,<br />
dass die ‘Spielregeln’ des Marktes<br />
eingehalten werden, also zum Beispiel Verträge<br />
auch erfüllt werden. Dass diese<br />
‘Spielregeln’, also der gesetzliche Rahmen<br />
für die Bedingungen des Marktes, eingehalten<br />
werden, ist nicht im Interesse des<br />
einzelnen Kapitalisten, der in ständiger<br />
Konkurrenz zu anderen Kapialisten steht.<br />
Es ist das Interesse der Kapital-Klasse als<br />
ganzes, die aber nicht selbstständig handlungsfähig<br />
ist. Sie braucht eine von ihr unabhängige<br />
Instanz (den Staat), die dafür<br />
sorgt, dass alle die ‘Spielregeln’ einhalten.<br />
Nach dieser Analyse ist der Staat eine Notwendigkeit<br />
zur Absicherung eines gesellschaftlichen<br />
Verhältnisses. Sie kann jedoch<br />
nicht erklären, warum der Staat dieses Verhältnis<br />
absichert.<br />
Staat als Instrument<br />
<strong>Marx</strong> sieht den Staat als Instrument der<br />
herrschenden Klasse. Die herrschende<br />
Klasse, also die Kapitaleigentümer, benötigen<br />
den Staat als neutrale Instanz. Deshalb<br />
schaffen sie diese neutrale Instanz und setzen<br />
ihn nach ihrem Belieben ein: „In dem<br />
Maß, wie der Fortschritt der modernen In-<br />
5 <strong>Marx</strong>, Das Kapital, in: <strong>Marx</strong> Engels Werke<br />
(MEW), Bd. 23, S. 766<br />
6 Fisahn, Herrschaft im Wandel, 2008, S. 95.<br />
40<br />
Staat: Herrschaft? Notwendigkeit? Instrument? Zur Staatstheorie <strong>Marx</strong>’ und marxistischer Staatstheorie <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
dustrie des Klassengegensatz zwischen Kapital<br />
und Arbeit entwickelte, erweiterte,<br />
vertiefte, in dem selben Maß erhielt die<br />
Staatsmacht mehr und mehr den Charakter<br />
einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung<br />
der Arbeiterklasse, einer Maschine<br />
der Klassenherrschaft.“ 7 Staatsgewalt<br />
wird bei <strong>Marx</strong> also ausschließlich<br />
als Mittel der Repression beschrieben. Diese<br />
Analyse erscheint vor dem Hintergrund<br />
der Realität im 19. Jahrhundert auch plausibel.<br />
Aus heutiger Perspektive ist aber die<br />
Ansicht, der Staat arbeite ausschließlich<br />
wie ein Instrument im Interesse der herrschenden<br />
Klasse, deutlich verkürzt. Dass in<br />
einer Demokratie zum Beispiel durchaus<br />
auch Lohnabhängige Einfluss auf die Gestaltung<br />
der Politik haben, kann kaum bestritten<br />
werden. Zudem gibt es zwar - auch<br />
<strong>heute</strong> - zahlreiche repressive Instrumente,<br />
die Herrschaft sichern, der Staat ist jedoch<br />
keinesfalls auf diese Funktion beschränkt. 8<br />
Zudem erscheint es zweifelhaft, den Staat<br />
als Maschine anzusehen und ihm damit<br />
eine Willenlosigkeit zu unterstellen. Vielmehr<br />
zeigt sich immer wieder, dass der<br />
Staat auch durchaus einen ‘eigenen Willen’<br />
entwickelt, also eine Politik im Eigeninteresse,<br />
zum eigenen Machterhalt oder -ausbau<br />
erfolgt. Ausgehend von <strong>Marx</strong>’ Kritik<br />
des Staates haben verschiedene AutorInnen<br />
die Analyse des Staates deshalb weiterentwickelt.<br />
Staat als Kräfteverhältnis<br />
So wendet sich Nicos Poulantzas gegen<br />
die Vorstellung vom Staat als Instrument.<br />
Er sieht den Staat als Organisator eines<br />
Kompromisses zwischen Herrschenden<br />
und Beherrschten: „Der Staat organisiert<br />
und reproduziert die Klassenhegemonie,<br />
indem er einen variablen Kompromißbereich<br />
zwischen herrschenden und beherrschenden<br />
Klassen absteckt, und dabei den<br />
herrschenden Klassen häufig sogar gewisse<br />
kurzfristige materielle Opfer aufzwingt,<br />
um langfristig die Reproduktion ihrer<br />
Herrschaft zu sichern.“ 9 Der Staat sichert<br />
danach durch sozialpolitische Maßnahmen<br />
die Reproduktion der Arbeitskraft ab.<br />
Auch Poulantzas unterscheidet damit auf<br />
Seiten der Kapitalisten zwischen kurzfristigen<br />
Individual- und langfristigen Klasseninteressen<br />
und weist zudem darauf hin,<br />
dass der Staat auch bestimmte Aufgaben<br />
übernimmt, die für einzelne Kapitalisten<br />
zu risikoreich oder mit zu hohen Investitionskosten<br />
verbunden wären. Erst dadurch<br />
(zum Beispiel durch die Organisation der<br />
Energieversorgung) werde die kapitalistische<br />
Produktionsweise vollständig gesichert.<br />
Da er damit also auch gegen die<br />
kurzfristigen Interessen einzelner Kapitalisten<br />
agieren müsse, bedürfe er einer relativen<br />
Autonomie gegenüber diesen Einzelinteressen.<br />
10 Deshalb kann er also gerade<br />
nicht als Instrument betrachtet werden.<br />
Die Autonomie bleibt aber relativ, weil<br />
Kompromisse nur soweit möglich sind, wie<br />
die Interessen der Kapitalklasse noch gewahrt<br />
werden. Der Staat organisiert nach<br />
Poulantzas folglich durch die Schaffung<br />
von Recht und dessen Durchsetzung die<br />
unterschiedlichen Interessen der einzelnen<br />
Kapitalisten. Gleichzeitig schwächt er die<br />
Mitglieder der beherrschten Klassen. Materielle<br />
Zugeständnisse gegenüber der ArbeiterInnen-Klasse<br />
verstärken diesen Prozess,<br />
der schließlich zu einer Normali-<br />
7 <strong>Marx</strong>, Der Bürgerkrieg in Frankreich, in: MEW,<br />
Bd. 17, S. 336<br />
8 Siehe hierzu auch näher Fisahn, Herrschaft im<br />
Wandel, 2008, S. 101 f..<br />
9 Poulantzas, Staatstheorie, 1978, S. 170.<br />
10 Poulantzas, Staatstheorie, 1978, S. 167 ff.<br />
41
sierung und zu bewusster oder unbewusster<br />
Akzeptanz führt. Ebenfalls fördert nach<br />
dieser Sichtweise der Staat durch das von<br />
ihm organisierte Bildungssystem unterschiedliche<br />
Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte,<br />
was ebenfalls zu einer Isolierung<br />
und zu weiteren Interessensgegensätzen<br />
innerhalb der ArbeiterInnen-<br />
Klasse führt. <strong>11</strong><br />
Damit müssen wir aber wieder zur<br />
Ausgangsfrage zurückkommen: Warum sichert<br />
der Staat gerade die Interessen der<br />
herrschenden Klassen ab? Wer den ökonomischen<br />
Produktionsprozess dominiert,<br />
indem er über die Ressourcen, die Arbeitskraft,<br />
die produzierten Gütern und letztlich<br />
den Profit verfügt, hat mehr finanzielle<br />
Ressourcen und mehr Macht. Die<br />
Hierarchie innerhalb staatlicher Strukturen<br />
bewirkt, dass die Besetzung weniger<br />
Posten an der Spitze einen relativ großen<br />
Einfluss bewirkt. Zudem können staatliche<br />
Akteure, also die politischen und exekutiven<br />
Spitzen der Verwaltung, ihr Personal<br />
weitgehend selbstständig, also ohne etwa<br />
den Einfluss des Parlaments, auswählen. So<br />
können sie bewirken, dass die einflussreichen<br />
Positionen von denjenigen besetzt<br />
werden, die die bestehenden Kräfteverhältnisse<br />
nicht grundsätzlich in Frage stellen.<br />
Die Kräfte verfügen über unterschiedliche<br />
Machtpotentiale, die Strukturen reproduzieren<br />
sich dabei immer wieder neu, sodass<br />
Verhältnisse tendenziell fortgeschrieben<br />
werden - aber eben nicht unverändert. Abhängig<br />
von der Organisationsform der<br />
Herrschaft können sie damit relativ mehr<br />
Einfluss auf den - im Prinzip autonomen -<br />
Staat ausüben als die beherrschte ArbeiterInnen-Klasse.<br />
Diese sind aber nicht völlig<br />
ohne Einfluss, insbesondere nicht in der<br />
Staatsform der Demokratie. Auf diese<br />
Weise entstehen auch innerhalb des staatlichen<br />
Apparats Interessengegensätze. Zwischen<br />
den spezialisierten Zweigen des<br />
Staatsapparats, aber auch innerhalb jeder<br />
staatlichen Einheit bestehen widersprüchliche<br />
Interessen. In diesem Sinne bezeichnet<br />
Poulantzas den Staat „[...] als die materielle<br />
Verdichtung eines Kräfteverhältnisses<br />
zwischen Klassen und Klassenfraktionen,<br />
das sich im Staat immer in spezifischer<br />
Form ausdrückt.“ 12 Auf welche<br />
Weise ein Ausgleich zwischen den Interessengegensätzen<br />
vorgenommen wird, hängt<br />
dann von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen<br />
ab.<br />
Kräfteverhältnis im Staat<br />
Skepsis gegenüber dem Staat ist also berechtigt.<br />
Aber gerade die Politik eröffnet<br />
Einflussmöglichkeiten für die Gesellschaft.<br />
Hier können - in einer Demokratie<br />
- auch andere Interessen als die des Kapitals<br />
vertreten werden. Der Staat ist also<br />
nicht unabhängig und verselbstständigt<br />
sich von der Gesellschaft. Vielmehr nehmen<br />
Politik und Ökonomie nicht nur<br />
wechselseitig aufeinander Einfluss, sie sind<br />
sogar strukturell verwoben. So werden beispielsweise<br />
die ökonomischen Verhältnisse<br />
durch politische Festlegungen determiniert<br />
(Stichwort: Eigentumsordnung). Gewissermaßen<br />
prägen sich Staat und Ökonomie<br />
dadurch gegenseitig..<br />
Hier konnten nun nicht ansatzweise<br />
alle relevanten Facetten der marxistisch geprägten<br />
Staatstheoriediskussion skizziert<br />
werden. Hierfür muss auf die weiterführende<br />
Literatur verwiesen werden. Es kann<br />
<strong>11</strong> Hirsch, Der Sicherheitsstaat, 1986, S. 81.<br />
12 Poulantzas, Staatstheorie, 1978, S. <strong>11</strong>9.<br />
42<br />
Staat: Herrschaft? Notwendigkeit? Instrument? Zur Staatstheorie <strong>Marx</strong>’ und marxistischer Staatstheorie <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
aber nun die Frage beantwortet werden, inwiefern<br />
eine marxistische Kritik des Staates<br />
mit den Forderungen nach einer Stärkung<br />
des Staates zusammenpassen. Der<br />
Staat organisiert Herrschaft und sichert<br />
gesellschaftliche Unterschiede ab. Diese<br />
Funktion des Staates wird deshalb auch<br />
von neoliberaler Seite nicht in Frage gestellt.<br />
Der Staat soll - bitteschön - durchaus<br />
dafür Sorgen, dass Kapital im Eigentum<br />
der Kapitalisten bleibt, dass Schuldner ihren<br />
Zahlungsverpflichtungen nachkommen<br />
usw. Abgebaut werden soll nur, was<br />
nicht dem Kapital, sondern den Menschen<br />
dient. Sozialversicherungen, öffentliche<br />
Daseinsvorsorge, ein öffentliches Bildungssystem<br />
u.v.a.m. sind Errungenschaften,<br />
die den Menschen dienen. Wenn also<br />
über „Sozialabbau“ oder „Privatisierungen“<br />
gestritten wird, dann geht es Verschiebungen<br />
im Kräfteverhältnis des Staates. Es<br />
lohnt sich also, um solche Verschiebungen<br />
zu kämpfen. l<br />
Verwendete, zugleich empfohlene Literatur:<br />
Schöbener/Knauff, Allgemeine Staatslehre, 2009<br />
Bauer, Schmerzgrenze - Vom Ursprung alltäglicher<br />
und globaler Gewalt, 20<strong>11</strong><br />
Hirsch, Materialistische Staatstheorie, 2005<br />
Fisahn, Herrschaft im Wandel, 2008<br />
Poulantzas, Staatstheorie, 1978 und<br />
<strong>Marx</strong>-Engels-Werke.<br />
43
DER WERT DES WERTS<br />
Von Björn Brennecke<br />
Die Aktualität einer politischen Theorie<br />
bemisst sich nach der Fähigkeit<br />
dieser Theorie, Funktionsmechanismen<br />
der Gesellschaft zu erklären und<br />
somit „soziales Handeln deutend verstehen<br />
und dadurch in seinem Ablauf<br />
und seinen Wirkungen ursächlich erklären“<br />
1 zu können. Dabei sollte sich<br />
jede Theorie des Umstandes bewusst<br />
sein, dass sie Funktionsweisen beschreibt,<br />
indem sie Strukturen und<br />
Mechanismen der Gesellschaft operationalisierbar<br />
und dadurch verständlich<br />
macht, um Tiefenstrukturen der<br />
Gesellschaft zu erklären und nicht um<br />
nur ein Abbild der Realität zu schaffen.<br />
Diese Abbildung der Realität könnte<br />
nur erklären, was direkt an der Oberfläche<br />
erscheint und direkt sichtbar ist.<br />
Aufgabe von Gesellschaftstheorie ist<br />
es hingegen, zu erklären, wie die Erscheinung<br />
an der Oberfläche entstanden<br />
ist und in welchem Verhältnis sie<br />
zur Gesellschaft steht.<br />
It’s the economy, stupid!<br />
Die Krise wohlfahrtsstaatlicher Gesellschaftskonzepte<br />
seit den 1990er Jahren hat<br />
- wieder einmal - deutlich gemacht, wie<br />
sehr die Ökonomie unser Leben beeinflusst<br />
und die Gesellschaft beherrscht.<br />
Zwei Jahrzehnte hindurch war der Neoliberalismus<br />
mit seinen Glaubensdogmen<br />
Privatisierung und Deregulierung die einflussreichste<br />
politische Theorie, der nur<br />
Ewiggestrige widersprochen haben, die die<br />
Zeichen der Zeit nicht verstehen wollten.<br />
Mit dem Ende der Geschichte und dem<br />
Sieg des Kapitalismus sollte die Armut von<br />
der Bildfläche der Welt verschwinden und<br />
ein neues Zeitalter anbrechen. Der Kapitalismus<br />
hat - genau wie die liberalen Theoretiker<br />
seit zwei Jahrhunderten versprochen<br />
haben - unvorstellbare Mengen an<br />
Reichtum produziert. Inmitten dieses<br />
Reichtums ist die Armut jedoch geblieben;<br />
sie hat sich sogar ausgeweitet. Der Neoliberalismus<br />
hat stets ein zu viel an staatlicher<br />
Regulierung dafür verantwortlich gemacht.<br />
Auch die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise<br />
wird den Chor der Neoliberalen<br />
nicht verstummen lassen, die immer noch<br />
Privatisierung und Deregulierung fordern.<br />
Die Glaubwürdigkeit dieser Apologeten<br />
des freien Marktes mag - zusammen mit<br />
dem Wert griechischer Staatsanleihen -<br />
dahingeschmolzen sein; an der politischen<br />
und gesellschaftlichen Praxis hat sich<br />
nichts geändert. Die Finanzkrise zeigt nur<br />
um so deutlicher die Abhängigkeit ganzer<br />
Staaten von den Transaktionen an den Finanzmärkten.<br />
Die Folge ist, dass - wie aktuell<br />
in Griechenland - allein die Ankündigung<br />
von Volksabstimmungen von „den<br />
Märkten“ derart abgestraft wird, dass man<br />
sich fragen kann, ob sich unsere Marktwirtschaft<br />
die Demokratie noch leisten<br />
kann.<br />
1 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen<br />
1922, S. 1.<br />
44
Auf der anderen Seite fürchten sich<br />
ganze Konzerne davor, die Konsumenten<br />
könnten realisieren, unter welchen Bedingungen<br />
die Waren produziert wurden, mit<br />
denen sich der postpolitische Mensch seine<br />
Identität zusammenkauft. Die Kunden<br />
würden sich angewidert der Konkurrenz<br />
zuwenden. Schnell wird in so einem Fall<br />
der politisch korrekte Starbucks-Kaffee geboren,<br />
von dessen Kaufpreis ein geringer<br />
Betrag dafür abgezweigt wird, die Folgen<br />
ausufernden, kapitalistischen Wirtschaftens<br />
zu beseitigen. Selbstverständlich ist jeder<br />
Cent, den Kaffeebäuerinnen und Kaffebauern<br />
zusätzlich einnehmen, zu<br />
begrüßen. Niemand sollte aber glauben,<br />
damit würde sich irgendetwas substantiell<br />
ändern. Mit marktwirtschaftlichen Mitteln<br />
können die Folgen der Marktwirtschaft<br />
nicht ausgeglichen, mit Bio-Bananen das<br />
Klima nicht gerettet, mit dem Belzebub<br />
der Teufel nicht ausgetrieben werden. Einen<br />
Kapitalismus mit menschlichem Antlitz<br />
wird es nicht geben - auch wenn versucht<br />
wird, die Menschlichkeit in die<br />
Verpackung der Ware zu integrieren.<br />
Zurück zu <strong>Marx</strong><br />
Alle diese Beschreibungen - so zutreffend<br />
sie sein mögen - begnügen sich jedoch damit,<br />
an der Oberfläche zu kratzen. Sie stellen<br />
fest, dass die Ökonomie unser Leben<br />
beeinflusst, sagen jedoch nicht warum. Sie<br />
stellen fest, dass wirtschaftliche Erwägungen<br />
wichtiger erscheinen als demokratische<br />
Entscheidungsprozesse, sagen jedoch<br />
nicht, wie es dazu kommen kann. Dabei ist<br />
eigentlich klar, dass der Reichtum - genau<br />
wie die Armut, die Ungerechtigkeit und<br />
die Krisen - bevor er überhaupt privat angeeignet<br />
werden kann, vorher gesellschaftlich<br />
produziert werden muss.<br />
Um diesen Schleier zu lüften, gilt es<br />
hinab zu steigen in den gesellschaftlichen<br />
Keller der Produktion, indem uns die von<br />
John Locke und William Petty entdeckte,<br />
von Adam Smith und David Ricardo formulierte<br />
und von Karl <strong>Marx</strong> zum zentralen<br />
Analyseinstrument verfeinerte und weiterentwickelte<br />
Arbeitswerttheorie erwartet. 2<br />
Erst hiermit ist es möglich, die Arbeit und<br />
die Produktion in den Mittelpunkt der<br />
Analyse und Kritik zu stellen und die Tiefenstrukturen<br />
kapitalistischer Herrschaft<br />
zu entwirren.<br />
Die Kritik an der marxistischen Werttheorie<br />
- dass Marktpreise letztlich durch<br />
Arbeitswerte bestimmt werden - besteht<br />
wiederum darin, die Werttheorie sei an der<br />
Realität nicht überprüfbar. Diese Kritik hat<br />
sich an der Umwandlung der von <strong>Marx</strong><br />
verwendeten „Werte“, die sich über die gesellschaftlich<br />
notwendige Arbeitszeit begründen,<br />
in „Preise“, die am Markt gehandelt<br />
werden, entzündet. <strong>Marx</strong> selbst hat im<br />
Kapital versucht, diese Wert-Preis-Transformation<br />
zu errechnen, konnte dies jedoch<br />
nicht erfolgreich zu Ende führen. Auf diesen<br />
Umstand kann man nun auf vier Wegen<br />
reagieren.<br />
Zentralität des Marktes<br />
Erstens kann man sich dogmatisch an den<br />
Wortlaut der marxschen Texte klammern<br />
und die Differenzen bei einer Transformation<br />
der Werte in Preise - genau wie die<br />
neoliberale Theorie - mit marktverzerrenden<br />
Effekten und komplizierten gesellschaftlichen<br />
Strukturen erklären, um so die<br />
2 Die Arbeitswerttheorie soll hier nicht im Einzelnen<br />
erklärt werden. Eine Suche bei Wikipedia<br />
sollte jeder/jedem Interessierten genug Material<br />
zum nach- und weiterlesen bringen.<br />
45
marxsche Theorie zu retten, obwohl sie einer<br />
Überprüfung an der Realität nicht<br />
stand hält. Dieser Weg würde jedoch der<br />
von <strong>Marx</strong> selbst aufgestellten Definition<br />
von Ideologie entsprechen - der eines notwendig<br />
falschen Bewusstseins. Gibt man<br />
den Wertbegriff hingegen auf, so bleibt die<br />
Bedeutung der Arbeit in der marxschen<br />
Analyse zwar anscheinend ein zentrales<br />
Element, weil die Arbeit die gesellschaftliche<br />
Welt konstituiert und die Quelle allen<br />
Reichtums bleibt, als zentraler Anknüpfungspunkt<br />
für Kritik wird sie allerdings<br />
aufgegeben. Kritisiert werden dann noch<br />
die konkrete Ausgestaltung der Arbeit -<br />
die Ausbeutung - und die private Aneignung<br />
des erwirtschafteten Gewinns - die<br />
Verteilung des Reichtums. Eine derartige<br />
Kritik, die sich auf moralische Kategorien<br />
(ungerechte Ausbeutung) oder reine Verteilungsfragen<br />
(private Aneignung gesellschaftlich<br />
erwirtschafteten Gewinns) begrenzt,<br />
kann wiederum die Tiefenstrukturen<br />
kapitalistischer Herrschaft nicht mehr<br />
erfassen und muss sich auf das Konstatieren<br />
von Ungerechtigkeiten beschränken.<br />
Ging es den liberalen Klassikern noch<br />
darum, die Ursachen der Wertschöpfung<br />
und Kapitalakkumulation zu erklären, um<br />
die Vorteile kapitalistischer gegenüber feudaler<br />
Produktionsweise darzustellen, ändert<br />
sich dieses Paradigma in den Neoklassischen<br />
Darstellungen. Der Bezugspunkt<br />
der Theorie wandelt sich von der Produktionsspähre<br />
und einer daraus folgenden objektiv<br />
orientierten Arbeitswerttheorie hin<br />
zur Zirkulationssphäre als Bezugspunkt<br />
und einer am subjektiven Nutzen orientierten<br />
Theorie der Preisbildung. Ging es den<br />
Klassikern darum, progressiv die Vorteile<br />
bürgerlicher Gesellschaften gegenüber feudalen<br />
Strukturen darzustellen, geht es der<br />
konservativen Neoklassik um die Verteidigung<br />
der bürgerlichen Gesellschaft gegen<br />
die Macht und Einfluss gewinnende organisierte<br />
Arbeiterbewegung. Für die Neoricardianer<br />
3 hingegen ist die Verwendung<br />
gesellschaftlich bestimmter Werte ein unnötiger<br />
Umweg. Sie gehen direkt von den<br />
Produktionspreisen aus, um das Transformationsproblem<br />
zu umgehen, die Produktion<br />
des Profits nachzuvollziehen und die<br />
marxistische Werttheorie samt aller normativen,<br />
gesellschaftskritischen Implikationen<br />
somit für überflüssig zu erklären.<br />
Diesen zweiten Weg sind weite Teile der<br />
Wissenschaft und Politik gegangen.<br />
Zentralität der Arbeit<br />
Nils Fröhlich 4 hingegen geht, als Reaktion<br />
auf die Neoricardianer und zur Kritik derselben,<br />
nicht von der Frage aus, ob man aus<br />
den Werten die Preise ableiten kann. Er<br />
geht den umgekehrten Weg. Hierbei wird<br />
die Werttheorie in aktualisierter Fassung<br />
auf konkretes statistisches Material angewendet,<br />
um zu sehen, ob sich ein signifikanter<br />
Unterschied zu den Ergebnissen der<br />
Neoricardianer ergibt, die mit Produktionspreisen<br />
rechnen. Somit soll geklärt werden,<br />
welche Relevanz das theoretische<br />
Transformationsproblem empirisch überhaupt<br />
hat. Fröhlich weist nach, dass der<br />
Unterschied im Ergebnis vernachlässigbar<br />
ist. Geht es also nur um das Errechnen der<br />
wirtschaftlichen Vorgänge, kommen beide<br />
Theorien zu einem vergleichbaren Ergebnis.<br />
Die Arbeitswerttheorie ist aber - wie<br />
Fröhlich nachweist - weniger komplex und<br />
3 Eine Übersicht zu diesem Ansatz findet sich bei<br />
H.D. Kurz und N. Salvadori, Theory of Production,<br />
Cambridge 1997.<br />
4 Nils Fröhlich, Die Aktualität der Arbeitswerttheorie,<br />
Theoretische und empirische Aspekte,<br />
Marburg 2009.<br />
46<br />
Der Wert des Werts <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
leichter zu berechnen. Die Beschränktheit<br />
unpolitischer Ökonomie kann somit einerseits<br />
empirisch überwunden werden; andererseits<br />
können mit einer kritischen Gesellschaftstheorie<br />
weiterhin gesamtgesellschaftliche<br />
Strukturen in den Blick<br />
genommen werden. Der Anspruch, den<br />
<strong>Marx</strong> schon in seinen berühmten Thesen<br />
über Feuerbach formuliert hat, die Welt<br />
nicht nur zu erklären sondern sie zu verändern,<br />
kann nur eine kritische Theorie der<br />
Gesellschaft aufrechterhalten.<br />
Zur Darstellung der vierten Variante<br />
soll hier die Neuinterpretation der<br />
marxschen Theorie von Moishe Postone<br />
herangezogen werden. Postone geht vom<br />
marxschen Spätwerk aus und beschreibt<br />
den <strong>Marx</strong>ismus als eine Kritik der Arbeit<br />
im Kapitalismus. 5 Entscheidend für Postone<br />
ist der Doppelcharakter der warenproduzierenden<br />
Arbeit - die Unterscheidung<br />
zwischen konkreter Arbeit, die stofflichen<br />
Reichtum produziert und abstrakter Arbeit,<br />
die Wert produziert. Konkrete, stofflichen<br />
Reichtum produzierende Arbeit kann<br />
gemessen und errechnet werden. Abstrakte<br />
Arbeit hingegen bezieht sich auf die gesellschaftlich<br />
notwendige Arbeitszeit und beschreibt<br />
die Abhängigkeit des Individuums<br />
von gesellschaftlichen Verhältnissen - von<br />
der Tiefenstruktur des Kapitalismus. Die<br />
Bestimmung des Werts soll demnach explizit<br />
keine empirische Kategorie sein, sondern<br />
ein gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis<br />
ausdrücken. Das Problem einer<br />
mathematischen Transformation der Werte<br />
in Preise stellt sich somit für Postone nicht<br />
mehr.<br />
In den bürgerlichen Revolutionen ist es<br />
den Menschen gelungen, sich verbriefte<br />
Rechte gegenüber dem Staat zu sichern<br />
und eine Gemeinschaft politisch gleicher<br />
und freier Menschen zu schaffen - einen<br />
Staat, der relativ frei von direkten, persönlichen<br />
Herrschaftsverhältnissen ist. Dieser<br />
Freiheit auf der einen Seite, steht auf der<br />
anderen Seite die Herrschaft durch gesellschaftliche<br />
Verhältnisse gegenüber. Diese<br />
Herrschaft zeigt sich in der wertproduzierenden<br />
abstrakten Arbeit. Die Rolle der<br />
Arbeit im Kapitalismus stellt hier eine historisch<br />
spezifische Form abstrakter Herrschaft<br />
dar, die es nicht nur zu analysieren,<br />
sondern vor allem zu kritisieren gilt. Postone<br />
geht es also um eine Analyse der gesellschaftlichen<br />
Herrschaft durch eine Kritik<br />
der wertproduzierenden abstrakten Arbeit.<br />
Der Markt ist dabei nur das Mittel, um die<br />
produzierten Werte zu realisieren, weil ein<br />
Produkt selbstverständlich verkauft werden<br />
muss, um Profit zu bringen. Die Werttheorie<br />
ist das Mittel, um diese Oberfläche zu<br />
durchdringen und die darunter verborgene<br />
Herrschaftsstruktur offen zu legen. Die<br />
entscheidende Erkenntnis an dieser Kritik<br />
der Arbeit im Kapitalismus ist - gegenüber<br />
einer Kritik, die sich bloß auf den Standpunkt<br />
der Arbeit stellt und die Arbeit<br />
selbst von der Kritik ausnimmt -, dass<br />
Herrschaft im Kapitalismus strukturell<br />
vermittelt wird.<br />
Ein <strong>Marx</strong>ismus ohne Klassentheorie ist<br />
denkbar, teilweise sogar nötig, um die sehr<br />
grobe Einteilung in Klassen zu differenzieren<br />
und die Probleme der modernen Welt<br />
analysieren und erfassen zu können. Ein<br />
<strong>Marx</strong>ismus ohne Werttheorie hingegen<br />
beraubt den <strong>Marx</strong>ismus seiner schärfsten<br />
Klinge und dient allein denjenigen als Beruhigungspille,<br />
die ihre Augen verschlossen<br />
halten wollen, um sich gemütlich im kapitalistischen<br />
System einzurichten. l<br />
5 Moishe Postone, Zeit, Arbeit und gesellschaftliche<br />
Herrschaft, Eine neue Interpretation der kritischen<br />
Theorie von <strong>Marx</strong>, Freiburg 2003.<br />
47
DIE WEITERENTWICK-<br />
LUNG ZUM KAPITAL 1<br />
Von Tobias Gombert<br />
I. Kernpunkte des Kapitals<br />
(MEW 23-25)<br />
Das bekannteste und wohl auch wirksamste<br />
Werk von <strong>Marx</strong> ist weiterhin<br />
das Kapital, das in den Jahren 1867ff.<br />
erstmalig erschienen ist. Es ist eine kritische<br />
Auseinandersetzung mit den<br />
existierenden zeitgenössischen ökonomischen<br />
Theorien, wie sie sich aus<br />
der buürgerlichen Philosophie ergeben<br />
haben. Ich habe mich in diesem<br />
Teil zum Kapital entschlossen, nur einen<br />
kleinen Ausschnitt zu behandeln:<br />
Die historische Herleitung des Kapitals<br />
soll in diesem Skript vernachlässigt<br />
werden. Es geht hier lediglich darum,<br />
einen groben Überblick über die generelle<br />
Systematik und Argumentationslinien<br />
zu geben und vor allem die<br />
Grundzüge des Produktionsprozesses<br />
in den Vordergrund zu stellen. Die<br />
Lektüre des Originals, die sich immer<br />
lohnt, soll dadurch ein wenig erleichtert<br />
werden. Also keine abschließende<br />
Zusammenfassung, sondern eine Hilfe,<br />
in die Lektüre des Originals einzusteigen.<br />
Schon der Titel des 3-bändigen Werkes<br />
spricht Bände: Das Kapital. Kritik der politischen<br />
Ökonomie.<br />
Das Kapital: Es handelt sich um eine<br />
Abhandlung, die nicht generell alle<br />
Wirtschaftsformen klären will, sondern<br />
historisch an einer geschichtlichen Formation<br />
ansetzt, nämlich dem damals<br />
zeitgenössischen Kapitalismus. Ohne<br />
bereits näher auf die <strong>Marx</strong>sche Theorie<br />
einzugehen, könnte man Kapital als das<br />
bezeichnen, was man für die Produktion<br />
von Waren einsetzt und was durch<br />
den Produktions- und Distributions-<br />
/Zirkulationsprozess vergrößert werden<br />
soll. Dieses Kapital scheint die charakteristische<br />
Kategorie dieser Zeit zu<br />
sein.<br />
Ökonomie: Das Wort kommt aus dem<br />
Griechischen und setzt sich aus dem<br />
Wort für »Haus« (oikos) und »Gesetz /<br />
Wort« (nomos) zusammen. Im weitesten<br />
Sinne umfasst es die gesamte Lebenserhaltung<br />
und Form, wie gelebt,<br />
1 Der Text ist ein Nachdruck der Kapitel 5 und 6<br />
aus „Einstieg in die marxistische Denkweise“ von<br />
Tobias Gombert / Juso-Landesverband NRW,<br />
2005<br />
48
gearbeitet und gewirtschaftet wird und<br />
nach welchen »Gesetzen« dies geschieht.<br />
Anders als in unserem heutigen<br />
modernen Denken kann es sich dabei<br />
durchaus um Naturgesetze handeln, das<br />
heißt Regeln, die göttlich oder durch<br />
die Natur festgelegt seien. Drei wesentliche<br />
Aspekte menschlicher Existenz<br />
sind damit aber ebenfalls genannt: Naturaneignung,<br />
Arbeit und Herrschaft.<br />
Der herausragende Theoretiker dieser<br />
»Hauswirtschaft«, die zugleich auf den<br />
Staat als »große Hauswirtschaft«, übertragen<br />
wurde, war in der griechischen Antike<br />
Aristoteles: »Nachdem nun klar geworden<br />
ist, aus welchen Teilen der Staat besteht,<br />
müssen wir nächst über die Hausverwaltung<br />
(oikonomía) sprechen, denn die Häuser<br />
(oikía) sind ja eben jene Bestandteile<br />
des Staates.« (Aristoteles 1994: 48) In der<br />
Folge beschreibt er, dass das Verhältnis von<br />
Herr und Sklave ein »natürliches« Herrschaftsverhältnis<br />
sei, wenn die Versklavung<br />
in einem »gerechten Krieg« zustande gekommen<br />
sei und der Sklave dann nicht<br />
mehr als ein »lebendiges Werkzeug« sei.<br />
Solche »natürlichen Begründungen« für<br />
Herrschaftsverhältnisse und wirtschaftliche<br />
Ausbeutung waren zwar schon in der<br />
griechischen Antik nicht unumstritten, haben<br />
aber in der Folgezeit gewirkt.<br />
Politische Ökonomie: Erst der Zusatz,<br />
dass es sich um eine politische Ökonomie<br />
handele, macht deutlich, dass es um<br />
die gesellschaftliche Organisationsform<br />
des Zusammenlebens geht und eben<br />
nicht um eine einmal vorgegebene<br />
göttliche oder natürliche Ordnung. Zudem<br />
wird der Gegenstandsbereich ausgeweitet:<br />
Während die Hausgemeinschaft<br />
letztendlich eine »Familienwirtschaft«<br />
darstellt, wird diese nun auf die<br />
»große Gemeinschaft« übertragen. Es<br />
wird somit zunächst unterstellt, dass die<br />
Gesellschaft nichts anderes sei als eine<br />
große Familie. Und genau diese Argumentation<br />
haben viele bürgerliche Geschichtsphilosophen<br />
in unterschiedlichen<br />
Formen vertreten. Vor allem unter<br />
den liberalen Philosophen des 18. Jahrhunderts<br />
war diese Argumentationsweise<br />
durchaus verbreitet.<br />
Kritik der politischen Ökonomie: In<br />
der <strong>Marx</strong>schen Interpretation kann es<br />
offensichtlich um diese Form der Lebens-<br />
und Wirtschaftstheorie nicht gehen,<br />
aber sie muss sie dennoch ernst<br />
nehmen und ihr argumentativ etwas<br />
entgegensetzen. Eine einfache Ablehnung<br />
reicht offensichtlich nicht aus,<br />
sondern erst eine dialektische Arbeitsweise,<br />
die liberale Theorie »von dem<br />
Kopf auf die Füße stellt«, kann eine<br />
neue Theorie begründen. <strong>Marx</strong> und<br />
Engels haben dann auch - wie kaum<br />
Wissenschaftler vor ihnen (und wohl<br />
auch nach ihnen) - die Theorien des 18.<br />
und 19. Jahrhunderts gekannt und argumentativ<br />
»gegengehalten«.<br />
A) Der ungewöhnliche Ausgangspunkt:<br />
Der erste Satz des Kapitals<br />
»Der Reichtum der Gesellschaften, in<br />
welchen kapitalistische Produktionsweise<br />
herrscht,<br />
erscheint als eine »ungeheure Warensammlung«,<br />
die einzelne Ware als seine<br />
Elementarform«<br />
(<strong>Marx</strong>/Engels 1998: 49)<br />
<strong>Marx</strong> beginnt ungewöhnlich. Nicht etwa<br />
die Ausbeutung, Not und Elend der Arbei-<br />
49
terinnen, der Arbeiter und ihrer Kinder,<br />
nicht die Beschreibung von Fabriken oder<br />
Bergwerken, von Heizöfen oder Dampfloks,<br />
Werften oder Landwirtschaft sind das<br />
erste Thema und der Ausgangspunkt für<br />
die ökonomische Analyse. Er beginnt mit<br />
etwas, was man für selbstverständlich oder<br />
nebensächlich halten mag: Mit der Ware.<br />
Dabei muss man sich klar machen, dass der<br />
erste Band des Kapitals zu keinem Zeitpunkt<br />
geschrieben worden ist, wo die »ungeheure<br />
Warensammlung« für alle fassbar<br />
gewesen wäre. Heute gehen wir in den Supermarkt<br />
um die Ecke und können einen<br />
verschwindend kleinen Teil dieser ungeheuren<br />
Warensammlung in Augenschein<br />
nehmen. 1867 hingegen war die Lebensrealität<br />
der meisten Menschen zwar von<br />
der ungeheuren Warensammlung mittelbar<br />
bestimmt und gleichzeitig waren die meisten<br />
Menschen von ihr ausgeschlossen.<br />
Dennoch gibt <strong>Marx</strong> eine wesentliche<br />
Stimmung der gesellschaftlichen Prosperität<br />
(Wohlstand; 86 wirtschaftlicher Aufschwung)<br />
wieder: »Die ökonomische Signatur<br />
der zweieinhalb Jahrzehnte<br />
zwischen 1850 und 1873/75 ist eindeutig<br />
zu erkennen: Alle Zeichen standen auf<br />
Hochkonjunktur. Das trifft einmal auf die<br />
Agrarwirtschaft zu, die von 1848 bis 1875<br />
die zweite Phase ihrer »Goldenen Jahre«<br />
seit 1826 durchlief. [...] Das positive Urteil<br />
gilt, zum zweiten, für die Industriewirtschaft,<br />
die - von nur einer ernsthaften Krise<br />
kurz unterbrochen - dank der Hochkonjunktur<br />
der deutschen Industriellen<br />
Revolution einen beispiellosen Aufschwung<br />
erfuhr.« (Wehler 1995: 38) Der<br />
Agrarkapitalismus und die Industrielle Revolution<br />
schienen einen immensen Fortschritt,<br />
einen gesellschaftlichen Reichtum<br />
zu produzieren, der unermesslich und auch<br />
ungefährdet schien. Insofern fängt <strong>Marx</strong><br />
eine Stimmung ein, die sich in den Folgejahren<br />
noch weiter verstärken sollte, erliegt<br />
ihr aber nicht. Denn <strong>Marx</strong> benennt schon<br />
im ersten Band des Kapitals die Krisenhaftigkeit<br />
des Kapitalismus. Und tatsächlich<br />
folgte die Krise auf den Fuß: »Aus dem<br />
trügerischen Gefühl permanenter Prosperität<br />
wurde sie (die Landwirtschaft) jedoch<br />
seit Mitte der siebziger Jahre jäh herausgerissen,<br />
als der Zusammenbruch des europäischen<br />
Agrarmarkts eine im Grunde bis<br />
<strong>heute</strong> anhaltende strukturelle Dauerkrise<br />
auslöste. [...] Die Trendperiode gipfelte in<br />
dem überschäumenden Boom der sogenannten<br />
»Gründerjahre“ von 1866 bis<br />
1873, ehe mit der Weltwirtschaftskrise von<br />
1873 und der sich anschließenden, völlig<br />
unerwarteten sechsjährigen Depression<br />
eine traumatische Zäsur folgte.« (Wehler<br />
1995: 38) Die »ungeheure Warensammlung«,<br />
der Reichtum der Gesellschaft war<br />
also durchaus eine gesellschaftliche Erfahrung.<br />
Aber <strong>Marx</strong> schließt sich der Euphorie<br />
nicht an.<br />
Auch bei diesem ungewöhnlichen Auftakt<br />
der Analyse lohnt es sich nämlich genau zu<br />
lesen: »Der Reichtum der Gesellschaften<br />
[...] erscheint als eine »ungeheure Warensammlung«.<br />
Warum »erscheint« der Reichtum<br />
nur als »ungeheure Warensammlung«,<br />
warum ist er keine? Die Formulierung enthält<br />
bereits zwei wesentliche Argumentationen<br />
der <strong>Marx</strong>schen Konzeption:<br />
1. »Erscheinen« hängt immer von dem<br />
Betrachter ab. Ihm oder ihr »erscheint«<br />
die Anhäufung (Akkumulation) der<br />
Waren als ungeheuer. Mit anderen<br />
Worten: Der Betrachter interpretiert<br />
die Warensammlung und etikettiert sie<br />
als »ungeheuer«. Diese Interpretation<br />
50<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
kann man kritisch untersuchen.<br />
2. Das Wort »ungeheuer« zeigt, dass<br />
sich der Betrachter, der interpretiert,<br />
sich einem Phänomen gegenüber sieht,<br />
das über seinen Verstand hinausgeht.<br />
»Ungeheuer« wirkt zumeist etwas auf<br />
den Betrachter, wenn es groß, übernatürlich,<br />
unfassbar und unveränderbar<br />
ist. Der Betrachter wäre der »ungeheuren<br />
Warensammlung« dann einfach<br />
ausgeliefert, die quasi als eine Art eigenständiges<br />
Lebewesen erscheint, das<br />
gefährlich, aber auch sehr hilfreich sein<br />
kann. Die ungeheure Warensammlung<br />
deutet aber auch auf die Macht der<br />
Wirtschaft hin.<br />
Diese Argumentation mag für uns <strong>heute</strong><br />
ungewöhnlich klingen, doch sie ist nicht<br />
aus der Luft gegriffen: Adam Smith, einer<br />
der einflussreichsten Ökonomen des 18.<br />
Jahrhunderts, hatte in seinem bekanntesten<br />
Werk von der »unsichtbaren Hand des<br />
Marktes« gesprochen, die nahezu von selbst<br />
Wohlstand und Reichtum für alle Nationen<br />
bringe. Nun sollte man Smith nicht Unrecht<br />
tun: Seine Konzeption ist durchaus<br />
vielschichtig und weitsichtig. Dennoch war<br />
das »Ungeheure« an der Warensammlung<br />
durchaus eine wirkungsmächtige Argumentation.<br />
Als ein besonders pointiertes<br />
Beispiel, welches Eigenleben der Wirtschaft<br />
und der »ungeheuren« Warensammlung<br />
zugerechnet wurde, lässt sich an einem<br />
Textausschnitt von Immanuel Kant illustrieren:<br />
»Man könnte fragen: Wenn die<br />
Natur gewollt hat, diese Eisküsten sollten<br />
unbewohnt bleiben, was wir aus ihren Bewohnern<br />
wenn sie ihnen dereinst (wie zu<br />
erwarten ist) kein Treibholz mehr zuführte?<br />
Denn es ist zu glauben, daß bei fortrückender<br />
Cultur die Einsassen der temperirten<br />
Erdstriche das Holz, was an den Ufern ihrer<br />
Ströme wächst, besser benutzen, es nicht in<br />
die Ströme fallen und so in die See wegschwemmen<br />
lassen werden. Ich antworte:<br />
Die Anwohner des Obstroms, des Jenissei,<br />
des Lena u.s.w. werden es ihnen durch Handel<br />
zuführen und dafür die Producte aus dem<br />
Thierreich, woran das Meer an den Eisküsten<br />
so reich ist, einhandeln, wenn sie (die<br />
Natur) nur allererst den Frieden unter ihnen<br />
erzwungen haben wird.« (Kant 1968a: 364)<br />
Der Handel werde also den Frieden sichern<br />
und die ungeheure Warensammlung kann<br />
sich weiter entwickeln und ihre ungeheure<br />
gesellschaftliche Wirkung entfalten.<br />
3. Für <strong>Marx</strong> ist entscheidend, dass er<br />
widerspricht, wenn es darum geht, dass<br />
die Warensammlung ungeheuer sei: Sie<br />
ist interpretierbar und sie ist steuerbar<br />
und von Menschen gemacht. Wenn er<br />
im Folgenden eine einzelne Ware herausgreift,<br />
die Elementarform der Warensammlung,<br />
dann soll das zum Verständnis<br />
der gesellschaftlichen<br />
Anhäufung (Akkumulation) der Waren<br />
führen. Er will zunächst die »Elementarform«<br />
untersuchen, wie in der Chemie<br />
kein Chaos herrscht, sondern<br />
Wechselwirkungen von Elementen die<br />
Vielfalt an Stoffen und Stoffreaktionen<br />
erklären kann und es ermöglicht, chemische<br />
Prozesse zu steuern.<br />
4. Die Untersuchung der »ungeheuren<br />
Warensammlung« ist auf eine Phase in<br />
der Geschichte begrenzt: Den Kapitalismus.<br />
Der Kapitalismus ist - das deutet<br />
sich hier schon an - eine Art und<br />
Weise, wie Natur gesellschaftlich organisiert<br />
wird. Sie setzt sich deutlich<br />
von anderen Organisationsformen (wie<br />
z. B. die mittelalterliche Lehenswirtschaft)<br />
ab.<br />
51
Der erste Satz des Kapitals enthält bereits<br />
wesentliche Weichenstellungen für die<br />
Analyse: Die kapitalistische Wirtschaft<br />
scheint von einem unübersichtlichen Warenmarkt<br />
geprägt zu sein, aber er kann analysiert<br />
werden. Dazu muss anhand der<br />
»Elementarform« vorgegangen werden.<br />
B) Wie ist die Ware bestimmt?<br />
Zunächst ist eine Ware ganz einfach zu bestimmen:<br />
Sie ist (zunächst) ein bestimmtes<br />
Ding. Dinge kann man zunächst physikalisch<br />
beschreiben: Sie haben eine Ausdehnung,<br />
besondere Eigenschaften und Beschaffenheiten,<br />
sie haben Qualitäten und<br />
Quantitäten. Dinge sind der Inhalt des gesellschaftlichen<br />
Reichtums. Dinge können<br />
einen Gebrauchswert für den Menschen<br />
haben, dann sind sie nützlich. Soweit handelt<br />
es sich lediglich um Definitionen, denen<br />
kaum jemand widersprechen würde.<br />
Es entspricht unserer Alltagserfahrung.<br />
Doch wie unterscheidet sich ein Ding<br />
von der Ware? Eine Ware ist eine gesellschaftliche<br />
Form nützlicher Dinge. Ein<br />
Ding muss also, um Ware zu sein, noch<br />
weitere Bedingungen erfüllen:<br />
1. Ein Ding kann nur zur Ware werden,<br />
wenn es gesellschaftlich und individuell<br />
zur Bedürfnisbefriedigung<br />
benötigt wird. Ein Ding ohne Gebrauchswert<br />
wäre eine Ware, die man<br />
nicht tauschen könnte. Diese Voraussetzung<br />
kann leicht angegriffen werden:<br />
Denn was ist schon gesellschaftlich<br />
notwendig? Ist eine CD von<br />
Daniel Küblböck wirklich notwendig?<br />
Ist einen Computer zu besitzen wirklich<br />
notwendig? Ist ein modernes<br />
Kunstwerk zu besitzen wirklich notwendig?<br />
Anders als das bei einigen Philosophen<br />
des 18. Jahrhunderts war, ist<br />
diese Form von normativer »Kulturkritik«<br />
nicht gemeint. Ob es sich um natürliche<br />
oder künstlic geschaffene Bedürfnisse<br />
handelt, ist für die<br />
Argumentation, ob ein Ding zur Ware<br />
werden kann gänzlich unerheblich.<br />
Der bekannteste Kritiker künstlicher<br />
Bedürfnisse, die lediglich gesellschaftlich<br />
geschaffen und abzulehnen seien,<br />
war im 18. Jahrhundert Jean-Jacques<br />
Rousseau. Er sieht mit dem Luxus auch<br />
die Unfreiheit der Menschen und die<br />
Ungleichheit unter den Menschen weiter<br />
wachsen: »Es ist leicht zu sehen, daß<br />
der Ackerbau seiner Natur nach die am<br />
wenigsten einträgliche von allen Künsten<br />
sein muß, weil der Gebrauch seines<br />
Erzeugnisses allen Menschen am unentbehrlichsten<br />
ist und dessen Preis daher<br />
nach den Fähigkeiten der Ärmsten<br />
bemessen sein muß. Aus demselben<br />
Prinzip kann man diese Regel herleiten:<br />
Im allgemeinen sind die Künste im<br />
umgekehrten Verhältnis zu ihrer Nützlichkeit<br />
einträglich und die notwendigsten<br />
müssen schließlich zu den am meisten<br />
vernachlässigten werden.«<br />
(Rousseau 1997: 315) Seine Antwort<br />
ist dann auch der Versuch, den Luxus<br />
und die Entwicklung eines industriellen<br />
Sektors und die Anhäufung von<br />
Waren zu verlangsamen oder zu verhindern<br />
und die Menschen so zu erziehen,<br />
dass sie nur ihre natürlichen Bedürfnisse<br />
gesellschaftlich befriedigen.<br />
Rousseau hat so analytisch im 18. Jahrhundert<br />
einige wesentliche Punkte genannt,<br />
die auch <strong>Marx</strong> in seine Konzeption<br />
aufnimmt, bleibt aber mit seiner<br />
wenig am Fortschritt orientierten Position<br />
hinter <strong>Marx</strong> zurück.<br />
52<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
2. Waren setzen einen Markt voraus,<br />
auf dem unterschiedliche Waren getauscht<br />
werden. Nur wenn mehrere<br />
Händler jeweils für sie nicht, aber für<br />
andere nützliche Dinge wechselseitig<br />
tauschen wollen, kann man von Dingen<br />
als Waren sprechen.<br />
3. Waren müssen vergleichbar sein,<br />
sonst könnten sie nicht getauscht<br />
werden. Sie müssen also eine Eigenschaft<br />
haben, die sie gemeinsam haben<br />
und die zugleich relativ sein muss. Waren<br />
müssen also bestimmte Werte haben,<br />
durch die sie vergleichbar und dadurch<br />
tauschbar werden.<br />
C) Wie kommt der Wert in die Ware?<br />
Wenn Waren vergleichbar sein müssen,<br />
um getauscht werden zu können, braucht<br />
man etwas, was in der Ware steckt, eine<br />
gemeinsame Eigenschaft aller Waren.<br />
Physikalische Eigenschaften eignen sich<br />
dazu offensichtlich nicht. Wie könnte man<br />
sonst die Küblböck- CD gegen ein Brot<br />
tauschen? In beides - Brot und Küblböck-<br />
CD - ist Arbeit gesteckt worden und das<br />
bezeichnet <strong>Marx</strong> als das Gemeinsame aller<br />
Waren. Die in eine bestimmte Ware hineingesteckte<br />
Arbeit in Form von Arbeitszeit<br />
ist der Maßstab für den Wert einer<br />
Ware. Damit gibt es eine weitere Voraussetzung<br />
dafür, dass ein Ding eine Ware<br />
sein kann: In das Ding muss Arbeit gesteckt<br />
worden sein.<br />
Wirklich?<br />
Ein Stein, den ich vom Spazierweg aufhebe,<br />
um ihn einem mit mir spazierenden<br />
Freund als Ware anzubieten, würde mir<br />
keine besonders gute Verhandlungsposition<br />
bescheren, wenn ich seine Taschenuhr<br />
dafür haben wollte. Die Taschenuhr will er<br />
mir - trotz freundlichster Überzeugungsarbeit<br />
- nicht überlassen. Das kann einmal<br />
damit zusammenhängen, dass der Freund<br />
in diesem Moment keine Verwendung für<br />
den Stein hat, er wird aber vor allem anführen<br />
können, dass der Wert der Uhr viel höher<br />
ist als der des Steins. Näher nachgefragt<br />
wird er irgendwann darauf kommen,<br />
dass in die Uhr bedeutend mehr Arbeit gesteckt<br />
worden ist als in den Stein.<br />
Verändern wir die Situation etwas zu meinen<br />
Gunsten: Ich hebe statt des Steins einen<br />
Rohdiamanten von 24 Karat auf und<br />
biete diesen als Tauschobjekt gegen die Taschenuhr.<br />
Der Freund würde diesem<br />
Tausch wahrscheinlich zustimmen. Widerspricht<br />
dieses Beispiel nicht der Wertbestimmung?<br />
Ist nicht in diesem Fall der<br />
Tauschwert meiner Ware schlichtweg dadurch<br />
bestimmt, wie groß jeweils Angebot<br />
und Nachfrage für Wackersteine einerseits<br />
und für 24-karätige Rohdiamanten andererseits<br />
ist? Wie kann man nun dennoch<br />
<strong>Marx</strong>’ These »retten«?<br />
<strong>Marx</strong> hält einer solchen Argumentation<br />
zwei wesentliche <strong>Argumente</strong> entgegen:<br />
Wert und Tauschwert einer Ware sind<br />
nicht das Gleiche und individueller und<br />
gesellschaftlicher Wert unterscheiden<br />
sich. Was heißt das?<br />
Der Rohdiamant von 24 Karat bestimmt<br />
sich im Wert nicht durch die individuelle<br />
Arbeit, die ich aufwenden musste, um ihn als<br />
Ware anzubieten, sondern der Wert bestimmt<br />
sich durch die Arbeits(zeit), die<br />
durchschnittlich benötigt wird, um die<br />
Ware anzubieten. <strong>Marx</strong> nennt das die<br />
durchschnittlich notwendige gesellschaft-<br />
53
liche Arbeit oder die abstrakte Arbeit.<br />
Wenn ich also weniger Arbeitszeit für das<br />
Finden des Rohdiamanten aufbringen musste,<br />
ist das mein Glück, bedauerlicherweise ist<br />
es mir bisher aber auch noch nicht passiert.<br />
Aus dieser Argumentation leitet sich<br />
bei <strong>Marx</strong> her, dass drei unterschiedliche,<br />
zusammenhängende Wertbegriffe zu unterscheiden<br />
sind:<br />
Der Wert kommt in die Ware durch individuelle<br />
Arbeit, die man in sie steckt. Der<br />
Wert kann durch Arbeitsstunden bestimmt<br />
werden. Als gesellschaftlicher Wert kommt<br />
aber nicht die individuelle benötigte Arbeitszeit<br />
als Wertmaßstab in Frage, sondern<br />
die durchschnittlich gesellschaftlich<br />
benötigte Arbeitszeit für die Produktion<br />
der Ware.<br />
Insofern ist die Arbeitsstunde eines Meisters<br />
gegenüber der eines Lehrlings nicht<br />
wertvoller. Vielmehr wird davon ausgegangen,<br />
dass der Meister in der gleichen Arbeitszeit<br />
mehr schafft. Insofern ist der<br />
Stuhl, den der Meister an einem Tag baut<br />
individuell weniger wert als der des Lehrlings,<br />
der zwei Tage gebraucht hat. Da aber<br />
gesellschaftlich höchstens ein Tag durchschnittlich<br />
zur Stuhlproduktion gebraucht<br />
wird, hat der Lehrling das Nachsehen.<br />
Warum aber ist die Arbeitsstunde des Meisters<br />
teurer als die des Lehrlings?<br />
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe:<br />
Zunächst handelt es sich um eine Frage des<br />
gesellschaftlichen Status und der<br />
Konvention, aber darüber hinaus bezahlt<br />
man in der Arbeitsstunde des Meisters<br />
auch noch die Arbeit mit, die er in seine eigene<br />
Ausbildung gesteckt hat. Zudem<br />
kann der Meister sich natürlich - egal wie<br />
kurz er braucht - immer auf die durchschnittliche<br />
gesellschaftliche Arbeitszeit<br />
beziehen.<br />
Probleme bekommt der Meister nur, wenn<br />
die durchschnittliche gesellschaftliche Arbeitszeit<br />
für die Stuhlproduktion durch<br />
Ikea wesentlich gemindert wird. Der<br />
durchschnittliche Wert des Stuhls sinkt<br />
damit und dem wird sich der Meister auf<br />
Dauer kaum entziehen können, es sei denn<br />
die Handfertigung begründet einen höheren<br />
Gebrauchswert (z. B. auch den Status,<br />
individuell gefertigte Stühle zu besitzen).<br />
Diese Argumentation mag etwas ungewohnt<br />
sein; sie erklärt aber mehr als<br />
die simple Behauptung, die Arbeit des<br />
Meisters sei mehr wert als die des Lehrlings.<br />
Der Gebrauchswert der Ware ist nicht gesellschaftlich<br />
bestimmt, sondern lediglich<br />
gesellschaftlich beeinflusst. So kann ein<br />
Gegenstand individuell sehr unterschiedlich<br />
viel wert sein, das ist zunächst nicht<br />
gesellschaftlich messbar. Dennoch ist der<br />
Gebrauchswert nicht gänzlich ohne gesellschaftliche<br />
Komponente: So kann eine Levis-Jeans<br />
individuell für einen Jugendlichen<br />
einen höheren Gebrauchswert haben<br />
als eine Noname-Jeans, wenn er damit zur<br />
Clique gehört.<br />
Der Tauschwert ist eine abgeleitete Größe<br />
aus dem Wert und hat mit dem<br />
Gebrauchswert nichts zu tun. Der<br />
Tauschwert kann differieren: Auf Dauer<br />
wird er sich - allen Schwankungen und<br />
Zufällen zum Trotz - an dem Wert, der in<br />
die Ware gesteckten, abstrakten Arbeit<br />
orientieren. Angebot und Nachfrage<br />
sind lediglich Faktoren, die die konkrete<br />
Höhe des Tauschwertes beeinflussen.<br />
Der Tauschwert kann - wie der Wert<br />
auf Dauer für eine Ware sinken, aus welchem<br />
Grund, wird später noch Thema<br />
sein.<br />
54<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
Nur wenn man die drei Wertbegriffe verstanden<br />
hat, wird man auch über die Dynamik<br />
kapitalistischer Gesellschaften sprechen<br />
und sie verstehen können. Der<br />
Wert repräsentiert sich aber bei <strong>Marx</strong> innerhalb<br />
der Geschichte in unterschiedlichen<br />
Wertformen, die sich von der einfachen<br />
Wertform bis zur »Geldform« entwickeln:<br />
• »einfache, einzelne oder zufällige<br />
Wertformen«, bei der frei Ware gegen<br />
Ware getauscht wird.<br />
• »totale oder entfaltete Wertform«<br />
(<strong>Marx</strong> 1998: MEW 23: 77), in der jeweils<br />
vergleichbare Waren getauscht<br />
werden. Der ungeheure Warenmarkt<br />
hat sich bereits entwickelt.<br />
• Die »allgemeine Wertform« (<strong>Marx</strong><br />
1998: MEW 23: 79), in der eine Ware<br />
als allgemeine Wertform angenommen<br />
wird, mit der die Mengen der anderen<br />
Waren ausdrückbar bemessen<br />
und deren Wert damit ausdrückbar<br />
wird.<br />
• Die Geldform - Eine Ware wird nur<br />
als allgemeines Äquivalent gehandelt.<br />
Durch das allgemeine Äquivalent<br />
wird der Gebrauchswert und Tauschwert<br />
getrennt. Der Fetischcharakter<br />
der Ware entsteht, weil die drei Wertformen<br />
sich erst im Tauschwert realisieren<br />
und dieser nun als wertbestimmend<br />
erscheint.<br />
D) Die Crux – Die sich selbst reproduzierende<br />
Ware und die <strong>Marx</strong>sche<br />
Arbeitswertlehre<br />
»Der Reichtum der Gesellschaften, in<br />
welchen kapitalistische Produktionsweise<br />
herrscht, erscheint als eine »ungeheure<br />
Warensammlung«, die einzelne<br />
Ware als seine Elementarform. «<br />
(<strong>Marx</strong>/Engels 1998: 49)<br />
Der Tausch von Waren ist keine Angelegenheit,<br />
die nur in kapitalistischen Gesellschaften<br />
vorkäme. Kehrt man noch einmal<br />
zum ersten Satz des Kapitals zurück, so erklärt<br />
die bisher beschriebene Tauschwirtschaft<br />
noch nicht die »ungeheure Warensammlung«<br />
und auch nicht die Anhäufung<br />
(Akkumulation) von Waren. Bevor man die<br />
Besonderheit kapitalistischer Gesellschaften<br />
systematisch erklären kann, muss allerdings<br />
zunächst noch eine kleine Ergänzung<br />
gemacht werden, die die Definition<br />
von Geld betrifft.<br />
Geld ist die Ware, die als allgemeines<br />
Äquivalent für alle Waren eingesetzt<br />
wird. Der Gebrauchswert der Ware Geld<br />
liegt für gewöhnlich nur darin, allgemeines<br />
Äquivalent zu sein. Die Einführung des<br />
Geldes als allgemeine Ware und Tauschmittel<br />
vermittelt sich dabei schon mit gesundem<br />
Menschenverstand: Müsste ich jedes<br />
Mal für meine Ware einen<br />
Tauschpartner suchen, der gerade meine<br />
Ware benötigt und dessen Ware ich haben<br />
will, so wäre das in komplexen Gesellschaften<br />
ein schwieriges bzw. unmögliches Unterfangen.<br />
Ein allgemeines Äquivalent hilft<br />
diesem Problem ab.<br />
Eine wesentliche Bedingung für Geld ist<br />
dabei, dass es gesellschaftlich limitiert sein<br />
muss, so dass der in dem Geld repräsen-<br />
55
tierte Wert auch halbwegs konstant bleibt.<br />
Dabei haben sich der Wert und der<br />
Tauschwert des Geldes weitgehend entkoppelt:<br />
Ein 100- €-Schein weist wenig<br />
Wert durch die in ihn gesteckte Arbeit aus,<br />
repräsentiert aber einen gesellschaftlich<br />
formal festgelegten Wert.<br />
Stellt man nun die bisher vorgestellte Form<br />
des Tausches dar, so lässt sie sich wie folgt<br />
in einer Formel darstellen:<br />
Ware (W) - Geld (G) - Ware (W)<br />
In dieser einfachen Form wäre aber - und<br />
das ist entscheidend - keine »ungeheure<br />
Warensammlung « und auch keine Akkumulation<br />
von Geld und Waren begründbar:<br />
Jeder bekäme, bis auf Zufälle und Ausnahmen<br />
- den Wert in Waren zurück, den<br />
er selbst auch in die Waren gesteckt hat.<br />
Wie käme aber dann die Anhäufung von<br />
immer mehr Geld und immer mehr Waren<br />
zustande? In einem geschlossenen System<br />
ließe sich zwar alles erklären, was an Arbeit<br />
geleistet wird, um das Überleben zu sichern,<br />
nicht aber, dass auch darüber hinaus<br />
Waren produziert und getauscht werden.<br />
Die Akkumulation der ungeheuren Warensammlung<br />
fasst <strong>Marx</strong> dann auch in eine<br />
sehr ähnliche, aber entscheidend abweichende<br />
Formel:<br />
G(eld) - W(are) - G(eld)’,<br />
wobei Geld’ größer sein muss als Geld.<br />
Diese kurze Formel fasst die wesentliche<br />
Formel des Kapitalismus zusammen: Es<br />
geht um die Anhäufung von Kapital. Es<br />
geht nicht etwa um die Produktion von<br />
Waren, sondern um die Akkumulation von<br />
Geld bzw. Kapital. Der Tausch mit Waren,<br />
die Gebrauchswert haben, ist dort nur ein<br />
Mittel zum Zweck, mehr Kapital zu akkumulieren.<br />
Problem an dieser Formel ist<br />
aber, dass man mit ihr noch nicht begründet<br />
hat, warum es eine beständige Akkumulation,<br />
also Anhäufung von Waren und<br />
vor allem von Geld geben sollte. Wie kann<br />
man - mit anderen Worten - systematisch<br />
voraussetzen, dass G über den Austausch<br />
von Waren zu G’ (also mehr Geld) wird.<br />
Natürlich kann man davon ausgehen, dass<br />
Menschen immer mehr produzieren und<br />
damit auch der jeweilige Gegenwert des<br />
allgemeinen Äquivalents (Geld) steigen<br />
muss. Allerdings würde es sich letztendlich<br />
noch um ein Nullsummenspiel handeln:<br />
Der Produzent bekäme regelmäßig nur<br />
den Gegenwert als Tauschwert, den er auch<br />
in Form von Arbeit(sstunden) in die Ware<br />
gesteckt hat, soweit er nicht ein besonderes<br />
Verkaufstalent entwickelt hat.<br />
Der Warentausch setzt daher schon etwas<br />
Wesentliches voraus: Es müsste also eine<br />
Ware geben, die sich selbst reproduziert,<br />
die sich aus sich selbst heraus wieder<br />
selbst schafft. Und diese Ware - so <strong>Marx</strong> -<br />
ist die menschliche Arbeitskraft. Ein Produzent<br />
kann sein Kapital vermehren, in<br />
dem er geschickt handelt - das ist von Zufällen<br />
und sicherlich auch vom Verhandlungsgeschick<br />
abhängig -, aber systematisch<br />
lässt sich die Akkumulation von<br />
Waren und von Kapital nur über eine »sich<br />
selbst reproduzierende Ware« erklären.<br />
Dann lässt sich die einfache Formel des<br />
G - W - G’ differenzierter darstellen als<br />
G - W - Arbeit/Produktion - W’ - G’.<br />
Diese Formel drückt aus, dass der Kapitalist<br />
zur Vermehrung seines Kapitals das<br />
Kapital durch einen Prozess aus zwei Teil-<br />
56<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
prozessen laufen lassen muss: Den Produktionsprozess<br />
und den Zirkulationsprozess.<br />
Für sein Kapital muss der Kapitalist<br />
dazu zunächst Waren ankaufen, die im<br />
Produktionsprozess durch menschliche<br />
Arbeit wertvoller werden. Diese Waren<br />
müssen dann im Folgenden auf dem Markt<br />
angeboten werden und zu mehr Kapital<br />
realisiert werden.<br />
Dieser Prozess bis zu G’ hängt natürlich<br />
von vielen Rahmenbedingungen ab: Ob<br />
die Waren, die der Kapitalist benötigt, zum<br />
entsprechenden Preis angeboten werden,<br />
ob das entsprechende Kapital verfügbar ist<br />
bzw. beschafft werden kann etc. Das erfolgreiche<br />
Durchlaufen des Gesamtprozesses<br />
von G zu G’ ist also kein Selbstläufer,<br />
sondern kann unterbrochen werden. Diese<br />
Formen der Unterbrechung und ihre<br />
Begründungen werden für die Krisenerklärung<br />
des Kapitalismus entscheidend<br />
sein.<br />
E) Die Notwendigkeit des Mehrwerts<br />
für die Kapitalakkumulation<br />
Diese These, dass es notwendig sei, eine<br />
sich selbst reproduzierende Ware zu haben,<br />
damit die Kapitalakkumulation (G-W-G’)<br />
funktionieren und erklärt werden kann, ist<br />
die umstrittene Arbeitswertlehre.<br />
Die Arbeitswertlehre von <strong>Marx</strong> hat allerdings<br />
frühere Quellen. Auch in der bürgerlichen<br />
Philosophie seit den liberalen<br />
Schriften John Lockes hatte die individuelle<br />
Arbeit Eigentum legitimiert: »Obwohl<br />
die Erde und alle niederen Lebewesen allen<br />
Menschen gemeinsam gehören, so hat<br />
doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner<br />
eigenen Person. Auf diese hat niemand ein<br />
Recht als nur er allein. Die Arbeit seines<br />
Körpers und das Werk seiner Hände sind,<br />
so können wir sagen, im eigentlichen Sinne<br />
sein Eigentum. Was immer er also dem<br />
Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen<br />
und in dem sie es belassen hat, hat er<br />
mit seiner Arbeit gemischt und ihm etwas<br />
eigenes hinzugefügt. Er hat es somit zu seinem<br />
Eigentum gemacht.« (Locke 1977:<br />
216f.) 3 Arbeit legitimiert - in dieser klassisch<br />
bürgerlichen Argumentation - Eigentum.<br />
Für die Zeit in der John Locke die<br />
beiden Abhandlungen über die Regierung<br />
geschrieben hat (1689), war das eine<br />
durchaus moderne und revolutionäre<br />
Sichtweise, richtete sie sich doch gegen geburtsständische<br />
Privilegien. Dabei schrieb<br />
Locke aus der Sichtweise des englischen<br />
Kleinadels, der sich in den Auseinandersetzungen<br />
und den Umverteilungskämpfen<br />
schließlich durchsetzte. Lockes Position<br />
hat aber vor allem als Argumentationszusammenhang<br />
die bürgerlichen Philosophen<br />
nach ihm geprägt.<br />
Die <strong>Marx</strong>sche Arbeitswertlehre hat allerdings<br />
noch eine zweite Quelle. Diese liegt<br />
bei Adam Smith: »Auf der untersten Entwicklungsstufe<br />
gehört der gesamte Ertrag<br />
der Arbeit dem Arbeiter, und die Menge<br />
Arbeit, die gemeinhin geleistet wird, um<br />
ein Gut zu erwerben oder zu erzeugen, ist<br />
das einzige Richtmaß, nach dem man die<br />
Menge Arbeit bestimmen kann, gegen die<br />
üblicherweise gekauft [...] werden sollte.«<br />
(Smith 1978: 42f.; zitiert nach Conert<br />
2002: 65) Schon die bürgerliche Philosophie,<br />
auf die sich noch <strong>heute</strong> liberale Wirtschaftstheoretiker<br />
berufen, kennt also die<br />
Definition, dass der Wert durch menschliche<br />
Arbeit in die Ware komme.<br />
Auch der zweite Schritt der Erklärung findet<br />
sich bereits bei Smith: »Sobald sich<br />
57
aber nun Kapital in den Händen einzelner<br />
gebildet hat, werden es einige von ihnen<br />
natürlich dazu verwenden, um arbeitsame<br />
Leute zu beschäftigen, denen sie Rohmaterialien<br />
und Unterhalt bieten, um einen Gewinn<br />
aus dem Verkauf ihrer Produkte zu<br />
erzielen [...] Der Wert, den ein Arbeiter<br />
dem Rohmaterial hinzufügt, lässt sich daher<br />
in diesem Falle in zwei Teile zerlegen,<br />
mit dem einen wird der Lohn gezahlt mit<br />
dem anderen der Gewinn des Unternehmers.«<br />
(Smith 1978: 43; zitiert nach Conert<br />
2002: 65) Mit anderen Worten: Der<br />
Arbeiter gibt bei Smith mehr Arbeit und<br />
damit Wert an die Ware ab, als er Lohn als<br />
Gegenwert erhält, dadurch kann der »Unternehmer«<br />
Gewinne machen.<br />
Auf beide Quellen (Liberalismus bei Lokke<br />
und bei Adam Smith) bezieht sich <strong>Marx</strong><br />
in seiner Arbeitswertlehre, allerdings entwickelt<br />
er beides weiter. Ausgangspunkt ist<br />
dabei die wesentliche Voraussetzung des<br />
Liberalismus, die <strong>Marx</strong> sarkastisch aufgreift:<br />
»Zur Verwandlung von Geld in Kapital<br />
muß der Geldbesitzer also den freien<br />
Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden,<br />
frei in dem Doppelsinn, daß er als freie<br />
Person über seine Arbeitskraft als seine<br />
Ware verfügt, daß er andererseits andere<br />
Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig,<br />
frei ist von allen zur Verwirklichung<br />
seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.«<br />
(<strong>Marx</strong> 1998: 183; vgl. auch <strong>Marx</strong> 1998:<br />
742)<br />
Der doppelt freie Arbeiter (frei an seiner<br />
Person und frei von Kapital) kann dann einen<br />
Vertrag mit dem Kapitalbesitzer eingehen<br />
und ihm seine Arbeitskraft verkaufen.<br />
Letzteres ist eine wesentliche<br />
Weiterentwicklung der liberalen Theoriebildung:<br />
Der Arbeiter verkauft nicht einfach<br />
seine Arbeit, sondern er ist gezwungen,<br />
sich selbst, seine gesamte Arbeitskraft,<br />
zu verkaufen: »So war die Unterscheidung<br />
zwischen dem Verkauf der Arbeit des Proletariers<br />
an den Kapitalisten und dem Verkauf<br />
seiner Arbeitskraft, die für die<br />
<strong>Marx</strong>sche Theorie des Mehrwerts und der<br />
Ausbeutung grundlegend ist, im Manifest<br />
noch nicht deutlich herausgearbeitet. «<br />
(Hobsbawm 2000: 17)<br />
Was meint diese Differenzierung von Arbeit<br />
und Arbeitskraft? Indem der Kapitalist<br />
mit dem Vertrag die Arbeitskraft kauft,<br />
hat er systematisch die Möglichkeit, den<br />
Arbeiter mehr arbeiten zu lassen, als der<br />
Arbeiter für seinen Lebensunterhalt benötigt.<br />
Er lässt den Arbeiter also nicht nur für<br />
seinen Lebensunterhalt arbeiten, sondern<br />
er lässt ihn länger arbeiten und erreicht dadurch<br />
einen »Mehrwert«, der sich in den<br />
produzierten Waren repräsentiert. Dieser<br />
Mehrwert stellt dem Kapitalisten sicher,<br />
dass er tatsächlich mehr Kapital am Ende<br />
des Produktions- und Tauschprozesses behält,<br />
als er vorher an Kapital hineingesteckt<br />
hat, dass also tatsächlich G-W-G’ gelten<br />
kann. Nur durch dieses Ausbeutungsverhältnis<br />
kann man von der »sich selbst reproduzierenden<br />
Ware« sprechen: die<br />
menschliche Arbeitskraft.<br />
Damit ist das Kapital nicht eine Ansammlung<br />
von Produktionsmitteln, sondern ein<br />
gesellschaftliches Verhältnis: »Durch den<br />
Kauf von Arbeitskraft verwandelt sich<br />
Geld in Kapital. Das Kapital ist nicht - wie<br />
vulgärökonomisch oder alltagssprachlich<br />
angenommen wird - ein Ensemble von<br />
Maschinen, Werkstoffen, Geld usw., sondern<br />
Resultat einer spezifischen Beziehung<br />
von Menschen, von denen die einen über<br />
Eigentum an diesen »Produktionsmitteln«<br />
58<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
verfügen, während die anderen allein<br />
ihre eigene Arbeitskraft auf den (Arbeits-)markt<br />
bringen können.«<br />
(Fetscher 1999:107)<br />
Die <strong>Marx</strong>sche Arbeitswertlehre baut damit<br />
auf zwei Abstraktionen auf: Als Grundlage<br />
des Wertes und des abgeleiteten Tauschwertes<br />
liegt nicht die individuelle Arbeit<br />
zugrunde, sondern die abstrakte gesellschaftliche<br />
Arbeit, die zu einem historischen<br />
Zeitpunkt mit technologischen Mitteln<br />
durchschnittlich benötigt wird.<br />
Zweitens wird das Arbeitsprodukt von seinen<br />
Produzenten abgezogen (abstrahiert),<br />
da eine Gesellschaft von Warentauschern<br />
nur bei Arbeitsteilung vorstellbar ist.<br />
Im Folgenden wird <strong>Marx</strong> noch zwei Formen<br />
des Mehrwerts unterscheiden, die mit<br />
der Entwicklung kapitalistischer Gesellschaft<br />
zu tun haben. Dazu aber später<br />
mehr.<br />
F) Die vier P des Kapitalismus<br />
Mit der Arbeitswertlehre verbinden sich in<br />
der <strong>Marx</strong>schen Kritik der politischen Ökonomie<br />
vier wesentliche analytische Begriffe,<br />
die die Grundkonstellation, aber auch<br />
die Entwicklung des Kapitalismus erklärbar<br />
machen sollen:<br />
Die Produktionsmittel: Die zur Erstellung<br />
von Produkten eingesetzten Dinge<br />
und Mittel, Rohstoffe, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel,<br />
aber auch die menschliche Arbeitskraft,<br />
die sich selbst immer wieder reproduziert.<br />
Die Produktivkräfte und ihre Entwicklung:<br />
Produktivkraft ist die Form der Leistung<br />
(Arbeit pro Zeiteinheit): »Je größer<br />
die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner<br />
die zur Herstellung eines Artikels erheischte<br />
Arbeitszeit« (<strong>Marx</strong> 1998: 55). Die<br />
Produktivkraftentwicklung hat aber - und<br />
das ist wesentlich - eine dialektische Wirkung:<br />
Einerseits erhöht sie die Arbeit pro<br />
Zeiteinheit (Leistung), andererseits wird<br />
damit auf Dauer die gesellschaftlich benötigte<br />
Arbeitszeit, die für die Produktion eines<br />
bestimmten Produkts benötigt wird,<br />
gesenkt. Damit hat dieser Artikel dann weniger<br />
Wert. Dieser geringere Wert wird<br />
sich in der Konkurrenz zwischen unterschiedlichen<br />
Produzenten einer Ware irgendwann<br />
als Tauschwertminderung ausdrücken.<br />
Die Wirkung und Logik der<br />
Produktivkraftentwicklung ist eine wesentliche<br />
Weiterentwicklung in der<br />
<strong>Marx</strong>schen Geschichtstheorie.<br />
Die Produktionsverhältnisse - Es gibt im<br />
Kapitalismus objektiv zwei Klassen: Kapitalisten<br />
und Arbeiter. Die Akkumulation<br />
von Kapital kann nur funktionieren, wenn<br />
der Kapitalist die Arbeiter ausbeutet. Der<br />
Kapitalist schließt einen Vertrag und kauft<br />
die Ware Arbeitskraft des Arbeiters. Der<br />
Lohn entspricht aber nicht der in der Ware<br />
verdinglichten Arbeit, sondern nur den Lebenserhaltungskosten<br />
(Reproduktionskosten)<br />
des Arbeiters. Der überschüssige<br />
(Mehr-)Wert ermöglicht die Kapitalanhäufung.<br />
Dieser Ausbeutungsvertrag konstituiert<br />
die Produktionsverhältnisse. Die<br />
Produktionsverhältnisse unterliegen dabei<br />
einem historischen Wandel. So hat auch in<br />
der Sklavenhaltergesellschaft der Herr den<br />
Mehrwert des Sklaven vereinnahmt, allerdings<br />
war dem kein Vertrag unter »Freien«<br />
vorausgegangen, sondern ein »Eigentum«<br />
an der fremden Person. Die »doppelte Freiheit«<br />
des Arbeiters (frei an der Person und<br />
59
frei von Kapital) ist somit eine andere<br />
Form der Ausbeutung.<br />
Die Profitrate zu guter Letzt fasst das<br />
Entwicklungsprinzip kapitalistischer Produktion<br />
zusammen und bildet die Grundlage<br />
für die marxistische Krisentheorie, die<br />
nach wie vor in der wissenschaftlichen Diskussion<br />
auch bei <strong>Marx</strong>isten umstritten ist.<br />
Auf die Profitrate muss im Folgenden noch<br />
näher eingegangen werden.<br />
G) Die Profitrate<br />
Die Arbeitswertlehre und Produktivkraft,<br />
Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse<br />
im Kapitalismus lassen sich in<br />
eine erklärende Formel zusammenfassen:<br />
M (Mehrwert)<br />
——————––––––––– = P (Profitrate)<br />
V (Variables Kapital/Lohn)<br />
+ C (festes Kapital)<br />
Die Profitrate leitet sich aus der wesentlichen<br />
Frage her, die oben gestellt wurde:<br />
Wie kann man regelmäßig davon ausgehen,<br />
dass G - W - G’ angenommen werden<br />
kann? Die Lösung des Kapitalisten heißt,<br />
den Mehrwert zu nutzen, der durch die<br />
Arbeitskraft der Arbeiter entsteht. Die<br />
Profitrate lässt sich dann durch das Verhältnis<br />
von Produktionskosten und Mehrwert<br />
bestimmen. Alle Kosten der Produktion<br />
(das heißt die Kosten für variables<br />
Kapital (Lohn) und festes Kapital (das<br />
heißt die weiteren Produktionsmittel))<br />
werden ins Verhältnis zum Mehrwert, der<br />
durch die Ausbeutung der Arbeitskraft der<br />
Arbeiter entsteht, gesetzt.<br />
Je höher demnach der Mehrwert, desto<br />
größer der Profit, der zu erzielen ist, das<br />
heißt: Je größer wird (voraussichtlich!)<br />
auch die Differenz zwischen G und G’, die<br />
Kapitalakkumulation, sein.<br />
Mit dieser Formel hat <strong>Marx</strong> einen wesentlichen<br />
wissenschaftlichen Schritt gemacht:<br />
Im Manifest der Kommunistischen Partei<br />
war zwar geschichtlich die Ausbeutung der<br />
Arbeiter entwickelt worden, es handelte<br />
sich aber nicht um eine wissenschaftliche,<br />
empirisch nachvollziehbare Theorie. Mit<br />
der Profitrate ändert sich das.<br />
Doch die Profitrate hat keine »einfache«<br />
Wirkung, sondern sie enthält die Vorstellung<br />
einer dialektischen Entwicklung der<br />
Kapitalakkumulation und das kommt<br />
durch zwei widerstreitende Möglichkeiten<br />
für den Kapitalisten zustande, Mehrwert<br />
zu produzieren: Absoluter und relativer<br />
Mehrwert.<br />
H) Absoluter und relativer Mehrwert<br />
Der Kapitalist kann zwei Methoden wählen,<br />
den Mehrwert und damit die Differenz<br />
zwischen G und G’ weiter zu steigern.<br />
Am besten macht man sich das klar, in dem<br />
man den Profit an einer Strecke darstellt<br />
und sich fragt, wie der Mehrwert (M) verlängert<br />
werden kann:<br />
Relative Mehrwertsteigerung - Bei der<br />
relativen Mehrwertsteigerung wird die Erhöhung<br />
des Mehrwerts durch ein für den<br />
Kapitalisten positiveres Verhältnis von M<br />
zu V+C erreicht. Dazu muss die Ausgangsstrecke<br />
A mit der zweiten verglichen werden.<br />
Er hat einen Extramehrwert produziert.<br />
Wie kann er diesen erreichen: Er<br />
kann zum Beispiel in Maschinen oder die<br />
Ausbildung / Weiterbildung der Arbeiter<br />
60<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
investieren. Dadurch wird zwar C größer<br />
werden. Für die gleiche Anzahl von Waren<br />
wird aber damit weniger Arbeit in die<br />
einzelne Ware gesteckt werden müssen:<br />
Sowohl M als auch V sinken. Dadurch<br />
steckt zwar weniger vergegenständlichte<br />
Arbeit in der Ware, die Ware ist somit weniger<br />
wert, aber der Kapitalist hat einen<br />
relativen Vorteil gegenüber einem Kapitalisten,<br />
der noch nach Variante A produziert.<br />
Der Kapitalist B kann nämlich billiger<br />
produzieren und (fast) genauso teuer<br />
verkaufen. Er kann sogar, die Ware etwas<br />
billiger als Konkurrent A anbieten und<br />
damit voraussichtlich insgesamt mehr<br />
Waren absetzen. Dadurch hat er einen relativen<br />
Mehrwert und einen Wettbewerbsvorteil<br />
gegenüber A erzielt.<br />
Die relative Mehrwertproduktion lässt<br />
sich also zusammenfassen: »Senkung des<br />
Werts der Arbeitskraft durch Steigerung<br />
der Produktivkraft der Arbeit.« (Heinrich<br />
2004: 149) Die Erzielung von relativem<br />
Mehrwert ist die wesentliche Ursache für<br />
die gesellschaftliche Produktivkraftentwicklung.<br />
Die relative Mehrwertsteigerung<br />
birgt aber immense gesellschaftliche<br />
Probleme:<br />
1. Problem bei der relativen Mehrwertsteigerung<br />
ist, dass sie nur über begrenzte<br />
Zeit funktionieren wird. Unternehmer<br />
A geht entweder unter oder<br />
wird sich ebenfalls neue Maschinen zulegen,<br />
um »mitzuhalten«, der Vorteil<br />
durch die relative Mehrwertsteigerung<br />
für den Kapitalisten ist damit hinfällig.<br />
Die Ware ist gesellschaftlich weniger<br />
wert.<br />
2. Rationalisierungen oder »Produktivkraftsteigerung«<br />
führen dazu, dass mit<br />
weniger Arbeitskraft die gleiche oder<br />
sogar eine größere Menge einer Ware<br />
produziert wird. Die Leistung, also Arbeit<br />
pro Zeiteinheit, steigt. Geht man<br />
davon aus, dass die gesellschaftliche<br />
Nachfrage nach Produkten nicht unbeschränkt<br />
ist - weder den Bedürfnissen<br />
nach, noch der Kaufkraft nach, so ergeben<br />
sich zwei Gefahren: Die Gefahr<br />
der Überproduktion und die Gefahr<br />
der Arbeitslosigkeit. Sowohl Überproduktion<br />
als auch Arbeitslosigkeit sind<br />
ohne Weiteres in der Geschichte und<br />
der Gegenwart nachweisbar und sie<br />
sind keine Störfaktoren kapitalistischer<br />
Produktion, sondern sie sind<br />
Teil der kapitalistischen Wirtschaftsform.<br />
3. Wenn die Produktivkraftsteigerung<br />
verallgemeinert wird, so wird insgesamt<br />
die spezielle Ware weniger Tauschwert<br />
erzielen. Damit sinkt verhältnismäßig<br />
zum eingesetzten Kapital G das durch<br />
den Produktions- und Tauschprozess<br />
gewonnene Kapital G’ durchschnittlich.<br />
Die Durchschnittsprofitrate müsste<br />
demnach tendenziell in der Branche<br />
sinken, da zwar in festes Kapital investiert<br />
wurde, aber zugleich V und M<br />
nicht steigen müssen. Diese Argumentation<br />
ist - gerade bei »orthodoxen<br />
<strong>Marx</strong>-Interpreten« der Drehund Angelpunkt<br />
für die Krisenanfälligkeit des<br />
Kapitalismus.<br />
Absolute Mehrwertsteigerung - Die absolute<br />
Mehrwertsteigerung setzt bei dem<br />
Verhältnis zwischen V und M an. Diese<br />
Relation drückt sich in der so genannten<br />
Mehrwertrate (M geteilt durch V) aus.<br />
Dabei wird anhand der Arbeitsstunden<br />
verglichen, welcher Anteil der Arbeitszeit<br />
61
der Arbeiter für seine Reproduktion<br />
(Lohn) arbeitet und wie viele Arbeitsstunden<br />
dem Mehrwert des Kapitalisten zuzuschlagen<br />
sind. Wird zum Beispiel die wöchentliche<br />
Arbeitszeit von 35 auf 40<br />
Stunden gesteigert ohne dass der Lohn erhöht<br />
wird, so hat der Kapitalist seine<br />
Mehrwertrate für sich günstiger gestaltet,<br />
da M steigt, V aber gleich bleibt. Auch die<br />
absolute Mehrwertsteigerung birgt immense<br />
gesellschaftliche Probleme:<br />
1. Setzt man einmal voraus, dass der<br />
Kapitalist nicht automatisch mit einer<br />
absoluten Mehrwertsteigerung auch<br />
die Produktion ausweiten wird, weil das<br />
wesentlich davon abhängt, ob die Ware<br />
sich auf dem Warenmarkt entsprechend<br />
behaupten kann, führt die Steigerung<br />
logischerweise zur höheren Arbeitslosigkeit.<br />
Mit weniger Arbeitern<br />
kann so der gleiche Mehrwert geschaffen<br />
werden. Wirtschaftlich bedeutet<br />
das für den einzelnen Kapitalisten einen<br />
Vorteil. Andererseits - und das<br />
zeigt sich auch in der gegenwärtigen<br />
Krise des Kapitalismus - sinkt gesamtgesellschaftlich<br />
natürlich auf Dauer<br />
auch die Massenkaufkraft in der Bevölkerung.<br />
2. Auch bei der absoluten Mehrwertrate<br />
gilt, dass eine Überproduktion oder<br />
Überakkumulation auftreten kann, bei<br />
der die Waren nicht mehr zu G’ verwertet<br />
werden können.<br />
Bevor <strong>Marx</strong> allerdings den tendenziellen<br />
Fall der Profitrate behandelt, wird im<br />
zweiten Band der Zirkulationsprozess, die<br />
Realisierung des Profits näher analysiert.<br />
Darunter zählen vor allem die Bedeutung<br />
der Umlaufzeiten, Zirkulations- und<br />
Transportkosten und die Buchhaltung. Dieser<br />
Band soll hier nicht näher betrachtet<br />
werden. Fakt ist aber, dass er auch <strong>heute</strong><br />
noch interessante und wesentliche Fragen<br />
enthält.<br />
Als Beispiel ist die Frage zu benennen, ob<br />
Transport und Logistik als Wert in die<br />
Ware oder nur als Kostenfaktor eingeht.<br />
Der Komplex der Logistik und Transportkosten,<br />
aber auch der weltweiten Absatzmärkte<br />
hat für eine weltweit vernetzte Produktion<br />
der »Global Player« immense<br />
Bedeutung.<br />
II. Die marxistische Krisenerklärung<br />
A. Die Besonderheit der <strong>Marx</strong>istischen<br />
Wirtschaftstheorie<br />
Anders als liberale Wirtschaftstheorien ist<br />
die <strong>Marx</strong>sche Kritik der politischen Ökonomie<br />
eine Theorie, die von der Krisenhaftigkeit<br />
des Kapitalismus als Normalfall<br />
ausgeht, gleichwohl es Prosperitätsphasen<br />
geben kann.<br />
Mit der <strong>Marx</strong>schen Erklärung von Krisen<br />
befinden wir uns in einer der umstrittensten<br />
und zugleich spannendsten Diskussionen<br />
marxistischer Theoriebildung. Grob<br />
gesagt, kann man dabei zwei wesentliche<br />
»Lager« in der Diskussion ausmachen:<br />
1. »Orthodox« argumentierende <strong>Marx</strong>isten<br />
beziehen sich in der Regel auf<br />
das »Gesetz zum tendenziellen Fall der<br />
Profitrate« als Erklärung für Krisen in<br />
der kapitalistischen Wirtschaft. Dieses<br />
Gesetz entwickelt <strong>Marx</strong> im dritten<br />
Band des Kapitals und soll demnach<br />
der wesentliche Grund sein, weshalb<br />
62<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
der Kapitalismus auf Dauer zusammenbrechen<br />
müsse.<br />
2. »Unorthodox« argumentierende<br />
<strong>Marx</strong>isten beziehen sich in der Regel<br />
auf einen weiter gefassten Krisenbegriff.<br />
Dabei werden - so von Michael<br />
Heinrich - einerseits editorische <strong>Argumente</strong><br />
2 geltend gemacht, wie inhaltlich<br />
darauf verwiesen, dass <strong>Marx</strong> im dritten<br />
Band des Kapitals durchaus unterschiedliche<br />
Begründungen für Krisen<br />
gebe. Vor allem der fünfte Abschnitt,<br />
der das zinstragende Kapital betrifft,<br />
gerät damit zusätzlich in den Blick.<br />
Im Folgenden werde ich zunächst die<br />
»klassische Erklärung« und danach die<br />
»modernere« Lesart vorstellen. Im zweiten<br />
Teil zu den marxistischen Grundlagen<br />
wird sich dann zeigen, dass die »modernere«,<br />
»unorthodoxere« Variante für die Erklärung<br />
der heutigen Tendenzen des Kapitalismus<br />
mehr beizutragen hat.<br />
B. Der tendenzielle Fall der Profitrate<br />
und der »Orthodoxe« Erklärung von<br />
Krisen<br />
Anders als liberale Wirtschaftstheorien<br />
oder aber auch die keynesianische Wirtschaftstheorien<br />
baut die marxistische Kritik<br />
an der politischen Ökonomie darauf<br />
auf, dass Krisen keine Ausnahme im kapitalistischen<br />
System sind, sondern logische<br />
Konsequenz. Das setzt eine Erklärung voraus,<br />
wie Krisen im Kapitalismus entstehen.<br />
<strong>Marx</strong> selbst hat dazu das »Gesetz des tendenziellen<br />
Falls der Profitrate« entwickelt,<br />
das jenseits älterer Erklärungsmodelle begründen<br />
soll, warum die Durchschnittsprofitrate<br />
tendenziell sinkt und dies die regelmäßig<br />
eintretenden Krisen bedinge.<br />
Im Kern geht es <strong>Marx</strong> dabei darum, dass<br />
Konkurrenzverhältnisse zwischen den Kapitalisten<br />
die Jagd nach Extraprofiten soweit<br />
antreibt, dass die gesellschaftliche<br />
Produktivkraftentwicklung angeheizt wird<br />
und sich immer aufs Neue verallgemeinert.<br />
Dies führt - wie oben bereits angedeutet -<br />
zu sinkenden Werten, Überproduktion und<br />
auch zu einer gesunkenen Durchschnittsprofitrate.<br />
Arbeitslosigkeit und Verelendung<br />
sind die weiter gehenden Folgen. Zugleich<br />
wird es auf Dauer zu einer<br />
Überakkumulation und -produktion kommen,<br />
weil die produzierten Waren kaum<br />
noch verkauft werden können und damit<br />
der Tauschprozess GW- G’ noch vor der<br />
Realisierung des Profits unterbrochen<br />
wird. Die kapitalistische Produktivkraftentwicklung<br />
und der tendenzielle Fall der<br />
Profitrate sind ohne einander daher nicht<br />
zu denken.<br />
Allerdings ist <strong>Marx</strong> weit davon entfernt,<br />
ein einfaches Gesetz zu formulieren. Es<br />
handelt sich lediglich um einen tendenziellen<br />
Fall der Profitrate, dem im gesellschaftlichen<br />
Gesamtprozess auch Faktoren<br />
entgegen stehen. Überakkumulationskrisen<br />
in einzelnen Branchen lassen<br />
sich nicht unmittelbar auf die gesamte<br />
Wirtschaft übertragen. Die entscheidende<br />
Frage ist vielmehr immer, ob der Tausch-<br />
2 <strong>Marx</strong> konnte selbst nur den ersten Band des Kapitals<br />
selbst herausgegeben. Der zweite und dritte<br />
Band wurde nach <strong>Marx</strong>’ Tod von Friedrich Engels<br />
(in ihrem mehr oder weniger ausgearbeiteten Zustand)<br />
zusammengestellt und geordnet. Im Bezug<br />
auf die Krisentheorie wird dabei deutlich, dass<br />
Engels mit der Anordnung und mit den Überschriften<br />
zu den Textteilen bereits das »Gesetz<br />
vom tendenziellen Fall der Profitrate« in den Vordergrund<br />
stellte, ohne dass das systematisch von<br />
<strong>Marx</strong> so gedacht gewesen sein muss (vgl. Heinrich<br />
2001: 357f.).<br />
63
prozess, der Zirkulationsprozess, G-W-G’<br />
gestört wird.<br />
Um die sinkende Profitrate zu erklären<br />
greift <strong>Marx</strong> auf ein Beispiel zurück. Dazu<br />
setzt er fest, dass der Arbeiter die Hälfte<br />
der Arbeitszeit für den Mehrwert und die<br />
Hälfte für seine Reproduktion arbeite. Er<br />
setzt dann pro Woche 100 Pfd. St. als variables<br />
Kapital an.<br />
Die entscheidende Frage ist nun, wie sich<br />
die Höhe des konstanten Kapitals auswirkt.<br />
Unter dieser Voraussetzung (einer<br />
Mehrwertrate m/v von 100%) ergibt sich<br />
folgende Profitrate:<br />
» Wenn c = 50, v = 100, so ist p’= 100/150<br />
= 66 2/3 %<br />
Wenn c = 100, v = 100, so ist p’= 100/200<br />
= 50 %<br />
Wenn c = 200, v = 100, so ist p’= 100/300<br />
= 33 1/3 %<br />
Wenn c = 300, v = 100, so ist p’= 100/400<br />
= 25 %<br />
Wenn c = 400, v = 100, so ist p’= 100/500<br />
= 20 % «<br />
(MEW 25: 221)<br />
Wenn sich diese Profitrate in allen wesentlichen<br />
Sparten der Wirtschaft so entwikkelt,<br />
könne man dann eben auch von einer<br />
insgesamt sinkenden Durchschnittsprofitrate<br />
ausgehen: »Die im Eingang hypothetisch<br />
aufgestellte Reihe drückt also die<br />
wirkliche Tendenz der kapitalistischen<br />
Produktion aus. Diese erzeugt mit der fortschreitenden<br />
relativen Abnahme des variablen<br />
Kapitals gegen das konstante eine<br />
steigend höhere organische Zusammensetzung<br />
des Gesamtkapitals, deren unmittelbare<br />
Folge ist, daß die Rate des Mehrwerts<br />
bei gleichbleibenden und selbst bei steigendem<br />
Exploitationsgrad der Arbeit sich<br />
in einer beständig sinkenden allgemeinen<br />
Profitrate ausdrückt. (Es wird sich weiter<br />
zeigen, warum dies Sinken nicht in dieser<br />
absoluten Form, sondern mehr in Tendenz<br />
zum progressiven Fall hervortritt.) Die<br />
progressive Tendenz der allgemeinen Profitrate<br />
zum Sinken ist also nur ein der kapitalistischen<br />
Produktionsweise eigentümlicher<br />
Ausdruck für die fortschreitende<br />
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft<br />
der Arbeit.« (MEW 25: 222f.)<br />
Bezieht man die gewöhnlichen konjunkturellen<br />
Wellen mit ein, ergäbe sich bei <strong>Marx</strong>’<br />
Argumentation also folgendes Bild:<br />
Abnehmender Mehrwert, weniger Arbeitsplätze,<br />
steigende gesellschaftliche Produktivkraft.<br />
Entscheidender ist aber, dass die Mehrwertrate<br />
in einer Zusammensetzung noch<br />
nichts über den erzielten Profit aussagen<br />
muss: »In Ländern von verschiedener Entwicklungsstufe<br />
der kapitalistischen Produktion<br />
und daher von verschiedener organischer<br />
Zusammensetzung des Kapitals<br />
kann die Rate des Mehrwerts (der eine<br />
Faktor, der die Profitrate bestimmt) höher<br />
stehen in dem Lande, wo der normale Arbeitstag<br />
kürzer ist, als in dem, wo er länger.<br />
Erstens: Wenn der englische Arbeitstag<br />
von 10 Stunden seiner höhern Intensität<br />
wegen gleich ist einem österreichischen<br />
Arbeitstag von 14 Stunden, können bei<br />
gleicher Teilung des Arbeitstags 5 Stunden<br />
Mehrarbeit [gemeint ist »m«, tg] dort einen<br />
höheren Wert auf dem Weltmarkt dar-<br />
64<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
stellen als 7 Stunden hier. Zweitens aber<br />
kann dort ein größrer Teil des Arbeitstags<br />
Mehrarbeit bilden als hier.« (<strong>Marx</strong> 2003:<br />
MEW 25: 225)<br />
Mit anderen Worten: Die billige Polemik<br />
der Kapitalisten, die sich gerade <strong>heute</strong> in<br />
unsäglichen Standortdebatten seitens der<br />
Unternehmerverbände abbilden, greifen zu<br />
kurz: Nicht die Arbeitszeit oder die<br />
»Lohnnebenkosten« sind allein entscheidend,<br />
sondern die Produktivität, die sich in<br />
Lohnstückkosten ausdrücken lässt. Und<br />
dieser Stand gesellschaftlicher Produktivität<br />
hängt von sehr viel mehr ab, als die<br />
Standortdiskussionen behaupten (z. B. vom<br />
Bildungs- und Gesundheitssystem, den<br />
Absatzmärkten etc.).<br />
Allerdings sollte man sich klar machen,<br />
dass diesem tendenziellen Fall der Profitrate<br />
insgesamt sechs Ursachen entgegen wirken<br />
können:<br />
1. Erhöhung des Exploitationsgrades<br />
der Arbeit<br />
2. Herunterdrücken des Arbeitslohns<br />
unter seinen Wert<br />
3. Verwohlfeilerung der Elemente des<br />
konstanten Kapitals<br />
4. Die relative Überbevölkerung<br />
5. Der auswärtige Handel<br />
6. Die Zunahme des Aktienkapitals<br />
<strong>Marx</strong> kehrt diesbezüglich die Blickrichtung<br />
um: »Wenn man die enorme Entwicklung<br />
der Produktivkräfte der gesellschaftlichen<br />
Arbeit selbst nur in den<br />
letzten 30 Jahren, verglichen mit allen früheren<br />
Perioden, betrachtet, wenn man namentlich<br />
die enorme Masse von fixem Kapital<br />
betrachtet, das außer der eigentlichen<br />
Maschinerie in die Gesamtheit des gesellschaftlichen<br />
Produktionsprozesses eingeht,<br />
so tritt an die Stelle der Schwierigkeit, welche<br />
bisher die Ökonomen beschäftigt hat,<br />
nämlich den Fall der Profitrate zu erklären,<br />
die umgekehrte, nämlich zu erklären, warum<br />
dieser Fall nicht größer oder rascher<br />
ist.« (MEW 25: 242) Die sechs entgegen<br />
wirkenden Ursachen, die einen rapiden Fall<br />
der Profitrate verhindern, beschreibt <strong>Marx</strong><br />
näher:<br />
Erhöhung des Exploitationsgrades der<br />
Arbeit (MEW 25: 242-245) - Die Erhöhung<br />
der Mehrarbeit (absolute Mehrwertsteigerung)<br />
und Intensivierung der Arbeit<br />
(relative Mehrwertsteigerung) kann die<br />
Mehrwertrate insgesamt im Verhältnis<br />
zum steigenden konstanten Kapital vermehren.<br />
Sieht man sich die seit den 1980er<br />
Jahren immer wieder geführten Diskussionen<br />
um längere Arbeitszeiten an, so kann<br />
man die Brisanz unmittelbar erkennen.<br />
Herunterdrücken des Arbeitslohnes unter<br />
seinen Wert (MEW 25: 245) - <strong>Marx</strong><br />
führt dieses Argument nicht näher aus,<br />
verweist allerdings auf den Konkurrenzaspekt,<br />
der nicht nur zwischen den Kapitalisten,<br />
sondern auch unter den Arbeitern<br />
(Stichwort: Reservearmee) wirkt. Auch<br />
hier hat die real seit den 1980er Jahren fallende<br />
Lohnentwicklung und die gleichzeitig<br />
steigende Arbeitslosenzahl einen empirischen<br />
Nachweis geliefert.<br />
Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten<br />
Kapitals (MEW 25: 245f.) - Bei<br />
dem dritten Aspekt handelt es sich um das<br />
Vehältnis der Masse des konstanten Kapitals<br />
zu seinem Wert. Dabei wird davon ausgegangen,<br />
dass eine starke Erhöhung der<br />
Masse nicht zwangsläufig bedeutet, dass<br />
der Wert dieser Masse im gleichen Maß<br />
65
steigt. Anhand eines Beispiels: Werden<br />
statt 10 CDs 1.000 CDs gepresst, so steigt<br />
der Wert des eingehenden Kapitals nicht<br />
zwangsläufig um das Hundertfache. Auch<br />
die Produktion der 1.000 CD-Rohlinge<br />
unterliegt einem Fall der Profitrate und damit<br />
der Verbilligung der Ware, so dass der<br />
Wert des eingebrachten fixen Kapitals insgesamt<br />
in der CD-Pressung geringer wird,<br />
zumal die Abnutzung der Maschinen bei<br />
höherer Produktion pro CD sinkt. Gerade<br />
in der modernen Massenproduktion, wie<br />
sie sich mit dem Fordismus durchgesetzt<br />
hat, führt dieser Aspekt zu einer günstigeren<br />
Konstellation in der Profitrate.<br />
Die relative Überbevölkerung (MEW 25:<br />
246f.) - In entwickelten kapitalistischen<br />
Gesellschaften werden für die Produktion<br />
immer weniger Arbeiter benötigt. Dies<br />
wirkt sich nicht nur auf die Konkurrenz der<br />
Arbeiter aus (vgl. 2.), sondern auch darauf,<br />
dass neue Produktionszweige (mit anfänglich<br />
günstigerer Profitrate) aufgebaut werden<br />
können. Mit anderen Worten: Der angehäufte<br />
Reichtum und die<br />
gesellschaftliche Produktivkraft sind so<br />
hoch, dass nicht mehr die Arbeit aller notwendig<br />
ist, um die Reproduktion der Gesellschaft<br />
abzusichern. Arbeitslosigkeit ist<br />
insofern ein Anzeichen für (falsch verteilten!!!)<br />
Reichtum der Gesellschaft. Diese<br />
Arbeitslosigkeit kann aber in anderen gesellschaftlichen<br />
Arbeitsbereichen genutzt<br />
werden. Die Diskussionen um ein nachhaltiges<br />
Wachstum und gesellschaftlichen Innovationen<br />
haben in diesem Aspekt ihren<br />
theoretischen Ort. In dem Moment, wo die<br />
Umwelttechnologien und die Hochtechnologie<br />
beispielsweise in Deutschland gefördert<br />
werden, können hoch produktive<br />
Arbeitsplätze mit hohen Qualifizierungsniveaus<br />
geschaffen werden, die zugleich<br />
verhältnismäßig zu anderen Branchen eine<br />
positive Profitrate haben und dadurch insgesamt<br />
positiv wirken und zugleich ein gesellschaftlich<br />
zunehmend wichtiges Feld<br />
abdecken.<br />
Der auswärtige Handel (MEW 25: 247-<br />
250) - Auch der auswärtige Handel kann<br />
für <strong>Marx</strong> ein stabilisierender Faktor sein:<br />
»Kapitale, im auswärtigen Handel angelegt,<br />
können eine höhere Profitrate abwerfen,<br />
weil hier erstens mit Waren konkurriert<br />
wird, die von anderen Ländern mit<br />
minderen Produktionsleichtigkeiten produziert<br />
werden, so daß das fortgeschrittenste<br />
Land seine Waren über ihrem Wert verkauft,<br />
obgleich wohlfeiler als die<br />
Konkurrenzländer. « (MEW 25: 247f.)<br />
Auch dieser Aspekt findet sich in den gegenwärtigen<br />
gesellschaftlichen Diskussionen<br />
wieder. Einfach gesagt: Der »Exportweltmeister<br />
Deutschland« fürchtet um<br />
seine Vorherrschaft, die durch eine höhere<br />
Produktivität zustande kommt. Ein weiterer<br />
Aspekt ist in diesem Zusammenhang in<br />
den Entwicklungstheorien und Handelsabkommen<br />
zu sehen. Dieser Aspekt bleibt<br />
aber hinter dem Blickpunkt der internationalen<br />
Solidarität ein nach wie vor problematischer<br />
Pfad, der hier nicht näher betrachtet<br />
werden kann.<br />
Die Zunahme des Aktienkapitals (MEW<br />
25: 250) - Wenn Kapitalisten mit Aktienkapital<br />
arbeiten, so geht dieses Kapital zwar<br />
vollständig in den Produktionsprozess ein<br />
und wird dadurch für die Mehrwertproduktion<br />
nutzbar. Allerdings wird als Dividende<br />
nicht der Anteil des Profits gezahlt,<br />
sondern nur ein geringerer Anteil. Dadurch<br />
wird das konstante Kapital relativ<br />
zum Mehrwert insgesamt für den Kapitalisten<br />
gedrückt, ohne dass die Profitrate dies<br />
66<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
vom tatsächlich eingesetzten Kapital hergibt.<br />
Dieser - gerade für die heutige Zeit -<br />
entscheidende Faktor wird bei <strong>Marx</strong> nicht<br />
näher ausgeführt. Ohne näher darauf einzugehen<br />
lässt sich aber feststellen, dass gerade<br />
das Aktienkapital einen nicht unwesentlichen<br />
Unsicherheitsfaktor darstellt, da<br />
die Aktienbesitzer ihrerseits durch Anund<br />
Verkauf Gewinne steigern wollen.<br />
Selbst bei diesen entgegen wirkenden Ursachen<br />
für eine lediglich progressiv fallende<br />
Profitrate sieht <strong>Marx</strong> allerdings einen tendenziellen<br />
Fall gegeben. Bevor wir eine<br />
vorläufige erste Bilanz für die sozialistische<br />
Strategie ziehen, müssen wir daher noch<br />
kurz auf die Entfaltung der »inneren Widersprüche<br />
des Gesetzes«, das fünfzehnte<br />
Kapitel des dritten Bandes und die Verteilung<br />
des relativen Profits in die Arten des<br />
gesellschaftlichen Reichtums eingehen.<br />
Die Formel der Profitrate enthält - und an<br />
dieser einen Stelle ist der Begriff berechtigt<br />
- eine widersprüchliche Entwicklung mit<br />
weit reichenden gesellschaftlichen Folgen:<br />
Auf der einen Seite wird der Mehrwert<br />
über menschliche Arbeit benötigt, der sich<br />
in Profiten realisieren kann, andererseits<br />
wird - um einen Extraprofit zu realisieren<br />
oder um mitzuhalten - die Produktivkraft<br />
ständig revolutioniert, womit die Arbeit<br />
entwertet wird.<br />
So »verlangsamt« der »Fall die Bildung<br />
neuer selbständiger Kapitale und erscheint<br />
so als bedrohlich für die Entwicklung des<br />
kapitalistischen Produktionsprozesses, er<br />
befördert Überproduktion, Spekulation,<br />
Krisen, überflüssiges Kapital neben überflüssiger<br />
Bevölkerung (...) Das wichtige<br />
aber in ihrem [der Ökonomen, tg] Horror<br />
vor der fallenden Profitrate ist das Gefühl,<br />
daß die kapitalistische Produktionsweise<br />
an der Entwicklung der Produktivkräfte<br />
eine Schranke findet, die nichts mit der<br />
Produktion des Reichtums als solcher zu<br />
tun hat; und diese eigentümliche Schranke<br />
bezeugt die Beschränktheit und den nur<br />
historischen, vorübergehenden Charakter<br />
der kapitalistischen Produktions-weise; bezeugt,<br />
daß sie keine für die Produktion des<br />
Reichtums absolute Produktionsweise ist,<br />
vielmehr mit seiner Fortentwicklung auf<br />
gewisser Stufe in Konflikt tritt.« (MEW<br />
25: 252)<br />
<strong>Marx</strong> hat damit eine Erklärung für eine offensichtlich<br />
paradoxe bzw. zynische gesellschaftliche<br />
Situation hergeleitet: Überakkumulation<br />
von Kapital, brachliegendes<br />
bzw. vernichtetes Kapital, »ungeheure Warensammlung«<br />
einerseits, neben extremer<br />
Armut und gesellschaftlicher Repression<br />
andererseits. Keine andere Wirtschaftstheorie<br />
ist in der Lage, die Gegensätze der<br />
Gesellschaft in ihrem inneren Zusammenhang<br />
so präzise zu beschreiben wie die<br />
marxistische.<br />
Für den Kapitalisten ergibt sich so das Risiko,<br />
zwar den Wert der Arbeitskraft exploitiert<br />
(also in der Ware vergegenständlicht<br />
zu haben), aber den Wert nicht als<br />
Profit realisieren zu können, wenn Waren<br />
nicht mehr zu einem vertretbaren Preis zu<br />
verkaufen sind, bei gleichzeitig vorangetriebener<br />
Produktivkraftentwicklung und<br />
erhöhten Produktionskapazitäten, die zur<br />
Notwendigkeiten führen, »den Markt beständig«<br />
auszudehnen (MEW 25: 253).<br />
Dieser Zwang zum Ausdehnen des Marktes<br />
hat Rosa Luxemburg später in den treffenden<br />
Begriff der »Landnahme des Kapitalismus«<br />
gefasst, der vor allem auf den<br />
Imperialismus bezogen war. Die imperiali-<br />
67
stische Politik im Vorfeld des Ersten Weltkriegs<br />
war demnach vor allem eine Auseinandersetzung<br />
um Absatzmärkte und Rohstoffe,<br />
also Landnahme von vorher<br />
nicht-kapitalistischen Milieus und Bereichen<br />
durch den Kapitalismus, die sein<br />
Überleben sichern.<br />
Allerdings reproduzieren sich Krisenzyklen<br />
selbst, da die Widersprüche eben auch<br />
widerstrebende Faktoren aufweisen. Entscheidend<br />
ist dabei letztendlich eine präzise<br />
Analyse der jeweiligen Krisenfaktoren,<br />
die zu einer Krise geführt haben. Stark verkürzt<br />
lassen sich mögliche Krisenzyklen in<br />
einem Schaubild darstellen, das allerdings<br />
nur die rudimentäre <strong>Marx</strong>sche Argumentation<br />
nachzeichnet. Gerade der volkswirtschaftliche<br />
Gesamtprozess lässt sich nur<br />
andeutungsweise bei <strong>Marx</strong> nachvollziehen,<br />
daher hat gerade die Krisentheorie und die<br />
gesamtwirtschaftliche Perspektive im 20.<br />
Jahrhundert in der marxistischen Theoriebildung<br />
großen Raum eingenommen. Diese<br />
Positionierung ist aber in der marxistischen<br />
Forschung durchaus umstritten.<br />
Auf der folgenden Seite ist die »orthodoxe<br />
Krisenerklärung« nach <strong>Marx</strong> in groben<br />
Zügen in ein Schaubild gefasst. Dabei wird<br />
zwischen der Unternehmens- und Branchenebene<br />
einerseits und der gesamtwirtschaftlichen<br />
Ebene andererseits unterschieden.<br />
Dabei muss man sich klar machen, dass die<br />
<strong>Marx</strong>sche Krisentheorie im Dritten Band<br />
von ihm nicht konsistent durchgehend bearbeitet<br />
werden konnte, sondern der Text<br />
eine nachträgliche Zusammenfassung von<br />
Textteilen durch Friedrich Engels darstellt.<br />
C. Der tendenzielle Fall der Profitrate<br />
auf dem Prüfstand – »Unorthodoxe«<br />
Erklärung von Krisen<br />
Die Profitrate, wie sie von <strong>Marx</strong> entwickelt<br />
wird, ist umstritten, auch was den Stellenwert<br />
in <strong>Marx</strong>’ Kapital angeht. Neben den<br />
Versuchen nachzuweisen, dass der tendenzielle<br />
Fall der Profitrate genauso zutrifft<br />
(wie von ihm beschrieben), gibt es allerdings<br />
auch Positionen, die versuchen, eine<br />
allgemeinere Perspektive zu finden. Eine<br />
gute Argumentation findet sich bei Michael<br />
Heinrich (Heinrich 2004: 148-153;<br />
Heinrich 2001: 327-341).<br />
An dieser Stelle soll nicht in allen Einzelheiten<br />
die wissenschaftlich fundierte Kritik<br />
von Michael Heinrich nachvollzogen, sondern<br />
eine generelle Argumentationslinie<br />
skizziert werden. Wenn die relative Mehrwertproduktion,<br />
der Kampf um Extraprofite<br />
der Grund für den tendenziellen Fall<br />
der Durchschnittsprofitrate sein soll, so<br />
lassen sich drei allgemeine Bedenken und<br />
eine immanente Kritik gegen diese<br />
Schlussweise äußern:<br />
1. Eine Durchschnittsprofitrate setzt an<br />
dem Vergleich einer Warenproduktion,<br />
quasi einer Branche, an. <strong>Marx</strong> Argumentation<br />
versucht also den tendenziellen<br />
Fall der Durchschnittsprofitrate<br />
an einer Kapitalie nachzuweisen und<br />
damit ein allgemeines Gesetz zu begründen.<br />
Man kann an dieser Stelle<br />
fragen, ob diese Verallgemeinerung auf<br />
eine Gesetzlichkeit tatsächlich angenommen<br />
werden kann. Dabei muss beachtet<br />
werden, dass die Krise sich im<br />
Kreislauf zwischen G-W-G’ abspielt<br />
und eine Unterbrechung zwischen Kapitaleinsatz,<br />
Produktion und Kapitalak-<br />
68<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
kumulation durch die Distribution der<br />
Ware sein muss. Diese Unterbrechung<br />
kann aber - neben brancheninternen<br />
Gründen der Konkurrenz - durchaus<br />
gerade in der Wechselwirkung zwischen<br />
unterschiedlichen Branchen liegen.<br />
Damit wäre der tendenzielle Fall<br />
der Durchschnittsprofitrate eine<br />
durchaus logische Folgerung, wenn es<br />
um einzelne Branchen und die Konkurrenzverhältnisse<br />
zwischen den Kapitalisten<br />
geht, nicht aber die einzige<br />
Krisenerklärung. Jede Krise müsste<br />
dann gesondert untersucht und geklärt<br />
werden.<br />
2. Eine Krisenerklärung kann nicht allein<br />
aus der Produktionssphäre erklärt<br />
werden, das unterschätzt wesentlich die<br />
Wechselwirkung zwischen den Branchen,<br />
aber auch andere Einflussfaktoren:<br />
Die Sphäre der Distribution (Verteilung<br />
von Waren), die staatliche<br />
Flankierung der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
und die Bedeutung des internationalen<br />
Finanzkapitals.<br />
3. Eine weitere wesentliche Einschränkung<br />
ergibt sich durch die Einbeziehung<br />
mehrerer Produktionsbereiche:<br />
Gesellschaftliche Basisinnovationen<br />
(wie es die informationstechnologische<br />
Revolution seit den 1970er Jahren<br />
war), können über einen beschränkten<br />
Zeitraum eine wirtschaftliche Prosperität<br />
erlangen. Das Schaffen neuer<br />
Märkte, die »extensive Akkumulation«,<br />
kann wirtschaftliche Prosperität auch<br />
in anderen Branchen herbeiführen.<br />
Das ändert nichts daran, dass<br />
die beschriebenen Krisenphänomene<br />
Teil kapitalistischer Produktionsweise<br />
sind.<br />
4. Michael Heinrich fügt seiner Erklärung<br />
allerdings auch noch eine immanente<br />
Kritik des tendenziellen Falls der<br />
Profitrate an, die hier - in sehr groben<br />
Zügen - nachvollzogen werden soll.<br />
Betrachtet man sich noch einmal die<br />
Formel der Profitrate, so bleibt eine wesentliche<br />
Relation bei dem tendenziellen<br />
Fall außen vor: Das Verhältnis von<br />
festem Kapital (C) zu variablen Kapital<br />
(V). Es wird nämlich vorausgesetzt,<br />
dass das feste Kapital so stark ansteigt,<br />
dass (V) und damit nachfolgend der<br />
Mehrwert nicht folgen können und dadurch<br />
insgesamt die Profitrate fällt. Das<br />
ist aber nur eine mögliche Entwicklung,<br />
keine zwangsläufige. Michael<br />
Heinrich verdeutlicht das durch eine<br />
mathematische Erweiterung: Er erweitert<br />
den Bruch der Profitrate um V (vgl.<br />
Heinrich 2004: 150):<br />
M M/V M/V<br />
–––––––– = ––––––––– = –––––––<br />
C + V C/V + V/V C/V + 1<br />
Diese mathematisch erweiterte Formel<br />
macht die Bedingung deutlich, unter<br />
der man annehmen kann, dass ein Gesetz<br />
zum tendenziellen Fall der Profitrate<br />
vorliegt. Das Gesetz setzt nämlich<br />
voraus, dass das Verhältnis von festem<br />
Kapital zum Lohn prinzipiell schneller<br />
steigen müsse als die Mehrwertrate und<br />
genau das - so meint Michael Heinrich<br />
- kann, muss aber nicht der Fall sein.<br />
Eine allgemeine Aussage über das Ausmaß<br />
des Steigens von c / v könne es<br />
nicht geben (Heinrich 2004: 151).<br />
Diese Argumentation lässt sich vielleicht<br />
an einem praktischen Beispiel besser nachvollziehen:<br />
69
In einem Unternehmen werden gleichzeitig<br />
neue Maschinen eingesetzt und auch<br />
die wöchentliche Arbeitszeit von 35 auf 40<br />
Stunden ohne Lohnausgleich pro Woche<br />
erhöht. Durch beide Maßnahmen wird das<br />
Verhältnis c/v und das Verhältnis m/v beeinflusst.<br />
Das eingesetzte feste Kapital<br />
steigt, während v sinkt. Allerdings steigt<br />
zugleich auch m an. Daher hängt es für die<br />
Entwicklung der Profitrate davon ab, wie<br />
sich das Verhältnis m / v und c / v+1 gestaltet.<br />
Das kann für den Einzelfall entwickelt<br />
werden, bedeutet aber noch kein allgemeines<br />
Gesetz für den tendenziellen Fall der<br />
durchschnittlichen Profitrate, schon gar<br />
nicht branchenübergreifend. Mit anderen<br />
Worten: Gelingt es dem Kapitalisten, die<br />
absolute Mehrwertsteigerung mit einer relativen<br />
zu verbinden, so kann die Profitrate<br />
trotz Entlassungen wieder steigen. Das ist<br />
allerdings eine Variante, die nicht zuletzt<br />
kulturell beschränkt ist. Das beste Beispiel<br />
für diese Diskussion ist die Wiedereinführung<br />
der 40 Stundenwoche: Diese kann<br />
zwar - wenn sie ohne oder über einen geringen<br />
Lohnausgleich durchgesetzt würde<br />
- kurzfristig eine durchschnittliche Profitrate<br />
in einer Branche stabilisieren, ändert<br />
aber an der Entwicklungsdynamik nur<br />
mittelfristig etwas. Da die Ausweitung des<br />
absoluten Mehrwerts auf natürliche und<br />
kulturelle Grenzen stößt und zudem von<br />
immensen sozialen Folgen und noch stärkerer<br />
Ausbeutung der ArbeiterInnen erkauft<br />
ist, kann es sich bei diesem Weg um<br />
keine wünschenswerte gesellschaftliche<br />
Entwicklung handeln.<br />
Für den weiter gefassten Krisenbegriff wird<br />
die Möglichkeit, dass es zu einem tendenziellen<br />
Fall der durchschnittlichen Profitrate<br />
kommt, nicht ausgeschlossen, nur,<br />
dass das eine nicht-umkehrbare und<br />
zwangsläufige auftretende Entwicklung<br />
sei, wird bestritten. Die Krisenursachen für<br />
(nicht-konjunkturelle, langfristige) Krisen<br />
müssen dann für jede historische Phase neu<br />
geprüft und dargestellt werden - Krisen<br />
sind nicht mehr monokausal zu erklären,<br />
sondern sind differenziert zu begründen,<br />
ohne dass damit die marxistische Argumentation<br />
obsolet geworden wäre. Mit dieser<br />
»Befreiung« von einer monokausalen<br />
Begründung ging auch einher, dass die<br />
weiteren Kapitel des dritten Bandes auf<br />
seine möglichen Krisenmomente überprüft<br />
werden.<br />
Eine zusätzliche Krisenquelle macht dann<br />
vor allem der fünfte Abschnitt zum» zinstragenden<br />
Kapital« deutlich, der vor allem<br />
Grundlagen über das Geldkapital und<br />
Bankenwesen enthält. Gerade für das 21.<br />
Jahrhundert, in dem von einem »finanzgesteuertem<br />
Akkumulationsregime « (Aglietta<br />
2000) die Rede ist, beinhaltet dieses Kapitel<br />
einiges für die Diskussion. Vergleiche<br />
zu den weiteren Ausführungen die sehr<br />
gute Zusammenfassung bei Michael Heinrich<br />
(Heinrich 2004: 154-168).<br />
Der Ausgangspunkt ist dabei simpel und<br />
setzt an der bereits bekannten Formel an<br />
und erweitert diese:<br />
G - G - W - G’ - G«<br />
Ein Geldbesitzer leiht einem Produktionskapitalisten<br />
Geld, das dieser als Kapital in<br />
die Produktion einbringt. Von dem über<br />
die Produktion erzielten Mehrwert bzw.<br />
dem erzielten Profit wird dieser in einen<br />
Zins für den Geldkapitalisten und einen<br />
Unternehmergewinn für den Produktionskapitalisten<br />
aufgeteilt. Ob das verliehene<br />
Kapital danach zurückgezahlt wird oder<br />
70<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
nur der Zins ist zunächst unerheblich. Diese<br />
Konstruktion hat wesentliche Folgen auf<br />
das Bewusstsein der beiden Kapitalisten:<br />
Für den Geldkapitalisten stellt sich der<br />
Prozess verkürzt dar als G - G’. Geld wird<br />
hierbei direkt als Kapital eingesetzt. Für<br />
ihn stellt es sich so dar, als »arbeite« sein<br />
Geld. Dies trifft allerdings nicht zu, da sich<br />
der Zins nur aus dem Profit speist, der aus<br />
dem unbezahlten Mehrwert der Arbeiter<br />
stammt. Das Verleihen des Geldes, durch<br />
das es erst zum Kapital wird, belässt das Risiko<br />
jedoch beim Produktionskapitalisten,<br />
denn der Zins kann sich nicht nach dem<br />
tatsächlich realisierten Profit richten, sondern<br />
nach der vor dem Produktionsprozess<br />
abgeschlossenen Vereinbarung.<br />
Der Produktionskapitalist wird selbst den<br />
Eindruck gewinnen, für den Geldkapitalisten<br />
zu arbeiten. Es vollzieht sich also ein<br />
Bewusstseinswandel, den <strong>Marx</strong> drastisch<br />
beschreibt: »Es entwickelt sich daher notwendig<br />
in seinem Hirnkasten die Vorstellung,<br />
daß sein Unternehmergewinn - weit<br />
entfernt, irgendeinen Gegensatz zur Lohnarbeit<br />
zu bilden und nur um bezahlte fremde<br />
Arbeit zu sein - vielmehr selbst Arbeitslohn<br />
ist, Aufsichtslohn, wages of<br />
superintendence of labour, höherer Lohn<br />
als der des gewöhnlichen Lohnarbeiters, 1.<br />
Weil sie kompliziertere Arbeit, 2. weil er<br />
selbst den Arbeitslohn auszahlt. Das seine<br />
Funktion als Kapitalist darin besteht,<br />
Mehrwert, d. h., unbezahlte Arbeit zu produzieren,<br />
und zwar unter den ökonomischsten<br />
Bedingungen, wird vollständig vergessen«.<br />
(MEW 25: 393) Und man könnte<br />
noch für die heutige Zeit ergänzen: Dem<br />
Unternehmer scheint es so, dass der besondere<br />
Arbeitslohn schon dadurch gerechtfertigt<br />
wird, dass er allein das Risiko trägt.<br />
Diese zunächst rein psychologische Beschreibung<br />
ist aber nur eine weniger entscheidende<br />
Folge: Viel wichtiger ist es<br />
<strong>Marx</strong>, die Wirkung des Zinskapitals und<br />
das Zusammenspiel zwischen ihm und<br />
dem Produktionskapital systematisch zu<br />
erklären.<br />
Dabei geht es vordringlich um die Höhe<br />
des Zinsfußes, der - anders als etwa der<br />
durch den Wert vorbestimmte, wenn auch<br />
nicht letztendlich festgelegte Tauschwert -<br />
frei gewählt werden kann. Daher ist auch<br />
die Entwicklung des Zinsfußes sehr viel<br />
mehr an der Frage von Prosperität und<br />
Krise orientiert: »Wenn man die Umschlagszeiten<br />
betrachtet, worin sich die<br />
moderne Industrie bewegt - Zustand der<br />
Ruhe, wachsende Belebung, Prosperität,<br />
Überproduktion, Krach, Stagnation, Zustand<br />
der Ruhe etc., Zyklen, deren weitere<br />
Analyse außerhalb unserer Betrachtung<br />
fällt - so wird man finden, daß meist niedriger<br />
Stand des Zinses den Perioden der<br />
Prosperität oder des Extraprofits entspricht,<br />
Steigen des Zinses der Scheide<br />
zwischen der Prosperität und ihrem Umschlag,<br />
Maximum des Zinses bis zur äußersten<br />
Wucherhöhe aber der Krisis. (...) Der<br />
Zinsfuß erreicht seine äußerste Höhe während<br />
der Krisen, wo geborgt werden muß,<br />
um zu zahlen, was es auch koste.« (MEW<br />
25: 372f.)<br />
Dies hat - im ersten Zugriff - zur Folge,<br />
dass das Verleihgeschäft als eine Art<br />
»Durchlauferhitzer « und Krisenverschärfer<br />
wirkt, eine These, die man mit der<br />
Krise der New Economy und dem Platzen<br />
der Spekulationsblase nur unterstützen<br />
kann. Allerdings betont <strong>Marx</strong> zwei Faktoren,<br />
die den Zuwachs des Zinsfußes vermindern:<br />
71
1. Die Erbschaft von Geld und damit<br />
von potenziellem Geldkapital akkumuliert<br />
sich auf Dauer. Geldbesitzer und<br />
Produktionskapitalisten stützen den<br />
Akkumulationsprozess. Die Konkurrenz<br />
unter den Geldkapitalisten steigt.<br />
Wer sich die sich weiter dramatisch<br />
entwickelnde Ungleichheit in der Verteilung<br />
des Reichtums in den Privathaushalten<br />
der Bundesrepublik in der<br />
heutigen Zeit ansieht, weiß auch, dass<br />
die Umverteilungsmechanismen und<br />
die Rekrutierung des Geldes als Kapital<br />
bestens funktioniert, in den seltensten<br />
Fällen zum Vorteil der privaten Haushalte.<br />
2. Die zweite Entwicklung ist der Entwicklung<br />
des Kreditsystems geschuldet,<br />
das die zunehmende Zentralisierung<br />
von privaten Geldern als Geldkapital<br />
aus allen Klassen der Gesellschaft organisiert<br />
und voran treibt. Auch diese<br />
Entwicklung drücke den Zinsfuß.<br />
Der zweite Faktor wird in dem wesentlichen<br />
Kapitel des Kredit- und Bankenwesens<br />
weitergeführt, das <strong>heute</strong> - in Zeiten<br />
eines global agierenden Finanzsektors zentrale<br />
Bedeutung erlangt.<br />
Auch bezogen auf die Banken führt <strong>Marx</strong><br />
die Analyse auf einen einfachen Kern zurück:<br />
»Mit der Entwicklung des Handels<br />
und der kapitalistischen Produktionsweise,<br />
die nur mit Rücksicht auf die Zirkulation<br />
produziert, wird diese naturwüchsige<br />
Grundlage des Kreditsystems erweitert,<br />
verallgemeinert, ausgearbeitet. Im großen<br />
und ganzen fungiert das Geld hier nur als<br />
Zahlungsmittel, d. h., die Ware wird<br />
verkauft nicht gegen Geld, sondern gegen<br />
ein schriftliches Versprechen der Zahlung<br />
an einem bestimmten Termin.« (MEW<br />
25: 413).<br />
Damit greift ein weiterer Akteur in den<br />
Wechsel von Geld(kapital) ein: »Im Anschluß<br />
an diesen Geldhandel entwickelt<br />
sich die andere Seite des Kreditwesens, die<br />
Verwaltung des zinstragenden Kapitals<br />
oder Geldkapitals, als besondere Funktion<br />
der Geldhändler. Das Borgen und Verleihen<br />
des Geldes wird ihr besondres Geschäft.<br />
Sie treten als Vermittler zwischen<br />
dem wirklichen Verleiher und dem Borger<br />
von Geldkapital. (...) Ihr Profit besteht im<br />
allgemeinen darin, daß sie zu niedrigen<br />
Zinsen borgt, als sie ausleiht.« (MEW 25:<br />
415f.) Dabei gibt es beim Kreditgeld (<strong>heute</strong><br />
Buchgeld genannt) eine Verdoppelung<br />
(vgl. MEW 25: 413ff.): Einerseits wechselt<br />
das tatsächliche Geldkapital seinen Besitzer,<br />
andererseits gibt es einen Schuldschein, der<br />
seinerseits weiter gehandelt werden kann.<br />
Damit entsteht Geld »aus dem Nichts« heraus<br />
und kann ebenso schnell wieder verschwinden,<br />
wenn es beim Borger eingelöst<br />
wird: »Zahle ich 100 Euro Bargeld auf mein<br />
Konto ein, dann befinden sich die 100 Euro<br />
Bargeld in der Kasse der Bank (und können<br />
von der Bank z. B. für einen Kredit verwendet<br />
werden); zugleich wächst mein Kontoguthaben,<br />
über das ich per Scheck oder<br />
Überweisung verfügen kann, um 100 Euro.<br />
Zusätzlich zu den 100 Euro Bargeld, die aus<br />
meiner Tasche in die Kasse der Bank wanderten,<br />
sind also 100 Euro Buch- oder Kreditgeld<br />
auf meinem Konto neu entstanden.«<br />
(Heinrich 2004: 160)<br />
Kreditgeld ist vor allem ein Phänomen des<br />
Bankenwesens, zumal das Bargeld, das eine<br />
Bank halten muss, sehr gering ist. Zudem<br />
kann die Zentralbank frei von Beschränkungen<br />
von einem materiellen Gegenwert<br />
72<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
Geld produzieren und damit den Banken<br />
Kredite verschaffen. Durch den Wegfall<br />
der Koppelung an materielle Ressourcen<br />
(Goldreserven) haben die Banken an Flexibilität<br />
gewonnen, ohne dass dies Krisen<br />
verhindern könnte. Diese Flexibilität<br />
schafft zugleich einen neuen Machtfaktor<br />
der Kreditvergabe. Zugang zu Kapital und<br />
die kapitalistische Steuerung funktioniert<br />
zunehmend über Kreditgeld. Dabei müssen<br />
die Geldvermittler selbst Gewinnzusagen<br />
einhalten - das Geschäft stellt sich für<br />
sie ebenso als gefährlich heraus. Die Diskussion<br />
um die Sicherheit bei der Vergabe<br />
von Krediten ist dann auch ein wesentliches<br />
Thema für Banken, wie die Verhandlungen<br />
von Basel I und II zeigen.<br />
Ein zweiter Weg sich Kapital zu schaffen<br />
ist das Aktienkapital. Aktien sind Unternehmensanteile,<br />
mit denen man einen Anspruch<br />
gegen das Unternehmen erwirbt<br />
(Stimmrecht auf der Aktionärsversammlung)<br />
und ein Anteil am Gewinn (Dividende).<br />
Allerdings handelt es sich bei Aktien<br />
nicht um einen festen Unternehmensanteil,<br />
sondern einen relativen: Verkauft man<br />
seinen Anteil, so tut man das zu den aktuellen<br />
marktüblichen Preisen der Börse, die<br />
mit dem wahren Wert des Unternehmens<br />
nichts zu tun haben. Die Börsenkurse richten<br />
sich viel mehr nach den Erwartungen<br />
an die Gewinne des Unternehmens in der<br />
Zukunft. Damit handelt es sich bei Aktien<br />
ebenso um eine Verdoppelung des Kapitals<br />
(vgl. Heinrich 2004: 163): Das an das Unternehmen<br />
fließende tatsächliche Kapital,<br />
das in den Produktionsprozess eingebracht<br />
wird und andererseits das Zahlungsversprechen<br />
an den Aktienbesitzer.<br />
<strong>Marx</strong> fasst die Ansprüche (Kreditgeld, Aktien,<br />
fest verzinsliche Wertpapiere) als «fiktives<br />
Kapital» zusammen. Das fiktive Kapital<br />
»beschleunigt daher die materielle Entwicklung<br />
der Produktivkräfte und die Herstellung<br />
des Weltmarkts« (MEW 25: 457).<br />
Gleichzeitig ist es aber auch der »Haupthebel<br />
der Überproduktion und Überspekulation<br />
im Handel« (MEW 25: 457) und »beschleunigt<br />
die gewaltsamen Ausbrüche<br />
dieses Widerspruchs, der Krisen« (MEW<br />
25: 457): »Das Kreditwesen beschleunigt<br />
daher die materielle Entwicklung der Produktivkräfte<br />
und die Herstellung des Weltmarkts,<br />
die als materielle Grundlagen der<br />
neuen Produktionsform bis auf einen gewissen<br />
Höhegrad herzustellen, die historische<br />
Aufgabe der kapitalistischen Produktionsweise<br />
ist. Gleichzeitig beschleunigt<br />
der Kredit die gewaltsamen Ausbrüche<br />
dieses Widerspruchs, die Krisen, und damit<br />
die Elemente der Auflösung der alten Produktionsweise.«<br />
(MEW 25: 457) Zwar<br />
kann dieses Kapital eingelöst werden, es<br />
materialisiert sich aber nur, wenn Geld aus<br />
dem Zirkulationsprozess herausgenommen<br />
wird. In welcher Höhe es sich materialisiert<br />
bzw. materialisieren kann, ist dabei<br />
nicht festgelegt. Diese Entkoppelung<br />
vom tatsächlichen Wertschöpfungsprozess<br />
führt dazu, dass fiktives Kapital an der Börse<br />
in kürzester Zeit geschaffen, aber auch<br />
vernichtet werden kann. Zur Unsicherheit<br />
führt das vor allem dann, wenn Unternehmen<br />
damit in kurzer Zeit eingeplantes Kapital<br />
für die Investition verlieren oder wenn<br />
sie Aktienwerte als Sicherheit für Kredite<br />
einbringen wollen (vgl. Heinrich 2004:<br />
164). Die Steuerung des fiktiven Kapitals<br />
wird so immer mehr zur Steuerung des Kapitalflusses<br />
allgemein.<br />
Insofern bildet das fiktive Kapital eine weitere<br />
Quelle für kapitalistische Krisen, da es<br />
die Möglichkeit, die Zirkulation von Kapi-<br />
73
tal zu unterbrechen, noch weiter erhöht.<br />
Damit wäre in einer weiter gefassten Krisendefinition<br />
zunächst festzustellen, dass<br />
die Unterbrechung der Kapitalzirkulation<br />
als Krise auftritt: Wie allerdings konkret<br />
die Gründe der Krise sind, lässt sich nur bei<br />
genauerer Analyse der jeweiligen Krise<br />
feststellen.<br />
Festzuhalten bleibt, dass fiktives Kapital<br />
nicht automatisch krisenverschärfend wirken<br />
muss: Es ermöglicht auch, dass in neuen<br />
innovativen Branchen schneller Kapital<br />
zur Verfügung steht. Betrachtet man sich<br />
aber andererseits, wie stark Aktienmärkte<br />
in die Unternehmenssteuerung eingreifen<br />
und Arbeitsplätze vernichten, wird der Unsicherheitsfaktor<br />
und die krisenverschärfende<br />
Wirkung sehr viel höher zu bewerten<br />
sein. So sollte man aus dem Kreditsystem<br />
keinen Heilsbringer machen: »Die dem<br />
Kreditsystem immanenten doppelseitigen<br />
Charaktere; einerseits die Triebfeder der<br />
kapitalistischen Produktion, Bereicherung<br />
durch Ausbeutung fremder Arbeiter, zum<br />
reinsten und kolossalsten Spiel- und<br />
Schwindelsystem zu entwickeln (...); andrerseits<br />
aber die Übergangsform zu einer<br />
neuen Produktionsweise zu bilden, - diese<br />
Doppelseitigkeit ist es, die den Hauptverkündern<br />
des Kredits (...) ihren angenehmen<br />
Mischcharakter von Schwindler und<br />
Prophet gibt.« (MEW 25: 457)<br />
Mit einem weiter gefassten Krisenbegriff<br />
verbindet sich auch, dass sich eine Zusammenbruchstheorie<br />
nicht mehr anbietet:<br />
Eine finale Krise, die durch den tendenziellen<br />
Fall der Durchschnittsprofitrate zustande<br />
kommen soll, ein natürlich ablaufender<br />
Prozess des Zusammenbruchs ist<br />
eben nicht vorhersagbar. Das erhöht den<br />
Druck, politisch aktiv zu werden.<br />
74<br />
Die Weiterentwicklung zum Kapital <strong>Argumente</strong> 3/20<strong>11</strong>
Notizen<br />
75
Notizen<br />
76
Notizen<br />
77
Notizen<br />
78
Notizen<br />
79
Notizen<br />
80