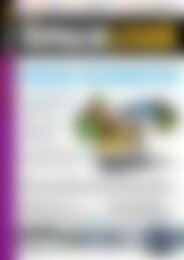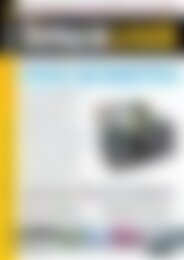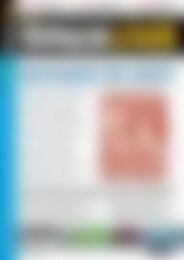Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10.2011<br />
NO-MEDIA-EDITION<br />
NUR 5,50 E<br />
<strong>SHELL</strong><br />
Bildbearbeitung mit Perl <strong>und</strong> Python S. 90<br />
Ordnung im Bilderwust mit Digikam S. 72<br />
Sammlung katalogisieren mit GCStar S. 60<br />
EUR 5,50<br />
Deutschland<br />
Österreich EUR 6,30<br />
Schweiz sfr 11,00<br />
Benelux EUR 6,50<br />
Spanien EUR 7,45<br />
Italien EUR 7,45<br />
10.2011<br />
10.2011<br />
Das Magazin für die Praxis<br />
Imagination • Anki • Pearl Simvalley SP-60 GPS • GCStar • Digikam • Audacity • Synology DS110j • Sbackup • <strong>SHELL</strong><br />
ANKI • IMAGINATION • DS110j • DIGIKAM • SBACKuP • AuDACITY • <strong>SHELL</strong><br />
ADMINISTrIErEN uND AuTOMATISIErEN OHNE GuI<br />
<strong>SHELL</strong><br />
Netzwerk voll im Griff S. 38<br />
Optimale Netzwerkkonfiguration <strong>und</strong><br />
schnelle Fehlerbehebung via Prompt<br />
Tools für Einsteiger <strong>und</strong> Profis S. 20, 32<br />
Einstieg in den klassischen CLI-Editor Vi(m),<br />
Shell-Skripte schreiben <strong>und</strong> via Menü bedienen<br />
Zugriffe steuern, Ressourcen freigeben S. 46<br />
Benutzerkonten prüfen <strong>und</strong> verwalten, Benutzergruppen zweckdienlich<br />
organisieren <strong>und</strong> Systemressourcen gezielt für die Anwender freigeben<br />
Anki S. 64<br />
Schneller lernen<br />
mit Flashcards<br />
Sbackup S. 82<br />
Daten sichern<br />
leicht gemacht<br />
4 195111 005504 10<br />
Terabyte-NAS mit Mehrwert S. 76<br />
Synology DS110j in Kombination mit Strato-HiDrive-Paket:<br />
Durchdachte Funktionen <strong>und</strong> Cloud-Backup auf Knopfdruck<br />
Ohrenschmaus<br />
mit Audacity S. 56<br />
Audio-Files schneiden <strong>und</strong><br />
mit Effekten aufpeppen<br />
Pfiffige Videos statt<br />
dröger Diashows S. 68<br />
Mit Imagination bringen Sie<br />
Bewegung ins Fotoalbum<br />
Dual-SIM-Handy zum kleinen Preis S. 86<br />
Perfekt für Urlaub <strong>und</strong> Dienstgespräch: Pearl Simvalley<br />
SP-60 nutzt virtuos zwei SIM-Karten im Parallelbetrieb<br />
www.linux-user.de
STRATO PRO<br />
Server-Technik, die begeistert!<br />
STRATO MultiServer<br />
Die Private Cloud auf flexiblen Hardware-Pools<br />
Setzen Sie bei Ihren Webprojekten voll auf die Flexibilität der STRATO MultiServer. Sie mieten dedizierte Leistung <strong>und</strong> können diese mit<br />
Hilfe der vorinstallierten Virtualisierungsoberfläche selbst aufteilen. Erstellen Sie virtuelle Maschinen <strong>und</strong> weisen dedizierte Ressourcen<br />
zu. So entsteht Ihre persönliche Cloud. Dank der neuen Hardware-Pools können weitere MultiServer zu einem Verb<strong>und</strong> zusammengefügt<br />
werden, so daß sich Daten <strong>und</strong> VMs untereinander flexibel verteilen lassen. Das Cloning funktioniert nun unmittelbar von Server<br />
zu Server – <strong>ohne</strong> Umweg über das Internet. So können Sie bequem Up- <strong>und</strong> Downgrades realisieren. Das ist echtes Cloud Computing!<br />
NEU! Hardware-Pools – schnell <strong>und</strong> flexibel Daten im<br />
MultiServer-Verb<strong>und</strong> austauschen<br />
TOP! Volle Kontrolle der privaten Cloud durch eigene<br />
dedizierte Hardware<br />
Parallelbetrieb von bis zu 8 aktiven virtuellen Maschinen<br />
VM-Cloning <strong>und</strong> BackupControl inklusive<br />
Simultaner Betrieb von Produktiv-, Entwicklungs- <strong>und</strong><br />
Testsystemen auf virtuellen Maschinen<br />
Preisaktion bis 30.09.2011<br />
3 Monate<br />
19<br />
*<br />
€mtl.<br />
ab<br />
danach ab 69 €<br />
Telefon: 0 18 05 - 00 76 77<br />
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)<br />
strato-pro.de<br />
* Vertragslaufzeit 12 Monate. Preis inkl. MwSt.
editorial<br />
Le Tablet, c‘est moi<br />
Sehr geehrte Leserinnen <strong>und</strong> Leser,<br />
die Geschichte von SCO, der<br />
Firma, die Lizenzgebühren für<br />
Linux kassieren wollte, endete am<br />
30. August mit der endgültigen<br />
Ablehnung aller Ansprüche durch<br />
ein US-Berufungsgericht [1]. Im<br />
Nachhinein erscheint SCO allerdings<br />
geradezu als Waisenknabe,<br />
denn ein gefährlicherer [2] Nachfolger<br />
steht schon bereit, <strong>und</strong> er<br />
will nicht nur Geld, sondern nichts<br />
weniger als ein Monopol: Apple.<br />
Lassen wir mal den unerfreulichen<br />
Fakt beiseite, dass die Kalifornier<br />
die Benutzer ihrer Erfolgsprodukte<br />
iPhone <strong>und</strong> iPad in ein<br />
Gefängnis einsperren, aus dem<br />
sich diese erst „jailbreaken“ müssen,<br />
um Apples Apps-Zensur zu<br />
entkommen. Ignorieren wir großzügig,<br />
dass Apple sogar eine inhaltliche<br />
Zensur der Apps vornimmt.<br />
Gehen wir auch über die<br />
Tatsache hinweg, dass Cupertino<br />
obendrein mit iCloud versucht, jeden<br />
final auf Apple-Produkte festzunageln,<br />
der so unvorsichtig war,<br />
sich diese zuzulegen [3].<br />
Dass Apple sich nicht entblödet,<br />
die Hersteller von Eierbechern [4]<br />
<strong>und</strong> Nudelgerichten [5] mit fadenscheinigen<br />
Prozessen zu überziehen,<br />
ließe sich noch in der Rubrik<br />
Anekdoten verbuchen. Schon weniger<br />
lustig ist es, wenn die Firma<br />
dem WWW-Standardisierungsgremium<br />
W3C eigentlich zugesicherte<br />
Rechte verweigert [6] oder<br />
gnadenlos jeden verklagt oder bedroht,<br />
der das Wort „Appstore“ in<br />
den M<strong>und</strong> nimmt [7] – freie Projekte<br />
nicht ausgenommen [8].<br />
Es genügt Apple auch nicht<br />
mehr, nur seine K<strong>und</strong>en zu bevorm<strong>und</strong>en<br />
– außerdem soll ja niemand<br />
anderswo einkaufen als in<br />
Cupertino: Mit einem fragwürdigen<br />
Gebrauchsmusterschutz [9]<br />
unterband die Firma Anfang August<br />
per Einstweiliger Verfügung<br />
(EV, [10]) die Auslieferung des<br />
(von Testern durchweg als gute<br />
iPad-Alternative gehandelten)<br />
Samsung Galaxy Tab mit Android.<br />
Jedes flache rechteckige Gerät mit<br />
abger<strong>und</strong>eten Kanten – wie sollte<br />
ein Tablet sonst aussehen? – als<br />
iPad-Nachahmung zu diffamieren,<br />
war Apple nicht genug, es musste<br />
im EV-Antrag obendrein die Abbildungen<br />
des Samsung-Geräts manipulieren<br />
[11]. Um die Sache auf<br />
die Spitze zu treiben, behauptet<br />
Apple jetzt auch noch, Android sei<br />
quasi in Cupertino erf<strong>und</strong>en worden<br />
[12] <strong>und</strong> verletze daher<br />
Apple-Patente. Begründung: Android-Chefentwickler<br />
Andy Rubin<br />
habe schließlich in den frühen<br />
1990ern mal bei Apple gearbeitet.<br />
Die Hardware zunageln, die Benutzer<br />
bevorm<strong>und</strong>en <strong>und</strong> einsperren,<br />
Inhalte zensieren, jede potenzielle<br />
Konkurrenz vorab wegklagen:<br />
Apple positioniert sich inzwischen<br />
als totale Antithese zu Open<br />
Source. So schön die Hardware des<br />
Herstellers ist, wer sie kauft – <strong>und</strong><br />
sei es nur, um Linux draufzuspielen<br />
– unterstützt Apples Machtansprüche,<br />
denn das Unternehmen<br />
lebt vom Hardware-Verkauf [13].<br />
Ich kann nur raten: Finger weg, so<br />
sehr es auch juckt …<br />
Herzliche Grüße,<br />
Jörg Luther<br />
Chefredakteur<br />
in eiGener SaCHe<br />
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder<br />
Ihre Meinung zu unserem Heft<br />
<strong>und</strong> dessen Inhalten erfragen, um<br />
<strong>LinuxUser</strong> genauer nach Ihren Wünschen<br />
ausrichten zu können: Bitte<br />
unterstützen Sie uns dabei <strong>und</strong> investieren<br />
Sie fünf Minuten Ihrer Zeit,<br />
um unseren Online-Fragebogen auszufüllen.<br />
Sie finden ihn unter:<br />
http://www.linux-user.de/Umfrage11<br />
Vielen Dank vorab für Ihre Hilfe!<br />
info<br />
[1] Urteil SCO/ Novell: http:// www. groklaw. net/ pdf3/ SCOvNovell10-4122. pdf<br />
[2] Apple mit Rekordgewinnen: http:// www. apple. com/ pr/ library/ 2011/ 07/ 19Apple-Reports-Third-Quarter-Results. html<br />
[3] iCloud mit Lock-in: http:// t3n. de/ news/ icloud-apple-cloud-anders-google-cloud-314459/<br />
[4] Apple vs. eiPOTT: http:// www. heise. de/ newsticker/ meldung/ iPod-vs-eiPOTT-Urteilsbegruendung-veroeffentlicht-1064220. html<br />
[5] Apple vs. Nudelhersteller: http:// gochengdoo. com/ en/ blog/ item/ 2397/ apple_tells_chinese_food_company_to_change_its_logo<br />
[6] Apple vs. W3C: http:// www. golem. de/ 1107/ 84858. html<br />
[7] Apple vs. Amazon: http:// www. golem. de/ 1107/ 85369. html<br />
[8] Apple vs. Amahi: http:// blog. amahi. org/ 2011/ 06/ 21/ apple-hits-amahi-with-a-cease-and-desist-wait-what/<br />
[9] Tablet-„Community-Design“: http :// www. scribd. com/ doc/ 61944044/ Community-Design-000181607-0001<br />
[10] Apples EV-Antrag: http:// www. scribd. com/ doc/ 61993811/ 10-08-04-Apple-Motion-for-EU-Wide-Prel-Inj-Galaxy-Tab-10-1<br />
[11] Foto-Manipulationen: http:// www. osnews. com/ story/ 25065/ Apple_Tampered_with_Evidence_in_German_Apple_v_Samsung_Case<br />
[12] Apple vs. Google: http:// fosspatents. blogspot. com/ 2011/ 09/ apple-to-itc-andy-rubin-got-inspiration. html<br />
[13] Apple-Umsätze aufgeschlüsselt: http:// www. osnews. com/ story/ 24996/ Illustrated_Apple_s_Fear_of_Android<br />
www.linux-user.de 10 | 11<br />
3
10 | 11<br />
90<br />
Wir zeigen, wie Sie mit<br />
den Bordmitteln populärer<br />
Skriptsprachen wie<br />
Perl <strong>und</strong> Python Fotos bearbeiten.<br />
82<br />
Nur wer seine Daten regelmäßig sichert,<br />
der hat im Ernstfall gute Karten.<br />
Mit Sbackup erledigen Sie die<br />
oft ungeliebte Aufgabe im Handumdrehen <strong>und</strong><br />
vor allem in einer komfortablen Oberfläche, die<br />
nicht nur das Sichern der wichtigen Daten, sondern<br />
auch das Wiederherstellen einfach macht.<br />
Ü-Ei-Figur, Modellauto, Bierdeckel<br />
oder doch eher klassische<br />
60Ob<br />
Literatur – die Sammelleidenschaft<br />
kennt keine Grenzen. Dank GCStar behalten<br />
Sie stets den Überblick über Ihre wertvollen<br />
<strong>und</strong> lieb gewonnenen Exponate.<br />
heft-dvd<br />
schwerpuNkt<br />
prAxis<br />
Neue distributionen ..... 10<br />
Knoppix 6.7, OpenSuse Life 11.4,<br />
Mandriva 2011, Arch Linux<br />
2011.08.19, Dream Studio 11.04<br />
Aktuelles<br />
Angetestet ............. 12<br />
Notizbuch Mynotex 1.1.4,<br />
SSH-Client-Suite Putty 0.61,<br />
SSL-Wrapper Stunnel 4.42,<br />
Videokonverter Transcoder 0.0.6<br />
Aktuelles .............. 14<br />
Die interessantesten Neuheiten<br />
von der Internationalen Funkausstellung<br />
2011, Gimp 2.7.3 mit<br />
Single-Window-Modus, Udev-<br />
Discover überwacht Hardware,<br />
Mandriva 2011 „Hydrogen“ mit<br />
vielen Neuerungen<br />
report<br />
linux bei Amadeus ....... 6<br />
Linux statt Mainframe: H<strong>und</strong>erte<br />
Millionen Buchungen jährlich<br />
laufen über die 2000 Suse- <strong>und</strong><br />
Red-Hat-Server der Amadeus-IT-<br />
Gruppe in Erding bei München.<br />
Bash für alle fälle ...... 20<br />
Das Programmieren von Shell-<br />
Skripten ist keine Hexerei. Schon<br />
mit wenigen Gr<strong>und</strong>kenntnissen<br />
sparen Sie durch das <strong>Automatisieren</strong><br />
alltäglicher Aufgaben viel Zeit.<br />
editor-urgestein vim .... 32<br />
Der Texteditor Vim ist unter<br />
Linux-Nutzern so populär, dass<br />
auch andere Programme das gleiche<br />
Bedienkonzept nutzen – ein<br />
Gr<strong>und</strong>, das Vorbild genauer unter<br />
die Lupe zu nehmen.<br />
Netzwerk-tools. . . . . . . . . 38<br />
Die Linux-Kommandozeile hält<br />
einen Satz leistungsfähiger<br />
Werkzeuge bereit, mit denen Sie<br />
Fehlern in der Netzwerkkonfiguration<br />
oder im Netz selbst schnell<br />
auf die Spur kommen.<br />
dateisysteme pflegen. . . . 42<br />
Mit nur wenigen Shell-Befehlen<br />
erzeugen <strong>und</strong> konfigurieren Sie<br />
die Gr<strong>und</strong>lage für jede Distribution:<br />
das Dateisystem.<br />
Benutzer verwalten ..... 46<br />
Anlegen, ändern, löschen – viele<br />
Aufgaben r<strong>und</strong> um Benutzerkonten<br />
<strong>und</strong> Gruppen erledigen<br />
Sie elegant mit einer Handvoll<br />
Kommandozeilentools.<br />
Audacity ............... 56<br />
Audacity ist völlig zu Recht bei<br />
Anfängern wie Profis beliebt: Der<br />
unter der GPL stehende So<strong>und</strong>editor<br />
wartet mit zahlreichen<br />
Funktionen auf <strong>und</strong> lässt sich<br />
dank einer Plugin-Schnittstelle<br />
beliebig erweitern.<br />
Gcstar ................ 60<br />
Mit GCStar haben Jäger <strong>und</strong><br />
Sammler ein einfach zu benutzendes<br />
Werkzeug an der Hand,<br />
um die gehorteten Schätze komfortabel<br />
zu verwalten.<br />
Anki ................... 64<br />
Lernkarteien helfen dabei, neue<br />
Sprachen <strong>und</strong> Fakten effektiv zu<br />
lernen. Das clevere <strong>und</strong> vielseitige<br />
Anki treibt das Flashcard-basierte<br />
Lernen auf die Spitze.<br />
imagination ............ 68<br />
Mit Imagination erstellen Sie<br />
im Handumdrehen effektvolle<br />
Diashows Ihrer Fotos samt musikalischer<br />
Untermalung <strong>und</strong> eindrucksvollen<br />
Überblendeffekten.<br />
digikam ............... 72<br />
Durch innovative Suchmethoden<br />
sorgt die Fotoverwaltung Digikam<br />
dafür, dass Sie in Ihrem Bildarchiv<br />
schnell <strong>und</strong> zielsicher die gewünschten<br />
Motive finden.<br />
4 10 | 11<br />
www.linux-user.de
heft-dvds<br />
Auf den Heft-DVDs dieser Ausgabe befindet<br />
sich ausschließlich Anwendungssoftware.<br />
Die Datenträger enthalten keine jugendgefährdenden<br />
Inhalte.<br />
ist schnell <strong>und</strong><br />
verzeiht nicht, Experten<br />
wissen sie auch heute noch zu schätzen: die Shell. Wir<br />
20Sie<br />
zeigen, wie Sie ein Linux-System <strong>ohne</strong> große Umwege unter Kontrolle behalten<br />
– sei es beim Tuning des Dateisystems, beim Prüfen <strong>und</strong> Einrichten<br />
des Netzwerks oder bei der Vergabe <strong>und</strong> dem Verwalten von Ressourcen.<br />
Auf der heft-dvd:<br />
Mit Mandriva 2011<br />
legen die Franzosen<br />
einen Neustart mit<br />
einem Mix aus altbewährten<br />
<strong>und</strong> neuen<br />
Konzepten vor.<br />
im test<br />
synology-NAs ds110j ... 76<br />
Im Paket mit einem 1-TByte-<br />
Account des Speicherdienstes<br />
HiDrive bietet Strato bei 24 Monaten<br />
Laufzeit das Synology-NAS<br />
DS110j zum Schnäppchenpreis<br />
von 49 Euro gleich mit an. Das<br />
Duo hat einiges zu bieten.<br />
Netz&system<br />
sbackup ............... 82<br />
Eben mal eine Datensicherung<br />
einrichten? Kein Problem: Mit<br />
Simple Backup <strong>und</strong> seiner aufgeräumten<br />
grafischen Oberfläche<br />
archivieren Sie wichtige Daten im<br />
Handumdrehen.<br />
hArdwAre<br />
simvalley sp-60 Gps .... 86<br />
Zwei SIM-Karten in einem Phone<br />
sparen nicht nur beim Reisen den<br />
lästigen Wechsel, sondern auch<br />
bei Anwendern, die ein Handy<br />
privat <strong>und</strong> eines beruflich nutzen.<br />
kNow-how<br />
fotos bearbeiten ........ 90<br />
Zum individuellen Nachbearbeiten<br />
größerer Bildmengen<br />
bietet sich das <strong>Automatisieren</strong><br />
mithilfe von Perl <strong>und</strong> Python an:<br />
Mit wenig Aufwand gelangen Sie<br />
zu ersten Ergebnissen.<br />
Mit Knoppix 6.7 geht die<br />
Mutter aller LiveSysteme<br />
in eine neue R<strong>und</strong>e – komplett<br />
aktualisiert <strong>und</strong> erweitert.<br />
So haben Sie unterwegs<br />
stets alle wichtigen<br />
Tools zur Hand.<br />
Sagen Sie aufgebläh<br />
ter Massenware den<br />
Kampf an mit Arch<br />
Linux 2011.08.19,<br />
das die optimale<br />
Gr<strong>und</strong>lage für ein<br />
schlankes, leistungsfähiges<br />
<strong>und</strong><br />
individuelles Linux<br />
System bietet.<br />
76<br />
Das DS110j von<br />
Synology erledigt in<br />
Kombination mit<br />
dem HiDrive-Paket von Strato<br />
das Backup wichtiger Daten komfortabel<br />
in der Cloud.<br />
service<br />
editorial ................ 3<br />
it-profimarkt .......... 98<br />
impressum ............105<br />
vorschau .............106<br />
Statt in den Repositories<br />
mühsam nach Lernsoftware<br />
zu kramen, haben<br />
Sie mit OpenSuse Edu Life<br />
11.4 alle wichtigen Programme<br />
für Schule <strong>und</strong><br />
Studium im perfekt abge<br />
stimmten System zur Hand.<br />
linuxuser dvd-edition<br />
hinweis: Haben Sie die DVDEdition dieser Ausgabe erworben,<br />
finden Sie auf seite 10 wei tere Informationen zu<br />
den Programmen auf den beiden Datenträgern. Haben Sie<br />
dagegen die güns tigere NoMediaAusgabe erstanden,<br />
enthält dieses Heft keine Datenträger.<br />
www.linux-user.de<br />
12 | 10 5
eport<br />
Linux bei Amadeus<br />
2000 Linux-Server im RZ-Einsatz<br />
Mit Linux in<br />
den Urlaub<br />
© Christa Richert, sxc.hu<br />
Wer fliegt, mit der Bahn oder dem Schiff fährt, im Hotel absteigt oder einen Mietwagen bucht,<br />
nutzt Linux: H<strong>und</strong>erte Millionen entsprechender Buchungen jährlich laufen im Rechenzentrum<br />
der Amadeus-IT-Gruppe im oberbayerischen Erding über Suse- <strong>und</strong> Red-Hat-Server. Dr. Udo Seidel<br />
reADMe<br />
H<strong>und</strong>erte Millionen Buchungen<br />
für Flüge,<br />
Bahn- <strong>und</strong> Kreuzfahrten,<br />
Hotelzimmer <strong>und</strong> Mietwagen<br />
laufen jährlich<br />
über die Systeme der<br />
Amadeus IT Group.<br />
Massive Transaktionsverarbeitung<br />
<strong>und</strong><br />
höchste Verfügbarkeit<br />
sind hier Trumpf: Schon<br />
wenige Minuten Ausfall<br />
verursachen Kosten in<br />
Millionenhöhe, die Wartungsfenster<br />
beschränken<br />
sich auf wenige Minuten<br />
im Quartal. In diesem<br />
anspruchsvollen<br />
Umfeld behaupten sich<br />
mittlerweile 2000 Linux-<br />
Server bestens.<br />
So gut wie jeder Reisende nutzt<br />
Linux – selbst wenn er noch nie<br />
etwas von dem freien Betriebssystem<br />
gehört hat. Ob er einen Flug<br />
oder eine Bahnfahrt bucht, ein<br />
Hotelzimmer oder einen Mietwagen<br />
reserviert, spielt dabei keine<br />
Rolle – ebensowenig, ob er sich im<br />
Reisebüro beraten lässt oder<br />
selbst in Online-Portalen stöbert.<br />
Wie funktioniert so eine Buchung<br />
eigentlich? Wie kommt das<br />
Reisebüro an die Daten für Flugverbindungen?<br />
Wo sind die Buchungsdaten<br />
gespeichert? Die<br />
Antworten auf alle diese Fragen<br />
finden sich in Erding bei München,<br />
einer sonst nur für die<br />
schmackhaften Produkte der lokalen<br />
Brauerei bekannten Kleinstadt:<br />
Hier werkeln in einem<br />
hochmodernen Rechenzentrum<br />
hinter den dicken Mauern der Firma<br />
Amadeus Data Processing<br />
über 2000 Linux-Server.<br />
Amadeus <strong>und</strong> IT<br />
Die Geschichte von Amadeus beginnt<br />
1987. In diesem Jahr gründeten<br />
die Fluggesellschaften Air<br />
France, Lufthansa, Iberia Airlines<br />
<strong>und</strong> Scandinavian Airlines die<br />
Amadeus-IT-Gruppe [1]. Deren<br />
Hauptquartier befindet sich in der<br />
spanischen Metropole Madrid,<br />
das Entwicklungszentrum operiert<br />
im südfranzösischen Nizza<br />
<strong>und</strong> das oberbayerische Erding<br />
fungiert als operatives Herzstück<br />
(Abbildung A). Amadeus ist ein<br />
sogenannter Global Distribution<br />
Service Provider – nicht der erste<br />
der Welt, aber weltweiter Marktführer.<br />
Am Anfang stand ein sogenanntes<br />
Computer-Reservierungssystem,<br />
das zunächst lediglich<br />
Daten für Flugreisen verwaltete.<br />
Später kamen weitere Bereiche<br />
dazu: Zug- <strong>und</strong> Schiffsreisen,<br />
Autovermietung, Hotelbuchungen<br />
<strong>und</strong> anderes mehr.<br />
Das Rückgrat bildete TPF, ein<br />
Echtzeit-Betriebssystem von IBM<br />
für Mainframes [2]. Das als hochspezialisiertes<br />
Betriebssystem für<br />
den Zweck der Computer-Reservierung<br />
entwickelte TPF abzulösen,<br />
galt lange Zeit als <strong>und</strong>enkbar.<br />
Zudem stand Amadeus als Lizenznehmer<br />
der Quelltext des Betriebssystems<br />
zur Verfügung –<br />
die TPF-Admins konnten also bei<br />
der Suche <strong>und</strong> Behebung von Fehlern<br />
auf die aus der Open-Source-<br />
Szene bekannten Möglichkeiten<br />
zurückgreifen <strong>und</strong> gegebenenfalls<br />
sogar eigene Funktionserweiterungen<br />
implementieren.<br />
Linux hält Einzug<br />
Vor einigen Jahren stand Amadeus<br />
vor der Entscheidung, entweder<br />
auf die neueste TPF-Version<br />
zu migrieren oder aber einen alternativen<br />
Weg einzuschlagen. Zu<br />
jener Zeit spielten die verschiede-<br />
6 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Linux bei Amadeus<br />
report<br />
nen Unix-Derivate eine dominierende<br />
Rolle, aber auch Linux kam<br />
zunehmend ins Blickfeld <strong>und</strong><br />
schickte sich an, in den Rechenzentren<br />
Einzug zu halten. Die Möglichkeit<br />
des Zugriffs auf den Quelltext<br />
war Amadeus von TPF schon<br />
vertraut – dieser Aspekt sprach<br />
eindeutig für Linux. Der Vorsprung<br />
von Unix im Enterprise-Bereich<br />
war allerdings – noch – zu groß. So<br />
kam es, dass Amadeus bei den ersten<br />
Schritten zur TPF-Ablösung<br />
auf traditionelle Unix-Derivate<br />
wie HP-UX [3] setzte.<br />
Linux fand dennoch seinerzeit<br />
ebenfalls einen Weg ins Amadeus-<br />
Rechenzentrum (Abbildung B,<br />
nächste Seite) – vor allem über<br />
den Geschäftsbereich E-Commerce,<br />
da es bereits damals als<br />
Quasistandard für Webserver<br />
galt. In manchen Bereichen verwaltete<br />
das freie Betriebssystem<br />
auch DNS-Domänen oder diente<br />
als Application-Server. Die in diesen<br />
Bereichen erzielten Erfolge<br />
mit Linux überzeugten auch die<br />
Strategen <strong>und</strong> Macher hinter der<br />
TPF-Ablösung, zumal Linux inzwischen<br />
über die notwendige<br />
Enterprise-Fähigkeit verfügte,<br />
beispielsweise in Sachen Support.<br />
Heute ist Linux untrennbar mit<br />
dem Erfolg von Amadeus verb<strong>und</strong>en.<br />
Über 2000 Server versehen<br />
im Erdinger Rechenzentrum unter<br />
Linux ihren Dienst. Dabei<br />
stellt die Airline-IT den mit Abstand<br />
größten Anteil: Dieser Bereich<br />
spielt bei der Ablösung von<br />
TPF eine Schlüsselfunktion, Linux<br />
muss sich hier einigen Herausforderungen<br />
stellen. Dabei steht die<br />
Vielseitigkeit von Linux der hochgradigen<br />
Spezialisierung von TPF<br />
gegenüber. Der Übergang vom<br />
„großen Eisen“ zu verteilten Systemen<br />
stellt <strong>ohne</strong>hin einen ausgewachsenen<br />
Paradigmenwechsel<br />
dar, nicht zuletzt auch hinsichtlich<br />
des Sicherheitskonzepts:<br />
Rechte <strong>und</strong> Rollen wandern von<br />
einer lokalen Tabelle in einen Verzeichnisdienst.<br />
Auch andere Informationen<br />
müssen netzwerkfähig<br />
werden, da ein Zugriff auf einen<br />
gemeinsamen Speicher schon<br />
hardwareseitig nicht mehr gegeben<br />
ist. Zum Einsatz kommen die<br />
Enterprise-Distributionen von<br />
Suse <strong>und</strong> Red Hat – dazu gleich<br />
mehr.<br />
Linux in der Airline-IT<br />
Die Architektur des Nachrichtenflusses<br />
zu TPF-Zeiten bestand aus<br />
einem Frontend <strong>und</strong> einigen<br />
Backends. Das Frontend war (<strong>und</strong><br />
ist es auch heute noch für manche<br />
Bereiche) der zentrale Einstiegspunkt:<br />
Hier treffen die Nachrichten<br />
der Fluggesellschaften oder<br />
andererer Global Distribution<br />
Provider ein. Das Frontend routet<br />
die Pakete zur eigentlichen Verarbeitung<br />
an die Backends weiter.<br />
Dieser bewährte Aufbau findet<br />
sich im Linux-Pendant wieder.<br />
Auch hier gibt es ein Frontend<br />
(genau genommen eigentlich<br />
mehrere), das den gesamten Verkehr<br />
empfängt.<br />
Ein solches Frontend – egal, ob<br />
TPF oder Linux – muss tausende<br />
Transaktionen pro Sek<strong>und</strong>e abwickeln<br />
können. Ein Großrechner<br />
vom Typ IBM z9/z10 lässt sich<br />
natürlich nicht einfach durch einen<br />
Linux-Server ersetzen. Mit<br />
dem Wechsel zum verteilten System<br />
spaltete Amadeus auch die<br />
Funktionen des Frontends auf.<br />
Dies ermöglicht es Amadeus, mit<br />
Standard-Servern ausreichend in<br />
die Breite zu skalieren. Das Linux-<br />
Frontend an sich besteht aus<br />
mehreren Maschinen, die sich gegenseitig<br />
absichern. Fällt eine aus,<br />
übernehmen die anderen. Dank<br />
ausgeklügelter Mechanismen erfolgt<br />
die Übernahme im Normalfall<br />
transparent für den Benutzer.<br />
Die eigentlichen Applikationen<br />
befinden sich auf den sogenannten<br />
Open-Backends. Die Anwendungsschicht<br />
läuft ebenso wie das<br />
Frontend unter Suse Linux Enterprise<br />
Server (SLES). Es gibt noch<br />
ein paar „historische“ Installationen<br />
von SLES 9, der Löwenanteil<br />
der Systeme basiert auf SLES 10<br />
<strong>und</strong> SLES 11. Typischerweise sind<br />
die Applikationen zu Farmen zusammengefasst.<br />
Das erlaubt auf<br />
einfache Weise eine Skalierung in<br />
die Breite. Die Applikationsebene<br />
sorgt für Hochverfügbarkeit – ein<br />
wichtiges Thema für Amadeus.<br />
Fallen die FM-Server („Flight Management“)<br />
aus, bleiben weltweit<br />
die Flugzeuge auf dem Boden: Dabei<br />
entstünde binnen Minuten ein<br />
Schaden in Millionenhöhe.<br />
Die Datenbank befindet sich in<br />
einem Mischbetrieb. Die größten<br />
Oracle-Installationen setzen mit<br />
HP-UX auf ein traditionelles Unix<br />
als Unterbau. Mit vierteljährlichen<br />
Wartungsfenstern von<br />
15 Minuten stehen die IT-Experten<br />
von Amadeus hier vor einer<br />
handfesten Herausforderung in<br />
Sachen Hochverfügbarkeit, weswegen<br />
es praktisch keine Alterna-<br />
GlossAr<br />
TPF: Transactions Processing<br />
Facilities. Echtzeit-OS<br />
für IBM-Mainframes<br />
der S/ 360- <strong>und</strong><br />
System-z-Familien, das<br />
speziell auf hochvolumige<br />
Transaktionsverarbeitung<br />
<strong>und</strong> 24x7-Hochverfügbarkeit<br />
ausgelegt<br />
wurde. TPF wurde erstmals<br />
1979 vorgestellt<br />
<strong>und</strong> liegt seit 2005 in<br />
der derzeit aktuellen<br />
Version z/ TPF 1.1 vor.<br />
HP-UX: Hewlett Packard<br />
Unix. Kommerzielles<br />
SysV-Unix von HP für PA-<br />
RISC- <strong>und</strong> IA64-Systeme<br />
(„Itanium“), derzeit aktuelle<br />
Version 11.31.<br />
Die Verbreitung des früher<br />
recht populären HP-<br />
UX nimmt mittlerweile<br />
stark ab, wohl nicht zuletzt,<br />
weil keine Version<br />
für die x86-64-Architektur<br />
existiert.<br />
A Im Amadeus-Rechenzentrum<br />
in Erding<br />
bei München versehen<br />
r<strong>und</strong> 2000 Linux-Server<br />
ihren Dienst. (Bild:<br />
Amadeus IT Group SA)<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 7
eport<br />
Linux bei Amadeus<br />
B Ein Blick in eine der<br />
sechs Feuerzellen des<br />
Amadeus-Rechenzentrums.<br />
(Bild: Amadeus<br />
GlossAr<br />
Data Processing<br />
GmbH)<br />
MVS: Multiple Virtual<br />
Storage. IBM-Mainframe-Betriebssystem<br />
der Siebziger- bis Neunzigerjahre<br />
für die Großrechner-Serien<br />
S/ 370<br />
<strong>und</strong> S/ 390, 2001 durch<br />
den Nachfolger z/ OS<br />
abgelöst.<br />
PCI-DSS: Payment Card<br />
Industry Data Security<br />
Standard. Regelwerk für<br />
das Abwickeln von Kreditkartentransaktionen.<br />
Firmen <strong>und</strong> Dienstleister,<br />
die solche Transaktionen<br />
speichern,<br />
übermitteln oder abwickeln,<br />
müssen diese<br />
Regelungen erfüllen.<br />
tive zum Einsatz des Real Application<br />
Clusters von Oracle gibt. Weniger<br />
kritische Systeme dagegen<br />
operieren im Failover-Modus.<br />
Kleinere Datenbanken laufen<br />
schon längst unter Red Hat Enterprise<br />
Linux (RHEL), <strong>und</strong> weitere<br />
folgen. Neben Oracle RDBMS<br />
setzt Amadeus auch MySQL ein –<br />
ein weiteres klares Ja zur Open-<br />
Source-Technologie.<br />
Obwohl es in hochkritischen<br />
Systemen seinen Dienst versieht,<br />
bleibt Linux dem Reisenden komplett<br />
verborgen. Das spricht einerseits<br />
für das freie Betriebssystem,<br />
das klaglos im Hintergr<strong>und</strong><br />
seinen Arbeit leistet. Andererseits<br />
ist es schade, dass von seinen<br />
Qualitäten der Nutznießer am anderen<br />
Ende der Leistungskette<br />
rein gar nichts mitbekommt.<br />
Der Zug fährt ab<br />
Bucht der Reisende ein Bahnticket<br />
über Amadeus, kommt ebenfalls<br />
viel Linux ins Spiel. Die Migration<br />
von HP-UX zu Linux erfolgte<br />
in zwei Schritten: Zunächst<br />
fand die Oracle-Datenbank ein<br />
neues Zuhause auf einem Red-<br />
Hat-Cluster. Dieser ist dabei überhaupt<br />
nicht ausgelastet <strong>und</strong> bietet<br />
noch weiteren Datenbanken eine<br />
stabile Plattform.<br />
Der Umzug der Anwendung war<br />
etwas schwieriger, da die Admins<br />
<strong>und</strong> Entwickler auch das Hochverfügbarkeitskonzept<br />
änderten: Der<br />
klassische Failover wich der Farm-<br />
Architektur. Wie schon bei der<br />
Airline-IT begrüßen gerade die<br />
Entwickler den Umzug auf Linux.<br />
Python, Java, moderne Compiler<br />
– was unter Unix eine stetige<br />
Herausforderung war,<br />
erweist sich unter Linux als<br />
normales Tagesgeschäft.<br />
Einen weiteren Geschäftszweig<br />
von Amadeus stellt<br />
das Hosting dar. Stöbert<br />
der potenzielle Urlauber im<br />
Online-Portal von Opodo.<br />
de, dann laufen die notwendigen<br />
Dienste auf Servern<br />
im Erdinger Rechenzentrum<br />
von Amadeus. Wenig<br />
überraschend dient hier Apache<br />
als Webserver im Einsatz -- allerdings<br />
aufgr<strong>und</strong> der speziellen<br />
K<strong>und</strong>enanforderungen nicht in<br />
der Version aus den distributionseigenen<br />
Repositories. Die Administratoren<br />
von Amadeus stellen<br />
ein Framework zur Verfügung, das<br />
es den K<strong>und</strong>en erlaubt, die gewünschten<br />
Versionen von Apache<br />
<strong>und</strong> Peripherie-Anwendungen zu<br />
betreiben. Gleiches gilt für den<br />
Applikationsserver wie Weblogic<br />
oder Jboss.<br />
Linux ist bei Amadeus aber nicht<br />
nur auf den K<strong>und</strong>ensystemen auf<br />
dem Vormarsch: Auch die interne<br />
IT fußt bereits teilweise auf Linux.<br />
Da Amadeus als Mainframe-Firma<br />
startet, war das hauseigene Problem-<br />
<strong>und</strong> Change-Management-<br />
System ursprünglich auf MVS [4]<br />
zu Hause. Inzwischen läuft der<br />
Datenbank-Teil mit MySQL auf<br />
RHEL, während die Anwendungsebene<br />
unter SLES ein neues Heim<br />
gef<strong>und</strong>en hat. Auch das Mail-System<br />
läuft schon seit Jahren auf Linux.<br />
Für den geschäftlichen Informationsaustausch<br />
kommt Lotus<br />
Notes zum Einsatz. Sollen die Produktivserver<br />
E-Mails verschicken<br />
oder weiterleiten, treten Postfix<br />
oder Sendmail auf den Plan. Monitoring,<br />
Software-Load-Control,<br />
Performance-Analyse, Change<strong>und</strong><br />
Configuration-Management –<br />
immer ist Linux da <strong>und</strong> stellt als<br />
Betriebssystem die Basis.<br />
Virtualisierung<br />
Virtualisierung gilt bei Amadeus<br />
als alter Hut – <strong>und</strong> das in zweierlei<br />
Hinsicht: Erstens war diese<br />
Technologie schon den Mainframe-Systemen<br />
bekannt <strong>und</strong><br />
kam folgerichtig auch im Erdinger<br />
Rechenzentrum schon früh zum<br />
Einsatz. Aber auch in der x86-<br />
Welt ist Virtualisierung kein neues<br />
Thema mehr. Amadeus greift<br />
auf Vmware als Hypervisor zurück,<br />
im Moment arbeiten r<strong>und</strong><br />
800 Linux-Server als virtuelle<br />
Gäste. Der Großteil davon dient<br />
als Entwicklungsplattform für die<br />
Airline-IT, aber auch der Anteil<br />
der Produktiv-Systeme wächst.<br />
Hier dominiert vor allem der Hosting-Bereich<br />
– der klassische<br />
Work load von Web- <strong>und</strong> Applikationsservern<br />
eignet sich hervorragend<br />
zum Virtualisieren. Als<br />
Hemmschuh erweisen sich dabei<br />
die ausgesprochen virtualisierungsunfre<strong>und</strong>lichen<br />
Lizenz- <strong>und</strong><br />
Support-Bedingungen bestimmter<br />
Betriebssystemanbieter – anderenfalls<br />
wäre Amadeus’ „Wirkungsgrad“<br />
in der Virtualisierung<br />
noch höher.<br />
Fazit<br />
Linux ist bei Amadeus keine Spielzeug-Plattform,<br />
das Erdinger Rechenzentrum<br />
vertraut dem freien<br />
Betriebssystem zahlreiche geschäftskritische<br />
Systeme an. Wie<br />
regelmäßige Sicherheitsaudits bestätigen,<br />
beispielsweise nach PCI-<br />
DSS [5], betreiben die IT-Experten<br />
von Amadeus das Linux-Geschäft<br />
ernsthaft <strong>und</strong> auf hohem<br />
Niveau. Die Audits zeigen auch,<br />
dass Amadeus die sensitiven Daten<br />
gut schützt – unter anderem<br />
auch dank Linux. Das heutige Rechenzentrum<br />
von Amadeus <strong>ohne</strong><br />
das freie Betriebssystem – unvorstellbar.<br />
(jlu) n<br />
info<br />
[1] Amadeus IT Group SA:<br />
http:// www. amadeus. com<br />
[2] IBM z/ TPF:<br />
http:// www. ibm. com/ software/ htp/ tpf/<br />
[3] HP-UX: http:// tinyurl. com/ lu1011-hpux<br />
[4] MVS: http:// de. wikipedia. org/ wiki/<br />
Multiple_Virtual_Storage<br />
[5] PCI-DSS:<br />
http:// de. wikipedia. org/ wiki/ PCI_DSS<br />
8 10 | 11<br />
www.linux-user.de
1&1 DUAL HOSTING<br />
DOPPELT SICHER!<br />
DOPPELT GUT...<br />
✓<br />
&<br />
1.000 Mitarbeiter!<br />
Maximal sicher:<br />
Paralleles Hosting Ihrer Website<br />
in zwei Hightech-Rechenzentren<br />
an verschiedenen Orten!<br />
✓ Superschnell:<br />
210 GBit/s Anbindung!<br />
✓ Zukunftssicher:<br />
1&1 DUAL HOSTING<br />
VIELE PAKETE JETZT SCHON AB<br />
0,–€/Monat*<br />
Dual Hosting gibt´s nur von 1&1! Kein anderer bietet Ihnen geored<strong>und</strong>ante<br />
Sicherheit <strong>und</strong> maximale Performance für Ihre Projekte.<br />
1&1 DUAL<br />
PERFECT<br />
6 Domains aus .de, .com, .net, .org, .at, .eu<br />
5 GB Webspace<br />
UNLIMITED T r a f fi c<br />
UNLIMITED Click & Build Apps uvm.<br />
0,–<br />
€<br />
In den ersten 3 Monaten,<br />
danach 9,99 €/Monat.*<br />
.DE, .EU, .COM, .NET, .ORG, .AT<br />
0, OHNE EINRICHTUNGSGEBÜHR! 29*<br />
ab<br />
€/Monat<br />
im ersten Jahr<br />
Weitere leistungsstarke<br />
1&1 Dual Hosting-Pakete<br />
<strong>und</strong> tolle Sparangebote<br />
unter www.1<strong>und</strong>1.info Ausgabe 08/11<br />
0 26 02 / 96 91<br />
0800 / 100 668 www.1<strong>und</strong>1.info<br />
&1 * Dual Perfect 1 3 Monate für 0,– €/Monat, danach 9,99 €/Monat. Einrichtungsgebühr 9,60 €. Domains im ersten Jahr .de, .eu 0,29 €/Monat, .com, .net, .org, .at 0,99 €/Monat, danach .de<br />
0,49 €/Monat, .eu , .com, .net, .org 1,49 €/Monat, .at 1,99 €/Monat. Einrichtungsgebühr entfällt. 12 Monate Mindestvertragslaufzeit. Preise inkl. MwSt.
Heft-DVD<br />
DVD-Inhalt<br />
Neues auf<br />
den Heft-DVDs<br />
Es ist ein Aufbruch in eine<br />
neue Zeit: Mit einem über-<br />
arbeiteten Desktop <strong>und</strong> neu-<br />
en Konzepten schlagen die<br />
Entwickler der französischen<br />
Distribution Mandriva 2011 ein<br />
neues Kapitel auf. Das Startmenü<br />
„Simple Welcome“ ermöglicht zum Bei-<br />
spiel nicht nur den Zugriff auf zuletzt<br />
benutzte Programme <strong>und</strong> Dokumente,<br />
sondern bietet auf einem zusätzlichen<br />
Reiter eine chronologische Liste der<br />
bereits aufgerufenen Anwendungen<br />
<strong>und</strong> Dateien. So finden Sie unter Umständen<br />
intuitive Software oder Inhalte,<br />
die Sie noch einmal benötigen.<br />
Einen Anknüpfungspunkt an die Vergan-<br />
genheit von Mandriva bildet allerdings das<br />
Kontrollzentrum des Systems, das die Ent-<br />
wickler nach wie vor auf Einfachheit ge-<br />
trimmt haben. So finden Sie an einer<br />
zentralen Stelle alle wichtigen Optionen<br />
zum Konfigurieren. Bei Bedarf<br />
schalten Sie hier ein neues Modul<br />
zum Verwalten der Software hinzu,<br />
das mit dem neuen Paketformat<br />
RPM5 optimal zusammenspielt. Sie<br />
finden auf der Heft-DVD, Seite A,<br />
eine Version für das 32-Bit-System,<br />
die sowohl den Live-Betrieb als auch<br />
die Installation erlaubt.<br />
Es ist ein Who´s who der wichtigen Mul-<br />
timedia-Anwendungen: die Programmliste<br />
in<br />
Dream Studio 11.04. Der Schwer-<br />
punkt der Applikationen liegt dabei auf<br />
Grafikprojekten – sei es bewegt oder<br />
unbewegt. Dazu kommen Audio-Tools<br />
wie Ardour oder Hydrogen sowie<br />
Webdevelopment-Software – kurz: alles,<br />
was Sie für einen Einstieg in das<br />
eigene Multimedia-Studio benötigen.<br />
Wer sich erst von den Qualitäten des<br />
Systems überzeugen möchte, tut<br />
dies einfach, indem er die<br />
Heft-DVD zur Hand nimmt<br />
<strong>und</strong> von Seite A Dream<br />
Studio in den Live-<br />
Betrieb bootet.<br />
Unbestritten leistet der Computer in der Bildung einen<br />
wichtigen Dienst. Das klappt aber nur, wenn die<br />
richtige Software installiert ist. Um nicht mühselig<br />
aus einer Vielzahl von Programmen die gewünschten<br />
auswählen zu müssen, bietet sich der Einsatz einer<br />
entsprechenden Distribution an, wie zum Beispiel<br />
OpenSuse Edu Life 11.4. Die gerade veröffentlichte<br />
Version kommt mit einer Vielzahl an nützlichen<br />
Lernprogrammen, die sich an Schüler, Studenten<br />
<strong>und</strong> Lehrer richten. Das System basiert auf Open-<br />
Suse 11.4 <strong>und</strong> bringt alle wichtigen Updates <strong>und</strong><br />
Sicherheitspatches mit, die auch die Standard-Distribution<br />
erhalten hat. Damit verfügt das System über<br />
eine getestete <strong>und</strong> leicht bedienbare Gr<strong>und</strong>lage. Die<br />
Bandbreite der integrierten Software reicht von einfachen<br />
Programmen für Kinder bis hin zu ausgewachsenen<br />
IDEs, die sich an Studierende richten.<br />
OpenSuse Edu Life bietet sowohl die Möglichkeit für<br />
einen Live-Test als auch für eine Installation auf<br />
einem Rechner. Sie finden die Distribution auf der<br />
Seite B der Heft-DVD in dieser Ausgabe.<br />
Wer statt vollgestopften Alleskönnern oder aufgeblähter<br />
Massenware eine schlanke <strong>und</strong> vor allem<br />
flotte Distribution mit klarem Fokus sucht, der liegt<br />
mit Arch Linux 2011.08.19 genau richtig: Das Projekt<br />
widmet sich seit Jahren dem erklärten Ziel, Aufbau<br />
<strong>und</strong> Umfang der Distribution so übersichtlich<br />
wie möglich zu halten. Dabei brauchen Sie als Anwender<br />
nicht auf aktuelle Programme zu verzichten.<br />
Nach der ersten Installation finden Sie ein Minimalsystem<br />
vor, das Sie optimal auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.<br />
Möchten Sie Arch Linux ausprobieren, haben<br />
Sie die Möglichkeit, die Distribution direkt von<br />
der Seite B der Heft-DVD zu installieren. Weiterhin<br />
finden Sie auf dem Datenträger selbst noch die ISO-<br />
Images, mit denen Sie Installationsmedien für 32-<br />
<strong>und</strong> 64-Bit-Systeme erstellen.<br />
Ein bewährter Klassiker geht in die nächste R<strong>und</strong>e:<br />
Knoppix 6.7 bringt neben den üblichen Updates aus<br />
Debian Stable <strong>und</strong> Testing eine Reihe gr<strong>und</strong>legender<br />
Neuerungen mit: So hat der Maintainer Klaus Knopper<br />
Chromium zum Standard-Browser erhoben. Der<br />
Gr<strong>und</strong> für diese Änderung liegt im schnellen Seitenaufbau<br />
des Browsers. Weiterhin bringt das System<br />
Kernel 2.6.39.3, X.org 7.6 sowie freie Nouveau-Treiber<br />
mit. Knoppix bietet sich in erster Linie als Live-<br />
System an. Sie finden das System als bootfähige Version<br />
auf der beiliegenden Eco-Disk. (agr) n<br />
10<br />
10 | 11<br />
www.linux-user.de
SonDERaKTion!<br />
Testen Sie jetzt<br />
3 ausgaben für<br />
nUR 3€<br />
Miniabo <strong>ohne</strong> Risiko!<br />
Jetzt schnell bestellen:<br />
Telefon: 07131 /2707 274<br />
Fax: 07131 / 2707 78 601<br />
E-Mail: abo@linux-user.de<br />
Web: www.linux-user.de/probeabo<br />
Mit großem Gewinnspiel unter:<br />
www.linux-user.de/probeabo<br />
GEwinnEn SiE... eine von fünf rewind mini hd kameras<br />
im gesamtwert von fast 400 euro!<br />
Nur bis 15.12.2011<br />
zur Verfügung gestellt von<br />
.de
aktuelles<br />
Angetestet<br />
JJJJI<br />
Mit dem SSL-Wrapper<br />
Stunnel sichern Sie<br />
auch die Kommunikation<br />
älterer Tools ab, die<br />
selbst keine Verschlüsselung<br />
unterstützen. Dabei<br />
eignet sich das Tool<br />
auch für komplexe Konfigurationen.<br />
Abhörsicher kommunizieren mit Stunnel<br />
Eigentlich sollte heute im Internet<br />
SSL-verschlüsselte Kommunikation<br />
der Standard sein, doch noch<br />
immer beherrschen viele Client<strong>und</strong><br />
Server-Anwendungen diese<br />
von Haus aus noch nicht. Hier<br />
hilft der SSL-Wrapper Stunnel dabei,<br />
die Kommunikation abzusichern.<br />
Das C-Programm nimmt<br />
auf einem definierten Port verschlüsselte<br />
Verbindungen an, entschlüsselt<br />
sie <strong>und</strong> stellt sie auf<br />
einem anderen Port dem nicht<br />
SSL-fähigen Client oder Server zur<br />
Verfügung. Während sich ältere<br />
Stunnel-Versionen noch ad hoc<br />
über Kommandozeilenparameter<br />
konfigurieren ließen, setzt Stunnel<br />
ab Version 4.x eine Konfigurationsdatei<br />
voraus, die Sie beim<br />
Aufruf angeben. Das Verzeichnis<br />
tools im Quellarchiv enthält bereits<br />
einige Beispielkonfigurationen<br />
als Vorlage. Für eine Minimalkonfiguration<br />
genügt es, lediglich<br />
Port <strong>und</strong> Interface anzugeben,<br />
auf denen Stunnel Verbindungen<br />
entgegennehmen <strong>und</strong> weiterleiten<br />
soll. Um Stunnel im Client-Modus<br />
zu betreiben, setzen Sie den Parameter<br />
client auf yes, ansonsten<br />
läuft Stunnel im Server-Modus.<br />
Dann erwartet es die Angabe eines<br />
Zertifikats mit dem Konfigurationsparameter<br />
cert. Eine Anleitung<br />
zum Erstellen selbst signierter<br />
Zertifikate finden Sie in der Dokumentation<br />
auf der Webseite von<br />
Stunnel. Eine Konfigurationsdatei<br />
darf auch mehrere Port-Angaben<br />
enthalten, sodass Sie mit einer<br />
Stunnel-Instanz mehrere Dienste<br />
auf unterschiedlichen Ports absichern.<br />
Je nach getunneltem Protokoll<br />
kann man über Datenkompression<br />
mit Zlib oder Rle den Datendurchsatz<br />
steigern. Im Server-<br />
Modus lässt sich Stunnel mit dem<br />
Super-Dienst inetd kombinieren<br />
<strong>und</strong> wird so nur bei Bedarf aktiv.<br />
Die meisten Anwender betreiben<br />
Stunnel jedoch als eigenständigen<br />
Dienst – ein entsprechendes Initskript<br />
für SysV-Init findet sich<br />
ebenfalls im tools-Verzeichnis des<br />
Quellarchivs. Die Gr<strong>und</strong>konfiguration<br />
können Sie noch um Funktionen<br />
wie etwa chroot oder ein<br />
Random-Seed zum Verbessern der<br />
Verschlüsselung erweitern. Nutzen<br />
Sie Stunnel als eigenen<br />
Dienst, empfiehlt es sich, diesen<br />
im Kontext eines unprivilegierten<br />
Benutzerkontos zu betreiben.<br />
stunnel 4.41<br />
Lizenz: GPLv2<br />
Quelle: http:// www. stunnel. org<br />
JJJII<br />
Transcoder, ein übersichtliches<br />
GTK-Frontend<br />
für Ffmpeg, macht das<br />
Konvertieren von Videodateien<br />
zum Kinderspiel.<br />
Die Geschwindigkeit der<br />
Recodierung hängt maßgeblich<br />
vom Zielformat<br />
<strong>und</strong> der Rechenleistung<br />
des Systems ab.<br />
Videos im Handumdrehen recodieren mit Transcoder<br />
Linux unterstützt zahlreiche Videoformate.<br />
Zum Konvertieren der<br />
Filme von einem Format in ein anderes<br />
empfehlen die meisten Foren<br />
das Konsolenprogramm Ffmpeg.<br />
Mit Transcoder existiert jetzt<br />
eine übersichtliche GTK-basierte<br />
Oberfläche, die Ihnen das Setzen<br />
von Parameterketten in Ffmpeg<br />
abnimmt. Im oberen Teil der<br />
Trans coder-Oberfläche listet das<br />
Tool alle zu bearbeitenden Filme<br />
auf. Über einen Dateidialog wählen<br />
Sie die zu konvertierenden Dateien<br />
bequem aus. In der unteren<br />
Hälfte des Fensters finden sich die<br />
Einstellungen für das Zielformat.<br />
Transcoder unterteilt die Optionen<br />
in je einen Video- <strong>und</strong> Audio-Bereich<br />
sowie einige allgemeine<br />
Settings. Für Videos stehen<br />
acht unterschiedliche Codierungen<br />
zur Auswahl, wobei die Palette<br />
von H.263 <strong>und</strong> H.264 über<br />
MPEG2 bis hin zu VP8 <strong>und</strong> XVID<br />
reicht. Auflösung <strong>und</strong> Bitrate der<br />
Zieldatei lassen sich ebenso anpassen<br />
wie die Anzahl der Bilder<br />
pro Sek<strong>und</strong>e. Standardmäßig<br />
nutzt Transcoder eine Auflösung<br />
von 640x480 Pixeln. Im Audio-Bereich<br />
stehen die Codecs AAC, AC3,<br />
MP2, MP3 <strong>und</strong> Vorbis zur Verfügung.<br />
Die Bitrate liegt mit 128<br />
kbit/ s bei einer Sampling-Rate von<br />
48 kHz im Standardbereich, beide<br />
Parameter lassen sich aber anpassen.<br />
Während Sie die Bitrate stufenlos<br />
verändern, sind Sie bei der<br />
Sampling-Rate an Vorgaben geb<strong>und</strong>en<br />
(niedrigste Einstellung: 8<br />
kHz). Die angepassten Einstellungen<br />
gelten für alle Videos in<br />
der Transcoder-Bearbeitungsschlange,<br />
individuelle Settings pro<br />
Video kennt das Tool nicht. Haben<br />
Sie alle Einstellungen vorgenommen,<br />
starten Sie das Umwandeln<br />
mit einem Mausklick. Die konvertierten<br />
Dateien legt Transcoder in<br />
der Voreinstellung im Verzeichnis<br />
~/Videos ab. Mit dem Browse-Symbol<br />
am oberen rechten Fensterrand<br />
ändern Sie den Speicherort.<br />
transcoder 0.0.6<br />
Lizenz: GPLv3<br />
Quelle: http:// transcoder84.<br />
sourceforge. net<br />
12 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Angetestet<br />
aktuelles<br />
Mit Mynotex sämtliche Notizen im Griff<br />
Mynotex hilft, wichtige Notizen<br />
zu erfassen <strong>und</strong> effizient zu verwalten.<br />
Das Tool verwaltet seine<br />
Einträge in einer SQLite-Datenbank,<br />
die Sie beim Start angeben.<br />
So lassen sich für unterschiedliche<br />
Aufgaben eigene Dateien anlegen<br />
<strong>und</strong> pflegen. In einer Datenbank<br />
können Sie beliebig viele Notizen<br />
mit verschiedenen Titeln ablegen<br />
<strong>und</strong> diese auch datieren. Eine solche<br />
Notiz darf auch einen Datei-<br />
Anhang enthalten. Über frei definierbare<br />
Schlagwörter fassen Sie<br />
Notizen zu Themengruppen zusammen.<br />
Am rechten Fensterrand<br />
Mynotex 1.1.4<br />
Lizenz: GPLv3<br />
Quelle: http:// code. google. com/ p/<br />
sunflower-fm/<br />
listet Mynotex alle bereits vergebenen<br />
Schlagworte auf. Die Ziffer<br />
hinter dem Schlagwort gibt Auskunft<br />
darüber, wie viele Notizen<br />
dazu die aktuelle Mynotex-<br />
Datenbank enthält. Statt nach<br />
Schlagworten können Sie auch<br />
nach einem bestimmten Betreff<br />
oder nach Textpassagen suchen.<br />
Jede Suche erfolgt nur innerhalb<br />
der gerade geöffneten Datenbank,<br />
einen Suchlauf über mehrere Dateien<br />
beherrscht Mynotex nicht.<br />
Der Notiztext selbst lässt sich wie<br />
in einer Textverarbeitung formatieren.<br />
Dank der HTML-Exportfunktion<br />
von Mynotex stellen Sie<br />
Notizen bei Bedarf <strong>ohne</strong> großen<br />
Aufwand auch jederzeit online.<br />
Daneben besteht die Möglichkeit,<br />
Notizen aus Mynotex heraus in<br />
LibreOffice zu öffnen, dort zu bearbeiten<br />
<strong>und</strong> als ODF-Dokument<br />
zu speichern. Möchten Sie einzelne<br />
Notizen vor unbefugtem Zugriff<br />
schützen, verschlüsseln Sie<br />
diese über den Punkt Encrypt des<br />
Notes-Menüs oder per [Strg]+[E].<br />
Geschützte Notizen zeigt Mynotex<br />
in der Titelübersicht mit<br />
einem roten Schriftzug an.<br />
JJJII<br />
Mit Mynotex steht Ihnen<br />
ein leistungsfähiges,<br />
allerdings noch nicht<br />
deutsch lokalisiertes<br />
Werkzeug zum Verwalten<br />
von Notizen zur Verfügung.<br />
Putty, der komfortable SSH-Client<br />
Windows-Anwender kennen die des Konsolenprogramms plink automatisieren<br />
Sie Abläufe oder er-<br />
SSH-Suite Putty schon lange –<br />
dass es auch eine Linux-Version weitern Skripte um SSH-Funktionen.<br />
Neben SSH beherrscht<br />
gibt, ist hingegen weniger bekannt.<br />
Im Gegensatz zu anderen Putty auch das Telnet-Protokoll<br />
grafischen SSH-Clients handelt es <strong>und</strong> unterstützt Rlogin.<br />
sich bei Putty nicht um eine reine Wer Putty bereits von Windows<br />
Oberfläche für OpenSSH: Das her kennt, findet sich nach dem<br />
Tool läuft dank einer eigenen SSH- Start in der GTK-Oberfläche sofort<br />
zurecht. Um eine Verbindung<br />
Implementierung auch <strong>ohne</strong><br />
OpenSSH. Die Putty-Suite umfasst<br />
neben dem grafischen Client das Übertragungsprotokoll aus,<br />
aufzubauen, wählen Sie lediglich<br />
noch eine Reihe von Kommandozeilenprogrammen<br />
wie beispiels-<br />
Sys tems an <strong>und</strong> legen gegebenen-<br />
geben die Adresse des Remoteweise<br />
psftp <strong>und</strong> pscp zum sicheren falls zusätzlich den Port fest, auf<br />
Übertragen von Dateien. Mittels dem der Remote-Dienst läuft. In<br />
der Navigationsleiste am linken<br />
Putty 0.61<br />
Fensterrand listet Putty alle weiteren<br />
Konfigurationsmöglich-<br />
Lizenz: MIT/ X<br />
Quelle: http:// www. chiark. greenend. keiten auf. Im Bereich Terminal<br />
000_LU1106_F-Weber_neu1.qxd<br />
org. uk/ ~sgtatham/ putty/<br />
18.09.2006 passen 19:00 Sie Uhr etwa Seite das Tastaturlayout<br />
1<br />
an, unter Window wählen Sie eine<br />
andere Schrift art <strong>und</strong> Farbe. Möchten<br />
Sie über eine SSH-Verbindung<br />
eine Portweiterleitung einrichten,<br />
nehmen Sie die entsprechenden<br />
Einstellungen im Bereich Connection<br />
vor. Alle Parameter für eine<br />
Verbindung zu einem bestimmten<br />
Remote-System lassen sich als Profil<br />
abspeichern<br />
<strong>und</strong> wiederverwenden.<br />
Die Daten<br />
dazu legt Putty<br />
unter ~/.putty/<br />
sessions ab. Die<br />
gespeicherten<br />
Verbindungen lassen<br />
sich auch mit<br />
den restlichen<br />
Tools der Suite<br />
nutzen. (jlu) <br />
JJJII<br />
Die Version 0.61 der<br />
praktischen SSH-Suite<br />
Putty bringt keine großen<br />
Neuerungen mit, beseitigt<br />
aber einige Fehler<br />
<strong>und</strong> nimmt kleinere Anpassungen<br />
vor, sodass<br />
sich ein Upgrade lohnt.<br />
X23
Aktuelles<br />
Neues r<strong>und</strong> um Linux<br />
Eee PC X101: Laut Hersteller<br />
Asus das dünnste<br />
<strong>und</strong> leichteste<br />
Netbook der<br />
Welt.<br />
Asus Eee PC X101 mit Intel Meego<br />
Als dünnstes <strong>und</strong> leichtestes<br />
Netbook der Welt feiert Asus<br />
den Eee PC X101 (http:// tiny<br />
url. com/ lu1110-asus-x101).<br />
Der knapp 18 Millimeter<br />
schlanke <strong>und</strong> 920 Gramm<br />
leichte Rechner wartet mit einem<br />
matten 10,1-Zoll-Display<br />
auf <strong>und</strong> basiert auf einem Intel-<br />
NM10-Chipsatz mit Atom-CPU<br />
(N435, 1,33 GHz) <strong>und</strong><br />
integ rierter GMA-3150-<br />
Grafik. Asus verbaut im<br />
einzelnen Memory-<br />
Slot 1 GByte DDR3-<br />
RAM, das sich<br />
auf maximal<br />
2 GByte erweitern<br />
lässt.<br />
Als Massenspeicher<br />
dient eine 8-GByte-SDD.<br />
Für HD-Multimedia liefert<br />
diese Kombination zu wenig<br />
Power <strong>und</strong> Platz, doch dafür ist<br />
der Flachmann auch gar nicht<br />
gedacht. Mit Intels Linux-Ableger<br />
Meego als Betriebssystem<br />
zielt der Eee PC X101 vornehmlich<br />
auf Social-Networking-Anwender.<br />
Entsprechende<br />
Apps für Instant Messaging,<br />
Face book <strong>und</strong> Twitter hat Asus<br />
denn auch schon vorinstalliert.<br />
Darüber hinaus sollen der Hersteller-Appstore<br />
sowie die Online-Plattform<br />
ASUS@Vibe einen<br />
besonders leichten Zugriff<br />
auf Anwendungen, E-Books,<br />
Musik <strong>und</strong> Spiele bieten. Im typischen<br />
Betrieb hält der dreizellige<br />
LiIon-Akku (2.600 mAh)<br />
des Eee PC X101 laut Asus bis<br />
zu vier St<strong>und</strong>en lang durch. Die<br />
Multimedia-Ausstattung des<br />
Gerätes umfasst eine 0,3-Megapixel-Webcam,<br />
integrierte Stereo-Lautsprecher,<br />
ein Mikrofon<br />
sowie eine Buchse für Audio-<br />
In/ Out. Daneben bringt der<br />
Eee PC X101 zwei USB-2.0-<br />
Ports sowie einen MicroSD-<br />
Cardreader mit. Verbindung ins<br />
Netz nimmt das Netbook ausschließlich<br />
via 802.11b/ g/ n-<br />
WLAN auf. Einen Ethernet-<br />
Port sucht man ebenso vergeblich<br />
wie einen zusätzlichen<br />
Bildschirmausgang – dafür bietet<br />
der ultraflache Korpus zu<br />
wenig Platz. Den Asus Eee PC<br />
X101 gibt es ab sofort zum<br />
empfohlenen Verkaufspreis<br />
von 169 Euro im Handel. Für<br />
das mit matter, texturierter<br />
Oberfläche versehene Gehäuse<br />
des r<strong>und</strong> 26 mal 18 Zentimeter<br />
großen Net books stehen die<br />
Farben Schwarz, Weiß, Rot <strong>und</strong><br />
Braun zur Auswahl. Asus gewährt<br />
auf das Gerät zwei Jahre<br />
Garantie inklusive Pick-Up<strong>und</strong><br />
Return-Service. (jlu)<br />
kurz notiert<br />
Mit Libre Office 3.4.3 hat die Document<br />
Fo<strong>und</strong>ation pünktlich<br />
Ende August ein Bugfix-Release<br />
des freien Büropakets vorgelegt<br />
(http:// www. libreoffice. org). Anfang<br />
Oktober soll Version 3.4.4<br />
dann einige bereits jetzt bekannte<br />
Fehler ausbügeln. ÇDVD<br />
Die Scratch- <strong>und</strong> Mix-Software<br />
Xwax 1.0 ermöglicht es Vinyl-<br />
Diskjockeys, mithilfe von Timecode-Platten,<br />
einer hochwertigen<br />
So<strong>und</strong>karte <strong>und</strong> eines Linux-PCs<br />
digitale Audiodateien so<br />
zu manipulieren, als wären sie<br />
auf Platte gepresst (http:// xwax.<br />
co. uk). Damit stellt die GPLv2-<br />
Software eine Alternative zu proprietären<br />
Produkten wie Final<br />
Scratch dar. ÇDVD<br />
Das Ziel des Projekts Ubuntu<br />
Friendly besteht darin, eine offene<br />
Datenbank mit Ubuntukompatibler<br />
Hardware für jede<br />
Version von Ubuntu zu erstellen.<br />
Dazu sucht man nun verstärkt<br />
nach Feedback von Ubuntu-Nutzern<br />
vom Einsteiger bis zum<br />
Fortgeschrittenen (http:// tinyurl.<br />
com/ lu1110-friendly).<br />
AT200: Android-Flachmann von Toshiba<br />
Gerade 8 Millimeter dünn: Toshibas Tablet AT200.<br />
Nicht einmal 600 Gramm<br />
schwer <strong>und</strong> 8 Millimeter dünn,<br />
10 Zoll Bildschirmdiagonale:<br />
Das sind die Abmessungen des<br />
Android-Tablets AT200 von<br />
Toshiba. Der kapazitive Touchscreen<br />
löst mit 1280x800 Bildpunkten<br />
auf. Für den nötigen<br />
Vortrieb sorgt ein mit 1,2 GHz<br />
getakteter Dualcore-Prozessor<br />
OMAP-4430 von TI. 1 GByte<br />
Arbeitsspeicher dürften auch<br />
für speicherintensive Anwendungen<br />
ausreichen. Im Antutu-Benchmark<br />
liegt das Gerät<br />
mit 3323 Punkten jedoch<br />
allenfalls im Mittelfeld. Da uns<br />
lediglich ein Vorserienmodell<br />
zum Test bereitstand, sind<br />
diese Werte nicht auf die finale<br />
Version übertragbar.<br />
Toshiba stellt das AT200 in<br />
verschiedenen Varianten mit<br />
bis zu 64 GByte Speicherplatz<br />
zur Verfügung. Der integrierte<br />
Micro-SD-Slot unterstützt die<br />
SDXC-Spezifikation,<br />
womit<br />
er Karten<br />
bis zu einer<br />
Maximalkapazität<br />
von 2<br />
TByte verwaltet.<br />
Die<br />
WLAN-<br />
Schnittstelle<br />
unterstützt<br />
die gängigen<br />
Standards<br />
802.11b/ g/ n. Auf der Rückseite<br />
des Tablets sitzt eine<br />
5-Megapixel-Kamera, für Videokonferenzen<br />
gibt es in der<br />
Front eine kleinere mit 2 Megapixeln.<br />
Als Akkulaufzeit<br />
nennt Toshiba 8 St<strong>und</strong>en<br />
beim Abspielen von Videos,<br />
macht jedoch keine Angaben<br />
zur Akkukapazität.<br />
Auch beim empfohlenen Verkaufspreis<br />
hält sich der Hersteller<br />
eher bedeckt: Es hieß lediglich,<br />
das Tablet würde „zum<br />
handelsüblichen Marktpreis“<br />
erscheinen, womit es, je nach<br />
Ausstattung, ungefähr in der<br />
Kategorie zwischen 400 <strong>und</strong><br />
600 Euro liegen dürfte. Während<br />
das WLAN-Modell voraussichtlich<br />
im Herbst dieses<br />
Jahres in die Läden kommt,<br />
liefert Toshiba die UMTS-Variante<br />
wahrscheinlich erst zum<br />
Weihnachtsgeschäft im Dezember<br />
aus. (tle)<br />
14<br />
10 | 11<br />
Das Neueste r<strong>und</strong> um Linux, aktuelle Kurztests <strong>und</strong> Artikel aus<br />
<strong>LinuxUser</strong> finden Sie täglich auf www.linux-community.de
Mandriva 2011 nur mit KDE<br />
Mit etwas Verspätung gegenüber<br />
dem bisher gewohnten<br />
Rhythmus ist Ende August<br />
Mandriva 2011.0 „Hydrogen“<br />
erschienen, die erste Mandriva-Version<br />
seit dem Fork<br />
von Mageia (http:// tinyurl.<br />
com/ lu1110-hydrogen). Mit<br />
dieser Ausgabe der Distribution<br />
startet gleichzeitig ein<br />
neuer, zwölfmonatlicher Release-Zyklus<br />
mit 18 Monaten<br />
Support für die Versionen.<br />
Zum Jahresende soll außerdem<br />
eine Mandriva-LTS-Variante<br />
mit einem Long Term<br />
Support von drei Jahren erscheinen.<br />
Mandriva schickt<br />
„Hydrogen“ mit KDE 4 als<br />
einzigen mitgelieferten Desktop<br />
ins Rennen. Andere Umgebungen<br />
wie Gnome <strong>und</strong><br />
XFCE sollen zwar weiterhin<br />
von der Community angeboten<br />
werden, zählen aber künftig<br />
nicht mehr zu den offiziellen<br />
Mandriva-Paketen. Ziel<br />
dieser Konzentration auf KDE<br />
soll es sein, Mandriva zur<br />
ausgefeiltesten KDE-Distribution<br />
überhaupt zu machen.<br />
In dieselbe Kerbe schlägt<br />
das Simple-Welcome-Menü,<br />
das das gewohnte Kickoff ersetzt.<br />
Das Schnellstartmenü,<br />
das Ubuntus Unity-Starter<br />
<strong>und</strong> dem Pendant der Gnome-<br />
3-Shell ähnelt, dürfte bei altgedienten<br />
Mandriva-Anwendern<br />
für Kontroversen sorgen.<br />
Ähnliches gilt für den<br />
Wechsel des Paketformats<br />
vom weitverbreiteten RPM4<br />
zum inkompatiblen Fork<br />
RPM5 – umso mehr, als der<br />
passende Mandriva Package<br />
Manager MPM noch nicht<br />
fertig ist: Er soll erst in Mandriva<br />
2011 LTS zum Einsatz<br />
kommen. Das Fotomanagement<br />
hat Mandriva an Shotwell<br />
übertragen, das damit<br />
Digikam ersetzt. Zu den aktualisierten<br />
Bestandteilen zählen<br />
der Kernel 2.6.38.7, GCC<br />
4.6.1, Firefox 5.0.1 <strong>und</strong> Libre-<br />
Office 3.4.2. Als weitere Neuerungen<br />
listen die Entwickler<br />
die Funktion Timeframe für<br />
den Dateimanager Nepomuk<br />
auf. Damit sucht der Nutzer<br />
nicht in Ordnern nach Dateien,<br />
sondern fährt auf der<br />
Zeitleiste Timeframe zu dem<br />
Zeitpunkt, an dem die Files<br />
gespeichert wurden (http://<br />
wiki. mandriva. com/ en/ 2011.<br />
0_Notes).<br />
Auf der Heft- DVD dieser<br />
Ausgabe finden Sie die 32-<br />
Bit-Version von Mandriva<br />
2011.0 „Hydrogen“ als installierbare<br />
Live-DVD zum Ausprobieren.<br />
(uba/ jlu) ÇDVD<br />
„Simple Welcome“, das neue Menüsystem von Mandriva 2011<br />
„Hydrogen“, ersetzt das gewohnte Kickoff. (Bild: Mandriva)<br />
Virtuelle Server<br />
Top-Performance zum Tiefpreis!<br />
• bis zu 3 CPU-Kerne<br />
• bis zu 8 GB RAM<br />
• bis zu 95 GB Festplatte<br />
• RAID-10-Datensicherheit<br />
• 5.000 GB Traffic inklusive<br />
• SSL-Zertifikat inklusive<br />
• Root-Zugriff per SSH<br />
• 100 % Backup-Speicher<br />
• 99,9 % garantierte Verfügbarkeit<br />
• 30 Tage Geld-zurück-Garantie<br />
• auch als Managed Server erhältlich<br />
• viele 64-Bit-Betriebssysteme nach Wahl<br />
6 Monate<br />
kostenlos<br />
danach ab 12,99 €*<br />
Jetzt kostenlos informieren unter:<br />
080 0 638 2587<br />
www.netclusive.de/linux<br />
* Aktion „6 Monate kostenlos“ gilt bis 31.10.2011. Nach 6 Monaten regulärer monatlicher Gr<strong>und</strong>preis:<br />
VPS L 12,99 €, VPS XL 16,99 €, VPS XXL 29,99 €. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt wahlweise 12 Monate<br />
(Aktion 6 Monate kostenlos entfällt) oder 24 Monate (6 Monate kostenlos). Abrechnung vierteljährlich. Einmalige<br />
Einrichtungsgebühr 9,99 €. Alle Preise inkl. MwSt. Preisänderungen <strong>und</strong> Irrtümer vorbehalten.
Aktuelles<br />
Neues r<strong>und</strong> um Linux<br />
Der 4,8-Zoll-Touchscreen des<br />
Acer Iconia Smart lässt bei einer<br />
Auflösung von<br />
1024x480 Pixeln<br />
reichlich Platz für<br />
Anwendungen.<br />
kurz notiert<br />
Für Backtrack 5 R1 haben die<br />
Entwickler den Kernel auf Version<br />
2.6.39.4 gebracht <strong>und</strong> die benötigten<br />
Injection-Patches angewendet<br />
(http:// www. backtrack-linux. org).<br />
Zudem integrierten sie r<strong>und</strong> 30<br />
neue Tools in die Security-Live-<br />
Distribution <strong>und</strong> aktualisierten 70<br />
weitere Programme.<br />
Im Rahmen des „Summer of<br />
Code“ erhielt die Gnome Shell<br />
3.1.90 eine ganze Reihe von Verbesserungen,<br />
darunter ein<br />
Onscreen-Keyboard, eine Personensuche<br />
in der Überblicksansicht<br />
sowie die Anzeige von<br />
Cover-Art in den Benachrichtigungen<br />
(http:// tinyurl. com/<br />
lu1110-gshell).<br />
Das Linux-basierte Roboat hat<br />
bei der diesjährigen World Robotic<br />
Sailing Championship in Lübeck<br />
gegen 14 andere autonome,<br />
unbemannte Segelboote den Sieg<br />
errungen. Das siegreiche Gefährt<br />
stammt aus Österreich, ist 3,7<br />
Meter lang <strong>und</strong> wiegt r<strong>und</strong> 300<br />
Kilogramm (http:// www. roboat.<br />
at). Es kommt nicht nur für Rennen,<br />
sondern auch in der Walforschung<br />
zum Einsatz.<br />
Acer Iconia Smart: Android-Smartphone mit Tablet-Qualitäten<br />
Mit seinem neuesten Android-<br />
Smartphone peilt Acer Benutzer<br />
an, die ein vielseitiges Gerät<br />
für die mobile Unterhaltung suchen:<br />
Das Iconia Smart kombiniert<br />
die Funktionen eines Tablet-PCs<br />
mit dem Format<br />
eines Handys. Der kapazitive<br />
Multi-Touchscreen<br />
des Iconia Smart weist<br />
bei einer Diagonale von<br />
4,8 Zoll eine Auflösung<br />
von 1024x480 Pixeln<br />
auf, was im Querformat<br />
das bequeme Surfen im<br />
Web ermöglicht.<br />
Android 2.3 „Gingerbread“<br />
als Betriebssystem<br />
<strong>und</strong> eine mit 1 GHz<br />
getaktete Snapdragon-<br />
CPU (Qualcomm MSM<br />
8255-1) liefern laut<br />
Acer genug Power, um<br />
auch hochauflösende Video-<br />
Inhalte <strong>ohne</strong> Einschränkungen<br />
zu genießen. Als Arbeitsspeicher<br />
bringt das Iconia Smart<br />
Android-Outdoorhandy Xperia Active von Sony<br />
Die sportliche Generation der<br />
Smartphone-Nutzer adressiert<br />
Sony Ericsson mit seinem auf<br />
der IFA vorgestellten Outdoor-Handy<br />
Xperia Active.<br />
Das auf Android 2.3.4 basierende<br />
Quad-Band-Handy erfüllt<br />
nach Herstellerangaben<br />
die IP67-Spezifikation, die<br />
Android im Goldfischglas: Das Sony Xperia Active.<br />
512 MByte RAM mit. Bei einer<br />
Größe von 142x65x14 Millimetern<br />
bringt das Gerät r<strong>und</strong><br />
185 Gramm auf die Waage, der<br />
1500-mAh-Akku hält laut Hersteller<br />
8 bis 11 St<strong>und</strong>en Gesprächszeit<br />
oder 450 bis 500<br />
St<strong>und</strong>en Standby durch.<br />
Anschluss ins Mobilnetz findet<br />
das Iconia Smart via Triple-Band-<br />
3G (HSPA+/ WCDMA, HSDPA,<br />
HSUPA) <strong>und</strong> Quad-Band-2G<br />
(GSM/ GPRS/ EDGE), obendrein<br />
unterstützt es 802.11b/ g/ n-<br />
WLAN <strong>und</strong> Bluetooth 2.1+EDR.<br />
Über die rückseitige 8-Megapixel-Kamera<br />
(Auto-Fokus, LED-<br />
Blitz) nimmt das Smartphone bei<br />
Bedarf Videos im 720p-Format<br />
auf <strong>und</strong> kann diese später über<br />
DLNA/ UPnP direkt auf passende<br />
Geräte wie PCs, Fernseher oder<br />
Spielkonsolen streamen. Ein integrierter<br />
HDMI-Anschluss erlaubt<br />
auch das Abspielen auf externen<br />
Wiedergabegeräten wie<br />
Fernsehern oder Projektoren.<br />
Für IP-basierte Videochats gibt<br />
es außerdem eine frontseitige<br />
2-Megapixel-Cam. Mit an Bord<br />
sind daneben ein UKW-Radio<br />
mit RDS, GPS, zahlreiche Sensoren<br />
(unter anderem für Beschleunigung,<br />
Lage <strong>und</strong> Licht),<br />
ein MicroSD-Slot, ein Micro-<br />
USB-Port, ein Dual-Mikrofon sowie<br />
ein Audio-Ausgang (3,5mm-<br />
Klinkenstecker).<br />
Die Software-Ausstattung umfasst<br />
einen Flash-fähigen Webbrowser,<br />
Clients für E-Mail <strong>und</strong><br />
Instant Messaging, Anwendungen<br />
für Audio- <strong>und</strong> Video-<br />
Streaming, PC- <strong>und</strong> Cloud-Synchronisation,<br />
Navigation, Geotagging<br />
<strong>und</strong> Routenplanung sowie<br />
vieles andere mehr. Weitere<br />
Anwendungen lassen sich jederzeit<br />
aus dem Android Market<br />
nachziehen. Das Acer Iconia<br />
Smart ist ab Mitte September<br />
zu einem unverbindlich empfohlenen<br />
Preis von 499 Euro im<br />
Handel erhältlich. (jlu)<br />
ihm unter anderem attestiert,<br />
dass es unbeschadet 30 Minuten<br />
in einem Meter Wassertiefe<br />
übersteht. Daneben stattet<br />
der Hersteller das Xperia<br />
Active mit einem kratzfesten<br />
Display aus. Angeblich soll<br />
sich der Touchscreen auch mit<br />
nassen Fingern problemlos<br />
bedienen<br />
lassen.<br />
Das vergleichsweise<br />
kleine Display<br />
löst<br />
320x480<br />
Bildpunkte<br />
auf <strong>und</strong><br />
stellt 16<br />
Millionen<br />
Farben dar.<br />
Dafür liefert<br />
die 1-GHz-CPU genügend<br />
Power in allen Lebenslagen.<br />
Als verfügbaren Speicher<br />
nennt Sony bis zu 300 MByte,<br />
den eine mitgelieferte Micro-<br />
SD-Karte um 1 GByte erweitert.<br />
Die eingebaute 5-Megapixel-Kamera<br />
nimmt optional<br />
Filme bis zu einer Auflösung<br />
von 720 Pixeln bei einer Wiederholrate<br />
von 30 Bildern in<br />
der Sek<strong>und</strong>e auf. Falls es einmal<br />
zu dunkel wird, springt<br />
der integrierte Blitz ein. Als<br />
Akkustandzeit nennt der Hersteller<br />
bis zu 350 St<strong>und</strong>en im<br />
Standby <strong>und</strong> maximal 4,5<br />
St<strong>und</strong>en Gesprächszeit. Voraussichtlich<br />
erscheint das<br />
Smartphone im vierten Quartal<br />
2011 zu einem Preis von<br />
ungefähr 300 Euro auf den<br />
deutschen Markt.<br />
16<br />
10 | 11<br />
Das Neueste r<strong>und</strong> um Linux, aktuelle Kurztests <strong>und</strong> Artikel aus<br />
<strong>LinuxUser</strong> finden Sie täglich auf www.linux-community.de
Eigenwillige Android-Tablets von Sony<br />
Erfrischend anders gestaltet<br />
Sony seine beiden Neuzugänge<br />
Tablet S <strong>und</strong> Tablet P.<br />
Beide arbeiten mit Android<br />
3.2 <strong>und</strong> setzen auf Nvidias<br />
Tegra-2-Plattform mit einer<br />
Dual-Core-CPU mit 1 GHz<br />
Taktfrequenz. Diese Verb<strong>und</strong>enheit<br />
attestieren auch die<br />
Antutu-Benchmarks, bei dem<br />
beide Geräte beinahe auf den<br />
Punkt genau die gleichen<br />
Werte erreichten <strong>und</strong> das<br />
vergleichbare<br />
Toshiba<br />
AT200 trotz<br />
dessen 1,2-<br />
GHz Dual-<br />
Core-CPU<br />
deutlich in<br />
den Schatten<br />
stellen.<br />
Trotz der<br />
fast identischen<br />
Leistung<br />
fallen<br />
die beiden<br />
neuen Sony-<br />
Tablets optisch sehr unterschiedlich<br />
aus. So erinnert<br />
das Tablet P an ein Brillenetui,<br />
das in beiden Hälften je<br />
ein Display mit einer Diagonale<br />
von je 5,5 Zoll <strong>und</strong> einer<br />
Auflösung von 1024x480<br />
Bildpunkten aufweist. Je<br />
nach Einsatz dient der untere<br />
Teil als Tastatur oder Spielesteuerung,<br />
aber auch als Ergänzung<br />
zum oberen Display.<br />
Das Tablet S wartet mit<br />
einem eigenwilligen, V-förmigen<br />
Profil auf, wodurch es<br />
laut Sony ergonomischer in<br />
der Hand liegen soll. Das 9,4<br />
Zoll große Display bietet eine<br />
Auflösung von 1200x800 Pixeln.<br />
Als Besonderheit stattet<br />
der Hersteller das Gerät<br />
mit einer Infrarotschnittstelle<br />
aus, die es zu einer<br />
multifunktionalen Fernbedienung<br />
umfunktioniert.<br />
Sony stellt dafür tausende<br />
Sonys Tablet P erinnert optisch ein wenig an ein<br />
Brillenetui <strong>und</strong> sticht nicht nur damit wohltuend<br />
aus dem Tablet-Einerlei hervor.<br />
Auch beim Tablet S gingen Sonys Designer eigene<br />
Wege. Dank seiner Infarot-Schnittstelle arbeitet<br />
es auch als Multifunktionsfernbedienung.<br />
Profile verschiedener Marken<br />
<strong>und</strong> Geräte zum Download<br />
bereit. Für unbekannte Marken<br />
steht ein Lernmodus zur<br />
Verfügung.<br />
Die WLAN-Variante des Tablet<br />
S soll bereits Ende September<br />
zu einem Preis von<br />
479 Euro für die 16-GByte-<br />
Version <strong>und</strong> 579 Euro für das<br />
32-GByte-Modell in den<br />
Handel kommen. Im November<br />
folgt eine 3G-Version für<br />
599 Euro.<br />
Das Tablet P<br />
bringt Sony<br />
voraussichtlich<br />
ebenfalls<br />
im November<br />
zu einem<br />
Preis von<br />
599 Euro heraus.<br />
Derzeit<br />
ist nur eine<br />
16-GByte-<br />
Version vorgesehen.<br />
(tle)<br />
Die Welt des perfekten Druckens<br />
TurboPrint 2<br />
for Linux<br />
"Mit TurboPrint macht der Einsatz aktueller Drucker<br />
unter Linux richtig Spaß." Zitat <strong>LinuxUser</strong> 3/2011<br />
Linux-Desktop mit TurboPrint Statusmonitor <strong>und</strong> Druckvorschau<br />
Jetzt 30 Tage kostenlos testen!<br />
Testversion auf www.turboprint.de<br />
Intelligente Treiber<br />
einfache Konfiguration über grafisches Menü<br />
Fotos <strong>und</strong> Dokumente in höchster Druckqualität<br />
präzises Farbmanagement für perfekte Farben<br />
Farbprofile für Spezial- <strong>und</strong> Fotopapiere<br />
Tintensparoptionen: halber Tintenverbrauch bei guter<br />
Druckqualität<br />
Drucker-Statusmonitor<br />
Tintenstand <strong>und</strong> Druckerstatus, Tools z.B. Düsenreinigung<br />
Anzeige von Druckaufträgen <strong>und</strong> Fortschritt<br />
schnelle Diagnose bei Druckproblemen<br />
Miniprogramm für Schnellzugriff aus Kontrollleiste<br />
Mehr Möglichkeiten<br />
Druckvorschau, manueller Duplexdruck<br />
komfortables Drucken im Netzwerk<br />
variabler CD-Druck, randloser Fotodruck<br />
Anwendersupport über Forum <strong>und</strong> per E-Mail<br />
TurboPrint Studio mit erweiterten Funktionen<br />
Farbeinmess-Service<br />
neue Farbräume <strong>und</strong> ICC-Profile einbinden<br />
CMYK-Proof ermöglicht farbverbindliche Drucke<br />
Preise im Online-Shop (incl. MwSt):<br />
TurboPrint Pro € 29,95<br />
TurboPrint Studio € 59,95<br />
Farbprofil-Einmessung € 14,95<br />
Über 400 Drucker sind unterstützt, z.B.<br />
Canon PIXMA iP, iX, MP, MX, MG, Pro9000/9500, Epson Stylus BX,<br />
SX, Stylus Photo P, PX, R1900/2880/3000, HP PhotoSmart ...<br />
Für alle gängigen Linux-Distributionen z.B. Ubuntu, SuSE, Debian,<br />
Fedora (x86 32/64bit CPU).<br />
net<br />
ZE<br />
DO<br />
www.turboprint.de<br />
ZEDOnet GmbH - Meinrad-Spieß-Platz 2 - D-87660 Irsee - Tel. 08341/9083905
Aktuelles<br />
Neues r<strong>und</strong> um Linux<br />
kurz notiert<br />
Das interaktive Tool PDF Masher<br />
0.6.0 wandelt PDF-Dokumente in<br />
E-Books der Formate EPUB <strong>und</strong><br />
Mobi um. Um korrekt strukturierte<br />
E-Books zu erzeugen, lässt<br />
es den Anwender Überschriften,<br />
Kolumnentitel <strong>und</strong> Ähnliches<br />
markieren <strong>und</strong> kann daraus nun<br />
auch Inhaltsverzeichnisse generieren<br />
(http:// www. hardcoded.<br />
net/ pdfmasher/).<br />
Toorox 08.2011 gibt es in den<br />
zwei Varianten XFCE <strong>und</strong> Lite<br />
(http:// toorox. de). Beide Spielarten<br />
der auf Gentoo basierenden<br />
Live-Distribution verwenden<br />
XFCE 4.8.0 als Desktop. In der<br />
Lite-Edition ersetzen jedoch<br />
schlankere Programme wie Abiword<br />
oder Midori schwergewichtige<br />
Anwendungen wie LibreOffice<br />
oder Icecat. Als Basis dient<br />
Kernel 2.6.39-gentoo-r3.<br />
Der Window-Manager Openbox<br />
3.5.0 verbessert die Xinerama-<br />
Unterstützung <strong>und</strong> erlaubt Icons<br />
in den Menüs. Das Tastenkürzel<br />
[Alt]+[Tab] zeigt die geöffneten<br />
Fenster in einer vertikalen Liste<br />
an. Daneben lassen sich jetzt<br />
auch die Dialogfenster mit<br />
Themes verschönern. Außerdem<br />
beseitigten die Entwickler zahlreiche<br />
Bugs (http:// openbox. org).<br />
Das Open-Source-Finanzprogramm<br />
KMyMoney 4.6.0 bringt<br />
als Neuerung ein Plugin zum Import<br />
von CSV-Dateien mit. Das<br />
Nachschlagen von Geldinstituten<br />
per OFX erfolgt nun über den<br />
Service Ofxhome.com, da Microsoft<br />
seinen entsprechenden<br />
Dienst eingestellt hat. Außerdem<br />
beseitigten die Entwickler über<br />
100 Bugs <strong>und</strong> fügten einige neue<br />
Lokalisierungen hinzu (http://<br />
kmymoney2. sourceforge. net).<br />
Die Rettungsdistribution System<br />
Rescue CD 2.3.0 basiert auf<br />
Kernel 3.0 <strong>und</strong> ist mit zahlreichen<br />
Software-Updates erhältlich.<br />
Gparted als zentrale Anwendung<br />
springt auf Version 0.9.0, Parted<br />
auf 2.4. Daneben nahmen die<br />
Entwickler Firefox 5.0 auf (http://<br />
www. sysresccd. org).<br />
„Honeycomb“ beschleunigt Dells Streak 7<br />
Das Streak 7 von Dell gehört zu<br />
den am besten verarbeiteten<br />
Android-Tablets im 7-Zoll-Format<br />
<strong>und</strong> ist bei Straßenpreisen<br />
um 300 Euro auch nicht mehr<br />
allzu teuer. Allerdings mangelte<br />
Mit dem Update auf Android 3.2 kann das Tegra-2-<br />
Tablet von Dell endlich zeigen, was in ihm steckt.<br />
Mit der Entwicklerversion<br />
2.7.3 nähert sich Gimp wieder<br />
ein Stück der bereits seit Längerem<br />
anvisierten Stable 2.8<br />
an. Die nun funktionsfähige<br />
Umsetzung des Single-Window-Modus<br />
gilt den Entwicklern<br />
als eines der wichtigen<br />
Der Open-Source-Entwickler<br />
José Félix Ontañón hat eine<br />
<strong>GUI</strong>-Anwendung namens<br />
Udev-Discover geschrieben,<br />
mit der sich Hardware-Informationen<br />
komfortabel durchblättern<br />
lassen (http://<br />
fontanon. org/ udevdiscover/).<br />
Die Software ähnelt dem<br />
Gnome Device Manager, der<br />
aber das obsolete HAL nutzte,<br />
um an Hardware-Informationen<br />
zu kommen. Das neue<br />
Werkzeug verwendet die Udev-<br />
Schnittstelle <strong>und</strong> zeigt ausführliche<br />
Informationen der im<br />
Sysfs des Linux-Kernels vorhandenen<br />
Geräte an. Die Einträge<br />
lassen sich durchsuchen<br />
<strong>und</strong> filtern, einzelne Geräte<br />
es ihm bisher an der nötigen<br />
Performance: Trotz Tegra-2-<br />
CPU (1 GHz, Dualcore) fühlte<br />
sich das Streak eher wie ein auf<br />
600 MHz getaktetes Billig-Pad<br />
an. Dank Android 3.2 ändert<br />
sich das jetzt:<br />
Das Tablet reagiert<br />
unter<br />
„Honeycomb“<br />
flüssig auf<br />
Eingaben <strong>und</strong><br />
macht trotz<br />
der geringen<br />
Auflösung<br />
von 800x480<br />
Bildpunkten<br />
so richtig Spaß.<br />
Gimp 2.7.3 mit Single-Window-Modus<br />
Features. Daneben bügelt<br />
Gimp 2.7.3 viele Fehler aus<br />
<strong>und</strong> bringt unter der Haube einige<br />
Neuerungen mit. Deswegen<br />
funktionieren möglicherweise<br />
für die derzeitige Stable<br />
Gimp 2.6 gedachte Plugins <strong>und</strong><br />
Skripts nur noch bedingt mit<br />
Udev-Discover: Gerätewart mit <strong>GUI</strong><br />
kann man auf Events überwachen.<br />
Udev-Discover steht unter<br />
GPLv3 <strong>und</strong> ist mit Python<br />
<strong>und</strong> GTK+ 3 umgesetzt. Auf<br />
Mit Android 3.2 ist nun auch<br />
die Tegra-Zone von Nvidia vorinstalliert,<br />
sodass sich auch<br />
Top-Games problemlos spielen<br />
lassen. Beim Antutu-Benchmark<br />
schafft das Streak sehr<br />
gute 4959 Punkte. Mit dem<br />
„Honeycomb“-Update verbessert<br />
sich auch die Akkulaufzeit<br />
des Streak 7 deutlich: So sind<br />
nun bis zu 8 St<strong>und</strong>en Video-<br />
Playback <strong>und</strong> mehrere Tage<br />
Standby möglich. Das Honeycomb-Update<br />
spielt Dell overthe-air<br />
ein – allerdings gilt es,<br />
zuvor sämtliche Daten mit der<br />
vorinstallierten Backup-Software<br />
von Nero zu sichern. (mhi)<br />
dem neuen Release. Gimp 2.8<br />
könnte gemäß den Plänen der<br />
Entwickler zum Jahresende erscheinen,<br />
vorher sind laut<br />
Chef entwickler Martin Nordholts<br />
zwingend noch Arbeiten<br />
an verschiedenen Layer-Funktionen<br />
nötig. (uba) ÇDVD<br />
Launchpad stehen Ubuntu/ Debian-Pakete<br />
sowie der Quelltext<br />
von Udev-Discover zum<br />
Herunterladen bereit. (mhu)<br />
Udev-Discover durchsucht das Linux-Sysfs sowie dessen Subsysteme<br />
nach Hardware-Informationen. (Bild: José Félix Ontañón)<br />
18<br />
10 | 11<br />
Das Neueste r<strong>und</strong> um Linux, aktuelle Kurztests <strong>und</strong> Artikel aus<br />
<strong>LinuxUser</strong> finden Sie täglich auf www.linux-community.de
Neues r<strong>und</strong> um Linux<br />
Aktuelles<br />
Asus schnürt B<strong>und</strong>le aus Android-Tablet <strong>und</strong> Docking-Tastatur<br />
„Honeycomb“-Tablet <strong>und</strong> Netbook<br />
in einem – so präsentiert<br />
Asus ein B<strong>und</strong>le aus dem<br />
Eee Pad Transformer TF101<br />
plus Docking-Tastatur, das es<br />
ab sofort im Handel gibt. Das<br />
Webpad TF101 (http:// tinyurl.<br />
com/ lu1110-asus-tf101) basiert<br />
auf einem Tegra-2-SoC von Nvidia<br />
mit Dualcore-ARM9-CPU<br />
(1 GHz) <strong>und</strong> Geforce-ULP-GPU<br />
(4 Kerne). Als Arbeitsspeicher<br />
bringt es 1 GByte DDR2-RAM<br />
mit, als Massenspeicher 16<br />
GByte eMMC. Das bei einem<br />
Format von 271x177x13 Millimetern<br />
<strong>und</strong> nur 680 Gramm<br />
Gewicht recht handliche Tablet<br />
besitzt einen kapazitiven 10,1-<br />
Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung<br />
von 1280x800 Pixeln.<br />
Als Betriebssystem ist<br />
Android 3.1 vorinstalliert, das<br />
sich aber over-the-air auf Version<br />
3.2 aktualisieren lässt.<br />
Über je einen Beschleunigungs<strong>und</strong><br />
Licht-Sensor sowie Gyroskop,<br />
Kompass <strong>und</strong> GPS registriert<br />
das TF101 seine Umwelt,<br />
mit der es via 802.11b/ g/ n-<br />
WLAN <strong>und</strong> Bluetooth 2.1+EDR<br />
bei Bedarf Kontakt aufnimmt.<br />
Die Multimedia-Ausstattung<br />
umfasst je eine front- <strong>und</strong> rückseitige<br />
Kamera (1,2 / 5 Megapixel),<br />
Stereo-Lautsprecher <strong>und</strong><br />
Mikrofon sowie eine kombinierte<br />
Kopfhörer/ Mikro-<br />
Buchse. Ansonsten beherbergt<br />
das rutschfeste braune Gehäuse<br />
lediglich noch einen Mini-<br />
HDMI-Port, einen Micro-SD-<br />
Cardreader sowie einen zweizelligen<br />
LiPo-Akku (3300 mAh,<br />
18 Watt), der laut Asus für bis<br />
zu 9,5 St<strong>und</strong>en Laufzeit taugt.<br />
Bei Anschluss des im Paket<br />
enthaltenen Docks mit Tastatur<br />
<strong>und</strong> Touchpad, das ebenfalls einen<br />
Zweizellen-Akku an Bord<br />
hat, erhöht sich die mögliche<br />
Laufzeit nach Herstellerangabe<br />
auf 16 St<strong>und</strong>en. Außerdem<br />
bringt das ansteckbare Unterteil<br />
auch zwei USB-2.0-Ports<br />
zum Anschluss von Peripherie<br />
sowie einen MMC/ SD/ SDHC-<br />
Cardreader mit. Mit einer<br />
Größe von 271x185x41 Millimetern<br />
<strong>und</strong> gut 1,3 Kilo Gesamtgewicht<br />
fällt das aus<br />
der Tab/ Tastaturdock-<br />
Kombi entstehende<br />
„Netbook“<br />
allerdings weder<br />
besonders klein noch recht<br />
leicht aus.<br />
Das B<strong>und</strong>le aus Eee Pad Transformer<br />
TF101 <strong>und</strong> Dockingtastatur<br />
vertreibt Asus ab sofort<br />
über ausgewählte Online-<br />
Shops <strong>und</strong> Fachhändler in<br />
Deutschland <strong>und</strong> Österreich<br />
zum empfohlenen Verkaufspreis<br />
von 499 Euro. (jlu) n<br />
Steck dir einen: Den Asus<br />
Eee Pad Transformer TF101 samt<br />
passender Dockingtastatur gibt<br />
es jetzt im günstigen B<strong>und</strong>le.<br />
1. Lernen Sie!<br />
Ja, ã training-on-the-jobÒ , oft praktiziert, aber nicht<br />
Ÿ berzeugend. Denn die Kollegen haben nie Zeit<br />
fŸ r echte ErklŠ rungen, au§ erdem werden ã NeueÒ<br />
sofort von dem vereinnahmt, was im Unternehmen<br />
schon seit Ewigkeiten tradiert wird. Warum gibt's<br />
seit 2000 Jahren Schulen <strong>und</strong> UniversitŠ ten?<br />
ã LERNENÒ ist eine vollwertige TŠ tigkeit, auf die<br />
man sich konzentrieren mu§ , die man nicht 'mal<br />
eben so nebenbei tun kann, <strong>und</strong> die immer auch<br />
eine Prise ã ErneuerungÒ beinhalten sollte!<br />
2. Ineffiziente Arbeit nicht akzeptieren!<br />
Je spezialisierter Sie arbeiten, desto weniger<br />
echte, fachliche Kollegen haben Sie in Ihrem eigenen<br />
Unternehmen. Wir stellen deshalb Gruppen<br />
zusammen, in denen Sie neben hilfsbereiten<br />
Kollegen mit Š hnlichen Kenntnissen an IHREM<br />
Projekt arbeiten. Und stŠ ndig ist ein fachlicher Berater<br />
anwesend.<br />
Das Neueste r<strong>und</strong> um Linux, aktuelle Kurztests <strong>und</strong> Artikel aus<br />
<strong>LinuxUser</strong> finden Sie täglich auf www.linux-community.de<br />
ã Guided CoworkingÒ nennen wir das, <strong>und</strong> es<br />
kš nnte DIE Lš sung fŸ r so manches Projekt sein,<br />
das in Ihrer Firma ã haktÒ .<br />
3. Hintergr<strong>und</strong><br />
Wer den riesigen OpenSource-Baukasten schnell<br />
beherrschen mu§ , geht zu einer unserer Ÿ ber 100<br />
Schulungen. Wer das bereits kann, aber schneller<br />
mit seinen Projekten vorankommen will, der<br />
kommt mit seiner Arbeit zum Guided Coworking.<br />
Wir sind eine der erfolgreichsten Schulungseinrichtungen<br />
im gesamten Bereich ã OpenSourceÒ<br />
- sowohl fŸ r Admins, als auch fŸ r Entwickler.<br />
Siehe www.linuxhotel.de<br />
10 | 11 19
schwerpunkt<br />
Bash-Skripting<br />
Erste Schritte mit Bash-Skripten<br />
Kleine Helfer<br />
Das Programmieren von Shell-Skripten ist keine Hexerei. Schon mit wenigen Gr<strong>und</strong>kenntnissen<br />
sparen Sie durch das <strong>Automatisieren</strong> alltäglicher Aufgaben viel Zeit. Æleen Frisch<br />
© Svilen001, sxc.hu<br />
reADMe<br />
Die Bourne-Again-Shell<br />
Bash hilft bei vielen<br />
kleinen <strong>und</strong> großen Aufgaben.<br />
Wenn Sie ein<br />
paar einfache Kniffe beherrschen<br />
<strong>und</strong> die richtigen<br />
Konstrukte kennen,<br />
können Sie im<br />
Lauf der Zeit viel Zeit<br />
<strong>und</strong> Mühe sparen.<br />
Listing 1<br />
#!/bin/bash<br />
if [ $# ‐gt 0 ]; then # Mindestens ein Argument sollte<br />
hier stehen<br />
tar czf /save/mystuff.tgz $@ >/dev/null<br />
fi<br />
Shell-Skripte sind der beste<br />
Fre<strong>und</strong> bequemer Menschen. Das<br />
mag seltsam klingen, denn das<br />
Schreiben eines Shell-Skripts setzt<br />
Können <strong>und</strong> Arbeit voraus, trotzdem<br />
stimmt es: Schreiben Sie ein<br />
Shell-Skript zum Erledigen von<br />
sich wiederholenden Aufgaben,<br />
rentiert sich die investierte Zeit in<br />
der Zukunft mehrfach. Außerdem<br />
ist das Schreiben eines Shell-<br />
Skripts eine Herausforderung, die<br />
viel Freude macht. Die nicht nur<br />
Bequemen, sondern auch Cleveren<br />
nehmen sich deshalb Zeit fürs Erlernen<br />
der Shell-Befehle <strong>und</strong> das<br />
Schreiben von Skripten.<br />
Dieser Artikel fasst die Gr<strong>und</strong>lagen<br />
zum Schreiben von Shell-<br />
Skripten mit Bash im Kontext einiger<br />
allgemeiner Aufgaben im<br />
Zusammenhang mit dem PC zusammen.<br />
Dabei erhalten Sie die<br />
wichtigsten Informationen, um<br />
gleich mit dem Schreiben eigener<br />
Skripte zu beginnen. Eine Zusammenfassung<br />
der im Artikel behandelten<br />
Kommandos <strong>und</strong> Optionen<br />
finden Sie in der Tabelle Schnellübersicht<br />
am Ende des Artikels.<br />
Hallo Bash!<br />
In der einfachsten Form besteht<br />
ein Shell-Skript lediglich aus einer<br />
Datei mit einer Liste von auszuführenden<br />
Befehlen. Das folgende<br />
Skript führt beispielsweise<br />
einen langen Tar-Befehl aus, um<br />
ein Backup von verschiedenen<br />
Bilddateien zu erstellen:<br />
#!/bin/bash<br />
tar cvzf /save/pix.tgz /home/chaU<br />
vez/pix /graphics/rdc /new/pix/rU<br />
rachel<br />
Das Skript beginnt mit einer speziellen<br />
Zeile, die die Datei selbst<br />
als Skript identifiziert. Die Kombination<br />
#! nennt man „Shebang“,<br />
darauf folgt der vollständige<br />
Dateipfad zur entsprechenden<br />
Shell. Der Shebang #!/bin/bash<br />
ruft ausdrücklich die Bourne-<br />
Again-Shell zum Ausführen des<br />
Skripts auf.<br />
Verwenden Sie die allgemeinere<br />
Form #!/bin/sh, kommt die Standard-Shell<br />
des Systems zum Zug,<br />
auf die der Symlink /bin/sh verweist<br />
– unter Ubuntu ist das beispielsweise<br />
die schlanke, weitgehend<br />
zur Bash kompatible Dash.<br />
Sie können die Ausführung aber<br />
auch einem ganz anderen Programm<br />
übertragen: Der Shebang<br />
#!/bin/cat etwa führt dazu, dass<br />
das entsprechende Programm<br />
den Inhalt des „Skripts“ auf der<br />
Konsole ausgibt.<br />
Damit die Shell das Skript auch<br />
als ausführbare Datei erkennt,<br />
setzen Sie zunächst die Ausführungsrechte<br />
entsprechend. Heißt<br />
die Datei zum Beispiel mytar, dann<br />
erledigen Sie das mit dem Befehl<br />
20 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Bash-Skripting<br />
schwerpunkt<br />
chmod u+x mytar – vorausgesetzt,<br />
die Datei liegt im aktuellen Verzeichnis.<br />
Der Rest des Skripts nach dem<br />
Shebang besteht aus dem eigentlichen<br />
Tar-Befehl mit den zu verarbeitenden<br />
Pfaden <strong>und</strong> Dateinamen.<br />
Der folgende Befehl führt<br />
das Skript aus, woraufhin einige<br />
Meldungen von Tar folgen:<br />
$ ./mytar<br />
Damit haben Sie die Anzahl der<br />
Anschläge, die zum Erzeugen eines<br />
Archivs nötig sind, von etwa<br />
75 Zeichen auf 8 Zeichen reduziert.<br />
Allerdings ließe sich das<br />
Skript noch etwas allgemeiner –<br />
<strong>und</strong> damit auch nützlicher – gestalten,<br />
indem Sie die zu archivierenden<br />
Dateien in der Kommandozeile<br />
angeben:<br />
$ ./mytar /home/chavez /new/pix/U<br />
rachel /jobs/proj5<br />
Mit diesem Befehl archivieren Sie<br />
eine andere Gruppe von Dateien.<br />
Das modifizierte Skript sehen Sie<br />
in Listing 1.<br />
Es gibt darin einige neue Features:<br />
Der Tar-Befehl verwendet<br />
jetzt Ein- <strong>und</strong> Ausgabeumleitung,<br />
um alle Meldungen zu unterdrücken,<br />
die sich nicht auf Fehler beziehen.<br />
Der Befehl befindet sich<br />
innerhalb einer If-Anweisung. Erweist<br />
sich die in eckigen Klammern<br />
angegebene Bedingung als<br />
wahr, arbeitet das Skript die darauf<br />
folgenden Befehle ab.<br />
Das Skript prüft, ob die Anzahl<br />
der Argumente zum Skript, die<br />
Sie in der Variable $# finden, höher<br />
als 0 liegt. Trifft das zu, hat<br />
der Benutzer einen oder mehrere<br />
Pfade fürs Archivieren angegeben.<br />
Fehlen die Parameter, gibt es<br />
nichts zu tun, der Befehl kommt<br />
also nicht zum Einsatz.<br />
Die neue Variante bietet außerdem<br />
einen weiteren Vorteil: Das<br />
Skript übergibt die Argumente,<br />
die es auf der Kommandozeile erhalten<br />
hat, mittels der speziellen<br />
Variable $@ an den Tar-Befehl.<br />
Diese Variable enthält die Liste<br />
der Argumente. Der Befehl von<br />
unserem Beispiel sieht dann wie<br />
folgt aus:<br />
tar czf /save/mystuff.tgz /home/U<br />
chavez /new/pix/rachel /jobs/proU<br />
j5 >/dev/null<br />
Auch hier haben Sie wieder jede<br />
Menge Tipparbeit gespart – zwar<br />
nicht ganz so viel, wie in der ersten<br />
Version des Skripts, dafür arbeitet<br />
diese Variante aber wesentlich<br />
flexibler.<br />
#!/bin/bash<br />
Eingabedatei<br />
Mit der Methode in Listing 2 ändern<br />
Sie die Arbeitsweise des<br />
Skripts. Das erste Argument enthält<br />
nun eine Datei, die eine Liste<br />
der zu archivierenden Verzeichnisse<br />
enthält. Die übrigen Argumente<br />
behandelt das Skript als<br />
einzelne Elemente, die es ebenfalls<br />
verwendet, wieder in der<br />
schon bekannten Variable $@.<br />
Das Skript verwendet die Variablen<br />
DIRS <strong>und</strong> OUTFILE. Gemäß unausgesprochener<br />
Konvention <strong>und</strong><br />
für die bessere Übersicht verwenden<br />
Sie am besten Großbuchstaben<br />
für die Variablennamen –<br />
zwingend erforderlich ist das aber<br />
nicht. Mit der ersten Anweisung<br />
speichert das Skript den Inhalt<br />
der im ersten Argument angegebenen<br />
Datei. Durch das Setzen<br />
der Backticks fügen Sie die Ausgabe<br />
des Cat-Befehls ein statt des<br />
Befehls selbst einzufügen.<br />
Das klappt mit jedem Befehl,<br />
den Sie zwischen die Backticks<br />
setzen. Auf diese Weise führt die<br />
Shell diesen zuerst aus <strong>und</strong> setzt<br />
die Ausgabe an dieser Stelle ein.<br />
Steht dieses Konstrukt innerhalb<br />
einer Anweisung, übernimmt diese<br />
anschließend die Ausgabe. Im<br />
Beispiel gibt der Befehl cat den<br />
Inhalt der Datei, angegeben als<br />
erstes Argument zum Skript –<br />
nämlich die Verzeichnisliste – aus<br />
<strong>und</strong> fügt diese innerhalb der doppelten<br />
Anführungszeichen in die<br />
Zuordnung ein <strong>und</strong> definiert dadurch<br />
die Variable DIRS. Zeilenumbrüche<br />
in der Datei der Verzeichnisliste<br />
spielen dabei keine Rolle:<br />
Diese wandelt die Shell in Leerzeichen<br />
um.<br />
Nachdem die Datei eingelesen<br />
ist <strong>und</strong> das Skript das erste Argument<br />
abgearbeitet hat, nutzen Sie<br />
die Anweisung shift, um den Dateinamen<br />
aus der Liste zu entfernen.<br />
Die neue Liste der Argumente<br />
enthält zudem Verzeichnisse,<br />
sofern Sie diese zuvor in der<br />
Kommandozeile angegeben haben,<br />
<strong>und</strong> $@ expandiert wieder zu<br />
der gewünschten Liste: Das<br />
Skript ersetzt die Variable durch<br />
die Verzeichnisnamen. Der Mechanismus<br />
ermöglicht es also, zuerst<br />
eine feste Liste von Elementen<br />
zum Archivieren im Skript zu<br />
speichern <strong>und</strong> – falls nötig – weitere<br />
Elemente als Parameter miteinzubeziehen.<br />
Die dritte Anweisung definiert<br />
die Variable OUTFILE, diesmal unter<br />
Zuhilfenahme des Kommandos<br />
date. Die Syntax $(...) entspricht<br />
dem Verwenden von Backticks<br />
(siehe Kasten Backticks oder<br />
nicht? auf der nächsten Seite).<br />
Diese Art von Operation ist unter<br />
dem Namen Kommando-Substitution<br />
bekannt.<br />
In der letzten Zeile steht dann<br />
der eigentliche Tar-Befehl, der<br />
nun die Liste aus der Datei sowie<br />
eventuelle zusätzliche Argumente<br />
berücksichtigt, die Sie archivieren<br />
wollen. Verwenden Sie eine<br />
Listing 2<br />
DIRS="`cat $1`"<br />
# DIRS = Inhalt der Datei im ersten<br />
Argument<br />
shift<br />
# entfernt das erste Argument aus der Liste<br />
OUTFILE="$(date +%y%m%d)" # erstellt einen Archivnamen mit Datum<br />
tar czf /tmp/$OUTFILE.tgz $DIRS $@ >/dev/null<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 21
schwerpunkt<br />
Bash-Skripting<br />
BAckticks oDer nicht?<br />
Variab le innerhalb einer anderen<br />
Anweisung, vergessen Sie nie, das<br />
Dollar-Zeichen vor dem Variablennamen<br />
zu setzen, wie zum Beispiel<br />
bei $DIRS.<br />
Tests<br />
Das Skript in Listing 2 prüft weniger<br />
gründlich als die vorherigen<br />
Beispiele die Exaktheit der Argumente.<br />
Etwas anspruchsvoller gestaltet<br />
sich Listing 3, das diese<br />
Prüfung wieder einführt <strong>und</strong><br />
noch mehr Flexibilität gewährleistet.<br />
Für das schnelle Bearbeiten<br />
von Argumenten kommt hier<br />
die Getopts-Funktion der Bash<br />
zum Einsatz.<br />
Die ersten beiden Befehle weisen<br />
den Variablen DEST <strong>und</strong> PREFIX<br />
die gewünschten Werte zu: zum<br />
einen das Verzeichnis, in dem die<br />
Archivdatei landet, sowie den Anfang<br />
des Dateinamens für das Archiv.<br />
Dieses Prefix erhält als Zusatz<br />
die Zeichenkette des aktuellen<br />
Datums (wie in Listing 2 oder<br />
Listing 4 auf der nächsten Seite<br />
definiert). Der Rest dieses Abschnittes<br />
im Skript folgt der<br />
Struktur einer While-Schleife:<br />
while Bedingung;<br />
Befehle<br />
done<br />
Bei der Kommandosubstitution hat bereits vor geraumer Weile<br />
die Schreibweise $(...) die ältere Variante mit Backticks abgelöst.<br />
Dafür gibt es gute Gründe:<br />
• Bessere Lesbarkeit: In vielen Darstellungsformen verwechselt<br />
man den Backtick ` sehr leicht mit dem einfachen Anführungszeichen<br />
’.<br />
• Besser einzutippen: Auf vielen internationalen Keyboard-Layouts<br />
lässt sich der Backtick nur schwer erreichen, auf manchen<br />
fehlt er ganz (etwa bei italienischen Standard-Keyboards).<br />
• Eindeutigere Syntax: Insbesondere beim Verschachteln von<br />
Substitutionen sowie beim Quoting entsteht ein übersichtlicheres<br />
Konstrukt.<br />
Daher sollten Sie in Ihren Skripten der Variante $(...) gegenüber<br />
der in der Bash zwar noch funktionierenden, aber als obsolet<br />
geltenden Backtick-Methode den Vorzug einräumen. Es gibt<br />
eigentlich nur zwei Gründe, den Backtick noch zu nutzen: Die<br />
Macht der Gewohnheit (viele routinierte Skript-Autoren sind mit<br />
dem „Fliegenschiss“ aufgewachsen) <strong>und</strong> den Zwang zur Kompatibilität<br />
mit älteren Shells (Bourne- <strong>und</strong> Korn-Shell) insbesondere<br />
auf anderen Unix-Systemen.<br />
Das Skript durchläuft die Schleife,<br />
solange die Bedingung erfüllt<br />
ist, <strong>und</strong> endet, wenn der Test negativ<br />
ausfällt – in diesem Fall das<br />
Konstrukt getopts "f:bn:d: " OPT.<br />
Die Ausdrücke für die Bedingung<br />
stehen häufig in eckigen Klammern,<br />
wie bei den If-Anweisungen<br />
im vorangegangenen Beispiel<br />
zu sehen, aber die eigentlichen<br />
Befehle nicht. Technisch gesehen<br />
rufen eckige Klammern den Test-<br />
Befehl auf.<br />
Der Befehl Getopts geht jede<br />
Option der Reihe nach durch, zusammen<br />
mit den eventuellen Argumenten<br />
dazu. Die Optionsbuchstaben<br />
landen nacheinander<br />
im zweiten Argument von Getopts<br />
(im vorliegenden Fall OPT),<br />
die Argumente in OPTARG. Das erste<br />
Argument von Getopts ist ein<br />
String der erlaubten Buchstaben<br />
(Groß- <strong>und</strong> Kleinschreibung unterscheidend).<br />
Einige Optionen verlangen ein<br />
Argument. Das zeigt immer der<br />
danach stehende Doppelpunkt –<br />
im Beispiel sind es die drei Buchstaben<br />
f, n <strong>und</strong> d.<br />
Listing 3<br />
#!/bin/bash<br />
DEST="/save"<br />
PREFIX="backup"<br />
Innerhalb der While-Schleife<br />
sorgt eine Case-Anweisung für<br />
das fachgerechte Bearbeiten der<br />
Optionen. Die Anweisung vergleicht<br />
den Wert von OPT mit einer<br />
Liste von Mustern. Bei jedem<br />
Muster handelt es sich um eine<br />
Zeichenkette, die Platzhalter enthalten<br />
darf. Eine r<strong>und</strong>e schließende<br />
Klammer beendet das Muster.<br />
Die Reihenfolge ist wichtig: Das<br />
erste passende Muster gewinnt.<br />
Im Beispiel sind neben den<br />
Mustern für die erlaubten Optionsbuchstaben<br />
zusätzlich ein<br />
Doppelpunkt <strong>und</strong> ein Sternchen<br />
als Jokerzeichen für alles definiert,<br />
was die anderen Muster<br />
nicht abfangen. Die auszuführenden<br />
Befehle bei den einzelnen<br />
Optionen unterscheiden sich, jeder<br />
Abschnitt endet mit doppeltem<br />
Semikolon.<br />
Über ‐n geben Sie ein alternatives<br />
Präfix für den Dateinamen des<br />
Archivs an. Dabei überschreiben<br />
Sie die Voreinstellung aus dem<br />
zweiten Befehl des Skripts. Über<br />
‐b setzen Sie Bzip2 statt Gzip zum<br />
Komprimieren der Daten ein. Mit-<br />
# Ablageort <strong>und</strong> Namensanfang (Prefix) vorgeben<br />
while getopts "f:bn:d:" OPT; do # Überprüfen der Parametern<br />
case $OPT in<br />
# gültige passende Muster<br />
vorgeben<br />
f) DIRS=$OPTARG ;; # ‐f <br />
b) ZIP="j"; EXT="tbz" ;; # ‐b = bzip2 statt gzip verwenden<br />
n) PREFIX=$OPTARG ;; # ‐n <br />
d) if [ "${OPTARG:0:1}" = "/" ] # ‐d <br />
then<br />
DEST=$OPTARG<br />
else<br />
echo "Zielverzeichnis muss mit / beginnen."<br />
exit 1<br />
# Skript mit Fehler‐Status<br />
beenden<br />
fi<br />
;;<br />
:) echo "Sie müssen ein Argument für die Option ‐$OPTARG angeben."<br />
exit 1<br />
;;<br />
*) echo "Kein gültiges Argument: ‐$OPTARG."<br />
exit 1<br />
;;<br />
esac<br />
done<br />
22 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Der perfekte Auftritt<br />
macht unseren Erfolg:<br />
auf dem Laufsteg<br />
<strong>und</strong> im Web.<br />
Stefan Klos mit Model Janina<br />
www.famepr.de<br />
Erstellt mit dem PowerPlus-Paket<br />
Stefan Klos<br />
STRATO<br />
Hosting<br />
Für Anwender mit hohen Ansprüchen<br />
Hosting PowerPlus L<br />
statt<br />
*<br />
Ihre Website mit echten Profi-Features:<br />
8 Domains <strong>und</strong> 5.000 MB Speicher im Paket inklusive<br />
Unlimited Traffic <strong>und</strong> 10 MySQL-Datenbanken nutzbar<br />
Pro-Features: PHP, Perl, Python, Ruby 8, Web-FTP u. v. m.<br />
NEU! Inklusive neu entwickeltem STRATO Communicator<br />
6 Monate für<br />
Aktionsangebot nur<br />
bis zum 30.09.2011<br />
*<br />
€/Mon.<br />
Jetzt bestellen unter: s trato.de / hosting<br />
Servicetelefon: 0 18 05 - 055 055<br />
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)<br />
* 6 Monate 0 €/mtl., danach 14,90 €/mtl. Einrichtungsgebühr 14,90 €. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Preis inkl. MwSt.
schwerpunkt<br />
Bash-Skripting<br />
Listing 4<br />
Listing 5<br />
#!/bin/bash<br />
tels ‐f übergeben Sie den Dateinamen<br />
mit der Liste der zu archivierenden<br />
Elemente, mittels ‐d das<br />
Zielverzeichnis für die Archivdatei<br />
(in der Voreinstellung /save).<br />
Dabei überprüft das Skript, ob<br />
das Zielverzeichnis mit dem absoluten<br />
Pfadnamen beginnt. Das<br />
Konstrukt ${OPTARG:0:1} verdient<br />
besondere Aufmerksamkeit. Sie<br />
haben die Möglichkeit, die Variablen<br />
in geschweifte Klammern einzufassen:<br />
$1 können Sie als ${1}<br />
schreiben <strong>und</strong> $CAT als ${CAT}.<br />
Diese Syntax ist nützlich. Sie erlaubt<br />
es Ihnen, Parameter über<br />
die neunte Position hinaus anzugeben:<br />
${11} steht zum Beispiel<br />
für den elften Parameter des<br />
Skripts, wohingegen $11 zum ersten<br />
Argument des Skripts gefolgt<br />
von einer 1 expandiert. Diese<br />
if [ ‐z $DIRS ]; then # Datei mit Verzeichnisliste<br />
vorhanden?<br />
echo "Die Option ‐f für die Listendatei fehlt."<br />
exit 1<br />
elif [ ! ‐r $DIRS ]; then<br />
echo "Kann die Datei $DIRS nicht finden oder einlesen."<br />
exit 1<br />
fi<br />
DAT="$(/bin/date +%d%m%g)"<br />
/bin/tar ‐${ZIP‐z} ‐c ‐f /$DEST/${PREFIX}_$DAT.${EXT‐tgz}<br />
`cat $DIRS` > /dev/null<br />
if [ $# ‐lt 1 ]; then # kein Argument,<br />
Eingabeaufforderung einblenden<br />
read ‐p "Wen wollten Sie überprüfen? " WHO<br />
if [ ‐z $WHO ]; then # kein Name wurde eingetragen<br />
exit 0<br />
fi<br />
else<br />
WHO="$1"<br />
# speichert das<br />
Kommandozeilen‐Argument<br />
fi<br />
LOOK=$(w | grep "^$WHO")<br />
if [ $? ‐eq 0 ]; then # vorherigen Befehlsstatus<br />
überprüfen<br />
WHEN=$(echo $LOOK | awk '{print $4}')<br />
echo "$WHO ist angemeldet seit $WHEN."<br />
else<br />
echo "$WHO ist zurzeit nicht angemeldet."<br />
fi<br />
exit 0<br />
Syntax ermöglicht es ebenfalls,<br />
Variablen vom umgebenden Text<br />
zu isolieren: Wenn der Wert von<br />
HAUSTIER zum Beispiel katze ist,<br />
dann expandiert ${HAUSTIER}2 zu<br />
katze2, während $HAUSTIER2 sich<br />
auf den Wert der Variable HAUS‐<br />
TIER2 bezieht, der vielleicht nicht<br />
definiert ist.<br />
Die Zeichenkette :0:1 nach dem<br />
Variablennamen extrahiert einen<br />
Substring aus OPTARG, angefangen<br />
an der ersten Position (die Position<br />
der Schriftzeichen beginnt<br />
mit 0) <strong>und</strong> fortgesetzt bis zum<br />
ersten Schriftzeichen, mit anderen<br />
Worten: Es bleibt das erste<br />
Schriftzeichen übrig.<br />
Die If-Anweisung überprüft<br />
dann, ob es sich dabei um einen<br />
Schrägstrich handelt. Falls nicht,<br />
erscheint eine Fehlermeldung,<br />
<strong>und</strong> das Skript endet mit einem<br />
Status von 1, was auf einen Fehler<br />
hinweist. Ein Status von 0 steht<br />
für einen erfolgreichen Durchlauf.<br />
Wenn eine Option ein Argument<br />
verlangt, dieses aber fehlt,<br />
ersetzt Getopts die Variable OPT<br />
Listing 6<br />
#!/bin/bash<br />
/bin/cat /usr/local/sbin/email_<br />
list |<br />
while read WHO WHAT SUBJ; do<br />
/usr/bin/mail ‐s "$SUBJ" $WHO<br />
< $WHAT<br />
echo $WHO<br />
done<br />
Listing 7<br />
#!/bin/bash<br />
mit einem Doppelpunkt <strong>und</strong> fügt<br />
den entsprechenden String in<br />
OPTARGS ein. Der vorletzte Abschnitt<br />
der Case-Anweisung arbeitet<br />
diese Fehler auf. Der letzte<br />
Abschnitt behandelt alle ungültigen<br />
Optionen. Getopts ersetzt in<br />
diesem Fall die Variable durch ein<br />
Fragezeichen <strong>und</strong> legt die unbekannte<br />
Option in OPTARGS ab. Das<br />
Joker-Muster entdeckt <strong>und</strong> behandelt<br />
diese Ereignisse.<br />
Dieser Code zum Behandeln von<br />
Argumenten ist nicht h<strong>und</strong>ertprozentig<br />
sicher. Es gibt Kombinationen<br />
von Optionen, die das<br />
Skript erst später bemerkt. Fehlt<br />
zum Beispiel in der Folge ‐f ‐n<br />
das Argument von ‐f, hält das<br />
Skript fälschlicherweise ‐n dafür.<br />
Den Rest des Skripts von Listing<br />
3 sehen Sie in Listing 4.<br />
Die If-Anweisung überprüft<br />
zwei mögliche Probleme mit der<br />
Datei, welche die Verzeichnisliste<br />
enthält. Der erste Test überprüft,<br />
ob die Variable DIRS fehlt, das<br />
heißt, ob sie die Länge null hat.<br />
In diesem Fall endet das Skript<br />
mit einer Fehlermeldung.<br />
Der zweite Test nach elif überprüft,<br />
ob die angegebene Datei<br />
existiert <strong>und</strong> der Zugriff funktioniert.<br />
Wenn nicht (das Ausrufezeichen<br />
in dem Ausdruck dient<br />
als ein logisches NOT), gibt das<br />
Skript ebenfalls eine Fehlermeldung<br />
aus <strong>und</strong> beendet sich.<br />
Die letzten beiden Anweisungen<br />
richten den Datumsteil für das<br />
PATH=/bin:/usr/bin<br />
# setzt den Pfad<br />
. /usr/local/sbin/functions.bash # . f => Datei f hier einbinden<br />
printf "USER\tGB USED\n"<br />
# Kopfzeile für Bericht drucken<br />
for WHO in $(
Archiv ein <strong>und</strong> starten den Tar-Befehl.<br />
Letzterer verwendet eine Art bedingter<br />
Auflösung von Variablen,<br />
zum Beispiel ${EXT‐tgz}. Der Bindestrich<br />
hinter dem Variablennamen<br />
zeigt an, dass der darauf folgende<br />
String zum Einsatz kommt, falls die<br />
Variable nicht definiert ist.<br />
Die Variablen EXT <strong>und</strong> ZIP sind nur<br />
dann definiert, wenn Sie die Option<br />
‐b verwenden, nämlich durch die<br />
Werte tbz <strong>und</strong> j. Haben Sie diese<br />
nicht früher im Skript definiert, verwendet<br />
es nun die Werte z <strong>und</strong> tgz.<br />
Alles nur Nummern<br />
Die bisher gezeigten Beispiele haben<br />
beide Arten von Bedingungen demonstriert<br />
– den Vergleich von Zeichenfolgen<br />
<strong>und</strong> das Testen von Dateieigenschaften.<br />
Listing 5 zeigt nun ein<br />
Beispiel für numerische Bedingungen.<br />
Dieses Skript entstand, um der<br />
Sekretärin des Vorsitzenden eines<br />
Unternehmens zu helfen: Sie war damit<br />
jederzeit in der Lage, schnell<br />
nachzusehen, wer gerade im Intranet<br />
angemeldet ist.<br />
Dieses Skript überprüft zunächst,<br />
ob die Dame ein Argument in der Befehlszeile<br />
angegeben hatte. Falls<br />
nicht, also wenn die Anzahl von Argumenten<br />
kleiner als 1 ist, erscheint<br />
eine Eingabezeile zur Angabe des gewünschten<br />
Benutzers. Dabei kommt<br />
der eingebaute Befehl read zum Einsatz.<br />
Die Eingabe landet wiederum in<br />
der Variablen WHO.<br />
Hat die Variable WHO nach der Abfrage<br />
immer noch die Länge null, hat die<br />
Sekretärin keinen Benutzernamen<br />
eingetippt, sondern lediglich [Eingabe]<br />
gedrückt. In diesem Fall beendet<br />
sich das Skript. Im anderen Fall,<br />
wenn die Sekretärin ein Argument<br />
bereits in der Befehlszeile angegeben<br />
hat, erhält WHO dieses als Wert. So<br />
oder so: Der Benutzername der gesuchten<br />
Person landet letztendlich<br />
immer am gleichen Platz.<br />
Der zweite Teil des Skripts verwendet<br />
zwei Konstrukte mit Befehlssubstitution.<br />
Das erste sucht in der Ausgabe<br />
des Befehls w nach dem gewünschten<br />
Benutzernamen <strong>und</strong> speichert<br />
die entsprechende Zeile in LOOK.<br />
Die zweite definiert die Variable WHEN<br />
als das vierte Feld dieser Ausgabe<br />
(Zeitpunkt der letzten Anmeldung).<br />
Dieses Feld extrahieren Sie mittels<br />
Awk. Sie brauchen das Tool nicht in<strong>und</strong><br />
auswendig zu kennen, um diesen<br />
einfachen Trick anzuwenden. Dabei<br />
kommt der Befehl nur zum Einsatz,<br />
wenn der Wert der Variable $?<br />
gleich 0 ist. Sie enthält den Statuscode<br />
des letzten Befehls, in diesem<br />
Fall also jenen von Grep. Liegt ein Ergebnis<br />
vor, hat sie den Wert 0, sonst<br />
den Wert 1.<br />
Zum Abschluss zeigt das Skript eine<br />
entsprechende Meldung mit dem Status<br />
des Benutzers:<br />
kyrre ist angemeldet seit 08:47.<br />
Fragt der Chef jetzt nach kyrre, kann<br />
die Sekretärin beruhigt die Auskunft<br />
geben, der sei derzeit an seinem<br />
Rechner beschäftigt.<br />
Schleifen binden<br />
Das Skript aus Listing 6 demonstriert<br />
eine weitere Verwendung von while<br />
<strong>und</strong> read: das Verarbeiten aufeinander<br />
folgender Zeilen einer Ausgabe oder<br />
einer Datei. Der Zweck des Skripts<br />
liegt im Versenden von Mails an Benutzer<br />
in einer Liste als separate E-<br />
Mails.<br />
Das Skript sendet über eine Pipe (|)<br />
den Inhalt der entsprechenden Datei<br />
an die While-Schleife. Diese liest mittels<br />
read die Zeilen <strong>und</strong> speichert deren<br />
Inhalt in drei Variablen. Das erste<br />
Wort einer Zeile landet in WHO, das<br />
zweite in WHAT <strong>und</strong> alle weiteren in<br />
SUBJ. Diese enthalten anschließend<br />
die Mailadresse, den Inhalt der Nachricht<br />
in einer Datei sowie den Betreff<br />
für jede Person. Die Variablen kommen<br />
beim Erstellen des nachfolgenden<br />
Mail-Befehls zum Einsatz.<br />
Beachten Sie, dass dieses Skript den<br />
vollständigen Pfadnamen für externe<br />
Befehle verwendet. Am besten geben<br />
Sie immer den vollständigen Pfadnamen<br />
an oder fügen eine PATH-Definition<br />
am Anfang des Skripts hinzu, um<br />
eventuelle Probleme mit den Berechtigungen<br />
von ausführbaren Dateien<br />
bei der Substitution zu vermeiden.<br />
Was die Sicherheit betrifft, geht dieses<br />
Skript viel zu lässig mit dem In-<br />
STRATO<br />
Hosting<br />
Für Anwender mit<br />
hohen Ansprüchen<br />
www.famepr.de<br />
Erstellt mit dem PowerPlus-Paket<br />
Hosting<br />
PowerPlus L<br />
6 Monate<br />
für<br />
*<br />
€/Mon.<br />
Aktionsangebot nur<br />
bis zum 30.09.2011<br />
Jetzt bestellen unter:<br />
strato.de<br />
Servicetelefon: 0 18 05 - 055 055<br />
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)<br />
* 6 Monate 0 €/mtl., danach 14,90 €/mtl. Einrichtungsgebühr 14,90 €.<br />
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Preis inkl. MwSt.
schwerpunkt<br />
Bash-Skripting<br />
Listing 8<br />
to_gb()<br />
{<br />
# arguments: user usage‐in‐KB<br />
halt der Datei email_list um <strong>und</strong><br />
vertraut darauf, dass diese ordnungsgemäß<br />
formatierte Mail-Adressen<br />
enthält. Möchten Sie das<br />
Skript aber weitergeben, gilt es,<br />
die Adressen sorgfältig zu überprüfen.<br />
So besteht etwa die Möglichkeit,<br />
dass ein Nutzer ein Benutzer<br />
eine Eingabe in der Form<br />
user@example.com; /irgendwo/run_me<br />
in der Adressenliste versteckt.<br />
Das führt dazu, dass das Programm<br />
run_me unerlaubt startet.<br />
Schleifen<br />
Die nächsten beiden Skripte veranschaulichen<br />
andere Arten von<br />
Schleifen, die Sie in Shell-Skripten<br />
über den for-Befehl anwenden<br />
können. Listing 7 auf der vorigen<br />
Seite erstellt einen Bericht<br />
über den belegten Speicherplatz<br />
mitsamt einer kompletten Liste<br />
von Verzeichnissen für eine Reihe<br />
von Anwendern.<br />
Die Dateien mit der Liste der<br />
Benutzer <strong>und</strong> der zu prüfenden<br />
Verzeichnisse finden sich hier explizit<br />
im Skript, aber Sie können<br />
auch Optionen dafür setzen. Das<br />
Skript beginnt mit der Angabe<br />
des Pfades <strong>und</strong> der Einbeziehung<br />
einer anderen Datei in das Skript<br />
mithilfe des Include-Datei-Mechanismus,<br />
dem sogenannten<br />
Punktbefehl (aufgerufen mit einem<br />
Punkt).<br />
Eine For-Schleife bildet das zentrale<br />
Konstrukt dieses Skripts. Innerhalb<br />
der Schleife erhält eine<br />
Variable bei jedem Durchgang einen<br />
neuen Wert. Das Schlüsselwort<br />
in verweist auf die Liste von<br />
local MB D1 D2 USER<br />
# lokale Variablen<br />
USER=$1<br />
MB=$(( $2/1024 ))<br />
# konvertieren in MByte<br />
D1=$(( $MB/1000 ))<br />
# Ausgabe ganzzahlig in GByte<br />
D2=$(( $MB‐($D1*1000) )) # Rest berechnen<br />
# display abcd MB as: a.bcd GB<br />
printf "%s\t%s\n" $USER $D1.${D2:0:1}<br />
return<br />
}<br />
Werten <strong>und</strong> der separate Befehl<br />
do leitet die eigentlichen Operationen<br />
ein. Die Schleife endet mit<br />
done, sobald sie alle Elemente der<br />
Liste abgearbeitet hat.<br />
Im Beispiel erhält die Variable<br />
WHO immer das nächste Element<br />
aus der Datei ckusers. Das Konstrukt<br />
$(1 ; I‐‐ )); do<br />
F=$(( $F*$I ))<br />
done<br />
echo $1'! = '$F<br />
exit 0<br />
Eine Funktion namens to_gb (Listing<br />
8) erledigt das Ausdrucken<br />
jeder Berichtszeile.<br />
Die Bash setzt voraus, dass Sie<br />
Funktionen vor dem Einsatz definieren.<br />
Es bietet sich dazu an,<br />
Funktionen in einer externen Datei<br />
zu speichern <strong>und</strong> über den<br />
Punktbefehl in Skripte einzubinden.<br />
Im Beispiel aus Listing 7<br />
liegt die Funktion in der Datei<br />
functions.bash.<br />
Die Funktion to_gb() beginnt<br />
mit der Definition einiger lokaler<br />
Variablen. Damit ignoriert sie jegliche<br />
Bedeutung, welche diese Variablennamen<br />
im aufrufenden<br />
Skript eventuell haben könnten,<br />
<strong>und</strong> die lokalen Werte gelangen<br />
nicht in den übergeordneten Kontext<br />
zurück.<br />
Der größte Teil der Funktion besteht<br />
aus arithmetischen Operationen.<br />
Die Bash unterstützt ausschließlich<br />
Ganzzahl-Arithmetik.<br />
Möchten Sie eine einigermaßen<br />
genaue Gesamtgröße in GByte<br />
anzeigen, müssen Sie zu diesem<br />
Zweck einen gängigen Trick nutzen:<br />
Sie entnehmen zuerst die<br />
Ganzzahlen, dann den Rest des<br />
GByte-Wertes, <strong>und</strong> setzen die<br />
Ausgabe per Hand zusammen.<br />
Haben Sie zum Beispiel als Wert<br />
2987 MByte <strong>und</strong> dividieren dies<br />
durch 1024, wäre das ger<strong>und</strong>ete<br />
Ergebnis 2 GByte. Um ein genaueres<br />
Ergebnis anzuzeigen, dividieren<br />
Sie stattdessen zuerst 2987<br />
durch 1000 (D1=2), dann berechnen<br />
Sie 2987‐(2*1000). Der Wert<br />
für D2 beträgt folglich 987.<br />
Anschließend geben Sie die Variable<br />
D1 aus, dann ein Komma<br />
<strong>und</strong> dann die erste Ziffer von D2:<br />
Das Ergebnis lautet nun 2.9. So<br />
sähe eine beispielhafte Ausgabe<br />
des Skripts aus:<br />
BENUTZER<br />
BELEGT in GB<br />
andrea 80.5<br />
karsten 14.3<br />
monika 0.3<br />
Der Befehl printf ermöglicht eine<br />
formatierte Ausgabe. Er erfordert<br />
einen Format-String, gefolgt von<br />
26 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Bash-Skripting<br />
schwerpunkt<br />
Argumente <strong>und</strong> Variablen<br />
$1 $2 ? $9 Befehlsargumente<br />
${nn}<br />
$@<br />
allgemeines Format für Argument nn<br />
alle Befehlsargumente: Liste von separaten Elementen<br />
$* alle Befehlsargumente: ein einzelnes Element<br />
$# Anzahl der Befehlsargumente<br />
$0 Skript-Name<br />
$var<br />
${var}<br />
${var:p:n}<br />
${var‐val2}<br />
${var+val2}<br />
${var=val2}<br />
${var?errmsg}<br />
arr=( var1, var2 )<br />
${arr[n]}<br />
${#arr[@]}<br />
getopts opts var<br />
Wert der Variable var<br />
allgemeines Format<br />
Allgemeine Anweisungskonstrukte<br />
`cmd`<br />
$(cmd)<br />
Substring von n Zeichen von var, beginnend bei p<br />
val2 zurückgeben, falls var nicht definiert ist<br />
val2 zurückgeben, falls var definiert ist<br />
val2 zurückgeben, falls var <strong>und</strong>efiniert ist, <strong>und</strong> bestimme var=val2<br />
var: errmsg einblenden, falls var <strong>und</strong>efiniert ist<br />
definiert arr als ein Array<br />
Element n von Array arr<br />
Anzahl der definierten Elemente in arr<br />
Prozessoptionen, Optionsbuchstabe in var zurückgeben (oder ?, wenn ungültig, oder :, wenn das erforderliche Argument fehlt).<br />
Der Parameter opts listet erlaubte Buchstaben auf, optional gefolgt von einem Doppelpunkt, der ein Argument verlangt (Doppelpunkt<br />
am Anfang: invalide Optionen ignorieren). Gibt das Argument der Option in fest definierten Variable OPTARG zurück.<br />
Ausgabe von cmd erneut auswerten (obsolete Schreibweise)<br />
Ausgabe von cmd erneut auswerten (kanonische Schreibweise)<br />
$? Exit-Status des letzten Kommandos<br />
$! PID (Prozess-ID) des zuletzt ausgeführten Hintergr<strong>und</strong>befehls<br />
eval string<br />
Substitutionsoperation am String vornehmen <strong>und</strong> dann ausführen<br />
. file Datei-Inhalt im Skript einfügen<br />
exit n<br />
Testmethoden<br />
Skript mit dem Status n beenden (0 bedeutet Erfolg)<br />
‐x Datei überprüft, ob die Datei die durch den Code ‐x angegebene Bedingung erfüllt. Einige nützliche Operationen sind: ‐s Datei größer<br />
als 0 Byte; ‐r lesbar; ‐w schreibbar; ‐e existiert; ‐d ist ein Verzeichnis; ‐f ist eine einfache Datei.<br />
Datei1 ‐nt Datei2<br />
Abfrage, ob Datei1 neuer ist als Datei2<br />
‐z Wort Länge von Wort gleich 0<br />
‐n Wort Länge von Wort größer als 0<br />
Wort1 = Wort2 Test auf identische Zeichenfolgen. Andere Operationen: !=, >,
schwerpunkt<br />
Bash-Skripting<br />
Variablen, um den Ausdruck zu<br />
befüllen. Kennbuchstaben hinter<br />
Prozentzeichen geben an, wo die<br />
Variablen-Inhalte landen. Im Beispiel<br />
bestimmt %s die Stellen, an<br />
denen die Funktion die Werte<br />
einfügt. Hier gibt der Buchstabe s<br />
an, dass es sich um eine Zeichenkette<br />
handelt.<br />
Die Zeichen \t <strong>und</strong> \n im Format-String<br />
entsprechen den Steuerzeichen<br />
Tabulator <strong>und</strong> Zeilenumbruch.<br />
Wollen Sie die Zeile explizit<br />
beenden, müssen Sie Letzteres<br />
angeben.<br />
Das nächste Skript (siehe Listing<br />
9, vorige Seite) berechnet Fakultäten<br />
<strong>und</strong> veranschaulicht dabei<br />
eine andere Art von For-<br />
Schleife. Sie ähnelt dem, was in<br />
vielen „echten“ Programmiersprachen<br />
üblich ist, wie zum Beispiel<br />
in C/C++.<br />
Die For-Syntax nutzt eine<br />
Schleifenvariable (I) zusammen<br />
mit einem Startwert ($1, also dem<br />
ersten Parameter, den Sie an das<br />
Skript übergeben), eine Bedingung<br />
zum Fortsetzen der Schleife<br />
sowie einen Ausdruck, der angibt,<br />
wie sich die Variable nach jedem<br />
Schleifendurchlauf ändert.<br />
Die Schleife selbst verarbeitet<br />
die Variable I. Am Ende jeder Iteration<br />
verringert das Skript den<br />
Wert von I um 1 (I++ würde anders<br />
herum I um den Wert 1 erhöhen).<br />
Die Schleife läuft durch,<br />
solange der Wert von I größer<br />
als 1 ist. Der Rumpf der Schleife<br />
multipliziert F (am Anfang auf 1<br />
Listing 10<br />
#!/bin/bash<br />
gesetzt) mit jedem nachfolgenden<br />
I. Das Skript endet mit der Ausgabe<br />
des Ergebnisses:<br />
$ ./fact 6<br />
6! = 720<br />
Wie man hier sieht, lässt sich<br />
auch in der Shell recht zügig Mathematik<br />
betreiben. Probieren Sie<br />
zum Beweis einmal ./fact 10000.<br />
Menüs erzeugen<br />
Das letzte Beispielskript demonstriert<br />
die eingebaute Fähigkeit<br />
der Bash zum Generieren von<br />
Menüs über den Select-Befehl<br />
(Listing 10).<br />
Die Parameter für den Select-<br />
Befehl setzen Sie in den beiden<br />
Variablen PKGS <strong>und</strong> MENU. Das<br />
Kons trukt benötigt eine Liste von<br />
Elementen als zweites Argument;<br />
dazu dient MENU. Über ein Konstrukt<br />
von Befehlssubstitutionen<br />
gelangen die Werte in den Platzhalter.<br />
Zusätzlich fügt das Skript<br />
am Ende der Liste die Zeichenkette<br />
Fertig hinzu.<br />
Die Definition von PKGS führt<br />
ein neues Feature ein: Arrays. Bei<br />
einem Array handelt es sich um<br />
eine Datenstruktur mit mehreren<br />
Elementen, die Sie über einen Index<br />
referenzieren. Folgendes Beispiel<br />
erzeugt <strong>und</strong> verwendet ein<br />
einfaches Array:<br />
$ a=(1 2 3 4 5)<br />
$ echo ${a[2]}<br />
3<br />
PATH=/bin:/usr/bin<br />
PFILE=/usr/local/sbin/userpkgs # Format der Eingabe: pkgname menu_<br />
item<br />
PKGS=( $(cat $PFILE | awk '{print $1}') )<br />
# Array von Paketnamen<br />
MENU="$(cat $PFILE | awk '{print $2}') Fertig" # Liste der Menüpunkte<br />
select WHAT in $MENU; do<br />
if [ $WHAT = "Fertig" ]; then exit; fi<br />
I=$(( $REPLY‐1 ))<br />
PICKED=${PKGS[$I]}<br />
echo Installiere Paket $PICKED ... Bitte haben Sie Geduld!<br />
... Befehle, um das Paket zu installieren ...<br />
done<br />
Zur Definition eines Arrays schließen<br />
Sie dessen Elemente in Klammern<br />
ein. Um auf eines davon zuzugreifen,<br />
verwenden Sie die Syntax<br />
aus der zweiten Zeile: Der<br />
Name des Elements steht in geschweiften,<br />
der Positionsparameter<br />
in eckigen Klammern. Das<br />
Nummerieren der Elemente beginnt<br />
bei 0. Die Anzahl der Elemente<br />
in einem Array erhalten Sie<br />
über den Ausdruck ${#a[@]}.<br />
Im Skript kommt ein Array in<br />
Form der Variable PKGS zum Einsatz.<br />
Dort finden sich die Werte<br />
aus dem zweiten Feld jeder Zeile<br />
der Eingabedatei. Das Select-Konstrukt<br />
verwendet den Inhalt von<br />
MENU für die Liste. Select erstellt<br />
aus den Elementen ein nummeriertes<br />
Menü <strong>und</strong> fordert den Benutzer<br />
zur Eingabe einer Auswahl<br />
auf. Das gewählte Element landet<br />
in der vor dem Schlüsselwort in<br />
angegebenen Variable (hier WHAT),<br />
die Nummer des Elements in<br />
REPLY. Das Skript reduziert den<br />
Wert von REPLY um 1 für das Abrufen<br />
des entsprechenden Paketnamens<br />
aus dem Array PKGS, der<br />
in der Variable PICKED landet.<br />
Die Differenz von 1 kommt zustande,<br />
weil die Nummerierung<br />
im Menü mit 1, bei den Elementen<br />
eines Arrays aber bei 0 anfängt.<br />
Wählt der Benutzer das<br />
Element Fertig, terminiert das<br />
Skript. Listing 11 zeigt ein Beispiel<br />
für einen Durchlauf.<br />
Fazit<br />
Eine Zusammenfassung gängiger<br />
Skript-Befehle finden Sie in der<br />
Tabelle Schnellübersicht auf der<br />
Vorseite. Sie beendet diesen Ausflug<br />
in die Welt der Bash <strong>und</strong><br />
macht hoffentlich Lust auf weitere<br />
Entdeckungen. (agr) n<br />
Listing 11<br />
1) CD/MP3_Player 3) Photo_Album<br />
2) Spider_Solitaire 4) Fertig<br />
#? 2<br />
Installiere Paket spider ...<br />
Bitte haben Sie Geduld!<br />
[...]<br />
#? 4<br />
28 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Richtig schreibt<br />
man mit Duden<br />
Ebenfalls erhältlich für Linux:<br />
Die neue Rechtschreibprüfung<br />
8.0 für Open-<br />
Office <strong>und</strong> LibreOffice<br />
Preis 19,95 J<br />
Das große Wörterbuch<br />
der deutschen Sprache<br />
199,95 J<br />
Richtiges <strong>und</strong><br />
gutes Deutsch<br />
19,95 J<br />
Ab sofort im Handel <strong>und</strong> im Internet unter www.duden.de
«Seitdem ich Microsoft ® Exchange benutze, hindert mich nichts mehr daran,<br />
effizient zu sein, wenn ich unterwegs bin. Ich synchronisiere meine Aufgaben<br />
<strong>und</strong> meine Kalender <strong>und</strong> teile sie mit meinen Mitarbeitern.»<br />
1 bis 1000 E-Mail-Accounts pro Domain<br />
25 GB Speicherplatz pro Account<br />
Gemeinsam genutzte Kalender <strong>und</strong> Aufgaben<br />
Anti-Virus, Anti-Spam<br />
Webmail (OWA), Outlook ®<br />
(MAPI)<br />
Mobile Synchronisation (ActiveSync)
Die professionelle<br />
Groupwarelösung<br />
Hosted 2010<br />
Ihre E-Mail-Accounts mit 25 GB Speicherplatz<br />
TM<br />
3, 96 €<br />
inkl. MwSt. / Monat / Account<br />
Mehr Informationen: www.ovh.de/mail oder 0049 (0) 681 906730<br />
Ortsnetznummer<br />
Europas Webhoster Nr. 1<br />
Quelle NetCraft – Juni 2011<br />
Domains | E-Mails | Hosting | VPS | Server | Private Cloud | Cloud | SMS | Telefonie<br />
OVH.DE
schwerpunkt<br />
Vi(m)-Basics<br />
Einführung in Vi(m)<br />
Vielseitig<br />
© John Nyberg, sxc.hu<br />
Der Texteditor Vim<br />
ist derart populär,<br />
dass auch viele andere<br />
Programme<br />
das gleiche Bedienkonzept<br />
nutzen.<br />
Frank Hofmann,<br />
Thomas Winde<br />
reADMe<br />
Wer Vim als Texteditor<br />
einsetzt, dem eröffnen<br />
sich viele Möglichkeiten<br />
effektiven Arbeitens –<br />
auch in anderen Programmen,<br />
die die gleichen<br />
Tastenkombinationen<br />
verwenden.<br />
Bei den aktuellen Linux-Distributionen<br />
heißt der Standard-Editor<br />
zumeist Vim [1]. Mit ihm erstellen<br />
<strong>und</strong> bearbeiten Sie nicht<br />
nur Textdateien jeglicher Art,<br />
sondern beispielsweise auch Programmcode,<br />
LaTeX-Dokumente,<br />
Stilvorlagen für Webseiten im<br />
CSS-Format <strong>und</strong> die Konfigurationsdateien<br />
des Betriebssystems<br />
<strong>und</strong> seiner Dienste.<br />
Die Vielseitigkeit von Vi <strong>und</strong><br />
Vim erschließt sich nicht auf den<br />
ersten Blick. Der große Vorteil:<br />
Das Bedienkonzept ist seit Jahrzehnten<br />
über die Systemgrenzen<br />
hinweg weitestgehend unverändert<br />
geblieben. Wer sich damit intensiv<br />
auseinandersetzt, dem<br />
steht nicht nur ein sehr mächtiges<br />
Werkzeug zu Diensten, sondern<br />
der verfügt auch über das<br />
Know-how für die Bedienung einer<br />
ganzen Reihe von weiteren<br />
Unix-Programmen.<br />
Es lohnt sich daher für jeden Benutzer,<br />
mit den gr<strong>und</strong>legenden<br />
Konzepten <strong>und</strong> Tastenkombinationen<br />
dieses Texteditors vertraut<br />
zu sein. In den Zertifizierungen<br />
des Linux Professional Institutes<br />
(LPI,[2]) bilden die beiden Texteditoren<br />
Vim <strong>und</strong> Emacs essenzielle<br />
Bestandteile.<br />
Rückblick<br />
Ein Blick in die Geschichte der<br />
Betriebssysteme zeigt, dass Unix-<br />
Systeme nunmehr seit Jahrzehnten<br />
Vi(m) als den Standard-Texteditor<br />
enthalten. Auf einem Unixartigen<br />
System finden Sie entweder<br />
das Original Vi oder einen<br />
entsprechenden Nachfolger.<br />
Der Ursprung der gesamten Vi-<br />
Familie liegt in den Siebzigerjahren<br />
des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
1976 erweiterte Bill Joy den zeilenorientierten<br />
Editor Ex um einen<br />
visual mode, der schnell an<br />
A Mehr Komfort in der grafischen Oberfläche: Texte editieren in Gvim.<br />
32 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Vi(m)-Basics<br />
schwerpunkt<br />
Populärität gewann. Von<br />
nun an war ein Navigieren<br />
mittels eines Cursors<br />
im Text möglich, anstatt<br />
einzelne Zeilen erst anzufordern,<br />
um sie dann ändern<br />
zu können. Bald<br />
startete das Programm<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich im Visual<br />
Mode <strong>und</strong> erhielt in der Folge den<br />
Namen Vi als Ableitung von der<br />
kürzesten, unzweideutigen Abkürzung<br />
für das Kommando<br />
visual im Editor Ex.<br />
Daraus entwickelten sich eine<br />
ganze Reihe von Erweiterungen<br />
<strong>und</strong> Portierungen auf andere<br />
Plattformen [3]. Zu den bekanntesten<br />
Varianten gehören Vim<br />
(„Vi Improved“) <strong>und</strong> Gvim. Beide<br />
Programme unterstützen das<br />
charakteristische Bedienkonzept<br />
über Modi <strong>und</strong> Tastenkombinationen.<br />
Vim bietet einen gegenüber<br />
Vi deutlich erweiterten Funktionsumfang.<br />
Gvim bereichert<br />
Vim um eine graphische Benutzeroberfläche<br />
auf der Basis des<br />
Gimp Toolkits (Gtk).<br />
Bei Vim handelt es sich um die<br />
weitaus populärste erweiterte<br />
Version von Vi, die aber nicht auf<br />
dessen Programmcode basiert.<br />
Der Autor Bram Moolenaar entwickelte<br />
seit 1991 einen Vi-ähnlichen<br />
Editor auf seinem Amiga,<br />
daher stand Vim zunächst auch<br />
für „Vi IMitation“. Schrittweise<br />
kamen weitere Funktionen hinzu<br />
(siehe Kasten Vim: Erweiterungen).<br />
1992 war dann bis auf eine<br />
kleine Menge der komplette Umfang<br />
von Vi erreicht – <strong>und</strong> aus der<br />
„Imitation“ entstand der verbesserte<br />
Vi alias Vim.<br />
Die <strong>GUI</strong>-Variante Gvim (Abbildung<br />
A) erlaubt es, das Programm<br />
etwas komfortabler über<br />
Menüs, Schalter <strong>und</strong> Scroll-Leisten<br />
zu bedienen. Es eignet sich<br />
sehr gut für Einsteiger, weil es<br />
sich nicht nur in der klassischen<br />
Weise per Tastatur, sondern zusätzlich<br />
auch mithilfe der Maus<br />
bedienen lässt. Zudem zeigen die<br />
meisten Menüeinträge die passenden<br />
Tastenkürzel an. Das<br />
hilft, diese zu erlernen <strong>und</strong> später<br />
im Terminal zu verwenden.<br />
ViM-klone<br />
Während Sie Vim unter Windows erst<br />
nachrüsten müssen, bringen unixoide<br />
Systeme das Programm gleich mit,<br />
wenn auch zum Teil in anderen Varianten.<br />
Auf einem BSD 4.4 (FreeBSD <strong>und</strong><br />
NetBSD) steht der Nvi [7] bereit. Dabei<br />
handelt es sich um eine fehlerbereinigte<br />
Neuimplementation des Editors,<br />
die sich an die Originalversion<br />
des Vi anlehnt. Slackware [8], Kate<br />
OS [9] <strong>und</strong> Minix [10] kommen mit Elvis<br />
[11] als Standard-Editor.<br />
Mac OS X „Snow Leopard“ installiert<br />
einen Vim 7.2, der dem Unix-Vim ähnelt.<br />
Für erweiterte Features steht<br />
Macvim [12] bereit: Er basiert auf der<br />
Vim-Version 7.3. Neben dem Darstellen<br />
der geöffneten Dateien in Reitern<br />
bietet er Mac-OS-typische Tastenkürzel,<br />
einen transparenten Fensterhintergr<strong>und</strong>,<br />
einen Vollbildmodus <strong>und</strong> die<br />
Möglichkeit, Multibyte-Sequenzen zu<br />
bearbeiten. Auch für ältere Mac-Versionen<br />
stehen Binär-Pakete bereit [13].<br />
Diese basieren auf der Vim-Version 6<br />
<strong>und</strong> erhalten keine Updates mehr.<br />
Schlägt Ihr Herz sowohl für Emacs als<br />
auch für Vim, sollten Sie den Texteditor<br />
Vile [14] ausprobieren. Vile steht<br />
für „VI Like Emacs“ <strong>und</strong> versucht, das<br />
Beste aus beiden Welten in einem<br />
Programm zu vereinen. Das Paket für<br />
das Terminal heißt Vile, das für X11<br />
Xvile (Abbildung D, nächste Seite).<br />
Unter der Haube<br />
Bei vielen aktuellen Linux-Systemen<br />
verweist lediglich ein symbolischer<br />
Link /usr/bin/vi auf ein bestimmtes<br />
Programm, das dann<br />
tatsächlich ausgeführt wird. In<br />
Debian-basierten Distributionen<br />
führt der Aufruf von vi zunächst<br />
zu einem gleichnamigen Symlink,<br />
der auf die Datei /etc/alternatives/vi<br />
zeigt. Diese verweist ihrerseits<br />
wiederum auf die Datei /usr/<br />
bin/vim.gtk. Wie das Kommando<br />
file verrät, handelt es sich dabei<br />
um das Programm, welches das<br />
System letztendlich ausführt (Abbildung<br />
B).<br />
Für Gvim sieht das Ganze recht<br />
ähnlich aus: Der symbolische<br />
Link nach /etc/alternatives/gvim<br />
zeigt ebenfalls auf /usr/bin/vim.<br />
gtk. Der Name legt bereits nahe,<br />
dass das Programm gegen die<br />
Bibliotheken des Gimp Toolkit<br />
(Gtk) gelinkt ist. Eine detailliertere<br />
Auskunft darüber, welche Module<br />
<strong>und</strong> Bibliotheken es integriert,<br />
gibt das Kommando vim<br />
‐‐version in einem Terminal (Abbildung<br />
C, nächste Seite).<br />
Vim gibt es für fast alle Betriebssysteme,<br />
insbesondere für<br />
alle Varianten von Linux, Unix,<br />
Mac OS <strong>und</strong> Windows (siehe Kasten<br />
Vim-Klone). Erlerntes Wissen<br />
nützt also auch auf diesen Systemen.<br />
Über Vim gibt es bereits<br />
eine ganze Reihe exzellenter Bücher<br />
<strong>und</strong> Beschreibungen, bei-<br />
B Um drei Ecken: Wie<br />
die Shell den Vim-Aufruf<br />
interpretiert.<br />
Die Autoren<br />
Frank Hofmann hat Informatik<br />
an der Technischen<br />
Universität<br />
Chemnitz studiert.<br />
Derzeit arbeitet er in<br />
Berlin im Büro 2.0,<br />
einem Open-Source<br />
Experten-Netzwerk,<br />
als Dienstleister mit<br />
Spezialisierung auf<br />
Druck <strong>und</strong> Satz. Seit<br />
2008 koordiniert er<br />
das Regionaltreffen<br />
der Linux User<br />
Groups aus der Region<br />
Berlin-Brandenburg.<br />
Thomas Winde ist<br />
selbstständiger Ausflugsfahrtenunternehmer<br />
<strong>und</strong> langjähriger<br />
Linuxanwender. Als<br />
Mitorganisator der<br />
Chemnitzer Linux-Tage<br />
zeichnet er für das<br />
Einsteigerforum verantwortlich.<br />
Auch auf<br />
verschiedenen anderen<br />
Linux-Veranstaltungen<br />
hält er Vorträge<br />
für Einsteiger.<br />
ViM-erweiterungen<br />
Gegenüber dem Ur-Vi von Bill Joy weist der Vi Improved eine<br />
ganze Reihe von Erweiterungen <strong>und</strong> Verbesserungen auf:<br />
• unbegrenztes Undo/ Redo ([U] <strong>und</strong> [Strg]+[R])<br />
• mehrere Fenster über- <strong>und</strong> nebeneinander<br />
• Fenstergruppen in Reitern<br />
• Syntax-Highlighting für mehr als 500 strukturierte Formate,<br />
darunter über 42 (Programmier-)Sprachen<br />
• Vervollständigen von Namen, Wörtern oder Variablen im<br />
Quellcode<br />
• Vergleichen <strong>und</strong> Kombinieren von Dateien<br />
• erweiterte reguläre Ausdrücke<br />
• Ein- <strong>und</strong> Ausklappen von Textblöcken („Folding“)<br />
• Öffnen von komprimierten Dateien<br />
• eingebauter Textumbruch<br />
• integrierte Hilfefunktion<br />
• Historie für Suche <strong>und</strong> Cursor-Positionen<br />
• Session-Datei mit Pufferlisten <strong>und</strong> Registerinhalten<br />
• Arbeiten mit Makros (Aufnehmen <strong>und</strong> Abspielen von Tastensequenzen)<br />
• Maus-Interaktion<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 33
schwerpunkt<br />
Vi(m)-Basics<br />
C Vim zeigt die Module,<br />
die es bereits<br />
mitbringt.<br />
DAnksAgung<br />
Lieben Dank für die<br />
Kommentare <strong>und</strong> Ergänzungen<br />
beim Zusammenstellen<br />
dieses Artikels gehen<br />
an Axel Beckert, Thomas<br />
Osterried,<br />
Werner Heuser, Sven<br />
Guckes, Julius Plenz<br />
<strong>und</strong> Wolfram Eifler.<br />
spielsweise Steve Ouallines „Vi<br />
IMproved – Vim“ [4] (englisch)<br />
<strong>und</strong> Reinhard Wobsts „Vim gepackt“<br />
[5]. Recht hilfreich ist auch<br />
das „Vi/ Vim Graphical Cheat<br />
Sheet“ [6], das eine farbig gestaltete<br />
Übersicht der einzelnen Tastenbelegungen<br />
im jeweiligen Modus<br />
bereithält.<br />
Bedienkonzept<br />
Vi war für den Einsatz am Textterminal<br />
konzipiert <strong>und</strong> weist daher<br />
absichtlich eine spartanische<br />
Benutzerschnittstelle auf. Gr<strong>und</strong>legend<br />
für das Verständnis des<br />
konzepte in ViM<br />
Konzept<br />
Kommandokombination<br />
Nummernpräfix vor<br />
Kommandos<br />
Filtern<br />
Suchen <strong>und</strong> Ersetzen<br />
mehrere Zwischenablagen<br />
(ein allgemeiner<br />
plus 35 weitere benannte<br />
Puffer)<br />
Editors ist das Konzept der mehreren<br />
Modi – Navigation <strong>und</strong><br />
blockweises Ändern im Kommandomodus,<br />
Schreiben <strong>und</strong> Korrigieren<br />
einzelner Zeichen im Einfügemodus,<br />
Überschreiben im Ersetzungsmodus,<br />
Markieren im visuellen<br />
Modus <strong>und</strong> komplexe<br />
Kommandos im Kommandozeilenmodus.<br />
Diese Modi erlauben<br />
das Wiederverwenden der Tasten<br />
in unterschiedlichen Kontexten.<br />
Verschiedene weitere Konzepte,<br />
wie man sie zum Teil auch aus<br />
grafischen Programmen kennt,<br />
vereinfachen die Textbearbeitung<br />
Beschreibung, Beispiele<br />
[D],[W] (lösche bis zum Wortende), [D],[$] (lösche bis<br />
zum Zeilenende), [D],[^] (lösche bis zum Zeilenanfang),<br />
[D],[1],[Umschalt+][G] (lösche vom Anfang des Dokuments<br />
bis zur aktuellen Cursor-Position)<br />
[5],[D],[D] (lösche drei Zeilen)<br />
:%!sort (sortiere den Text über das externe Unix-<br />
Kommando sort)<br />
:%s/foo/bar/g (ersetze foo durch bar im gesamten<br />
Text)<br />
[Y],[Y] (kopiert aktuelle Zeile in den allgemeinen Puffer),<br />
[Umschalt]+[2],[A],[Y],[Y] (kopiert aktuelle Zeile in<br />
den benannten Puffer „a“), [Umschalt]+[2],[A],[P] (fügt<br />
Inhalt des benannten Puffers „a“ hinter aktueller Cursorposition<br />
ein)<br />
weiter. Diese Konzepte basieren<br />
auf Zeichenfolgen <strong>und</strong> Tastenkombinationen,<br />
mit denen Sie die<br />
einzelnen Aktionen auslösen <strong>und</strong><br />
steuern (siehe Tabelle Konzepte<br />
in Vim).<br />
Nach dem Start befinden Sie<br />
sich im Kommandomodus, in dem<br />
Sie den Text über die Tastaturkommandos<br />
verändern. Hier arbeiten<br />
Sie mit Tastenkombinationen<br />
auf Zeichen oder Textblöcken:<br />
Zum Beispiel löscht<br />
[3],[D],[W] drei Worte ab der aktuellen<br />
Position des Cursors im<br />
Text, [5],[D],[D] dagegen fünf Zeilen,<br />
beginnend bei der aktuellen<br />
Zeile. [D],[Umschalt]+[G] tilgt alle<br />
Zeichen von der aktuellen Cursorposition<br />
bis zum Textende. Die<br />
Position der Schreibmarke ändern<br />
Sie über die Tasten [H] (links), [J]<br />
(unten), [K] (oben) <strong>und</strong> [L]<br />
(rechts). In Vim sind zusätzlich<br />
die Pfeil- <strong>und</strong> Bewegungstasten<br />
entsprechend belegt. Kombinieren<br />
Sie die Tasten mit den Ziffernpräfixen,<br />
springen Sie hier durch<br />
den Text. Mit [Umschalt]+[G] bewegt<br />
sich der Cursor zum letzten<br />
Zeichen in der Datei.<br />
Über weitere Tasten schalten Sie<br />
in die anderen Modi um. Über<br />
[Esc] gelangen Sie stets in den<br />
Kommandomodus zurück. Den<br />
Einfügemodus erreichen Sie über<br />
[I] oder [A] (Einfügen vor oder<br />
nach der Cursorposition). Mittels<br />
[R] überschreiben Sie nur das Zeichen<br />
unter dem Cursor. Mit<br />
[Umschalt]+[R] wechseln Sie in<br />
den Überschreibmodus.<br />
Mit [Umschalt]+[.] gelangen Sie<br />
aus dem Kommandomodus in<br />
den Kommandozeilenmodus für<br />
globale Aufgaben <strong>und</strong> öffnen in<br />
der letzten Zeile des Terminals<br />
eine Eingabezeile. Dort speichert<br />
zum Beispiel w Dateiname den aktuellen<br />
Text unter dem angegebenen<br />
Dateinamen, wq Dateiname<br />
speichert <strong>und</strong> beendet den Editor<br />
in einem Zug. Mit q! beenden Sie<br />
den Editor, <strong>ohne</strong> die Änderungen<br />
im Text zu speichern.<br />
In den visuellen Modus gelangen<br />
Sie mittels [V] beziehungs-<br />
34 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Vi(m)-Basics<br />
schwerpunkt<br />
Kurse & Urlaub<br />
D Der Vim-Klon Vile/ Xvile im Einsatz.<br />
weise [Umschalt]+[V]. Über<br />
die Bewegungstasten markieren<br />
Sie zunächst den<br />
Text, den Sie dann mit den<br />
oben benannten Kommandos<br />
bearbeiten.<br />
Um das effektive Bedienen<br />
des Texteditors zu erlernen,<br />
hilft es, sich im Einfügemodus<br />
auf die Eingabe zu konzentrieren,<br />
um dann im<br />
Kommandomodus die Tippfehler<br />
auszubessern <strong>und</strong><br />
Wörter, Sätze oder Absätze<br />
entsprechend zu verschieben.<br />
[1] Vim-Homepage: http. //www.vim.org<br />
[2] Linux Professional Institute (LPI): http://www.lpi.org<br />
[3] Vi bei Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Vi<br />
Nächste Schritte<br />
Mit den hier vorgestellten<br />
Informationen gelingen bereits<br />
die ersten Schritte in<br />
der Vim-Welt. Noch wesenlich<br />
interessanter wird es<br />
aber, wenn Sie das hier erworbene<br />
Wissen in weiteren<br />
Programmen in ähnlicher<br />
Art <strong>und</strong> Weise anwenden<br />
können. Mit solchen Werkzeugen<br />
beschäftigen wir uns<br />
in einem Artikel in einer der<br />
nächsten Ausgaben von <strong>LinuxUser</strong>.<br />
(agr/ jlu) n<br />
[4] Vim-Buch: Steve Oualline, „Vi IMproved – Vim“, New Riders Publishing,<br />
info<br />
Indianapolis, 2001, ISBN 0-7357-1001-5, ftp://ftp.vim.org/pub/vim/doc/book/<br />
vimbook-OPL.pdf<br />
[5] Vim-Referenz: Reinhard Wobst, „Vim ge-packt“, MITP Verlag Bonn 2004,<br />
ISBN 3-8266-1425-9, http://home.wtal.de/rwobst/vim/<br />
[6] Vi/ Vim-Cheat-Sheet: http://www.viemu.com/vi-vim-cheat-sheet.gif<br />
[7] Nvi – 4.4-BSD-Reimplementierung von Vi:<br />
http://packages.debian.org/squeeze/nvi<br />
[8] Slackware Linux: http://www.slackware.com/<br />
[9] Kate OS: http://www.kateos.org/<br />
[10] Minix 3: http://www.minix3.org/<br />
[12] Macvim: http://code.google.com/p/macvim/<br />
[13] Macvim (Again): http://macvim.org<br />
[11] Elvis: http://packages.debian.org/squeeze/elvis<br />
[14] Vile: http://packages.debian.org/squeeze/vile<br />
Kostenloser Urlaub am Bodensee<br />
bodenseo möchte Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin einen<br />
kostenlosen Urlaub am Bodensee im 4-Sterne-Hotel “Hoeri<br />
am Bodensee” schenken: www.hoeri-am-bodensee.de<br />
Buchen Sie einen Kurs vom 1. Oktober bis 31. März, <strong>und</strong> Ihre<br />
Partnerin oder Partner übenachtet kostenlos in Ihrem<br />
Doppelzimmer. Auch das Frühstücksbüffet übernimmt<br />
bodenseo!<br />
Kurse finden<br />
Zum Beispiel können Sie Linux von Gr<strong>und</strong> auf kennen <strong>und</strong><br />
verstehen lernen. Oder wie wäre es mit Python, die<br />
Programmiersprache auf die Google setzt? Stöbern Sie doch<br />
einfach mal in unserem Kursprogramm im Internet. Neben<br />
Linux- <strong>und</strong> Shell-Kursen finden Sie die wichtigsten<br />
Sprachen wie Perl, C, C++, Tcl/Tk, Java, Bash, PHP <strong>und</strong><br />
viele andere: www.bodenseo.de<br />
Kleine Gruppen<br />
bodenseo will, dass Lernen Spaß macht <strong>und</strong> schnell geht.<br />
Deshalb sind alle Kurse sorgfältigst auf die jeweilige<br />
Zielgruppe abgestimmt. Wir legen großen Wert darauf, dass<br />
wir möglichst homogene <strong>und</strong> kleine Gruppen schulen, die<br />
in der Regel aus nur 2 – 4 Teilnehmer/innen bestehen.<br />
Preise<br />
Unsere Kurse gibt es bereits ab 379,- € plus MwSt pro Tag.<br />
Vollpension im 4-Sterne-Hotel “Hoeri am Bodensee”<br />
(www.hoeri-am-bodensee.de) mit Sauna, Swimming-Pool <strong>und</strong><br />
Wellness- <strong>und</strong> Spabereich ist bereits im Kurspreis enthalten.<br />
Telefon<br />
Manche Fragen lassen sich telefonisch einfach besser klären.<br />
Deshalb ist bodenseo telefonisch für Sie von montags bis<br />
inklusive samstags zwischen 8 <strong>und</strong> 20 Uhr erreichbar:<br />
07731/1476120<br />
Linux am Bodensee<br />
www.bodenseo.de<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 35
schwerpunkt<br />
Netzwerk-Tools<br />
Tools für die Konfiguration <strong>und</strong> Fehlerbehebung von Netzwerkverbindungen<br />
Handliche Werkzeuge<br />
© John Holst, Fotolia<br />
Die Kommandozeile<br />
hält einen<br />
Satz leistungsfähiger<br />
Werkzeuge bereit,<br />
mit denen Sie<br />
reADMe<br />
Fehlern in der<br />
Netzwerkkonfiguration<br />
oder im Netz<br />
selbst schnell auf<br />
die Spur kommen.<br />
James Mohr, Joe<br />
„Zonker“ Brockmeier<br />
Die Linux-Kommandozeile<br />
bietet eine leistungsstarke<br />
Sammlung<br />
von Werkzeugen für die<br />
Konfiguration <strong>und</strong> Fehlerbehebung<br />
von Netzwerkverbindungen.<br />
Linux <strong>und</strong> andere Systeme auf<br />
Unix-Gr<strong>und</strong>lage bieten in aller Regel<br />
mehrere Alternativen zum Lösen<br />
eines Problems. Das mag Anwender<br />
mit weniger Erfahrung gelegentlich<br />
etwas verwirren, gehört<br />
aber zu den bestimmenden Merkmalen<br />
der Open-Source-Welt.<br />
Netzwerk-Tools bilden da keine<br />
Ausnahme: Hier finden Sie eine<br />
Reihe von nützlichen Programmen<br />
– einige mit ähnlichen Aufgaben,<br />
aber auch solche mit einzigartiger<br />
Funktion – zum Konfigurieren<br />
<strong>und</strong> Verwalten von Netzwerkverbindungen<br />
sowie zur Suche<br />
<strong>und</strong> Behebung von Fehlern.<br />
Dieser Artikel stellt die gängigsten<br />
Werkzeuge für die Arbeit mit<br />
Netzwerken vor. Er setzt dabei<br />
voraus, dass Sie mindestens über<br />
gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse von<br />
TCP/ IP-Netzwerkkonzepten wie<br />
Listing 1<br />
Adressierung, Namensauflösung<br />
<strong>und</strong> Routing verfügen ([1],[2]).<br />
Schnittstellen<br />
Der Befehl ifconfig war <strong>und</strong> ist<br />
immer noch auf vielen Systemen<br />
das Standardwerkzeug für die<br />
Konfiguration von Netzwerkschnittstellen.<br />
Auf neueren Linux-<br />
Systemen finden Sie zusätzlich<br />
den Befehl ip, hinter dem sich<br />
nicht nur eine Neuauflage von Ifconfig<br />
verbirgt, sondern der als<br />
Arbeitspferd einer ganz neuen<br />
Generation von Netzwerkprogrammen<br />
arbeitet.<br />
Das Programm ip integriert<br />
nicht nur die Funktion einiger älterer<br />
Tools, sondern bietet eine<br />
einheitliche Syntax für alle Funktionen.<br />
Im Gegensatz dazu bilden<br />
die im Paket net-tools bereitgestellten<br />
Werkzeuge, zu denen<br />
$ ip addr show dev eth0<br />
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000<br />
link/ether 00:19:d1:a1:3e:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff<br />
inet 192.168.1.203/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0<br />
inet6 fe80::219:d1ff:fea1:3eb9/64 scope link<br />
valid_lft forever preferred_lft forever<br />
auch Ifconfig zählt, eine breite<br />
Sammlung von eigenständigen<br />
Hilfsprogrammen, die voneinander<br />
unabhängig entstanden.<br />
Ip gehört zum Paket iproute.<br />
Dank der Ähnlichkeit zwischen<br />
den einzelnen Werkzeugen aus<br />
diesem Paket konfigurieren Sie<br />
Ihr Netzwerk viel einfacher, denn<br />
Sie brauchen keine unterschiedliche<br />
Syntax für die einzelnen<br />
Funktionen zu erlernen. Darüber<br />
hinaus müssen Sie nicht immer<br />
im Kopf behalten, welches Werkzeug<br />
gerade für welche Funktion<br />
nötig wäre, denn Ip bringt viele<br />
der Fähigkeiten von ifconfig,<br />
route <strong>und</strong> arp unter einem Dach<br />
mit. Ein Aufruf von ip sieht in der<br />
allgemeinen Form wie folgt aus:<br />
$ ip Optionen Objekt Kommando<br />
Beim Objekt handelt es<br />
sich etwa um link für<br />
Netzwerkschnittstellen,<br />
addr für IP-Adressen, route<br />
für Routen <strong>und</strong> so weiter.<br />
Der Befehl ip unterstützt<br />
neben den genannten<br />
noch mehrere andere Ob-<br />
38 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Netzwerk-Tools<br />
schwerpunkt<br />
jekte – die Manpage des Tools liefert<br />
weitere Details.<br />
Im Kontext von ip handelt es<br />
sich bei einem Link-Objekt um<br />
ein (entweder physikalisches oder<br />
virtuelles) Netzwerkgerät. Die<br />
Details zu einer solchen Schnittstelle<br />
erhalten Sie mithilfe des Befehls<br />
ip addr show (Listing 1).<br />
In den meisten Fällen liefert das<br />
Kommando show die gr<strong>und</strong>legenden<br />
Parameter zu einem angegebenen<br />
Objekt. Geben Sie kein solches<br />
explizit an, zeigt es die Informationen<br />
für alle betreffenden<br />
Objekte an. Zum Beispiel erhalten<br />
Sie mittels ip addr show Informationen<br />
zu den Adressen aller<br />
Netzwerkschnittstellen. Gegebenenfalls<br />
verwenden Sie list statt<br />
show. Das kommt der Vorstellung<br />
entgegen, dass das System Geräte<br />
eher auflistet als „zeigt“.<br />
Die in Listing 1 gezeigte Form<br />
des Befehls ip addr arbeitet mit<br />
drei Parametern: show dev eth0.<br />
Das Kommando show arbeitet also<br />
als ein Befehl-im-Befehl mit den<br />
Argumenten dev eth0. Das zeigt,<br />
dass die Befehle mit Ip in der Regel<br />
etwas komplexer ausfallen als<br />
die Entsprechungen mit Ifconfig:<br />
Dort hieße derselbe Befehl einfach<br />
ifconfig eth0.<br />
Möchten Sie eine virtuelle<br />
Schnittstelle eth0:1 hinzufügen,<br />
dann sieht der entsprechende Befehl<br />
wie folgt aus:<br />
# ip addr add 192.168.1.42 dev eU<br />
th0:1<br />
In diesem Fall dienen die Parameter<br />
192.168.1.42 dev eth0:1 als Argumente<br />
für den Befehl add. Dieses<br />
Beispiel weist dem Gerät<br />
eth0:1 die IP-Adresse 192.168.1.42<br />
zu. Den Ip-Befehl verwenden Sie<br />
auch zum Aktivieren <strong>und</strong> Deaktivieren<br />
von Schnittstellen:<br />
# ip link set up dev eth1<br />
Hier kommt das Kommando set<br />
zum Einsatz. Die Befehle set <strong>und</strong><br />
view gehören zum link-Objekt. Als<br />
Alternative für das Aktivieren einer<br />
Netzwerkschnittstelle bietet<br />
sich der Befehl ifup an. Dahinter<br />
verbirgt sich eigentlich ein Shellskript,<br />
welches das System beim<br />
Hochfahren aus der Datei /etc/<br />
init.d/network zum Aktivieren der<br />
Schnittstelle aufruft. Wie zu erwarten,<br />
gibt es auch ein Kommando<br />
ifdown, bei dem es sich jedoch<br />
lediglich um einen symbolischen<br />
Link auf Ifup handelt.<br />
Routing<br />
Traditionell definieren <strong>und</strong> verwalten<br />
Sie Routen über den Befehl<br />
route. Mit ip route steht eine<br />
modernere Alternative zur Verfügung.<br />
Das Hinzufügen einer Route<br />
sieht bei den beiden Tools wie<br />
folgt aus:<br />
# route add ‐net 192.168.42.0/24U<br />
gw 192.168.1.99<br />
# ip route add 192.168.42.0/24 vU<br />
ia 192.168.1.99<br />
Das Format gleicht im Gr<strong>und</strong>e genommen<br />
dem beim Hinzufügen<br />
von IP-Adressen. Beachten Sie,<br />
dass beide Befehle die Route für<br />
einen gesamten Bereich von IP-<br />
Adressen (192.168.42.0/24 im<br />
CIDR-Format) hinzufügen <strong>und</strong><br />
diese Route einer Router-Adresse<br />
zuweisen – mithilfe des Arguments<br />
gw (engl. „gateway“) im<br />
Route-Befehl <strong>und</strong> dem deutlich<br />
intuitiveren via bei ip route.<br />
Geben Sie den Befehl ip route<br />
<strong>ohne</strong> modifizierendes Argument<br />
ein, erhalten Sie eine Liste der vorkonfigurierten<br />
Routen, wobei die<br />
Ausgabe etwas<br />
eingängigere<br />
Informa-<br />
$ route<br />
tionen enthält<br />
als jene<br />
von Route.<br />
Ein Beispiel<br />
dafür finden<br />
Sie in Listing<br />
2, das die<br />
$ ip route<br />
Ausgaben der<br />
beiden Tools<br />
auf einem<br />
Notebook<br />
zeigt.<br />
Namen <strong>und</strong> Zahlen<br />
Das Address Resolution Protocol<br />
ARP ermittelt die physikalische<br />
Hardware-Adresse, die zu der IP-<br />
Adresse eines Rechners gehört.<br />
Ursprünglich nutzte <strong>und</strong> verwaltete<br />
der Befehl arp die gleichnamigen<br />
Tabellen. Auch hierfür stellt<br />
Ip einen Ersatz bereit.<br />
Das Objekt heißt in diesem Fall<br />
neigh (engl.: „neighbor“, Nachbar).<br />
Beispiele für die Ausgabe der zwei<br />
Befehle zeigt Listing 3, nächste<br />
Seite. In beiden Fällen enthält die<br />
Ausgabe die IP-Adresse<br />
(192.168.1.111), die Link-Layer-<br />
Adresse (lladdr 00:30:05:0c:<br />
0b:23) sowie das physische Gerät<br />
(eth0), das mit dieser Adresse verb<strong>und</strong>en<br />
ist.<br />
Benutzer bauen eine Verbindung<br />
zu einem entfernten Rechner<br />
eher über den Hostnamen als<br />
über die IP-Adresse auf. Computer<br />
aber müssen die IP-Adresse<br />
verwenden <strong>und</strong> wandeln den Namen<br />
daher automatisch via DNS<br />
zurück in Zahlen. Ob das Umwandeln<br />
von Namen <strong>und</strong> Adressen<br />
klappt, prüfen Sie entweder<br />
mit dem Tool nslookup oder mit<br />
host. Beide Programme gehören<br />
zum Paket bind-utils. Der Befehl<br />
nslookup bietet dabei mehr Funktionalität<br />
<strong>und</strong> liefert eine umfangreichere<br />
Ausgabe als host.<br />
Fehler beheben<br />
Nachdem Sie Routen definiert haben,<br />
überzeugen Sie sich zuerst<br />
davon, ob die Pakete entfernte<br />
Hosts tatsächlich erreichen. Dazu<br />
gLossAr<br />
CIDR: Classless Inter-<br />
Domain Routing [3]. Ein<br />
Verfahren zur effizienteren<br />
Nutzung des IP-<br />
Adressraums <strong>und</strong> um<br />
die Größe der Routing-<br />
Tabellen zu reduzieren.<br />
tipp<br />
Der Befehl ip erlaubt,<br />
die Namen der Objekte<br />
abzukürzen.<br />
Meist genügt der<br />
ers te Buchstabe des<br />
Objektbezeichners,<br />
etwa ip l für ip link<br />
oder ip a für ip<br />
addr. Beachten Sie<br />
jedoch, dass es einige<br />
Objekte mit gleichen<br />
Anfangsbuchstaben<br />
gibt, zum Beispiel<br />
address <strong>und</strong><br />
addrlabel. Sie können<br />
Abkürzungen<br />
nicht nur für Objekte,<br />
sondern auch für Befehle<br />
verwenden.<br />
Statt ip addr show<br />
dev eth0 genügt<br />
auch ip a s eth0.<br />
Listing 2<br />
Kernel‐IP‐Routentabelle<br />
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface<br />
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0<br />
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 2 0 0 eth1<br />
link‐local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1<br />
default gateway 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0<br />
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.105 metric 1<br />
192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.106 metric 2<br />
169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1000<br />
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto static<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 39
schwerpunkt<br />
Netzwerk-Tools<br />
Listing 3<br />
Listing 4<br />
$ ping ‐c4 192.168.1.111<br />
verwenden Sie das Werkzeug ping<br />
<strong>und</strong> geben dabei als Argument<br />
entweder den Hostnamen oder<br />
die entsprechende IP-Adresse an<br />
(Listing 4). Die Option ‐c (engl.<br />
„count“) begrenzt dabei die Anzahl<br />
der übermittelten Pakete.<br />
Ohne diese Einschränkung sendet<br />
Ping fortlaufend Testpakete,<br />
bis Sie es über [Strg]+[C] beenden.<br />
In der Ausgabe von Ping sehen<br />
Sie einen Bericht für jedes<br />
Paket mit den Informationen<br />
über den Erfolg der Verbindungsaufnahme<br />
<strong>und</strong> die entsprechenden<br />
Antwortzeiten.<br />
Um die Route der Pakete bis<br />
zum Ziel zu überprüfen, verwenden<br />
Sie entweder das traditionelle<br />
traceroute oder das neuere Hilfsprogramm<br />
tracepath, das wie Ping<br />
zum Paket iputils gehört. Obwohl<br />
es sich bei Traceroute um das ältere<br />
Programm handelt, kennt es<br />
mehr Optionen als Tracepath.<br />
Letzteres nimmt im Prinzip als<br />
Parameter nur ein Ziel (Adresse<br />
oder Hostname) sowie eine Port-<br />
Nummer entgegen. Ansonsten<br />
können Sie lediglich über ‐l die<br />
Paketlänge angeben <strong>und</strong> mittels<br />
PING 192.168.1.111 (192.168.1.111) 56(84) bytes of data.<br />
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.309 ms<br />
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.361 ms<br />
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.316 ms<br />
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.318 ms<br />
‐‐‐ 192.168.1.111 ping statistics ‐‐‐<br />
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms<br />
rtt min/avg/max/mdev = 0.309/0.326/0.361/0.020 ms<br />
$ ss ‐r<br />
State Recv‐Q Send‐Q Local Address:Port Peer Address:Port<br />
ESTAB 0 0 192.168.1.105:57633 hydra.ntm‐gmbh.de:ssh<br />
ESTAB 0 0 192.168.1.105:50981 grape.canonical.com:https<br />
ESTAB 0 8 192.168.1.105:40217 defendo.local:24800<br />
‐n die Namensauflösung deaktivieren.<br />
Traceroute dagegen kennt<br />
r<strong>und</strong> ein Dutzend Parameter von<br />
Time-to-live-Werten über Maximum<br />
Hops bis hin zum Typ der<br />
Schnittstelle. Erachten Sie den<br />
Verlauf der Pakete als ineffizient<br />
oder unerwartet, erfahren Sie<br />
über route oder ip route, welche<br />
Routen konfiguriert sind. Beachten<br />
Sie, dass Sie nur diejenige<br />
Route sehen, die in der lokalen<br />
Maschine konfiguriert ist; möglicherweise<br />
liegt das Problem jedoch<br />
an anderer Stelle.<br />
Es kommt vor, dass ein bestimmter<br />
Router explizit so konfiguriert<br />
ist, keine Angaben auszugeben.<br />
Von Tracepath erhalten<br />
Sie in diesem Fall keine Ausgabe.<br />
Das bedeutet aber nicht, dass mit<br />
dem Ziel keine Verbindung möglich<br />
wäre (was Sie wiederum mit<br />
Ping prüfen). Es bedeutet lediglich,<br />
dass der dazwischen liegende<br />
Router die Anfrage von Tracepath<br />
(oder Traceroute) einfach nicht<br />
beantwortet. Weitere Tools für<br />
die Fehlerbehebung stehen Ihnen<br />
mit dem Befehl netstat zur Verfügung.<br />
Er gibt Informationen über<br />
Verbindungen<br />
sowie<br />
Routing-Tabellen<br />
<strong>und</strong><br />
umfangreiche<br />
Statistiken<br />
für<br />
Schnittstellen<br />
aus. Hier<br />
zu erwähnen<br />
ist noch das<br />
neuere Tool<br />
ss, das zwar<br />
Teil des iproute-Paketes<br />
ist <strong>und</strong> sich<br />
auf Sockets<br />
<strong>und</strong> Verbindungen<br />
konzentriert<br />
(Listing 5).<br />
Weitere Informationen<br />
entnehmen<br />
Sie der Manpage<br />
von ss.<br />
$ arp 192.168.1.111<br />
Adresse Hardware‐Typ Hardware‐Adresse Optionen Maske Schnittstelle<br />
192.168.1.111 ether 00:30:05:0c:0b:23 C eth0<br />
$ ip neigh show 192.168.1.1<br />
192.168.1.111 dev eth0 lladdr 00:30:05:0c:0b:23 REACHABLE<br />
Listing 5<br />
Letzter Schliff<br />
Um zu prüfen, ob Sie einen entfernten<br />
Rechner erreichen, bietet<br />
der Befehl ping immer die einfachste<br />
Lösung. Funktioniert ein<br />
Ping, können Sie davon ausgehen,<br />
dass das Netzwerk richtig<br />
konfiguriert ist (oder zumindest<br />
gut genug, damit Pakete an ihrem<br />
Bestimmungsort ankommen).<br />
Um sicherzugehen, dass wirklich<br />
alles passt, überprüfen Sie,<br />
ob Sie den entfernten Rechner sowohl<br />
über den Hostnamen als<br />
auch über die IP-Adresse erreichen.<br />
Erreichen Sie die Maschine<br />
lediglich über die Adresse, jedoch<br />
nicht mit dem Hostnamen, dann<br />
liegt das Problem höchstwahrscheinlich<br />
beim DNS. Dasselbe<br />
gilt für den umgekehrten Fall:<br />
Der Eintrag für den Host verweist<br />
dann auf eine falsche IP-Adresse.<br />
Können Sie weder mit dem<br />
Hostnamen noch mit der IP-Adresse<br />
eine Verbindung zum entfernten<br />
Rechner herstellen, fangen<br />
Sie am besten beim lokalen<br />
Rechner an <strong>und</strong> arbeiten sich<br />
dann Schritt für Schritt weiter<br />
nach außen vor. Die erste Frage<br />
lautet, ob TCP/ IP auf dem lokalen<br />
System richtig konfiguriert ist.<br />
Das prüfen Sie mit ip addr.<br />
Senden Sie dann einen Ping an<br />
den Router, um sicherzustellen,<br />
dass Sie mit ihm verb<strong>und</strong>en sind.<br />
Klappt das, dann versuchen Sie<br />
Ping mit einer Adresse jenseits<br />
des Routers, um zu testen, ob dieser<br />
die Pakete auch weiterleitet.<br />
Haben Sie damit das Problem<br />
noch immer nicht entdeckt, geben<br />
Traceroute oder Tracepath mehr<br />
Auskunft darüber, wo genau die<br />
Pakete verlorengehen. (agr/ jlu) n<br />
info<br />
[1] Netzwerkprotokolle: Achim Leitner,<br />
„Netz-Geheimnisse“, LU 11/ 2005, S. 40,<br />
http:// www. linux-community. de/ 9483<br />
[2] TCP/ IP-Basics: Kristian Kißling, „Pfade<br />
durch den Dschungel“, LU 12/ 2006, S. 34,<br />
http:// www. linux-community. de/ 11811<br />
[3] Classless Inter-Domain Routing:<br />
http:// de. wikipedia. org/ wiki/<br />
Classless_ Inter-Domain_Routing<br />
40 10 | 11<br />
www.linux-user.de
www.android–user.de
schwerpunkt<br />
Dateisysteme pflegen<br />
Dateisysteme aufsetzen, konfigurieren <strong>und</strong> warten mit Bordmitteln<br />
Festes F<strong>und</strong>ament<br />
© Greyman, sxc.hu<br />
Mit ein paar<br />
einfachen Shell-<br />
Befehlen legen<br />
Sie die Gr<strong>und</strong>lage<br />
für jede moderne<br />
Linux-Distribution:<br />
das Dateisystem.<br />
Nathan Willis<br />
reADMe<br />
Obwohl die meisten<br />
Linux-Distributionen<br />
heutzutage über benutzerfre<strong>und</strong>liche<br />
grafische<br />
Oberflächen verfügen,<br />
um Dateisysteme aufzusetzen<br />
<strong>und</strong> zu verwalten,<br />
ist es durchaus<br />
sinnvoll zu wissen, wie<br />
Sie diese Aufgaben per<br />
Befehlszeile erledigen.<br />
Linux unterstützt ein breites<br />
Spektrum an Dateisystemen, darunter<br />
viele aus dem Umfeld anderer<br />
Betriebssysteme. Für Festplatten<br />
kommen jedoch nach wie<br />
vor am ehesten die nativen Linux<br />
Dateisysteme Ext2, Ext3 <strong>und</strong><br />
Ext4 (den Nachfolgern von Ext2)<br />
sowie XFS infrage. Aus Kompatibilitätsgründen<br />
ist es darüber hinaus<br />
wichtig, das VFATDateisystem<br />
zu lesen <strong>und</strong> auf diesem Daten<br />
zu schreiben, da es standardmäßig<br />
auf vielen Medien zum<br />
Einsatz kommt, darunter USB<br />
Sticks <strong>und</strong> FlashLaufwerke. Darüber<br />
hinaus dienen einige Tools,<br />
die beim Verwalten von normalen<br />
Dateisystemen helfen, auch zum<br />
Verwalten von SwapPartitionen.<br />
Solche SwapPartitionen setzt der<br />
LinuxKernel als virtuellen Speicher<br />
ein, wenn nicht genug Arbeitsspeicher<br />
bereitsteht.<br />
Dateisysteme anlegen<br />
Mit dem Befehl mkfs (Abbildung<br />
A) richten Sie ein neues<br />
Dateisystem auf einem ausgewählten<br />
BlockGerät ein, beispielsweise<br />
in einer Partition auf<br />
der Festplatte. Die gr<strong>und</strong>sätzliche<br />
Aufrufform lautet:<br />
# mkfs ‐t Typ Gerät<br />
Dabei bezeichnet Typ eines der<br />
von Linux unterstützten Dateisysteme,<br />
wie zum Beispiel Ext2<br />
oder XFS, <strong>und</strong> Gerät legt die Partition<br />
auf der Festplatte fest, wie<br />
zum Beispiel /dev/hda1 oder auch<br />
/ dev/sdc3. Darüber hinaus dürfen<br />
Sie neben dem Dateisystemtyp<br />
weitere Parameter angeben, die<br />
allerdings je nach Dateisystem<br />
unterschiedlich ausfallen.<br />
Das Programm mkfs überlässt<br />
das eigentliche Erstellen des<br />
Dateisystems einem von mehreren<br />
Spezialwerkzeugen, wie etwa<br />
mkfs.ext2, mkfs.xfs oder mkfs.vfat.<br />
Da sich Dateisysteme stark voneinander<br />
unterscheiden, pflegen<br />
die Experten des jeweiligen Systems<br />
die Tools selbst. Das trägt<br />
dazu bei, dass deren Programmcode<br />
äußerst stabil läuft.<br />
Die meisten der Programme nutzen<br />
dieselben Optionen, obwohl<br />
es in Einzelfällen Unterschiede<br />
gibt – abhängig von den Funktionen,<br />
die das jeweilige Dateisystem<br />
kennt. Es empfiehlt sich daher,<br />
stets den Befehl mkfs zu nutzen,<br />
um ein Dateisystem zu erstellen,<br />
selbst wenn dieser andere spezifische<br />
Helfer aufruft.<br />
Trotz der Unterschiede gibt es<br />
ein paar Standardoptionen, die<br />
allen Hilfsprogrammen gemeinsam<br />
sind. Benutzen Sie den Parameter<br />
‐c, so prüft das Programm<br />
das angegebene Gerät auf defekte<br />
Blöcke, die es dann während des<br />
eigentlichen Erstellens überspringt.<br />
Die Parameter ‐v <strong>und</strong> ‐V<br />
bewirken die Ausgabe von ausführlichen<br />
beziehungsweise sehr<br />
ausführlichen Meldungen.<br />
Beispiele<br />
Mit folgender Zeile formatieren<br />
Sie die erste Partition des ersten<br />
SATALaufwerks mit Ext3:<br />
# mkfs ‐t ext3 /dev/sda1<br />
42 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Dateisysteme pflegen<br />
schwerpunkt<br />
In diesem Beispiel kommen die<br />
Standardeinstellungen für Blockgröße,<br />
InodeParameter sowie alle<br />
anderen Optionen zum Einsatz –<br />
wobei das Programm einige davon<br />
tatsächlich erst während der<br />
Laufzeit ermittelt, während mkfs<br />
die Geometrie der Festplatten<br />
Partition analysiert. Der folgende<br />
Befehl erzeugt ebenfalls ein Ext3<br />
Dateisystem auf /dev/sda1, erzwingt<br />
aber eine Blockgröße von<br />
4096 Byte:<br />
A Unterschiede zwischen<br />
dem simulierten<br />
Erzeugen von XFS- <strong>und</strong><br />
Ext3-Dateisystemen.<br />
Die Optionen ‐f <strong>und</strong> ‐F<br />
sorgen dafür, dass<br />
mkfs das Dateisystem<br />
selbst dann erstellt,<br />
wenn bereits ein Dateisystem<br />
vorhanden ist.<br />
# mkfs ‐t ext3 ‐b 4096 /dev/sda1<br />
Ein weiterer Befehl erzeugt dasselbe<br />
Dateisystem wie die vorherige<br />
Befehlszeile, legt aber zusätzlich<br />
eine JournalDatei auf einer<br />
separaten Partition an (/dev/sdb1).<br />
# mkfs ‐t ext3 ‐b 4096 ‐J deviceU<br />
=/dev/sdb1 /dev/sda1<br />
Dagegen legen Sie mit folgendem<br />
Befehl eine XFSPartition auf der<br />
ersten Partition /dev/sda1 an:<br />
# mkfs ‐t xfs /dev/sda1<br />
Folgende Eingabe ist erforderlich,<br />
um für dieses Dateisystem eine<br />
Blockgröße von 4096 Byte einzustellen:<br />
# mkfs ‐t xfs ‐b size=4096 /dev/U<br />
sda1<br />
Die Syntax unterscheidet sich von<br />
der bei Ext3. Daher sollten Sie<br />
sich mithilfe der Dokumentation<br />
genau darüber informieren, was<br />
die Dateisystemspezifischen Parameter<br />
bei mkfs bewirken.<br />
Wartung<br />
Obwohl die Speicherkapazität der<br />
Festplatten jedes Jahr zunimmt,<br />
scheint es, als füllten sich die<br />
OptiOnen<br />
Sämtliche Tools für Ext-Dateisysteme sowie XFS unterstützen<br />
Optionen, mit denen Sie die Einstellungen für das Dateisystem<br />
anpassen, darunter die Blockgröße, die Anzahl<br />
<strong>und</strong> Größe der Inodes, die Größe der Fragmente oder den<br />
Speicherplatz, der für Prozesse reserviert bleibt, die der Administrator<br />
ausführt. Darüber hinaus gibt es Optionen, um<br />
die Deskriptortabelle für Blockgruppen zu vergrößern, falls<br />
sich die Dateisystemgröße einmal verändert, sowie zum Anpassen<br />
der Einstellungen für Stripe, Stride <strong>und</strong> andere Informationen,<br />
die Sie benötigen, wenn Sie das Dateisystem<br />
in einen RAID-Verb<strong>und</strong> einbinden.<br />
Erfreulicherweise existieren Standardeinstellungen für all<br />
diese Parameter, die Sie auch nutzen sollten, falls es nicht<br />
gute Gründe gibt, davon abzuweichen. Nichtsdestoweniger<br />
sollten Sie sich für den Fall, dass es irgendwann einmal bei<br />
Ihrer Arbeit mit Dateisystemen zu Problemen kommt, mit<br />
den Gr<strong>und</strong>lagen der Optionen vertraut machen.<br />
Über Blockgröße geben Sie die Größe der Chunks an, die<br />
ein Dateisystem benutzt, um Daten zu speichern – gewissermaßen<br />
die Granularität der Teile, in die es eine Datei<br />
aufspaltet, wenn Sie diese auf ein Medium speichern.<br />
Ext-Dateisysteme verstehen sich auf Blöcke in den Größen<br />
1024, 2048 oder 4096 Byte. Größere Blöcke erhöhen einerseits<br />
den Durchsatz, da die Platte pro Zeiteinheit mehr<br />
Daten liest <strong>und</strong> schreibt, bevor der Treiber eine neue Position<br />
ansteuert. Andererseits verschwenden Sie auf diese<br />
Weise viel Platz auf dem Datenträger, wenn Sie eine Vielzahl<br />
kleiner Dateien speichern, da jedes Fragment einer<br />
Datei trotzdem immer einen kompletten Block verbraucht,<br />
selbst wenn die Daten nur einen kleinen Teil davon belegen.<br />
Für alle vier Linux-Dateisysteme stellen Sie die Blockgröße<br />
mittels des Parameters ‐b ein. Die nach dem Parameter<br />
erforderliche Syntax weist jedoch Unterschiede auf,<br />
weswegen Sie die Einzelheiten in der Manpage für die jeweilige<br />
Option nachlesen sollten.<br />
Ext3, Ext4 <strong>und</strong> XFS unterstützen Journaling, mit dem sie<br />
Fehlern bei Abstürzen vorbeugen. Das geschieht mittels<br />
eines Änderungsberichtes bezüglich der Dateien <strong>und</strong> Verzeichnisse,<br />
des sogenannten Journals. Die Größe dieses<br />
Journals geben Sie entweder in Blöcken oder Bytes an. Außerdem<br />
legen Sie fest, ob das Journal auf demselben Gerät<br />
liegen soll oder Sie es getrennt speichern möchten. Die genaue<br />
Syntax unterscheidet sich je nach Dateisystem. Beachten<br />
Sie daher die Dokumentation.<br />
VFAT-Dateisysteme unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht<br />
von den nativen Dateisystemen, die bei Linux <strong>und</strong> Unix-ähnlichen<br />
Betriebssystemen zum Einsatz kommen. Da FAT sehr<br />
viel einfacher gestrickt ist, müssen Sie sich um Inodes,<br />
Fragmentgrößen oder RAID-Einstellungen hier keine Gedanken<br />
machen. Sie haben die Möglichkeit, die Anzahl der reservierten<br />
Sektoren, Sektoren pro Cluster <strong>und</strong> die Sektorengröße<br />
einzustellen – Parameter, die den Blockeinstellungen<br />
der nativen Dateisysteme unter Unix ähneln. In beinahe allen<br />
Fällen sind die Standardeinstellungen ausreichend.<br />
Der Befehl mkswap erzeugt einen Swap-Bereich auf einer<br />
Partition – analog zu mkfs, der ein Dateisystem erstellt. Die<br />
Syntax gleicht sich ebenfalls: Sie lautet mkswap Gerät, wobei<br />
der optionale Parameter ‐c bewirkt, dass das Programm<br />
die Partition auf defekte Blöcke hin überprüft, bevor es den<br />
entsprechenden Bereich einrichtet. Genauso wie Sie ein<br />
neues Dateisystem mithilfe des Befehls mount in den Verzeichnisbaum<br />
einhängen, bevor es zum Einsatz bereitsteht,<br />
gilt es, eine neue Swap-Partition mit dem Befehl swapon ‐L<br />
Gerät zu aktivieren.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 43
schwerpunkt<br />
Dateisysteme pflegen<br />
B Df stellt den Speicherplatzverbrauch<br />
im<br />
laufenden Betrieb dar.<br />
Mit dem Parameter ‐a<br />
zeigt es zusätzlich virtuelle<br />
Dateisysteme<br />
wie /proc an.<br />
Platten noch schneller, als man<br />
sie nachkaufen kann. Wahrscheinlich<br />
kommt dieses Problem auch<br />
von Zeit zu Zeit auf Sie zu. Zu wenig<br />
Speicherplatz auf der Platte<br />
ist aus verschiedenen Gründen<br />
unangenehm: Beispielsweise erstellt<br />
das Betriebssystem eine<br />
ganze Reihe temporärer Dateien,<br />
was in einigen Fällen dazu führt,<br />
dass ein RootDateisystem auf einer<br />
vollen oder fast vollen Partition<br />
die Performance des Rechners<br />
erheblich beeinträchtigt.<br />
Platz prüfen<br />
Bei Bedarf prüfen Sie den Speicherplatz<br />
mit dem Befehl df<br />
(„disk free“). Falls Sie keine Parameter<br />
setzen, gibt Df eine Tabelle<br />
zurück, in der das Programm den<br />
Speicherplatzverbrauch aller eingeb<strong>und</strong>enen<br />
Dateisysteme darstellt,<br />
<strong>und</strong> zwar in KByte sowie<br />
als Prozentsatz der Gesamtgröße<br />
jedes Dateisystems. Geben Sie<br />
den Parameter ‐a an, bezieht Df<br />
virtuelle Dateisysteme wie zum<br />
Beispiel /proc mit in die Auswertung<br />
ein (Abbildung B).<br />
Einen Bericht für eine bestimmte<br />
Partition erhalten Sie, indem<br />
Sie diese als Argument verwenden,<br />
wie df /dev/sda1. Übergeben<br />
Sie einen Dateinamen als Argument,<br />
so analysiert Df diejenige<br />
Partition, welche die angegebene<br />
Datei enthält. Außerdem kennt<br />
das Programm Df einige weitere<br />
nützliche Parameter:<br />
• Mit ‐i listet es die Anzahl der<br />
belegten Inodes auf, statt jene<br />
der Blocks.<br />
• Mit ‐l beschränken Sie den Bericht<br />
auf lokale Dateisysteme.<br />
• Die Optionen ‐‐type=Typ <strong>und</strong><br />
‐‐exclude‐type=Typ ermöglichen<br />
es, die Ausgabe auf einen bestimmten<br />
DateisystemTyp zu<br />
beschränken beziehungsweise<br />
einen solchen bei der Anzeige<br />
auszuschließen.<br />
• Der Parameter ‐h liefert die Ergebnisse<br />
„humanreadable“ als<br />
für Menschen leichter erfassbarer<br />
in KByte, MByte, GByte<br />
oder TByte.<br />
Stellen Sie fest, dass auf einer<br />
Partition nur noch wenig freier<br />
Speicher verbleibt, bietet sich als<br />
Erstes eine Analyse des Platzverbrauchs<br />
mittels du an. Der Aufruf<br />
du /Verzeichnis liefert eine Liste<br />
des Ordners samt aller seiner Unterverzeichnisse<br />
inklusive des jeweiligen<br />
Speicherplatzverbrauchs<br />
in KByte. Fügen Sie den Parameter<br />
‐a hinzu, listet Du zusätzlich<br />
zu den Verzeichnissen noch den<br />
Speicherplatz auf, den die Dateien<br />
verbrauchen, beides rekursiv.<br />
Geben Sie Du kein Verzeichnis als<br />
Argument mit, verwendet es das<br />
aktuelle Verzeichnis als Ausgangspunkt.<br />
Die Option ‐c gibt<br />
zusätzlich zu den Statistiken der<br />
Dateien <strong>und</strong> Verzeichnissen noch<br />
eine Gesamtsumme an.<br />
Andere Optionen dienen dazu,<br />
verirrte große Dateien ausfindig<br />
zu machen, wie zum Beispiel ‐L,<br />
das allen symbolischen Links<br />
folgt, oder ‐x, mit dessen Hilfe Sie<br />
die Suche auf das aktuelle Dateisystem<br />
einschränken. Über<br />
‐‐max‐depth=N begrenzen Sie die<br />
Anzahl der Rekursionen, mit denen<br />
das Programm in Unterverzeichnisse<br />
abtaucht – eine äußerst<br />
hilfreiche Option, wenn Sie<br />
es mit einer umfangreichen<br />
Dateisammlung zu tun haben.<br />
Wie bei Df liefert auch bei Du der<br />
Parameter ‐h die Ergebnisse als<br />
KByte, MByte, GByte oder TByte.<br />
Tuning<br />
Es gibt einige Tools, die die Möglichkeit<br />
bieten, die Leistung von<br />
Dateisystemen zu verbessern. So<br />
verändern Sie beispielsweise mit<br />
dem Programm tune2fs viele Einstellungen<br />
von ExtDateisystemen.<br />
Mit tune2fs ‐c N legen Sie<br />
beispielsweise die Anzahl der<br />
Mounts zwischen automatischen<br />
Integritätsüberprüfungen fest.<br />
Den maximalen zeitlichen Abstand<br />
zwischen Überprüfungen<br />
bestimmen Sie mit tune2fs ‐i<br />
Zeitraum. Dabei bezeichnen die<br />
Buchstaben d, m <strong>und</strong> w jeweils<br />
Tage, Monate <strong>und</strong> Wochen. Bei<br />
Bedarf fügen Sie mit dem Befehl<br />
tune2fs ‐j einem Ext3Dateisystem<br />
ein Journal hinzu. Bei Bedarf<br />
passen Sie zudem die RAIDParameter,<br />
JournalEinstellungen <strong>und</strong><br />
das Verhalten in Bezug auf die reservierten<br />
Blöcke an.<br />
Sämtliche Tools zum Modifizieren<br />
der Größe von Dateisystemen<br />
beherrschen sowohl das Vergrößern<br />
als auch Verkleinern. Das<br />
Vergrößern eines Dateisystems<br />
setzt allerdings verständlicherweise<br />
voraus, dass auf der darunterliegenden<br />
Festplattenpartition<br />
genügend Platz frei ist.<br />
44 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Dateisysteme pflegen<br />
schwerpunkt<br />
Das Dateisystem XFS bringt eine<br />
eigene Palette an Tools mit, die<br />
viele der bereits genannten Optionen<br />
ebenfalls abdecken. Über<br />
xfs_growfs bearbeiten Sie beispielsweise<br />
die Größe. Darüber<br />
hinaus gibt es weitere Aktionen,<br />
die die Software beherrscht: Verwenden<br />
Sie die Option ‐m, modifizieren<br />
Sie mithilfe des Befehls<br />
xfs_growfs den Wert des Speicherplatzes,<br />
den das System für<br />
Inodes reserviert. Die Optionen<br />
‐l <strong>und</strong> ‐L ermöglichen es, Änderungen<br />
am Journal vorzunehmen<br />
– beide Funktionen sind auch in<br />
den anderen Tools der anderen<br />
Dateisysteme enthalten. XFS<br />
stellt darüber hinaus ein Tool<br />
zum Defragmentieren namens<br />
xfs_fsr bereit – so etwas existiert<br />
für ExtDateisysteme nicht.<br />
Darüber hinaus legen Sie bei Bedarf<br />
Sicherheitskopien <strong>und</strong> DateisystemSnapshots<br />
unter XFS an.<br />
Das Tool xfs_freeze friert das<br />
Dateisystem ein: Kein Programm<br />
darf Dateien lesen oder schreiben.<br />
xfsdump erstellt eine Sicherheitskopie<br />
eines Dateisystems (in<br />
InodeAbfolge, was den Einsatz<br />
bei einem gemounteten Dateisystem<br />
ermöglicht). Mit xfsrestore<br />
spielen Sie eine vorher angefertigte<br />
Sicherheitskopie ein.<br />
Fehlersuche<br />
Linux überprüft jedes Dateisystem<br />
in regelmäßigen Abständen<br />
<strong>und</strong> beim Systemstart. Dabei<br />
sucht ein Testprogramm nach<br />
Unregelmäßigkeiten – zum Beispiel<br />
Inodes, die zu keiner Datei<br />
gehören, Abweichungen zwischen<br />
der Zahl der InodeReferenzen<br />
<strong>und</strong> dem InodeReferenzzähler<br />
oder Unterschieden zwischen der<br />
Zahl der verfügbaren Blöcke in einem<br />
Dateisystem <strong>und</strong> der erwarteten<br />
Anzahl, die im Superblock<br />
gespeichert ist.<br />
Findet das Betriebssystem Diskrepanzen,<br />
interpretiert es dies<br />
als einen Hinweis darauf, dass ein<br />
Systemabsturz oder ein anderes<br />
Problem vorliegt. Das Tool, das<br />
die Prüfungen vornimmt, heißt<br />
fsck. Wenn Sie vermuten,<br />
dass etwas im<br />
Dateisystem nicht in<br />
Ordnung sein könnte,<br />
nutzen Sie folgenden<br />
Befehl, um die Prüfung<br />
manuell anzustoßen<br />
<strong>und</strong> alle nötigen Reparaturen<br />
zu erledigen:<br />
# fsck Gerät<br />
Geben Sie fsck ein, <strong>ohne</strong><br />
ein Ziel zu präzisieren,<br />
prüft das Programm alle<br />
Dateisysteme in /etc/<br />
fstab in der angegebenen<br />
Reihenfolge.<br />
Die dateisystemspezifischen<br />
Programme zum Überprüfen<br />
auf Fehler – e2fsck bei Ext<br />
Dateisystemen <strong>und</strong> fsck.vfat bei<br />
VFAT (Abbildung C) – unterstützen<br />
größtenteils dieselben Parameter,<br />
die Syntax weicht jedoch<br />
im Detail ab. Es ist daher wichtig,<br />
die Hinweise in der Dokumentation<br />
der Programme zu beachten.<br />
Bei VFATDateisystemen äußern<br />
sich Fehler in Form von anderen<br />
Symptomen – defekte Cluster<br />
<strong>und</strong> Verzeichniszeiger oder<br />
sogar defekte Dateinamen. Das<br />
Tool fsck.vfat entdeckt viele dieser<br />
Probleme <strong>und</strong> kann einige davon<br />
beseitigen. Wie die anderen<br />
Tools verfügt auch dieses Programm<br />
über einen nicht interaktiven<br />
Betriebsmodus, der den<br />
Einsatz in einem Skript ermöglicht.<br />
So kennzeichnen Sie bei Bedarf<br />
automatisch defekte Cluster,<br />
damit diese in Zukunft nicht<br />
mehr zum Einsatz kommen. Der<br />
Parameter ‐V bewirkt, dass fsck.<br />
vfat einen zweiten Prüflauf startet,<br />
nachdem das Tool versucht<br />
hat, Fehler zu beheben.<br />
XFS verfügt über getrennte<br />
Werkzeuge zum Prüfen <strong>und</strong> zur<br />
Reparatur: xfs_check <strong>und</strong> xfs_repair.<br />
Wie bei den anderen Dateisystemen<br />
mit JournalingFunktion<br />
gibt es eine Option, mit deren<br />
Hilfe Sie auch in diesem Fall das<br />
Journal auf einer anderen Partition<br />
abspeichern.<br />
Zwei hilfreiche Funktionen, die<br />
nur bei XFS existieren, erreichen<br />
Sie über die Parameter ‐f sowie<br />
‐s: Ersterer ermöglicht das Überprüfen<br />
eines DateisystemImages,<br />
das als normale Datei vorliegt,<br />
wie zum Beispiel eine Sicherheitskopie<br />
eines Dateisystems, die Sie<br />
mit xfsdump angelegt haben. Die<br />
Option ‐s bewirkt, dass das Programm<br />
nur schwerwiegende Fehler<br />
meldet. Das Tool xfs_repair<br />
schafft es in den meisten Fällen,<br />
Datenfehler zu korrigieren, wie<br />
sie auch e2fsck behebt.<br />
Expertenmodus<br />
Wollen Sie ein fehlerhaftes Dateisystem<br />
mit flexibleren Mitteln<br />
untersuchen, greifen Sie auf andere<br />
Programme zurück. Bei<br />
Prob lemen mit Ext2/ 3/ 4 gestattet<br />
es das Tool debugfs, das Dateisystem<br />
interaktiv zu untersuchen<br />
<strong>und</strong> Fehler zu beheben. Dabei haben<br />
Sie die Möglichkeit, Schritt<br />
für Schritt vorzugehen.<br />
Dabei stehen ähnliche Befehle<br />
wie in einer LinuxShell bereit,<br />
zum Beispiel cd, open, close, pwd,<br />
mkdir <strong>und</strong> sogar chroot. Seine wirkliche<br />
Stärke zeigt das Tool, wenn<br />
es darum geht, Superblöcke, Blöcke<br />
<strong>und</strong> Inodes direkt zu untersuchen,<br />
Zuordnungen herzustellen<br />
<strong>und</strong> wieder aufzuheben, Blöcke<br />
freizugeben <strong>und</strong> sogar Referenzen<br />
zu erstellen. (agr) n<br />
C Die Ausgabe von<br />
fsck unter Einsatz der<br />
Standardoptionen bei<br />
einem VFAT-Dateisystem.<br />
Die Option ‐v bewirkt<br />
die Ausgabe ausführlicher<br />
Meldungen.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 45
schwerpunkt<br />
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen auf der<br />
Befehlszeile verwalten<br />
Zentrales<br />
Register<br />
© Pawel Szpytma, 123RF<br />
Lernen Sie<br />
Dateien <strong>und</strong><br />
Befehle kennen,<br />
mit deren Hilfe Sie<br />
Benutzer- <strong>und</strong><br />
Gruppen-Konten<br />
hinzufügen, verändern<br />
<strong>und</strong> entfernen.<br />
Matt Simmons, Joe<br />
„Zonker“ Brockmeier<br />
reADMe<br />
Hinzufügen, Bearbeiten<br />
<strong>und</strong> Entfernen von Benutzern<br />
<strong>und</strong> Benutzergruppen:<br />
All diese Aufgaben<br />
gehen schnell<br />
<strong>und</strong> elegant von der<br />
Hand, wenn Sie die richtigen<br />
Tools kennen <strong>und</strong><br />
gekonnt einsetzen.<br />
In der IT-Steinzeit, als ein Computer<br />
noch etliche Quadratmeter<br />
in Anspruch nahm, kam es so gut<br />
wie nie vor, dass mehrere Personen<br />
denselben Rechner gleichzeitig<br />
nutzten. Mit zunehmender<br />
Leistung gewann das Konzept des<br />
„Time Sharing“ an Bedeutung:<br />
Die Anwender gaben ihre Programme<br />
(„Jobs“) ein <strong>und</strong> starteten<br />
diese. Dann erhielten sie die<br />
Ergebnisse des Jobs <strong>und</strong> starteten<br />
danach den nächsten Auftrag<br />
– eine mühselige Angelegenheit.<br />
Parallel arbeiten<br />
In den 70er-Jahren löste Multitasking<br />
das Time-Sharing-Konzept<br />
ab: Nun konnten mehrere<br />
Programme zur gleichen Zeit aktiv<br />
sein. Dies führte zum Konzept<br />
des Benutzerkontos: Das System<br />
bot die Möglichkeit, dass sich<br />
eine große Anzahl Anwender<br />
parallel anmelden durfte, wobei<br />
alle Zugriff auf eine individuelle<br />
Arbeitsumgebung erhielten.<br />
Linux <strong>und</strong> andere Unix-basierte<br />
Systeme nutzen das Konzept des<br />
Benutzerkontos, um Identitäten<br />
zu verwalten. Außerdem begrenzen<br />
sie auf diese Weise den Zugriff<br />
auf Ressourcen, die mit dem<br />
betreffenden Account oder mit<br />
den Gruppen, zu denen er gehört,<br />
verknüpft sind.<br />
Zu den Charakteristika des Benutzerkontos<br />
zählt die Eingabeaufforderung<br />
beim Anmelden.<br />
Der Systemadministrator hat unter<br />
Linux zudem die Möglichkeit,<br />
den Zugang zu den Ressourcen<br />
per Gruppen-Mitgliedschaft zu<br />
verwalten. Eine Gruppe fasst<br />
mehrere Benutzer zusammen, üblicherweise<br />
mit einer gemeinsamen<br />
Aufgabe <strong>und</strong> daher mit einem<br />
ähnlichen Bedürfnis nach<br />
Zugang zu einer gemeinschaftlich<br />
genutzten Ressource.<br />
Eine Gruppe namens Buchhaltung<br />
enthält beispielsweise alle<br />
Nutzer, die der gleichnamigen<br />
Abteilung angehören <strong>und</strong> daher<br />
dieselben Zugriffsrechte auf Tabellen<br />
<strong>und</strong> andere Daten mit Finanzinformationen<br />
benötigen.<br />
Statt jedem einzelnen Nutzer Zugriffsrechte<br />
für jede einzelne Datei<br />
zuzuweisen, räumt der Administrator<br />
diese Möglichkeit der<br />
Gruppe Buchhaltung ein <strong>und</strong> ordnet<br />
dann die jeweiligen Nutzer<br />
dieser Gruppe zu.<br />
Diese Vorgehensweise bietet<br />
sich auch für Peripheriegeräte<br />
(Drucker, Scanner) oder Dienste<br />
eines Rechners an. Damit Benutzer<br />
beispielsweise auf das optische<br />
Laufwerk (CD/ DVD) am PC<br />
zugreifen können, müssen sie<br />
Mitglied der Gruppe cdrom sein<br />
(zumindest bei Debian <strong>und</strong> dessen<br />
Abkömmlingen), <strong>und</strong> der Zugriff<br />
auf Userspace-Dateisysteme<br />
(Fuse) setzt die Mitgliedschaft in<br />
der Gruppe fuse voraus. Viele Distributionen<br />
gestatten nur solchen<br />
Benutzern den Zugriff auf den<br />
Befehl sudo, die zu den Gruppen<br />
admin oder wheel gehören.<br />
UID <strong>und</strong> GID<br />
Für jedes Benutzerkonto legt das<br />
System je eine Zeile in den beiden<br />
Dateien /etc/passwd <strong>und</strong> /etc/shadow<br />
an. Auf diese Weise weist es<br />
jedem Benutzer eine eindeutige<br />
Kennung zu, die Benutzer-ID<br />
(UID). In ähnlicher Weise legt es<br />
46 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
schwerpunkt<br />
für jede Gruppe eine Zeile in der<br />
Datei /etc/group an <strong>und</strong> weist ihr<br />
eine Gruppenkennung zu (GID).<br />
Als UIDs <strong>und</strong> GIDs sind Ganzzahlen<br />
von 0 bis 232-1 zulässig.<br />
Als allgemeiner Usus gilt allerdings<br />
der Höchstwert 65535, was<br />
216-1 entspricht. UIDs zwischen 0<br />
<strong>und</strong> 999 reservieren die Distributoren<br />
im Allgemeinen für Systemdienste.<br />
Dem Superuser-Konto,<br />
root genannt, sollten Sie immer<br />
die UID 0 zuweisen. Weiter sollte<br />
er Mitglied einer Gruppe namens<br />
root sein, der Sie den GID-Wert 0<br />
zuordnen. Das erfüllt bestimmte<br />
Annahmen seitens des Systems,<br />
zum Beispiel in Skripten. Die IDs<br />
der normalen Benutzer fangen<br />
bei den meisten Linux-Distributionen<br />
mit der UID 1000 an.<br />
Kommentare<br />
Jeder Benutzer darf die Datei /<br />
etc/passwd öffnen <strong>und</strong> lesen. Dass<br />
Benutzer Einsicht in eine Datei<br />
mit Passwörtern haben – selbst,<br />
wenn diese verschlüsselt sind –<br />
stellt allerdings ein Sicherheitsrisiko<br />
dar. Daher befinden sich die<br />
Passwörter auf modernen Systemen<br />
in der Datei /etc/shadow, die<br />
nur der Superuser einsehen darf.<br />
Doppelpunkte gliedern jede Zeile<br />
in /etc/passwd in Abschnitte<br />
(Abbildung A), wobei das erste<br />
Feld den Benutzernamen enthält,<br />
der den Inhaber gegenüber dem<br />
System identifiziert. Das zweite<br />
Feld zeigt an, ob ein Benutzer<br />
sich am System überhaupt anmelden<br />
darf. Der Eintrag x erlaubt<br />
dies, ein Asterisk (*) verwehrt dagegen<br />
das Anmelden.<br />
Das dritte <strong>und</strong> vierte Feld enthalten<br />
jeweils die UID des Users<br />
beziehungsweise die GID der<br />
Gruppe, zu der er gehört. Das<br />
fünfte Feld heißt GECOS-Feld –<br />
die Abkürzung steht für „General<br />
Electric Comprehensive Operating<br />
System“. Früher standen in<br />
diesem Feld Sicherheitskennungen,<br />
heute speichern die Distributionen<br />
an dieser Stelle zusätzliche<br />
Informationen über den Benutzer,<br />
getrennt durch Kommata.<br />
Obwohl das Feld meist nur den<br />
Namen des Benutzers enthält,<br />
lautet das vollständige Format:<br />
Voller Name, Gebäude/Raumnummer,<br />
Telefon dienstlich, weitere<br />
Telefonnummer<br />
Das sechste Feld der Datei legt<br />
das Home-Verzeichnis des Benutzers<br />
fest. Existiert das genannte<br />
Verzeichnis nicht, verwendet das<br />
System beim Einloggen des Benutzers<br />
das Wurzelverzeichnis /<br />
als aktuelles Verzeichnis.<br />
Das letzte Feld der Datei /etc/<br />
passwd bezeichnet die Shell des Benutzers.<br />
Meldet sich dieser in einem<br />
Terminal an, braucht er einen<br />
Kommandozeileninterpreter,<br />
der mit ihm interagiert <strong>und</strong> Befehle<br />
entgegennimmt. Das Feld<br />
legt diesen Interpreter fest, unter<br />
Linux in der Regel die Bash.<br />
Überprüfen Sie die Datei /etc/<br />
passwd auf Ihrem eigenen Rechner,<br />
dann stellen Sie eventuell fest,<br />
dass bei mehreren Konten als<br />
Shell /sbin/nologin steht. Das verhindert,<br />
dass diese Konten Zugang<br />
zu einer Shell erhalten – für<br />
den Fall, dass Dritte die Systemprozesse,<br />
die sie verwalten, manipuliert<br />
haben. Diese Methode eignet<br />
sich auch für Konten, die zum<br />
Beispiel nur für das Verteilen von<br />
Mails gedacht sind.<br />
Wie in der Datei /etc/passwd<br />
trennen auch in /etc/shadow Doppelpunkte<br />
die einzelnen<br />
Felder, für jedes<br />
Konto existiert eine<br />
eigene Zeile (Abbildung<br />
A, unten). Das<br />
erste Feld enthält den<br />
Benutzernamen des<br />
Kontos, das zweite<br />
Feld das verschlüsselte<br />
Passwort. Die Verschlüsselungsmethode<br />
hängt von der Distribution<br />
ab. Ursprünglich<br />
kam das<br />
Verfahren Crypt zum<br />
Einsatz, später löste<br />
das MD5-Hashing das<br />
Crypt-Verfahren ab.<br />
Die Felder drei bis sechs steuern<br />
den Zeitraum der Gültigkeit des<br />
Passworts. Aus Sicherheitsgründen<br />
empfiehlt es sich, das Passwort<br />
regelmäßig zu ändern. Dazu<br />
legen Sie für jedes Passwort fest,<br />
wie viele Tage maximal vergehen<br />
dürfen, bis das System ein neues<br />
Passwort anfordert.<br />
Um zu verhindern, dass Benutzer<br />
einfach im Schnellverfahren<br />
mehrere Passwörter durchlaufen,<br />
bis sie wieder beim ursprünglichen<br />
angelangt sind, schreiben<br />
viele Sicherheitsrichtlinien zusätzlich<br />
eine Mindestdauer für<br />
die Gültigkeit eines Passworts<br />
vor. Die Felder in /etc/shadow ermöglichen<br />
es, Regeln für das Altern<br />
von Passwörtern aufzustellen.<br />
Die Bedingungen zum Ändern<br />
von Passwörtern gelten nur<br />
für normale Benutzer; der Superuser<br />
darf Passwörter <strong>ohne</strong> Einschränkungen<br />
ändern.<br />
Das dritte Feld der Datei /etc/<br />
shadow enthält das Passwort-Alter.<br />
Es zeigt die Anzahl der Tage seit<br />
dem Beginn der Unix-Zeit am 1.<br />
Januar 1970. Verwenden Sie das<br />
Date-Kommando, um die Zahl in<br />
ein Datum umzuwandeln (Listing<br />
1, folgende Seite).<br />
Daraus ergibt sich, dass das<br />
Passwort für den Benutzer msimmons<br />
am 8. November 2009 festgelegt<br />
wurde. Der Rest der datumsspezifischen<br />
Felder beziehen<br />
sich auf diese Zahl.<br />
A Oben ein Beispiel<br />
für einen Eintrag in der<br />
Datei /etc/passwd, unten<br />
eines für einen<br />
Eintrag in der Datei<br />
/ etc/shadow.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 47
schwerpunkt<br />
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
Listing 2<br />
Listing 1<br />
01 $ grep msimmons /etc/shadow<br />
02 msimmons:$1$UVHO7Lj9<br />
$SguVZlNtWWoCoi7m2uS<br />
e/1:14556:0:99999:7:::<br />
03 $ date ‐d "Jan 1 1970 + 14556<br />
days"<br />
04 Sun Nov 8 00:00:00 EST 2009<br />
01 # finger msimmons<br />
02 Login: msimmons Name: Matt Simmons<br />
03 Directory: /home/msimmons Shell: /bin/bash<br />
04 Last login Sun Nov 8 14:51 (EST) on pts/2 from centos<br />
05 No mail.<br />
06 No Plan.<br />
Listing 3<br />
01 $ who<br />
02 msimmons tty1 2009‐11‐08 14:58<br />
03 root :0 2009‐11‐08 12:46<br />
04 root pts/0 2009‐11‐08 12:48 (:0.0)<br />
05 msimmons pts/2 2009‐11‐08 14:58 (centos)<br />
06<br />
07 $ w<br />
08 15:00:51 up 8:58, 4 users, load average: 0.07,<br />
0.10, 0.10<br />
09 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE<br />
JCPU PCPU WHAT<br />
10 msimmons tty1 ‐ 14:58 2:19<br />
0.22s 0.22s ‐bash<br />
11 root :0 ‐ 12:46 ?xdm?<br />
4:11 0.92s /usr/bin/gnome‐session<br />
12 root pts/0 :0.0<br />
12:48 0.00s 0.76s 0.29s ssh msimmons@localhost<br />
13 msimmons pts/2 centos<br />
14:58 0.00s 0.20s 0.02s w<br />
Das vierte Feld besagt, wie viele<br />
Tage mindestens vergehen müssen,<br />
bevor der Benutzer das Passwort<br />
ändern darf. Im Beispiel<br />
steht dieser Wert auf 0, das heißt,<br />
es gibt keinen Mindestwert: Der<br />
Benutzer darf das Passwort also<br />
jederzeit ändern.<br />
Das fünfte Feld bezeichnet die<br />
maximale Anzahl der Tage, die<br />
zwischen zwei Änderungen des<br />
Passworts vergehen dürfen. Da es<br />
keine Möglichkeit gibt, einen unbegrenzten<br />
Zeitraum festzulegen,<br />
stellen viele Distributionen an<br />
dieser Stelle mit 99999 eine Zeitspanne<br />
von 274 Jahren ein.<br />
Das sechste Feld legt fest, wie<br />
viele Tage vor Ablauf des Passworts<br />
das System einen Warnhinweis<br />
an den Benutzer einblendet.<br />
Im Beispiel erhielte der Benutzer<br />
sieben Tage, bevor das Passwort<br />
abläuft, beim Anmelden einen<br />
entsprechenden Hinweis <strong>und</strong> die<br />
Gelegenheit, es zu ändern.<br />
Das siebte Feld legt fest, wie viele<br />
Tage nach Ablauf des Passwortes<br />
das System das Konto abschaltet.<br />
Für ein deaktiviertes<br />
Konto zeigt das achte Feld an,<br />
seit wann der Account bereits abgeschaltet<br />
ist (Anzahl der Tage<br />
seit Beginn der Unix-Zeit). Das<br />
letzte Feld bleibt für künftige Anwendungen<br />
reserviert.<br />
Gruppenarbeit<br />
Der Aufbau der Datei /etc/group<br />
ähnelt jenem der Dateien /etc/<br />
passwd <strong>und</strong> /etc/shadow, doch enthält<br />
sie weniger Felder. Das erste<br />
davon gibt den Namen der Gruppe<br />
an, gefolgt von einem Token,<br />
ähnlich wie in der Passwd-Datei.<br />
Das dritte Feld zeigt die GID, <strong>und</strong><br />
das letzte Feld enthält eine durch<br />
Kommas getrennte Liste von<br />
Konten in dieser Gruppe. Enthält<br />
die Datei /etc/passwd für einen Benutzer<br />
eine GID, heißt dies nicht<br />
zwingend, dass eine Mitgliedschaft<br />
in der entsprechenden<br />
Gruppe in /etc/group vorliegt.<br />
Es gibt eine Reihe von Tools, um<br />
die Benutzerkonten im System<br />
näher zu untersuchen. Das einfachste<br />
Werkzeug dieser Art ist<br />
das Tool finger, das Sie einfach<br />
mit einem Benutzernamen als Argument<br />
aufrufen. Es liefert dann<br />
eine ganze Reihe von Informationen<br />
in einem kompakten Überblick<br />
zurück (Listing 2).<br />
Die Informationen über den Benutzer<br />
stellt das System mithilfe<br />
der bereits besprochenen Dateien<br />
zusammen. Darüber hinaus zieht<br />
Listing 4<br />
01 # useradd ‐D<br />
02 GROUP=100<br />
03 HOME=/home<br />
04 INACTIVE=‐1<br />
05 EXPIRE=<br />
06 <strong>SHELL</strong>=/bin/bash<br />
07 SKEL=/etc/skel<br />
08 CREATE_MAIL_SPOOL=yes<br />
es noch einige Logs sowie Dateien<br />
im Benutzerverzeichnis der Person<br />
heran. In der Vergangenheit<br />
war es üblich, über finger nicht<br />
nur Informationen über einen lokalen<br />
Benutzer abzurufen, sondern<br />
auch eine Verbindung zu einem<br />
Finger-Server auf TCP-Port<br />
79 auf einem entfernten Rechner<br />
herzustellen. Durch gestrafftere<br />
Sicherheitsrichtlinien ist Letzteres<br />
mit der Zeit aus der Mode gekommen,<br />
weswegen heute kaum<br />
eine Standardinstallation mehr<br />
einen Finger-Server enthält.<br />
Um festzustellen, welche Benutzer<br />
aktuell am System angemeldet<br />
sind, verwenden Sie entweder<br />
den Befehl who oder nutzen stattdessen<br />
w, wenn Sie Wert auf einen<br />
ausführlichen Bericht legen (Listing<br />
3). Beide zeigen den Benutzernamen<br />
sowie das Gerät, auf<br />
dem sich der Benutzer angemeldet<br />
hat, aber bei w sehen Sie zusätzlich<br />
noch die benutzten Programme<br />
sowie einige Statistiken.<br />
Konten anlegen<br />
Auf der Kommandozeile erstellen<br />
Sie neue Nutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
meist mit useradd <strong>und</strong> groupadd.<br />
Diese Werkzeuge, auf die Sie nur<br />
als Superuser Zugriff erhalten,<br />
finden Sie standardmäßig im Verzeichnis<br />
/usr/sbin. Auf Debian-<br />
Systemen gibt es auch das Perl-<br />
Skript adduser, das als benutzerfre<strong>und</strong>liches<br />
Frontend für<br />
Useradd, Groupadd <strong>und</strong> Usermod<br />
gedacht ist. Da Useradd bei allen<br />
Linux-Distributionen funktioniert,<br />
beziehen sich die folgenden<br />
Beispiele auf dieses Tool.<br />
Trotz zahlreicher möglicher Optionen<br />
erweist sich der Umgang<br />
mit Useradd als nicht sonderlich<br />
kompliziert. Beim ersten Aufruf<br />
ist der nützlichste Parameter<br />
wahrscheinlich ‐D (Listing 4): Er<br />
zeigt die momentan geltenden<br />
Standardwerte für verschiedene<br />
Einstellungen an, festgelegt in<br />
der Datei /etc/default/useradd.<br />
Diese Werte können sich von Distribution<br />
zu Distribution allerdings<br />
unterscheiden.<br />
48 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Alles zum ThemA<br />
Android<br />
Die Monatszeitschrift für Android-Fans, Smartphone-<strong>und</strong> Tablet Nutzer<br />
Kennenlernangebot:<br />
3 AusgAben<br />
für nur 3 euro<br />
Jetzt bestellen unter:<br />
www.android–user.de/miniabo<br />
Telefon 07131 / 2707 274 • Fax 07131 / 2707 78 601 • E-Mail: abo@android-user.de<br />
ab 29.09.<br />
Neu!<br />
am KiosK
schwerpunkt<br />
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
Listing 6<br />
Um ein neues Benutzerkonto per<br />
Kommandozeile zu erstellen, geben<br />
Sie useradd Benutzername ein,<br />
woraufhin das Programm die entsprechenden<br />
Zeilen in die Dateien<br />
/etc/passwd <strong>und</strong> /etc/shadow einträgt.<br />
Das Benutzerkonto ist in<br />
diesem Stadium allerdings noch<br />
nicht ganz einsatzfähig, da Sie<br />
bislang weder ein Passwort zugewiesen<br />
noch ein Benutzerverzeichnis<br />
erstellt haben. Um das<br />
Benutzerkonto startklar zu machen,<br />
gibt es mehrere Argumente,<br />
mit deren Hilfe Sie es entsprechend<br />
gestalten:<br />
# /usr/sbin/useradd msimmons ‐c U<br />
"Matt Simmons" ‐d /home/msimmonsU<br />
‐m ‐s /bin/bash<br />
Zusätzlichen zu den Einträgen in<br />
/etc/passwd <strong>und</strong> /etc/shadow trägt<br />
diese Befehlszeile den Wert Matt<br />
Simmons in das GECOS-Feld ein<br />
(‐c), legt das Benutzerverzeichnis<br />
fest (‐d) <strong>und</strong> erstellt es auch<br />
gleich (‐m) <strong>und</strong> weist als Anmelde-<br />
Shell (‐s) die Bash zu. Damit steht<br />
ein funktionierendes Benutzerkonto<br />
bereit.<br />
Ein Parameter für Useradd, der<br />
im Beispiel nicht zum Einsatz<br />
kam, lautet ‐‐password. Als Argument<br />
dient hier ein verschlüsselter<br />
Password-Hash. Diese Option<br />
sollte man tunlichst meiden, da<br />
dadurch kurzzeitig das verschlüsselte<br />
Passwort für alle Benutzer<br />
im System zu sehen ist.<br />
Listing 5<br />
01 # passwd msimmons<br />
02 Enter new UNIX password:<br />
03 Retype new UNIX password:<br />
04 passwd: password updated<br />
successfully<br />
01 # cat /etc/shadow | grep msimmons<br />
02 msimmons:$1$MfBYOD/O$yv2.31xLwrsN9oXtlBxpa0:14563:0:9<br />
9999:7:::<br />
03 # chage ‐E "2009‐11‐16" msimmons<br />
04 # cat /etc/shadow | grep msimmons<br />
05 msimmons:$1$MfBYOD/O$yv2.31xLwrsN9oXtlBxpa0:14563:0:99<br />
999:7::14564:<br />
06 # date ‐d "Jan 1, 1970 + 14564 days"<br />
07 Mon Nov 16 00:00:00 EST 2009<br />
Erledigen Sie das Erstellen von<br />
Benutzerkonten per Skript <strong>und</strong><br />
erhalten alle neuen Benutzer<br />
standardmäßig das gleiche Passwort,<br />
spart dies eventuell Zeit.<br />
Alternativ bietet es sich an, einen<br />
Blick auf den Befehl /usr/sbin/newusers<br />
zu werfen, der das Importieren<br />
von Benutzerkonten im<br />
Batch-Verfahren erlaubt. Der<br />
Nachteil von Newusers liegt darin,<br />
dass es die Passwörter, die Sie<br />
eingeben, im Klartext speichert –<br />
eine gravierende Sicherheitslücke,<br />
sollten Angreifer den Weg in das<br />
System finden.<br />
Es kommt immer wieder vor,<br />
dass Sie Benutzerkonten erstellen<br />
wollen, die kein Benutzerverzeichnis<br />
<strong>und</strong> keine Login-Daten<br />
benötigen – zum Beispiel, wenn<br />
ein Account nur die Funktion hat,<br />
Mails zu empfangen oder zu verschicken.<br />
Dann können Sie folgenden<br />
Befehl nutzen:<br />
# /user/sbin/useradd mailuser ‐cU<br />
"Mail User" ‐M ‐s /bin/false<br />
Die Option ‐M weist useradd an, in<br />
diesem Fall kein Home-Verzeichnis<br />
zu erstellen <strong>und</strong> mit ‐s auf ein<br />
Login zu verzichten (‐s /bin/false,<br />
alternativ: ‐s /bin/nologin).<br />
Keine eigene Gruppe<br />
Standardmäßig erstellt Useradd<br />
eine Gruppe mit demselben Namen<br />
wie der Benutzernamen (daher<br />
existiert in obigem Beispiel<br />
parallel zum Benutzer msimmons<br />
eine Gruppe namens msimmons).<br />
Bei umfangreichen Mehrplatzsystemen<br />
ist das unter Umständen<br />
nicht erwünscht. In diesem Fall<br />
weisen Sie das Programm über<br />
die Option ‐n (Abkürzung für<br />
‐‐no‐user‐group) an, keine neue<br />
Benutzergruppe zu erstellen.<br />
Stattdessen geben Sie entweder<br />
über die Option ‐g die Gruppe an<br />
oder tun gar nichts – worauf<br />
Useradd versucht, einen Gruppeneintrag<br />
in /etc/default/useradd<br />
zu finden. Existiert dieser nicht,<br />
kommt die Gruppe users mit der<br />
GID 100 zum Zuge.<br />
Zu guter Letzt kommt es manchmal<br />
vor, dass Sie die Benutzer-ID<br />
(UID) selbst festlegen wollen, anstatt<br />
das System standardmäßig<br />
die nächste verfügbare UID zuweisen<br />
zu lassen. Dies ist hauptsächlich<br />
dann sinnvoll, wenn Sie<br />
sichergehen möchten, dass ein<br />
Benutzer auf verschiedenen Systemen<br />
über dieselbe UID verfügt.<br />
Die Option lautet ‐u NNNN, wobei<br />
NNNN die UID bezeichnet, die Sie<br />
dem Benutzer zuweisen wollen:<br />
# /user/sbin/useradd newuser ‐cU<br />
"New User" ‐d /home/newuser ‐m U<br />
‐s /bin/bash ‐g testuser ‐u 2001<br />
Es fällt auf Dauer lästig, bei jedem<br />
Nutzer alle diese Optionen<br />
anzugeben. Um den Aufwand zu<br />
reduzieren, bietet es sich an, die<br />
Vorgaben zu ändern. Dazu modifizieren<br />
Sie entweder /etc/default/useradd<br />
oder nutzen die<br />
Standard-Option ‐D. Wie beschrieben<br />
gibt useradd ‐D <strong>ohne</strong><br />
weitere Parameter die Standardeinstellungen<br />
aus. Benutzen Sie<br />
aber den Befehl mit weiteren Optionen,<br />
ändern Sie die Standardwerte.<br />
Der folgende Befehl setzt<br />
Ablaufdatum, Standard-Shell <strong>und</strong><br />
Gruppe neu:<br />
# /user/sbin/useradd newuser ‐D U<br />
‐e 2012‐12‐31 ‐s /bin/false ‐g tU<br />
testuser<br />
Die Option ‐e legt das Ablaufdatum<br />
für Benutzerkonten im Format<br />
Jahr‐Monat‐Tag fest. Die Option<br />
‐s stellt die Standard-Shell ein,<br />
‐g setzt die Standard-Gruppe.<br />
Werfen Sie einen kurzen Blick<br />
auf die Dokumentation für den<br />
Befehl useradd auf Ihrem Rechner.<br />
In den meisten Fällen passen die<br />
Standardwerte. Bringen die Vorgaben<br />
nicht den gewünschten Erfolg,<br />
greifen Sie wie beschrieben<br />
auf useradd zurück, um über diesen<br />
Befehl den Account entsprechend<br />
anzupassen.<br />
Wenn Sie den Parameter ‐‐password<br />
nicht verwenden, schaltet<br />
das System das Benutzerkonto<br />
50 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
schwerpunkt<br />
ab. In diesem Fall bearbeiten Sie<br />
das Passwort des Kontos mithilfe<br />
des Befehls passwd. Mit der Eingabe<br />
/usr/bin/passwd Username erstellen<br />
Sie ein Passwort für einen<br />
neuen Benutzer. Listing 5 zeigt,<br />
wie das Ergebnis dieses Befehls<br />
normalerweise aussieht.<br />
Beachten Sie, dass viele Distributionen<br />
bestimmte Anforderungen<br />
bezüglich der Sicherheit von<br />
Passwörtern stellen, um die Sie<br />
nicht herumkommen – außer als<br />
Root, wo Sie aber immer noch einen<br />
Warnhinweis erhalten.<br />
Der Befehl Passwd erlaubt es daneben,<br />
den Status für ein oder<br />
mehrere Benutzerkonten abzufragen.<br />
Möchten Sie beispielsweise<br />
nachsehen, ob das Konto<br />
msimmons im Einsatz ist, erledigen<br />
Sie das mit folgendem Befehl:<br />
# passwd ‐S msimmons<br />
msimmons P 11/20/2009 0 99999 7 ‐1<br />
Als Resultat sehen Sie den Login-<br />
Namen, den Status des Passwortes,<br />
das Datum der letzten Änderung<br />
(falls zutreffend), den minimal<br />
<strong>und</strong> maximal erlaubten Zeitraum<br />
zwischen Änderungen, den<br />
Zeitraum für den Warnhinweis<br />
<strong>und</strong> wie lange das Konto schon<br />
deaktiviert ist.<br />
Der Buchstabe P weist darauf<br />
hin, dass das Konto über ein gültiges<br />
Passwort verfügt. Stünde<br />
hier ein L, wäre das Konto gesperrt;<br />
NP wiese auf das Fehlen eines<br />
Passworts hin. Geben Sie am<br />
Prompt passwd ‐S ‐a ein, gibt das<br />
Programm dieselben Informationen<br />
aus, diesmal allerdings für<br />
alle Benutzerkonten.<br />
Möchten Sie ein Konto sperren,<br />
erledigen Sie dies mit dem Befehl<br />
passwd ‐l Benutzername. Das macht<br />
das Passwort ungültig, indem es<br />
einen zufälligen Wert erhält, der<br />
mit keinem verschlüsselten Wert<br />
übereinstimmt. Auf diese Weise<br />
legen Sie das Konto allerdings<br />
nicht komplett still: Verfügt der<br />
Benutzer beispielsweise über einen<br />
gültigen SSH-Schlüssel, vermag<br />
er sich dennoch einzuloggen.<br />
Um ein Konto sicher zu deaktivieren<br />
<strong>und</strong> jede Anmeldung zu unterbinden,<br />
verwenden Sie passwd<br />
‐‐expiredate 1, was das Ablaufdatum<br />
in die Vergangenheit setzt.<br />
Einige Versionen von Passwd erledigen<br />
das automatisch, sobald<br />
Sie die Option ‐l verwenden. Um<br />
ein Konto zu entsperren, geben<br />
Sie passwd ‐u ein: Das stellt das<br />
frühere Passwort wieder her.<br />
Bearbeiten<br />
Dem Administrator stehen darüber<br />
hinaus noch mehr Tools bereit,<br />
um Konten <strong>und</strong> Gruppen zu<br />
analysieren <strong>und</strong> zu bearbeiten.<br />
Das wichtigste Werkzeug zum Bearbeiten<br />
bereits bestehender Benutzerkonten<br />
ist /usr/sbin/usermod.<br />
Es lässt dieselben Kommandozeilenoptionen<br />
zu wie /usr/<br />
sbin/useradd, inklusive des Benutzernamens<br />
(‐‐login NeuerBenutzername)<br />
<strong>und</strong> der UID (‐‐uid NeueUID).<br />
Oft kommt es vor, dass ein Systemadministrator<br />
nur dann mit<br />
Benutzerkonten zu tun hat, wenn<br />
es darum geht, diese anzulegen,<br />
zu löschen oder Benutzern zu helfen,<br />
ihr Passwort wiederherzustellen.<br />
Manchmal jedoch tritt<br />
der Fall ein, dass Sie Usermod<br />
brauchen, um Änderungen am<br />
Konto vorzunehmen, wie zum<br />
Beispiel das Ablaufdatum. Um<br />
dieses zu ändern, verwenden Sie<br />
die Option ‐e JJJJ‐MM‐TT (J=Jahr,<br />
M=Monat, T=Tag).<br />
Unter Umständen müssen Sie<br />
die Benutzerverzeichnisse irgendwann<br />
einmal verschieben. Dazu<br />
verwenden Sie dieselbe Option<br />
(‐d), die Sie bei Useradd benutzt<br />
haben, um das Verzeichnis festzulegen.<br />
Fügen Sie die Option ‐m<br />
hinzu, verschieben Sie zusätzlich<br />
den Inhalt des bestehenden Verzeichnisses<br />
ins neue:<br />
# usermod ‐d /home/newhome ‐m<br />
Arbeiten Sie mit Red Hat oder<br />
Fedora (oder einem anderen System<br />
das SELinux einsetzt), geben<br />
Sie mithilfe der Option ‐Z den<br />
SELinux-Benutzer an.<br />
Ein weiterer typischer Fall besteht<br />
darin, dass Sie Benutzer zu<br />
neuen Gruppen hinzufügen müssen.<br />
Dazu dienen die Optionen ‐a<br />
(für „append“) <strong>und</strong> ‐G (für<br />
„groups“). Dabei müssen Sie die<br />
Gruppen durch Kommas getrennt<br />
angeben (wobei kein Leerzeichen<br />
dazwischen stehen darf). Um einen<br />
Benutzer zu den Gruppen<br />
cdrom <strong>und</strong> admin hinzufügen, tippen<br />
Sie daher:<br />
# usermod ‐a ‐G cdrom,admin<br />
Das Entfernen des Benutzers aus<br />
einer Gruppe geht nicht ganz so<br />
intuitiv von der Hand, es gibt keinen<br />
eigenen Befehl dafür. Stattdessen<br />
müssen Sie den Befehl<br />
Usermod verwenden, <strong>und</strong> zwar<br />
mit denjenigen Gruppen als Argument,<br />
in denen der Benutzer Mitglied<br />
bleiben soll, also zum Beispiel<br />
cdrom <strong>und</strong> user. Damit entfernen<br />
Sie ihn automatisch aus allen<br />
anderen Gruppen:<br />
# usermod ‐G cdrom,user<br />
Mit dem Befehl /usr/sbin/groupmod<br />
bearbeiten Sie darüber hinaus<br />
Einstellungen für einzelne Gruppen.<br />
Genau wie Usermod unterstützt<br />
auch Groupmod sämtliche<br />
Optionen, die der vorher erwähnte<br />
Befehl Groupadd anbietet.<br />
Mit Usermod bearbeiten Sie bei<br />
Bedarf das GECOS/ Kommentar-<br />
Feld. Allerdings bleibt dabei das<br />
Format demjenigen überlassen,<br />
der den Befehl eingibt. Das Kommando<br />
/usr/bin/chfn macht es wesentlich<br />
einfacher, Zugang zum<br />
standardisierten Format zu erhalten:<br />
Geben Sie den Befehl <strong>ohne</strong><br />
weitere Optionen ein, fragt das<br />
System sogar nach, ob Sie alle Felder<br />
ausfüllen möchten.<br />
Mit Passwd ändern Sie einige,<br />
aber nicht alle Einstellungen für<br />
das Altern des Passwortes. Das<br />
Tool /usr/bin/chage hingegen gewährt<br />
Ihnen volle Kontrolle über<br />
alle Optionen. Bei Chage können<br />
Sie sowohl ein explizites Datum<br />
eingeben als auch die Anzahl der<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 51
schwerpunkt<br />
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
Listing 7<br />
Tage seit Beginn der Unix-Zeit.<br />
Listing 6 (S. 50) zeigt in allen Einzelheiten<br />
das Ändern des Ablaufdatums<br />
von einem Passwort, bei<br />
dem ein herkömmlich formatiertes<br />
Datum zum Einsatz kommt.<br />
01 $ ulimit ‐a<br />
02 core file size (blocks, ‐c) 0<br />
03 data seg size (kbytes, ‐d) unlimited<br />
04 scheduling priority (‐e) 0<br />
05 file size (blocks, ‐f) unlimited<br />
06 pending signals (‐i) 32768<br />
07 max locked memory (kbytes, ‐l) unlimited<br />
08 max memory size (kbytes, ‐m) unlimited<br />
09 open files (‐n) 1024<br />
10 pipe size (512 bytes, ‐p) 8<br />
11 POSIX message queues (bytes, ‐q) 819200<br />
12 real‐time priority (‐r) 0<br />
13 stack size (kbytes, ‐s) 8192<br />
14 cpu time (seconds, ‐t) unlimited<br />
15 max user processes (‐u) 32768<br />
16 virtual memory (kbytes, ‐v) unlimited<br />
17 file locks (‐x) unlimited<br />
Verteilungskampf<br />
Listing 4 (S. 48) enthielt bereits<br />
einen Verweis auf die Variable<br />
SKEL, die im Beispiel auf das Verzeichnis<br />
/etc/skel zeigt. Dahinter<br />
verbirgt sich das Skeleton-Verzeichnis,<br />
das alle Standarddateien<br />
für ein neues Benutzerverzeichnis<br />
enthält. Jedes Mal, wenn Sie<br />
ein neues Konto erstellen, dient<br />
dieses Verzeichnis als Vorlage:<br />
Sämtliche Dateien <strong>und</strong> Verzeichnisstrukturen,<br />
die sich darin befinden,<br />
landen im neuen Benutzerverzeichnis,<br />
das Sie beim Befehl<br />
Useradd angeben. Diese Methode<br />
eignet sich ausgezeichnet<br />
dazu, um jedem neuen Benutzer<br />
ein Profil oder eine spezielle<br />
Bash-Umgebung zuzuweisen.<br />
Eine weitere Datei zum Verwalten<br />
von Benutzerumgebungen<br />
heißt /etc/profile. Jedes Mal,<br />
wenn ein Benutzer sich anmeldet,<br />
überprüft das System diese Datei<br />
<strong>und</strong> liest daraus die Standardwerte<br />
für häufig genutzte Umgebungsvariablen,<br />
wie zum Beispiel<br />
Prompts, Pfade oder Umasks.<br />
Neben dem Bearbeiten der eigentlichen<br />
Benutzerkonten gehört<br />
das Verteilen der Systemressourcen<br />
mit zu den wichtigen<br />
Aufgaben beim <strong>Administrieren</strong> eines<br />
Systems. Auf einem Rechner,<br />
den mehrere Personen benutzen,<br />
sollte jeder Nutzer gleichberechtigt<br />
Zugriff auf den Speicher andere<br />
Komponenten erhalten. Die<br />
stärkste Waffe im Arsenal ist dabei<br />
das in die Bash integrierte<br />
Tool ulimit: Es setzt dem einzelnen<br />
User Grenzen für den Verbrauch<br />
von Festplattenspeicher,<br />
Arbeitsspeicher oder auch die Anzahl<br />
der Prozesse.<br />
Sie haben die Möglichkeit, den<br />
Befehl von einer Benutzer-Shell<br />
aus zu starten. In diesem Fall<br />
wirkt er sich sowohl auf die Shell<br />
aus als auch auf alle Programme,<br />
die Sie darin starten. Das Kommando<br />
kennt „harte“ <strong>und</strong> „weiche“<br />
Limits sowie unbegrenzte<br />
Werte. Legen Sie ein hartes Limit<br />
einmal fest, können Sie es später<br />
nur noch senken, aber nicht mehr<br />
erhöhen. Ein anfänglich gesetztes<br />
weiches Limit dürfen Sie bis zur<br />
Höhe des harten Limits anheben,<br />
aber nicht darüber hinaus.<br />
Der Parameter unlimited hebt<br />
alle Barrieren auf <strong>und</strong> erlaubt es<br />
dem Benutzer, sämtliche Ressourcen<br />
eines bestimmten Typs<br />
für sich zu beanspruchen.<br />
Da es dieser Befehl relativ einfach<br />
macht, zulässige Aktivitäten<br />
der Benutzer zu blockieren, ist es<br />
wichtig, die Konsequenzen von<br />
Modifikationen über Ulimit zu<br />
durchschauen. Schränken Sie beispielsweise<br />
den Verbrauch von<br />
Arbeitsspeicher ein, führt dies<br />
unter Umständen dazu, dass<br />
beim Benutzer Programme, die<br />
auf Shared Libraries aufsetzen,<br />
abstürzen oder nicht starten.<br />
Normalerweise kommt Ulimit<br />
zum Einsatz, um harte <strong>und</strong> weiche<br />
Grenzen in der Datei /etc/profile<br />
festzulegen. Da die Shell bei<br />
jedem Start auf /etc/profile zugreift,<br />
sobald sich ein Nutzer anmeldet,<br />
haben Sie die Möglichkeit,<br />
dort harte Limits zu setzen,<br />
um die User im Zaum zu halten.<br />
Weiche Limits hingegen darf der<br />
Benutzer individuell nach Bedarf<br />
anpassen – bis zu der Höhe, die<br />
Sie als Administrator für diese Variable<br />
vorgesehen haben.<br />
Grenzen setzen<br />
Ulimit bietet zahlreiche Optionen,<br />
die auf Systemen mit knappen<br />
Ressourcen von Interesse<br />
sind. Bei knappem Festplattenspeicher<br />
beschränken Sie beispielsweise<br />
über die Option ‐c die<br />
Größe der Coredumps sowie über<br />
‐f die maximale Dateigröße, die<br />
eine Shell <strong>und</strong> alle ihre Kindprozesse<br />
schreiben.<br />
Testen einzelne Benutzer experimentelle<br />
Software, ist es mitunter<br />
sinnvoll, das System zu schützen,<br />
indem Sie die maximale Anzahl<br />
an Prozessen (‐u), den CPU-<br />
Verbrauch (‐t) <strong>und</strong> den maximalen<br />
Anteil am Arbeitsspeicher (‐m)<br />
beschränken, damit keine wild gewordenen<br />
Prozesse den Rechner<br />
plötzlich überlasten.<br />
Um die aktuellen Beschränkungen<br />
aufzulisten, verwenden Sie<br />
den Befehl ulimit ‐a (Listing 7). In<br />
der linken Spalte sehen Sie für<br />
jede Option eine kurze Beschreibung,<br />
die dafür zuständige Option<br />
steht in der Mitte, <strong>und</strong> die aktuelle<br />
Grenze rechts. Um sowohl<br />
ein hartes als auch ein weiches Limit<br />
zu setzen, verwenden Sie ulimit<br />
Optionen Grenze. Um nur ein<br />
hartes Limit zu setzen, reicht ‐H,<br />
für weiche Limits ‐S.<br />
Ausmisten<br />
Benutzerkonten unterliegen einem<br />
Lebenszyklus: Früher oder<br />
später müssen Sie unter Umständen<br />
Benutzerkonten aus einem<br />
System wieder entfernen, <strong>und</strong> oft<br />
ist es für alle Beteiligten wünschenswert,<br />
wenn dabei keine<br />
Spuren zurückbleiben. In einem<br />
Unternehmen sollten Sie sich vorab<br />
darüber informieren, welche<br />
Richtlinien bezüglich des Aufbewahrens<br />
von Firmendaten gelten,<br />
<strong>und</strong> sicherstellen, dass Sie alle nötigen<br />
Sicherheitskopien von den<br />
Benutzerdaten anfertigen, bevor<br />
Sie diese endgültig aus dem System<br />
löschen.<br />
52 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen<br />
schwerpunkt<br />
Falls Sie vorhaben, die Daten aufzubewahren,<br />
gilt es, eine Entscheidung<br />
zu treffen, wer die Daten<br />
erhält <strong>und</strong> in welcher Form<br />
Sie sie übergeben – das heißt, ob<br />
es ausreicht, lediglich den Eigentümer<br />
im System zu ändern oder<br />
ob ein Auslagern auf einen Datenträger<br />
<strong>und</strong> die physische Übergabe<br />
erforderlich sind.<br />
Haben Sie diese vorbereitenden<br />
Arbeiten abgeschlossen, ermitteln<br />
Sie im ersten Schritt die UID<br />
<strong>und</strong> die Gruppenmitgliedschaften<br />
des Benutzers. Am einfachsten<br />
erledigen Sie diese einfache Aufgabe<br />
mit dem Befehl id:<br />
# id msimmons<br />
uid=1002(msimmons) gid=1004(msimU<br />
mons) groups=1004(msimmons),37(oU<br />
perator)<br />
Mithilfe dieser Informationen<br />
spüren Sie die Dateien, die sich<br />
im Besitz des Nutzers befinden,<br />
auf allen Dateisystemen auf <strong>und</strong><br />
weisen sie gegebenenfalls anderen<br />
Benutzern zu. Zum Aufspüren<br />
der Daten verwenden Sie find<br />
in Kombination mit der fraglichen<br />
UID:<br />
# find / ‐uid 1002<br />
Sobald Sie das Schicksal der Dateien<br />
des Benutzers geklärt haben,<br />
entfernen Sie das Konto<br />
selbst mit dem Befehl<br />
# /usr/sbin/userdel Benutzername<br />
aus dem System. Mit dem Parameter<br />
‐r löschen dabei Sie automatisch<br />
das dazugehörige Benutzerverzeichnis.<br />
Das Entfernen<br />
der Gruppe des Benutzers klappt<br />
über<br />
# /usr/sbin/groupdel Gruppe<br />
Dieser Befehl entfernt die entsprechende<br />
Zeile in /etc/group,<br />
löscht aber keine Dateien, die mit<br />
dieser Gruppe verknüpft sind.<br />
Die bessere Alternative zum<br />
Handhaben der Dateien stellt der<br />
bereits erwähnte Find-Befehl dar,<br />
bei dem Sie dieses Mal statt ‐uid<br />
den Parameter ‐gid nutzen.<br />
Fazit<br />
Das Verwalten der Benutzerkonten<br />
stellt einen wichtigen Teil des<br />
Linux-Alltags dar. Je vertrauter<br />
Sie mit den Tools sind, desto<br />
mehr steigert sich Ihre Effizienz<br />
<strong>und</strong> Flexibilität. Mit den vorgestellten<br />
Tools verfügen Sie über<br />
eine solide Basis <strong>und</strong> einen gut<br />
sortierten Werkzeugkasten.<br />
Benötigen Sie weitere Informationen<br />
zu diesem Thema, werfen<br />
Sie am besten einen Blick in die<br />
Dokumentation der verschiedenen<br />
Programme. Darüber hinaus<br />
finden Sie im Internet zahlreiche<br />
Workshops <strong>und</strong> Howtos, die Ihnen<br />
beim Verwalten von Benutzerkonten<br />
<strong>und</strong> Gruppen weiterhelfen.<br />
(agr) n<br />
Harte Nuss?<br />
Android 3<br />
Apps entwickeln<br />
Debian GNU/Linux<br />
aktuell zu »Squeeze«<br />
Geknackt!<br />
fauxware, Fotolia<br />
■ Hilfe für Einsteiger<br />
■ Topaktuelle News<br />
■ Riesiges Artikelarchiv<br />
aktuell zu<br />
»Honeycomb«<br />
<strong>und</strong> »Gingerbread«<br />
419 S., 2011, mit DVD, 34,90 €<br />
» www.GalileoComputing.de/2516<br />
Linux-Know-how<br />
Linux-Server einrichten<br />
<strong>und</strong> administrieren<br />
786 S., 4. Auflage 2011, mit DVD, 39,90 €<br />
» www.GalileoComputing.de/2510<br />
www.GalileoComputing.de<br />
Linux-Server<br />
Bestseller!<br />
www.linux-community.de<br />
Deine tägliche Portion Linux<br />
www.linux-user.de<br />
925 S., 2011, mit DVD, 39,90 €<br />
» www.GalileoComputing.de/2443<br />
815 S., 2011, 49,90 €<br />
» www.GalileoComputing.de/2205<br />
10 | 11 53<br />
Wissen, wie’s geht.
praxis<br />
Audacity<br />
So<strong>und</strong>bearbeitung mit Audacity<br />
Schnittmeister<br />
Linux eignet sich hervorragend zum Schneiden<br />
<strong>und</strong> Bearbeiten von So<strong>und</strong>dateien. Mit<br />
Audacity, einem der bekanntesten Audio-<br />
Editoren, peppen Sie Ihre Aufnahmen im<br />
Handumdrehen auf. Florian Effenberger<br />
© Carole Nickerson, sxc.hu<br />
Audacity 1.3.13<br />
LU/audacity/<br />
rEaDME<br />
Audacity ist bei Anfängern<br />
wie Profis beliebt,<br />
denn der unter der GPL<br />
stehende So<strong>und</strong>editor<br />
wartet nicht nur mit<br />
zahlreichen Funktionen<br />
auf, sondern lässt sich<br />
zudem dank Plugin-<br />
Schnittstelle schnell erweitern.<br />
Neben Linux<br />
steht er auch für Mac<br />
OS X <strong>und</strong> Windows zur<br />
Verfügung.<br />
Der So<strong>und</strong>editor Audacity [1]<br />
präsentiert sich aufgeräumt <strong>und</strong><br />
steht auch in deutscher Sprache<br />
zur Verfügung (Abbildung A). Einige<br />
Plugins auf unserem Testsystem<br />
(siehe Kasten Audacity einrichten)<br />
ließen allerdings eine<br />
Lokalisierung vermissen. Direkt<br />
nach dem Programmstart öffnet<br />
sich eine Dialogbox mit Links zu<br />
Dokumentation, Wiki <strong>und</strong> Forum,<br />
die es auch in einer deutschsprachigen<br />
Variante gibt [2]. Schon<br />
ein flüchtiger Blick darauf lässt<br />
erahnen, welche Möglichkeiten in<br />
Audacity schlummern. Im Folgenden<br />
vermitteln wir Ihnen das<br />
Handwerkszeug, um mit Audacity<br />
den eigenen Aufnahmen sprichwörtlich<br />
den Marsch zu blasen.<br />
Allesfresser<br />
Der erste Schritt besteht darin,<br />
das gewünschte Material in Audacity<br />
zu laden, beispielsweise durch<br />
Import – was dank einer Vielzahl<br />
unterstützter Dateiformate keinerlei<br />
Probleme bereitet. WAV,<br />
MP3 <strong>und</strong> Ogg Vorbis [3] öffnet<br />
der So<strong>und</strong>editor problemlos, audiophile<br />
Geister freuen sich über<br />
die jüngst hinzugekommene Unterstützung<br />
für FLAC. Auch zahlreiche<br />
proprietäre Codecs wie<br />
WMA machten im Test keinerlei<br />
Probleme – zumindest, solange<br />
sie frei von DRM sind. Derartige<br />
Formate setzen unter Umständen<br />
aber die Installation zusätzlicher<br />
Bibliotheken voraus. Einschränkungen<br />
gibt es hingegen bei MIDI,<br />
das Audacity zwar importiert,<br />
aber weder abspielt noch speichert<br />
– dafür eignet sich ein sogenannter<br />
Sequencer aber <strong>ohne</strong>hin<br />
besser. Doch ganz gleich, welches<br />
Format Sie öffnen, der Weg ist<br />
immer derselbe: Datei | Import |<br />
Audio… sorgt dafür, dass Audacity<br />
das Material einliest.<br />
Aufwendiger, dafür aber auch<br />
kreativer, ist die Aufnahme eigenen<br />
Materials. Das muss sich<br />
nicht auf das Einsprechen von<br />
Texten per Mikrofon beschränken<br />
– auch lieb gewordene Schätze<br />
von alten Tonbändern, zerkratzten<br />
Schallplatten <strong>und</strong> ausgeleierten<br />
Kassetten lesen Sie ein <strong>und</strong><br />
restaurieren das Material direkt<br />
am PC. Je nach System stehen<br />
mehrere Audioquellen zur Verfügung,<br />
die zunächst ausgewählt<br />
werden wollen, wozu Sie sich der<br />
vier Dropdown-Boxen in der rechten<br />
oberen Fensterhälfte bedienen<br />
(Abbildung B). Auf unserem Testsystem<br />
mit einfacher Onboard-<br />
So<strong>und</strong>karte <strong>und</strong> zwei Eingängen<br />
mussten wir lediglich auf den<br />
auDacity EinrichtEn<br />
Audacity ist Bestandteil nahezu jeder<br />
Linux-Distribution. Auf unserem<br />
Testsystem mit Ubuntu 11.04 genügte<br />
zur Installation das Einrichten<br />
des Pakets audacity. Um MP3-Dateien<br />
zu bearbeiten, installieren Sie<br />
zusätzlich noch die sogenannte<br />
Lame-Bibliothek libmp3lame0. Anschließend<br />
starten Sie Audacity<br />
über den gleichnamigen Eintrag im<br />
Gnome-Menü unter Anwendungen |<br />
Multimedia. Ubuntu liefert die derzeit<br />
aktuelle Beta-Version Audacity<br />
1.3.13 aus, die gegenüber dem stabilen<br />
Release 1.2 zahlreiche neue<br />
Funktionen mit sich bringt <strong>und</strong> deutlich<br />
mehr Formate unterstützt.<br />
56 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Audacity<br />
praxis<br />
Mikrofoneingang umstellen <strong>und</strong><br />
die rote Aufnahmetaste betätigen.<br />
Ob die Signale auch laut <strong>und</strong><br />
deutlich ankommen, das sehen<br />
Sie sowohl in der Spuranzeige als<br />
auch in der oben mittig platzierten<br />
Aussteuerungsanzeige (Abbildung<br />
C). Zum Justieren des Signals<br />
dienen die Schieber oben<br />
rechts im Programmfenster: Sie<br />
regeln die Lautstärke sowohl der<br />
Aufnahme als auch der Wiedergabe.<br />
Durch einen Klick auf den kleinen<br />
Pfeil unterhalb der Aussteuerungsanzeige<br />
<strong>und</strong> die Wahl der<br />
Option Aussteuerungsanzeige aktivieren<br />
starten Sie einen Monitormodus,<br />
der auch <strong>ohne</strong> laufende<br />
Aufnahme den jeweiligen Pegel<br />
anzeigt – wer häufig Live-Aufnahmen<br />
macht, der weiß, wie hilfreich<br />
das sein kann.<br />
Auf der richtigen Spur<br />
Die soeben gestartete Aufnahme<br />
läuft nun so lange, bis Sie den gelben<br />
Stopp-Knopf drücken. Um die<br />
Schneidearbeit zu minimieren,<br />
können Sie den Mitschnitt auch<br />
unterbrechen – beispielsweise für<br />
den Seitenwechsel von Schallplatten<br />
oder aber für längere Pausen<br />
in einer Live-Aufnahme. Dazu<br />
dient naheliegenderweise die<br />
blaue Pause-Taste. Um die Aufnahme<br />
wieder fortzusetzen, klicken<br />
Sie erneut darauf. Haben Sie<br />
versehentlich doch auf Stopp geklickt,<br />
gibt es noch einen Trick:<br />
Drücken Sie gleichzeitig die Umschalt-<br />
<strong>und</strong> die rote Aufnahme-<br />
Taste, denn auch das setzt den<br />
Mitschnitt fort.<br />
Doch warum ist die Umschalttaste<br />
überhaupt erforderlich? Das<br />
liegt in einem weiteren Feature<br />
von Audacity begründet, nämlich<br />
der Möglichkeit, mit mehreren<br />
Spuren zu arbeiten. Probieren Sie<br />
es einmal aus: Nehmen Sie einen<br />
Text auf, klicken Sie auf Stopp,<br />
<strong>und</strong> drücken danach erneut die<br />
Aufnahmetaste – diesmal jedoch<br />
<strong>ohne</strong> [Umschalt]. Diese zweite<br />
Aufnahme wird nicht etwa zum<br />
vorherigen Bereich hinzugefügt,<br />
sondern als zweite Spur angelegt.<br />
Der Clou dabei: Während die neue<br />
Aufnahme läuft, spielt Audacity<br />
die bestehenden Spuren ab. Was<br />
zunächst verwirrend klingen mag,<br />
hat einen handfesten Nutzen:<br />
Wer beispielsweise schon immer<br />
mal sein Interpretationstalent à la<br />
Bobby McFerrin („Don’t worry, be<br />
happy“) unter Beweis stellen wollte,<br />
wer Aufnahmen mit einer<br />
Kommentarspur versehen will,<br />
oder wer Hörspiele <strong>und</strong> Dialoge<br />
mit verschiedenen Sprechern aufnimmt,<br />
der weiß die Mehrspurfunktionalität<br />
zu schätzen.<br />
Was früher teurer Luxus gehobener<br />
Rekorder war, ist jetzt direkt<br />
am heimischen PC möglich: Jede<br />
Spur wird separat eingesprochen<br />
<strong>und</strong> am Schluss als eine Datei<br />
exportiert. Diese Wiedergabefunktion<br />
lässt sich übrigens im Transport-Menü<br />
deaktivieren. Dort finden<br />
Sie auch weitere Aufnahmemöglichkeiten,<br />
beispielsweise einen<br />
zeitgesteuerten Mitschnitt<br />
oder die Möglichkeit, automatisch<br />
bei Erreichen eines bestimmten<br />
Lautstärkepegels aufzunehmen.<br />
Überhaupt erweisen sich die<br />
Spuren als sehr mächtiges Werkzeug.<br />
Audacity zeigt jede separat<br />
an, markiert die aktuell ausgewählte<br />
mit einem gelben Rahmen,<br />
<strong>und</strong> gibt dem Tonmeister auf der<br />
linken Seite zahlreiche Kontrollelemente<br />
an die Hand. Ein Klick<br />
auf den Pfeil neben Tonspur öffnet<br />
ein Kontextmenü mit zahlreichen<br />
Optionen. Darin geben Sie jeder<br />
Spur bei Bedarf einen eigenen Namen<br />
– in unserem Beispiel (Abbildung<br />
D) die der Sprecher Erwin<br />
<strong>und</strong> Fred – verschieben sie nach<br />
oben oder unten, <strong>und</strong> wählen die<br />
Art der Tondarstellung. Zusätzlich<br />
bietet Audacity auch die Möglichkeit,<br />
das Sampleformat <strong>und</strong> die<br />
Samplerate anzupassen <strong>und</strong> verschiedene<br />
Spuren, beispielsweise<br />
von zwei Mikrofonen, zu einer<br />
Stereospur zusammenzufassen<br />
<strong>und</strong> wieder zu trennen.<br />
Zur besseren Kontrolle schalten<br />
Sie einzelne Aufnahmen über die<br />
gleichnamige Schaltfläche Stumm<br />
oder reduzieren die Wiedergabe<br />
mittels Solo auf eine ganz bestimmte<br />
Tonspur. Diese Technik<br />
hilft beispielsweise bei Liveaufnahmen<br />
dabei, den Applaus des<br />
Publikums auszublenden oder<br />
einzelne Instrumente gesondert<br />
zu hören. Zusätzlich stellen Sie<br />
über die entsprechenden Regler<br />
sowohl die Balance als auch die<br />
Lautstärke jeder einzelnen Spur<br />
für die Wiedergabe<br />
separat<br />
ein.<br />
A Trotz zahlreicher<br />
Funktionen präsentiert<br />
sich Audacity sehr aufgeräumt<br />
<strong>und</strong> übersichtlich.<br />
B Die Zahl der möglichen<br />
Audioquellen<br />
kann manchmal ganz<br />
schön verwirren.<br />
tipp<br />
Audacity konvertieren<br />
Sie mit wenigen<br />
Handgriffen sogar zu<br />
einer portablen Version<br />
für den USB-<br />
Stick. Ein Eintrag im<br />
offiziellen Wiki verrät,<br />
wie’s geht [7].<br />
C Die Aussteuerungsanzeige<br />
sollten Sie immer<br />
im Blick haben.<br />
D Spuren sind das<br />
zentrale Element jeder<br />
Audiobearbeitung.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 57
praxis<br />
Audacity<br />
E Die Zoomwerkzeuge<br />
erleichtern<br />
die Navigation in der<br />
Aufnahme.<br />
Arbeiten Sie mit mehreren Spuren,<br />
dann klappen Sie gerade<br />
nicht benötigte Mitschnitte einfach<br />
über den unteren Pfeil ein.<br />
Misslungene Aufnahmen befördert<br />
ein Klick auf das X gleich<br />
ganz ins Nirwana.<br />
F Was Nadel <strong>und</strong> Faden für<br />
den Schneider, das sind<br />
diese Funktionen für den<br />
Tonmeister.<br />
Tapferes Schneiderlein<br />
Sind die verschiedenen Spuren im<br />
Programm, dann geht es ans Eingemachte,<br />
das eigentliche Bearbeiten<br />
der Aufnahme, wofür Audacity<br />
komfortable Editierwerkzeuge<br />
zur Verfügung stellt. Einfachste<br />
Übung: Der Schnitt des<br />
Materials, mit dem Sie zu lange<br />
Pausen, unnütze Stille am Anfang<br />
oder auch missglückte Passagen<br />
einfach entfernen.<br />
In der Aufnahme navigieren Sie<br />
mit einem sogenannten Marker,<br />
einer grauen, vertikalen Linie,<br />
welche die aktuelle Position in der<br />
Datei verrät. Mit ihr legen Sie<br />
auch die Zielposition für den Einfügen-Befehl<br />
fest. Um den Marker<br />
zu setzen, klicken Sie an die gewünschte<br />
Stelle in der Spur. Bei<br />
einem Klick auf das Play-Symbol<br />
oder einem Druck auf die Leertaste<br />
spielt Audacity den Track nicht<br />
mehr von Anfang an ab, sondern<br />
jeweils von der gerade gewählten<br />
Position aus. Da der Marker nicht<br />
automatisch mitwandert, startet<br />
auch ein erneuter Klick auf die<br />
Play-Taste die Aufnahme wieder<br />
von der gewünschten Position –<br />
ideal, um bestimmte Stellen<br />
mehrfach Probe zu hören.<br />
Markieren Sie einen Bereich<br />
mittels gedrückter linker Maustaste,<br />
hinterlegt der Editor ihn<br />
dunkelblau <strong>und</strong> markiert ihn somit.<br />
Alle Aktionen – wie Ausschneiden,<br />
Kopieren oder das Zuweisen<br />
von Effekten – beziehen<br />
sich dann nur noch auf diese Auswahl<br />
<strong>und</strong> nicht mehr auf die gesamte<br />
Datei. Das<br />
gilt auch für die<br />
Wiedergabe, die bei<br />
einer Markierung<br />
nur den jeweiligen<br />
Bereich abspielt.<br />
Zur genauen Kontrolle<br />
nutzen Sie den sogenannten<br />
Loop-Modus, also das Abspielen<br />
in einer Dauerschleife. Dazu klicken<br />
Sie mit gedrückter Umschalttaste<br />
auf das Play-Symbol,<br />
<strong>und</strong> Audacity spielt den gewählten<br />
Bereich so lange, bis Sie die<br />
Wiedergabe abbrechen.<br />
Die gesamte Spur markieren Sie<br />
bei Bedarf durch einen Klick ins<br />
Kontrollelement auf der linken<br />
Seite, mehrere Spuren durch Halten<br />
der Umschalttaste <strong>und</strong> einen<br />
Klick ins jeweilige Kontrollelement.<br />
Praktisch ist auch die<br />
Schnellvorschau: Drücken Sie auf<br />
der Tastatur [1], dann spielt Audacity<br />
ab Marker beziehungsweise<br />
Mausposition eine Sek<strong>und</strong>e des<br />
aktuellen Projekts ab.<br />
Je länger die Aufnahme ausfällt,<br />
desto ungenauer ist die Darstellung<br />
selbst bei hoher Auflösung,<br />
da der Editor standardmäßig die<br />
komplette Spur anzeigt. Um genauer<br />
zu arbeiten, nutzen Sie die<br />
Zoom-Werkzeuge (Abbildung E),<br />
um den angezeigten Bereich anzupassen.<br />
Neben einer Funktion<br />
zum Vergrößern <strong>und</strong> Verkleinern<br />
passen Sie auch die gesamte Datei<br />
ins Fenster ein, alternativ stellen<br />
Sie nur die aktuelle Auswahl in<br />
voller Breite dar.<br />
So gerüstet, geht es nun ans eigentliche<br />
Schneiden. Markieren<br />
Sie den gewünschten Bereich <strong>und</strong><br />
klicken Sie das entsprechende<br />
Werkzeug an (Abbildung F). Ausschneiden,<br />
Kopieren <strong>und</strong> Einfügen<br />
sind selbsterklärend <strong>und</strong> funktionieren<br />
wie in jeder Textverarbeitung.<br />
Mit Stille setzen Sie die<br />
Lautstärke des gewählten Bereichs<br />
auf null. Über die praktische<br />
Funktion Zuschneiden entfernen<br />
Sie alle Bereiche außer dem<br />
aktuell gewählten – ideal, um aus<br />
einem längeren Radio-Mitschnitt<br />
genau ein Lied zu sichern.<br />
Um Daten aus der aktuellen Spur<br />
in eine neue zu überführen, gibt<br />
es ebenfalls zwei Funktionen: Mit<br />
Bearbeiten | In neue Tonspur kopieren<br />
kopieren Sie die aktuelle Auswahl<br />
in eine zusätzliche Spur, um<br />
daran beispielsweise Effekte zu<br />
testen. Ähnlich arbeitet Bearbeiten<br />
| In neue Tonspur verschieben,<br />
das den ausgewählten Bereich jedoch<br />
nicht dupliziert, sondern<br />
stattdessen nur verschiebt. Wer<br />
einen Blick ins Bearbeiten-Menü<br />
wagt, der sieht schnell, dass dort<br />
noch weitere Funktionen zur Verfügung<br />
stehen. Das deutschsprachige<br />
Audacity-Handbuch [4],<br />
wenn auch schon etwas in die<br />
Jahre gekommen, verrät dazu<br />
noch mehr Kniffe sowie eine<br />
Technik, wie Sie mit mehreren<br />
Spuren effizient schneiden.<br />
Effekthascherei<br />
Haben Sie die Aufnahme nach<br />
Ihren Wünschen zugeschnitten,<br />
verleihen Sie ihr mit einem der<br />
zahlreichen Effekte den nötigen<br />
Feinschliff. Das Angebot reicht<br />
dabei von einfachen Standards<br />
über Restaurationswerkzeuge bis<br />
hin zu komplexen Spezialfiltern.<br />
Einen guten Einstieg bietet das<br />
sogenannte Ein- <strong>und</strong> Ausblenden,<br />
das den vorher vorgenommenen<br />
Schnitt perfekt ergänzt. Mit dieser<br />
Funktion sorgen Sie dafür,<br />
dass Ihre Aufnahme am Anfang<br />
langsam an Lautstärke gewinnt<br />
<strong>und</strong> am Schluss die Lautstärke<br />
sanft zurückgefahren wird.<br />
Dazu markieren Sie etwa ein bis<br />
zwei Sek<strong>und</strong>en (Abbildung G) am<br />
Anfang der Aufnahme, wodurch<br />
Audacity diesen Bereich blau hinterlegt.<br />
Anschließend wählen Sie<br />
im Menü Effekte die Funktion<br />
Einblenden, woraufhin kurze Zeit<br />
später die Änderung der Lautstärke<br />
in der Spur sichtbar wird (Abbildung<br />
H). Analog markieren Sie<br />
ein bis zwei Sek<strong>und</strong>en am Ende<br />
der Aufnahme <strong>und</strong> wählen Effekte<br />
| Ausblenden.<br />
Das Menü Effekte bildet den<br />
Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt zum Aufpeppen<br />
Ihrer Aufnahme. Im Test<br />
58 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Audacity<br />
praxis<br />
G Im Editorfenster zeigt Audacity die jeweilige Dauer der Aufnahme an.<br />
präsentierte Audacity hier mehr<br />
als 30 Einträge (Abbildung I).<br />
Neben Klassikern wie Bassverstärkung,<br />
Echo, Phaser <strong>und</strong> Wahwah-Effekt<br />
bietet der digitale<br />
Werkzeugkasten auch wichtige<br />
Hilfsmittel wie etwa eine Rauschentfernung,<br />
die alte Schallplattenaufnahmen<br />
in ein besseres<br />
Licht rückt. Auch die Geschwindigkeit<br />
der Aufnahme sowie deren<br />
Tonhöhe passen Sie mit ein<br />
paar Klicks an, <strong>und</strong> zu guter Letzt<br />
sorgen Sie mit der Normalisieren-<br />
Funktion für ein einheitliches<br />
Lautstärkeverhalten.<br />
Der einzige Nachteil besteht darin,<br />
dass Sie Effekte nicht „live“<br />
zuschalten können, da deren Berechnung<br />
einiges an Zeit in Anspruch<br />
nimmt. Allerdings bieten<br />
die meisten Optionen eine Kurzvorschau,<br />
mit der der gewünschte<br />
Effekt auf die aktuelle Passage<br />
vorgeschaut wird.<br />
Eine Frage des Formats<br />
Ist die Aufnahme perfekt, geht es<br />
ans Speichern. Im Gegensatz zu<br />
anderen Programmen verändert<br />
Audacity die Originaldatei auf der<br />
Festplatte nicht. Die Funktion<br />
Projekt speichern im Datei-Menü<br />
erzeugt vielmehr ein File mit der<br />
Endung .aup – ein Audacity-eigenes<br />
Format samt separatem Datenverzeichnis<br />
mit der Endung<br />
_data. In der Standardkonfiguration<br />
enthält es alle relevanten Einstellungen<br />
sowie die einzelnen<br />
Spuren. Audacity nutzt es zur<br />
weiteren Bearbeitung, es kann<br />
aber von so gut wie keinem anderen<br />
Programm abgespielt werden.<br />
Das Pendant dazu ist der Export<br />
in eines der unterstützten Audioformate<br />
wie etwa MP3 oder Ogg<br />
Vorbis, den Sie über Datei | Exportieren…<br />
aufrufen. Das funktioniert<br />
prinzipiell ähnlich wie bei<br />
Grafikprogrammen, wo die exportierten<br />
Bilder lediglich die Grafikdaten<br />
enthalten, während das<br />
programmeigene Format verschiedene<br />
Ebenen, Bearbeitungsschritte<br />
<strong>und</strong> mehr unterstützt.<br />
Ganz ähnlich verhält es sich mit<br />
Audacity: Beim Export beispielsweise<br />
ins MP3-Format fasst es<br />
sämtliche Spuren zu einer zusammen<br />
<strong>und</strong> entfernt die Spurnamen<br />
– für das Weiterbearbeiten denkbar<br />
ungeeignet. Als Faustregel<br />
gilt daher: Eine Kopie für die weitere<br />
Bearbeitung im AUP-Format<br />
aufbewahren, zur Weitergabe am<br />
besten nach Ogg Vorbis exportieren.<br />
Praktisch ist die Funktion,<br />
eine markierte Auswahl zu exportieren,<br />
die Sie ebenfalls im Menü<br />
Datei finden. Auf diese Weise sichern<br />
Sie beispielsweise jedes<br />
Lied eines Live-Konzerts in eine<br />
separate Datei. Noch komfortabler<br />
funktioniert die Angelegenheit<br />
mit sogenannten Schnittpunkten,<br />
die das Audacity-Wiki<br />
ausführlich dokumentiert [5].<br />
Vor dem Speichern bietet es sich<br />
an, zur besseren Inventarisierung<br />
die sogenannten Metadaten zu<br />
bearbeiten, die Sie unter Datei |<br />
Metadaten-Editor… finden. Dort<br />
hinterlegen Sie Titel, Interpret,<br />
Album <strong>und</strong> weitere Informationen,<br />
die Audacity dann beispielsweise<br />
auch in die ID3-Tags von<br />
MP3-Dateien übernimmt.<br />
info<br />
[1] Audacity: http:// audacity. sourceforge. net<br />
[2] Deutschsprachige Hilfe: http:// wiki.<br />
audacityteam. org/ wiki/ German_Information<br />
[3] Multimediaformate: Florian Effenberger,<br />
„Wald der Formate“, LU 08/ 2011, S. 78,<br />
http:// www. linux-community. de/ 22953<br />
[4] Deutschsprachiges Handbuch:<br />
http:// www. audacity-forum. de/ download/ Au<br />
dacity-Handbuch-deutsch-23-Jan-2005. pdf<br />
[5] Aufteilen von Dateien mit Schnittpunkten:<br />
http:// audacity. sourceforge. net/ de/ docs/<br />
schneiden/<br />
[6] Informationen zu Plugins: http:// audacity.<br />
sourceforge. net/ download/ plugins<br />
[7] Portable Version erzeugen: http:// wiki.<br />
audacityteam. org/ wiki/ Portable_Audacity<br />
Fazit<br />
Dieser Artikel kann nur einen<br />
Ein blick in die Möglichkeiten von<br />
Audacity geben. Trotz der Funktionsvielfalt<br />
lässt sich das Programm<br />
einfach bedienen, auch<br />
Neulinge kommen schnell zu<br />
brauchbaren Ergebnissen. Studiomusiker,<br />
die teure proprietäre<br />
Software gewohnt sind, vermissen<br />
sicher einige Funktionen, aber<br />
für semiprofessionelle Anwender<br />
reicht Audacity völlig aus. Zudem<br />
gibt es zahlreiche Plugins mit Zusätzfunktionen,<br />
die sich in der Regel<br />
durch einfaches Kopieren installieren<br />
lassen [6]. Vor dem Einstieg<br />
in Audacity sollten Sie die<br />
reichhaltige Dokumentation studieren,<br />
die viele Tipps <strong>und</strong> Tricks<br />
bereithält <strong>und</strong> erklärt, wie Sie mit<br />
Audacity auch an großen Projekten<br />
effektiv arbeiten. (jlu) n<br />
H So sieht eine ein<strong>und</strong><br />
ausgeblendete<br />
Aufnahme im Editor<br />
aus.<br />
I Audacity bringt<br />
schon von Haus aus<br />
zahlreiche Filter <strong>und</strong><br />
Effekte mit.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 59
praxis<br />
GCStar<br />
© Sascha Hofmann, sxc.hu<br />
Sammlungen mit GCStar verwalten<br />
Schätze im Blick<br />
Dank GCStar<br />
verwalten Jäger<br />
<strong>und</strong> Sammler mit<br />
einem einfach zu<br />
benutzenden<br />
Werkzeug komfortabel<br />
die gehorteten<br />
Schätze.<br />
Falko Benthin<br />
rEaDME<br />
GCStar erlaubt das<br />
komfortable Verwalten<br />
umfangreicher Sammlungen.<br />
Dazu bringt es<br />
eine ganze Reihe vordefinierter<br />
Sammlungstypen<br />
mit, die einen<br />
schnellen Einstieg erlauben.<br />
Daneben lassen<br />
sich auch eigene<br />
Typen definieren.<br />
Tassen, Briefmarken, Kaffeemühlen,<br />
Ü-Ei-Figuren, Münzen,<br />
Bücher, CDs, DVDs … im Laufe<br />
eines Sammlerlebens häuft sich<br />
so einiges an. Überschreiten die<br />
gehorteten Schätze eine kritische<br />
Menge, fällt es immer schwerer,<br />
den Überblick zu behalten. Profi-<br />
„Sammler“ wie Bibliotheken <strong>und</strong><br />
Museen helfen sich da mit aufgefeilten<br />
Kataloganwendungen wie<br />
CollectiveAccess, KoHa oder Evergreen<br />
– solche Programme sind<br />
für den Hobbysammler in den<br />
meisten Fällen zu umfangreich.<br />
Doch unter Linux laufen auch viele<br />
einfachere Programme, die Jäger<br />
<strong>und</strong> Sammler dabei unterstützen,<br />
ihre Bestände zu katalogisieren<br />
<strong>und</strong> so den Überblick zu bewahren.<br />
Zu dieser Riege zählt<br />
auch GCStar [1].<br />
Das Programm eignet sich als<br />
Verwaltungsassistent für eine<br />
Vielzahl von Leidenschaften, bei<br />
denen man Dinge anhäuft. Neben<br />
Sammelklassikern wie Büchern,<br />
CDs <strong>und</strong> Videos lässt es sich auch<br />
für Brettspiele, Weine, Stempel<br />
oder Modellautos nutzen. Sammler,<br />
die sich auf andere Gegenstände<br />
konzentrieren, legen dazu<br />
eigene, angepasste Kataloge an.<br />
Falls Sie bereits eine Sammlungsverwaltung<br />
wie Tellico ([2],[3]),<br />
Alexandria [4] oder MyMovies [5]<br />
genutzt haben, können Sie entsprechende<br />
Sammlungen in die<br />
Software importieren. Das Programm<br />
hilft nicht nur, Bestandteile<br />
einer Sammlung zu verwalten,<br />
sondern lässt sich auch nutzen,<br />
um zu dokumentieren, wenn<br />
Sie etwas verleihen.<br />
GCStar einrichten<br />
GCStar steht unter der GPL <strong>und</strong><br />
basiert auf Perl <strong>und</strong> Gtk2. In vielen<br />
Fällen hält die distributionseigene<br />
Paketverwaltung das Programm<br />
vor. Möchten Sie aber die<br />
aktuellste Version 1.6.2 einsetzen,<br />
kommen Sie nicht um die Installation<br />
aus den Quellen herum.<br />
Dazu laden Sie den Tarball [6] herunter<br />
<strong>und</strong> entpacken ihn mittels<br />
$ tar ‐xzf gcstar‐1.6.2.tar.gz<br />
An Abhängigkeiten benötigt das<br />
Programm Gtk2, Perl <strong>und</strong> Gtk2-<br />
perl. Zum Einrichten stehen drei<br />
Wege zur Auswahl – Grafik- (./install)<br />
<strong>und</strong> Textmodus (./install<br />
‐‐text) sowie automatisch:<br />
# ./install ‐‐prefix=/Ziel<br />
Bei Letzterem bestimmen Sie mit<br />
dem Parameter ‐‐prefix das Zielverzeichnis.<br />
Läuft die Installation<br />
A Für viele Sammelgebiete bietet<br />
das Programm GCStar bereits vorgefertige<br />
Sammlungen.<br />
60 10 | 11<br />
www.linux-user.de
GCStar<br />
praxis<br />
B GCStar nimmt Daten<br />
in übersichtlichen<br />
Masken entgegen.<br />
GCStar 1.6.2<br />
LU/gcstar/<br />
fehlerfrei durch, starten Sie die<br />
Sammlungsverwaltung anschließend<br />
mit /Ziel/bin/gcstar.<br />
Erste Schritte<br />
Nach dem Start bietet GCStar<br />
Vorlagen für verschiedene Sammelgebiete<br />
an (Abbildung A). Alternativ<br />
importieren Sie eine bestehende<br />
Sammlung oder legen<br />
einen Sammlungstyp nach eigenen<br />
Vorstellungen an. Um eine<br />
private Bibliothek zu verwalten,<br />
bietet sich die Büchersammlung<br />
an. Der Sammlungstyp enthält<br />
bereits alle relevanten Datenfelder<br />
für Titel, ISBN-Nummer, Autoren<br />
<strong>und</strong> so weiter, sodass Sie<br />
keine weiteren Anpassungen vornehmen<br />
müssen.<br />
Haben Sie den Sammlungstyp<br />
ausgewählt, öffnet GCStar bereits<br />
eine Eingabemaske, in die Sie alle<br />
erforderlichen Informationen<br />
eingegeben können (Abbildung<br />
B). In einer Büchersammlung<br />
sind die ersten beiden unbeschrifteten<br />
Felder des Reiters Allgemein<br />
für ISBN <strong>und</strong> Titel vorgesehen,<br />
bei allen anderen Feldern<br />
gibt GCStar an, welche Daten es<br />
erwartet. Das Erscheinungsdatum<br />
geben Sie entweder direkt im<br />
Format TT/ MM/ JJJJ ein oder<br />
nutzen dazu den grafischen Dialog<br />
Wählen Sie ein Datum. Die Cover-Ansicht<br />
eines Buches hinterlegen<br />
Sie, indem Sie das zugehörige<br />
Feld in der Maske mit der rechten<br />
Maustaste anklicken.<br />
Neben dem Reiter Allgemein, der<br />
außer Titel <strong>und</strong> ISBN auch Genre,<br />
Autoren, Sprache, Seitenanzahl<br />
<strong>und</strong> Beschreibung eines Werkes<br />
abfragt, existieren noch Tabs für<br />
Details, Bemerkungen zu einem<br />
eventuellen Verleih <strong>und</strong> Markierungen.<br />
In der Detailansicht hinterlegen<br />
Sie Daten zur Auflage<br />
des Werkes sowie wann Sie das<br />
Buch erworben haben<br />
<strong>und</strong> wie es Ihnen<br />
gefallen hat.<br />
Die Markierungen<br />
dienen der Verschlagwortung,<br />
sodass<br />
Sie später auch<br />
thematisch nach einem<br />
Buch suchen<br />
können. Für Werte,<br />
die häufiger auftreten,<br />
bietet GCStar<br />
beim Erfassen Dropdown-Listen<br />
an, die<br />
sich mit der Zeit füllen.<br />
So sparen Sie<br />
jede Menge Tipparbeit, beispielsweise<br />
bei Autoren, Verlagen, Genres<br />
<strong>und</strong> Markierungen.<br />
Internetsuche<br />
Umfangreiche Büchersammlungen<br />
zu katalogisieren, kann ein<br />
zeitraubendes Unterfangen sein.<br />
Um Zeit zu sparen, bietet GCStar<br />
eine Importfunktion, mit deren<br />
Hilfe die Anwendung einen großen<br />
Teil der benötigten Daten<br />
automatisch ausfüllt. Dazu greift<br />
GCStar auf die Datenbanken verschiedener<br />
Anbieter zurück,<br />
da runter Amazon, Bol, ISBNdb,<br />
Merlin <strong>und</strong> andere mehr (Abbil-<br />
C Die Internetsuche<br />
ruft viele Daten aus<br />
Datenbanken großer<br />
Anbieter ab.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 61
praxis<br />
GCStar<br />
D Erzielt die Suche im<br />
Internet mehrere Treffer,<br />
müssen Sie entscheiden,<br />
welchen<br />
Sie letztendlich<br />
übernehmen.<br />
F Ausgefeilte Filter<br />
machen das Auffinden<br />
einzelner Einträge<br />
zum Kinderspiel.<br />
dung C, vorherige Seite). Die Angabe<br />
des Titels, der ISBN oder des<br />
Autors genügen, um sich dann<br />
mit etwas Glück durch den Klick<br />
auf den Button Internetsuche viel<br />
Tipperei zu ersparen.<br />
War die Suche erfolgreich, listet<br />
GCStar alle infrage kommenden<br />
Titel auf, sofern mehrere Werke<br />
den Suchkriterien entsprechen<br />
(Abbildung D). Sie können die zugehörigen<br />
Daten sofort importieren<br />
oder sich eine <strong>Vorschau</strong> anzeigen<br />
lassen, um zu prüfen, ob<br />
es sich bei dem ausgewählten Titel<br />
wirklich um das gewünschte<br />
Werk handelt. Nach einer Übernahme<br />
der Daten genügen – je<br />
nach Datenbank – meist wenige<br />
zusätzliche Informationen per<br />
Hand, um den GCStar-Eintrag zu<br />
komplettieren.<br />
Anfragen nach fremdsprachigen<br />
Titeln verliefen bei Amazon<br />
Deutschland meist im Sande –<br />
hier ziehen Sie am besten gleich<br />
einen entsprechenden Anbieter<br />
im Ausland für die Suche heran.<br />
Auch eine nur auf einem Titel basierende<br />
Anfrage führt nicht immer<br />
zum gewünschten Ergebnis:<br />
Schon ein Tippfehler oder ein nur<br />
teilweise eingegebener Titel sorgen<br />
oft dafür, dass die Suche keinen<br />
Treffer liefert. Basiert die Suche<br />
auf der ISBN-13, werden die<br />
Daten in der Regel problemlos gef<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> sofort geladen.<br />
Verleih<br />
Gerade die Bestandteile privater<br />
Bibliotheken sowie CDs <strong>und</strong><br />
DVDs werden hin <strong>und</strong> wieder verliehen.<br />
GCStar bietet hierfür ein<br />
rudimentäres Management, das<br />
sich hinter dem Reiter Verleih verbirgt.<br />
Hier lassen sich nicht nur<br />
Entleiher <strong>und</strong> Verleihdatum festhalten,<br />
sondern auch eine Erinnerungsmail<br />
versenden <strong>und</strong> eine<br />
Verleihhistorie anzeigen (Abbildung<br />
E). Entleiher <strong>und</strong> der Text<br />
der Erinnerungsnachricht<br />
hinterlegen<br />
Sie unter<br />
Einstellungen<br />
|<br />
Entleiher<br />
<strong>und</strong> greifen<br />
so später<br />
schnell darauf<br />
zurück.<br />
Um sofort<br />
zu sehen,<br />
was noch so<br />
alles im Bekanntenuniversum<br />
herumschwirrt,<br />
genügt ein Klick auf<br />
Datei | Verliehenes anzeigen.<br />
Filter<br />
Je umfangreicher eine Bibliothek<br />
ausfällt, desto schwieriger wird<br />
es, einzelne Bücher wiederzufinden.<br />
Vor allem, wenn einem Titel<br />
<strong>und</strong> Autor gerade partout nicht<br />
einfallen wollen, erweisen sich<br />
Filterfunktionen als überaus hilfreich.<br />
Solche bietet GCStar zuhauf<br />
<strong>und</strong> ordnet ihnen einen eigenen<br />
Menüpunkt zu. Er erlaubt<br />
es, die Bibliothek im Handumdrehen<br />
nach Autoren, Verlagen,<br />
Sprachen, Genre oder Markierungen<br />
zu filtern.<br />
Etwas granularer gestaltet sich<br />
das Filtern über die Suche. Die<br />
Standardsuche ermöglicht es bereits,<br />
den Bestand nach Wörtern<br />
im Titel oder nach ISBNs zu<br />
durchsuchen. Weiterhin können<br />
Sie angeben, ob GCStar nur Werke<br />
auflisten soll, die bereits gelesen,<br />
ab einem bestimmten Datum<br />
erworben oder mit einer Mindestpunktzahl<br />
bewertet wurden<br />
(Abbildung F).<br />
Noch mehr Möglichkeiten bietet<br />
die Erweiterte Suche, mit deren<br />
Hilfe Sie die Einträge nach beliebigen<br />
Kriterien durchsuchen beziehungsweise<br />
eine große Anzahl<br />
von Suchmerkmalen kombinieren,<br />
um die Ergebnisliste so weit<br />
wie möglich einzuschränken. Mit<br />
der erweiterten Suche durchforsten<br />
Sie beispielsweise auch die<br />
Beschreibungen <strong>und</strong> Kommentare<br />
zu einzelnen Werken oder merken<br />
alle Titel vor, die schon einmal<br />
an einen bestimmten Entleiher<br />
gingen (Abbildung G).<br />
info<br />
[1] GCStar: http:// www. gcstar. org<br />
[2] Tellico: http:// tellico-project. org/<br />
[3] Tellico-Workshop: Mirko Albrecht, „Ordnung!“,<br />
LU 05/ 2008, S. 54,<br />
http:// www. linux-community. de/ 15472<br />
[4] Alexandria: http:// alexandria. rubyforge. org<br />
[5] MyMovies: http:// www. mymovies. dk<br />
[6] GCStar herunterladen:<br />
http:// download. gna. org/ gcstar/<br />
62 10 | 11<br />
www.linux-user.de
GCStar<br />
praxis<br />
Nicht unbedingt nötig, aber<br />
mitunter recht nützlich sind<br />
die mit GCStar möglichen<br />
Statistischen Auswertungen,<br />
die Sie unter dem Menüpunkt<br />
Datei finden. Damit<br />
stellen Sie schnell fest, wie<br />
viele Werke zu welchen Genres<br />
zählen, welche Sprache<br />
in der Bibliothek dominiert<br />
oder von welchem Verlag die<br />
meisten Bücher kommen<br />
(Abbildung H). Ob Statistiken<br />
sinnvoll sind, die auf<br />
Beschreibung, ISBN oder<br />
Erscheinungsdatum basieren,<br />
muss allerdings jeder<br />
für sich entscheiden.<br />
Ein ebenfalls verzichtbares, aber<br />
witziges Feature stellt der Button<br />
Heute Abend dar. Können Sie sich<br />
nicht so recht entscheiden, was<br />
als nächste Lektüre ansteht,<br />
nimmt dieser Schalter die Entscheidung<br />
zufallsbasiert ab. Dabei<br />
berücksichtigt die Auswahl nur<br />
solche Werke, die Sie laut Eintrag<br />
noch nicht gelesen haben – es<br />
lohnt sich also, diszipliniert das<br />
entsprechende Häkchen unter<br />
Details zu setzen.<br />
Export<br />
Neben den bereits erwähnten<br />
Features verfügt GCStar auch<br />
über umfangreiche Export-Funktionen,<br />
sodass Sie keineswegs<br />
zwingend für den Rest Ihrer Tage<br />
mit GCStar arbeiten müssen, nur<br />
weil Sie der Anwendung die kompletten<br />
Informationen zu einer<br />
Sammlung anvertraut haben. So<br />
sollte es problemlos möglich sein,<br />
auf Tellico auszuweichen. Eine<br />
Migration zu anderen Programmen<br />
mit den Exportformaten<br />
CSV, XML <strong>und</strong> SQL gestaltet sich<br />
etwas aufwendiger, ist aber immer<br />
noch angenehmer, als sämtliche<br />
Daten neu einzugeben.<br />
Fazit<br />
Mit GCStar haben Jäger <strong>und</strong><br />
Sammler ein einfach zu benutzendes<br />
Werkzeug an der Hand,<br />
um die gehorteten Schätze komfortabel<br />
zu verwalten. Die vorgefertigten<br />
Typen für weit verbreitete<br />
Sammelbereiche ermöglichen<br />
einen schnellen Start. GCStar<br />
lässt sich intuitiv bedienen <strong>und</strong><br />
konzentriert sich im Funktionsaufwand<br />
auf das Wesentliche, sodass<br />
auch Neulinge schnell mit<br />
dem Programm zurechtkommen.<br />
Poweruser werden Tastenkürzel<br />
für einzelne Funktionen vermissen<br />
– aber für Menschen, die tagtäglich<br />
ganze Wagenladungen<br />
Neuerwerbungen heranschleppen,<br />
gibt es sicherlich bessere Lösungen<br />
als das vorliegende Programm.<br />
Für den normalen Sammler<br />
bietet GCStar alles Notwendige,<br />
selbst wenn die Sammlung aus<br />
mehreren h<strong>und</strong>ert oder tausend<br />
Stücken besteht. (jlu) n<br />
E Das Verleihfeature<br />
hilft, Verliehenes im<br />
Blick zu behalten.<br />
G Dank eines Filters gibt GCStar darüber Auskunft, welche der eigenen Bücher<br />
Sie bereits an Ihre Fre<strong>und</strong>e ausgeliehen haben.<br />
H Statistiken zeigen übersichtlich, wie viele Werke in Ihrer<br />
Sammlung bestimmte Kriterien erfüllen.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 63
praxis<br />
Anki<br />
Lernkarteien helfen<br />
dabei, neue Sprachen<br />
<strong>und</strong> Fakten<br />
effektiv zu lernen.<br />
Das clevere <strong>und</strong><br />
vielseitige Anki<br />
treibt das Flashcard-basierte<br />
Lernen<br />
auf die Spitze.<br />
Thomas Leichtenstern<br />
rEaDME<br />
Das in Python geschriebene<br />
Programm Anki<br />
bietet den Unterbau für<br />
digitale Lernkarteien aller<br />
Art. Viele davon stehen<br />
im Internet zum<br />
Download bereit, optional<br />
erstellt sie der Nutzer<br />
selbst. Diverse Im<strong>und</strong><br />
Exportfunktionen<br />
sowie eine statistische<br />
Auswertung komplettieren<br />
das Programm.<br />
Lernen auch jenseits der Schule<br />
oder Uni – ob Sprachen, Fachbegriffe<br />
oder neue Techniken – gehört<br />
heute beinahe untrennbar<br />
zu unserer Kultur. Althergebrachte<br />
Techniken wie das Lesen von<br />
Fachliteratur erweisen sich als<br />
nur begrenzt hilfreich, da die<br />
Lernmedien nicht mit dem Leser<br />
interagieren <strong>und</strong> nur unzureichende<br />
Möglichkeiten bieten, erlerntes<br />
Wissen zu vertiefen.<br />
Anders verhält es sich mit Lernkarteien,<br />
neuhochdeutsch: Flashcards.<br />
Sie erlauben es, das Lernmaterial<br />
zielgerichtet so lange zu<br />
wiederholen, bis der Stoff sitzt.<br />
Technisch voll auf der Höhe gibt<br />
sich da das Flashcard-Programm<br />
Anki [1]: Die Anwendung erlaubt,<br />
die virtuellen Lernkarten um Grafiken<br />
<strong>und</strong> Audio-Ausgaben anzureichern<br />
sowie den Lernerfolg<br />
statistisch auszuwerten.<br />
Installation<br />
Lediglich Fedora bietet in F15<br />
<strong>und</strong> F16 aktuelle Anki-Versionen<br />
zur Installation an. Ubuntu stellt<br />
im Main-Repository zwar Anki<br />
bereit, jedoch handelt es sich dabei<br />
um die veraltete Version 1.0.1.<br />
Das derzeit aktuelle Release 1.2.8<br />
erhalten Sie auf der Projektseite<br />
optional als DEB-Paket oder im<br />
Quellcode. Ein Klick auf das DEB-<br />
Paket im Dateibrowser startet die<br />
Installation <strong>und</strong> löst dabei einige<br />
Abhängigkeiten selbstständig auf.<br />
Um alle Funktionen des Programms<br />
zu nutzen, gilt es jedoch,<br />
einige zusätzliche Pakete zu installieren.<br />
Zum Ausgeben von grafischen<br />
Auswertungen benötigt<br />
Anki python-numpy sowie pythonmatplotlib,<br />
für den Audio-Support<br />
den mplayer, sox, pyaudio <strong>und</strong><br />
lame. Bei der Installation legt das<br />
Setup im Gnome-Menü einen Programmstarter<br />
unter Bildung an.<br />
Anwender von Linux-Distributionen<br />
mit einer anderen Paketverwaltung<br />
als DPKG installieren das<br />
Programm aus den Quellen. Hier<br />
gilt es, zuvor python ab Version<br />
2.4, python-qt/pyqt, sqlalchemy,<br />
simplejson <strong>und</strong> pysqlite2 einzurichten.<br />
Wechseln Sie dann in das<br />
aus dem Tarball extrahierte Anki-<br />
Verzeichnis <strong>und</strong> tippen Sie sudo<br />
python setup.py install. Sie starten<br />
Anki danach mit dem Aufruf<br />
anki im Terminal.<br />
© Benito LeGrande, sxc.hu<br />
Setup<br />
Die gr<strong>und</strong>legenden Einstellungen<br />
des Programms erreichen Sie unter<br />
Einstellungen | Optionen. Im<br />
Reiter Einfach (Abbildung A) legen<br />
Sie unter anderem die Sprache<br />
sowie einige Anzeigemerkmale<br />
fest, etwa Trennlinie zwischen<br />
Frage <strong>und</strong> Antwort. Wie erwähnt<br />
erlaubt Anki das Einbinden von<br />
Multimedia-Dateien. Wo das Programm<br />
diese speichert, stellen Sie<br />
über Multimedia ein. Neben dem<br />
Sichern im Verzeichnis des zugehörigen<br />
Kartenstapels stellt das<br />
Programm auch Dropbox als<br />
möglichen Speicherort bereit. Der<br />
Vorteil: Die Dateien stehen Ihnen<br />
auf jedem Rechner mit installiertem<br />
Dropbox-Client [2] zur Verfügung.<br />
Warum Anki diese Option<br />
aber nicht auch für andere Objekte<br />
wie die Kartenstapel selbst<br />
anbietet, bleibt unklar.<br />
Der Abschnitt Netzwerk gestattet<br />
es unter anderem, einen Anki-<br />
Account anzulegen oder sich dort<br />
anzumelden. Dieser dient dazu,<br />
Stapel zu sichern <strong>und</strong> zu synchro-<br />
64 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Anki<br />
praxis<br />
nisieren. Sofern Sie einen Proxy<br />
als Zugang ins Internet verwenden,<br />
tragen Sie ihn an dieser Stelle<br />
ein. Im Reiter Speichern geben<br />
Sie unter anderem vor, in welchem<br />
Zyklus Anki während der<br />
Abfrage Ihre Eingaben sichert,<br />
Erweitert ermöglicht es Ihnen unter<br />
anderem, den Zeitzähler einzublenden<br />
<strong>und</strong> farbig anzuzeigen<br />
oder die Anzeige für kleine Bildschirme<br />
zu optimieren.<br />
Der erste Start<br />
Wie in der analogen Welt unterscheidet<br />
auch Anki zwischen Stapeln<br />
<strong>und</strong> Karten, Letztere im Programm<br />
auch Fakten genannt. Stapel<br />
bezeichnen die Zusammenstellung<br />
mehrerer Karten aus einem<br />
Themengebiet. Ob Sie einen<br />
eigenen Stapel erstellen oder fertige<br />
aus dem Internet herunterladen<br />
möchten, entscheiden Sie im<br />
Modus Stapel, den das Programm<br />
beim Start anzeigt. Derzeit stehen<br />
mehrere H<strong>und</strong>ert der virtuellen<br />
Lernhelfer zum Download bereit.<br />
Die Themengebiete reichen<br />
dabei von Übungen zu den verschiedensten<br />
Sprachen bis hin zu<br />
LPIC-2-Vorbereitungen <strong>und</strong> Lernsätzen<br />
zu Anatomie. Nach Anwahl<br />
<strong>und</strong> Download des gewünschten<br />
Stapels erscheint dieser in der Tabelle<br />
unter Stapel (Abbildung B).<br />
Ein Klick auf Öffnen neben dem<br />
Eintrag führt Sie zu den Lern-Einstellungen,<br />
in denen Sie die Rahmenbedingungen<br />
festlegen, wie<br />
etwa die Reihenfolge der Abfrage<br />
oder den Zeitrahmen, in dem Sie<br />
die Aufgaben lösen möchten. Das<br />
Aktivieren<br />
von Lernen<br />
am unteren<br />
Rand startet<br />
die Abfrage<br />
(Abbildung<br />
C).<br />
Im oberen<br />
Feld erscheint<br />
danach<br />
der Begriff,<br />
den Sie<br />
lernen möchten.<br />
Nach einem<br />
Klick<br />
auf Antwort<br />
anzeigen zeigt Anki darunter die<br />
Lösung an. Je nachdem, wie einfach<br />
oder schwer die Frage für Sie<br />
war, wiederholen Sie diese Bald, in<br />
1 Tag, 4 Tagen oder erst in 7 Tagen.<br />
Das Anklicken des entsprechenden<br />
Schalters öffnet die nächste<br />
Frage des Stapels. Öffnen Sie den<br />
Stapel später wieder, erscheinen<br />
die Karten entsprechend Ihrer Zuordnung<br />
erst nach dem gewählten<br />
Zeitraum zur erneuten Abfrage.<br />
Zur Auswertung der erzielten<br />
Lernerfolge stellt Anki ein grafisches<br />
Analysetool bereit, das Sie<br />
über den Schalter Diagramme öffnen.<br />
Dieses zeigt danach auf acht<br />
Balkendiagramme verteilt unter<br />
anderem an, wann, wie oft <strong>und</strong> in<br />
welchen Abständen Sie Karten<br />
wiederholt haben (Abbildung D).<br />
Selbst gestaltet<br />
Damit ist Anki mit seinen Fähigkeiten<br />
aber noch lange nicht am<br />
Ende: Es kann auch Multimedia-<br />
Dateien <strong>und</strong> mathematische Formeln<br />
in die Karten einbinden.<br />
Zur Gestaltung der Karten setzt<br />
das Tool komplett auf LaTeX <strong>und</strong><br />
HTML, was erlaubt, das Layout<br />
praktisch frei zu definieren.<br />
Um eine neue Karte zu erstellen,<br />
klicken Sie nach Anwahl eines<br />
Stapels auf den grünen Plus-<br />
Schalter oben links. Es erscheint<br />
eine Eingabemaske, in der Sie<br />
Frage <strong>und</strong> Antwort eintragen. Darüber<br />
finden Sie mehrere Icons,<br />
mit denen Sie unter anderem den<br />
Text kolorieren <strong>und</strong> formatieren.<br />
Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol,<br />
so erscheint ein Dateibrowser,<br />
über den Sie eine auf<br />
dem System vorhandene Audio-<br />
Datei in die Karte einbinden.<br />
Möchten Sie eine Bilddatei hinzufügen,<br />
klicken Sie auf die stilisierte<br />
Palette <strong>und</strong> anschließend<br />
im Dateibrowser auf die ge-<br />
A Die Einstellungen<br />
von Anki erlauben unter<br />
anderem das Einbinden<br />
von Dropbox als<br />
Speichermedium multimedialer<br />
Inhalte.<br />
Anki 1.2.8<br />
LU/anki/<br />
B Im Abschnitt Stapel<br />
zeigt Anki alle heruntergeladenen<br />
oder<br />
selbst erstellten Lernkarteien<br />
in der Übersicht<br />
an.<br />
anki-plugins<br />
Zum Erweitern des Funktionsumfangs<br />
von Anki nutzen Sie die Plugin-Schnittstelle.<br />
Um neue Erweiterungen hinzuzufügen,<br />
wechseln Sie ins Menü Datei<br />
| Herunterladen | Öffentlich freigegebenes<br />
Plugin…. Damit öffnet sich<br />
ein Auswahlfenster, das alle derzeit<br />
frei verfügbaren Plugins auflistet. Um<br />
eines davon hinzuzufügen, genügt es,<br />
das Gewünschte anzuwählen <strong>und</strong> danach<br />
mit OK zu bestätigen.<br />
Die Verwaltung der Erweiterungen erreichen<br />
Sie unter Einstellungen | Plugins.<br />
Der etwas missverständliche Unterpunkt<br />
Starten ermöglicht es, einzelne<br />
oder alle Module an- oder abzuschalten.<br />
Viele der Plugins entfalten ihr Potenzial<br />
aber erst im Backend – so etwa<br />
Google TTS. Es ermöglicht im Editiermodus,<br />
eine Frage via Google Text to<br />
Speech mit einer gesprochenen Version<br />
zu versehen. Ähnlich verhält es<br />
sich mit Leo: Das Plugin verlinkt sowohl<br />
Frage als auch Antwort direkt mit<br />
der Übersetzungsseite Dict.leo.org [3].<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 65
praxis<br />
Anki<br />
C Je nachdem, ob<br />
Ihnen die Antwort<br />
schwer- oder leichtfiel,<br />
legen Sie fest, wann<br />
Anki die Karte wiederholen<br />
soll.<br />
wünschte Aufnahme. Hier gilt es<br />
zu beachten, dass die Applikation<br />
die Datei in der unveränderten<br />
Originalgröße anzeigt. Abhilfe<br />
schafft das Plugin „Resize Image“,<br />
das zumindest die Breite des Bildes<br />
an die aktuelle Darstellung<br />
anpasst (siehe Kasten Anki-Plugins,<br />
vorige Seite). Der Aufnahmeknopf<br />
daneben erlaubt es, per<br />
Mikrofon gesprochene Anmerkungen<br />
einzufügen. Im Lernmodus<br />
spielen Sie die hinterlegten<br />
Dateien mit dem Wiedergabeknopf<br />
in der Menüleiste ab.<br />
Ein Klick auf Kartenlayout im<br />
Hinzufügen-Modus öffnet ein<br />
weiteres Fenster, in dem Sie unter<br />
anderem die Ausrichtung des Textes<br />
beeinflussen. Am unteren<br />
Rand finden Sie einen Schalter,<br />
der in der Gr<strong>und</strong>einstellung auf<br />
Fordere mich nicht auf, die Antwort<br />
einzugeben steht. Ändern Sie das<br />
auf Mit Feld Antwort vergleichen,<br />
so erscheint zukünftig in allen<br />
Karten des verwendeten Stapels<br />
eine Eingabezeile, in der Sie die<br />
Antwort eintippen. Diese vergleicht<br />
Anki nach dem Klick auf<br />
Antwort anzeigen buchstabengenau<br />
mit der hinterlegten Antwort.<br />
Das weitgehend schlüssige<br />
Bedien konzept verkompliziert<br />
Anki durch sogenannte Modelle,<br />
von denen das Programm vier<br />
verschiedene (Einfach, Englisch,<br />
Französisch <strong>und</strong> Chinesisch) zum<br />
Einsatz bereitstellt. Solche Modelle<br />
fassen eine Liste von Vorlagen<br />
<strong>und</strong> Feldern zusammen, die es erlauben,<br />
die Stapel <strong>und</strong> Karten auf<br />
den jeweils benutzten Anwendungsfall<br />
auszurichten. Abgesehen<br />
von Ausnahmen genügt in<br />
der Regel jedoch das Modell Einfach.<br />
Weiterführende Informationen<br />
zum Thema erhalten Sie im<br />
Online-Manual [4].<br />
Um aktuell geladene Karten zu<br />
bearbeiten, klicken Sie auf das angedeutete<br />
Eingabefeld rechts neben<br />
dem grünen Pluszeichen. Damit<br />
öffnet sich der Editor, der<br />
weitgehend jenem zum Anlegen<br />
neuer Karten entspricht. Eine<br />
<strong>Vorschau</strong> fehlt jedoch in beiden<br />
Varianten, was sich speziell beim<br />
Einsatz von Multimedia-Dateien<br />
als hinderlich erweist.<br />
Im- <strong>und</strong> Export<br />
Seine Auslegung auf plattformunabhängiges<br />
Arbeiten beweist Anki<br />
nicht nur damit, dass es neben<br />
Linux auch für Mac OS X <strong>und</strong><br />
Windows zum Download bereitsteht,<br />
sondern auch mit den zahlreichen<br />
Funktionen zum Im- <strong>und</strong><br />
Export. Die einfachste Methode,<br />
Stapel zwischen Rechnern zu teilen,<br />
bietet Anki mit einem Online-<br />
Konto auf seiner Webseite.<br />
Klicken Sie nach der kostenfreien<br />
Anmeldung auf Datei | Synchronisieren,<br />
lädt das Programm den<br />
aktuell geöffneten Stapel auf das<br />
Konto [5]. In der Gr<strong>und</strong>einstellung<br />
geschieht das bei jedem<br />
Schließen des Programms automatisch.<br />
Arbeiten Sie an einem<br />
Rechner <strong>ohne</strong> installiertes Anki,<br />
können Sie die Fragen hochgeladener<br />
Stapel nach der Anmeldung<br />
auch direkt via Browser beantworten<br />
oder editieren.<br />
Zum Importieren online abgelegter<br />
Stapel klicken Sie auf Datei<br />
| Herunterladen | Eigener Stapel<br />
<strong>und</strong> wählen aus dem Dialog das<br />
Gewünschte aus. Lokal gespeicherte<br />
Stapel fügen Sie via Datei |<br />
Importieren… Ihren Stapeln hinzu.<br />
Fazit<br />
Anki leistete sich im Test keinen<br />
einzigen Fehler oder Absturz, was<br />
für saubere Programmierung<br />
spricht – bei einem Projekt solcher<br />
Komplexität beileibe keine Selbstverständlichkeit.<br />
An einigen Stellen<br />
war die Übersetzung jedoch inkonsistent,<br />
meist aber erst in tiefer<br />
verschachtelten Einstellungen.<br />
Auch fuhr das Python-Programm<br />
in der Nutzerführung Minuspunkte<br />
ein: An der Oberfläche<br />
noch schlüssig <strong>und</strong> leicht zu<br />
durchschauen, änderte sich das<br />
Bild in den Tiefen der Konfiguration.<br />
Wollen Sie das Programm<br />
ausreizen, kommen Sie um einen<br />
Blick ins umfangreiche englische<br />
Manual nicht herum. Dafür belohnt<br />
Anki Sie dann mit einem<br />
weitgehend frei konfigurierbaren<br />
Fragenkatalog, der wohl jedem<br />
Anspruch genügt. (tle) n<br />
D Ankis Karteneditor<br />
bietet eine Vielzahl von<br />
Möglichkeiten, zusätzliche<br />
Medien einzubinden<br />
<strong>und</strong> das Layout<br />
dem eigenen Geschmack<br />
oder Bedürfnis<br />
anzupassen.<br />
info<br />
[1] Anki: http:// ankisrs. net<br />
[2] Dropbox: http:// www. dropbox. com<br />
[3] Leo: http:// dict. leo. org<br />
[4] Online-Manual:<br />
http:// ankisrs. net/ docs/ index. html<br />
[5] Anki-Online-Konto:<br />
http:// anki. ichi2. net/ study<br />
66 10 | 11<br />
www.linux-user.de
EINfaCH auf LINuX<br />
umSTEIGEN!<br />
4 x im Jahr kompaktes Linux-Know-how - IMMER mit 2 DVDs<br />
15%<br />
sparen<br />
EASYLINUX-JAHRES-ABO<br />
NUR 33,30E*<br />
❱<br />
JETZT GRaTIS<br />
aBo-pRämIE<br />
SICHERN!<br />
Ich bekomme gratis:<br />
1. das EasyLinux Mega-Archiv<br />
Jahres-DVD 2010 (8 Jahre Easy-<br />
Linux auf einer DVD)<br />
2. DVD „Die Reise der Pinguine“<br />
(solange Vorrat reicht)<br />
Coupon<br />
*Preise außerhalb Deutschlands siehe www.easylinux.de/abo<br />
ich möchte EasyLinux für nur 8,33 Euro* pro Ausgabe<br />
Ja,<br />
abonnieren.<br />
ich möchte für nur 1 € pro Monat das EasyLinux-<br />
Ja,<br />
Community-Abo abschließen. Jederzeit Zugriff<br />
auf alle Online-Artikel, Workshops <strong>und</strong> mehr.<br />
Ich zahle pro Ausgabe nur € 8,33* statt € 9,80* im Einzelverkauf.<br />
Ich erhalte EasyLinux alle drei Monate (vier Ausgaben pro Jahr) zum Vorzugspreis von<br />
€ 33,30* pro Jahr bei jährlicher Verrechnung. Möchte ich EasyLinux nicht mehr<br />
haben, kann ich das Abonnement nach einem Jahr jederzeit kündigen.<br />
Name, Vorname<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Mein Zahlungswunsch: Bequem per Bankeinzug Gegen Rechnung<br />
Straße, Nr.<br />
BLZ<br />
Konto-Nr.<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Bank<br />
JETZT GLEICH BESTELLEN!<br />
n Tel.: 07131 / 2707 274 n fax: 07131 / 2707 78 601<br />
n uRL: www.easylinux.de/abo n E-mail: abo@easylinux.de
praxis<br />
Imagination<br />
Diashows erstellen mit Imagination<br />
Elegante<br />
Vorstellung<br />
Präsentieren Sie Ihre Fotos einmal anders: Als Diaschau ganz <strong>ohne</strong><br />
Dias. Imagination hat die Funktionen dazu. Vincze-Aron Szabo<br />
© Christos Georghiou, Fotolia<br />
Imagination 3.0<br />
LU/imagination/<br />
rEaDME<br />
Mit Imagination erstellen<br />
Sie im Handumdrehen<br />
effektvolle Diashows Ihrer<br />
Fotos samt musikalischer<br />
Untermalung <strong>und</strong><br />
eindrucksvollen Überblendeffekten.<br />
A In den Diaschau-<br />
Einstellungen legen<br />
Sie das Format fest, in<br />
das Imagination die<br />
Slideshow nach dem<br />
Bearbeiten exportiert.<br />
Wollte man früher in geselliger<br />
R<strong>und</strong>e die neuesten Urlaubsfotos<br />
präsentieren, ließ man seine Fotos<br />
als Dia entwickeln <strong>und</strong> schleppte<br />
dann die gesamte Ausrüstung zum<br />
Familientreffen mit: Diaprojektor,<br />
Leinwand <strong>und</strong> – nicht zu vergessen<br />
– die mit den Dias gefüllten<br />
Magazine. War endlich alles aufgebaut<br />
<strong>und</strong> hatte sich das Publikum<br />
zu fünft auf das Dreiersofa gequetscht,<br />
konnte die Vorführung<br />
beginnen. Der Bediener drückte<br />
den entsprechenden Knopf auf<br />
der Fernbedienung, <strong>und</strong> der Projektor<br />
sorgte für das typische Geräusch,<br />
das sich anhörte wie das<br />
Durchladen eines Plastikgewehrs.<br />
Ein neues Dia wurde vor die Linse<br />
geschoben, <strong>und</strong> auf der Leinwand<br />
war die nächste Urlaubserinnerung<br />
zu bew<strong>und</strong>ern.<br />
Mit der analogen Fotografie verschwinden<br />
auch die Diaschauen.<br />
Statt Projektor <strong>und</strong> Leinwand<br />
kommen mittlerweile Monitor,<br />
Smartphone, Fernseher oder sogar<br />
Beamer zum Einsatz, um die<br />
jüngsten Reiseerlebnisse anderen<br />
zu präsentieren Doch die Atmosphäre<br />
eines Dia-Abends muss dabei<br />
nicht verloren gehen: Statt<br />
nacheinander Bilder aus einem<br />
Dateimanager heraus aufzurufen,<br />
können Sie mithilfe von entsprechenden<br />
Tools schöne Fotosequenzen<br />
erstellen. Ein solches<br />
Werkzeug ist Imagination [1], mit<br />
dem Sie Fotosequenzen<br />
–<br />
sogenannte<br />
Slide shows –<br />
erstellen. Sie<br />
können einzelne<br />
Fotos wie in<br />
einer Diaschau<br />
nacheinander<br />
abspielen <strong>und</strong><br />
dazu selbst ausgewählte Hintergr<strong>und</strong>musik<br />
laufen lassen. Für das<br />
Überblenden zwischen den einzelnen<br />
Fotos bietet das Programm<br />
verschiedene Übergänge. Passenderweise<br />
heißen Fotos in Imagination<br />
auch „Dia“. Imagination<br />
erstellt Slideshows im DVD-gerechten<br />
VOB-Format, als Flash,<br />
Theora Vorbis oder 3GP.<br />
Installation<br />
Imagination liegt derzeit in Version<br />
3.0 vor. Nach dem Herunterladen<br />
[2] des Quell-Tarballs (auch<br />
auf der Heft-DVD) entpacken Sie<br />
diesen in ein beliebiges Verzeichnis<br />
(Listing 1, Zeile 1). Anschließend<br />
wechseln Sie in den entpackten<br />
Ordner (Zeile 2). Dort öffnen<br />
Sie nun die Datei src/support.h mit<br />
einem Texteditor (Zeile 3), suchen<br />
die Zeile #define PLUGINS_INSTALLED<br />
0 <strong>und</strong> ändern die 0 in eine 1. Speichern<br />
Sie diese Änderung <strong>und</strong><br />
schließen Sie den Editor wieder.<br />
Durch diese kleine Anpassung<br />
stehen Ihnen nachher auch die<br />
Übergänge zwischen einzelnen<br />
68 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Imagination<br />
praxis<br />
Bildern zur Verfügung – andernfalls<br />
würden Sie keine Übergänge<br />
auswählen können.<br />
Führen Sie nun ./configure aus,<br />
um Imagination für Ihr System zu<br />
konfigurieren. Eventuell erhalten<br />
Sie hier die Meldung, dass bestimmte<br />
Pakete fehlen. Richten<br />
Sie die fehlenden Komponenten<br />
dann über den Paketmanager des<br />
Systems ein <strong>und</strong> rufen Sie ./configure<br />
erneut auf. Unter Linux Mint<br />
11 mussten wir beispielsweise die<br />
Pakete docbook-xsl, intltool,<br />
libglib2.0-dev, libgtk2.0-dev <strong>und</strong><br />
libsox-dev nachinstallieren.<br />
Nach der Konfiguration übersetzen<br />
<strong>und</strong> installieren Sie Imagination<br />
mit dem bekannten Dreischritt<br />
(Zeile 4 bis 6). Im Anschluss<br />
starten Sie die Anwendung<br />
über den Befehl imagination<br />
auf der Kommandozeile oder per<br />
Maus über das Startmenü.<br />
Erste Schritte<br />
Nach dem Start legen Sie zuerst<br />
über den Menüeintrag Diaschau |<br />
Neu oder über die Tastenkombination<br />
[Strg]+[N] eine neue Diaschau<br />
an. Im Dialog Neue Diaschau<br />
anlegen nehmen Sie gr<strong>und</strong>legende<br />
Einstellungen zum Format<br />
(siehe Tabelle Videoformate)<br />
<strong>und</strong> der Größe des Videos vor.<br />
Abhängig von der Auswahl des<br />
Formats stehen verschiedene<br />
Größen zur Auswahl. Nachdem<br />
Sie Format <strong>und</strong> Größe ausgewählt<br />
haben, aktivieren Sie die Funktion<br />
Bilder in das Format einpassen<br />
<strong>und</strong> legen eine passende Hintergr<strong>und</strong>farbe<br />
fest, bevor Sie den<br />
Dialog bestätigen.<br />
Nun holen Sie die zu präsentierenden<br />
Fotos in die Slideshow.<br />
Dazu klicken Sie im Menü auf<br />
Diaschau | Bilder importieren oder<br />
drücken [Strg]+[I]. Navigieren Sie<br />
nun in das Verzeichnis mit den<br />
gewünschten Bildern <strong>und</strong> wählen<br />
Sie die entsprechenden Dateien<br />
aus. Sie können auch nachträglich<br />
weitere Bilder hinzufügen. Haben<br />
Sie eine Auswahl getroffen, erscheinen<br />
die Bilder am unteren<br />
Fensterrand in einer Leiste.<br />
Hier bringen Sie die Bilder per<br />
Maus in die gewünschte Reihenfolge.<br />
Dazu halten Sie die linke<br />
Maustaste gedrückt <strong>und</strong> ziehen<br />
einzelne Bilder an die vorgesehene<br />
Stelle. Möchten Sie dabei nicht<br />
immer durch die gesamte Leiste<br />
scrollen, dann erleichtern Sie sich<br />
mit dem Übersichtsmodus das<br />
Leben: Klicken Sie dazu im Menü<br />
Ansicht auf Übersicht. Nun zeigt<br />
Imagination die Bilder ähnlich<br />
wie in einem Dateimanager an.<br />
Denken Sie bei all der Verschieberei<br />
auch daran, Ihr Projekt zwischendurch<br />
zu speichern.<br />
Haben Sie die richtige Reihenfolge<br />
gef<strong>und</strong>en, geht es an die Gestaltung<br />
der Slideshow. Sie können<br />
für jedes Bild eigene Einstellungen<br />
festlegen (Abbildung B),<br />
wie Texte, Überblendeffekte <strong>und</strong><br />
Anzeigedauer. Allerdings bedeutet<br />
das, dass Sie tatsächlich auch<br />
jedes Bild in die Hand nehmen<br />
müssen: Es fehlt die Möglichkeit,<br />
01 $ tar ‐xzf<br />
imagination‐3.0.tar.gz<br />
02 $ cd imagination‐3.0/<br />
03 $ gedit src/support.h<br />
04 $ .configure<br />
05 $ make<br />
06 $ sudo make install<br />
Listing 1<br />
Einstellungen von einem Foto auf<br />
ein anderes zu übertragen. Immerhin<br />
können Sie bei gedrücktem<br />
[Strg] mehrere Bilder mit der<br />
Maus markieren <strong>und</strong> gemeinsame<br />
Einstellungen treffen.<br />
Effektiv<br />
Um Einstellungen für ein einzelnes<br />
Bild vorzunehmen, wählen Sie<br />
dieses aus <strong>und</strong> passen in den<br />
rechts daneben platzierten Reitern<br />
die Optionen an. Im Tab<br />
Video verbergen sich alle wichtigen<br />
Eigenschaften für die Optik. Unter<br />
Überblend-Effekt wählen Sie<br />
aus der Auswahlliste einen passen-<br />
B In Imagination legen<br />
Sie für jedes Bild getrennt<br />
die Anzeigedauer,<br />
Überblendeffekte<br />
<strong>und</strong> zahlreiche<br />
weitere Einstellungen<br />
fest.<br />
ViDEoforMatE<br />
Kürzel Format Erläuterung<br />
VOB DVD Video VOB ist ein Containerformat für<br />
DVDs, das neben den eigentlichen<br />
Videos auch Untertitel <strong>und</strong> Menüinformationen<br />
enthalten kann. VOB-<br />
Dateien mit Videos sind üblicherweise<br />
MPEG-2- oder MPEG-1-codiert.<br />
OGV Theora Vorbis Theora ist ein freier Videocodec <strong>und</strong><br />
ist als patentfreies Pendant als Alternative<br />
zu anderen verwendeten<br />
Codecs im Internet gedacht.<br />
FLV Flash Video Dateien im bekannten Flash-Format<br />
können mit vielen gängigen Playern<br />
abgespielt werden.<br />
3GP Mobile Phones Containerformat für Mobiltelefone,<br />
das auf MPEG4 basiert.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 69
praxis<br />
Imagination<br />
C Imagination stellt<br />
zahlreiche Überblendeffekte<br />
zur Verfügung.<br />
D Jedes Bild, dem Sie<br />
einen Überblendeffekt<br />
zuordnen, versieht<br />
Imagination mit einem<br />
entsprechenden Icon.<br />
den Effekt aus (Abbildung C). Die<br />
Menü-Einträge dieser Auswahlliste<br />
erscheinen zwar auf Englisch,<br />
doch die kleinen <strong>Vorschau</strong>bildchen<br />
unten machen ganz schnell klar,<br />
um was für einen Effekt es sich jeweils<br />
handelt, <strong>ohne</strong> diesen schon<br />
auswählen zu müssen.<br />
Experimentierfreudige klicken<br />
einfach auf Zufällig, woraufhin<br />
Imagination selbst einen Effekt<br />
aussucht. Der eingestellte Effekt<br />
gilt stets für die Überblendung<br />
vom vorherigen Bild auf das aktuelle<br />
Foto. Haben Sie einen Überblendeffekt<br />
ausgewählt, signalisiert<br />
Imagination diesen durch<br />
ein kleines Icon am zugehörigen<br />
<strong>Vorschau</strong>bildchen (Abbildung D).<br />
Zusätzlich legen Sie über die<br />
entsprechenden Felder die Überblendgeschwindigkeit<br />
sowie die<br />
Anzeigedauer fest. Unter Länge<br />
der Diaschau behalten Sie immer<br />
im Blick, wie lange die Diaschau<br />
mit den getroffenen Einstellungen<br />
insgesamt dauert.<br />
Das Gesamtergebnis<br />
können Sie<br />
sich als <strong>Vorschau</strong><br />
über das Abspielsymbol<br />
Startet die<br />
<strong>Vorschau</strong> in der<br />
Werkzeugleiste<br />
schon einmal ansehen.<br />
Möchten Sie<br />
wissen, wie oft welcher<br />
Überblendeffekt<br />
an welcher Stelle<br />
der Slideshow<br />
zum Einsatz kommt,<br />
hilft der Menüpunkt<br />
Dia | Bericht weiter<br />
(Abbildung E).<br />
Kennen Sie Ken Burns?<br />
Als „Ken-Burns-Effekt“ bezeichnet<br />
man das Verfahren, mittels<br />
Vergrößern <strong>und</strong> Schwenken aus<br />
einem Standbild ein Pseudo-Bewegtbild<br />
zu erstellen. Als Namensgeber<br />
dient dabei der renommierte<br />
<strong>und</strong> mehrfach ausgezeichnete<br />
US-amerikanische Dokumentarfilmer<br />
Ken Burns [3],<br />
der diese Technik zwar nicht erf<strong>und</strong>en<br />
hat, sie jedoch in seinen<br />
Filmen meisterlich anwendet.<br />
Dank Imagination setzen auch<br />
Sie bequem dieses Verfahren ein,<br />
um beispielsweise die Aufmerksamkeit<br />
der Zuschauer durch<br />
Ausrichten <strong>und</strong> Zoomen auf einen<br />
bestimmten Punkt (etwa ein<br />
Gesicht) zu lenken.<br />
Schieben Sie dazu den Regler<br />
Zoom im Bereich Dia-Bewegung<br />
nach rechts, um etwas in das Bild<br />
hineinzuzoomen. Nun ziehen Sie<br />
mit gedrückter linker Maustaste<br />
das Bild an diejenige Stelle, in die<br />
Imagination später per Ken-<br />
Burns-Effekt hineinzoomen soll.<br />
Gegebenenfalls müssen Sie dabei<br />
den Vergrößerungsfaktor noch<br />
ein wenig nachjustieren. Über<br />
Dauer legen Sie fest, wie lange der<br />
Fokus auf diesem Punkt liegen<br />
soll. Entspricht das Ergebnis<br />
schließlich Ihren Ansprüchen, klicken<br />
Sie auf Hinzufügen <strong>und</strong> erstellen<br />
damit einen sogenannten<br />
Anhaltepunkt.<br />
Sie können auf einem Bild auch<br />
mehrere Anhaltepunkte anlegen<br />
– etwa, um auf Gruppenfotos jedes<br />
Gesicht einmal im Porträt<br />
vergrößert zu zeigen. Als ersten<br />
Anhaltepunkt sollten Sie immer<br />
das komplette, nicht gezoomte<br />
Bild verwenden – anderenfalls<br />
startet Imagination dieses Bild in<br />
der Diaschau gegebenenfalls stark<br />
hineingezoomt am ersten Anhaltepunkt.<br />
Möchten Sie einen einzelnen<br />
Anhaltepunkt nachträglich<br />
verändern, wählen Sie ihn<br />
dazu über die Pfeil-Schalter aus.<br />
Vergessen Sie nicht, nach erfolgter<br />
Änderung mittels Aktualisieren<br />
die Anpassungen zu übernehmen.<br />
Zum Löschen klicken Sie<br />
einfach auf Entfernen.<br />
Beim ersten Versuch, mit dem<br />
Ken-Burns-Effektwerkzeug zu arbeiten,<br />
gelangen Sie wahrscheinlich<br />
nicht sofort ans Ziel der Wünsche.<br />
Mit ein wenig Ausprobieren<br />
stellen sich dann aber zügig zufriedenstellende<br />
Ergebnisse ein.<br />
Text <strong>und</strong> Musik<br />
Über den Bereich Dia-Text fügen<br />
Sie einer Abbildung auch Texte<br />
hinzu. Neben der Schriftart <strong>und</strong><br />
der Schriftgröße legen Sie dabei<br />
über die beiden entsprechenden<br />
Buttons auch eine Füllfarbe <strong>und</strong><br />
eine Schriftkonturfarbe fest. Zusätzlich<br />
können Sie unter Animation<br />
einen Effekt für das Einblenden<br />
des Textes auswählen. Über<br />
den Punkt Position des Untertitels<br />
bestimmen Sie, an welcher Stelle<br />
des Bildes der Text erscheint.<br />
Um die Stimmung zu pointieren<br />
oder bei langen Diaschauen keine<br />
Langeweile aufkommen zu lassen,<br />
hilft oft eine passende musiinfo<br />
[1] Imagination:<br />
http:// imagination. sourceforge. net<br />
[2] Download: http:// sourceforge. net/ projects/<br />
imagination/ files/ imagination/ 3. 0/<br />
[3] Ken Burns (Wikipedia):<br />
http:// de. wikipedia. org/ wiki/ Ken_Burns<br />
[4] Bombono DVD: Vincze-Aron Szabo, „Menü<br />
mit drei Gängen“, LU 09/ 2011, S. 48,<br />
http:// www. linux-community. de/ 22904<br />
70 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Imagination<br />
praxis<br />
kalische Untermalung. Klicken<br />
Sie dazu im Menü auf Diaschau |<br />
Musik importieren oder drücken<br />
Sie [Strg]+[M]. Über den sich öffnenden<br />
Dialog wählen Sie anschließend<br />
die gewünschten Musikdateien<br />
aus. Dann passen Sie<br />
die Reihenfolge der Stücke unter<br />
dem Reiter Audio an.<br />
Export<br />
Sind Sie mit allen Einstellungen<br />
zufrieden, exportieren Sie nun<br />
die Diaschau als Video. Vorher<br />
lohnt es sich eventuell, noch einmal<br />
die <strong>Vorschau</strong>funktion über<br />
Diaschau | <strong>Vorschau</strong> auszuführen.<br />
Den Export, also das Erzeugen<br />
der eigentlichen Slideshow, stoßen<br />
Sie über Diaschau | Exportieren<br />
an. In dem sich daraufhin öffnenden<br />
Dialog treffen Sie weitere<br />
Einstellungen, wie zum Beispiel<br />
Qualität, Format <strong>und</strong> Auflösung.<br />
Zu guter Letzt starten Sie dann<br />
den Export.<br />
Haben Sie mehrere Slideshows<br />
produziert, können Sie noch einen<br />
Schritt weitergehen <strong>und</strong> das<br />
Gesamtkunstwerk zum Beispiel<br />
auf eine DVD brennen. Ein ansprechendes<br />
Menü dazu erstellen<br />
Sie beispielsweise mit Bombono<br />
[4]. So haben Sie am Ende ein<br />
optisches Schmankerl erarbeitet,<br />
das sich prima verschenken lässt.<br />
Fazit<br />
Trotz einiger Haken in der Handhabbarkeit<br />
lassen sich mit Imagination<br />
ansehnliche Slideshows erstellen.<br />
Ein paar Funktionen fehlen<br />
allerdings noch: So würde der<br />
Bedienkomfort beträchtlich von<br />
Eigenschaftsprofilen profitieren,<br />
mit denen man die Einstellungen<br />
eines angepassten Fotos nachträglich<br />
auf weitere Bilder übertragen<br />
könnte. Dennoch macht<br />
die Arbeit mit Imagination Spaß<br />
<strong>und</strong> führt zu sehr ansehnlichen<br />
Ergebnissen. Dazu trägt nicht zuletzt<br />
bei, dass die Entwickler die<br />
Anwendung auf das funktional<br />
Notwendigste reduziert haben,<br />
sodass auch Einsteiger tolle Diaschauen<br />
zusammenstellen können,<br />
<strong>ohne</strong> sich langwierig einarbeiten<br />
zu müssen. (jlu) n<br />
E Über Dia | Bericht<br />
können Sie sich anzeigen<br />
lassen, wie oft Sie<br />
einzelne Übergänge<br />
verwenden.
praxis<br />
Digikam<br />
Digikam schafft Ordnung bei den Bildern<br />
Sammeln <strong>und</strong><br />
Strukturieren<br />
© Krayker, sxc.hu<br />
Durch innovative<br />
Suchmethoden<br />
sorgt Digikam dafür,<br />
dass Sie in<br />
Ihrem Bildarchiv<br />
schnell <strong>und</strong> zielsicher<br />
die gewünschten<br />
Motive finden.<br />
Karsten Günther<br />
rEaDME<br />
Die wachsenden Mengen<br />
digitaler Bilder erfordern<br />
die richtigen<br />
Werkzeuge, um einzelne<br />
Motive zu finden. Digikam<br />
kombiniert zahlreiche<br />
Mechanismen,<br />
um Struktur in die Bilderflut<br />
zu bringen.<br />
Mit einer steigenden Anzahl<br />
von Bildern auf der Festplatte<br />
wachsen die Schwierigkeiten, ein<br />
gewünschtes Bild wiederzufinden.<br />
Hier setzen Bildarchive wie Digikam,<br />
F-Spot oder Shotwell an: Sie<br />
identifizieren die Bilder nicht nur<br />
über EXIF-Tags, sondern erlauben<br />
zusätzlich das Vergeben von Stichwörtern<br />
sowie komplexe Suchen.<br />
Digikam [1] arbeitete ursprünglich<br />
als Datenbank-Frontend, verfügt<br />
heute aber über wesentlich<br />
mehr Funktionen, wie einen<br />
Leuchttisch <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
zum Bearbeiten von Bildern sowie<br />
Funktionen, um verwaltete Bilder<br />
wiederzufinden. Das Programm<br />
importiert alle gängigen Bildformate<br />
<strong>und</strong> Kamera-Rohdaten, die<br />
es bei Bedarf seit einiger Zeit sogar<br />
nach DNG wandelt.<br />
Alle Angaben im Folgenden beziehen<br />
sich auf Digikam 1.2.0, basierend<br />
auf KDE SC 4.4.5 aus dem<br />
Repository von Ubuntu 10.04.<br />
Spaltenkünstler<br />
Die Programmoberfläche teilt sich<br />
in drei Spalten (Abbildung A):<br />
Links befindet sich die Suchspalte,<br />
die entsprechenden Treffer<br />
zeigt Digikam in der mittleren<br />
Spalte. Für dort ausgewählte Bilder<br />
erscheinen rechts Details.<br />
Über Buttons in den Rahmen<br />
blenden Sie die äußeren Spalten<br />
ein oder aus. Der obere Rand enthält<br />
Schalter für häufig benötigte<br />
Funktion, der untere eine Statuszeile.<br />
Über einen Regler <strong>und</strong> eine<br />
Schaltfläche passen Sie die Größe<br />
der angezeigten Bilder ein.<br />
Im linken Rahmen (Bereich 1)<br />
steuern Sie über sieben Schaltflächen<br />
die Anzeige in dieser Spalte:<br />
Es gibt eine Übersicht der Alben,<br />
eine kalendarisch sortierte Ansicht,<br />
eine Liste der Stichworte,<br />
eine Zeitleiste mit den Entstehungsdaten<br />
der Bilder sowie drei<br />
Suchfunktionen: die Suche nach<br />
einem Stichwort, eine unscharfe<br />
Suche sowie die Suche nach Geodaten.<br />
Die Suchkriterien geben<br />
Sie am unteren Rand ein.<br />
Bilder, die den Kriterien entsprechen,<br />
zeigt Digikam oben in<br />
der Mitte als Liste (Bereich 3), bei<br />
Bedarf schalten Sie dies über<br />
[Strg]+[T] um. Ein Doppelklick<br />
auf ein Bild vergrößert die Ansicht<br />
(Bereich 4). Am unteren<br />
Rand gibt es ein Eingabefeld für<br />
Stichwörter (Bereich 6), eine Auswahl<br />
für Dateitypen (Bereich 7)<br />
<strong>und</strong> sternförmige Radiobuttons<br />
(Bereich 8), über die Sie steuern,<br />
welche Wertung Bilder haben sollen,<br />
die das Programm nach der<br />
Suche anzeigt.<br />
Digikam führt bei Bedarf mehrere<br />
Varianten von Detailinformationen<br />
zum aktuellen Bild auf, wie<br />
Dateieigenschaften, Metadaten<br />
(EXIF-, IPTC-, XMP-Tags), Farbinformationen,<br />
Beschriftungen <strong>und</strong><br />
Stichwörter. Ein typischer Arbeitsablauf<br />
sieht vor, dass Sie Bilder<br />
von einer Kamera, einem Kartenleser<br />
oder USB-Medium einlesen.<br />
Dabei hat es sich bewährt,<br />
die Bilder zunächst in ein spezielles<br />
Eingangsverzeichnis zu importieren.<br />
Arbeiten Sie mit Rohdaten,<br />
sollten Sie diese nach DNG konvertieren,<br />
was später den Austausch<br />
vereinfacht.<br />
Nach dem Import haben Sie die<br />
Möglichkeit, die Bilder zu bewerten<br />
<strong>und</strong> jene auszuwählen, die Sie<br />
in Alben verschieben wollen. Über<br />
Stichwörter, Kommentare <strong>und</strong> die<br />
geographischen Daten vereinfachen<br />
Sie ein späteres Auffinden<br />
der Motive. Bei Bedarf bearbeiten<br />
72 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Digikam<br />
praxis<br />
<strong>und</strong> verbessern Sie die Fotos. Für<br />
ein detaillierteres Bearbeiten<br />
lohnt es sich aber, auf externe<br />
Programme zurückzugreifen.<br />
Importieren<br />
Um Bilder <strong>und</strong> andere Multimediadaten<br />
in die Applikation aufzunehmen,<br />
steht ein eigener<br />
Menüpunkt Importieren bereit.<br />
Dieses Menü erlaubt neben dem<br />
Einlesen der Inhalte von einer<br />
Kamera oder einem USB-Speicher<br />
das Kopieren der Daten von einem<br />
Kartenleser. Zwei weitere<br />
Punkte regeln den Import von lokalen<br />
Ordnern <strong>und</strong> Dateien, der<br />
Rest der Menüpunkte erlaubt den<br />
Zugriff auf Bilder in Online-Alben<br />
wie Facebook oder Picasa.<br />
Nach dem Anstecken eines Mediums<br />
erscheint ein neues Fenster,<br />
das die auf dem Speicher befindlichen<br />
Dateien anzeigt. Nun<br />
laden Sie entweder alle oder nur<br />
ausgewählte Bilder herunter.<br />
Nach einem Klick auf die entsprechende<br />
Schaltfläche fragt das Programm<br />
ab, in welches Album Sie<br />
die Bilder importieren möchten.<br />
Dabei können Sie alternativ auch<br />
ein neues Album anlegen. In jedem<br />
Fall haben Sie die Möglichkeit,<br />
die Eigenschaften des Albums<br />
(Titel, Kategorie oder Datum)<br />
zu bearbeiten. Ein Import<br />
ist zwar empfehlenswert, aber<br />
nicht zwingend notwendig: Da Digikam<br />
die verwalteten Verzeichnisse<br />
überwacht, genügt es auch,<br />
mit einem Dateimanager Bilder<br />
direkt in ein Album zu kopieren.<br />
Verzeichnisse lädt Digikam mit<br />
allen Unterverzeichnissen, sofern<br />
deren Namen nicht mit einem<br />
Punkt beginnen. Beim Import<br />
von Verzeichnissen kopiert die<br />
Software stillschweigend sämtliche<br />
darin enthaltenen Dateien,<br />
auch solche, die das Programm<br />
weder liest noch anzeigt.<br />
Für das direkte Laden von Bildern<br />
von der Kamera verwendet<br />
die Applikation Libgphoto2, die<br />
dieses Verfahren für viele gängigen<br />
Kameras ermöglicht. Das<br />
funktioniert allerdings nur, solange<br />
Sie die Kamera nicht als<br />
Massenspeicher eingehängt haben.<br />
Kameras, die diese Technik<br />
verwenden, erscheinen als Mass<br />
Storage Camera.<br />
Taggen <strong>und</strong> Bewerten<br />
Nach dem Laden in die Datenbank<br />
bietet es sich an, die Bilder<br />
zu verschlagworten. Sie können<br />
auch mehrere Bilder auswählen<br />
<strong>und</strong> mit einem gemeinsamen<br />
Schlagwort versehen: Das Kontextmenü<br />
jedes markierten Bildes<br />
zeigt unter Stichwort zuweisen<br />
eine Liste der bisher bekannten<br />
Stichwörter. Fehlt das Gewünschte<br />
für die ausgewählten Bilder, legen<br />
Sie es über Neues Stichwort<br />
hinzufügen an. Alternativ ziehen<br />
Sie die Stichwörter aus der Liste<br />
rechts auf die entsprechenden<br />
Bilder, was aber ein zusätzliches<br />
Bestätigen erfordert. Dafür bietet<br />
dieses Verfahren die Möglichkeit,<br />
in einem Schritt mehrere Stichwörter<br />
aus der Liste auszuwählen.<br />
Die einzelnen Tags trennen Sie<br />
mit Kommas. Analog entfernen<br />
Sie Stichwörter: Das Kontextmenü<br />
enthält einen entsprechenden<br />
Eintrag zum Entfernen der Tags<br />
von Bildern.<br />
Eine weitere, effektive Methode<br />
des Verschlagwortens stellt in der<br />
rechten Spalte der Reiter Beschriftung/<br />
Stichwörter (Abbildung B,<br />
nächste Seite) bereit. Dort zeigt<br />
Digikam veränderbare Details zu<br />
den ausgewählten Aufnahmen.<br />
Hier stellen Sie die Bewertung,<br />
das Aufnahmedatum sowie weitere<br />
Daten ein – <strong>und</strong> vergeben natürlich<br />
Stichwörter: Meine Stichwörter<br />
enthält eine Liste aller in<br />
der Datenbank vergebenen Stichwörter,<br />
von denen Sie die gewünschten<br />
via Mausklick in einer<br />
Checkbox auswählen. Zusätzlich<br />
stehen die zuletzt genutzten<br />
Stichwörter über den Button ganz<br />
rechts in dieser Zeile bereit. Der<br />
Button links davon bewirkt, dass<br />
Digikam die Liste auf die in den<br />
ausgewählten Bildern bisher<br />
schon verwendeten beschränkt.<br />
Digikam bietet die Möglichkeit,<br />
Stichwörter in Hierarchien zu<br />
ordnen. Als Trennsymbol verwendet<br />
es dabei einen Schrägstrich.<br />
Es empfiehlt sich, von dieser<br />
Möglichkeit Gebrauch zu machen:<br />
Legen Sie zu viele Einträge direkt<br />
auf der obersten Ebene an, hat<br />
das den Nachteil, dass die Liste<br />
A Das Hauptfenster<br />
von Digikam fasst die<br />
Elemente zum Verwalten<br />
der Bilder in drei<br />
Spalten zusammen.<br />
Glossar<br />
DNG: Ein von Adobe auf<br />
dem TIFF/ EP-Standard<br />
basierendes Format für<br />
digitale Negative. Das<br />
Unternehmen erlaubt<br />
den lizenzfreien Einsatz<br />
<strong>und</strong> hat einen Entwurf<br />
an die ISO-Gremien geschickt,<br />
um das Format<br />
in TIFF/ EP zu integrieren.<br />
installation<br />
Alle gängigen Distributionen führen Digikam in ihren Repositories.<br />
Um allerdings alle Features von Digikam zu nutzen, müssen<br />
Sie auch die Kipi-Plugins installieren. Für eine deutschsprachige<br />
Oberfläche benötigt das Programm zusätzlich das Paket kdel10n-de<br />
. Beim ersten Start aktiviert Digikam einen Assistenten,<br />
um einige Einstellungen vorzunehmen. Die meisten Möglichkeiten<br />
sind gut erklärt, die Voreinstellungen erweisen sich als<br />
sinnvoll – etwa beim Anlegen der Datei für die Datenbank im<br />
Wurzelverzeichnis. Beim Einsatz von Rohdaten lohnt es sich, den<br />
passenden Editor zu aktivieren.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 73
praxis<br />
Digikam<br />
B Eine Liste enthält<br />
bereits genutzte Tags.<br />
So verhindern Sie einen<br />
Wust von ähnlichen<br />
Schlagworten.<br />
C Unter dem Punkt<br />
Recent locations führt<br />
Digikam eine Liste mit<br />
den bereits ausgewählten<br />
Orten.<br />
schnell sehr lang <strong>und</strong> unübersichtlich<br />
ausfällt. Wichtig: Bei<br />
Stichwörtern unterscheidet Digikam<br />
zwischen Groß- <strong>und</strong> Kleinschreibung,<br />
bei HIMMEL, Himmel <strong>und</strong><br />
himmel handelt es sich also um unterschiedliche<br />
Tags.<br />
Stichwörter speichert das Bildarchiv<br />
in erster Linie in der Datenbank,<br />
kann sie aber auch in<br />
die Bilddateien übertragen. Die<br />
erste Methode ermöglicht den<br />
schnellen Zugriff, die zweite erlaubt<br />
es, Metadaten in andere<br />
Programme mitzunehmen. Dabei<br />
kommt es allerdings manchmal<br />
zu Verlusten, wenn diese Programme<br />
diese Daten ihrerseits<br />
nicht speichern. Im Menü Extras<br />
finden Sie den Menüpunkt Metadaten<br />
in alle Bilder schreiben, mit<br />
dem Digikam die in der Datenbank<br />
vorhandenen<br />
Einträge in<br />
einem<br />
Rutsch in<br />
die Bilder<br />
überträgt.<br />
Geodaten<br />
Geodaten<br />
ermöglichen<br />
es,<br />
Bilder aus<br />
einer Region<br />
zusammenzufassen.<br />
Spezielle<br />
EXIF-<br />
Tags nehmen<br />
bei<br />
Bedarf die passenden Koordinaten<br />
für Länge, Breite <strong>und</strong> Höhe<br />
auf. Digikam bietet im Menü Bild<br />
mehrere Möglichkeiten an, diese<br />
Daten auszuwerten:<br />
• Kameras mit GPS schreiben die<br />
Tags automatisch in die Bilder.<br />
Digikam erkennt das <strong>und</strong> pflegt<br />
die Daten in die Datenbank ein.<br />
• Bei mit GPS-Trackern aufgenommenen<br />
Daten gilt es, diese<br />
zeitlich synchronisiert auf die<br />
Bilder zu übertragen.<br />
• Mithilfe einer auf Google-Maps<br />
basierenden Karte geben Sie<br />
Tags nachträglich ein oder editieren<br />
diese.<br />
Die letzte Variante nutzen Sie<br />
über den Menüpunkt Bild | Geolokalisierung<br />
| Koordinaten bearbeiten<br />
…. Digikam öffnet ein Fenster<br />
(Abbildung C), in dem Sie die von<br />
Google-<br />
Maps bekannte<br />
Blase<br />
auf den<br />
Standort<br />
zum Zeitpunkt<br />
der<br />
Aufnahme<br />
verschieben.<br />
Mit einem<br />
Klick<br />
auf OK<br />
übernehmen<br />
Sie die<br />
Auswahl.<br />
Bewerten<br />
Handelt es sich bei den Stichwörtern<br />
schon um eine höchst individuelle<br />
Angelegenheit, gilt das in<br />
einem noch weit höheren Maß für<br />
die Bewertungen. Es bedarf einer<br />
stringent durchgehaltenen Taktik,<br />
um deren Vorteile richtig zu nutzen.<br />
Ein einfaches Verfahren zum<br />
Erstellen von Bewertungen basiert<br />
auf dem Prinzip, zwischen<br />
den Mengen der Bilder in den jeweiligen<br />
Bewertungsstufen ein<br />
festes Zahlenverhältnis im Bereich<br />
von 3 bis 10 anzustreben.<br />
Wählen Sie einen Faktor von 5,<br />
enthält jede untergeordnete Ebene<br />
immer nur ein Fünftel der Bilder<br />
der aktuellen. So entsteht relativ<br />
schnell eine ausgewogene Hierarchie.<br />
Eine ausführliche Diskussion<br />
zu diesem Thema findet<br />
sich im Web [2].<br />
Bilder suchen<br />
Digikam verfügt über verschiedene<br />
Sortier- <strong>und</strong> Suchfunktionen<br />
sowie Ansichten. Sie erreichen die<br />
Funktionen über Schaltflächen<br />
links im Rahmen des Fensters.<br />
Die Albenansicht zeigt die Bilder<br />
als Ordnerstruktur. Um die Liste<br />
einzugrenzen, geben Sie Suchfeld<br />
am unteren Rand den Namen<br />
oder Namensbestandteile ein.<br />
In der Kalenderübersicht sehen<br />
Sie Bilder aller Alben nach Jahreszahl<br />
<strong>und</strong> Monat chronologisch<br />
sortiert. So erhalten Sie schnell<br />
einen Überblick der in einem bestimmten<br />
Zeitraum gemachten<br />
Bilder. Die Zeitleiste dagegen<br />
zeigt eine statistische Übersicht<br />
der Bilderzahlen, aufgetragen als<br />
Histogramm gegen die Zeit.<br />
Über die Stichworte, welche die<br />
Applikation alphabetisch sortiert<br />
<strong>und</strong> hierarchisch gegliedert anzeigt,<br />
finden Sie die Aufnahmen,<br />
denen Sie die entsprechenden<br />
Tags zugeordnet haben. Ein Suchfeld<br />
am unteren Rand grenzt auch<br />
hier das Ergebnis ein.<br />
Die Funktion der unscharfen Suche<br />
ermöglicht es, anhand eines<br />
Beispielbildes ähnliche Aufnahmen<br />
zu finden. Ein Schwellwert<br />
74 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Digikam<br />
praxis<br />
legt fest, wie sehr sich die Bilder<br />
gleichen müssen. Hierfür berücksichtigt<br />
Digikam den Bildinhalt<br />
(Farben <strong>und</strong> Strukturen), den es<br />
in sogenannten Fingerabdrücken<br />
speichert. Die Funktion ermöglicht<br />
es außerdem, anhand einer<br />
groben Skizze nach Bildern zu<br />
suchen.<br />
Für die Kartensuche wertet das<br />
Programm die Geotags aus <strong>und</strong><br />
erlaubt es, in einer stilisierten<br />
Karte via Maus in Kombination<br />
mit [Strg] ein Gebiet zu markieren,<br />
aus dem die gesuchten Bilder<br />
stammen. Das funktioniert natürlich<br />
nur für Bilder, die Sie mit<br />
Geotags ausgezeichnet haben.<br />
Meist bietet das Bildarchiv auch<br />
eine inkrementelle Suche: Digikam<br />
zeigt dann nach Eingabe eines<br />
Buchstabens sofort alle passenden<br />
Ergebnisse. Das erweist<br />
sich insbesondere bei der Stichwortsuche<br />
als sehr effektiv.<br />
Digikam speichert Suchanfragen<br />
<strong>und</strong> hält sie für spätere Anfragen<br />
vor. Über die Schaltfläche<br />
mit dem Fernglas im linken Rahmen<br />
öffnet sich ein entsprechender<br />
Dialog. Ein Eingabefeld oben<br />
nimmt den Suchbegriff auf. Darunter<br />
öffnen Sie über eine entsprechende<br />
Schaltfläche die erweiterte<br />
Suche. Diese erreichen<br />
Sie alternativ über einen Klick auf<br />
Extras | Erweiterte Suche… oder<br />
[Strg]+[Alt]+[F].<br />
Hier definieren Sie eine Suche<br />
nach einzelnen EXIF-Tags, etwa<br />
nach hohen ISO-Werten (Abbildung<br />
D). Mehrere Angaben verknüpfen<br />
Sie mit einem logischen<br />
„UND“. Liefert die Suche ein befriedigendes<br />
Ergebnis, können Sie<br />
diese abspeichern. Dazu vergeben<br />
Sie einen möglichst eindeutigen<br />
Namen, der dann in der Liste darunter<br />
erscheint.<br />
Angaben in den Feldern unterhalb<br />
des Hauptfensters schränken<br />
ein, was Digikam tatsächlich anzeigt.<br />
Drei davon (Stichwörter<br />
jeglicher Art einschließlich Dateinamen,<br />
der Auswahlknopf für den<br />
Dateityp <strong>und</strong> die Bewertung) befinden<br />
sich direkt unter dem<br />
Hauptfenster <strong>und</strong> stellen<br />
so einfache Suchmethoden<br />
bereit: Wählen Sie<br />
dafür einfach das Hauptalbum<br />
aus <strong>und</strong> nutzen<br />
Sie dann diese Felder.<br />
Falls Digikam einige Bilder<br />
nicht findet, obwohl<br />
die Datenbank diese enthält,<br />
ist wahrscheinlich<br />
Albenunterbaum einschließen<br />
im Menü Ansicht<br />
nicht aktiviert.<br />
Im Test sorgten diese<br />
Controls aber für Irritationen,<br />
denn Sie schränken<br />
das Ergebnis einer<br />
Suche über die Schaltflächen<br />
auf der linken Seite ein. Falls<br />
Sie also beispielsweise das Eingabefeld<br />
für die Schlagwortsuche<br />
nicht löschen <strong>und</strong> dort auch nur<br />
ein Buchstabe zurückbleibt, reduziert<br />
sich das Suchergebnis auf unerwartete<br />
Weise. Da das Suchfeld<br />
Unicode-Zeichen akzeptiert, besteht<br />
somit die Möglichkeit, dass<br />
Sie versehentlich ein nicht sichtbares<br />
Zeichen eingeben, das dann in<br />
jedem Fall für eine ergebnislose<br />
Suche sorgt. Einziger Hinweis auf<br />
ein zusätzliches Suchkriterium ist<br />
eine Art Lämpchen neben dem<br />
Eingabefeld, das auf Rot springt,<br />
wenn die Eingabe kein Ergebnis<br />
liefert.<br />
Ordnung im Chaos<br />
Bei einer großen Menge an Bildern<br />
fällt es schwer, das Gesuchte<br />
über einzelne Tags zu finden –<br />
etwa, weil diese unvollständig<br />
sind, fehlen oder synonyme Stichwörter<br />
im Einsatz sind. Andererseits<br />
fördert die Suche bei korrekten<br />
<strong>und</strong> vollständigen Schlagworten<br />
oft einfach zu viele Treffer zutage.<br />
Hier hilft eine Kombination<br />
von Tags, das Ziel einzukreisen.<br />
Im Menü Ansicht existieren eine<br />
Reihe von Optionen, über die Sie<br />
die Darstellung der Bilder steuern.<br />
Bilder sortieren legt die Reihenfolge<br />
fest, die Digikam in Alben <strong>und</strong><br />
bei anderen Ausgaben verwendet,<br />
zum Beispiel bei den Stichwörtern<br />
oder in der Kalenderübersicht.<br />
Bilder gruppieren | Nach Album bewirkt,<br />
dass Digikam zusätzlich zu<br />
allen anderen Kriterien noch die<br />
Alben zeigt, in denen die Bilder<br />
lagern. Albumunterbaum einschließen<br />
<strong>und</strong> Stichwortunterbaum einschließen<br />
sorgen dafür, dass das<br />
Programm beim Einlesen <strong>und</strong> der<br />
Anzeige rekursiv arbeitet.<br />
Fazit<br />
Digikam bringt viele Funktionen<br />
mit, um auch sehr umfangreiche<br />
Bildersammlungen zu verwalten.<br />
Dabei speichert die Anwendung<br />
viele Daten separat in einer Datenbank,<br />
sodass der Originalzustand<br />
der Bilddateien erhalten<br />
bleibt. Das Hinzufügen von zusätzlichen<br />
Metadaten fällt nach einer<br />
kurzen Einarbeitungszeit<br />
leicht. Auf der anderen Seite erschlägt<br />
Digikam den Anwender<br />
förmlich mit seiner Funktionsvielfalt.<br />
Das macht es – zumindest<br />
mit den Standardeinstellungen –<br />
nicht gerade zur ersten Wahl für<br />
Gelegenheitsnutzer. Für diese gibt<br />
es geeignetere Kandidaten. Doch<br />
die Menge der Aufnahmen nimmt<br />
ständig zu, <strong>und</strong> nur mit einem<br />
ausreichend dimensionierten<br />
Werkzeug behalten Sie auch in Zukunft<br />
noch den Überblick. (agr) n<br />
info<br />
[1] Digikam: http:// www. digikam. org<br />
[2] Bewertungen: http:// www. gerhard. fr/ DAM/<br />
deutsch. html<br />
D Die erweiterte Suche<br />
erlaubt zum Beispiel<br />
das Filtern nach<br />
bestimmten Werten in<br />
EXIFTags.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 75
im test<br />
Synology DS110j<br />
Synology-NAS DS110j <strong>und</strong> Strato HiDrive<br />
Sinnig kombiniert<br />
© binski, 123RF<br />
Im Paket mit einem HiDrive-Account mit einer Speicherkapazität von 1 TByte bietet Strato das<br />
Synology-NAS DS110j zum Preis von 49 Euro bei 24 Monaten Laufzeit an. Thomas Leichtenstern<br />
ReADme<br />
Strato bietet im B<strong>und</strong>le<br />
mit einem 1-TByte-Hi-<br />
Drive-Account das Synology-NAS<br />
DS110j für 49<br />
beziehungsweise<br />
99 Euro an. Der Hoster<br />
liefert das Gerät mit einer<br />
1-TByte-WD-Festplatte<br />
<strong>und</strong> vorinstallierter<br />
Software zum Zugriff<br />
auf den HiDrive-<br />
Account aus.<br />
Der Webhoster Strato bietet zu<br />
seinen HiDrive-Accounts [1] der<br />
Größe 1 <strong>und</strong> 2 TByte ein Synology-NAS<br />
zum Vorzugspreis an. Bei<br />
einer HiDrive-Laufzeit von<br />
12 Monaten kostet das 1-TByte-<br />
NAS DS110j [2] 99 Euro, bei<br />
24 Monaten 49 Euro. Der Straßenpreis<br />
des Gerätes liegt bei<br />
knapp 180 Euro. Zum 2-TByte-<br />
Account liefert Strato optional<br />
das DS211j [3] für 149 beziehungsweise<br />
199 Euro. Hier liegt<br />
der reguläre Verkaufspreis bei<br />
technische spezifikAtionen<br />
Hersteller<br />
Synology<br />
Modell<br />
DS110j<br />
Betriebssystem Linux<br />
CPU<br />
Marvell 6281, 800 MHz<br />
Hauptspeicher 128 MByte DDR2<br />
Festplatte<br />
SATA II, 2,5 oder 3,5 Zoll, max. 3 GByte<br />
Leistungsaufnahme 19 W Betrieb, 9 W Ruhezustand<br />
Schnittstellen 3 x USB 2.0, 1 x RJ45 (GbE)<br />
Netzteil<br />
extern<br />
Geräuschpegel 19,9 dB(A)<br />
Größe (HxBxT) 160 X 63 X 218 mm<br />
Gewicht<br />
810 Gramm<br />
etwa 280 Euro. Im Strato-B<strong>und</strong>le<br />
arbeitet das NAS als lokaler Netzwerkspeicher,<br />
der HiDrive-Account<br />
dient in erster Linie zur Datensicherung.<br />
Zu diesem Zweck<br />
bietet der Hoster eine App für das<br />
NAS an, die es erlaubt, die Datenbestände<br />
konsistent zu halten.<br />
Innere Werte<br />
Die von uns getestete Synology<br />
Diskstation DS110j (Abbildung A)<br />
liefert Strato mit einer 1-TByte-<br />
Festplatte des Typs Western Digital<br />
WD10EARS aus der Caviar-<br />
Green-Reihe aus. Das mit Ext3 formatierte<br />
SATA-Laufwerk arbeitet<br />
mit 5400 Umdrehungen <strong>und</strong> besitzt<br />
64 MByte Cache. Die Zugriffszeit<br />
liegt laut Hersteller bei 8,9 ms.<br />
Die Platte zeichnet sich durch<br />
niedrigen Energieverbrauch <strong>und</strong><br />
eine geringe Geräuschentwicklung<br />
aus. Im Test erreichte sie beim<br />
Kopieren einer 1-GByte-Datei<br />
etwa 30 MByte/ s Durchsatz. Da<br />
das auf Blockebene arbeitende<br />
Hdparm der Platte aber mit annähernd<br />
100 MByte/ s durchaus ordentliche<br />
Werte attestiert, bremst<br />
vermutlich das Dateisystem die<br />
Performance aus. Um die Platte<br />
gegen eine größere oder schnellere<br />
zu tauschen, lösen Sie am Blech<br />
auf der Rückseite die zwei äußersten<br />
Schrauben oben <strong>und</strong> unten.<br />
Danach schieben Sie den Deckel<br />
nach vorne auf. Das NAS unterstützt<br />
HDDs bis zu einer Größe<br />
von 3 TByte. Beachten Sie: Beim<br />
ersten Start mit einer neuen Platte<br />
formatiert das NAS diese <strong>und</strong><br />
installiert darauf das auf Linux<br />
basierende Betriebssystem. Sämtliche<br />
enthaltenen Daten gehen dabei<br />
entsprechend verloren.<br />
Zum Anschluss von Druckern<br />
oder USB-Massenspeichern bietet<br />
die DS110j drei USB-2.0-Anschlüsse.<br />
Die Schnittstellen eignen<br />
sich jedoch nicht dazu, das<br />
Gerät seinerseits als externe USB-<br />
Festplatte zu verwenden, was<br />
beim erstmaligen Befüllen des<br />
Storage durchaus hilfreich wäre.<br />
Der Anschluss ans LAN erfolgt via<br />
76 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Synology DS110j<br />
im test<br />
Gbit-Ethernet, WLAN bringt das<br />
Gerät von Hause aus nicht mit.<br />
Allerdings unterstützt es eine Reihe<br />
von USB-WLAN-Dongles [4],<br />
um diese Funktion nachzurüsten.<br />
Laut Hersteller begnügt sich die<br />
Diskstation mit einem Stromverbrauch<br />
von 19 Watt im Betrieb<br />
<strong>und</strong> 9 Watt im Ruhezustand. Die<br />
mit 800 MHz getaktete ARM-CPU<br />
des Typs Marvell 6281 liefert für<br />
die meisten Anwendungsfälle ausreichend<br />
Leistung, allerdings fällt<br />
die Speicherausstattung mit<br />
128 MByte RAM eher mager aus.<br />
Ein Auf- oder Umrüsten des Speichers<br />
ist nicht möglich.<br />
Zum Lieferumfang der DS110j<br />
gehören neben dem NAS selbst je<br />
ein Strom- <strong>und</strong> LAN-Kabel sowie<br />
eine DVD mit dem Handbuch <strong>und</strong><br />
der Software. Die Tabelle Technische<br />
Spezifikationen fasst die Eckdaten<br />
des Gerätes zusammen.<br />
Erster Start<br />
Installationssoftware steht sowohl<br />
für Windows als auch Mac<br />
OS X <strong>und</strong> Linux zum Einsatz bereit.<br />
Für Linux beschränkt sie sich<br />
jedoch auf den sogenannten Synology<br />
Assistant (Abbildung B). Dieser<br />
dient in erster Linie dazu, das<br />
NAS im Netz ausfindig zu machen<br />
<strong>und</strong> in einer Tabelle anzuzeigen.<br />
Da Sie die Administrationsoberfläche<br />
des Gerätes nach dem Anschluss<br />
ans Netz aber <strong>ohne</strong>hin<br />
über http://diskstation:5000 erreichen,<br />
bleibt der Sinn der Funktion<br />
unklar. Darüber hinaus bietet die<br />
Applikation einen Ressourcenmonitor<br />
sowie eine Funktion namens<br />
Photo Uploader. Für den Zugriff<br />
über potenziell unsichere Netze<br />
bietet das NAS auch die verschlüsselte<br />
HTTPS-Variante an.<br />
Am Synology DiskStation Manager<br />
melden Sie sich via Browser<br />
mit dem Nutzernamen admin<br />
<strong>ohne</strong> Passwort an. Das Webinterface<br />
haben die Entwickler dem<br />
Look & Feel einer Desktopumgebung<br />
nachempf<strong>und</strong>en (Abbildung<br />
C, nächste Seite). So öffnet<br />
ein Mausklick auf eines der Elemente<br />
stets ein Fenster, das Sie<br />
beliebig auf<br />
dem Pseudo-<br />
Desktop positionieren.<br />
Die<br />
Fenster besitzen<br />
am oberen<br />
rechten<br />
Rand die bekannten<br />
Symbole<br />
zum<br />
Schließen <strong>und</strong><br />
Verkleinern,<br />
der Dateibrowser<br />
unterscheidet sich sowohl<br />
optisch als auch technisch nur<br />
unwesentlich von den bekannten<br />
lokalen Varianten.<br />
Einrichten <strong>und</strong> Verwalten<br />
Um das Passwort für das Admin-<br />
Konto einzustellen, klicken Sie zunächst<br />
auf das Icon Bedienfeld <strong>und</strong><br />
im neuen Fenster auf Benutzer.<br />
Ein Doppelklick auf admin öffnet<br />
den Konfigurationsdialog. Er erlaubt<br />
auch das Zuteilen von Disk-<br />
Quota sowie das Zuweisen zu<br />
Gruppen. Über Gemeinsame Ordner<br />
im Fenster Bedienfeld richten<br />
Sie Freigaben ein. Alternativ verwenden<br />
Sie als Übertragungsprotokoll<br />
SMB/ CIFS, NFS oder FTP,<br />
Letzteres optional auch SSL/ TLSverschlüsselt.<br />
Ferner erlaubt das<br />
NAS auch das Anlegen verschlüsselter<br />
Shares. Diese chiffriert es<br />
mit Ecryptfs, dessen Ergebnis die<br />
Box via Fuse ins Dateisystem einhängt.<br />
Das geschieht aber sowohl<br />
auf der Web-<strong>GUI</strong> als auch bei der<br />
Freigabe transparent. Allerdings<br />
lassen sich verschlüsselte<br />
Shares nicht mit NFS<br />
einbinden.<br />
Der nach unten zeigende<br />
Pfeil oben links öffnet einen<br />
den gängigen Desktops<br />
nachempf<strong>und</strong>enen<br />
Programmstarter. Er enthält<br />
sämtliche installierten<br />
Apps sowie einige nützliche<br />
Zusatzfeatures wie<br />
etwa den Ressourcenmonitor.<br />
Dieser zeigt die Auslastung<br />
von CPU <strong>und</strong><br />
Hauptspeicher sowie den<br />
Netzwerkdurchsatz an. Ein<br />
Klick aufs jeweilige<br />
Diagramm öffnet die Detailansicht.<br />
Wie es um die Ressourcen<br />
der Festplatte bestellt ist, zeigt<br />
der Speichermanager. Er bietet darüber<br />
hinaus einen SMART-Test<br />
sowie die Möglichkeit, das NAS<br />
als iSCSI-Target zu nutzen. Allgemeine<br />
Informationen des Gerätes<br />
zeigt ein Klick auf Systeminformationen,<br />
in dem Sie auch auf verschiedene<br />
Logs zugreifen.<br />
Um via SSH auf das NAS zuzugreifen,<br />
aktivieren Sie im Bedienfeld<br />
unter Terminal die Checkbox<br />
neben SSH-Dienst aktivieren. Ein<br />
Einstellen des Ports erlaubt die<br />
Konfiguration jedoch nicht. Möchten<br />
Sie als Root auf der Maschine<br />
arbeiten, melden Sie sich via ssh<br />
root@IP‐Adresse auf dem Server an.<br />
Als Passwort verwenden Sie jenes<br />
des Admin-Accounts. Ein su als<br />
normaler Nutzer scheitert mit<br />
dem Hinweis su: must be suid to<br />
work properly.<br />
Eine weitere Möglichkeit, Multimedia-Dateien<br />
im Netz zu teilen,<br />
A Das Synology-NAS<br />
DS110j besitzt ungefähr<br />
die Abmessungen<br />
eines Taschenbuches.<br />
B Neben dem Aufspüren<br />
angeschlossener<br />
Synology-Systeme im<br />
Netz beherbergt der<br />
Synology Assistant einen<br />
Ressourcenmonitor<br />
<strong>und</strong> einen Foto-<br />
Uploader.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 77
im test<br />
Synology DS110j<br />
C Nicht nur optisch<br />
erweckt die webbasierte<br />
Konfiguration<br />
des NAS den Anschein<br />
einer Desktopoberfläche.<br />
Auch viele Funktionen<br />
wurden daraus<br />
übernommen.<br />
bietet die Box via DLNA/ UPnP.<br />
Sofern das Empfangsgerät – sei es<br />
Rechner, Fernseher oder Smartphone<br />
– über einen geeigneten<br />
Client verfügt, ist es in der Lage,<br />
Filme, Musik <strong>und</strong> Bilder direkt<br />
wiederzugeben.<br />
Ziehen Sie es vor, Dateien aus<br />
dem Internet direkt auf das NAS<br />
zu laden, verwenden Sie dafür die<br />
integrierte Download Station, die<br />
Sie zunächst im Bedienfeld aktivieren<br />
<strong>und</strong> danach über den Programmstarter<br />
aufrufen. Das Modul<br />
unterstützt neben regulären<br />
HTTP-Downloads auch BitTorrent<br />
<strong>und</strong> Emule (Abbildung D).<br />
Der Zeitplaner ermöglicht es Ihnen<br />
festzulegen, wann das NAS<br />
mit dem Download beginnen soll.<br />
Daten sichern<br />
Eine nicht unerhebliche Rolle auf<br />
einer zentralen Sammelstelle für<br />
Daten spielt das Backup. Das<br />
Synology-NAS bietet dafür im<br />
Startmenü den Eintrag Datensicherung<br />
-<strong>und</strong> -wiederherstellung an.<br />
Als Ziel wählen Sie zwischen einer<br />
externen Festplatte <strong>und</strong> verschiedenen<br />
Sicherungsorten im<br />
Netzwerk – unter anderem Amazons<br />
S3, einem Synology- oder einem<br />
eigenen Rsync-Server. Im<br />
gut beschriebenen Konfigurationsdialog<br />
legen Sie den Zeitplan<br />
sowie die zu sichernden Verzeichnisse<br />
fest. Eine Auswahl der Backupstrategie,<br />
etwa inkrementell<br />
oder differenziell, beherrscht das<br />
Modul nicht.<br />
Das in unserem Testgerät bereits<br />
vorinstallierte Modul HiDrive<br />
Backup erlaubt das Erstellen der<br />
Datensicherung auf Stratos Online-Speicher.<br />
Daneben bietet<br />
Strato die App unter [5] zum<br />
Download an. Im Gr<strong>und</strong>e funktioniert<br />
diese wie das beschriebene<br />
generische Backup-Modul, mit<br />
dem Unterschied, dass sie <strong>ohne</strong><br />
große Mühen das Einbinden des<br />
Strato-Accounts erlaubt. Nach einem<br />
Klick auf Erstellen erscheint<br />
der Konfigurationsdialog, in dem<br />
Sie den Benutzernamen <strong>und</strong> das<br />
Passwort des HiDrive-Accounts<br />
eingeben. Darunter ermöglichen<br />
diverse Checkboxen das An- <strong>und</strong><br />
Abwählen von Features wie Übertragungsverschlüsselung<br />
aktiveren<br />
oder Es werden nur geänderte Inhalte<br />
innerhalb von Truecrypt Containern<br />
(Abbildung E).<br />
Der letzte Eintrag gestattet, die<br />
Bandbreite beim Backup zu limitieren,<br />
damit noch genug Durchsatz<br />
zum Arbeiten verbleibt. Idealerweise<br />
stellen Sie im Reiter Geplante<br />
Datensicherung eine Zeit<br />
ein, zu der das erhöhte Datenaufkommen<br />
beim Backup keine Rolle<br />
spielt. Der Backup-Planer erlaubt<br />
das Anlegen beliebig vieler Aufgaben.<br />
So sichern Sie beispielsweise<br />
wichtige Dokumente im St<strong>und</strong>entakt,<br />
weniger wichtige nur wöchentlich.<br />
Einen schnellen Überblick<br />
über die Einstellungen des<br />
jeweiligen Backup-Sets liefert Info<br />
abrufen. Möchten Sie die Sicherung<br />
außerhalb des festgelegten<br />
Zeitplans starten, klicken Sie auf<br />
Jetzt Datensicherung durchführen.<br />
Im HiDrive-Account erscheint<br />
das Backup im Verzeichnis user/<br />
Nutzername/DiskStation_Kennung/GesicherteOrdner.<br />
Da HiDrive seinerseits<br />
regelmäßig Sicherungen anlegt,<br />
besteht bei dieser Kombination<br />
nur eine minimale Gefahr<br />
von Datenverlusten, wenngleich<br />
das Prozedere kein Backup im<br />
klassischen Sinn ersetzt.<br />
D Der Downloadmanager<br />
des NAS erlaubt<br />
<strong>ohne</strong> Umwege über<br />
den Client das direkte<br />
Herunterladen von Dateien<br />
aus dem Internet.<br />
Er unterstützt dazu<br />
unter anderem Emule<br />
<strong>und</strong> BitTorrent.<br />
Erweiterte Funktionen<br />
Möchten Sie vom Internet aus auf<br />
das NAS zugreifen, müssen Sie<br />
78 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Synology DS110j<br />
im test<br />
dazu die entsprechenden Ports<br />
auf dem Router an das Gerät weiterleiten.<br />
Das notwendige Setup<br />
übernimmt das Modul Routerkonfiguration.<br />
Aus einer Liste wählen<br />
Sie den Router aus <strong>und</strong> geben<br />
Nutzernamen <strong>und</strong> Passwort an.<br />
Via Erstellen legen Sie danach die<br />
Ports fest, die der Router an das<br />
NAS weiterleiten soll. Da in der<br />
Auswahl unterstützter Geräte die<br />
in Deutschland weitverbreiteten<br />
Modelle von AVM <strong>und</strong> Speedport<br />
fehlen, dürften viele Nutzer hierzulande<br />
allerdings nicht umhinkommen,<br />
manuell am Router<br />
Hand anzulegen.<br />
Um Einbruchsversuchen via<br />
Brute Force vorzubeugen, nutzen<br />
Sie die Automatische Blockierung.<br />
Nach einer definierten Anzahl<br />
fehlgeschlagener Login-Versuche<br />
innerhalb einer bestimmten Zeit<br />
sperrt das NAS den Zugriff. Optional<br />
legen Sie unter Ablauf der Blockierung<br />
fest, nach wie vielen Tagen<br />
das NAS die IP-Adresse wieder<br />
freischaltet. Die Sperrung betrifft<br />
nicht nur den Port, auf dem die<br />
fehlgeschlagenen Logins stattfanden,<br />
sondern greift für alle.<br />
Können oder wollen Sie nicht<br />
über die Standardschnittstellen<br />
auf die gehosteten Daten zugreifen,<br />
nutzen Sie stattdessen die File<br />
Station, die Sie über http://diskstation:7000<br />
erreichen. Im Gr<strong>und</strong>e<br />
handelt es sich dabei um einen in<br />
HTML implementierten Dateibrowser,<br />
der in der Verzeichnisliste<br />
links oben die gehosteten<br />
Shares anzeigt <strong>und</strong> darunter die<br />
Ordner des lokalen Laufwerks.<br />
Dateien <strong>und</strong> Verzeichnisse verschieben<br />
oder kopieren Sie via<br />
Drag & Drop vom lokalen Rechner<br />
in die gewünschte Freigabe. Zum<br />
Herunterladen einer Datei genügt<br />
ein Doppelklick darauf. Um ein<br />
komplettes Verzeichnis zu kopieren,<br />
klicken Sie mit der rechten<br />
Maustaste darauf <strong>und</strong> wählen Sie<br />
aus dem Kontextmenü Herunterladen,<br />
worauf die Software die<br />
Daten als ZIP-File transferiert.<br />
Um eine nette, aber nur unzureichend<br />
umgesetzte Idee handelt<br />
es sich bei der Photo Station. Nach<br />
dem Aktivieren bindet dieses Modul<br />
sämtliche in das Share photo<br />
hochgeladenen Bilddateien in ein<br />
auf Cooliris [6] basierendes Webalbum<br />
ein. Im Test dauerte das<br />
allerdings bei 26 im Schnitt<br />
400 KByte großen Bildern über<br />
eine St<strong>und</strong>e – bei einer permanenten<br />
CPU-Auslastung von<br />
knapp 100 Prozent. Ein Blick in<br />
top ergab, dass convert damit beschäftigt<br />
war, jedes Bild in vier<br />
verschieden große <strong>Vorschau</strong>bilder<br />
umzuwandeln, was die CPU über<br />
Gebühr beanspruchte.<br />
An dieser Stelle kommt der große<br />
Auftritt des eingangs erwähnten<br />
Synology Assistant: Die Funktion<br />
Foto-Uploader übernimmt<br />
nämlich das Konvertieren der Bilder<br />
bereits auf dem Client-Rechner<br />
<strong>und</strong> reduziert so sowohl den<br />
Rechenaufwand als auch die Zeit<br />
zum Anlegen des Albums drastisch.<br />
Ein Set aus etwa 100 Bildern<br />
verarbeitete der Assistent in<br />
nicht einmal zehn Minuten. Die<br />
Galerie erreichen Sie anschließend<br />
im Browser unter der URL<br />
http://diskstation/photo.<br />
Externe Geräte<br />
Von seiner besten Seite präsentiert<br />
sich die Diskstation DS110j<br />
im Umgang mit externen Geräten.<br />
USB-Massenspeicher bindet<br />
sie direkt nach dem Einstecken<br />
im Verzeichnis usbshare ins Dateisystem<br />
ein. Verwalten lassen sich<br />
die Medien über das Bedienfeld<br />
unter Externe Geräte.<br />
Um den kompletten Inhalt des<br />
externen Speichers auf das NAS<br />
zu kopieren, aktivieren Sie zunächst<br />
im Reiter USBCopy die<br />
Checkbox vor USBCopy aktivieren.<br />
Damit genügt zukünftig ein<br />
Druck auf die grün beleuchtete<br />
Taste auf der Frontseite der<br />
DS110j, um den Kopiervorgang<br />
zu starten. Nach Abschluss der<br />
Aktion hängt das NAS den Datenträger<br />
selbstständig aus, die grüne<br />
Kontrollleuchte erlischt.<br />
Möchten Sie lediglich einzelne<br />
Dateien oder Ordner auf das NAS<br />
kopieren, genügt es, sie im Dateibrowser<br />
per Drag & Drop an die<br />
gewünschte Stelle zu ziehen.<br />
Auch den im Test angeschlossenen<br />
Drucker Canon Pixma<br />
IP4600 erkannte die Diskstation<br />
anstandslos <strong>und</strong> stellte ihn via<br />
SMB im Netz zum Einsatz bereit.<br />
Fazit<br />
Das Synology-NAS DS110j machte<br />
im Test eine ausgesprochen<br />
gute Figur. Das Gerät passt nicht<br />
zuletzt wegen seines transparenten<br />
Designs <strong>und</strong> der offenen<br />
Schnittstellen perfekt in Stratos<br />
HiDrive-Portfolio.<br />
Abgesehen von der etwas langsamen<br />
Festplatte <strong>und</strong> dem mit<br />
128 MByte eher mickerig dimensionierten<br />
Hauptspeicher gab es<br />
am Gerät sowohl hard- als auch<br />
softwareseitig nichts zu bemängeln.<br />
Trotz des eingebauten Lüfters<br />
arbeitet das Gerät ausgesprochen<br />
leise. Die Konfiguration via<br />
Web-<strong>GUI</strong> wirkt bis ins Detail<br />
durchdacht, dasselbe gilt für die<br />
Strato-App zum Einbinden des<br />
HiDrive-Accounts. (tle) n<br />
E Das Modul HiDrive<br />
Backup erlaubt, in wenigen<br />
Minuten einen<br />
HiDrive-Account zur<br />
Datensicherung einzubinden.<br />
[1] Strato HiDrive: http:// www. strato. de/ online-speicher/ privat-speicher/<br />
[2] Synology DS110j: http:// www. synology. com/ products/ spec. php? product_<br />
name=DS110j& lang=deu<br />
[3] Synology DS211j: http:// www. synology. com/ products/ spec. php? product_<br />
name=DS211j& lang=deu<br />
[4] Von Synology unterstützte WLAN-Dongles:<br />
http:// www. synology. com/ support/ faq_show. php? q_id=427& lang=deu<br />
[5] Strato HiDrive Synology App: http:// strato-faq. de/ 808<br />
[6] Cooliris: http:// www. cooliris. com<br />
info<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 79
netz&system<br />
Sbackup<br />
Simples Backup für Ubuntu<br />
Sichere Daten<br />
Schnell mal ein Backup einrichten? Mit Sbackup <strong>und</strong> seiner grafischen<br />
Oberfläche archivieren Sie wichtige Daten im Handumdrehen. Kristian Kißling<br />
© Domen Colja, 123RF<br />
ReaDme<br />
Sbackup 0.11.4<br />
LU/sbackup/<br />
Sbackup präsentiert<br />
sich als durchdachtes<br />
Programm zum Sichern<br />
von Benutzerdaten aller<br />
Art. Trotz einiger Inkonsistenzen<br />
in der Bedienung<br />
funktioniert<br />
Sbackup insgesamt<br />
sehr gut <strong>und</strong> erlaubt das<br />
komfortable Sichern<br />
<strong>und</strong> flexible Wiederherstellen<br />
wichtiger Dateien<br />
<strong>und</strong> Verzeichnisse.<br />
InstallatIon<br />
Ubuntu 11.04 „Natty“ führt die (zum Testzeitpunkt) aktuellste<br />
Version von Sbackup (0.11.4) bereits in seinen Repositories.<br />
Zur Installation starten Sie das Software-Center,<br />
geben oben rechts in der Suchmaske den Begriff sbackup<br />
ein <strong>und</strong> markieren die zwei Pakete sbackup <strong>und</strong> sbackupgtk<br />
zu Installation. Das Paket sbackup-plugins-fuse benötigen<br />
Sie in aller Regel nicht, da Sbackup über Gnomes GIO/<br />
GVFS bereits auf entfernte Speicherorte zugreifen kann.<br />
Möchten Sie sicher sein, stets die aktuellste Sbackup-Version<br />
zu betreiben, binden Sie das Projekt-PPA<br />
(ppa:nssbackup‐team/ppa) in die Paketquellen Ihres Ubuntu-<br />
Systems ein <strong>und</strong> installieren Sbackup von dort.<br />
Neuen Festplatten sieht man selten<br />
an, ob sie morgen oder erst in<br />
vier Jahren den Geist aufgeben.<br />
Fest steht, dass der Tag irgendwann<br />
kommt – <strong>und</strong> dann möchten<br />
Sie Ihre Daten gern in Sicherheit<br />
wissen. Diese speichern sich jedoch<br />
nicht von allein: Programme<br />
wie Sbackup [1] helfen beim Sichern<br />
der Datenflut. Die in Python<br />
geschriebene Software galt<br />
lange als Standard-Backup-Programm<br />
von Ubuntu, da sie im<br />
Rahmen von Googles „Summer of<br />
Code“ für die Distribution entwickelt<br />
wurde. Tatsächlich bringt sie<br />
gegenüber anderen etablierten<br />
Backup-Lösungen wie Rsnapshot<br />
<strong>und</strong> Rsync den Vorteil mit, eine<br />
auf Gtk+ basierende grafische<br />
Oberfläche zu besitzen. Das sollte<br />
Sie aber nicht dazu verleiten, blind<br />
auf irgendwelche Knöpfchen zu<br />
drücken. Solange Sie nicht genau<br />
wissen, wie das Programm funktioniert,<br />
sollten Sie Sbackup keine<br />
wertvollen Daten anvertrauen:<br />
Trotz der Einfachheit (das S in<br />
Sbackup steht für „simple“) birgt<br />
die Software ein paar Fallstricke.<br />
Sbackup besteht aus zwei Komponenten<br />
(Abbildung A): dem Backup-Frontend<br />
Simple Backup-Configuration<br />
<strong>und</strong> dem Wiederherstellungstool<br />
Simple Backup-Restoration.<br />
Im klassischen Gnome-Menü<br />
finden Sie beide unter Systemwerkzeuge.<br />
Über Simple Backup<br />
Config richten Sie Sbackup ein.<br />
Hier legen Sie fest, welche Daten<br />
die Software sichert, wo sie diese<br />
ablegt <strong>und</strong> wie häufig sie das tut.<br />
Über den Restoration-Teil von<br />
Sbackup stellen Sie die Sicherungen<br />
bei Bedarf wieder her.<br />
Verwenden Sie eine andere Distribution als Ubuntu, installieren<br />
Sie Sbackup aus dem Tarball [2] – es setzt Python ab<br />
Version 2.5, PyGTK ab Version 2.10, die Python-setuptools,<br />
Pygnome, Pyglade, Pynotify, Gettext, Gvfs, Gvfs-fuse sowie<br />
Gvfs-backends voraus. Wollen Sie die Fuse-Plugins betreiben,<br />
benötigen Sie zusätzlich Fuse selbst sowie Python-pexpect<br />
<strong>und</strong> Sshfs sowie Curlftpfs. Nach dem Entpacken des<br />
Tarballs wechseln Sie in das neu entstandene Verzeichnis<br />
<strong>und</strong> rufen dort make auf, dann als Root make install. Damit<br />
richten Sie Sbackup unter /usr/local ein <strong>und</strong> starten<br />
es anschließend durch den Aufruf von sbackupconfig. Zum<br />
Betrieb benötigt das Programm administrative Rechte.<br />
82 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Sbackup<br />
netz&system<br />
Auftakt<br />
Beim Sichern der Daten machen<br />
Sie im Regelfall zunächst ein vollständiges<br />
Backup, im Anschluss<br />
folgen dann sogenannte inkrementelle<br />
Backups: Diese speichern<br />
lediglich die Dateien, die<br />
sich seit der letzten Datensicherung<br />
verändert haben. In gewissen<br />
regelmäßigen Abständen (wöchentlich,<br />
monatlich – je nach Bedarf)<br />
folgen dann wieder Volldatensicherungen.<br />
So sammeln sich<br />
dank der inkrementellen Methode<br />
keine immensen Datenmengen<br />
an. Auf jeden Fall sollten Sie<br />
im Vorfeld errechnen, wie viel<br />
Speicherplatz Sie voraussichtlich<br />
für Ihre Daten benötigen <strong>und</strong> die<br />
Sicherungszyklen dementsprechend<br />
einrichten.<br />
Um das gesamte System zu archivieren<br />
<strong>und</strong> bei Bedarf zu restaurieren,<br />
eignet sich Sbackup<br />
nicht. Sie sichern damit aber<br />
<strong>ohne</strong> Probleme die Dateien aus<br />
den Home-Verzeichnissen. Bei<br />
der Wahl des Speicherortes sollten<br />
Sie bedenken, dass auch externe<br />
Festplatte irgendwann das<br />
Zeitliche segnen. Erfreulicherweise<br />
hinterlegt die Software Daten<br />
auch auf SSH- <strong>und</strong> FTP-Servern.<br />
Alternativ kaufen Sie also Speicherplatz<br />
bei einem Webspace-<br />
Anbieter [3] <strong>und</strong> verschieben die<br />
Daten dorthin. Der Vorteil: Diese<br />
Anbieter erstellen meist selbst<br />
Backups ihrer K<strong>und</strong>endaten. Diese<br />
lassen sich also nach einem<br />
Zwischenfall im Rechenzentrum<br />
wiederherstellen. Der Nachteil:<br />
Sie sind gezwungen, die Daten zu<br />
verschlüsseln, um Ihre Privatsphäre<br />
zu schützen.<br />
Anpacken<br />
Beim ersten Aufruf beschwert<br />
sich Sbackup sofort darüber, dass<br />
es kein gültiges Backup-Profil finden<br />
kann – ein solches gilt es nun<br />
anzulegen. Damit beginnen Sie<br />
im Reiter Allgemein (Abbildung<br />
B). Hier legen Sie fest, in<br />
welchen Intervallen Sbackup statt<br />
einer inkrementellen Sicherung<br />
ein Vollbackup vornehmen soll,<br />
<strong>und</strong> bestimmen, ob <strong>und</strong> mit welcher<br />
Kompressionsmethode das<br />
Programm den Datenumfang reduziert.<br />
Außerdem weisen Sie<br />
Sbackup hier bei Bedarf an, die<br />
Sicherungsarchive in handliche<br />
Teile zu zerlegen, mit denen auch<br />
ältere Dateisysteme wie FAT16<br />
<strong>und</strong> FAT32 umgehen können.<br />
Welche Dateien Sie sichern wollen,<br />
bestimmen Sie in den Registern<br />
Zu sichernde Daten <strong>und</strong> Nicht<br />
Sichern. Die Optionen in diesen<br />
Reitern erklären sich von selbst.<br />
Über Datei hinzufügen füttern Sie<br />
die Liste auf dem Reiter Zu sichernde<br />
Daten mit entsprechenden<br />
Dateien <strong>und</strong> Verzeichnissen<br />
(Abbildung C).<br />
Unter Nicht Sichern nehmen Sie<br />
gegebenenfalls komplette Pfade<br />
oder bestimmte Dateitypen von<br />
der Sicherung aus (Abbildung D,<br />
nächste Seite). Sbackup ermittelt<br />
den Dateityp anhand der Namensendung,<br />
hier dürfen Sie auch<br />
eigene Dateitypen definieren.<br />
Caches, gelöschte Dateien,<br />
Thumbnails <strong>und</strong> ähnlich Backup-<br />
Unwürdiges schließt das Programm<br />
bereits von sich aus über<br />
Reguläre Ausdrücke von der Datensicherung<br />
aus. Weiteren Ausnahmen<br />
über selbst definierte<br />
Regexe [4] steht nichts im Weg.<br />
Unter Sonstiges unterbinden Sie<br />
das Sichern von Files, die eine<br />
bestimmte Größe überschreiten,<br />
<strong>und</strong> legen fest, ob Sbackup Symlinks<br />
folgen soll.<br />
Auf dem Reiter Zielverzeichnis<br />
definieren Sie den Ort, an dem<br />
Sbackup die Sicherungen ablegen<br />
soll. Standardmäßig sichert das<br />
Programm die Daten nach /var/<br />
backup (Standardverzeichnis ),<br />
über den zweiten Auswahlpunkt<br />
A Sbackup besteht aus<br />
einem Frontend für<br />
Konfiguration <strong>und</strong><br />
Backup sowie einem<br />
Wiederherstellungsteil.<br />
B Im Reiter Allgemein treffen Sie Gr<strong>und</strong>einstellungen für das Backup.<br />
In aller Regel könne Sie hier die Vorgaben stehen lassen.<br />
C Über das Register Zu sichernde Daten legen Sie fest, welche Dateien<br />
<strong>und</strong> Verzeichnisse Sie sichern wollen.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 83
netz&system<br />
Sbackup<br />
D Im Reiter Nicht<br />
Sichern schließen Sie<br />
unwichtige oder unerwünschte<br />
Daten von<br />
der Sicherung aus.<br />
E Sbackup akzeptiert<br />
als Zielverzeichnis sowohl<br />
lokale Medien als<br />
auch Netzwerklaufwerke.<br />
(Benutzerdefiniertes geben Sie<br />
einen anderen Ordner an. Dieser<br />
darf sich auf der lokalen Festplatte<br />
befinden, es kann sich aber auch<br />
um externe Medien oder via Netzwerk-Share<br />
eingeb<strong>und</strong>ene Laufwerke<br />
handeln (Abbildung E).<br />
Wollen Sie Ihre Daten auf einen<br />
Server im Netz sichern, nutzen<br />
Sie dazu die Option Einen entfernten<br />
Speicher verwenden. Sie geben<br />
die notwendigen Anmeldedaten<br />
entweder direkt oder Schritt für<br />
Schritt im Dialog unter Verbinde…<br />
ein <strong>und</strong> prüfen dort über Verbinden,<br />
ob die Verbindung überhaupt<br />
zustande kommt. Der Eintrag<br />
ftp://User@Server/Verzeichnis<br />
sichert mittels des Benutzerkontos<br />
User die Daten im Ordner Verzeichnis<br />
auf dem FTP-Server Server.<br />
Erfreulicherweise<br />
übernimmt der Restore-<br />
Teil von Sbackup die angegebene<br />
Adresse später<br />
automatisch: Das spart<br />
zusätzliche Tipparbeit<br />
beim Wiederherstellen<br />
der Daten.<br />
Time is on my side<br />
Im Reiter Zeitplan stellen<br />
Sie das Backup scharf<br />
(Abbildung F). Unter<br />
Einfach legen Sie über das<br />
Ausklappmenü Sicherungen<br />
erstellen fest, in welchen<br />
Intervallen Sbackup die Daten<br />
automatisch sichert, wobei<br />
die Auswahl von Täglich bis Monatlich<br />
reicht. Entscheiden Sie<br />
sich für Benutzerdefiniert eröffnet<br />
das Eingabefeld Cron-Ausdruck die<br />
Möglichkeit, einen Cron-Job für<br />
das Backup einzurichten (siehe<br />
Kasten Cron-Job). Nach einem<br />
Neustart des Systems nimmt<br />
Sbackup die Sicherungen in den<br />
von Ihnen festgelegten Intervallen<br />
vor – entweder nach eigenem<br />
Gusto oder zum via Cron festgelegten<br />
Zeitpunkt.<br />
Existieren noch keine Sicherungen<br />
am vereinbarten Ort, legt<br />
Sbackup nach dem Start über<br />
Werkzeuge | Die Sicherung jetzt<br />
durchführen ein volles Backup an,<br />
das Sie an der Endung ful erkennen.<br />
Später schiebt es dann inkrementelle<br />
Backups mit der Endung<br />
inc hinterher. Die Namen<br />
der Backups versieht es<br />
mit einem eigenen Zeitstempel,<br />
sodass Sie später<br />
wissen, von wann welche<br />
Datei stammt (Abbildung<br />
G).<br />
Bevor Sie das Programm<br />
aber über Die Sicherung<br />
jetzt durchführen<br />
den Dienst aufnehmen<br />
lassen, klicken Sie unbedingt<br />
auf das Speichern-<br />
Icon in der Menüleiste.<br />
Andernfalls übernimmt<br />
Sbackup die Änderungen<br />
nicht <strong>und</strong> bleibt bei den<br />
Standardeinstellungen.<br />
Schaufel, Besen, Protokoll<br />
Für potenziell mehr Speicherplatz<br />
auf dem Backup-Medium sorgen<br />
die Inhalte des Reiters Aufräumen<br />
im Konfigurationsdialog. Hier<br />
weisen Sie Sbackup entweder an,<br />
nach einem bestimmten Verfallsdatum<br />
– voreingestellt sind 30<br />
Tage – alte Sicherungen zu entsorgen,<br />
oder Sie greifen zur wesentlich<br />
ausgefeilteren Funktion<br />
Logarithmisches Entfernen. Es<br />
dünnt die Sicherungen der Vergangenheit<br />
umso gründlicher aus,<br />
je älter die Daten sind. So behalten<br />
Sie nur noch ein Backup pro<br />
Woche vom letzten Monat, vom<br />
letzten Jahr bleibt nur ein Backup<br />
pro Monat übrig <strong>und</strong> so weiter.<br />
Von den vorhergehenden Jahren<br />
behalten Sie am Ende lediglich jeweils<br />
ein Backup.<br />
Im Reiter Berichte konfigurieren<br />
Sie, wo <strong>und</strong> wie ausführlich<br />
Sbackup seine Aktionen protokollieren<br />
soll. Auch einen Bericht per<br />
E-Mail kann das Programm auf<br />
Wunsch bei jeder Aktion zustellen.<br />
Dazu müssen Sie lediglich<br />
den Adressaten der Nachricht angeben<br />
<strong>und</strong> die Kontaktdaten eines<br />
SMTP-Servers für den Versand<br />
eintragen (Abbildung H). Ob<br />
dieser den Transport der Nachricht<br />
auch wirklich übernehmen<br />
kann, prüfen Sie über den Schalter<br />
Testen der Mail-Einstellungen.<br />
Restauratives<br />
Meist versauern Backups ungenutzt<br />
auf einer Festplatte – <strong>und</strong><br />
das ist auch gut so. Sollten Sie<br />
CRon-Job<br />
Cron-Jobs heißen unter Linux Aufgaben,<br />
die das System mithilfe des<br />
Cron-Daemons regelmäßig ausführt<br />
[5]. Dazu definieren Sie Zeitpunkte:<br />
Die fünf Sterne in einem<br />
Cron-Ausdruck stehen – von links<br />
nach rechts – für Minute, St<strong>und</strong>e,<br />
Tag, Monat <strong>und</strong> Wochentag. Die<br />
Sbackup-Vorgabe 0 4 * * * führt zu<br />
einem Sicherungslauf täglich um<br />
vier Uhr morgens. Um jeweils am<br />
28. eines Monats um 13:52 ein<br />
Backup zu machen, hieße der Eintrag<br />
52 13 28 * *.<br />
84 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Sbackup<br />
netz&system<br />
F Neben einigen Standardeinstellungen sichern Sie Ihre Daten auf<br />
Wunsch zu definierten Zeiten. Die stellen Sie über einen CronJob ein.<br />
G Im Wiederherstellungsfenster (siehe Abschnitt „Restauratives“)<br />
nehmen Sie die gesicherten Daten bei Bedarf genauer unter die Lupe.<br />
doch einmal in die Verlegenheit<br />
kommen, Dateien retten zu müssen,<br />
nutzen Sie die Simple Backup<br />
Restoration (Abbildung G).<br />
Im Bereich Sicherungsziel erscheint<br />
unter Standardziel für Profile<br />
das während der Konfiguration<br />
angegebene lokale oder entfernte<br />
Backup-Verzeichnis. Handelt<br />
es sich um eine mit Sbackup<br />
an einem anderen Speicherort erstellte<br />
Sicherung, geben Sie stattdessen<br />
unter Eigenes Ziel den entsprechenden<br />
Ordner an. Die darin<br />
aufgef<strong>und</strong>enen Backup-Dateien<br />
listet die Software unter Verfügbare<br />
Sicherung auf. Wählen Sie<br />
eine davon aus, erscheint unter<br />
Wiederherstellung rechts daneben<br />
der Verzeichnisbaum. Handelt es<br />
sich um ein volles Backup, sehen<br />
Sie dort alle zu dem Zeitpunkt gesicherten<br />
Dateien.<br />
Bei inkrementellen Sicherungen<br />
tauchen dagegen nur die seit<br />
dem letzten Backup geänderten<br />
Dateien auf. Erstellen Sie beispielsweise<br />
jeweils am Montag<br />
ein volles Backup <strong>und</strong> stellen<br />
dann am Freitag fest, dass Sie<br />
alle Änderungen seit Montag<br />
brauchen, müssen Sie alle INC-<br />
Dateien wiederherstellen, die<br />
nach dem Vollbackup am Montag<br />
hinzugekommen sind.<br />
Bei sehr vielen angelegten Backup-Dateien<br />
hilft der oberhalb von<br />
Verfügbare Sicherungen platzierte<br />
Info<br />
[1] Sbackup: https:// launchpad. net/ sbackup<br />
[2] Sbackup-Tarball:<br />
http:// sourceforge. net/ projects/ sbackup/<br />
[3] Cloud-Storage: Thomas Drilling,<br />
„Datenwolke“, LU 09/ 2011, S. 24,<br />
http:// www. linux-community. de/ 24107<br />
[4] Reguläre Ausdrücke: Frank Hofmann,<br />
„Schnipseljagd“, LU 09/ 2011, S. 84,<br />
http:// www. linux-community. de/ 24091<br />
[5] Cron-Basics: Heike Jurzik, „Punktlandung“,<br />
LU 02/ 2006, S. 94, http:// www.<br />
linux-community. de/ 9812<br />
Kalender dabei, ältere Sicherungsdaten<br />
anhand des Sicherungsdatums<br />
zu identifizieren.<br />
Die Daten, für die Schnappschüsse<br />
vorliegen, erscheinen im Kalender<br />
gefettet. Ein Klick auf das<br />
Datum listet unter Verfügbare<br />
Sicherungen nur jene des entsprechenden<br />
Tags auf.<br />
Wählen Sie das Backup unter<br />
Verfügbare Sicherungen aus <strong>und</strong><br />
klicken auf Wiederherstellen, so<br />
restauriert Sbackup die Datei am<br />
Originalschauplatz – <strong>und</strong> überschreibt<br />
dabei unter Umständen<br />
vorhandene neuere Versionen.<br />
Über Wiederherstellen unter… legen<br />
Sie die neuere Datei an anderer<br />
Stelle ab. Über Änderungen<br />
rückgängig machen rollen Sie den<br />
Stand der gesicherten Dateien auf<br />
jenen vor der aktuellen Sicherung<br />
zurück. Rückgängig machen unter…<br />
restauriert diesen zurückgerollten<br />
Stand statt an originaler<br />
Stelle an einem anderen Ort.<br />
Backup-Dateien, die Sie nicht<br />
mehr benötigen, können Sie an<br />
dieser Stelle einfach manuell über<br />
den Reiter Verwaltung von Sicherungen<br />
mithilfe des Schalters Entfernen<br />
löschen.<br />
Fazit<br />
Sbackup präsentiert sich als recht<br />
durchdachtes Programm zum<br />
Sichern von Benutzerdaten aller<br />
Art. Es eignet sich jedoch nicht<br />
dazu, das komplette System zu<br />
sichern beziehungsweise wiederherzustellen.<br />
Trotz einiger kleinerer<br />
Schwachstellen <strong>und</strong> Inkonsistenzen<br />
in der Bedienung funktioniert<br />
Sbackup insgesamt sehr gut<br />
<strong>und</strong> nimmt Ihnen die lästige Arbeit<br />
ab, Backups mitsamt Cron-<br />
Jobs über die Kommandozeile<br />
einzurichten. (kki/ jlu) n<br />
H Sbackup informiert<br />
Sie über ein ausführliches<br />
Protokoll <strong>und</strong><br />
auf Wunsch sogar per<br />
EMail von allen seinen<br />
Aktionen.<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 85
hardware<br />
Pearl Simvalley SP-60 GPS<br />
© Eduardo Rivero, 123RF<br />
Dual-SIM-Handy mit Android 2.2<br />
Doppeldecker<br />
Zwei SIM-Karten in einem Phone sparen nicht nur beim Reisen den lästigen Wechsel,<br />
sondern auch bei Anwendern, die ein Handy privat <strong>und</strong> eines beruflich nutzen. Thomas Leichtenstern<br />
readMe<br />
Der Online-Händler<br />
Pearl bietet ein Dual-<br />
SIM-fähiges Android-<br />
Smartphone für 129<br />
Euro an. Dank des GPS-<br />
Moduls dient es gleichzeitig<br />
als Navigationssys<br />
tem, das Google<br />
Maps zur Routenplanung<br />
nutzt.<br />
A Pearls Simvalley<br />
SP-60 wirkt durchaus<br />
schick, hat aber bis auf<br />
das Verwalten von zwei<br />
SIM-Karten nicht viel<br />
zu bieten.<br />
Ein Telefon, das zwei SIM-Karten<br />
verwaltet, erleichtert das Leben<br />
in vielen Fällen ungemein: Im<br />
Ausland beispielsweise nutzen Sie<br />
zum Surfen die landeseigene Karte<br />
<strong>und</strong> bleiben mit der anderen<br />
trotzdem erreichbar. Als Nutzer<br />
eines Firmenhandys benötigen<br />
Sie nur noch ein Telefon, um auf<br />
dem privaten wie geschäftlichen<br />
Anschluss erreichbar zu sein.<br />
Der Versandanbieter Pearl Agency<br />
[1] offeriert das Dual-SIM-<br />
Phone Simvalley SP-60 [2] zum<br />
attraktiven Preis von 129 Euro.<br />
Die baugleiche Variante SP-40 [3]<br />
<strong>ohne</strong> GPS-Modul kostet 99 Euro.<br />
Wie das Gerät das Verwalten der<br />
zwei Karten auf die Reihe bekommt<br />
<strong>und</strong> was es technisch im<br />
Vergleich zu Smart phones der<br />
gleichen Preisklasse bietet, zeigt<br />
der Test.<br />
Technik<br />
Die technischen Daten des SP-60<br />
(Abbildung A) entsprechen in<br />
etwa denen der Einsteiger-<br />
Smartphones LG P 500 Optimus<br />
<strong>und</strong> Sony Ericsson Xperia X8, die<br />
Amazon in der Preiskategorie um<br />
die 150 Euro anbietet.<br />
Allerdings muss das Pearl- Phone<br />
mit einer 420-MHz-CPU auskommen,<br />
während die genannte Konkurrenz<br />
600 MHz Rechenpower<br />
mitbringt. Im Antutu-Benchmark<br />
[4] erreicht das SP-60 entsprechend<br />
magere 467 Punkte,<br />
wogegen der Konkurrent von<br />
Sony mit 767 Zählern punktet<br />
<strong>und</strong> der Rivale von LG sogar mit<br />
939. Auch beim Akku kocht das<br />
Simvalley-Smartphone mit einem<br />
1100-mAh-Akku eher auf Sparflamme:<br />
Sony <strong>und</strong> LG spendieren<br />
ihren Smartphones Energiespeicher<br />
mit 1200 respektive 1500<br />
mAh Kapazität.<br />
Ähnlich mager sieht es bei Datentransfers<br />
über das mobile<br />
Netz aus. Während die beiden<br />
Vergleichskandidaten via UMTS/<br />
HSDPA eine maximale Transferrate<br />
von 7,2 Mbit/ s anbieten, begnügt<br />
sich das Simvalley SP-60<br />
auf EDGE mit einer theoretisch<br />
möglichen maximalen Bandbreite<br />
von 473,6 kbit/ s. In der Praxis<br />
liegt die Transferrate jedoch deutlich<br />
niedriger: Ein Test im E-Plus-<br />
Netz ergab einen tatsächlichen<br />
Durchsatz von 179 kbit/ s, das<br />
entspricht 22 KByte/ s.<br />
An Speicher bietet das Pearl-<br />
Smartphone 190 MByte verfügbaren<br />
Arbeitsspeicher <strong>und</strong><br />
271 MByte Speicherplatz für<br />
Apps. Möchten Sie das Gerät auch<br />
86 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Pearl Simvalley SP-60 GPS<br />
hardware<br />
zum Aufbewahren von Multimedia-Dateien<br />
nutzen, kommen Sie<br />
um den Einsatz einer Micro-SD-<br />
Karte (maximal 16 GByte) nicht<br />
herum. Diese gehört jedoch nicht<br />
zum Lieferumfang. Den Einschub<br />
finden Sie an der rechten Gehäuseseite,<br />
ein Wechsel im laufenden<br />
Betrieb ist möglich.<br />
Das kapazitive Display des Simvalley<br />
SP-60 besitzt eine Diagonale<br />
von 3,2 Zoll mit einer Auflösung<br />
von 320x480 Pixeln. Die integrierte<br />
Kamera erstellt Bilder<br />
bis zu 2 Megapixeln, allerdings<br />
fehlt ihr sowohl der Autofokus als<br />
auch ein LED-Blitz. Eine Zusammenfassung<br />
zeigt die Tabelle<br />
Technische Eckdaten.<br />
Doppelpack<br />
Die Einschübe für die SIM-Karten<br />
befinden sich auf der Rückseite<br />
unter dem Akku. Der mit A gekennzeichnete<br />
rechte Slot repräsentiert<br />
die erste Karte, B auf der<br />
linken die zweite. Zum Öffnen<br />
der Metallabdeckung gilt es, diese<br />
zunächst ein Stück zurückzuschieben<br />
<strong>und</strong> danach aufzuklappen<br />
(Abbildung B).<br />
Nach dem Booten erfolgt die<br />
Abfrage nach den PINs beider<br />
Karten, die das Gerät im Anschluss<br />
aktiviert. Entsprechend<br />
empfängt das Telefon Gespräche<br />
auch von beiden Karten gleichermaßen.<br />
Das Modul für abgehende<br />
Gespräche zeigt am unteren Rand<br />
zwei Buttons, mit denen Sie festlegen,<br />
über welche Karte Sie das<br />
Gespräch führen möchten (Abbildung<br />
C, nächste Seite). Die<br />
gr<strong>und</strong>legende Konfiguration der<br />
SIMs erreichen Sie in<br />
den Einstellungen unter<br />
Dual-SIM-Einstellungen<br />
(Abbildung D, nächste<br />
Seite). Hier aktivieren<br />
oder deaktivieren Sie<br />
auf Knopfdruck die<br />
Karten <strong>und</strong> legen die<br />
Standardkarte fest.<br />
Als Standard für die<br />
Datenübertragung legt<br />
das Telefon die Karte 1<br />
fest. In den Android-<br />
Einstellungen unter<br />
Drahtlos <strong>und</strong> Netzwerke | Datenverbindungs-SIM<br />
ändern Sie diese<br />
Zuordnung gegebenenfalls. Der<br />
Punkt Mobile Netzwerke enthält<br />
die Konfiguration der Zugangspunkte<br />
<strong>und</strong> des Netzbetreibers<br />
für jede Karte getrennt. Welche<br />
Karte gerade welchen Dienst anbietet,<br />
ersehen Sie aus den Ziffern<br />
in den Symbolen für Datenübertragung<br />
<strong>und</strong> Signalstärke in<br />
der Leiste oben.<br />
Ein schnelles Ab- <strong>und</strong> Umschalten<br />
der GPRS/ EDGE-Verbindung<br />
erreichen Sie im Auswahlmenü,<br />
das erscheint, wenn Sie den Ein-/<br />
Aus-Schalter oben rechts länger<br />
betätigen. Welche Alternativen es<br />
derzeit zum Einsatz von zwei<br />
SIM-Karten in einem Android-<br />
Smartphone gibt, zeigt der Kasten<br />
Alternativen.<br />
Praxistest<br />
Zum Booten benötigt das Smartphone<br />
etwa eine Minute – angesichts<br />
der eher bescheidenen<br />
CPU-Leistung ist das ein durchaus<br />
akzeptabler Wert. Beim Gebrauch<br />
fällt schnell der unpräzise<br />
alTernaTiven<br />
Androidbasierte Alternativen an Dual-<br />
SIM-Smartphones sind derzeit in<br />
Deutschland dünn gesät. Lediglich<br />
der Anbieter Viewsonic kündigt für<br />
den Oktober 2011 ein Gerät an, das<br />
allerdings mehr als 250 Euro kosten<br />
soll [5]. Die inneren Werte – eine<br />
600-MHz-CPU, 512 MByte RAM <strong>und</strong><br />
ein 3,5-Zoll-Display mit einer Auflösung<br />
von 480x320 Pixeln – überzeugen<br />
aber genauso wenig wie die des<br />
SP-60. Eine weitere Möglichkeit bieten<br />
Dual-SIM-Adapter [6]. Dabei handelt<br />
es sich um eine Pseudo-SIM-<br />
Karte, in die Sie zwei zurechtgeschnittene<br />
SIMs einpassen. Diese Technik<br />
ist jedoch nicht durchgängig in der<br />
Software des Smartphones umgesetzt,<br />
weswegen die Nutzung der zwei<br />
Karten eher umständlich ausfällt. Ferner<br />
erlaubt diese Technik nur beschränkt<br />
das gleichzeitige Nutzen beider<br />
Karten. Anrufe empfängt beispielsweise<br />
jeweils nur eine.<br />
Touchscreen unangenehm auf:<br />
Manchmal lag der vom Gerät<br />
identifizierte Berührungspunkt<br />
um einen Zentimeter neben dem<br />
tatsächlichen. Das führte dazu,<br />
dass beispielsweise falsche Menüpunkte<br />
aufgerufen wurden. Hier<br />
fehlt eine Möglichkeit, das Display<br />
nachträglich zu kalibrieren.<br />
Das Benutzen der vergleichsweise<br />
kleinen Display-Tastatur gerät<br />
deswegen ab <strong>und</strong> an zum Glücksspiel.<br />
Das in der Gr<strong>und</strong>einstellung<br />
deaktivierte haptische Feed-<br />
B Unter dem Akku finden<br />
Sie die zwei Einschübe<br />
für die SIM-<br />
Karten. Der rechte beherbergt<br />
Karte 1, der<br />
linke Karte 2.<br />
Technische eckdaTen<br />
Vertrieb<br />
Pearl Agency<br />
Modell<br />
Simvalley SP-60 GPS<br />
OS<br />
Android 2.2 „Froyo“<br />
Display<br />
3,2 Zoll, Auflösung 320x480 Pixel<br />
Speicher<br />
512 MByte ROM, 256 MByte RAM<br />
Anschlüsse<br />
Erweiterung Micro-SD bis 16 GByte<br />
Anschlüsse 3,5 mm Klinke, Micro-USB 2.0<br />
Datenaustausch WLAN 802.11b/ g, Bluetooth 2.1 EDR, EDGE<br />
Kamera<br />
Kamera<br />
2 Megapixel, <strong>ohne</strong> Blitz, Fixfokus<br />
Bildgröße<br />
max. 2048x1536 (interpoliert)<br />
Videogröße max. 720x480 / 10 fps<br />
Formate<br />
Video(1)(2) MPEG4, H.263, H.264, WMV<br />
Audio(1)<br />
MP3, MIDI, AAC, eAAC+, WMA, PCM<br />
Sonstiges<br />
GSM-Frequenzen(1) 850/ 900/ 1800/ 1900<br />
Akku<br />
1100 mAh<br />
Standzeit(1) Standby bis 200 h, Sprechen bis 4 h<br />
Maße<br />
119x57x14 mm<br />
Lieferumfang Telefon, Akku, Ladegerät, Headset, USB-<br />
Kabel, Bedienungsanleitung<br />
Preis<br />
129,90 Euro<br />
(1) Herstellerangabe; (2) im Test nicht möglich<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 87
hardware<br />
Pearl Simvalley SP-60 GPS<br />
C Über welche Karte<br />
Sie ausgehende Anrufe<br />
führen, wählen Sie mit<br />
den Buttons unter dem<br />
Ziffernblock.<br />
Glossar<br />
Rolling-Shutter-Effekt:<br />
Diagonale Verzerrungen,<br />
die auftreten,<br />
wenn sich entweder das<br />
Motiv oder die Kamera<br />
bewegt. Eine gerade<br />
Linie erscheint dann<br />
beispielsweise seitlich<br />
gebogen. Der Effekt<br />
zeigt sich in erster Linie<br />
bei CMOS-Sensoren.<br />
D In den „Dual-SIM-<br />
Einstellungen“ aktivieren<br />
<strong>und</strong> deaktivieren<br />
Sie die Karten.<br />
back bei Displayberührungen<br />
sollte auch tunlichst ausgeschaltet<br />
bleiben. Die Vibration erreicht<br />
kaum die Fingerkuppen, dafür<br />
schnarrt das Telefon laut.<br />
Um halbwegs flüssig mit dem<br />
SP-60 zu arbeiten, empfiehlt es<br />
sich, sämtliche Animationen unter<br />
Einstellungen | Display zu deaktivieren.<br />
Auf Apps, die eine gewisse<br />
Performance erwarten, vor<br />
allem im grafischen Bereich, sollten<br />
Sie besser verzichten. Selbst<br />
vergleichsweise anspruchslose<br />
Spiele wie Angry Birds stellt das<br />
SP-60 nur im Zeitlupentempo dar<br />
– Sie können die einzelnen<br />
Frames mitzählen.<br />
Die vorinstallierte Google-<br />
Maps-App startet dagegen zügig<br />
<strong>und</strong> zeigt bei WLAN-Verbindung<br />
die Karten schnell an. Bei einer<br />
EDGE-Verbindung dauert der<br />
Kartenaufbau wesentlich länger:<br />
Es vergehen zuweilen 30 <strong>und</strong><br />
mehr Sek<strong>und</strong>en, bis alle Kacheln<br />
einer Karte fertig geladen sind.<br />
Ähnliches gilt für den vorinstallierten<br />
Webbrowser, der sich<br />
selbst beim Laden der schlanken<br />
Google-Startseite über 30 Sek<strong>und</strong>en<br />
Zeit lässt. Im WLAN verhält<br />
sich der Browser erwartungsgemäß<br />
deutlich agiler <strong>und</strong> stellt<br />
schlanke Seiten wie die der Wikipedia<br />
in einer ansprechenden Geschwindigkeit<br />
dar. Auch die mobile<br />
Seite von Facebook <strong>und</strong> jene<br />
des Bilderdienstes Picasaweb erscheinen<br />
flüssig.<br />
Ausgezeichnet schlug sich das<br />
Simvalley SP-60 in seiner Paradedisziplin,<br />
dem Umgang mit zwei<br />
SIM-Karten. Durch die Integration<br />
an den relevanten Stellen der<br />
Software war es mühelos möglich,<br />
die Karten nach den eigenen<br />
Wünschen einzurichten <strong>und</strong> sie<br />
zu nutzen. Allerdings verwendet<br />
das Telefon nur eine Adressdatenbank<br />
für beide Karten. Eine Trennung,<br />
beispielsweise zwischen beruflichen<br />
<strong>und</strong> privaten Adressen,<br />
klappt nicht.<br />
Von seiner weniger guten Seite<br />
präsentierte sich das Pearl-Smartphone<br />
im Bereich Multimedia.<br />
Die von der integrierten Kamera<br />
aufgenommenen Fotos <strong>und</strong> Filme<br />
genügen höchstens Dokumentationszwecken.<br />
Die Bilder wirken<br />
wie durch einen Schleier aufgenommen,<br />
unscharf, wenig kontrastreich<br />
<strong>und</strong> weisen deutliche<br />
Farbverfälschungen auf. In Videos<br />
tritt bei Kameraschwenks ein<br />
ausgeprägter Rolling-Shutter-Effekt<br />
auf.<br />
Audiodateien in den Formaten<br />
OGG <strong>und</strong> MP3 gab das Handy<br />
völlig problemlos wieder. Warum<br />
der Hersteller den Lautsprecher<br />
jedoch auf der Rückseite des Gerätes<br />
platziert, das bleibt völlig<br />
unklar. Darüber hinaus fehlt dem<br />
integrierten Audioplayer eine Dateibrowsing-Funktion,<br />
sodass<br />
sich nur Audio-Dateien öffnen<br />
lassen, die sich im Standardpfad<br />
des Players befinden.<br />
Beim Abspielen von Video-Dateien<br />
versagte das Pearl-Handy<br />
gänzlich. Mangels eines integrierten<br />
Dateibrowsers gilt es, zunächst<br />
einen solchen nachzuinstallieren,<br />
um überhaupt in der<br />
Ordnerstruktur des Speichers navigieren<br />
zu können <strong>und</strong> das Speicherverzeichnis<br />
für die Filme zu<br />
erreichen. Das Abspielen sämtlicher<br />
Testfilme (OGV, WMV, MPG,<br />
AVI) verweigerte das Simvalley<br />
SP-60 aber <strong>ohne</strong>hin mit dem lapidaren<br />
Vermerk, dass es „dieses<br />
Video leider nicht wiedergegeben“<br />
könne. Das widerspricht der Herstellerangabe,<br />
das Gerät käme mit<br />
diesen Dateitypen zurecht.<br />
Fazit<br />
Wer die Dual-Sim-Funktion des<br />
Pearl Simvalley SP-60 nur als nettes<br />
Feature <strong>und</strong> nicht als Hauptzweck<br />
das Geräts betrachtet,<br />
kauft sich besser ein anderes<br />
Smartphone. In der Preisklasse<br />
um die 150 Euro tummeln sich<br />
zwischenzeitlich einige Markengeräte,<br />
die das China-Handy von<br />
Pearl in fast jeder Hinsicht locker<br />
in den Schatten stellen.<br />
Wer jedoch vorhat, sich das<br />
Smartphone genau wegen dieser<br />
Funktion zuzulegen, liegt damit<br />
goldrichtig. Im Test funktionierte<br />
es einwandfrei <strong>und</strong> ließ eine akkurate<br />
Trennung zu, welche Verbindung<br />
über welche Karte läuft. Alternativen<br />
dazu lässt der deutsche<br />
Markt bislang weitgehend vermissen,<br />
die Dual-SIM-Adaptertechnik<br />
funktioniert vergleichsweise unzureichend.<br />
(tle) n<br />
info<br />
[1] Pearl: http:// www. pearl. de<br />
[2] Simvalley SP-60:<br />
http:// www. pearl. de/ a-PX3505-4073. shtml<br />
[3] Simvalley SP-40:<br />
http:// www. pearl. de/ a-PX3500-4073. shtml<br />
[4] Antutu-Benchmark:<br />
http:// www. antutu. com/ software. php<br />
[5] Viewsonic V350:<br />
http:// www. viewsoniceurope. com/ de/<br />
products/ v350. htm<br />
[6] Dual-SIM-Adapter Hypercard 3G:<br />
http:// www. hypercard3g. de<br />
88 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Hier startet<br />
iHr UBUNtU!<br />
● JaHres-aBo FÜr NUr E 26,90<br />
15%<br />
sparEn<br />
●<br />
iMMer Mit aKtUeLLster<br />
UBUNtU-DistriBUtioN aUF DVD<br />
NeU:<br />
● Digitales Jahresabo<br />
im PDF-Format für<br />
nur E 24,20!<br />
Jetzt BesteLLeN<br />
Telefon: 07131 / 2707 274<br />
Fax: 07131 / 2707 78 601<br />
E-Mail: abo@ubuntu-user.de<br />
Internet: http://www.ubuntu-user.de<br />
ich möchte Ubuntu User für nur E 6,73<br />
Ja,<br />
pro Ausgabe abonnieren.<br />
Ich erhalte Ubuntu User viermal im Jahr zum Vorzugs preis von e 6,73 statt e 7,90 im Einzelverkauf,<br />
bei jährlicher Verrechnung e 26,90 (*Österreich: e 29,90, Schweiz: SFr 53,90,<br />
restliches Europa: e 33,90). Ich gehe keine langfristige Bindung ein. Möchte ich das Abo<br />
nicht länger beziehen, kann ich die Bestellung jederzeit <strong>und</strong> fristlos kündigen. Geld für bereits<br />
bezahlte, aber noch nicht gelieferte Ausgaben erhalte ich zurück. Sollten Sie noch Fragen<br />
haben, hilft Ihnen unser Abo-Service gerne weiter (089-20959127).<br />
Linux New Media AG, Putzbrunner Straße 71, 81739 München; Aufsichtsrat: Rudolf Strobl<br />
(Vorsitz), Vorstand: Brian Osborn, Hermann Plank, Handelsregister: HRB 129161 München<br />
Name, Vorname<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Mein Zahlungswunsch: Bequem per Bankeinzug Gegen Rechnung<br />
Straße, Nr.<br />
BLZ<br />
Konto-Nr.<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Bank
know-how<br />
Foto-Batch (Teil 3)<br />
Bildverarbeitung mit den Skriptsprachen Perl <strong>und</strong> Python<br />
Mehr Motorkraft<br />
Mit nur wenigen Zahlen Code korrigieren Sie das Format digitaler Bilder, passen die Metadaten<br />
an oder beschriften die Fotos für den Upload in ein Online-Album. Frank Hofmann<br />
© Slulesoj, sxc.hu<br />
Beispiel-Skripte<br />
LU/fotobatch/<br />
reAdme<br />
Zum individuellen Nachbearbeiten<br />
einer größeren<br />
Anzahl Bilder bietet<br />
sich das <strong>Automatisieren</strong><br />
mithilfe von Perl<br />
<strong>und</strong> Python an: Der Programmieraufwand<br />
hält<br />
sich in Grenzen, die Arbeit<br />
führt relativ schnell<br />
zum Erfolg.<br />
In den ersten beiden Teilen der<br />
Artikelserie ([1],[2]) kamen die<br />
beiden Werkzeuge ImageMagick<br />
[3] <strong>und</strong> GraphicsMagick [4]<br />
zum Einsatz. In kleinere Shell-<br />
Skripte integriert, leisteten Sie<br />
dort gute Dienst. Zu beiden<br />
Werkzeugen gehören mächtige<br />
Bibliotheken, für die wiederum<br />
Bindings zu verschiedenen Programmiersprachen<br />
existieren.<br />
Programmierschnittstellen<br />
Wenn Sie also statt in der Shell zu<br />
arbeiten lieber Ihre Lieblingsprogrammiersprache<br />
zum Lösen der<br />
Aufgabe einsetzen möchten, dann<br />
stehen Ihnen viele Möglichkeiten<br />
offen. Für ImageMagick <strong>und</strong> GraphicsMagick<br />
gibt es Schnittstellen<br />
unter anderem für C/ C++,<br />
Perl, Java, Python, Ruby <strong>und</strong> Tcl.<br />
Diese sind erfreulicherweise vollständig,<br />
aktuell <strong>und</strong> verständlich<br />
dokumentiert.<br />
Serie AutomAtiSche BildverArBeitung<br />
Teil 1: ImageMagick, GraphicsMagick LU 03/ 2011, S. 84<br />
Teil 2: Magick Scripting Language LU 06/ 2011, S. 84<br />
Teil 3: Bearbeiten mit Perl/ Python LU 09/ 2011, S. 90<br />
In diesem Artikel drehen sich die<br />
Beispiele um die Bildmanipulation<br />
mit den beiden Skriptsprachen<br />
Perl <strong>und</strong> Python. Beide gehören<br />
zur Kategorie der Skriptsprachen.<br />
Vor dem Ausführen transponiert<br />
ein Interpreter den Programmcode<br />
in Bytecode. Das eigentliche<br />
Übersetzen erfolgt erst zur Laufzeit,<br />
Sie brauchen im Vorfeld also<br />
nichts zu kompilieren. Das Binding<br />
für Perl heißt PerlMagick [5],<br />
das für Python PythonMagick [6].<br />
Das erste Beispiel widmet sich<br />
PerlMagick. Das dafür erforderliche<br />
Debian/ Ubuntu-Paket heißt<br />
libgraphics-magick-perl. Nach der<br />
Installation des Paketes binden Sie<br />
das Perl-Modul über die folgende<br />
Deklaration in ein Skript ein:<br />
use Graphics::Magick;<br />
Nun stehen die Klassen <strong>und</strong><br />
Funktionen aus diesem Modul<br />
bereit. Der Code aus Listing 1<br />
dient dazu, die Bildinformationen<br />
anzuzeigen. Die Namen der Dateien<br />
geben Sie dem Skript als Parameter<br />
beim Aufruf mit.<br />
Jede Datei, die Sie beim Aufruf als<br />
Parameter übergeben, berücksichtigt<br />
das Programm (Zeile 10). Geben<br />
Sie keine Dateien an, bricht<br />
das Programm vorher ab (Zeile 7).<br />
Für einen besseren Programmierstil<br />
wäre stattdessen eine Funktion<br />
usage_exit() angebracht, die<br />
den Anwender auf fehlende Argumente<br />
hinweist. Der Aufruf in<br />
Zeile 7 müsste dann so lauten:<br />
usage_exit() unless @ARGV<br />
Zeile 12 erzeugt ein neues Grafikobjekt,<br />
über dessen Methoden Sie<br />
später auf die Dateien zugreifen.<br />
In der Zeile 13 öffnen Sie die Bilddatei<br />
<strong>und</strong> bestimmen den Bildtyp,<br />
die Bildgröße <strong>und</strong> den Farbmodus.<br />
In den Zeilen 17 bis 20 erfolgt die<br />
Ausgabe der Bildwerte, in Listing<br />
2 dargestellt am Aufruf für<br />
das Polaroid-Bild aus dem ersten<br />
Teil dieser Artikelserie.<br />
Statische Beschriftung<br />
Im zweiten Beispiel für den Alltagsgebrauch<br />
erhalten die Aufnahmen<br />
einen Schriftzug. Auf die-<br />
90 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Foto-Batch (Teil 3)<br />
know-how<br />
se Weise versehen Sie ein Bild mit<br />
dem Namen des Fotografen oder<br />
einer Beschreibung zum Motiv.<br />
Sinnvoll ist das für Bilder, die Sie<br />
über ein Online-Album oder eine<br />
Fotodatenbank im Internet bereitstellen.<br />
Hier schützt ein sichtbares<br />
Zeichen der Urheberschaft<br />
vor Missbrauch. Bei der heutzutage<br />
erzeugten Menge digitaler Aufnahmen<br />
hilft ein Kommentar dabei,<br />
später Ort <strong>und</strong> Datum der<br />
Aufnahme zuzuordnen.<br />
Beim Beschriften kommt die<br />
Methode Annotate der Magick-<br />
Klasse zum Einsatz, der Sie den<br />
Text als Parameter übergeben<br />
(Listing 3). Diese Methode akzeptiert<br />
zusätzlich als Parameter verschiedene<br />
Attribute, wie zum Beispiel<br />
Art, Größe <strong>und</strong> Farbe der<br />
Schrift. Für die Schriftart erwartet<br />
die Methode den vollständigen<br />
Pfad zur Fontdatei. Im Beispiel erfolgt<br />
die Ausgabe des Textes mittels<br />
der (fiktiven) Truetype-Datei<br />
font.ttf mit einer Schriftgröße<br />
von 40 Punkt in roter Farbe.<br />
Der Text landet auf dem Bild an<br />
einer Position, die Sie über ein<br />
Koordinatenpaar für die waagerechte<br />
X- <strong>und</strong> senkrechte Y-Achse<br />
festlegen. Der Ursprung des Koordinatensystems<br />
befindet sich in<br />
der linken oberen Bildecke. Von<br />
da aus berechnet sich die Position<br />
in Pixeln. Um das veränderte Bild<br />
zu speichern, nutzen Sie die Write-<br />
Methode des Bild-Objektes:<br />
$bild‐>Write(filename=>$dateinamU<br />
e);<br />
Der Einfachheit halber speichern<br />
Sie das Skript, dessen Aufbau im<br />
Wesentlichen jenem von Listing 1<br />
ähnelt, unter dem Namen schriftzug.pl<br />
ab (Listing 4, nächste Seite).<br />
Sie rufen es mit folgendem<br />
Kommando auf, um ein PNG-Bild<br />
mit dem Schriftzug zu versehen:<br />
$ ./schriftzug.pl foto.png<br />
Abbildung A zeigt ein Bild nach<br />
dem Bearbeiten. Es kommt problemlos<br />
mit UTF-8-codierten Umlauten<br />
<strong>und</strong> Sonderzeichen zurecht.<br />
Das Skript funktioniert<br />
auch, wenn Sie beim Aufruf eine<br />
Serie von Bildern übergeben, die<br />
Sie identisch beschriften wollen.<br />
Dabei hilft Ihnen die Art, wie Digitalkameras<br />
die Aufnahmen im<br />
Dateisystem der Speicherkarte benennen.<br />
Als Dateiname verwenden<br />
aktuelle Modelle eine Kombination<br />
aus Buchstaben <strong>und</strong> Ziffern.<br />
Während die Abfolge der<br />
Buchstaben sich je nach Hersteller<br />
unterscheidet, geben die Ziffern in<br />
aller Regel die fortlaufende Nummer<br />
an, beispielsweise IMG0176.PNG<br />
für die 176. Aufnahme. Besteht<br />
die Bildserie aus den sechs Dateien<br />
(IMG0023.PNG bis IMG0028.PNG),<br />
sieht der Aufruf wie folgt aus:<br />
$ ./schriftzug.pl IMG002[3‐8].PNG<br />
Die Shell wertet zunächst die Eingabezeile<br />
aus <strong>und</strong> findet dabei<br />
den regulären Ausdruck. Sie expandiert<br />
die Werte in den eckigen<br />
Klammern als einzelne Ziffern 3<br />
bis 8 <strong>und</strong> kombiniert diese mit<br />
dem umgebenden Text zum Dateinamen.<br />
Anschließend erhält<br />
das Skript diese als Parameter.<br />
Flexible Beschriftung<br />
Bisher stand der Schriftzug direkt<br />
im Skript. Für einen anderen Text<br />
müssten Sie dieses jedes Mal verändern<br />
oder den Text als zusätzlichen<br />
Parameter übermitteln.<br />
Mit einem kleinen Kniff gelingt<br />
es aber, den Text aus einer Datei<br />
auszulesen. Die Annotate-Methode<br />
erlaubt die Angabe eines Dateinamens<br />
– in dieser angegebenen<br />
Datei legen Sie die Zeile einfach<br />
ab. Dazu ändern Sie den Aufruf in<br />
Zeile 14 von Listing 4 wie folgt:<br />
$text = '@beschriftung.txt'<br />
$ ./bildinfo.pl polaroid.png<br />
Datei: polaroid.png<br />
Format: Portable Network<br />
Graphics<br />
Größe: 296x243<br />
Modus: RGB<br />
liSting 2<br />
Bei jedem Aufruf des Skriptes<br />
liest das Magick-Objekt die Datei<br />
beschriftung.txt <strong>und</strong> versieht das<br />
Foto mit dem dort gespeicherten<br />
Text. Um den Inhalt der Datei<br />
festzulegen, genügt ein Texteditor.<br />
Individuelle Beschriftung<br />
Manchmal möchten Sie nicht alle<br />
Bilder identisch beschriften, sondern<br />
jedes mit einem anderen<br />
Text versehen. Dafür müssen Sie<br />
aber das Perl-Skript wieder etwas<br />
verändern (Listing 5, nächste Seite).<br />
Sie erstellen zunächst eine<br />
Textdatei, in der Sie für jede Abbildung<br />
den gewünschten Text<br />
hinterlegen. Die Angaben für die<br />
jeweilige Datei legen Sie in einer<br />
eigenen Zeile ab – zuerst den Namen<br />
der Bilddatei, danach den<br />
Text. Als Trennzeichen fungiert<br />
ein Doppelpunkt, gefolgt von einem<br />
Leerzeichen:<br />
foto156.png: Berlin, Funkturm am<br />
Messegelände<br />
foto159.png: Berlin,<br />
Alexanderplatz mit Weltzeituhr<br />
...<br />
der Autor<br />
Frank Hofmann hat<br />
Informatik an der TU<br />
Chemnitz studiert.<br />
Derzeit arbeitet er in<br />
Berlin im Open-<br />
Source-Expertennetzwerk<br />
Büro 2.0 als<br />
Dienstleister mit<br />
Spezialisierung auf<br />
Druck <strong>und</strong> Satz. Er<br />
gehört zur Linux User<br />
Group Potsdam<br />
(upLUG).<br />
liSting 1<br />
01 #!/usr/bin/perl ‐w<br />
02 # bildinfo.pl ‐ Bildinformationen anzeigen<br />
03<br />
04 # GraphicsMagick‐Modul einbinden<br />
05 use Graphics::Magick;<br />
06 # Abbrechen, falls keine Dateien als Parameter<br />
übergeben wurden<br />
07 exit unless @ARGV;<br />
08<br />
09 my ($dateiname, $farbraum, $format, $hoehe, $breite);<br />
10 foreach (@ARGV) {<br />
11 $dateiname = $_;<br />
12 $bild = Graphics::Magick‐>new;<br />
13 $bild‐>Read ($dateiname);<br />
14 ($farbraum, $format, $hoehe, $breite) =<br />
$bild‐>Get('colorspace', 'format', 'height', 'width');<br />
15<br />
16 print "Datei: ", $dateiname, "\n";<br />
17 print "Format: ", $format, "\n";<br />
18 print "Größe: ", $breite, "x", $hoehe, "\n";<br />
19 print "Modus: ", $farbraum, "\n";<br />
20 print " \n";<br />
21<br />
22 }<br />
$text = 'Ostseeurlaub 2011';<br />
$bild‐>Annotate (font=>'font.ttf', pointsize=>40,<br />
fill=>'red', text=>$text, x=>100, y=>100);<br />
liSting 3<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 91
know-how<br />
Foto-Batch (Teil 3)<br />
A Dank eines einfachen<br />
Perl-Skriptes<br />
versehen Sie alle Urlaubsfotos<br />
auf einen<br />
Rutsch mit einem passenden<br />
Kommentar.<br />
liSting 4<br />
Das Perl-Skript aus Listing 5 rufen<br />
Sie danach mit dem Namen<br />
der Textdatei auf:<br />
$ ./beschriftung.pl bilderliste.U<br />
txt<br />
Nach den Anweisungen zu Beginn<br />
gilt es, die Datei mit der Bilderliste<br />
zu öffnen (Zeile 13) <strong>und</strong> danach<br />
in einer Schleife zeilenweise<br />
zu verarbeiten. Jede gelesene<br />
Textzeile zerlegt das Skript mithilfe<br />
eines regulären Ausdrucks<br />
<strong>und</strong> der Funktion split am Trennzeichen<br />
: in zwei separate Teile<br />
(Zeile 16), die im Array @zeile landen.<br />
Danach gibt das Skript die<br />
Werte einmal aus, um Ihnen die<br />
01 #!/usr/bin/perl ‐w<br />
02 # schriftzug.pl ‐ Bilder statisch beschriften<br />
03<br />
04 # GraphicsMagick‐Modul einbinden<br />
05 use Graphics::Magick;<br />
06 # Abbrechen, falls keine Dateien als Parameter<br />
übergeben wurden<br />
07 exit unless @ARGV;<br />
08<br />
09 my ($dateiname, $text, $bild);<br />
10 foreach (@ARGV) {<br />
11 $dateiname = $_;<br />
12 $bild = Graphics::Magick‐>new;<br />
13 $bild‐>Read ($dateiname);<br />
14 $text = 'Albi (Tarn), Midi‐Pyrénées, 2008 ‐ Frank<br />
Hofmann';<br />
15 $bild‐>Annotate (font=>'font.ttf', pointsize=>40,<br />
fill=>'red', text=>$text, x=>100, y=>100);<br />
16 $bild‐>Write(filename=>$dateiname);<br />
17 }<br />
liSting 5<br />
01 #!/usr/bin/perl ‐w<br />
02 # beschriftung.pl ‐ Bilder<br />
flexibel beschriften<br />
03<br />
04 # graphicsmagick‐Modul<br />
einbinden<br />
05 use Graphics::Magick;<br />
06 # Abbrechen, falls keine<br />
Parameter übergeben wurden<br />
07 exit unless @ARGV;<br />
08<br />
09 my (@zeile, $dateiname,<br />
$bild);<br />
10<br />
11 $dateiname = $ARGV[0];<br />
12<br />
13 open (DATEILISTE,<br />
$dateiname);<br />
14<br />
15 while () {<br />
16 @zeile = split(/:\s+/, $_,<br />
2);<br />
17 print "Datei: $zeile[0]\n";<br />
18 print "Text: $zeile[1]\n";<br />
19<br />
20 $bild =<br />
Graphics::Magick‐>new;<br />
21 $bild‐>Annotate<br />
(font=>'font.ttf',<br />
pointsize=>40, fill=>'red',<br />
text=>$zeile[1], x=>100,<br />
y=>100);<br />
22 $bild‐>Write(filename=>$ze<br />
ile[0]);<br />
23 }<br />
24 close (DATEILISTE);<br />
Gelegenheit zu geben, diese noch<br />
einmal zu kontrollieren. In den<br />
folgenden Zeilen operiert das<br />
Skript auf der Bilddatei: Es erzeugt<br />
das Bildobjekt, liest die Datei<br />
ein, beschriftet sie mit der Annotate-Methode,<br />
schreibt die geänderte<br />
Bilddatei <strong>und</strong> schließt<br />
diese – alles wie gehabt. Zu guter<br />
Letzt schließt das Skript die Datei<br />
mit der Bilderliste wieder.<br />
Perl-Alternativen<br />
Falls Ihnen PerlMagick nicht zusagt,<br />
gibt es probate Alternativen<br />
– etwa das Modul Imager [7], das<br />
bereits zur Standardinstallation<br />
gehört <strong>und</strong> als ebenbürtig zu Perl-<br />
Magick gilt. Die GD-Library [8]<br />
erfreut sich bei PHP-Entwicklern<br />
großer Beliebtheit. Für Perl existiert<br />
ebenfalls ein Modul dazu.<br />
Dieses enthält neben vielen Routinen<br />
zum Erzeugen von Grafiken<br />
einige Methoden zum Bearbeiten<br />
von Bildern, beispielsweise zum<br />
Rotieren <strong>und</strong> zum Transponieren.<br />
Wer die Skriptsprache Python<br />
bevorzugt, dem sei zum Bearbeiten<br />
von Bildern die Python Imaging<br />
Library (PIL) ans Herz gelegt<br />
[9]. Derzeit steht die stabile<br />
Version 1.1.7 bereit (veröffentlicht<br />
im November 2009). Die Bibliothek<br />
liegt in Versionen für Python<br />
2.5 <strong>und</strong> 2.6 vor; für Python 3<br />
gibt es noch kein offizielles Release.<br />
Das Debian/ Ubuntu-Paket<br />
dazu heißt python-imaging, die Dokumentation<br />
python-imaging-doc.<br />
PIL macht es dem Entwickler<br />
vergleichsweise einfach. Das Einbinden<br />
der Bibliothek erfolgt über<br />
das Einbinden des Moduls mit der<br />
Zeile import Image im Python-<br />
Skript. Die ausführliche Dokumentation<br />
steht in drei Varianten<br />
bereit – online, als PDF-Handbuch<br />
<strong>und</strong> als Debian/ Ubuntu-Paket<br />
([10],[11]). Sie sorgt nach einer<br />
sehr kurzen Einarbeitungszeit<br />
für schnelle Erfolge. Neugierig<br />
machen die kleinen Tutorials zu<br />
PIL, die Nadia Alramli in ihrem<br />
Blog veröffentlicht [12].<br />
Vollständig unterstützt die Bibliothek<br />
beispielsweise die Formate<br />
für Rastergrafiken BMP, GIF,<br />
IM, JPEG, PDF, PNG, PPM, TIFF<br />
<strong>und</strong> XBM, Formate wie MPEG,<br />
PhotoCD, PSD <strong>und</strong> WMF nur<br />
lesend. Auf EPS-Vektorgrafiken<br />
92 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Foto-Batch (Teil 3)<br />
know-how<br />
versteht sich PIL bisher nur mithilfe<br />
von Ghostscript – dafür aber<br />
vollständig.<br />
Bildinformationen<br />
Listing 6 gleicht von den Zielen<br />
her Listing 1. Das Skript gibt die<br />
Informationen zu einer Bilddatei<br />
auf der Standardausgabe aus (Abbildung<br />
B). Die Namen der Bilddateien<br />
erhält das Skript als Parameter<br />
im Aufruf. Nach Angabe<br />
des verwendeten Encodings in<br />
Zeile 1 (hier UTF-8) gilt es, die<br />
beiden zusätzlichen Python-Module<br />
sys <strong>und</strong> Image zu laden (Zeilen<br />
5 <strong>und</strong> 6). Danach wertet das<br />
Skript in Zeile 8 die Aufrufzeile<br />
aus. Das Konstrukt sys.argv[1:]<br />
übernimmt alle übergebenen Parameter<br />
der Aufrufzeile als Liste,<br />
mit Ausnahme des ersten Parameters:<br />
Dieser enthält den nicht<br />
benötigten Namen des Skriptes.<br />
In der For-Schleife in Zeile 10<br />
arbeitet das Skript die Liste der<br />
Parameter einzeln ab, wobei jeder<br />
Parameter den Dateinamen einer<br />
Bilddatei repräsentiert. Nach der<br />
Ausgabe des Dateinamens (Zeile<br />
11) folgt das Laden des Bildes<br />
mit der Methode open() (Zeile 13).<br />
Die Variable bild ist ein Objekt<br />
der Klasse Image mit den Attributen<br />
format (Bildformat), size (Breite<br />
<strong>und</strong> Höhe des Bildes) <strong>und</strong> mode<br />
(Farbmodus). Die Werte der Attribute<br />
liest das Skript aus der Variablen<br />
bild <strong>und</strong> gibt sie danach<br />
auf der Standardausgabe aus (Zeilen<br />
14 bis 16).<br />
Das ganze Konstrukt ist in eine<br />
Struktur eingebettet (try/except),<br />
um auftretende Fehler beim Ablauf<br />
abzufangen. Enthält die Variable<br />
dateiname beispielsweise keine<br />
Bilddatei oder vermag das Skript<br />
die angegebene Bilddatei nicht zu<br />
lesen, überspringt es die Ausgabe<br />
der Bilddetails <strong>und</strong> gibt einen<br />
Fehlerhinweis auf der Standardausgabe<br />
aus (Zeile 19).<br />
Bilder drehen<br />
Für das Drehen von Bildern beinhaltet<br />
die PIL-Klasse die beiden<br />
Methoden rotate <strong>und</strong> transpose.<br />
Während rotate das Drehen um<br />
einen beliebigen Winkel gestattet,<br />
bringt transpose feste Winkel<br />
<strong>und</strong> die Transformationen um die<br />
horizontale <strong>und</strong> vertikale Bildachse<br />
mit. In Sachen Ausführungsgeschwindigkeit<br />
<strong>und</strong> Qualität<br />
der Transformation besteht<br />
kein Unterschied zwischen beiden<br />
Methoden. Nachfolgend<br />
kommt rotate zum Einsatz.<br />
Als einzigen Parameter benötigt<br />
rotate den Drehwinkel als Fließkommazahl.<br />
Listing 7 zeigt das<br />
Drehen eines Bildes um 45 Grad<br />
im Uhrzeigersinn. Zeile 1 enthält<br />
die Instruktionen zum Öffnen<br />
der Datei in Form eines Objektes<br />
der Image-Klasse. Dieses landet<br />
in der Variable bild.<br />
Zeile 2 definiert eine Variable<br />
drehwinkel, die den Fließkommawert<br />
45.0 zugewiesen bekommt.<br />
In Zeile 3 erfolgt das Drehen des<br />
Bildes über den Aufruf der Methode<br />
rotate der Variable bild.<br />
Den gewünschten Drehwinkel<br />
übergeben Sie einfach als Parameter.<br />
In Zeile 4 landet das gedrehte<br />
Bild in der angegebenen Datei –<br />
bei der Abfolge im Beispiel in der<br />
01 # bildinfo.py<br />
liSting 6<br />
02 # ‐*‐ coding: utf‐8 ‐*‐<br />
03<br />
04 # Module System <strong>und</strong> PIL laden<br />
05 import sys<br />
06 import Image<br />
07<br />
08 kommandozeile = sys.argv[1:]<br />
09<br />
10 for dateiname in<br />
kommandozeile:<br />
11 print ("Datei: %s" %<br />
dateiname)<br />
12 try:<br />
13 bild = Image.<br />
open(dateiname)<br />
14 print ("Format: %s" %<br />
bild.format)<br />
15 print ("Größe: %s x %s" %<br />
(bild.size[0], bild.size[1]))<br />
16 print ("Modus: %s" %<br />
bild.mode)<br />
17 print (" ")<br />
18 except IOError:<br />
19 print ("Fehler: kann %s<br />
nicht lesen" % dateiname)<br />
Originaldatei. Listing 8 behebt<br />
diesen Makel <strong>und</strong> zeigt das Drehen<br />
eines Bildes in einem kompletten<br />
Python-Skript. Sie rufen<br />
es wie folgt auf:<br />
$ python bilddrehen.py Drehwinkel<br />
Eingabedatei Ausgabedatei<br />
Das Skript erwartet die Parameter<br />
exakt in dieser genannten Reihenfolge.<br />
Für das Drehen des Bildes<br />
um 45 Grad im Uhrzeigersinn<br />
sieht der Aufruf so aus:<br />
$ python bilddrehen.py 45.0 bild.<br />
png bild‐gedreht.png<br />
01 bild = Image.open(dateiname)<br />
02 drehwinkel = 45.0<br />
03 bild.rotate(drehwinkel)<br />
04 bild.save(dateiname)<br />
liSting 7<br />
B Mit nur wenigen<br />
Zeilen Python zaubern<br />
Sie Metainformationen<br />
aus Bilddateien heraus.<br />
liSting 8<br />
01 # bilddrehen.py<br />
02 # ‐*‐ coding: utf‐8 ‐*‐<br />
03<br />
04 # Module System <strong>und</strong> PIL laden<br />
05 import sys<br />
06 import Image<br />
07<br />
08 (drehwinkel, dateiname, ausgabedatei) = sys.argv[1:]<br />
09 drehwinkel = float(drehwinkel)<br />
10<br />
11 print ("Drehwinkel: %f Grad" % drehwinkel)<br />
12 print ("Datei: %s" % dateiname)<br />
13 print ("Ausgabedatei: %s" % ausgabedatei)<br />
14<br />
15 try:<br />
16 bild = Image.open(dateiname)<br />
17 neuesbild = bild.rotate(drehwinkel)<br />
18 neuesbild.save(ausgabedatei)<br />
19 except IOError:<br />
20 print ("Fehler: kann %s nicht bearbeiten." %<br />
dateiname)<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 93
know-how<br />
Foto-Batch (Teil 3)<br />
C Gqview/ Geeqie stellt<br />
das Bild <strong>und</strong> dessen<br />
Exif-Daten dar.<br />
dAnkSAgung<br />
Der Autor bedankt<br />
sich bei Wolfram Eifler,<br />
Wolfram Schneider<br />
<strong>und</strong> dem Perl-<br />
Stammtisch Berlin<br />
[19] für deren kritische<br />
Anmerkungen,<br />
konstruktive Kommentare<br />
<strong>und</strong> Anregungen<br />
im Vorfeld<br />
dieses Artikels.<br />
Diese Zusatzinformationen zu den<br />
Aufnahmen stehen oft im EXIF-<br />
Format [14] bereit <strong>und</strong> beinhalten<br />
beispielsweise die Auflösung des<br />
Bildes, den Kamerahersteller <strong>und</strong><br />
das Modell, den Farbraum, die genutzten<br />
Filter <strong>und</strong> Objektive sowie<br />
die Orientierung für Hochoder<br />
Querformat [15]. Dabei unterstützen<br />
die Kameras nur die<br />
Formate JPEG, TIFF (Rev. 6) <strong>und</strong><br />
RIFF WAV, die Formate PNG <strong>und</strong><br />
GIF bleiben bislang außen vor.<br />
Viele Beispiele im Netz zeigen<br />
den erfolgreichen Zugriff auf die<br />
Exif-Daten mit dem speziellen<br />
PIL-Modul ExifTags. Diese Information<br />
scheint für aktuelle PIL-<br />
Versionen veraltet zu sein, denn<br />
das Auslesen gelang damit nicht.<br />
Die Alternative Pyexiv2 [16] lieferte<br />
hingegen Ergebnisse. Das<br />
Modul stellt eine Schnittstelle für<br />
die C++-Bibliothek Exiv2 bereit.<br />
Als vollständiges Beispiel zum<br />
Auslesen der Exif-Daten dient<br />
Listing 9: Nach dem Laden des<br />
Bildes (Zeile 14) erfolgt das Lesen<br />
der Exif-Daten mit der Methode<br />
readMetadata (Zeile 15). Eine Liste<br />
der gef<strong>und</strong>enen Metatags liefert<br />
die Methode exifKeys (Zeile 16).<br />
In Zeile 18 gibt das Skript die Liste<br />
zusammen mit den gespeicherten<br />
Metadaten aus. Es akzeptiert<br />
als einzigen Parameter eine Datei<br />
im JPG- oder TIFF-Format, etwa<br />
aufgerufen wie in Listing 10.<br />
Die Liste <strong>und</strong> Werte der Exif-<br />
Tags variieren <strong>und</strong> hängen von<br />
der Kamera selbst, deren Firmware<br />
<strong>und</strong> den Kamera-Einstellungen<br />
ab (siehe dazu das Interview<br />
mit Phil Harvey [17], dem Entwickler<br />
von Exiftool). Die Ausgabe<br />
in Listing 10 verrät, dass das Bild<br />
mit einer Canon Powershot A470<br />
am 14. September 2008 kurz nach<br />
11 Uhr aufgenommen wurde (geinfo<br />
[1] Teil 1 der Serie: Frank Hofmann, „Am laufenden Band“, LU 03/ 2011, S. 84,<br />
http:// www. linux-community. de/ 22947<br />
[2] Teil 2 der Serie: Frank Hofmann, „Fix <strong>und</strong> fertig“, LU 06/ 2011, S. 84,<br />
http:// www. linux-community. de/ 22948<br />
[3] ImageMagick: http:// www. imagemagick. org<br />
[4] GraphicsMagick: http:// www. graphicsmagick. org<br />
[5] PerlMagick: http:// www. imagemagick. org/ script/ perl-magick. php<br />
[6] PythonMagick: http:// wiki. python. org/ moin/ PythonMagick<br />
[7] Perl-Modul Imager: http:// imager. perl. org/<br />
[8] Perl-Modul für die GD-Library: http:// search. cpan. org/ ~lds/ GD/ GD. pm<br />
[9] Python Imaging Library: http:// www. pythonware. com/ products/ pil<br />
[10] PIL-Dokumentation (online):<br />
http:// www. pythonware. com/ library/ pil/ handbook/ index. htm<br />
[11] PIL-Dokumentation (PDF):<br />
http:// www. pythonware. com/ media/ data/ pil-handbook. pdf<br />
[12] PIL-Tutorial: Nadia Alramli, „From Basic to Advanced Drawing“,<br />
http:// nadiana. com/ pil-tutorial-basic-advanced-drawing<br />
[13] Geeqie-Workshop: Karsten Günther, „Ordentlich sortiert“, LU 10/ 2010, S. 58,<br />
http:// www. linux-community. de/ 21689<br />
[14] EXIF: http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Exchangeable_image_file_format<br />
[15] EXIF-Spezifikation: http:// www. exif. org/ specifications. html<br />
[16] Pyexiv2-Projekt: http:// tilloy. net/ dev/ pyexiv2/<br />
[17] Interview mit Phil Harvey: Andreas Bohle, „Alles im Griff“, LU 09/ 2010, S. 28,<br />
http:// www. linux-community. de/ 21636<br />
[18] Exif-Daten zur Bildausrichtung:<br />
http:// www. impulseadventure. com/ photo/ exif-orientation. html<br />
[19] Perl-Stammtisch Berlin: http:// perlmongers. de/ ? BerlinPM<br />
Nach dem Python-Vorspann (Zeile<br />
1 bis 7) wertet das Skript den<br />
Aufruf aus. Zunächst liest es die<br />
Parameter aus <strong>und</strong> weist diese den<br />
drei internen Variablen drehwinkel,<br />
dateiname <strong>und</strong> ausgabedatei zu (Zeile<br />
8). Es lohnt sich sicherzustellen,<br />
dass der Drehwinkel eine<br />
Fließkommazahl ist (Zeile 9). Das<br />
geschieht, indem Sie den im Parameter<br />
übermittelten Wert für den<br />
Drehwinkel mittels float() explizit<br />
in eine Fließkommazahl umwandeln.<br />
Die Zeilen 11 bis 13 geben<br />
die Werte für die zu bearbeitende<br />
Datei, den Drehwinkel <strong>und</strong><br />
die Ausgabedatei aus.<br />
In den Zeilen 15 bis 20 erfolgt<br />
das Rotieren: Das Skript öffnet<br />
die Bilddatei (Zeile 16), dreht sie<br />
dann um den gewünschten Winkel<br />
(Zeile 17), legt anschließend<br />
das veränderte Bild in der Variable<br />
neuesbild ab <strong>und</strong> speichert das<br />
Resultat schließlich in der Ausgabedatei<br />
(Zeile 18). Eine bestehende<br />
Datei gleichen Namens überschreibt<br />
es <strong>ohne</strong> Rückfrage. Tritt<br />
beim Bearbeiten ein Ein-/ Ausgabefehler<br />
auf, greift das Try-Except-Statement,<br />
fängt den Fehler<br />
ab <strong>und</strong> gibt ihn aus (Zeile 20).<br />
Daten auslesen<br />
Mit Listing 8 steht eine generische<br />
Schnittstelle zum Rotieren<br />
von Bildern bereit, die beliebige<br />
Drehwinkel ermöglicht. Im Alltag<br />
reduziert sich das häufig auf die<br />
Notwendigkeit, Bilder korrekt im<br />
Quer- oder Hochformat anzuzeigen.<br />
Viele Programme werten<br />
dazu bereits Zusatzinformationen<br />
in den Bildern aus <strong>und</strong> stellen<br />
das Bild entsprechend gedreht<br />
dar. <strong>LinuxUser</strong> stellte dazu bereits<br />
die Möglichkeiten von<br />
Geeqie (Abbildung C) vor [13].<br />
AuSrichtungSoptionen<br />
Option Bedeutung Winkel<br />
1 Querformat, Nullpunkt oben links Drehen um 0 Grad<br />
3 Querformat, Nullpunkt unten rechts Drehen um 180 Grad<br />
6 Hochformat, Nullpunkt oben rechts Drehen um 90 Grad<br />
8 Hochformat, Nullpunkt unten links Drehen um 270 Grad<br />
94 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Foto-Batch (Teil 3)<br />
know-how<br />
nauer: Die Kamera hat diesen Zeitstempel<br />
eingetragen). Das Bild hat<br />
eine Breite von 2048 Pixel <strong>und</strong><br />
eine Höhe von 1536 Pixeln.<br />
Die Zeile Exif.Image.Orientation<br />
mit dem Wert 1 besagt, dass die<br />
Aufnahme im Querformat vorliegt.<br />
Gemäß [18] sind auch die<br />
Werte in der Tabelle Ausrichtungsoptionen<br />
gültig. Eine Kamera ermittelt<br />
die Ausrichtung über einen<br />
Lagesensor, mittels dessen sie erkennt,<br />
ob Sie gerade im Hochoder<br />
Querformat aufnehmen.<br />
Demgemäß setzt sie den entsprechenden<br />
Wert in den Exif-Daten.<br />
Verfügt das Aufnahmegerät über<br />
keinen solchen Sensor, trägt es bei<br />
allen Aufnahmen eine 1 ein, geht<br />
also vom Querformat aus.<br />
Nach Exif-Daten drehen<br />
Als letztes Beispiel dient ein<br />
Skript, welches das Bild so dreht,<br />
wie es sich der Fotograf bei der<br />
Aufnahme gedacht hat. Die<br />
Gr<strong>und</strong>lage dazu liefern die Exif-<br />
Daten, die den notwendigen<br />
Drehwinkel verraten. Dazu kombiniert<br />
der Code in Listing 11<br />
Funktionen aus PIL <strong>und</strong> Pyexiv2.<br />
01 # exif.py<br />
liSting 9<br />
02 # ‐*‐ coding: utf‐8 ‐*‐<br />
03<br />
04 # Module System <strong>und</strong> Pyexiv2<br />
laden<br />
05 import sys<br />
06 import pyexiv2<br />
07<br />
08 kommandozeile = sys.argv[1:]<br />
09 dateiname = kommandozeile[0]<br />
10<br />
11 print ("Datei: %s" %<br />
dateiname)<br />
12<br />
13 try:<br />
14 bild = pyexiv2.<br />
Image(dateiname)<br />
15 bild.readMetadata()<br />
16 info = bild.exifKeys()<br />
17 for key in info:<br />
18 print ("%s: %s" % (key,<br />
bild[key]))<br />
19 except IOError:<br />
20 print ("Fehler: kann<br />
%s nicht bearbeiten" %<br />
dateiname)<br />
Nach dem Vorspann (Zeile 1 bis 8)<br />
<strong>und</strong> dem Auswerten der Parameter<br />
(Zeile 9 bis 13) liest das Skript<br />
die Exif-Daten aus der Bilddatei<br />
aus (Zeile 16 bis 19). Interessant<br />
ist der Eintrag Exif.Image.Orientation,<br />
dessen Wert in der Variable<br />
ausrichtung landet (Zeile 19). Zeile<br />
21 enthält eine Liste mit Einträgen,<br />
die jedem Wert der Ausrichtung<br />
den entsprechenden<br />
Drehwinkel zuordnet. Dabei fungiert<br />
der Wert der Ausrichtung<br />
als Index in der Liste.<br />
Beinhaltet die Ausrichtung einen<br />
Wert größer 1, gilt es, das<br />
Bild entsprechend zu drehen. In<br />
den Zeilen 27 bis 29 erledigt die<br />
PIL-Methode rotate das Rotieren<br />
des Bildes. Dabei gehen zunächst<br />
die Exif-Daten verloren. Deswegen<br />
überträgt das Skript diese in<br />
den Zeilen 31 bis 45 aus dem alten<br />
Bild ins neue. Dazu kopiert es<br />
die Werte des Ursprungsbildes<br />
zunächst vollständig in die Datenstruktur<br />
des neuen Bildes<br />
(Zeilen 33 bis 38).<br />
Liegt ein Bild im Hochformat<br />
vor, bedürfen alle achsenbezogenen<br />
Werte einer Korrektur, also<br />
Höhe <strong>und</strong> Breite des Bildes sowie<br />
die Auflösung <strong>und</strong> Ausrichtung.<br />
Schließlich speichert das Skript<br />
das Ergebnis in Zeile 45 in der<br />
neuen Datei.<br />
Fazit<br />
Im Gegensatz zu einfachen Skripten<br />
mittels Bash <strong>und</strong> anderen<br />
Kommandozeilen-Werkzeugen<br />
bietet das Bearbeiten von Bilddateien<br />
mit Skriptsprachen bei geringerem<br />
Aufwand sehr viel mehr<br />
liSting 10<br />
$ python exif.py IMG_0284.JPG<br />
Datei: IMG_0284.JPG<br />
Exif.Image.Make: Canon<br />
Exif.Image.Model: Canon<br />
PowerShot A470<br />
Exif.Image.Orientation: 1<br />
Exif.Image.DateTime: 2008‐09‐14<br />
11:05:50<br />
Exif.Photo.PixelXDimension: 2048<br />
Exif.Photo.PixelYDimension: 1536<br />
...<br />
Möglichkeiten. Allerdings gilt es,<br />
dazu im Zweifelsfall eine komplett<br />
neue Sprache zu lernen –<br />
aber solche Herausforderungen<br />
machen ja unter anderem den<br />
Reiz von Linux aus, oder? (agr) n<br />
liSting 11<br />
01 # exif2.py<br />
02 # ‐*‐ coding: utf‐8 ‐*‐<br />
03<br />
04 # Module System, PIL <strong>und</strong> Pyexiv2 laden<br />
05 import sys<br />
06 import pyexiv2<br />
07 import Image<br />
08<br />
09 kommandozeile = sys.argv[1:]<br />
10 dateiname = kommandozeile[0]<br />
11 ausgabedatei = kommandozeile[1]<br />
12<br />
13 print ("Datei: %s" % dateiname)<br />
14<br />
15 try:<br />
16 bild = pyexiv2.Image(dateiname)<br />
17 bild.readMetadata()<br />
18 info = bild.exifKeys()<br />
19 ausrichtung = bild['Exif.Image.Orientation']<br />
20<br />
21 zuordnung = {1: 0.0, 3: 180.0, 6: 90.0, 8: 270.0}<br />
22 drehwinkel = zuordnung[ausrichtung]<br />
23 print ("Ausrichtung: %i" % ausrichtung)<br />
24 print ("Drehwinkel: %f Grad" % drehwinkel)<br />
25<br />
26 if ausrichtung > 1:<br />
27 neuesbild = Image.open(dateiname)<br />
28 neuesbild = neuesbild.rotate(drehwinkel)<br />
29 neuesbild.save(ausgabedatei)<br />
30<br />
31 neuesbild = pyexiv2.Image(ausgabedatei)<br />
32 neuesbild.readMetadata()<br />
33 for key in info:<br />
34 try:<br />
35 neuesbild[key] = bild[key]<br />
36 except:<br />
37 print ("Konvertierungsfehler bei Eintrag %s"<br />
% key)<br />
38<br />
39 neuesbild['Exif.Image.Orientation'] = 1<br />
40 if ausrichtung > 5:<br />
41 neuesbild['Exif.Image.XResolution'] =<br />
bild['Exif.Image.YResolution']<br />
42 neuesbild['Exif.Image.YResolution'] =<br />
bild['Exif.Image.XResolution']<br />
43 neuesbild['Exif.Photo.PixelXDimension'] =<br />
bild['Exif.Photo.PixelYDimension']<br />
44 neuesbild['Exif.Photo.PixelYDimension'] =<br />
bild['Exif.Photo.PixelXDimension']<br />
45 neuesbild.writeMetadata()<br />
46 print ("Ausgabedatei: %s" % ausgabedatei)<br />
47 except IOError:<br />
48 print ("Fehler: kann %s nicht bearbeiten" %<br />
dateiname)<br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 95
servIce<br />
IT-Profimarkt<br />
PROFI<br />
MARKT<br />
Sie fragen sich, wo Sie maßgeschneiderte<br />
Linux-Systeme sowie kompetente Ansprechpartner<br />
zu Open-Source-Themen<br />
finden? Der IT-Profimarkt weist Ihnen<br />
hier als zuverlässiges Nachschlagewerk<br />
den Weg. Die im Folgenden gelisteten<br />
Unternehmen beschäftigen Experten auf<br />
ihrem Gebiet <strong>und</strong> bieten hochwertige<br />
Produkte <strong>und</strong> Leistungen.<br />
Die exakten Angebote jeder Firma entnehmen<br />
Sie deren Homepage. Der ersten Orientierung<br />
dienen die Kategorien Hardware,<br />
Software, Seminaranbieter, Systemhaus,<br />
Netzwerk/TK sowie Schulung/Beratung.<br />
Der IT-Profimarkt-Eintrag ist ein<br />
Service von Linux-Magazin <strong>und</strong> <strong>LinuxUser</strong>.<br />
Online-Suche<br />
Besonders komfortabel finden Sie einen<br />
Linux-Anbieter in Ihrer Nähe online über<br />
die neue Umkreis-Suche unter:<br />
[http://www.it-profimarkt.de]<br />
Weitere Informationen:<br />
Linux New Media AG<br />
Anzeigenabteilung<br />
Putzbrunner Str. 71<br />
D-81739 München<br />
Tel: +49 (0) 89 / 99 34 11-23<br />
Fax: +49 (0) 89 / 99 34 11-99<br />
E-Mail: anzeigen@linux-user.de<br />
IT-ProFImArkT (LIsTe sorTIerT nAch PosTLeITzAhL)<br />
Firma Anschrift Telefon Web 1 2 3 4 5 6<br />
Schlittermann internet & unix support 01099 Dresden, Tannenstr. 2 0351-802998-1 www.schlittermann.de 3 3 3 3<br />
imunixx GmbH UNIX consultants 01468 Moritzburg, Heinrich-Heine-Str. 4 0351-83975-0 www.imunixx.de 3 3 3 3 3<br />
future Training & Consulting GmbH Leipzig 04315 Leipzig, Kohlgartenstraße 15 0341-6804100 www.futuretrainings.com 3<br />
future Training & Consulting GmbH Halle 06116 Halle (Saale), Fiete-Schulze-Str. 13 0345-56418-20 www.futuretrainings.com 3<br />
future Training & Consulting GmbH Chemnitz 09111 Chemnitz, Bahnhofstraße 5 0371-6957730 www.futuretrainings.com 3<br />
TUXMAN Computer 10369 Berlin, Anton-Saefkow-Platz 8 030-97609773 www.tuxman.de 3 3 3 3 3<br />
Hostserver GmbH 10405 Berlin, Winsstraße 70 030-47375550 www.hostserver.de 3<br />
Compaso GmbH 10439 Berlin, Driesener Strasse 23 030-3269330 www.compaso.de 3 3 3 3 3<br />
Linux Information Systems AG Berlin 12161 Berlin, B<strong>und</strong>esallee 93 030-818686-03 www.linux-ag.com 3 3 3 3 3<br />
elego Software Solutions GmbH 13355 Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25 030-2345869-6 www.elegosoft.com 3 3 3 3<br />
future Training & Consulting GmbH Berlin 13629 Berlin, Wernerwerkdamm 5 030-34358899 www.futuretrainings.com 3<br />
verion GmbH 16244 Altenhof, Unter den Buchen 22 e 033363-4610-0 www.verion.de 3 3 3<br />
Logic Way GmbH 19061 Schwerin, Hagenower Str. 73 0385-39934-48 www.logicway.de 3 3 3 3<br />
Sybuca GmbH 20459 Hamburg, Herrengraben 26 040-27863190 www.sybuca.de 3 3 3 3 3<br />
iTechnology GmbH c/ o C:1 Solutions GmbH 22083 Hamburg, Osterbekstr. 90 c 040-52388-0 www.itechnology.de 3 3 3 3<br />
UDS-Linux - Schulung, Beratung, Entwicklung 22087 Hamburg, Lübecker Str. 1 040-45017123 www.uds-linux.de 3 3 3 3 3 3<br />
future Training & Consulting GmbH Wismar 23966 Wismar, Lübsche Straße 22 03841-222851 www.futuretrainings.com 3<br />
Dr. Plöger & Kollegen secom consulting GmbH &<br />
Co. KG<br />
24105 Kiel, Waitzstr. 3 0431-66849700 www.secom-consulting.de 3 3 3 3 3<br />
beitco - Behrens IT-Consulting 26197 Ahlhorn, Lessingstr. 27 04435-9537330-0 www.beitco.de 3 3 3 3<br />
talicom GmbH 30169 Hannover, Calenberger Esplanade 3 0511-123599-0 www.talicom.de 3 3 3 3 3<br />
futureTraining & Consulting GmbH Hannover 30451 Hannover, Fössestr. 77 a 0511-70034616 www.futuretrainings.com 3<br />
teuto.net Netzdienste GmbH 33602 Bielefeld, Niedenstr. 26 0521-96686-0 www.teuto.net 3 3 3 3 3<br />
MarcanT GmbH 33602 Bielefeld, Ravensberger Str. 10 G 0521-95945-0 www.marcant.net 3 3 3 3 3 3<br />
1 = hardware 2 = netzwerk/Tk 3 = systemhaus 4 = seminaranbieter 5 = software 6 = schulung/Beratung (s. 96)<br />
98 10 | 11<br />
www.linux-user.de
IT-Profimarkt<br />
servIce<br />
IT-ProFImArkT (ForTSETzuNG voN S. 88)<br />
Firma Anschrift Telefon Web 1 2 3 4 5 6<br />
Hostserver GmbH 35037 Marburg, Biegenstr. 20 06421-175175-0 www.hostserver.de 3<br />
OpenIT GmbH 40599 Düsseldorf, In der Steele 33a-41 0211-239577-0 www.OpenIT.de 3 3 3 3 3<br />
Linux-Systeme GmbH 45277 Essen, Langenbergerstr. 179 0201-298830 www.linux-systeme.de 3 3 3 3 3<br />
Linuxhotel GmbH 45279 Essen, Antonienallee 1 0201-8536-600 www.linuxhotel.de 3<br />
Herstell 45888 Gelsenkirchen, Wildenbruchstr. 18 0176-20947146 www.herstell.info 3 3 3 3<br />
OpenSource Training Ralf Spenneberg 48565 Steinfurt, Am Bahnhof 3-5 02552-638755 www.opensource-training.de 3<br />
Intevation GmbH 49074 Osnabrück, Neuer Graben 17 0541-33508-30 osnabrueck.intevation.de 3 3 3 3<br />
LWsystems GmbH & Co. KG 49186 Bad Iburg, Tegelerweg 11 05403-5556 www.lw-systems.de 3 3 3 3 3 3<br />
Systemhaus SAR GmbH 52499 Baesweiler, Arnold-Sommerfeld-Ring 27 02401-9195-0 www.sar.de 3 3 3 3 3 3<br />
uib gmbh 55118 Mainz, Bonifaziusplatz 1b 06131-27561-0 www.uib.de 3 3 3 3 3<br />
LISA GmbH 55411 Bingen, Elisenhöhe 47 06721-49960 www.lisa-gmbh.de 3 3 3 3 3<br />
saveIP GmbH 64283 Darmstadt, Schleiermacherstr. 23 06151-666266 www.saveip.de 3 3 3 3 3<br />
LAMARC EDV-Schulungen u. Beratung GmbH 65193 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 14 0611-260023 www.lamarc.com 3 3 3 3<br />
ORDIX AG 65205 Wiesbaden, Kreuzberger Ring 13 0611-77840-00 www.ordix.de 3 3 3 3 3<br />
LinuxHaus Stuttgart 70565 Stuttgart, Hessenwiesenstrasse 10 0711-2851905 www.linuxhaus.de 3 3 3 3 3<br />
com<strong>und</strong>us GmbH 71332 Waiblingen, Schüttelgrabenring 3 07151-5002850 www.com<strong>und</strong>us.com 3<br />
Veigel Linux Software Development 71723 Großbottwar, Frankenstr. 15 07148-922352 www.mvlsd.de 3 3 3 3<br />
future Training & Consulting GmbH Reutlingen 72770 Reutlingen, Auchterstraße 8 07121-14493943 www.futuretrainings.com 3<br />
Manfred Heubach EDV <strong>und</strong> Kommunikation 73728 Esslingen, Hindenburgstr. 47 0711-4904930 www.heubach-edv.de 3 3 3 3<br />
Waldmann EDV Systeme + Service 74321 Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheimer Str. 25 07142-21516 www.waldmann-edv.de 3 3 3 3 3<br />
in-put Das Linux-Systemhaus 76133 Karlsruhe, Moltkestr. 49 0721-6803288-0 www.in-put.de 3 3 3 3 3 3<br />
Bodenseo 78224 Singen, Pomeziastr. 9 07731-1476120 www.bodenseo.de 3 3 3<br />
Linux Information Systems AG 81739 München, Putzbrunnerstr. 71 089-993412-0 www.linux-ag.com 3 3 3 3 3<br />
Synergy Systems GmbH 81829 München, Konrad-Zuse-Platz 8 089-89080500 www.synergysystems.de 3 3 3 3 3<br />
B1 Systems GmbH 85088 Vohburg, Osterfeldstrasse 7 08457-931096 www.b1-systems.de 3 3 3 3 3<br />
ATIX AG 85716 Unterschleißheim, Einsteinstr. 10 089-4523538-0 www.atix.de 3 3 3 3 3<br />
Bereos OHG 88069 Tettnang, Kalchenstraße 6 07542-9345-20 www.bereos.eu 3 3 3 3 3<br />
OSTC Open Source Training and Consulting GmbH 90425 Nürnberg, Delsenbachweg 32 0911-3474544 www.ostc.de 3 3 3 3 3 3<br />
Dipl.-Ing. Christoph Stockmayer GmbH 90571 Schwaig, Dreihöhenstr. 1 0911-505241 www.stockmayer.de 3 3 3<br />
fidu.de IT KG 95448 Bayreuth, Ritter-v.-Eitzenb.-Str. 19 09208-657638 www.linux-onlineshop.de 3 3 3 3<br />
Computersysteme Gmeiner 95643 Tirschenreuth, Fischerhüttenweg 4 09631-7000-0 www.gmeiner.de 3 3 3 3 3<br />
RealStuff Informatik AG CH-3007 Bern, Chutzenstrasse 24 0041-31-3824444 www.realstuff.ch 3 3 3<br />
CATATEC CH-3013 Bern, Dammweg 43 0041-31-3302630 www.catatec.ch 3 3 3<br />
EBP Gasser CH-4208 Nunningen, Winkel 6 0041-61793-0099 www.ebp-gasser.ch 3 3 3 3 3<br />
Syscon Systemberatungs AG CH-8003 Zürich, Zweierstrasse 129 0041-44-4542010 www.syscon.ch 3 3 3 3 3<br />
Helvetica IT AG CH-8890 Flums, Bahnhofstrasse 15 0041-817331567 www.helvetica-it.com 3 3 3<br />
1 = hardware 2 = netzwerk/Tk 3 = systemhaus 4 = seminaranbieter 5 = software 6 = schulung/Beratung <br />
www.linux-user.de<br />
10 | 11 99
servIce<br />
10 | 11<br />
100 www.linux-user.de<br />
Usergroups<br />
Aachen<br />
AachenerLinux-Usergroup<br />
(ALUG)<br />
http://www.alug.de<br />
Aachen<br />
Computer-ClubanderRWTH<br />
Aachene.V.(CCAC)<br />
http://www.ccac.rwth-aachen.<br />
de<br />
Ahaus<br />
Linux-UsergroupAhaus(LUGAH)<br />
http://www.lugah.de<br />
Ahlen/Westfalen<br />
LUGAhlen<br />
http://linuxahlen.li.funpic.de/<br />
Ahrtal<br />
Linux-UsergroupAhrtal(Ahrlug)<br />
http://www.ahrlug.de<br />
Aichach<br />
Linux-UsergroupAichach<br />
http://www.lug-aichach.de<br />
Allershausen<br />
Linux-UsergroupAmpertal<br />
(LUGA)<br />
http://www.luga.net<br />
Altdorf/<br />
Nürnberg<br />
GNU/<strong>LinuxUser</strong>GroupAltdorf<br />
(GLUGA)<br />
http://www.gluga.de<br />
Amberg<br />
Open-Source-Stammtisch<br />
Amberg(amTuxTisch)<br />
http://www.amtuxtisch.de/<br />
Ansbach<br />
Linux-UsergroupAnsbach<br />
(LUGAN)<br />
http://www.lug-an.de<br />
Aschaffenburg<br />
Linux-UsergroupAschaffenburg<br />
(LUGAB)<br />
http://www.lugab.de<br />
Augsburg<br />
Linux-UsergroupAugsburg<br />
(LUGA)<br />
http://www.luga.de<br />
Backnang<br />
Linux-UsergroupBacknang<br />
http://www.lug-bk.de<br />
BadBrückenau<br />
Linux-UsergroupBadBrückenau<br />
BrunoZehe@web.de<br />
BadDriburg<br />
Linux-UsergroupBadDriburg<br />
http://www.bdpeng.de.vu<br />
BadHersfeld<br />
Linux-UsergroupHersfeld<br />
http://www.lugh.de<br />
BadWildungen<br />
Linux-UsergroupBadWildungen<br />
http://linuxheaven.cjb.net<br />
Bamberg<br />
Linux-UsergroupBamberg<br />
(GLUGBA)<br />
http://www.lug-bamberg.de<br />
Basel(CH)<br />
Linux-UsergroupBasel(BLUG)<br />
http://www.blug.ch<br />
Bautzen<br />
Linux-UsergroupBautzen<br />
http://www.lug-bz.de<br />
Bayreuth<br />
Linux-UsergroupBayreuth<br />
http://www.linux-bayreuth.de<br />
Bergisch<br />
Gladbach<br />
BergischeLinux-<strong>und</strong>Unix-<br />
Enthusiastenu.-Fre<strong>und</strong>e<br />
(BLUEFROGS)<br />
http://www.bluefrogs.de<br />
Berlin<br />
Linux-UsergroupBerlin(BeLUG)<br />
http://www.belug.de<br />
Berlin<br />
UbuntuBerlin<br />
http://www.ubuntu-berlin.de<br />
Berlin/<br />
Friedrichshain-<br />
Kreuzberg<br />
LinuxWorks!<br />
http://friedrichshain.homelinux.<br />
org<br />
Berlin/<br />
Lichtenrade<br />
Linux-UsergroupLichtenrade<br />
(LUGL)<br />
http://www.lugl.net<br />
Berlin/Marzahn-<br />
Hellersdorf<br />
Open-Source-Fan-Group<br />
Marzahn-Hellersdorf(OSFanG)<br />
http://www.osfang.de<br />
Bern(CH)<br />
Linux-UsergroupBern(LUGBE)<br />
http://www.lugbe.ch<br />
Biel/Bienne/<br />
Seeland(CH)<br />
Linux-UsergroupSeeland<br />
(LugSeeland)<br />
http://www.lugseeland.ch<br />
Bielefeld<br />
<strong>LinuxUser</strong>groupOstwestfalen-<br />
Lippe<br />
http://lug-owl.de/Lokales/<br />
Bielefeld/<br />
Bitburg-Prüm<br />
Linux-UsergruppeSchneifeltux<br />
http://www.schneifeltux.de<br />
Bocholt<br />
Linux-UsergroupBocholt(BLUG)<br />
http://www.blug.de<br />
Bochum<br />
Linux-UsergroupBochum<br />
(BGLUG)<br />
http://www.bglug.de<br />
Bonn<br />
BonnerLinux-Usergroup<br />
(BOLUG)<br />
http://www.bonn.linux.de/<br />
Bonn<br />
Linux/UnixUsergroupSankt<br />
Augustin(LUUSA)<br />
http://www.luusa.org<br />
Bozen(Südtirol)<br />
Linux-UsergroupBozen(LUGBZ)<br />
http://www.lugbz.org<br />
Brandenburg<br />
Brandenburger<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
e.V.(BraLUG)<br />
http://www.bralug.de<br />
Bremen<br />
Linux-StammtischBremen<br />
http://lug-bremen.info<br />
Bremerhaven<br />
Linux-StammtischBremerhaven<br />
http://www.lug-bhv.de/<br />
Bretten<br />
BrettenerLinux-Usergroup<br />
(BRELUG)<br />
http://www.brelug.de<br />
Bruchsal<br />
Linux-UsergroupBruchsal<br />
http://www.lug-bruchsal.de<br />
Buchholz<br />
Nordheide<br />
Linux-UsergroupBuchholz<br />
Nordheide<br />
http://www.lug-buchholznordheide.de<br />
Burghausen<br />
Linux-UsergroupBurghausen<br />
http://www.lug-burghausen.org<br />
Böblingen/<br />
Sindelfingen<br />
Linux-UsergroupBöblingen/<br />
Sindelfingen(LUGBB)<br />
http://www.lugbb.org<br />
Celle<br />
LUGCelle<br />
http://www.lug-celle.de<br />
Cham<br />
Linux-UsergroupOberpfalz<br />
(LUGO)<br />
http://lugo.signum-media.de<br />
Chemnitz<br />
Linux-UsergroupChemnitz<br />
(CLUG)<br />
http://www.clug.de<br />
Coesfeld<br />
Linux-UsergroupCoesfeld<br />
http://www.lug-coesfeld.de<br />
Cottbus<br />
CottbuserLinux-Usergroup<br />
(COLUG)<br />
http://www.colug.de/<br />
Damme<br />
UsersofLinuxDamme(ULD)<br />
http://www.damme.de<br />
Darmstadt<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupDarmstadt<br />
(DaLUG)<br />
http://www.dalug.org<br />
Datteln<br />
Linux-UsergroupDatteln(LUGD)<br />
http://www.lug-datteln.de<br />
Delitzsch<br />
(Sachsen)<br />
Linux-UsergroupDelitzsch<br />
http://www.lug-delitzsch.de<br />
Detmold<br />
Linux-UsergroupOstwestfalen-<br />
Lippe(LUGOWL)<br />
http://lug-owl.de/Lokales/<br />
Detmold/<br />
Dorfen<br />
Linux-UsergroupDorfen(LUGD)<br />
http://www.dolug.de<br />
Dormagen<br />
PinguinPower(PP)<br />
http://www.dorlug.de<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
Linux-UsergroupDortm<strong>und</strong><br />
(LUGRUDO)<br />
http://www.outerspace.de/<br />
lugrudo/<br />
Dresden<br />
Linux-UsergroupDresden<br />
http://lug-dd.schlittermann.de/<br />
Duisburg<br />
DuisburgerLinux-Usergroup<br />
(DULUG)<br />
http://www.dulug.de<br />
Duisburg<br />
Linux-UsergroupDuisburg<br />
(LUG-DUI)<br />
http://lugdui.ihg.uni-duisburg.de<br />
Düsseldorf<br />
Linux-UsergroupDüsseldorf<br />
(DLUG)<br />
http://www.dlug.de<br />
Ebstorf<br />
EbstorferLinux-Stammtisch<br />
(ELST)<br />
support@konqi-werkstatt.de<br />
Eggenfelden<br />
EggenfeldenerLinux-Usergroup<br />
(EgLUG)<br />
http://www.lug-eggenfelden.org<br />
Eichsfeld<br />
Eichsfelder<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
(EICLUG)<br />
http://linux.eichsfeld.net<br />
Eisenach<br />
Linux-UsergroupEisenach<br />
http://lug-eisenach.de/<br />
Elmshorn<br />
ComputerclubElmshorne.V.<br />
http://www.cceev.de/<br />
Erding<br />
Linux-UsergroupErding<br />
http://www.lug-erding.de<br />
Erkelenz<br />
Linux-UsergroupErkelenz<br />
http://www.lug-erkelenz.de<br />
Erlangen<br />
ErlangerLinux-Usergroup<br />
(ERLUG)<br />
http://www.erlug.de<br />
Essen<br />
EssenerLinux-Fre<strong>und</strong>e(ELiF)<br />
http://www.linuxstammtisch.de<br />
Essen<br />
EssenerLinux-Stammtisch<br />
(ELiSta)<br />
http://members.tripod.de/elista<br />
Essen<br />
EssenerLinux-Usergroup(ELUG)<br />
http://www.elug.de<br />
Essen<br />
PerlMongersimRuhrgebiet<br />
(Ruhr.pm)<br />
http://ruhr.pm.org/<br />
Esslingen<br />
Linux-UsergroupEsslingen<br />
http://rhlx01.rz.fht-esslingen.<br />
de/lug/<br />
Ettlingen/Albtal<br />
LUGAlbtal<br />
http://www.lug-albtal.de<br />
Fischbachtal<br />
<strong>LinuxUser</strong>groupFischbachtal<br />
(FIBALUG)<br />
http://fibalug.de<br />
Flensburg<br />
Linux-UsergroupFlensburg<br />
(LUGFL)<br />
http://www.lugfl.de<br />
Frammersbach<br />
FrammersbacherLUG<br />
kke@gmx.net<br />
Frankfurt<br />
Linux-UsergroupFrankfurt<br />
http://www.lugfrankfurt.de<br />
Freiburg<br />
FreiburgerLinux-Usergroup<br />
(FLUG)<br />
http://www.freiburg.linux.de<br />
Freiburg<br />
LUGderStudentensiedlung<br />
Freiburg(StuSieLUG)<br />
http://linux.studentensiedlung.<br />
de<br />
Freising<br />
Linux-UsergroupFreising<br />
(LUGFS)<br />
http://www.lug-fs.de<br />
Friedrichshafen<br />
Yetanother<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
(YALUG)<br />
http://yalug.de<br />
Fulda<br />
Linux-UsergroupFulda<br />
http://lug.rhoen.de<br />
Fürstenfeldbruck<br />
LUGdesBürgernetzesLandkreis<br />
Fürstenfeldbruck(LUGFFB)<br />
http://lug.ffb.org/<br />
Fürth<br />
FürtherLinux-Usergroup(FLUG)<br />
http://www.fen-net.de/flug<br />
Gießen<br />
Linux-UsergroupGießen(LUGG)<br />
http://lugg.tg.fh-giessen.de<br />
Gießen<br />
LUGderLiebig-SchuleGießen<br />
(LioLUG)<br />
http://liolug.liebigschulegiessen.de/<br />
Grafing<br />
Linux-UsergroupGrafing(LUGG)<br />
http://www.lug-grafing.org<br />
Greifswald<br />
Linux-UsergroupGreifswald<br />
http://www.lug-hgw.de/<br />
Groß-Gerau<br />
Linux-UsergroupGroß-Gerau<br />
(LUGGG)<br />
http://www.luggg.de<br />
Groß-Zimmern<br />
Linux-UsergroupGroß-Zimmern<br />
(GROZILUG)<br />
http://www.grozilug.de<br />
Gummersbach<br />
GummersbacherLinux-<br />
Usergroup(GULUG)<br />
http://www.gulug.de<br />
Guntersblum<br />
GuntersblumerLinux-Usergroup<br />
(GLUG)<br />
http://www.ghks.de/glug/<br />
Gunzenhausen<br />
GunzenhauserLinux-Usergroup<br />
(LUGGUU)<br />
http://www.gunnet.de/linux<br />
Gütersloh<br />
Linux-UsergroupOstwestfalen-<br />
Lippe(LUGOWL)<br />
http://lug-owl.de/Lokales/<br />
Guetersloh/<br />
Göppingen<br />
Linux-UsergroupFilstal<br />
http://lug.fto.de/<br />
Göttingen<br />
Göttinger<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
(GOELUG)<br />
http://www.goelug.de/<br />
Göttingen<br />
GöttingerUnix/Linux-<br />
Anwendergruppe(GULAG)<br />
http://gulag.de<br />
Haiger<br />
Linux-UsergroupLahn-Dill-Kreis<br />
(LDK/LUG)<br />
http://www.ldknet.org/lug/<br />
Halberstadt<br />
Linux-UsergroupHalberstadt<br />
http://www.lug-hbs.de<br />
Halle<br />
HallescheLinux-Usergroup<br />
(HALIX)<br />
http://www.halix.info<br />
Hamburg<br />
LUG-BalistaHamburge.V.(LUG-<br />
Balista)<br />
http://www.lug-balista.de<br />
Hamburg<br />
Unix-GruppederHamburger<br />
MHe.V.<br />
http://www.hmh-ev.de<br />
Hameln<br />
Linux-UsergroupWeserbergland<br />
(LBW)<br />
http://tux.hm<br />
Hanau<br />
HanauerLinux-Usergroup<br />
(HULUG)<br />
http://www.hulug.de/<br />
Hannover<br />
Linux-UsergroupHannover<br />
(LUGH)<br />
http://lug-hannover.de<br />
Hatten<br />
Linux-UsergroupOldenburg-<br />
Land(LUGOLand)<br />
http://www.lugoland.de<br />
Hattingen<br />
HattingerLinux-Usergroup<br />
(HatLug)<br />
http://www.hatlug.de<br />
Hegau<br />
Hegau<strong>LinuxUser</strong>Gruppe<br />
(HegauLUG)<br />
http://www.linuxag.hegau.org<br />
Heidenheim<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupHeidenheim<br />
http://www.lug-hdh.de<br />
Heilbad<br />
Heiligenstadt<br />
Linux-StammtischLinuxNode<br />
Eichsfeld<br />
http://linuxnode.eichsfeld.net<br />
Heilbronn<br />
Linux-UsergroupHeilbronn<br />
(LUUGHN)<br />
http://www.luug-hn.org<br />
LInux.usergrouPs<br />
ImFolgendendieListederunsbekanntenLinux-UsergroupsimdeutschsprachigenRauminKurzfassung.Änderungen<strong>und</strong>UpdatesbittederRedaktion(usergroups@linuxnewmedia.de)mitteilen(Name,Beschreibung,<br />
Treffpunkt,Adresse,Ansprechpartner,Homepage,E-Mail,Telefon,Fax,Mitgliederzahl...).
Usergroups<br />
servIce<br />
LInux.usergrouPs<br />
Herford<br />
Herrenberg<br />
Hesel<br />
Hildesheim<br />
Holzminden<br />
Horrheim<br />
Hoyerswerda<br />
Idstein(Taunus)<br />
Ingolstadt<br />
Iserlohn<br />
Itzehoe<br />
Jena<br />
Jever<br />
GNU/<strong>LinuxUser</strong>groupHerford<br />
(GLUGHF)<br />
http://lug-owl.de/LugWiki/<br />
GLUGHF<br />
Linux-StammtischimGäu<br />
(LiStiG)<br />
http://www.listig.org<br />
CCOstfriesland-Linux-Gruppe<br />
http://www.cco-online.de/linux<br />
HildesheimerLinux-Usergroup<br />
(NG)(HiLUG-NG)<br />
http://www.hilug-ng.de<br />
ComputerclubHochsollinge.V.<br />
http://www.cch-holzminden.de/<br />
Linux-UsergroupVaihingen/<br />
Enz(VLUG)<br />
http://www.vlug.de<br />
Linux-UsergroupHoyerswerda<br />
(HOYLUG)<br />
http://linux.griebel-web.eu/<br />
Linux-UsergroupTaunus(LUG-<br />
Taunus)<br />
http://www.lug-taunus.org<br />
Linux-UsergroupIngolstadte.V.<br />
http://www.lug-in.de<br />
Linux-UsergroupIserlohn<br />
http://area51.fh-swf.de/<br />
ComputerClubItzehoee.V.<br />
(CCIZ)<br />
http://www.cc-itzehoe.de<br />
Linux-UsergroupJena(LUG<br />
Jena)<br />
http://www.lug-jena.de<br />
FriesischeLinux-Usergroup<br />
(FriLUG)<br />
http://www.frilug.de<br />
Kaarst<br />
Kaiserslautern<br />
Kaiserslautern<br />
Karlsruhe<br />
Kassel<br />
Kiel<br />
Kierspe-<br />
Meinerzhagen<br />
Koblenz<br />
Koblenz<br />
Konstanz<br />
Konz<br />
Krefeld<br />
Kreuzlingen(CH)<br />
KaarsterLinux-Usergroup<br />
(KAALUG)<br />
http://www.kaalug.de<br />
Linux-UsergroupKaiserslautern<br />
(LUG-KL)<br />
http://www.lug-kl.de<br />
UniversitätKaiserslautern<br />
(UNIX-AG)<br />
http://www.unix-ag.uni-kl.<br />
de/~linux/<br />
KarlsruherLinux-Usergroup<br />
(KaLUG)<br />
http://www.karlsruhe.linux.de<br />
Linux-UsergroupKassel(LUGK)<br />
http://www.lug-kassel.de<br />
LUGKiel<br />
http://www.lug-kiel.de<br />
Linux-UsergroupMärkischer<br />
Kreis(LUGMK)<br />
linuxusergroupmk@netscape.net<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupMayen-<br />
Koblenz(LUG-MYK)<br />
http://www.lug-myk.de/<br />
LUGderUniversitätKoblenz<br />
http://www.colix.org<br />
Linux-UsergroupBodensee<br />
(LLUGB)<br />
http://llugb.amsee.de/<br />
Linux-UsergroupKonz(TRILUG)<br />
http://www.trilug.fh-trier.de<br />
Linux-UsergroupKrefeld<br />
(LUG-KR)<br />
http://www.lug-kr.de<br />
Linux-UsergroupKreuzlingen<br />
http://linuxtreff.ch/<br />
Kronach<br />
Köln<br />
Köln<br />
Landau<br />
Landshut<br />
Langen(Hessen)<br />
/Dreieich/<br />
Egelsbach<br />
Langenfeld<br />
Laufander<br />
Pegnitz<br />
Leipzig<br />
Lenningen<br />
Lindenberg<br />
Lingen/Rheine<br />
Linz(A)<br />
Lippstadt/Soest<br />
/Erwitte<br />
Linux-UsergroupKronach<br />
http://www.lug-kronach.de<br />
KölnerGentoo<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
(KGLUG)<br />
http://www.kglug.de<br />
Linux-WorkshopKöln(LiWoK)<br />
http://www.uni-koeln.de/<br />
themen/linux/<br />
Linux-UsergroupLandau(LUG-<br />
Landau)<br />
http://www.lug-ld.de<br />
Linux-UsergroupLandshut<br />
http://www.lalug.de<br />
LangenerLinux-Usergroup<br />
(LaLUG)<br />
http://www.lalug.net<br />
LangenfelderLinux-Usergroup<br />
(LANLUG)<br />
http://www.lanlug.org<br />
Linux-UsergroupLaufa.d.<br />
Pegnitz(LUGLAUF)<br />
http://www.lug-lauf.de<br />
LeipzigerLinux-Stammtisch<br />
http://www.gaos.org/lug-l/<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupLenningen<br />
http://linuxusergrouplenningen.<br />
de.vu<br />
Linux-UsergroupLindau(LugLi)<br />
http://www.allgaeu.org/lugli<br />
Linux-UsergroupSpelle<br />
http://www.spelle.net/lugs<br />
Linux-UsergroupLinz(LUGL)<br />
http://www.lugl.at<br />
<strong>LinuxUser</strong>groupErwitte<br />
http://www.lug-erwitte.de<br />
Lohr<br />
Loitsche<br />
Ludwigsburg<br />
Luxembourg<br />
Lübeck<br />
Lüneburg<br />
Lünen<br />
Lörrach<br />
Lörrach<br />
Magdeburg<br />
Mainz<br />
Marburg<br />
Marktredwitz<br />
Marl<br />
Linux-UsergroupLohr(LUGLohr)<br />
http://lug.lohr-am-main.de<br />
Linux-StammtischLoitsche(LSL)<br />
http://www.t-online.de/home/<br />
mumumu/<br />
Linux-UsergroupRaum<br />
Ludwigsburg(LuLUG)<br />
http://www.lulug.de<br />
LinuxLuxembourg(LiLux)<br />
http://www.linux.lu<br />
Linux-UsergroupLübeck<br />
http://www.linuxuser-luebeck.<br />
de<br />
Linux-UsergroupLüneburg<br />
(LueneLUG)<br />
http://luene-lug.org<br />
LUGLünen<br />
http://www.lug-luenen.de<br />
Linux-UsergroupLörrach<br />
(LUGLOE)<br />
http://www.lug-loerrach.de<br />
Lörracher<strong>LinuxUser</strong>group<br />
(LÖLUG)<br />
http://www.loelug.de<br />
Magdeburger<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
e.V.(MDLUG)<br />
http://www.mdlug.de<br />
Linux-UsergroupMainz(UFO)<br />
http://www.ufo.uni-mainz.de<br />
MarburgerLinux-Usergroup<br />
(MRLUG)<br />
http://www.mr-lug.de<br />
Linux-GruppeMarktredwitz<br />
ststroes@tirnet.de<br />
Linux-UsergroupMarl<br />
http://www.lug-marl.de<br />
s. 102<br />
MAGAZIN<br />
SondErAkTion<br />
Testen Sie jetzt<br />
3 Ausgaben<br />
für 3 Euro!<br />
nUr<br />
MiT dVd!<br />
Coupon senden an: Linux-Magazin Leser-Service A.B.O.<br />
Postfach 1165, 74001 Heilbronn<br />
JA,<br />
ich möchte die nächsten 3 Linux-Magazin-Ausgaben für nur E 3*, statt<br />
E 17,40*, testen. Wenn mich das Linux-Magazin überzeugt <strong>und</strong> ich 14 Tage<br />
nach Erhalt der dritten Ausgabe nicht schriftlich abbestelle, erhalte ich das Linux-Magazin jeden<br />
Monat zum Vorzugspreis von nur E 5,13* statt E 5,80* im Einzelverkauf, bei jährlicher Verrechnung.<br />
Ich gehe keine langfristige Verpflichtung ein. Möchte ich das Linux-Magazin nicht mehr beziehen,<br />
kann ich jederzeit schriftlich kündigen. Mit der Geld-zurück-Garantie für bereits bezahlte,<br />
aber nicht gelieferte Ausgaben.<br />
Name, Vorname<br />
Straße, Nr.<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Gleich bestellen, am besten mit dem Coupon<br />
oder per<br />
• Telefon: 07131 / 2707 274 • Fax 07131 / 2707 78 601<br />
• E-Mail: abo@linux-magazin.de<br />
Mit großem Gewinnspiel (Infos unter: www.linux-magazin.de/probeabo)<br />
*Preis gilt für Deutschland<br />
Mein Zahlungswunsch: Bequem per Bankeinzug Gegen Rechnung<br />
BLZ<br />
Konto-Nr.<br />
Bank<br />
Beliefern Sie mich bitte ab der Ausgabe Nr.<br />
LM1124M
servIce<br />
10 | 11<br />
102 www.linux-user.de<br />
Usergroups<br />
LInux.usergrouPs (ForTSETzuNG voN S. 101)<br />
Memmingen<br />
Linux-UsergroupAllgäu(LUGAL)<br />
http://www.lugal.de<br />
Meppen<br />
Linux-UsergroupMeppen<br />
http://www.lug-meppen.de<br />
Metelen<br />
Linux-StammtischMetelen<br />
http://www.linuxdu.de<br />
Mitterteich<br />
Linux-UsergroupMitterteich<br />
http://www.linux-mitterteich.de<br />
Moers<br />
Linux-UsertreffeninMoers<br />
opers@syrinx1.du.gtn.com<br />
Mosbach<br />
Linux-UsergroupMosbach<br />
(LUGMOS)<br />
http://linuxwiki.de/LugMosbach<br />
Mühlheima.d.<br />
Ruhr<br />
Penguinshour-Workshops<strong>und</strong><br />
Selbsthilfegruppe(Penhour)<br />
http://www.az-muelheim.de/<br />
penhour/<br />
München<br />
BSDSocialEventMünchen(BSE)<br />
http://bse.42.org<br />
München<br />
BSD-UsergroupinMünchen<br />
(BIM)<br />
http://berklix.org/bim/<br />
München<br />
MünchnerGentoo<strong>LinuxUser</strong><br />
Group(MGLUG)<br />
http://www.mglug.de<br />
München<br />
MünchnerLinux-Usergroup<br />
(MUC-LUG)<br />
http://www.muc-lug.de<br />
MünchenSüd-Ost<br />
/Ottobrunn<br />
Linux-UsergroupOttobrunn<br />
(LUGOTT)<br />
http://www.lug-ottobrunn.de<br />
MünchenSüd-<br />
West<br />
Linux-UsergroupWürmtal<br />
(WLUG)<br />
http://wlug.acos.net<br />
Münster<br />
Linux-StammtischMünster<br />
(MueSLI)<br />
http://www.mueslihq.de<br />
Mönchengladbach<br />
Linux-Usergroup<br />
Mönchengladbach(LUGMOE)<br />
http://www.lugmoe.de<br />
Mörfelden-<br />
Walldorf<br />
<strong>LinuxUser</strong>groupMörfelden-<br />
Walldorf(MöWa-LUG)<br />
http://www.moewa-lug.de<br />
Naumburg<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupNaumburg<br />
(LUGNMB)<br />
http://lugnmb.dyndns.org<br />
Neubrandenburg<br />
Linux-Usergroup<br />
Neubrandenburge.V.(LUG-NB)<br />
http://www.lug-nb.de<br />
Neuburgander<br />
Donau<br />
LUGNeuburganderDonau<br />
(LUGND)<br />
http://www.lug-nd.de<br />
Neuenburg<br />
Linux-UsergroupNeuenburg<br />
http://w3-net.ri-web.de/cont/<br />
lugnbg/index.php<br />
Nieder-Olm<br />
RheinhessenerLinux-<br />
Gemeinschaft<br />
info@kkcs.de<br />
Niederrhein<br />
NiederrheinischeLinuxUnix<br />
UserGroup(NLUUG)<br />
http://www.nluug.de<br />
Nienburg<br />
Linux-UsergroupNienburg<br />
(NILUG)<br />
http://ni-linux.de<br />
Norderstedt<br />
Linux-UsergroupNorderstedt<br />
(LUGN)<br />
http://www.lug-norderstedt.de<br />
Nordheide<br />
LUUGNordheide<br />
http://www.luug-nordheide.de<br />
Nußdorf/Aiging<br />
Linux-UsergroupTraunstein<br />
(LUGTra)<br />
http://www.lug-ts.de<br />
Nürnberg<br />
Linux-UsergroupNürnberg<br />
(LUGNü)<br />
http://www.align.de/<br />
Oberhausen<br />
Linux-UsergroupOberhausen<br />
(LUGOR)<br />
http://www.linuxob.de<br />
Oberkirchen<br />
LUGRenchtal-Tuxe<br />
http://tuxe.renchtal.com<br />
Oberpfalz<br />
Linux-UsergroupOberpfalz<br />
http://www.cham.baynet.<br />
de/lugo/<br />
Oberwallis(CH)<br />
Linux-UsergroupOberwallis<br />
(LUGO)<br />
http://www.lugo.ch<br />
Offenburg<br />
Linux-UsergroupOffenburg<br />
(LUGOG)<br />
http://www.lugog.de<br />
Oldenburg<br />
Linux-UsergroupOldenburg<br />
(LUGO)<br />
http://oldenburg.linux.de<br />
Olpe<br />
Linux-UsergroupOlpe<br />
http://www.lug-raum-olpe.<br />
de.vu<br />
Osnabrück<br />
Linux-UsergroupOsnabrück<br />
http://www.lugo.de<br />
Ostwestfalen-<br />
Lippe<br />
Linux-UsergroupOstwestfalen-<br />
Lippe(LUG-OWL)<br />
http://www.lug-owl.de<br />
Paderborn<br />
Linux-UsergroupOstwestfalen-<br />
Lippe(LUG-OWL)<br />
http://lug-owl.de/Lokales/<br />
Paderborn/<br />
Passau<br />
Linux-/Unix-UsergroupPassau<br />
(LUGP)<br />
http://www.fmi.uni-passau.<br />
de/~lug/<br />
Peine<br />
Linux-UsergroupPeine(LUGP)<br />
http://www.lug-peine.org<br />
Pfaffenhofen<br />
(Ilm)<br />
Hallertuxe.V.<br />
http://www.hallertux.de<br />
Pforzheim<br />
Linux-UsergroupPforzheim<br />
(LUGP)<br />
http://www.pf-lug.de<br />
Pirmasens<br />
Linux-StammtischPirmasens<br />
http://www.ic.pirmasens.de<br />
Potsdam<br />
PotsdamerLinux-Usergroup<br />
(UPLUG)<br />
http://www.uplug.de<br />
Preetz<br />
(Schleswig-<br />
Holstein)<br />
<strong>LinuxUser</strong>groupPreetz<br />
(PreetzLUG)<br />
http://preetzlug.de<br />
Prerow<br />
Linux-UsergroupPrerow<br />
c.dittmann@magrathea.de<br />
Quedlinburg<br />
Linux-UsergroupQuedlinburg<br />
(LUGQLB)<br />
http://www.lug-qlb.de<br />
Quickborn<br />
QuickbornerLinux-Usergroup<br />
(QLUG)<br />
http://www.qlug.net<br />
Rathenow<br />
Linux-StammtischRathenow<br />
http://linux.php4u.org<br />
Ravensberg<br />
Linux-UsergroupRavensberg<br />
(LUGRAV)<br />
http://www.lugrav.de<br />
Ravensburg<br />
Informatik-<strong>und</strong>Netzwerkverein<br />
Ravensburge.V(LUGRA)<br />
http://www.infnet.verein.de/<br />
linux/<br />
Ravensburg<br />
Linux-UsergroupRavensburg<br />
(LUG)<br />
http://www.yalug.de<br />
Regensburg<br />
Linux-UsergroupRegensburg<br />
http://www.lugr.de<br />
Regensburg<br />
RegensburgerLinux-Usergroup<br />
(R-LUG)<br />
http://www.regensburg.franken.<br />
de/rlug/<br />
Reutlingen<br />
Linux-UsergroupReutlingen<br />
http://www.lug-reutlingen.de<br />
Rheda-<br />
Wiedenbrück<br />
Linux-UsergroupRheda-<br />
Wiedenbrück(LUG-RHWD)<br />
http://www.lug-rhwd.de<br />
Rhein-Neckar<br />
UnixUsergroupRhein-Neckar<br />
e.V.(UUGRN)<br />
http://www.uugrn.org<br />
Rosenheim<br />
Linux-UsergroupRosenheim<br />
http://www.lug-rosenheim.org<br />
Rostock<br />
RostockerLinux-Usergroup<br />
http://linux.baltic.net<br />
Rotenburg<br />
ComputervereinRotenburg<br />
(CVR)<br />
http://www.cvr.de/linux<br />
Rotenburga.d.<br />
Fulda<br />
init4-DieLinux-Enthusiasten<br />
(init4)<br />
http://www.init4.de<br />
Rothenburgo.d.<br />
Tauber<br />
Linux-UsergroupRothenburg<br />
(LUGROT)<br />
http://lugrot.de<br />
Römerberg/<br />
Speyer<br />
LUGRömerberg/Speyer<br />
http://linuxwiki.de/<br />
LugRoemerbergSpeyer<br />
Saalfeld<br />
LUGSlf/Ru<br />
http://lug-slf.de<br />
Saarland<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupSaare.V.<br />
(LUGSaar)<br />
http://www.lug-saar.de<br />
Salem<br />
Linux-UsergroupSalem<br />
http://www.lug-salem.de<br />
Salzburg(A)<br />
Linux-UsergroupSalzburg<br />
http://www.salzburg.luga.or.at<br />
Sauerland<br />
Linux-UsergroupSauerland<br />
http://www.lug-sauerland.de<br />
Schaumburg<br />
Linux-UsergroupSchaumburg<br />
http://www.lug-schaumburg.de<br />
Schwabach<br />
<strong>LinuxUser</strong>Schwabache.V.<br />
(LUSC)<br />
http://www.lusc.de<br />
Schweinfurt<br />
Linux-UsergroupSchweinfurt<br />
http://www.lug-sw.de<br />
Schweiz(CH)<br />
Linux-UsergroupSwitzerland<br />
http://www.lugs.ch<br />
Schwerin<br />
West-MecklenburgerLinux-<br />
Usergroup(WEMELUG)<br />
http://www.wemelug.de<br />
Schwäbisch<br />
Gmünd<br />
Linux-StammtischSchwäbisch<br />
Gmünd(LSSG)<br />
http://www.uliweb.de/lssg<br />
Seeheim-<br />
Jugenheim<br />
Linux-UsergroupDarmstadt<br />
http://www.mathematik.tudarmstadt.de/dalug/<br />
Senftenberg<br />
Linux-UsergroupSenftenberg<br />
(LUGSE)<br />
http://www.lugse.de<br />
Siegen<br />
UNIX-AGSiegen(Uni-GHSie)<br />
http://www.si.unix-ag.org<br />
Sindelfingen/<br />
Böblingen<br />
Böblingen-ClubLinux-User-<br />
Gruppe(SinLUG)<br />
http://www.mefia.org<br />
Sinsheim<br />
Linux-UsergroupSinsheim<br />
(SiLUG)<br />
http://www.linuxwiki.de/<br />
LugSinsheim<br />
Speyer<br />
Linux-UsergroupKetsch<br />
http://www.lug-ketsch.de<br />
St.Pölten(A)<br />
Linux-UsergroupSt.Pölten<br />
(LUGSP)<br />
http://www.lugsp.at<br />
Stormarn<br />
Linux-UsergroupStormarn<br />
http://www.lug-stormarn.de<br />
Stuttgart<br />
Linux-UsergroupStuttgart<br />
(LUGS)<br />
http://www.lug-s.org/<br />
Taubertal<br />
TaubertälerLinux-Usergroup<br />
(TaLUG)<br />
http://www.talug.de/<br />
Thüringen<br />
ThüringerLinux-Usergroup<br />
(TLUG)<br />
http://www.tlug.de/<br />
Tirol(A)<br />
Tiroler<strong>LinuxUser</strong>group(LUGT)<br />
http://www.lugt.at<br />
Traunstein<br />
Linux-UsergroupTraunstein<br />
(LUGTS)<br />
http://www.lug-ts.de<br />
Trier<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupTrier(LUG<br />
Trier)<br />
http://www.lug-trier.de<br />
Troisdorf/<br />
Siegburg/Spich<br />
TroisdorferLinux-Usergroup<br />
(TroLUG)<br />
http://www.trolug.de<br />
Tuttlingen<br />
Linux-UsergroupTuttlingen<br />
http://lug.intuttlingen.de/<br />
Tübingen<br />
Linux-UsergroupTübingen<br />
(LUGT)<br />
http://tuebingen.linux.de<br />
Ulm<br />
Linux-UsergroupUlm(LUGU)<br />
http://lugulm.de<br />
Untermain<br />
Linux-UsergroupUntermain<br />
(LUGU)<br />
http://www.lug-untermain.de<br />
Viersen<br />
Linux-UsergroupViersen(LUGV)<br />
http://www.lug-viersen.de<br />
Villingen-<br />
Schwenningen<br />
<strong>LinuxUser</strong>GroupVillingen-<br />
Schwenningene.V.(LUG-VSe.V.)<br />
http://www.lug-vs.de<br />
Voralpen(A)<br />
Linux-UsergroupVoralpen<br />
(VALUG)<br />
http://www.valug.at<br />
Vorarlberg(A)<br />
Linux-UsergroupVorarlberg<br />
(LUGV)<br />
http://www.lugv.at<br />
Waiblingen<br />
ComputerclubWaiblingene.V.<br />
http://www.ccwn.org<br />
Waldkraiburg<br />
Linux-UsergroupWaldkraiburg<br />
http://www.lug-waldkraiburg.org<br />
Walsrode<br />
Linux-UsergroupWalsrode<br />
http://www.lug-walsrode.de/<br />
Wedel<br />
Linux-UsergroupWedel(LUG<br />
Wedel)<br />
http://www.lug-wedel.de<br />
Weinheim<br />
Computer-ClubWeinheime.V.<br />
(CCW)<br />
http://ccw.iscool.net<br />
Weißenbrunn<br />
Linux-UsergroupKronach<br />
(LUGKR)<br />
http://www.kronachonline.de<br />
Wernigerode<br />
Linux-UsergroupWernigerode<br />
(LUGWR)<br />
http://www.lug-wr.de<br />
Westerwald<br />
Linux-UsergroupWesterwald<br />
http://www.lug-westerwald.de<br />
Wien(A)<br />
<strong>LinuxUser</strong>groupWien<br />
http://www.viennalinux.at<br />
Wien(A)<br />
Linux-UsergroupAustria(LUGA)<br />
http://www.luga.or.at<br />
Wien(A)<br />
Linux-UsergroupTUWien(LLL)<br />
lll@radawana.cg.tuwien.ac.at<br />
Wiesbaden<br />
Linux-UsergroupWiesbaden<br />
PenguinUsergroup<br />
http://www.pug.org<br />
Wilhelmshaven<br />
Linux-UsergroupWilhelmshaven<br />
(LUG-WHV)<br />
http://www.lug-whv.de<br />
Witten<br />
WittenerLinux-Usergroup<br />
(WitLUG)<br />
http://www.witlug.de<br />
Wolfsburg<br />
WolfsburgerLinux-Usergroup<br />
(WOBLUG)<br />
http://www.lug.wolfsburg.de<br />
Wolfsburg<br />
WolfsburgerUnix-Usergroup<br />
(WUUG)<br />
http://www.unix.necoac.de<br />
Worms<br />
Wormser<strong>LinuxUser</strong>Group<br />
(WoLUG)<br />
http://www.wolug.de<br />
Wuppertal<br />
WuppertalerLinux-Usergroup<br />
(WupLUG)<br />
http://www.wuplug.org<br />
Würmtal<br />
WürmtalerLinux-Usergroup<br />
(WLUG)<br />
http://www.wlug.de<br />
Würzburg<br />
Linux-UsergroupWürzburg<br />
(LUGWUE)<br />
http://www.lugwue.de<br />
Würzburg<br />
Linux-UsergroupWürzburg<br />
(WÜLUG)<br />
http://www.wuelug.de<br />
Zweibrücken<br />
Linux-UsergroupZweibrücken<br />
http://www.lug-zw.de<br />
Zwickau<br />
Linux-UsergroupZwickau(ZLUG)<br />
http://www.zlug.org
Seminare<br />
servIce<br />
batt für<br />
enten<br />
Linux-Magazin<br />
ACADEMY<br />
Online-Training<br />
Erfolgreicher Einstieg in<br />
WordPress 3<br />
mit Hans-Georg Esser, Chefredakteur EasyLinux<br />
Ansprechende Webseiten, Blogs <strong>und</strong><br />
Shops einfach selber erstellen<br />
❚ Installation in 5 Minuten<br />
❚ Designs ändern<br />
❚ Optimieren für Suchmaschinen<br />
❚ Funktionen erweitern<br />
❚ Benutzerrechte festlegen<br />
❚ Geld verdienen mit Werbung<br />
❚ Besucher analysieren<br />
❚ Sicherheit <strong>und</strong> Spam-Schutz<br />
20%<br />
Treue-Rabatt für<br />
Abonnenten<br />
Linux-Magazin<br />
ACADEMY<br />
Online-Training<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
für LPIC 1 & 2<br />
Besorgen Sie sich Brief <strong>und</strong><br />
Siegel für Ihr Linux-<br />
Knowhow mit der<br />
LPI-Zertifizierung.<br />
- Training für die Prüfungen<br />
LPI 101 <strong>und</strong> 102<br />
- Training für die Prüfungen<br />
LPI 201 <strong>und</strong> 202<br />
Sparen Sie mit<br />
paketpreiSen!<br />
20%<br />
Treue-Rabatt für<br />
Abonnenten<br />
OpenSource Training Ralf Spenneberg<br />
Schulungen direkt vom Autor<br />
Wege aus der Lizenzfalle mit Samba 4<br />
3 Tage 04.10. 06.10.2011<br />
Spam Lösungen<br />
3 Tage 04.10. 06.10.2011<br />
OpenVPN Die IPsec Alternative<br />
3 Tage 04.10. 06.10.2011<br />
Linux Storage Lösungen<br />
2 Tage 10.10. 11.10.2011<br />
High Availability and Load Balancing mit Linux<br />
2 Tage 12.10. 13.10.2011<br />
Sourcefire 3D System<br />
4 Tage 18.10. 21.10.2011<br />
Apache 2.x Webserver Administration<br />
4 Tage 17.10. 20.10.2011<br />
Modsecurity<br />
3 Tage 17.10. 19.10.2011<br />
SELinux Administration<br />
2 Tage 24.10. 25.10.2011<br />
Freie Distributionswahl:<br />
Opensuse, Fedora, Debian Squeeze,<br />
CentOS oder Ubuntu LTS<br />
Ergonomische Arbeitsplätze<br />
Umfangreiche Schulungsunterlagen mit<br />
Übungen<br />
Informationen <strong>und</strong> Anmeldung unter:<br />
academy.linux-magazin.de/wordpress<br />
Informationen <strong>und</strong> Anmeldung unter:<br />
academy.linux-magazin.de/lpic<br />
Am Bahnhof 35<br />
48565 Steinfurt<br />
Tel.: 02552 638755<br />
Fax: 02552 638757<br />
Weitere Informationen unter www.ost.de<br />
DiD you<br />
know?<br />
1-9h_Anzeige_wordpress_v02.indd 1<br />
Linux-Magazin<br />
ACADEMY<br />
18.04.2011 LM-Academy_1-9h_Anzeige_LPIC-Mike.indd 11:18:15 Uhr<br />
1<br />
18.04.2011 11:05:38 Uhr<br />
Online-Training<br />
Monitoring mit Nagios<br />
mit Michael Streb von Netways<br />
Netzwerk überwachen<br />
leicht gemacht (Auszug):<br />
20%<br />
❚ das Webfrontend<br />
❚ Überwachung von<br />
Windows/Linux/Unix<br />
❚ Strukturieren der Konfiguration<br />
❚ Überwachen von<br />
SNMP-Komponenten<br />
❚ Addons Nagvis,<br />
Grapher V2, NDO2DB Mit vielen<br />
Treue-Rabatt für<br />
Abonnenten<br />
Praxisbeispielen<br />
Informationen <strong>und</strong> Anmeldung unter:<br />
academy.linux-magazin.de/nagios<br />
UNIX-C-C++ Java<br />
Seminare<br />
in Nürnberg<br />
(oder inhouse)<br />
UNIX/Linux<br />
UNIX/Linux-Aufbau<br />
C, C-Aufbau<br />
C++<br />
OOA/OOD (mit UML)<br />
Java<br />
Perl, XML<br />
weitere Kurse auf Anfrage, Telephonhotline<br />
Dipl.-Ing.<br />
Christoph Stockmayer GmbH<br />
90571 Schwaig/Nbg • Dreihöhenstraße 1<br />
Tel.: 0911/505241 • Fax 0911/5009584<br />
EMail: sto@stockmayer.de<br />
http://www.stockmayer.de<br />
WusstEn siE’s?<br />
Linux-Magazin <strong>und</strong> <strong>LinuxUser</strong> haben<br />
ein englisches Schwester magazin!<br />
Am besten, Sie informieren gleich<br />
Ihre Linux-Fre<strong>und</strong>e in aller Welt...<br />
Linux-Magazin<br />
LM_Anzeige_1-9h_Anzeige_Nagios-Mike.indd 1<br />
©mipan, fotolia<br />
ACADEMY<br />
20%<br />
Treue-Rabatt für<br />
Abonnenten<br />
Online-Training<br />
IT-Sicherheit<br />
Gr<strong>und</strong>lagen<br />
mit Tobias Eggendorfer<br />
14.04.2011 11:58:43 Uhr<br />
Themen:<br />
- physikalische Sicherheit<br />
- logische Sicherheit<br />
• Betriebssystem<br />
• Netzwerk<br />
- Sicherheitskonzepte<br />
- Sicherheitsprüfung<br />
Inklusive Benutzer- <strong>und</strong><br />
Rechteverwaltung, Authentifizierung,<br />
ACLs sowie wichtige<br />
Netzwerkprotokolle <strong>und</strong> mehr!<br />
Linux-Magazin<br />
ACADEMY<br />
Online-Training<br />
mit Hans-Georg Esser, Chefredakteur EasyLinux<br />
OpenOffice -<br />
Arbeiten mit Vorlagen<br />
Erleichtern Sie sich Ihre<br />
tägliche Arbeit mit (Auszug):<br />
❚ einheitlichen Dokumentenvorlagen<br />
❚ automatischen Formatierungen<br />
❚ generierten Inhaltsverzeichnissen<br />
20%<br />
Treue-Rabatt für<br />
Abonnenten<br />
Mit vielen<br />
Praxisbeispielen<br />
www.linux-magazine.com<br />
Informationen <strong>und</strong> Anmeldung unter:<br />
academy.linux-magazin.de/sicherheit<br />
Informationen <strong>und</strong> Anmeldung unter:<br />
academy.linux-magazin.de/openoffice<br />
LMI_german_2-9h_black_2308-2011.indd 1<br />
LM-Academy_1-9h_Security-Mike.indd 1<br />
26.08.2011 14:40:14 Uhr www.linux-user.de<br />
12.04.2011<br />
LM_Academy_1-9h_Anzeige_openoffice-Mike.indd<br />
14:00:35 Uhr<br />
1<br />
12.04.2011 15:08:54 Uhr<br />
10 | 11 103
servIce<br />
Veranstaltungen / Autoren / Inserenten<br />
verAnsTALTungen<br />
23.-24.09.2011<br />
master software Libre: Jornadas Abiertas (3)<br />
Vigo, Spanien<br />
http://www.mastersoftwarelibre.com/2011/08/05/<br />
jornadas-abiertas-de-septiembre-2011/<br />
23.-24.09.2011<br />
open source hardware conference 2011<br />
Madrid, Spanien<br />
http://oshwcon.org/es<br />
29.09.2011<br />
expo Tecnología Bolivar 2011<br />
Puerto Ordaz, Venezuela<br />
http://www.facebook.com/event.php?eid=259469494072<br />
327&ref=notif¬if_t=event_invite<br />
04.-09.10.2011<br />
Pycon De 2011<br />
Leipziger KUBUS<br />
Permoserstraße 15<br />
04318 Leipzig<br />
http://de.pycon.org<br />
06.-07.10.2011<br />
Droidcon London 2011<br />
London, Großbritannien<br />
http://uk.droidcon.com/<br />
12.-15.10.2011<br />
Libreoffice conference 2011<br />
Paris, Frankreich<br />
http://conference.libreoffice.org/<br />
14.-16.10.2011<br />
ubucon 2011<br />
Leipzig<br />
http://ubucon.de<br />
17.10.2011<br />
eclipse embedded Day spanien 2011<br />
Zamudio, Spanien<br />
http://www.tecnalia.com/en/divisions/ict-europeansoftware-institute/software-systems-engineering/ev<br />
20.-21.10.2011<br />
6th International Workshop on Plan 9<br />
Madrid, Spanien<br />
http://iwp9.org/<br />
21.-27.10.2011<br />
hacker halted usA 2011<br />
Miami, FL, USA<br />
http://www.hackerhalted.com/2011<br />
23.-25.10.2011<br />
Linux kernel summit 2011<br />
Prag, Tschechien<br />
http://events.linuxfo<strong>und</strong>ation.org/events/linux-kernelsummit<br />
26.-28.10.2011<br />
Linuxcon europe<br />
Prag, Tschechien<br />
http://events.linuxfo<strong>und</strong>ation.org/events/<br />
05.11.2011<br />
Brandenburger Linux-Infotag 2011<br />
Institut für Informatik der Uni Potsdam<br />
Campus Griebnitzsee, Haus 6<br />
Prof.-Dr.-Helmert-Straße<br />
14482 Potsdam<br />
http://blit.org<br />
07.-11.11.2011<br />
Apachecon nA 2011<br />
Vancouver, BC, Canada<br />
http://na11.apachecon.com/<br />
09.-10.11.2011<br />
Libre software World conference 2011<br />
Zaragoza, Spanien<br />
http://www.asolif.es/?page=fechas_lswc_2011<br />
11.-13.11.2011<br />
Fscons 2011<br />
Göteborg, Schweden<br />
http://fscons.org/<br />
12.-13.11.2011<br />
openrheinruhr 2011<br />
RIM Oberhausen<br />
Hansastraße 20<br />
46049 Oberhausen<br />
http://www.openrheinruhr.de<br />
12.-18.11.2011<br />
sc11: supercomputing 2011<br />
Seattle, WA, USA<br />
http://sc11.supercomputing.org/<br />
16.-18.11.2011<br />
open source Developers conference 2011<br />
Canberra, Australien<br />
http://osdc.com.au<br />
26.11.2011<br />
Linuxday vorarlberg 2011<br />
Dornbirn, Österreich<br />
http://www.linuxday.at<br />
04.-09.12.2011<br />
LIsA ’11<br />
Boston, MA, USA<br />
http://www.usenix.org/events/<br />
AuToren<br />
Falko Benthin Sammlungen verwalten mit GCStar (60)<br />
Andreas Bohle Neues auf den Heft-DVDs (10),<br />
<strong>Vorschau</strong> <strong>LinuxUser</strong> 11/2011 (106)<br />
Joe „Zonker“ Brockmeier CLI-Tools zur Fehlersuche im Netzwerk (38),<br />
Benutzer <strong>und</strong> Gruppen verwalten am Prompt (46)<br />
Florian Effenberger So<strong>und</strong>editor Audacity für Newbies <strong>und</strong> Profis (56)<br />
Æleen Frisch Einführung in die Bash-Programmierung (20)<br />
Karsten Günther Fotos effektiv verwalten mit Digikam (72)<br />
Frank Hofmann Einstieg in den Standard-Editor Vim (32),<br />
Fotos verarbeiten mit Perl <strong>und</strong> Python (90)<br />
Kristian Kißling Komfortable Datensicherung mit Sbackup (82)<br />
Thomas Leichtenstern Neues r<strong>und</strong> um Linux – IFA-News (14),<br />
Flashcard-basiertes Lernen mit Anki (64),<br />
NAS Synology DS110j <strong>und</strong> Strato HiDrive (76),<br />
Dual-SIM-Handy Pearl Simvalley SP-60 GPS (86)<br />
Jörg Luther Editorial (3), Neues r<strong>und</strong> um Linux (14),<br />
Komfortable Datensicherung mit Sbackup (82)<br />
James Mohr CLI-Tools zur Fehlersuche im Netzwerk (38)<br />
Dr. Udo Seidel Report: Linux im Amadeus-Rechenzentrum (6)<br />
Matt Simmons Benutzer <strong>und</strong> Gruppen verwalten am Prompt (46)<br />
Vincze-Aron Szabo Animierte Dia-Schauen mit Imagination (68)<br />
Uwe Vollbracht Aktuelle Software im Kurztest (12)<br />
Nathan Willis Dateisysteme pflegen auf der Kommandozeile (42)<br />
InserenTen<br />
1&1 Internet AG www.eins<strong>und</strong>eins.de 9<br />
Android User GY www.androiduser.de 41, 49<br />
Bibliograph. Institut AG www.bifab.de 29<br />
Bodenseo www.bodenseo.de 35<br />
Cso<strong>und</strong>-Konferenz www.cs-conf.de 105<br />
EasyLinux www.easylinux.de 67<br />
Fernschule Weber GmbH www.fernschule-weber.de 13<br />
Galileo Press www.galileo-press.de 53<br />
Hetzner Online AG www.hetzner.de 108<br />
Linux Magazine www.linux-magazine.com 103<br />
Linux-Community www.linux-community.de 53<br />
Linux-Hotel www.linuxhotel.de 19<br />
Linux-Magazin www.linux-magazin.de 101<br />
Linux-Magazin Academy www.academy.linux-magazin.de 103<br />
<strong>LinuxUser</strong> www.linuxuser.de 11<br />
Netclusive GmbH www.netclusive.de 15<br />
OpenRheinRuhr www.openrheinruhr.de 71<br />
OVH GmbH www.ovh.de/ 30<br />
PlusServer AG www.plusserver.de 36, 54, 80, 96<br />
Spenneberg Training www.spenneberg.com 103<br />
Stockmayer GmbH www.stockmayer.de 103<br />
Strato AG www.strato.de 2, 23, 25<br />
Ubuntu User www.ubuntu-user.de 89<br />
Verion GmbH www.verion.de 107<br />
ZEDOnet GmbH www.turboprint.de 17<br />
104 10 | 11<br />
www.linux-user.de
Impressum<br />
service<br />
Anschrift<br />
Homepage<br />
Artikel <strong>und</strong> Foren<br />
Abo/Nachbestellung<br />
E-Mail (Leserbriefe)<br />
Abo-Service<br />
Pressemitteilungen<br />
<strong>LinuxUser</strong> ist eine Monatspublikation der Linux New Media AG.<br />
Putzbrunner Str. 71, 81739 München<br />
Telefon: (089) 99 34 11-0, Fax: (089) 99 34 11-99<br />
http://www.linux-user.de<br />
http://www.linux-community.de<br />
http://www.linux-user.de/bestellen/<br />
<br />
<br />
<br />
Chefredakteur Jörg Luther (v. i. S. d. P.) (jlu)<br />
Stellv. Chefredakteur Andreas Bohle (agr)<br />
Redaktion<br />
Linux-Community<br />
Datenträger<br />
Ständige Mitarbeiter<br />
Grafik<br />
Sprachlektorat<br />
Produktion<br />
Druck<br />
Geschäftsleitung<br />
Mediaberatung<br />
D / A / CH<br />
UK / Ireland<br />
USA<br />
Marcel Hilzinger (mhi)<br />
Thomas Leichtenstern (tle)<br />
Marcel Hilzinger (mhi)<br />
Thomas Leichtenstern (tle)<br />
Mirko Albrecht, Erik Bärwaldt, Falko Benthin, Florian Effenberger,<br />
Karsten Günther, Frank Hofmann, Christoph Langer, Tim Schürmann,<br />
Martin Steigerwald, Vince-Áron Szabó, Uwe Vollbracht<br />
Elgin Grabe (Titel <strong>und</strong> Layout)<br />
Bildnachweis: Stock.xchng, 123rf.com, Fotolia.de <strong>und</strong> andere<br />
Astrid Hillmer-Bruer, Elke Knitter<br />
Christian Ullrich <br />
Vogel Druck <strong>und</strong> Medienservice GmbH & Co. KG, 97204 Höchberg<br />
Brian Osborn (Vorstand) <br />
Hermann Plank (Vorstand) <br />
Petra Jaser <br />
Tel.: +49 (0)89 / 99 34 11 24<br />
Fax: +49 (0)89 / 99 34 11 99<br />
Penny Wilby <br />
Tel.: +44 (0)1787 211 100<br />
National Sales Director<br />
Ann Jesse <br />
Tel.: +1 785 841 88 34<br />
National Account Manager<br />
Eric Henry <br />
Tel.: +1 785 917 09 90<br />
Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 01.01.2011.<br />
Pressevertrieb<br />
Abonnentenservice<br />
D / A / CH<br />
MZV Moderner Zeitschriften Vertrieb GmbH & Co. KG<br />
Ohmstraße 1, 85716 Unterschleißheim<br />
Tel.: (089) 3 19 06-0, Fax: (089) 3 19 06-113<br />
Lea-Maria Schmitt <br />
Postfach 1165, 74001 Heilbronn<br />
Telefon: +49 (0)7131 27 07-274<br />
Telefax: +49 (0)7131 27 07 -78-601<br />
impressum<br />
Abo-Preise Deutschland Österreich Schweiz Ausland EU<br />
No-Media-Ausgabe € 5,50 € 6,30 Sfr 11,00 (siehe Titel)<br />
DVD-Ausgabe € 8,50 € 9,35 Sfr 17,00 (siehe Titel)<br />
Jahres-DVD (Einzelpreis) € 14,95 € 14,95 Sfr 18,90 € 14,95<br />
Jahres-DVD (zum Abo 1 ) € 6,70 € 6,70 Sfr 8,50 € 6,70<br />
Mini-Abo (3 Ausgaben) € 3,00 € 3,00 Sfr 4,50 € 3,00<br />
Jahresabo No Media € 56,10 € 64,60 Sfr 92,40 € 71,60<br />
Jahresabo DVD € 86,70 € 95,00 Sfr 142,80 € 99,00<br />
Preise Digital Deutschland Österreich Schweiz Ausland EU<br />
Heft-PDF Einzelausgabe € 5,50 € 5,50 Sfr 7,15 € 5,50<br />
DigiSub (12 Ausgaben) € 56,10 € 56,10 Sfr 72,90 € 56,10<br />
DigiSub (zum Abo 1 ) € 12,00 € 12,00 Sfr 12,00 € 12,00<br />
HTML-Archiv (zum Abo 1 ) € 12,00 € 12,00 Sfr 12,00 € 12,00<br />
Preise Kombi-Abos Deutschland Österreich Schweiz Ausland EU<br />
Mega-Kombi-Abo 2 € 143,40 € 163,90 Sfr 199,90 € 173,90<br />
(1) nur erhältlich in Verbindung mit einem Jahresabo Print oder Digital<br />
(2) mit <strong>LinuxUser</strong>-Abo (DVD) <strong>und</strong> beiden Jahres-DVDs, inkl. DELUG-Mitgliedschaft<br />
(monatl. DELUG-DVD)<br />
Schüler- <strong>und</strong> Studentenermäßigung: 20 Prozent gegen Vorlage eines Schülerausweises<br />
oder einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung. Der aktuelle Nachweis ist bei Verlängerung<br />
neu zu erbringen. Informationen zu anderen Abo-Formen, Ermäßigungen im Ausland<br />
etc. unter http://shop.linuxnewmedia.de.<br />
Adressänderungen bitte umgehend mitteilen, da Nachsendeaufträge bei der Post nicht<br />
für Zeitschriften gelten.<br />
Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds <strong>und</strong> wird von uns mit seiner<br />
fre<strong>und</strong>lichen Genehmigung verwendet. »Unix« wird als Sammelbegriff für die Gruppe der<br />
Unix-ähnlichen Betriebssysteme (wie beispielsweise HP/UX, FreeBSD, Solaris) verwendet,<br />
nicht als Bezeichnung für das Trademark (»UNIX«) der Open Group. Der Linux-Pinguin<br />
wurde von Larry Ewing mit dem Grafikprogramm »The GIMP« erstellt.<br />
Eine Haftung für die Richtigkeit von Veröffentlichungen kann – trotz sorgfältiger Prüfung<br />
durch die Redaktion – vom Verlag nicht übernommen werden. Mit der Einsendung von<br />
Manuskripten oder Leserbriefen gibt der Verfasser seine Einwilligung zur Veröffent lich ung<br />
in einer Publikation der Linux New Media AG. Für unverlangt eingesandte Manuskripte<br />
oder Beiträge übernehmen Redaktion <strong>und</strong> Verlag keinerlei Haftung.<br />
Autoreninfos: http://www.linux-user.de/Autorenhinweise. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Einsendungen zu kürzen <strong>und</strong> zu überarbeiten. Das exklusive Urheber- <strong>und</strong> Verwertungsrecht<br />
für angenommene Manus kripte liegt beim Verlag. Es darf kein Teil des Inhalts <strong>ohne</strong> schriftliche<br />
Genehmigung des Verlags in irgendeiner Form vervielfältigt oder verbreitet werden.<br />
Copyright © 1999 - 2011 Linux New Media AG ISSN: 1615-4444<br />
Victor Lazzarini<br />
Ian McCurdy<br />
Michael Gogins<br />
Internationale Cso<strong>und</strong>-Konferenz<br />
30. September – 2. Oktober 2011<br />
Hochschule für Musik, Theater <strong>und</strong> Medien Hannover<br />
Emmichplatz 1<br />
Eintritt frei<br />
John ffitch<br />
Richard Boulanger<br />
Andrés Cabrera<br />
<strong>und</strong> viele andere…<br />
Steven Yi<br />
www.linux-user.de 10 | 11<br />
105
VORSCHAU<br />
Das nächste Heft: 11/2011<br />
Ausgabe 11/2011 erscheint am 20. Oktober 2011<br />
© Linusb4, sxc.hu<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Privatsphäre<br />
Niemand lässt sich gerne über die Schulter<br />
schauen, schon gar nicht bei der Arbeit am PC. In<br />
der realen Welt merken Sie schnell, wenn der<br />
Atem des Spions im Nacken kitzelt. Entlang der<br />
digitalen Pfade lauern jedoch zahlreiche gesichtslose<br />
Spitzel, die Sie häufig erst bemerken, wenn es<br />
zu spät ist. Mit starker Kryptographie <strong>und</strong> Hilfsprogrammen<br />
sichern Sie Ihre Kommunikation<br />
über das Netz sowie die Daten auf Ihrem Rechner<br />
gegen unerwünschte Zugriffe. Wir zeigen, wie Sie<br />
dabei Tools wie GnuPG, Tor <strong>und</strong> Privoxy zu einer<br />
nahtlosen Abwehrstrategie verzahnen.<br />
Rauf aufs Velo<br />
Alternatives Betriebssystem hilft<br />
alternativem Transportmittel:<br />
Die Software mit dem ungewöhnlichen<br />
Namen Lugdulo’V unterstützt<br />
Sie bei der Suche nach einem<br />
Mietfahrrad in vielen Städten<br />
Deutschlands sowie in vielen<br />
Ländern der Welt. Und natürlich<br />
gibt es – entsprechend dem<br />
Open-Source-Prinzip – für jeden<br />
die Möglichkeit, beim Projekt<br />
mitzumachen.<br />
Vom Foto zum Film<br />
Die Diashow hat ausgedient:<br />
Dank Photofilmstrip zaubern Sie<br />
mit wenigen Mausklicks aus einer<br />
Sammlung von Fotos ein Video,<br />
das Erinnerungen an Familienfeiern<br />
oder Urlaube in fremden Ländern<br />
in ein stimmungsvolles <strong>und</strong><br />
bewegtes Moment komplett mit<br />
Ken-Burns-Effekt verwandelt.<br />
Notebook liebt Ubuntu<br />
Das Rockiger Satchbook, das in der stattung mit einem Intel Core i5 (2,3 GHz)<br />
sowie 500-GByte-SATA-Platte daherkommt,<br />
hat laut Hersteller nur Komponenten<br />
verbaut, die mit Ubuntu Linux<br />
Gr<strong>und</strong>aus-<br />
ausgezeichnet harmonieren.<br />
Ob das in der Praxis wirklich<br />
klappt, zeigt ein Test in<br />
der kommenden Ausgabe.<br />
© Rockiger<br />
Ausgabe 04/2011 erscheint am 10. Oktober 2011<br />
© PKruger, 123RF<br />
Dampf machen<br />
Der PC wirkt langsam, obwohl<br />
eine aktuelle CPU darin werkelt?<br />
Wir zeigen, wie Sie viele Dinge<br />
unter Linux deutlich beschleunigen<br />
können. So vermeiden Sie<br />
Wartezeiten. Weitere Themen<br />
sind flinke Dateimanager, Tools,<br />
zum <strong>Automatisieren</strong> <strong>und</strong> ein Ausflug<br />
in die Linux-Shell.<br />
Moderne Desktops<br />
KDE 4, Gnome 3, Unity <strong>und</strong> viele<br />
mehr: Die Auswahl bei den grafischen<br />
Oberflächen für Linux ist<br />
größer geworden, <strong>und</strong> viele langjährige<br />
KDE-Anwender fragen<br />
sich, ob ein Wechsel sinnvoll ist.<br />
Wir schauen, für wen sich der<br />
Umstieg auf einen der Alternativdesktops<br />
lohnt.<br />
Verschlüsselt <strong>und</strong> signiert<br />
Mails wandern oft unverschlüsselt<br />
durchs Netz. Wenn Sie sicherstellen<br />
wollen, dass außer dem<br />
Empfänger niemand einen Blick<br />
darauf werfen kann, setzen Sie<br />
GnuPG ein. Wir erklären die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen, stellen Tools vor <strong>und</strong><br />
verraten, wie Sie Kontakte mit<br />
Windows-Mailern einbeziehen.<br />
MAGAZIN<br />
© Kheng Ho Toha, 123RF<br />
Ausgabe 10/2011 erscheint am 08. September 2011<br />
Für alle Plattformen Booten im Vertrauen Pferdefußnoten<br />
Das nächste Magazin hilft Programmierern,<br />
sich aus der Plattform-Falle<br />
zu befreien, zum Beispiel<br />
mit Python im Duo mit Qt<br />
oder GTK+. Andere Artikel im<br />
Schwerpunkt zeigen, dass <strong>und</strong><br />
wie Mono, Java oder HTML5 für<br />
Flexibilität sorgen.<br />
Mit einem TPM-Chip, Trusted<br />
Grub, Kernel 2.6.30, den Linux<br />
Security Module Hooks <strong>und</strong> speziellen<br />
Mandatory-Access-Erweiterungen<br />
von SE Linux. Richtig<br />
zusammengefügt, entsteht ein<br />
System, das nahtlos seine Integrität<br />
beweisen kann.<br />
Manch smarter Politiker vergisst<br />
beim Zitieren gern die Quelle der<br />
Erkenntnis. Die Bitparade in der<br />
kommenden Ausgabe hilft <strong>und</strong><br />
vergleicht Programme wider die<br />
Vergesslichkeit, die auch Systemarchitekten,<br />
Entwicklern <strong>und</strong> anderen<br />
von Nutzen sind.<br />
106<br />
10 | 11<br />
Die Redaktion behält sich vor, Themen aus aktuellem Anlass zu ändern oder zu streichen.