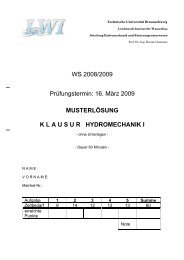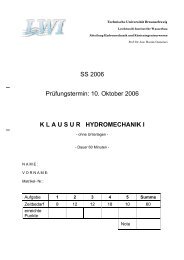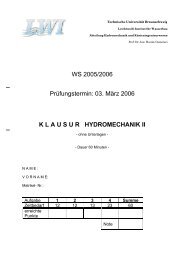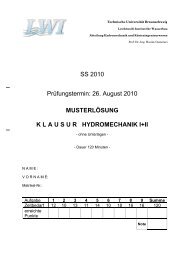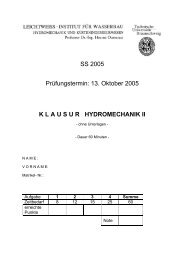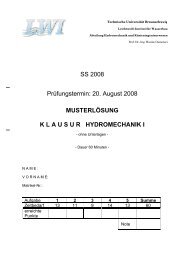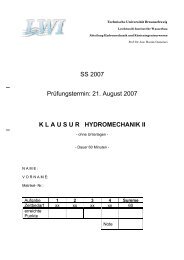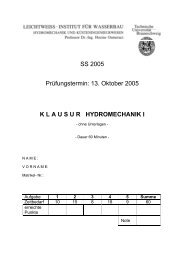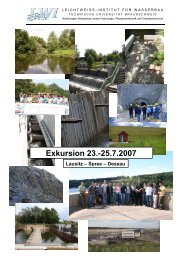Musterlösung WS 2003/2004 - LeichtweiÃ-Institut für Wasserbau
Musterlösung WS 2003/2004 - LeichtweiÃ-Institut für Wasserbau
Musterlösung WS 2003/2004 - LeichtweiÃ-Institut für Wasserbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
L E I C H T W E I S S - I N S T I T U T F Ü R W A S S E R B A U<br />
T E C H N I S C H E U N I V E R S I T Ä T B R A U N S C H W E I G<br />
P R Ü F U N G S T E R M I N : 30. März <strong>2004</strong><br />
K L A U S U R<br />
<strong>Wasserbau</strong> + Wasserwirtschaft I<br />
n e u e D P O !<br />
- ohne Unterlagen -<br />
Dauer: 60 Minuten<br />
N A M E : ..............................................................................<br />
MUSTERLÖSUNG<br />
Vorname: ..............................................................................<br />
Matrikel-Nr: ..............................................................................<br />
Ingenieurhydrologie<br />
Aufgabe 1 2 3 4 5 SUMME<br />
ungef. Zeitbedarf in Minuten<br />
= erreichbare Punktzahl 16 P. 14 P. 12 P. 8 P. 10 P. 60 P.<br />
erreichte Punkte<br />
.......... P. .......... P. .......... P. .......... P. ..........P. ............ P.<br />
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft - Professor Dr.-Ing. Ulrich Maniak
Aufgabe 1<br />
AUSSAGEN zur Ingenieurhydrologie<br />
(richtig ? / falsch ?)<br />
7 * 2 + 6 = 20 Punkte<br />
hier sind 4 Zusatzpunkte enthalten 20 – 4 16 Punkte<br />
Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen mit„X“ jeweils an, ob sie „zutreffend“ (= richtig) oder<br />
„nicht zutreffend“ (= falsch) sind. Es wird empfohlen, lieber kein „X“ zu setzen, wenn Sie nicht<br />
sicher sind, ob es in die Spalte „r“ oder eher zu „f“ gehört. Dadurch vermeiden Sie, dass Pluspunkte<br />
für korrekte sichere Antworten durch unsichere falsche Entscheidungen verloren gehen; denn<br />
innerhalb einer Gruppe von Aussagen wird in der Regel ein richtig gesetztes Kreuz durch ein<br />
falsches aufgehoben!<br />
1.1 AUSSAGEN zum Niederschlag r f<br />
Die Gebietsniederschlagshöhe für ein Untersuchungsgebiet<br />
ist im einfachsten Fall der Mittelwert aller im Gebiet<br />
gemessenen Punktniederschläge.<br />
Die durchschnittliche jährliche Niederschlagshöhe ist in<br />
Braunschweig deutlich geringer als an der Station<br />
„Brocken“ im Harz (sogar nur etwa halb so groß):<br />
X<br />
X<br />
Bei zyklonalen Niederschlägen (Großwetterlagen – horizontale<br />
Luftbewegungen) sind die Intensitäten meistens<br />
deutlich geringer als bei konvektiven Niederschlägen.<br />
Für Hochwasserbetrachtungen sollte die Dauer des gewählten<br />
Bemessungsniederschlags niemals kleiner als die<br />
Konzentrationszeit im untersuchten Einzugsgebiet sein.<br />
X<br />
X<br />
1.2 AUSSAGEN zur Verdunstung r f<br />
Von einem Waldgebiet verdunstet normalerweise mehr<br />
Wasser als von einer nahegelegenen Ödland-Fläche.<br />
(bei Vergleich monatlicher Verdunstungshöhen!)<br />
X<br />
Die Tages-Verdunstungshöhe von einem See kann nie<br />
größer als die Niederschlagshöhe dieses Tages werden.<br />
Die aktuelle Evapotranspiration wird im Sommer immer<br />
größer sein als die potentielle Evapotranspiration.<br />
X<br />
X<br />
Bei der Berechnung nach PENMAN wird auch der Einfluss<br />
des Windes auf die Verdunstung berücksichtigt.<br />
X
1.3 AUSSAGEN zum Abfluss r f<br />
Abflussmessungen sind aufwendiger als Wasserstandsmessungen;<br />
daher werden Abflusskurven erstellt, um aus gemessenen<br />
Wasserständen Abflüsse bestimmen zu können. X<br />
Die Abflussspende entspricht der monatlichen Abflussmenge<br />
an einer Messstelle [in m³/Monat].<br />
X<br />
Aus der Abfluss-Füllenlinie für ein Bemessungshochwasser<br />
lässt sich entnehmen, wieviel Wasser zurückgehalten werden<br />
muss, um einen vorgegebenen Höchstabfluss im Unterwasser<br />
nicht zu überschreiten. (dieses X zählt doppelt!)<br />
XX<br />
1.4 AUSSAGEN zur Abflussbildung r f<br />
Als direkter Abfluss gilt für ein Regenereignis die<br />
Wassermenge, die sich ergibt, wenn von der zugehörigen<br />
Abflusswelle der Basisabfluss abgezogen wird.<br />
X<br />
Der Abflussbeiwert ist das Verhältnis des Abflussvolumens aus<br />
dem Einzugsgebiet (ohne Basisabfluss) zum Gesamt-Niederschlagsvolumen<br />
auf dieses Gebiet.<br />
X<br />
Der Abflussbeiwert muss für versiegelte Flächen und<br />
Ödland größer als für Waldgebiete angesetzt werden.<br />
X<br />
Wenn in einem Starkregenintervall innerhalb von einer halben<br />
Stunde (∆t = 0,5 h) insgesamt 20 mm Niederschlag fallen,<br />
ergibt sich dafür bei einer Verlustrate von Φ = 8 mm/h ein<br />
Effektivniederschlag von . . . 12 mm 16 mm<br />
(zutreffenden Wert bitte ankreuzen!)<br />
X<br />
1.5 AUSSAGEN zur Statistik r f<br />
Eine Wasserstandsdauerlinie zeigt die in einem Zeitabschnitt<br />
(z.B. 1 Jahr) an einer Messstelle beobachteten<br />
Wasserstände der Größe nach geordnet .<br />
X<br />
Ein 5-jährlicher Hochwasserabfluß hat eine<br />
Unterschreitungswahrscheinlichkeit von p u = 5 %.<br />
X<br />
Ein 50-jährlicher Hochwasserabfluß hat eine<br />
Überschreitungswahrscheinlichkeit von p ü = 2 %.<br />
X<br />
Bei der linearen Regression gilt, dass die Steigung der<br />
Regressionsgeraden positiv wird, wenn der zugehörige<br />
Korrelationskoeffizient mit r = -0,98 ermittelt wurde.<br />
X
1.6 AUSSAGEN zu Flussgebietsmodellen r f<br />
Vereinfachend wird bei der Ermittlung von Abflussganglinien<br />
aus Niederschlägen davon ausgegangen, dass am Rand des<br />
Einzugsgebiets die Niederschlagshöhe halb so groß wie<br />
im Bereich des Hauptvorfluters (=Fluss bzw. Bach) ist.<br />
X<br />
Wenn bei einem Hochwasser-Rückhaltebecken die Überfallbreite<br />
der Hochwasserentlastungsanlage vergrößert wird,<br />
bewirkt das, dass sich im Becken bei gleichem Abfluss<br />
ein höherer Höchstwasserstand einstellt.<br />
X<br />
Wenn eine 2-h-Einheitsganglinie einen Scheitelwert von<br />
u i,max = 3,3 m³/(s mm) nach 2*∆t = 4 h aufweist , wird bei<br />
einem Berechnungsniederschlag von 32 mm/2h und einer<br />
Verlustrate von 6 mm/h für den Direktabfluss folgendes<br />
Ergebnis erhalten (zutreffende Werte bitte ankreuzen!):<br />
Der Scheitelabfluss QD max beträgt [in m³/s] :<br />
30,0 66,0<br />
X<br />
Erreicht wird dieser Scheitelabfluss nach einer Zeit von: 4h 6h<br />
X<br />
1.7 AUSSAGEN zur Speicherbewirtschaftung r f<br />
Der Totraum einer Talsperre ist für die Nutzungsdauer<br />
so zu bemessen, dass dort das mitgeführte Geschiebe<br />
aufgenommen werden kann.<br />
X<br />
Ein Ausgleichsbecken unterhalb einer Talsperre erfüllt<br />
den gleichen Zweck wie ein Hochwasserrückhaltebecken.<br />
Der Speicherausbaugrad ist definiert als Verhältnis der<br />
mittleren Speicherfüllung zur Speicherkapazität.<br />
X<br />
X<br />
Wenn mit einer Anfangsfüllung von 15 Mio.m³ im Januar sich<br />
im April desselben Jahres ein erster Überlauf von 9 Mio.m³<br />
einstellt, würde ohne Anfangsfüllung dieser Überlauf entfallen<br />
und bei dem nachfolgenden Überlauf im November würde - bei<br />
gleich bleibenden Zuflussbedingungen und derselben konstanten Abgabe<br />
- die Überlaufmenge reduziert werden, und zwar<br />
maximal um: 15 [ Mio.m³] 6<br />
(zutreffenden Wert bitte ankreuzen!)<br />
X
1.8 AUSSAGEN / Überschlagsrechnung zur Seeretention 6 Punkte<br />
Seeretention<br />
Abfluss Q in m³/s<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0 4 8 12 16 20 24<br />
Zeit t in h<br />
Gegeben ist die Zuflussganglinie QZ(t) zur Hochwasserentlastungsanlage einer<br />
Talsperre für ein Bemessungs- Hochwasserereignis.<br />
1.) Skizzieren Sie bitte die Abflussganglinie QA(t) aus dem Stausee, wenn<br />
anzunehmen ist, dass dieser zu Beginn (t=0) so weit gefüllt ist, dass QA =<br />
20 m³/s über die Hochwasserentlastungsanlage abfließen [QA(0) = QZ(0)];<br />
als Maximalabfluss ist QA = 65 m³/s anzunehmen. 2<br />
2.) Geben Sie die Zeit an, wann dieser höchste Abfluss erreicht wird. 1<br />
10 h<br />
3.) Ermitteln Sie überschlägig, welches Volumen bei diesem Ereignis im<br />
unbeherrschbaren Hochwasserschutzraum zusätzlich aufgenommen<br />
werden müsste, wenn nur 55 m³/s als Maximalabfluss zulässig wären. 3<br />
(65 – 48) * 10 / 2 = 85 m³/s * 3600 s = 306 000 m³
Aufgabe 2: Einheitsganglinie - Abflussgangline<br />
14 Punkte<br />
Für ein Hochwasserereignis im Einzugsgebiet des F-Baches (Einzugsgebietgröße A Eo = 5,22 km²)<br />
steht Ihnen der gemessene Niederschlag und eine gemessene Abflussganglinie am Gebietsauslass<br />
zur Verfügung (siehe folgende Abbildung). Der Basisabfluss beträgt Q basis = 5 m³/s.<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30 mm 40 mm 10 mm<br />
14 mm<br />
24 mm<br />
0 mm<br />
33.8<br />
Φ = 16 mm/h<br />
30.000<br />
QA [m³/s]<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
16.9<br />
19.4<br />
10.000<br />
5.000<br />
5.0<br />
5.0<br />
0.000<br />
0 1 2 3 4 5 6 7<br />
Zeit [h]<br />
2.1: Bestimmen Sie die effektive Niederschlagshöhe pro Zeitintervall ( ∆t = 1h<br />
). Gehen Sie dabei<br />
von einem konstanten Verlustratenansatz aus. (8 P.)<br />
2.2: Bestimmen Sie mit Hilfe der Abflussganglinie und dem effektiven Niederschlag aus 2.1 die<br />
Einheitsganglinie des Einzugsgebietes und skizzieren Sie diese (6 P.)<br />
1.4<br />
1.2<br />
u [m³/(s*mm)]<br />
1<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0,85<br />
0,6<br />
0.2<br />
0<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
Zeit t [h]
Musterlösung zu Aufgabe 2:<br />
2.1:<br />
Direktabfluss:<br />
0 1 2 3 4 5 Zeit in h<br />
5-5 =<br />
0<br />
5-5 =<br />
0<br />
16,9-5 =<br />
11,9<br />
5-5 =<br />
28,8<br />
33,8-5 =<br />
14,4<br />
Volumen des Direktabflusses (ohne Basisabfluss !):<br />
V direkt = (11,9 +28,8+14,4)*3600 = 198 360 m³<br />
Effektiver Niederschlag (entsprechend dem direkten Abfluss)<br />
N eff. = V direkt / A Eo = 198360 m³ / 5,22 km² = 38 mm<br />
Gesamtniederschlag<br />
N ges. = 30 + 40 + 10 = 80 mm<br />
Gesamtverluste<br />
V = 80 – 38 = 42 mm<br />
19,4-5 =<br />
mittlere Verlustrate (hier: 3 * 1h-Intervall)<br />
korrigierte Verlustrate<br />
42<br />
42 -10<br />
φ m<br />
= = 14 mm/h > 10mm/h = N 3 φ korr.<br />
= = 16 mm/h<br />
3<br />
2<br />
0<br />
Direktabfluss<br />
in m³/s<br />
Effektivniederschlag pro Intervall (∆t = 1h) (bei Verlustrate Φ = 16 mm/∆t = 16 mm/h)<br />
N eff.1 = 30 – 16 = 14 mm/h<br />
N eff.2 = 40 – 16 = 24 mm/h<br />
N eff.3 = 10 – 16 < 0 0 mm/h<br />
2.2:<br />
Einheitsganglinie:<br />
u m = (Q direkt,m – Σu m-i *N eff,i+1 ) / N eff,1<br />
i=1 bis k-1 bei k Niederschlags-Intervallen<br />
u 0 = 0 m³/s/mm<br />
u 1 = 11,9 / 14 = 0,85 m³/s/mm<br />
u 2 = (28,8 – 24*0,85) / 14 = 0,6 m³/s/mm<br />
u 3 = (14,4 – 0*0,85 – 24*0,6) / 14 = 0 m³/s/mm
Aufgabe 3: SPEICHERBEMESSUNG 12 Punkte<br />
Aus dem E-Fluss wird fortlaufend Kühlwasser entnommen, um den Betrieb eines nahegelegenen<br />
Kraftwerks aufrecht zu erhalten. Damit sichergestellt werden kann, dass der Abfluss an der<br />
Entnahmestelle nicht unter einen vorgegebenen Grenzwert von 2,0 m³/s absinkt, wird aus einer<br />
oberhalb gelegenen Talsperre mit einer Nutzraumgröße von 40 Mio.m³ mindestens diese Menge<br />
kontinuierlich abgegeben.<br />
Das z. Zt. aus zwei Blöcken bestehende Kraftwerk soll nun um einen weiteren gleichartigen<br />
Block erweitert werden, so dass dementsprechend auch der Kühlwasserbedarf um 50% größer<br />
wird. Das bedeutet, dass zur Gewährleistung der erhöhten Kühlwasserentnahme in Zukunft<br />
durchgehend ein Mindestabfluss von 3,0 m³/s einzuhalten ist.<br />
Mit Hilfe des Summenlinienverfahrens soll für einen repräsentativ ausgewählten Zeitraum von 6<br />
Jahren zunächst untersucht werden, ob der Kraftwerksbetrieb mit der vorhandenen Talsperre<br />
ohne Unterbrechung gewährleistet werden kann oder ob eine Einschränkung des Betriebs bzw.<br />
eine Vergrößerung des Nutzraums (wie groß mindestens ?) vorgenommen werden.<br />
(Rechnung mit 30 Tagen/Monat = 360 Tage/Jahr)<br />
1. Welche konstante Abgabe könnte bei der bisherigen Nutzraumgröße von 40 Mio.m³ geleistet<br />
werden? Siehe Blatt 3.1 424 / 72 = 5,89 Mio.m³/Monat 4<br />
Abgabe QA 40 :<br />
………5,89…… Mio. m 3 /Monat = ……2,27……… m³/s<br />
2. In wie vielen Monaten pro Jahr (Durchschnitt aus dem betrachteten 6-Jahres-Zeitraum<br />
ermitteln) könnte ein erhöhter Mindest-Abfluss von QAR = 3,0 m³/s bei unveränderter<br />
Nutzraumgröße nicht vollständig eingehalten werden? 4<br />
gewünschte Abgabe QAR = 3,0 m³/s = 7,776 Mio.m³/Monat = ca. 560 Mio.m³ / 6 a<br />
Abgabe von >= 3,0 m³/s ist in den betrachteten 6-Jahren in ……7…… Monaten,<br />
also durchschnittlich in …1,2… Monaten / Jahr nicht in vollem Umfang möglich.<br />
3. Auf welche Größe muss der Nutzraum vergrößert werden, damit die benötigte Regelabgabe<br />
von 3,0 m³/s für die erhöhte Kühlwassermenge durchgehend bereitgestellt werden kann? 4<br />
erforderliche Nutzraumgröße (QAR=3,0 m³/s): ………72…… Mio. m 3<br />
Gegeben: Summenlinie der Zuflüsse 6 Jahre (= 72 Monate) Summe = 648 Mio.m³<br />
mittlerer Zufluss: QZm = 648 / 72 = 9 Mio.m³/Monat = 3,472 m³/s (Bild 3.1)<br />
(mit 2 Doppel-Exemplaren)<br />
vorhandene Speicher-Nutzraumgröße: S N = 40 Mio.m³<br />
zukünftig - für 3 Kraftwerk-Blöcke - benötigte Abgabe : QA 3 B = 3,0 m³/s
Summe der Speicher-Zuflüsse und -abgaben<br />
700<br />
600<br />
500<br />
Ablauf der Bearbeitung<br />
1. Nutzraumgröße S N an mehreren Stellen<br />
– Übergang von geringer zu großer Steigung –<br />
nach oben antragen!<br />
2. Tangenten jeweils von den Endpunkten<br />
S N an vorausgehende Zufluss-Summenlinie<br />
zeichnen!<br />
3. geringste Tangentensteigung<br />
maßgebend, um die mögliche konstante<br />
Abgabe QA zu bestimmen (Maßstab <br />
Volumen pro Zeit, Umrechnung)<br />
424 Mio m³<br />
Zufluss [Mio m³]<br />
400<br />
300<br />
S N = 40 Mio m³<br />
200<br />
QA 40 = 5,89 Mio.m³/Monat<br />
= 2,27 m³/s<br />
100<br />
0<br />
0 12 24 36 48 60 72<br />
Zeit [Monate]<br />
Bild 3.1
Summe der Speicher-Zuflüsse und -abgaben<br />
700<br />
600<br />
560 Mio.m³/6 Jahre = 3,0 m³/s = gewQA (gewünscht)<br />
500<br />
Zufluss [Mio m³]<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
S N = 40 Mio m³<br />
4 Monate<br />
3 Monate<br />
Ablauf der Bearbeitung<br />
1. Steigung für gewQA ermitteln und als<br />
Gerade (ab „Nullpunkt“ 0 / 0) zeichnen !<br />
2. Nutzraumgröße S N an mehreren Stellen –<br />
Übergang von (im Vergleich zu 1.) größerer zu<br />
geringerer Steigung – nach unten antragen!<br />
3. Geraden mit der Steigung für gewQAR<br />
parallel verschieben an die Endpunkte S N<br />
und ggf. – wenn die Zufluss-Summenlinie<br />
(=QZ-SL) geschnitten wird – ab dem nachfolgenden<br />
„Minimum“ (Übergang von geringerer<br />
zu stärkerer Steigung) parallel verschoben<br />
weiterführen bis zum nächsten Schnittpunkt,<br />
wieder verschieben an „Minimum“ usw.<br />
4. „Fehlzeiten“ (=Zeiten, in denen gewQAR<br />
nicht vollständig geleistet werden kann)<br />
beginnen jeweils am Schnittpunkt und enden<br />
am „Minimum“! Dauer QA < gewQAR<br />
0<br />
0 12 24 36 48 60 72<br />
Zeit [Monate]<br />
Bild 3.1 (Doppel 1)
Summe der Speicher-Zuflüsse und -abgaben<br />
700<br />
600<br />
560 Mio.m³/6 Jahre = 3,0 m³/s = gewQA (gewünscht)<br />
500<br />
Zufluss [Mio m³]<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
72 Mio.m³ = erfS N<br />
erforderl. Nutzraumgröße<br />
für QAR = 3,0 m³/s<br />
0 12 24 36 48 60 72<br />
Zeit [Monate]<br />
Ablauf der Bearbeitung<br />
1. Steigung für gewQAR ermitteln und als<br />
Gerade (ab „Nullpunkt“ 0 / 0) zeichnen!<br />
2. Geradenabschnitte mit dieser Steigung<br />
(gewQAR) als Tangenten an Übergangsstellen<br />
von größerer zu geringerer Steigung<br />
(vergl. mit 1. „lokale Maxima“) zeichnen<br />
( Parallelverschiebung) !<br />
3. erforderliche Nutzraumgröße erfS N als<br />
maximale Differenz von der jeweiligen<br />
Tangente zur darunterliegenden Zufluss-<br />
Summenlinie (QZ-SL) bestimmen (zur vergleichenden<br />
Kontrolle an mehreren Stellen<br />
zusätzlich eingezeichnet) ! (das ist das<br />
Volumen, das am Tangentenpunkt im<br />
Nutzraum verfügbar sein muss, damit die<br />
gew. Abgabe gewQAR durchgehend eingehalten<br />
werden kann! daraus ergibt sich:<br />
benötigte Speicherkapazität erfS N !)<br />
4. Nutzraumgröße erfS N an der Ordinatenachse<br />
antragen, um dort - mit diesem<br />
Maßstab - die Größe abzulesen.<br />
Bild 3.1 (Doppel 2)
Aufgabe 4: Gewässergüte<br />
8 Punkte<br />
Bestimmen Sie den Trophiegrad der Okertalsperre, die zurzeit zu 79% gefüllt ist. Der mittlere Zufluss<br />
zur Talsperre beträgt 2,42 m³/s. Mit den Zuflüssen werden pro Jahr ca. 1,65 Tonnen Phosphor<br />
in die Talsperre eingebracht.<br />
a) Berechnen Sie die maßgeblichen Parameter und markieren Sie im unteren Diagramm den<br />
jetzigen Zustand der Talsperre<br />
b) Welcher Phosphorgehalt der Zuflüsse müsste erreicht werden, damit sich – bei sonst gleichen<br />
Verhältnissen – ein mesotropher Zustand einstellt?<br />
c) Wie würde sich der Trophiegrad ändern, wenn die Talsperre im Mittel nur noch bis<br />
400 m+NN gefüllt ist?<br />
430<br />
430<br />
Wasserstand [m+NN]<br />
420<br />
416,6<br />
410<br />
400<br />
390<br />
380<br />
370<br />
360<br />
Stauziel<br />
18<br />
1.<br />
Wasserstand [m+NN]<br />
420<br />
410<br />
400<br />
390<br />
380<br />
37 370<br />
1,95<br />
360<br />
1,2<br />
2.<br />
350<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60<br />
Speicherinhalt [Mio m³] 46,85<br />
Formeln:<br />
mittlere Verweilzeit<br />
mittlere Tiefe<br />
Volumen<br />
τ =<br />
mittl. jährlicherZufluss<br />
z =<br />
Volumen<br />
Seeoberfläche<br />
[m]<br />
m P<br />
Flächenbelastung L =<br />
[g/m² ⋅ a]<br />
Seeoberflä che<br />
[a]<br />
350<br />
0<br />
0,1<br />
0,2<br />
0,3<br />
0,4<br />
0,5<br />
0,6<br />
0,7<br />
0,8<br />
0,9<br />
mit m p = Phosphoreintrag [g/a]<br />
1<br />
1,1<br />
1,2<br />
1,3<br />
1,4<br />
1,5<br />
1,6<br />
1,7<br />
1,8<br />
1,9<br />
Speicheroberfläche [km²]<br />
2<br />
2,1<br />
2,2<br />
2,3<br />
2,4<br />
2,5<br />
1. - Wasserstand für Füllung S = 37 Mio m³<br />
2. - zugehörige Speicheroberfläche ablesen<br />
100<br />
10<br />
Flächenbelastung L<br />
1<br />
hypertroph<br />
polytroph<br />
eutroph<br />
0.1<br />
mesotroph<br />
oligotroph<br />
0.01<br />
0.1 1 10 100 1000<br />
Verhältnis mittlere Tiefe zu mittlerer Verweilzeit z/t
Musterlösung zu Aufgabe 4:<br />
a) Volumen (=Speicher-Füllung): S = 0,79 * 46,85 = 37 Mio m³<br />
mittl. Jährlicher Zufluss: 2,42 * 3600 *24 *365 = 76,32 Mio m³/a<br />
mittlere Verweilzeit:<br />
t = 37 / 76,32 = 0,48 a<br />
Seeoberfläche aus Diagramm: 1,95 km² (bei Füllungsstand S = 37 Mio m³)<br />
mittlere Tiefe:<br />
z = 37 / 1,95 = 19 m<br />
z/t =19 / 0,48 = 39,6 m/a<br />
Flächenbelastung:<br />
L = 1,65 / 1,95 = 0,85 g/m²/a<br />
eutroph !<br />
100<br />
10<br />
c)<br />
a)<br />
b)<br />
1,375<br />
0,85<br />
0,54<br />
Flächenbelastung L<br />
1<br />
hypertroph<br />
polytroph<br />
eutroph<br />
eutroph<br />
0.1<br />
mesotroph<br />
62,5<br />
oligotroph<br />
39,6<br />
0.01<br />
0.1 1 10 100 1000<br />
Verhältnis mittlere Tiefe zu mittlerer Verweilzeit z/t<br />
b) L = 0,54 g/m²*a (abgelesen aus Diagramm Übergang „eutroph“ „mesotroph“ bei unverändertem Wert „z/t“ )<br />
Phosphorfracht m P = 0,54 * 1,95 = 1,053 * 10 6 g/a = 1,053 Tonnen/Jahr<br />
Phosphorgehalt (P-Konzentration) im Zufluss c = 1,053 / 76,32 = 0,014 g/m³ (bzw. mg/l)<br />
c) bei Füllung bis NN+400m mittlerer Füllungsstand S* = 18 Mio m³<br />
mittlere Seeoberfläche F* = 1,2 km²<br />
mittlere Verweilzeit:<br />
t = 18 / 76,32 = 0,24 a<br />
mittlere Tiefe:<br />
z = 18 / 1,2 = 15 m<br />
z / t = 15 / 0,24 = 62,5 m/a<br />
Flächenbelastung:<br />
L = 1,65 / 1,2 = 1,375 g/m²/a<br />
→ eutroph
Aufgabe 5:<br />
10 Punkte<br />
Aufgabe 5.1 (6 Punkte):<br />
Gegeben ist Ihnen ein Auszug aus dem Gewässerkundlichen Jahrbuch 1998 für den Pegel<br />
Schmittlotheim an der Eder. Welche Kennwerte können Sie daraus entnehmen bzw. daraus<br />
eindeutig ermitteln? Bitte kreuzen Sie entweder Ja oder Nein an! Falls Sie Ja ankreuzen geben Sie<br />
bitte den Wert an!<br />
Kennwert JA, der Kennwert beträgt…. NEIN<br />
Abfluss, der an 300 Tagen im Kalenderjahr 1998<br />
unterschritten wurde<br />
Höchster im Abflussjahr gemessener<br />
Niedrigwasserabfluss<br />
Verdunstungshöhe im August<br />
Höchster im Abflussjahr gemessener Wasserstand<br />
Mittlerer Abfluss für das Abflussjahr 1998<br />
X ablesen aus Dauertabelle für das<br />
Kalenderjahr bei 300 d Unterschreitungsdauer<br />
39,5 m³/s<br />
unsinnig höchster Niedrigwasserabfluss<br />
angegeben sind für die einzelnen Monate lediglich mittlere<br />
Niederschlags- und Abflusshöhen, so dass durch Bilanzierung<br />
„grob“ mittlere Verdunstungshöhen abgeschätzt<br />
werden könnten, wenn angenommen wird, dass in (aus)<br />
dem Boden keine Speicherung (Abgabe) erfolgt.<br />
DAHER keine genauen Verdunstungswerte<br />
X bei HQ – bei Hauptwerten - angegeben<br />
W = 355 cm<br />
(vermutlich bei HQ auch HW, jedoch nicht<br />
zwingend / theoretisch wäre noch ein anderer<br />
Maximal-Wasserstand - bei kleinerem Q -<br />
denkbar z.B. durch den Einfluss von Kraut,<br />
Verbau oder anderen Hindernissen.)<br />
X<br />
aus Hauptwerten für Abflussjahr<br />
MQ = 22,2 m³/s<br />
X<br />
X<br />
( X )<br />
Mittlere Abflussspende [l/(s*km²)] für den 29. Oktober<br />
X<br />
339/1202 = 0,28 m³/(s . km²)<br />
= 280 l/(s . km²)<br />
der Quotient aus mittlerem Tagesabfluss –<br />
Tageswerte - und der Einzugsgebietsgröße<br />
ergibt die mittlere Abflussspende für den<br />
genannten Tag
Abflüsse<br />
Wesergebiet 1998<br />
A : 1202 km Pegel : Schmittlotheim<br />
Nr.<br />
PNP : NN + 245.87 m<br />
Gewässer : Eder<br />
Lage: 74.5 km oberhalb der Mündung links<br />
m /s<br />
Gebiet : Fulda<br />
42800309<br />
Tag<br />
1997 1998<br />
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez<br />
3.50 8.21 30.0 T 9.43 8.26 8.74 26.0 13.4 3.30 4.51 3.43 24.0 205 12.5<br />
3.41 8.48 30.8 T 8.21 9.49 8.75 35.4 12.0 3.40 4.88 3.25 36.0 211 11.6<br />
3.35 8.76 50.0 G 8.14 18.1 9.18 33.4 9.56 3.00 5.01 3.40 35.0 143 11.2<br />
3.28 8.87 90.6 G 7.97 32.5 10.3 27.4 7.76 2.90 4.27 4.35 30.3 96.8 11.2<br />
3.28 8.65 90.8 G 7.78 67.5 10.5 23.0 6.29 2.75 3.60 5.10 27.0 79.4 11.2<br />
3.96 8.42 100 G 7.60 82.9 11.3 20.1 5.67 3.00 3.30 5.35 23.5 67.2 11.0<br />
5.89 8.48 87.9 G 7.41 123 12.0 18.0 6.00 3.10 2.95 5.35 29.5 58.3 10.2<br />
6.29 8.79 75.2 R 7.23 174 19.6 15.2 7.10 3.30 2.65 5.35 62.0 51.9 10.5<br />
6.98 8.67 61.2 R 6.50 143 29.2 12.9 5.98 3.45 2.35 5.60 58.0 59.5 16.7<br />
14.3 12.3 49.7 R 6.41 94.1 31.4 11.5 5.78 3.40 2.30 5.35 39.5 68.5 14.7<br />
15.7 23.8 40.1 T 6.07 65.9 39.1 10.4 5.58 4.30 2.10 5.35 37.0 66.1 10.1<br />
14.5 40.8 32.0 6.82 48.4 39.4 9.52 5.97 5.78 2.05 5.70 38.5 57.4 8.89<br />
16.3 87.2 26.6 8.83 36.1 35.6 8.52 5.14 10.6 2.00 6.00 96.0 48.2 32.0<br />
15.3 101 22.7 9.98 29.4 29.9 7.85 4.65 19.3 1.80 6.70 93.0 43.8 61.8<br />
13.3 81.0 19.3 9.52 25.5 25.3 7.12 4.37 19.7 1.75 56.0 78.0 41.8 79.2<br />
13.8 59.0 18.8 9.26 25.7 24.3 6.61 4.67 18.6 1.70 146 56.0 40.7 87.6<br />
12.6 42.6 20.4 10.2 24.1 20.5 6.13 4.62 17.2 1.50 114 43.0 39.1 77.5<br />
11.4 32.5 19.0 10.1 23.2 17.9 5.72 5.09 14.4 1.45 133 36.0 35.7 62.8<br />
10.8 26.5 21.4 9.55 21.6 17.1 5.45 5.04 12.5 1.40 95.0 27.3 33.1 52.6<br />
10.1 22.5 25.3 9.21 19.5 15.1 5.16 4.99 10.6 1.35 46.2 23.5 28.6 48.9<br />
9.62 21.7 25.2 8.87 18.1 17.0 4.82 4.36 8.96 1.30 31.5 20.8 24.6 42.0<br />
9.02 18.4 23.9 8.97 15.9 15.2 4.76 3.84 7.62 1.60 23.5 18.3 21.3 36.7<br />
8.28 16.1 22.6 8.72 15.8 13.7 4.50 3.79 6.82 3.30 18.5 16.5 21.1 32.0<br />
7.63 15.4 20.1 8.03 14.6 13.2 4.25 3.74 6.63 4.46 14.5 20.6 17.8 28.2<br />
7.06 19.3 18.5 7.66 13.2 12.7 4.39 3.69 5.42 6.19 12.2 56.0 16.3 24.8<br />
6.75 24.0 15.7 7.26 12.2 12.4 4.32 3.72 4.92 4.49 10.6 97.0 14.8 26.3<br />
6.26 31.2 14.7 7.08 11.6 19.2 4.42 3.59 4.31 6.09 9.30 98.0 14.3 37.5<br />
5.80 40.2 14.3 7.41 11.1 37.1 5.05 3.43 4.07 5.66 8.40 153 14.7 50.8<br />
6.57 44.9 13.2 10.5 33.8 4.75 3.33 4.68 4.59 8.10 339 14.5 52.3<br />
8.20 41.5 11.5 9.81 29.8 4.17 3.23 7.37 4.04 7.50 227 13.5 45.2<br />
35.0 R 10.6 9.14 4.06 6.21 3.83 189 37.1<br />
4.+ 1. 31. 11. 1. 1. 31. 30. 5. 21. 2. 23. 30. 12.<br />
3.28 8.21 10.6 6.07 8.26 8.74 4.06 3.23 2.75 1.30 3.25 16.5 13.5 8.89<br />
8.77 29.5 35.6 8.22 39.2 20.6 11.1 5.55 7.47 3.18 26.8 68.7 54.9 34.0<br />
16.7 105 105 12.0 182 42.7 47.0 18.4 21.0 7.12 154 429 238 91.2<br />
13.+ 14. 6. 17. 8. 11. 2. 1. 14. 25. 16. 29. 1.+ 16.<br />
mm<br />
mm<br />
76 112 102 21 111 113 67 71 85 55 184 270 0 0<br />
19 66 79 17 87 44 25 12 17 7 58 153 118 76<br />
mm<br />
mm<br />
1983 1959 1947 1947 1942 1974 1952 1964 1964+ 1973 1947 1959 1983 1959<br />
0.600 1.52 0.500 1.00 1.70 3.00 1.60 0.300 0.500 0.160 0.140 0.510 0.600 1.52<br />
6.49 9.30 9.20 9.79 10.1 8.98 5.23 3.90 3.43 3.07 3.18 4.24 6.66 9.42<br />
21.3 34.0 34.1 32.2 31.5 23.4 11.0 8.72 8.76 6.78 7.75 12.3 21.1 34.4<br />
68.8 127 139 118 104 57.7 27.6 25.4 27.7 20.9 24.2 39.7 65.2 128<br />
450 475 507 770 361 188 255 178 170 94.0 190 429 258 475<br />
1940 1947 1948 1946 1981 1986 1984 1984 1980 1960 1957 1998 1984 1947<br />
86 103 95 67 74 61 66 74 81 74 71 76 85 101<br />
44 79 79 59 71 51 27 19 20 14 17 29 46 79<br />
Abflußjahr (*)<br />
Kalenderjahr<br />
1998 1998<br />
m /s<br />
m /s<br />
m /s<br />
l/(s km )<br />
l/(s km )<br />
l/(s km )<br />
mm<br />
mm<br />
m /s<br />
m /s<br />
m /s<br />
m /s<br />
m /s<br />
m /s<br />
m /s<br />
l/(s km )<br />
l/(s km )<br />
l/(s km )<br />
mm<br />
mm<br />
1.30<br />
22.2<br />
429<br />
1.08<br />
18.5<br />
357<br />
Niedrigwasser<br />
3.28<br />
24.0<br />
182<br />
2.73<br />
20.0<br />
151<br />
1.30<br />
20.5<br />
429<br />
1.08<br />
17.1<br />
357<br />
1.30<br />
26.4<br />
429<br />
1.08<br />
22.0<br />
357<br />
1267 535 732 1079<br />
582 312 271 693<br />
0.140<br />
1.76<br />
19.3<br />
235<br />
770<br />
1.46<br />
16.1<br />
196<br />
bei W= 355 cm bei W= 355 cm<br />
0.500<br />
3.74<br />
29.4<br />
229<br />
770<br />
3.11<br />
24.5<br />
190<br />
0.140<br />
1.92<br />
9.22<br />
67.0<br />
429<br />
1.60<br />
7.67<br />
55.7<br />
0.140<br />
1.81<br />
19.3<br />
231<br />
770<br />
171<br />
bei W= 411 cm<br />
164 38.2 171<br />
bei W= 411 cm<br />
340 332 102 340<br />
1.51<br />
16.1<br />
192<br />
929 487 442 925<br />
509 384 126 512<br />
(*) Abflußjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.<br />
HQ1, HQ5 : Jahresreihe 1941/1998<br />
Extremwerte ab 1931<br />
Verkrautung an allen Monaten<br />
4 Tage Randeis; 5 Tage Rand-, Grund- und Treibeis ( 3.02. - 7.02. )<br />
3 Tage Rand- und Treibeis ( 1.02. - 2.02. und 11.02. )<br />
Anlage zu Aufgabe 5.1:<br />
Hochwasser<br />
339 339 610 196 67.0<br />
227 227 362 158 60.5<br />
189 211 312 143 58.5<br />
174 205 300 129 52.5<br />
153 189 229 121 49.7<br />
146 174 215 112 48.3<br />
143 153 176 104 45.6<br />
133 146 174 98.3 44.2<br />
123 146 151 93.1 41.5<br />
96.0 98.0 117 75.6 32.8<br />
78.0 87.6 91.1 58.3 25.0<br />
58.0 66.1 81.2 48.0 20.9<br />
40.2 57.4 67.6 40.8 17.1<br />
31.5 39.5 54.1 30.4 12.2<br />
23.8 29.8 38.5 21.1 8.90<br />
18.3 21.6 31.5 15.6 6.24<br />
13.3 16.7 21.8 12.1 4.12<br />
10.2 12.7 17.3 9.81 2.39<br />
8.42 9.55 13.6 7.51 1.78<br />
7.50 8.26 12.6 6.41 1.58<br />
6.98 7.62 11.5 5.91 1.52<br />
6.26 7.08 11.1 5.41 1.29<br />
5.89 6.19 10.6 5.01 1.11<br />
5.45 5.72 10.1 4.61 1.00<br />
5.09 5.42 9.60 4.21 0.820<br />
4.68 4.99 9.10 3.81 0.820<br />
4.39 4.59 8.50 3.45 0.780<br />
4.07 4.32 8.30 3.01 0.710<br />
3.60 3.83 7.90 2.61 0.710<br />
3.35 3.43 7.50 2.21 0.630<br />
3.33 3.33 7.10 2.01 0.630<br />
3.10 3.10 6.80 1.82 0.440<br />
2.75 2.75 6.20 1.61 0.400<br />
2.05 2.05 6.20 1.31 0.260<br />
2.00 2.00 6.20 1.21 0.260<br />
1.80 1.80 6.20 1.11 0.260<br />
1.75 1.75 6.00 1.02 0.240<br />
1.70 1.70 6.00 0.950 0.240<br />
1.60 1.60 6.00 0.900 0.240<br />
1.50 1.50 6.00 0.810 0.240<br />
1.45 1.45 6.00 0.710 0.200<br />
1.40 1.40 5.80 0.630 0.200<br />
1.35 1.35 5.80 0.540 0.200<br />
1.30 1.30 5.60 0.140 0.140<br />
BfG Koblenz
Aufgabe 5.2 (4 Punkte):<br />
In den folgenden Abbildungen ist eine Abflussganglinie und Abflusskurve gegeben. Wie viele Tage<br />
muss die Schifffahrt unterbrochen werden, wenn der minimale Wasserstand 3 m und der maximale 6 m<br />
beträgt? Kennzeichnen Sie die Zeiten, in denen die Schifffahrt unterbrochen werden muss, in der<br />
Abbildung!<br />
450<br />
Wegen<br />
Hochwassers ist<br />
die Schifffahrt an<br />
31 Tagen pro Jahr<br />
nicht möglich<br />
150<br />
15d<br />
Wegen zu geringen<br />
Wasserstands<br />
(Niedrigwasser)<br />
ist die Schifffahrt an<br />
35+15 = 50 Tagen<br />
pro Jahr nicht<br />
möglich!<br />
Abflussganglinie<br />
35 d 31 d<br />
Unterbrechung Schifffahrt wegen …<br />
Niedrigwasser Hochwasser<br />
danach HIER oben<br />
in Abfluss-Ganglinie Abschnitte<br />
der Unter- bzw. Überschreitung<br />
dieser zulässigen Min- / Max-<br />
Abflüsse markieren und Zeiten<br />
ablesen!<br />
zuerst HIER<br />
unten<br />
Zulässige Abflüsse aus<br />
den zulässigen Niedrigund<br />
Hochwasserständen<br />
bestimmen!<br />
Abflusskurve