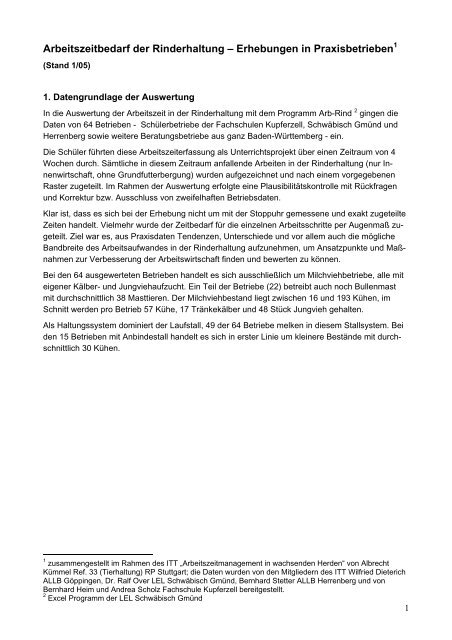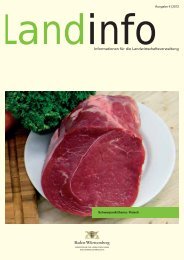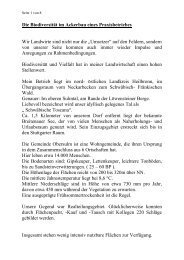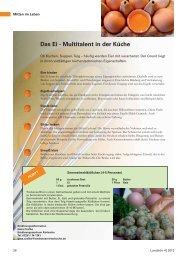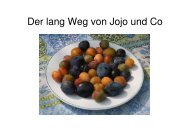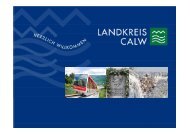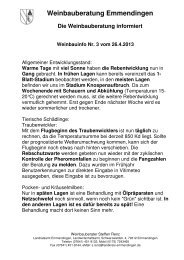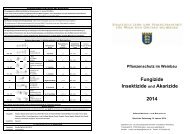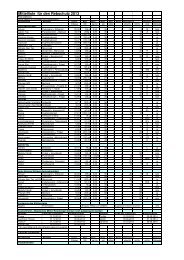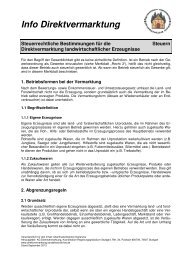Arbeitszeitbedarf der Rinderhaltung – Erhebungen in Praxisbetrieben
Arbeitszeitbedarf der Rinderhaltung – Erhebungen in Praxisbetrieben
Arbeitszeitbedarf der Rinderhaltung – Erhebungen in Praxisbetrieben
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung <strong>–</strong> <strong>Erhebungen</strong> <strong>in</strong> <strong>Praxisbetrieben</strong> 1<br />
(Stand 1/05)<br />
1. Datengrundlage <strong>der</strong> Auswertung<br />
In die Auswertung <strong>der</strong> Arbeitszeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung mit dem Programm Arb-R<strong>in</strong>d 2 g<strong>in</strong>gen die<br />
Daten von 64 Betrieben - Schülerbetriebe <strong>der</strong> Fachschulen Kupferzell, Schwäbisch Gmünd und<br />
Herrenberg sowie weitere Beratungsbetriebe aus ganz Baden-Württemberg - e<strong>in</strong>.<br />
Die Schüler führten diese Arbeitszeiterfassung als Unterrichtsprojekt über e<strong>in</strong>en Zeitraum von 4<br />
Wochen durch. Sämtliche <strong>in</strong> diesem Zeitraum anfallende Arbeiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung (nur Innenwirtschaft,<br />
ohne Grundfutterbergung) wurden aufgezeichnet und nach e<strong>in</strong>em vorgegebenen<br />
Raster zugeteilt. Im Rahmen <strong>der</strong> Auswertung erfolgte e<strong>in</strong>e Plausibilitätskontrolle mit Rückfragen<br />
und Korrektur bzw. Ausschluss von zweifelhaften Betriebsdaten.<br />
Klar ist, dass es sich bei <strong>der</strong> Erhebung nicht um mit <strong>der</strong> Stoppuhr gemessene und exakt zugeteilte<br />
Zeiten handelt. Vielmehr wurde <strong>der</strong> Zeitbedarf für die e<strong>in</strong>zelnen Arbeitsschritte per Augenmaß zugeteilt.<br />
Ziel war es, aus Praxisdaten Tendenzen, Unterschiede und vor allem auch die mögliche<br />
Bandbreite des Arbeitsaufwandes <strong>in</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung aufzunehmen, um Ansatzpunkte und Maßnahmen<br />
zur Verbesserung <strong>der</strong> Arbeitswirtschaft f<strong>in</strong>den und bewerten zu können.<br />
Bei den 64 ausgewerteten Betrieben handelt es sich ausschließlich um Milchviehbetriebe, alle mit<br />
eigener Kälber- und Jungviehaufzucht. E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Betriebe (22) betreibt auch noch Bullenmast<br />
mit durchschnittlich 38 Masttieren. Der Milchviehbestand liegt zwischen 16 und 193 Kühen, im<br />
Schnitt werden pro Betrieb 57 Kühe, 17 Tränkekälber und 48 Stück Jungvieh gehalten.<br />
Als Haltungssystem dom<strong>in</strong>iert <strong>der</strong> Laufstall, 49 <strong>der</strong> 64 Betriebe melken <strong>in</strong> diesem Stallsystem. Bei<br />
den 15 Betrieben mit Anb<strong>in</strong>destall handelt es sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um kle<strong>in</strong>ere Bestände mit durchschnittlich<br />
30 Kühen.<br />
1 zusammengestellt im Rahmen des ITT „Arbeitszeitmanagement <strong>in</strong> wachsenden Herden“ von Albrecht<br />
Kümmel Ref. 33 (Tierhaltung) RP Stuttgart; die Daten wurden von den Mitglie<strong>der</strong>n des ITT Wilfried Dieterich<br />
ALLB Göpp<strong>in</strong>gen, Dr. Ralf Over LEL Schwäbisch Gmünd, Bernhard Stetter ALLB Herrenberg und von<br />
Bernhard Heim und Andrea Scholz Fachschule Kupferzell bereitgestellt.<br />
2 Excel Programm <strong>der</strong> LEL Schwäbisch Gmünd<br />
1
2. Arbeitswirtschaft im Überblick aller Betriebe: Milchvieh, Kälber, Jungvieh, Bullen<br />
Der durchschnittliche jährliche <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> je Bestandstier (Tab. 1) ist erwartungsgemäß bei<br />
den Milchkühen mit 49 Stunden am höchsten. Für die Kälberaufzucht (anteiliges Tränkekalb je<br />
Kuh) liegt <strong>der</strong> Zeitaufwand im Schnitt bei 8 Stunden. Die Jungviehaufzucht bzw. Bullenmast benötigt<br />
im Jahr 9 bzw. 11 Stunden je Stallplatz.<br />
Beim Milchvieh liegt <strong>der</strong> Arbeitsschwerpunkt mit 61 % beim Melken; bei <strong>der</strong> Kälber- und Jungviehaufzucht<br />
schlägt die Fütterung mit etwa 70 % des Arbeitsbedarfs am stärksten zu Buche. Die<br />
Mastbullen benötigen sogar 80 % <strong>der</strong> Arbeitszeit für Fütterung, da durch die überwiegende Haltung<br />
auf Vollspalten alle an<strong>der</strong>en Arbeiten nur ger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>s Gewicht fallen.<br />
Tabelle 1: Jährlicher <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> im Durchschnitt <strong>der</strong> Betriebe<br />
Arbeitsbereich Ø 80 % liegen zwischen 2)<br />
Stunden Anteil % Std. m<strong>in</strong>. Std. max.<br />
Milchvieh gesamt (60 Betriebe) je Kuh/Jahr 1) 49 30 70<br />
• davon Melken (<strong>in</strong>kl. Vor- und Nacharbeiten) 30 61% 19 40<br />
• davon Fütterung, Grund- und Kraftfutter 11 23% 4 21<br />
• davon sonstige Arbeiten 8 16% 3 15<br />
Tränkekälber gesamt (64 Betriebe) je Kuh/Jahr 8 4 14<br />
• davon Tränken, Fütterung 6 69% 2 10<br />
• davon Misten, E<strong>in</strong>streuen 2 20%
setzungen. Der zweite Betrieb ist e<strong>in</strong>e Kooperation mit ebenfalls ungünstigen baulichen<br />
Voraussetzungen.<br />
Grafik 1: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> Abhängigkeit von Bestandsgröße und Stalltyp<br />
90<br />
<strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Milchvieh <strong>in</strong> Abhängigkeit von Bestandsgröße und Stalltyp<br />
(Milchvieh o. Jungvieh; 15 Anb<strong>in</strong>de- und 49 Laufstallbetriebe, davon 4 mit Roboter)<br />
80<br />
Stunden Laufstall<br />
AKh je Kuh und Jahr<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Ausreißer<br />
Trend<br />
Stunden Anb<strong>in</strong>destall<br />
Stunden Roboter<br />
10<br />
0<br />
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190<br />
Bestandsgröße (Kuhzahl)<br />
E<strong>in</strong>deutig ist jedoch auch, dass die Arbeitszeitdegression bei steigenden Bestandsgrößen e<strong>in</strong>e<br />
abnehmende Tendenz hat und die Trendkurve ab ca. 70-80 Kühen deutlich abflacht. E<strong>in</strong>zelbetriebe<br />
zeigen, das Größe alle<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong> Garant für hohe Arbeitseffizienz ist. Bei ca. 30 Akh/Kuh u.<br />
Jahr sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Untergrenze, zum<strong>in</strong>dest für Betriebe mit Gruppenmelkständen, erreicht zu se<strong>in</strong>.<br />
Neben dem Effekt <strong>der</strong> Größe ist die Streuung zu beachten: Bei gleicher Bestandsgröße und gleichem<br />
Stalltyp beträgt die Bandbreite <strong>der</strong> Werte gut 20 Stunden je Kuh, hier liegen <strong>in</strong> den Betrieben<br />
offensichtlich große Reserven e<strong>in</strong>er arbeitswirtschaftlichen Verbesserung.<br />
Bei <strong>der</strong> unterschiedlichen Bestandsgröße ist <strong>der</strong> direkte Vergleich zwischen Anb<strong>in</strong>de- und Laufstall<br />
nicht s<strong>in</strong>nvoll. Klar zu sehen ist jedoch, dass v. a. kle<strong>in</strong>ere Laufställe ke<strong>in</strong>e wesentlich höhere<br />
Arbeitseffizienz wie gut organisierte Anb<strong>in</strong>deställe haben.<br />
Tabelle 2: Arbeitszeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Milchviehhaltung im Anb<strong>in</strong>de- und Laufstall<br />
Kuhzahl Stück Std./Kuh/Jahr<br />
Stallsystem (Anzahl Betriebe) Ø (m<strong>in</strong>-max) Ø (80% m<strong>in</strong>-max)<br />
Anb<strong>in</strong>deställe (16) 31 (15-60) 64 (54-82)<br />
Laufställe konv. (45) 63 (25-193) 43 (29-63)<br />
Laufställe Roboter (4) 93 (74-110) 16 (14-16)<br />
Insgesamt gesehen (Tab. 2) ist <strong>der</strong> Unterschied im <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> zwischen Anb<strong>in</strong>de- und Laufstall<br />
mit im Durchschnitt 20 Stunden je Kuh und Jahr enorm, wobei hier Größen- und Systemeffekte<br />
zusammenkommen. Die Betriebe mit Roboter benötigen nur sehr wenig Zeit je Kuh. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
handelt es sich um 4 ausgesuchte Betriebe mit sehr guter Betriebsführung.<br />
3
3.2. Melkarbeit<br />
Das Melken hat mit ca. 60 % den höchsten Anteil am Arbeitsanfall beim Milchvieh (s. Tab. 1). Wie<br />
zu erwarten, benötigen die kle<strong>in</strong>eren Betriebe im Anb<strong>in</strong>destall (Tabelle 3, Grafik 2) je Kuh durchschnittlich<br />
11 h länger als die Laufställe mit Melkstand. Bei den Laufställen ist die Schwankungsbreite<br />
zwischen M<strong>in</strong>imal- und Maximalwerten jedoch sehr hoch.<br />
Tabelle 3: Zeitaufwand für die Melkarbeit (AKh / Kuh / Jahr)<br />
Stallsystem nur Melken<br />
Vor-,<br />
Nacharbeiten Summe<br />
Anteil Rüstzeiten<br />
<strong>in</strong> %<br />
Ø 15 Anb<strong>in</strong>deställe 31 7 38 18%<br />
Ø 45 Laufställe o. Roboter 22 4 27 17%<br />
80% M<strong>in</strong>.-Max. 15 - 30 2 - 7 19 - 37<br />
Ø 4 Laufställe m. Roboter 5,4<br />
Lässt man die Extreme außen vor, so schwankt <strong>der</strong> Zeitaufwand für die Melkarbeit je Kuh und Jahr<br />
zwischen ca. 19 und 37 Stunden. Bei e<strong>in</strong>em Betrieb mit 60 Kühen entsprechen diese knapp 20<br />
Stunden Differenz je Kuh etwa ½ AK, e<strong>in</strong> beachtliches Potential für Effizienzsteigerungen. Die<br />
Bestandsgröße alle<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t bei den ausgewerteten <strong>Praxisbetrieben</strong> nicht den großen E<strong>in</strong>fluss auf<br />
den Akh-Bedarf je Kuh für den Bereich Melken zu haben (Grafik 2). Effizientes Melken f<strong>in</strong>det sich<br />
<strong>in</strong> größeren und kle<strong>in</strong>eren Beständen.<br />
Grafik 2: Bestandsgröße, Stalltyp und Akh-Bedarf für den Bereich Melken<br />
AKh je Kuh und Jahr<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Melkzeit, Stalltyp und Bestandsgröße<br />
(AKh für Vorbereitung, Melken und Re<strong>in</strong>igung)<br />
Ausreißer<br />
Roboter<br />
Summe Melken Laufstall<br />
Summe Melken Anb<strong>in</strong>destall<br />
0 50 100 150 200<br />
Bestandsgröße (Kuhzahl)<br />
Der Zeitaufwand (AKh/Kuh/Jahr) für das Melken hängt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis von vielen Faktoren ab:<br />
• baulich-technische Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en effektiven Melkablauf (Vor-, Nachwartebereiche,<br />
Treibhilfe / Treibwege, Ausstattung und mögliche Durchsatzleistung Melkstand)<br />
• Melkrout<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit technischer Zusatzausrüstung<br />
• momentaner Eutergesundheitsstatus <strong>der</strong> Herde, Anzahl <strong>der</strong> Problemtiere und Sauberkeit<br />
<strong>der</strong> Euter, Langmelker im Bestand<br />
• Abstimmung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Melkpersonen auf die Melkstandgröße (Melkplätze)<br />
4
In Grafik 3 wird <strong>der</strong> Unterschied zwischen Durchsatzleistung (Kühe/Std.) und Arbeitsleistung (notw.<br />
Akh/Kuh) deutlich. Größere Melkstände schaffen zwar mehr Kühe/Std., aber die Arbeitsleistung<br />
unterscheidet sich nicht gravierend (z.B. Melkstände 2*4 2*5 2*6 <strong>in</strong> Grafik 3).<br />
Grafik 3: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Melken <strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Anzahl Melkplätze<br />
45<br />
<strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Melken <strong>in</strong> Laufställen und Anzahl <strong>der</strong><br />
Melkplätze<br />
(ohne Vorbereitungs- und Re<strong>in</strong>igungsarbeiten)<br />
40<br />
AKh je Kuh und Jahr<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
4 8 12 16 20 24<br />
Melkplätze im Melkstand<br />
E<strong>in</strong> wichtiger Faktor für e<strong>in</strong>e hohe Arbeitsleistung ist die Abstimmung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Melkpersonen<br />
auf die Melkstandkapazität. Dies lässt sich auch deutlich mit den Praxisdaten zeigen, wenn man<br />
die Arbeitsleistung <strong>in</strong> den Laufstallbetrieben wie <strong>in</strong> Grafik 4 nach den Melke<strong>in</strong>heiten je 1,0 Melk-AK<br />
gruppiert.<br />
Grafik 4: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Melken <strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Anzahl Melkzeuge je Melkperson<br />
28<br />
26<br />
Arbeitseffizienz beim Melken <strong>in</strong> den Laufstallbetrieben<br />
Melkzeit (ohne Vorber./Re<strong>in</strong>igung) und Zahl <strong>der</strong> Melkzeuge je Melkperson<br />
16<br />
14<br />
AKh je Kuh und Jahr<br />
24<br />
22<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
26<br />
Betriebe<br />
15<br />
Betriebe<br />
6<br />
Betriebe<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
durchschn. Anzahl <strong>der</strong><br />
Melkplätze<br />
10<br />
7 und =10 MZ je MP<br />
Melkzeuge (MZ) je Melkperson (MP)<br />
0<br />
Melkzeit<br />
Zahl <strong>der</strong> Melkplätze<br />
5
Die theoretisch mögliche Arbeitsleistung e<strong>in</strong>es Melkers (x Melkzeuge/Melk-AK) lässt sich <strong>in</strong> den<br />
<strong>Praxisbetrieben</strong> meist nicht erreichen (siehe Grafik 4). Nur <strong>in</strong> 6 Betrieben bedient e<strong>in</strong>e (1,0) AK<br />
beim Melken 10 o<strong>der</strong> mehr Melkzeuge. Bei <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> Laufstallbetriebe (26) s<strong>in</strong>d es weniger<br />
als 7 Melkzeuge je Melkperson, d. h. <strong>in</strong> vielen <strong>der</strong> 2*4-6 Melkstände s<strong>in</strong>d >1,0 bis zu 2,0 AK<br />
beschäftigt. Die zweite Person ist zum<strong>in</strong>dest teilweise beim Melken zugegen, übernimmt Rout<strong>in</strong>earbeiten,<br />
hilft bei Problemtieren, holt Kühe aus den Boxen und besorgt das Nachtreiben etc.<br />
Die Mehrzahl <strong>der</strong> Betriebe realisiert 4-7 Umtriebe je Melkplatz und Melkzeit, allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d auch<br />
e<strong>in</strong>ige Melkstände für den (jetzigen) Bestand überdimensioniert, an<strong>der</strong>e werden nach<br />
Bestandsaufstockungen sehr <strong>in</strong>tensiv mit über 10 Umtrieben je Melkzeit genutzt.<br />
Von den ausgewerteten Laufstallbetrieben nutzen 9 Betriebe e<strong>in</strong>en Warteraum (ohne Darstellung).<br />
Sie benötigen für das Melken <strong>in</strong>kl. Nebenarbeiten im Schnitt 3 Stunden weniger als <strong>der</strong> Durchschnitt.<br />
Bei <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Zahl an Betrieben und <strong>der</strong> großen Streuung kann diese Zahl nur als Tendenz<br />
gewertet werden. In <strong>der</strong> Literatur wird e<strong>in</strong>e Effizienzsteigerung von 10-15% durch geeignete<br />
Wartebereiche angegeben.<br />
Ob die Melkstände mit o<strong>der</strong> ohne Zusatztechnik wie Abnahmeautomatik, Stimulation etc. ausgestattet<br />
waren, zeigte bei den Praxisdaten ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die durchschnittliche Melkzeit.<br />
An<strong>der</strong>erseits ist ohne diese technischen Hilfsmittel e<strong>in</strong>e effiziente Melkarbeit bei hoher Arbeitsqualität<br />
kaum umzusetzen, da <strong>der</strong> Melker ab e<strong>in</strong>em bestimmten Durchsatz nicht mehr alle notwendigen<br />
Rout<strong>in</strong>earbeiten ordnungsgemäß ausführen kann.<br />
Fazit zum Bereich Melken: Die Effizienz im Praxisbetrieb hängt von vielen verschiedenen Faktoren<br />
ab. Wenn die Anzahl <strong>der</strong> Melkpersonen, die technische Ausstattung, die Größe des Melkstandes<br />
und dessen E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> den Kuhverkehr sowie e<strong>in</strong>e effiziente Melkrout<strong>in</strong>e mit <strong>der</strong> klaren Zielvorgabe<br />
„Arbeitseffizienz“ verknüpft werden, dann steckt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Melkarbeit die mit Abstand größte<br />
„Arbeitsreserve“ im Milchviehbetrieb. Die effizientesten Betriebe zeigen, dass die Zielwerte für die<br />
Melkarbeit (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Auswertung nur Melkstände, Roboter) erreichbar s<strong>in</strong>d.<br />
Zielgrößen: Melkstand<br />
Karussell<br />
Roboter<br />
15 h / Kuh u. Jahr<br />
10 h / Kuh u. Jahr<br />
6 h / Kuh u. Jahr<br />
6
3.3. Fütterung und sonstige Arbeiten Milchvieh<br />
Fütterung<br />
Die Fütterung nimmt laut Tabelle 1 im Schnitt 23 % <strong>der</strong> Arbeitszeit beim Milchvieh <strong>in</strong> Anspruch, <strong>der</strong><br />
größte Teil davon fällt auf Grundfuttervorlage (Tab. 4). Die Betriebe <strong>in</strong> Anb<strong>in</strong>deställen benötigen<br />
aufgrund <strong>der</strong> ungünstigeren baulichen Voraussetzungen und <strong>der</strong> kle<strong>in</strong>eren Bestände die doppelte<br />
Zeit zum Füttern wie die Laufstallbetriebe.<br />
Tabelle 4: Zeitaufwand für Fütterung Milchvieh (AKh / Kuh / Jahr)<br />
Anzahl<br />
Betriebe<br />
Ø Anzahl<br />
Milchkühe<br />
Fütterung<br />
Grundfutter<br />
Zwischen den Futtervorlagesystemen im Laufstall zeigen sich gewisse Unterschiede, die Handvorlage<br />
<strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit dem Blockschnei<strong>der</strong> benötigt zusätzlich gut 3 h je Kuh und Jahr<br />
(Tabelle 4). Allerd<strong>in</strong>gs ist e<strong>in</strong> deutlicher E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Bestandsgröße zu beachten (siehe Grafik 5),<br />
da <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die größeren Betriebe Futterverteil- o<strong>der</strong> Mischwagen e<strong>in</strong>setzen. Berücksichtigt<br />
man die Bestandsgrößenunterschiede, so gibt es offensichtlich auch ke<strong>in</strong>e gravierenden Arbeitszeitdifferenzen<br />
zwischen <strong>der</strong> Futtervorlage mit Futtermisch- o<strong>der</strong> Verteilwagen.<br />
Grafik 5: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Fütterung <strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Bestandsgröße<br />
Fütterung<br />
Kraft- u.<br />
M<strong>in</strong>eralf.<br />
Summe<br />
Futter<br />
Ø Alle Anb<strong>in</strong>deställe 15 31 13,0 4,4 17,4<br />
Ø Alle Laufställe 49 66 7,7 0,9 8,6<br />
Laufställe 80% M<strong>in</strong>.-Max. 25 - 193 3 - 13
Sonstige Arbeiten Milchvieh<br />
Die sonstigen Arbeiten s<strong>in</strong>d als E<strong>in</strong>zelposten relativ kle<strong>in</strong> und unterscheiden sich auch kaum zwischen<br />
den verschiedenen Betriebstypen. Daher werden aufgrund <strong>der</strong> Datengrundlage nur die Mittelwerte<br />
dargestellt.<br />
Sonstige Arbeiten <strong>in</strong> AKh je Kuh und Jahr<br />
alle Betriebe Laufställe<br />
• Misten, E<strong>in</strong>streuen, Boxenpflege 3,8 3,5<br />
• Geburtshilfe, Geburtskontrolle 0,7 0,6<br />
• Medikamente, Behandlung, Besamung 0,7 0,8<br />
• Klauenpflege 1,0 0,8<br />
• Reparaturen, E<strong>in</strong>stallen, E<strong>in</strong>- u. Verkauf Tiere 0,6 0,6<br />
• Kuhplaner führen, Transpon<strong>der</strong> 0,5 0,6<br />
• Sonstiges 0,6 0,6<br />
• Summe sonst. Arbeiten 7,8 7,4<br />
• 80% m<strong>in</strong>. - max. 4 - 15 4 - 13<br />
4. Kälberaufzucht<br />
Die Erfassung von Arbeitszeiten für die Kälberaufzucht (Geburt - Absetzen) ist im Vergleich zur<br />
Milchviehhaltung mit größeren Unsicherheiten behaftet, da die Abgrenzung Tränkeperiode Kälberaufzucht<br />
Jungviehaufzucht schwierig ist und von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich gehandhabt<br />
wird. Zudem kann die e<strong>in</strong>zelbetriebliche Situation bei <strong>der</strong> i. d. R. 4-wöchigen Datenerfassungsperiode<br />
das Ergebnis relativ stark bee<strong>in</strong>flussen (viel wenig Tränkekälber). Die Varianz<br />
zwischen den Betrieben (Tab. 1; Grafik 6) wird daher sicher zum Teil auch auf methodische<br />
Schwierigkeiten zurückzuführen se<strong>in</strong>. Klar zu erkennen ist jedoch <strong>der</strong> Effekt <strong>der</strong> Bestandsgröße<br />
auf den <strong>Arbeitszeitbedarf</strong>.<br />
Grafik 6: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kälberaufzucht (Tränkeperiode)<br />
Arbeitszeit Kälberaufzucht (Tränkeperiode)<br />
(kalkulierter Wert bei 50/70/90 Tränketagen)<br />
AKh je aufgezogenes Kalb<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Tränkeautomat (kalk.)<br />
Eimertränke (kalk.)<br />
Trend<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Durchschnittsbestand <strong>in</strong> Stück<br />
8
Tränkesystem<br />
Der Großteil <strong>der</strong> Arbeit während <strong>der</strong> Tränkezeit steckt mit fast 70 % im Bereich Tränken / Füttern.<br />
Hier müssen Ansatzpunkte für e<strong>in</strong>e effiziente Arbeitserledigung gesucht werden.<br />
Oft wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Tränkeautomat als Möglichkeit zur Arbeitszeite<strong>in</strong>sparung e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Grafik 7 vergleicht die 16 Betriebe mit Tränkeautomat mit den übrigen Betrieben.<br />
Grafik 7: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kälberaufzucht (Tränkeperiode) <strong>in</strong> Abhängigkeit vom Tränkesystem<br />
AKh je aufgezogenes Tier<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Bestand 16 Kälber<br />
Alle Betriebe<br />
(64)<br />
Arbeitszeitaufwand <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kälberaufzucht (Tränkekälber)<br />
durchschnittlicher AKh Aufwand bei verschiedenen Tränkesystemen<br />
(mit/ohne Tränkeautomat, unterschiedliche Tränkedauer)<br />
Bestand 18 Kä.<br />
Mit<br />
Tränkeautomat<br />
(16)<br />
Bestand 18 Kälber<br />
ke<strong>in</strong><br />
Tränkeautomat<br />
Bestandsgröße<br />
wie TA (35)<br />
Bestand 13 Kälber<br />
Bestand 16 Kälber<br />
Bestand 12 Kälber<br />
ke<strong>in</strong> TA 12 Wo<br />
Tränkedauer (8) Tränkedauer<br />
(34)<br />
Tränkedauer (5)<br />
Sonstiges: Behandl.,<br />
E<strong>in</strong>stallen, E<strong>in</strong>- u.<br />
Verkauf, Kennzeichn.<br />
Misten, E<strong>in</strong>streuen<br />
Tränken und Füttern<br />
Die Automaten-Betriebe s<strong>in</strong>d im Schnitt größer und ihr Kälberbestand liegt bei durchschnittlich 18<br />
Tränkekälbern. Vergleicht man sie mit den durchschnittlich gleich großen Betrieben ohne Tränkeautomat,<br />
so benötigen sie im Schnitt gut 1,0 Akh je Kalb weniger an Zeit für das Tränken und Füttern<br />
als die Betriebe ohne Tränkeautomat. Diese Differenz erreicht nicht ganz Angaben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur,<br />
wo je nach Gruppengröße bzw. Tränkedauer als E<strong>in</strong>sparpotential 1,5 - 2,5 Stunden je aufgezogenem<br />
Kalb angegeben werden.<br />
Bei den Betrieben ohne Tränkeautomat mit unterschiedlich langer Tränkedauer zeigt sich e<strong>in</strong>e<br />
Tendenz zu ger<strong>in</strong>gerem Zeitbedarf für Tränken/Füttern bei verkürzter Tränkezeit.<br />
Fazit Kälberaufzucht: Die e<strong>in</strong>zelbetrieblichen Differenzen liegen vor allem bei kle<strong>in</strong>eren Betrieben<br />
bei etwa 4 - 6 Stunden je aufgezogenem Kalb. Dies zeigt e<strong>in</strong> gewisses Potential an möglichen Verbesserungen<br />
<strong>der</strong> Arbeitswirtschaft. Dem Bereich Tränken / Füttern muss hier die größte Aufmerksamkeit<br />
gewidmet werden, da er etwa 70 % <strong>der</strong> Gesamtzeit erfor<strong>der</strong>t. Daneben spielt nur noch das<br />
Misten / E<strong>in</strong>streuen e<strong>in</strong>e gewisse Rolle. Die weiteren Arbeiten s<strong>in</strong>d für sich gesehen notwendig und<br />
bieten im E<strong>in</strong>zelnen weniger Ansatzpunkte für Arbeitszeite<strong>in</strong>sparungen.<br />
9
5. Jungviehaufzucht<br />
Je Jungviehplatz werden im Schnitt knapp 9 Stunden pro Jahr benötigt. Mit durchschnittlich 70 %<br />
hat die Fütterung den mit Abstand größten Anteil. In e<strong>in</strong>zelnen kle<strong>in</strong>en <strong>Praxisbetrieben</strong> werden<br />
aber auch für das Misten / E<strong>in</strong>streuen alle<strong>in</strong> fast 10 Stunden e<strong>in</strong>gesetzt.<br />
Tabelle 5: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Jungviehaufzucht (Akh je Bestandstier u. Jahr)<br />
Jungvieh<br />
davon Stunden für<br />
Betriebstyp (Anzahl)<br />
Anzahl<br />
Tiere<br />
Stunden<br />
gesamt<br />
Fütterung<br />
Grundf.<br />
Fütterung<br />
Kraftfutter<br />
Summe<br />
Füttern<br />
Misten,<br />
E<strong>in</strong>str.<br />
Sonstiges<br />
alle Betriebe (64) 48 8,9 5,1 1,0 6,1 2,0 0,8<br />
Laufstallbetriebe (49) 53 7,8 4,4 0,8 5,2 1,8 0,8<br />
80 % M<strong>in</strong>. - Max. 4- 13 2 - 7
6. Mastbullen<br />
Wie beim Jungvieh ist bei den Mastbullen die Fütterung mit etwa 80 % wichtigster Arbeitsfaktor.<br />
Das Misten / E<strong>in</strong>streuen hat noch weniger Bedeutung als beim Jungvieh, da die Mastbullen <strong>in</strong> aller<br />
Regel auf Vollspalten gehalten werden.<br />
Tabelle 7: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bullenmast (Akh je Bestandstier u. Jahr)<br />
davon Stunden für ..<br />
Betriebstyp<br />
(Anzahl)<br />
Stunden<br />
gesamt<br />
Fütterung<br />
Grundfutter<br />
Fütterung<br />
Kraftfutter<br />
Summe<br />
Füttern<br />
Misten,<br />
E<strong>in</strong>streuen Sonstiges<br />
Durchschnitt (22) 10,8 6,3 2,3 8,6 1 1,2<br />
80 % M<strong>in</strong>. - Max. 4-16 2-10
7. Allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung<br />
In Tabelle 8 werden allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten aufgeführt. Nicht enthalten, da im Rahmen <strong>der</strong> Auswertung<br />
nicht erfasst, ist die Gülle-/Festmistausbr<strong>in</strong>gung.<br />
Die Varianz <strong>der</strong> erfassten allgeme<strong>in</strong>en Arbeiten ist von Betrieb zu Betrieb sehr hoch, aufgrund <strong>der</strong><br />
schwierigen Zuordnung und des unregelmäßigen Anfalles dürften hier aber die Fehler <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Datenerfassung relativ groß se<strong>in</strong>. Im Schnitt fallen je Betrieb 210 Stunden im Jahr o<strong>der</strong> 4 Stunden<br />
je Woche an, davon gut 1 Stunde für allgeme<strong>in</strong>e tierhaltungsbezogene Managementaufgaben.<br />
Ausgehend vom Durchschnitt dürfte dieser Umfang für e<strong>in</strong>e geregelte Betriebsführung auch m<strong>in</strong>destens<br />
notwendig se<strong>in</strong>. Legt man diese allgeme<strong>in</strong>en Arbeiten bei den Laufstallbetrieben auf die<br />
Kuhzahl um, so fallen je Platz im Durchschnitt 3,5 Std. an.<br />
Tab. 8: Durchschnittlich für allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten benötigte Stunden<br />
Betriebe <strong>in</strong>sgesamt<br />
AKh je Betrieb<br />
Laufstallbetriebe (47)<br />
AKh je Kuhplatz<br />
Summe Allgem. Arbeiten 209 3,5<br />
80% M<strong>in</strong>. - Max. 86 - 374 1,3 - 5,6<br />
• davon Silo abdecken 47 0,8<br />
• davon Futtere<strong>in</strong>kauf 39 0,6<br />
• davon Stallre<strong>in</strong>igung 31 0,5<br />
• davon Management 72 1,2<br />
• davon Sonstiges 22 0,3<br />
12
8. Zielgrößen <strong>der</strong> Arbeitswirtschaft und Möglichkeiten zur Optimierung<br />
Ausgehend von den Betriebdaten werden Zielgrößen für die Laufstallbetriebe <strong>der</strong> Auswertung formuliert<br />
und <strong>in</strong> Stichworten Maßnahmen zur Umsetzung e<strong>in</strong>er arbeitswirtschaftlich günstigen<br />
Betriebsorganisation aufgeführt.<br />
Neben den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tabelle genannten Details gelten natürlich die übergeordneten Elemente e<strong>in</strong>er<br />
effizienten Arbeitsorganisation: e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle Arbeitsplanung, Absprachen, feste Zuständigkeiten<br />
etc. Dasselbe trifft für vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung <strong>der</strong> Tiergesundheit zu, die aufwendige<br />
Son<strong>der</strong>behandlungen ersparen.<br />
Maßnahmen / Effekt / Zielgröße<br />
Anmerkungen<br />
Milchviehhaltung ohne Futterbau (Gruppenmelkstand, 50 - 100 Kühe) => 30 - 35 Std. / Kuh/ Jahr<br />
davon Melken => 15-20 h je Kuh / Jahr<br />
Melkablauf<br />
Melkstandgröße an Herdengröße angepasst;<br />
2*5-8; Ziel 1 Melkperson<br />
E<strong>in</strong>halten e<strong>in</strong>er festen Melkrout<strong>in</strong>e (Gruppenweise),<br />
ausreichende Stimulation<br />
bis 2*6/8 1 Melkperson, 2. Person nur für Kannenkühe /<br />
Problemtiere („Fresh Cow-group“ u.ä.), diese mögl. sep.<br />
wichtig für rationelles Arbeiten bei guter Melkarbeit<br />
zentrale Ablage <strong>in</strong> <strong>der</strong> Melkgrube für Zubehör<br />
saubere Euter durch Boxenhygiene und -pflege<br />
ggf. automatische Stimulation / Abnahmeautomatik<br />
/ Nachmelkautomatik<br />
Zeitaufwand für Euterre<strong>in</strong>igung 5 - > 30 sec/Kuh!!<br />
Kosten: Stimulation ca. 200-400 € , Abnahmeautomatik<br />
ca. 600 € , Nachmelk- und Abnahmeautomatik ca. 1200 -<br />
1300 € je Melkplatz<br />
E<strong>in</strong>- und Austreiben; Gruppenwechsel<br />
Vorwartebereich (E<strong>in</strong>sparung 10-15 % o<strong>der</strong> 2-3<br />
h/Kuh/J.)<br />
optimierter E<strong>in</strong>- und Austrieb, Nachwartebereich<br />
Nachtreibehilfe <strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit Warteraum,<br />
vorzugsweise mechanisch<br />
Warteraum m<strong>in</strong>d. 1,5 m² je Kuh (<strong>der</strong> Melkgruppe); im<br />
Altgebäude Zwischenabsperrung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Boxengasse<br />
gera<strong>der</strong> heller Austrieb, ggf. Nachwartebereich; Tränke,<br />
aber nicht direkt h<strong>in</strong>ter dem Ausgang<br />
elektr. Kuhtreiber zwar umstritten, werden aber <strong>in</strong> <strong>Praxisbetrieben</strong><br />
v.a. <strong>in</strong> Boxengassen mit Erfolg e<strong>in</strong>gesetzt<br />
heller Melkstand, rutschsicherer Boden<br />
Son<strong>der</strong>gruppe f. Kannenkühe, Problemtiere<br />
Schnellaustrieb (FGM)<br />
erst bei größeren Beständen<br />
erst bei größeren Melkständen ab 2x8<br />
davon Fütterung => 5 h / Kuh / Jahr<br />
e<strong>in</strong>fache Rationen (Zahl und Komponenten) im<br />
Misch-/ Verteilwagen + Transpon<strong>der</strong><br />
z.B. aufgew. Ration für Laktierende, Jungvieh (< 1 J.) +<br />
2. Ration für Trockensteher / Färsen > 1 Jahr<br />
mechanisierte und e<strong>in</strong>fache Komponentenbeschickung<br />
Nachschieben mechanisiert<br />
ggf. überbetriebliche Fütterung<br />
13
Maßnahmen / Effekt / Zielgröße<br />
Anmerkungen<br />
davon sonstige Arbeiten Milchvieh => 4 - 7 h / Kuh / Jahr<br />
allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten => 3 - 5 h / Kuh / Jahr<br />
soweit möglich festes Schema für Rout<strong>in</strong>earbeiten<br />
Trockenstellen, Klauenschneiden, TU, HIT Meldungen,<br />
Silopflege, Futtere<strong>in</strong>kauf, .....<br />
E<strong>in</strong>streuvorrat im Kopfbereich <strong>der</strong> Liegeboxen<br />
mech. Boxen- und Laufgangpflege / E<strong>in</strong>streuen<br />
Striktes Fruchtbarkeitsmanagement, ggf.<br />
Pedometer<br />
Selektionsmöglichkeit nach dem Melkstand,<br />
ggf. mit Klauenpflegestand<br />
Bestandsbetreuung<br />
Für Rout<strong>in</strong>earbeiten (TU, KB u.ä.) und Tierkontrolle<br />
(Klauen usw.)<br />
feste Term<strong>in</strong>e für Vertreter- und sonstige<br />
Besuche<br />
Maßnahmen / Effekt / Zielgröße<br />
Anmerkungen<br />
Kälberaufzucht => 3 - 4 h je aufgezogenes Tränkekalb<br />
Tränkeautomat; E<strong>in</strong>sparung 1,0 - 2,0 h je aufgezogenes<br />
Kalb<br />
Frühentwöhnung, Eimertränke<br />
Kosten ca. 6-8000 €, lohnt nur bei entsprechen<strong>der</strong> Auslastung<br />
(ca. 50-60 aufgezogene Kälber/E<strong>in</strong>heit)<br />
bei günstigen Bed<strong>in</strong>gungen (kurze Wege, Vollmilchtränke)<br />
auch sehr rationell,<br />
Vorteil: Komb<strong>in</strong>ation mit Tierkontrolle<br />
ab Woche 3 Gruppenhaltung, entmisten mechanisiert<br />
E<strong>in</strong>streu(zwischen)lagerung bei <strong>der</strong> Liegefläche<br />
Futterration = Milchviehration + extra KF<br />
Jungviehaufzucht => 5 h / Platz / Jahr<br />
Fütterung s. Milchvieh<br />
ab 4-6 Monaten Haltung auf Flüssigmist mit<br />
Liegeboxen<br />
Hochboxen mit weicher Matte, Tiefboxen ungünstig<br />
bei entsprechenden betrieblichen Voraussetzungen<br />
ggf. Auslagerung<br />
14