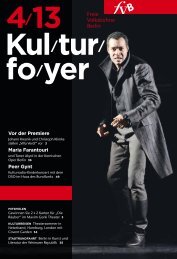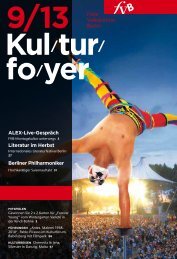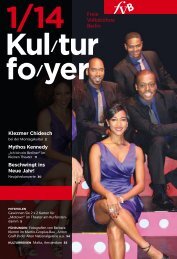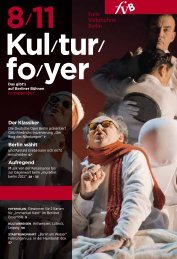Volksbühnen-Spiegel 1/2013 - Freie Volksbühne Berlin
Volksbühnen-Spiegel 1/2013 - Freie Volksbühne Berlin
Volksbühnen-Spiegel 1/2013 - Freie Volksbühne Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den die noch bestehenden etwa 250 Vereine liquidiert<br />
oder durch Mitgliedschaft im nationalsozialistischen<br />
Reichsverband „Deutsche Bühne“ gleichgeschaltet. Die<br />
Reichsorganisation „Deutsche Bühne“ war nicht nur die<br />
Nachfolgerin des Verbandes der deutschen <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Vereine,<br />
sondern auch des parallel dazu bis dahin<br />
existierenden Bühnenvolksbundes.<br />
Albert Brodbeck, der Geschäftsführer des Verbandes,<br />
schrieb in der letzten Nummer der „<strong>Volksbühne</strong>“ im<br />
Juni 1933: „Wir haben gearbeitet und unser Bestes<br />
gegeben, dreizehn Jahre lang. Wir haben, was unser<br />
ärgster Feind nicht bestreiten wird, den entscheidenden<br />
Vorstoß gemacht zur kulturellen Emanzipation der minderbemittelten<br />
Volksschichten. Wir haben gleichzeitig<br />
dem deutschen Theater eine Armee neuer, treuer,<br />
kunstbegeisterter Menschen zugeführt. Wir haben das<br />
theaterlose flache Land der Bühnenkunst erschließen<br />
helfen. Wir haben unsere Pflicht getan und sonst nichts<br />
aus uns gemacht. Was wir geschaffen und geschafft<br />
haben, war nicht umsonst. Das deutsche Theater wird<br />
immer wieder seine lebendigsten Kräfte aus den Quellen<br />
ableiten müssen, die von der deutschen <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Bewegung<br />
erschlossen worden sind. Insofern ist<br />
die deutsche <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>arbeit nicht tot.“<br />
Die Zitate sind der Darstellung des Verbandes deutscher<br />
<strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Vereine durch Dr. Marlene Gärtner<br />
(Droste Verlag 1978) entnommen. Heinrich Braulich<br />
beschrieb in seinem Buch „Die <strong>Volksbühne</strong>“ (Henschelverlag<br />
1976) „Theater und Politik in der deutschen<br />
<strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>bewegung“ zwar aus der gefärbten Sicht<br />
damaliger DDR-Ideologie, stellte aber viele Fakten u.a.<br />
auch über die Auflösung der <strong>Berlin</strong>er <strong>Volksbühne</strong> zusammen.<br />
Darum soll es jetzt noch in kurzer Zusammenfassung<br />
gehen.<br />
Die Auflösung der Vereine geschah nicht auf einen<br />
Schlag und hat sich überall etwas anders vollzogen. In<br />
<strong>Berlin</strong> zum Beispiel war die Existenz des Vereins stark<br />
an die der eigenen Theater, der <strong>Volksbühne</strong> am damaligen<br />
Bülowplatz und dem Theater am Nollendorfplatz,<br />
gebunden. Dabei spielte Staatssekretär a. D. Curt Baake<br />
eine Rolle, der Erste Vorsitzende der <strong>Volksbühne</strong><br />
e.V., wie sich der <strong>Berlin</strong>er Verein nannte, und des Verbandes.<br />
Während sich der Verband aufgelöste, nahm die<br />
<strong>Berlin</strong>er <strong>Volksbühne</strong> im Mai 1933 zur neuen Situation<br />
Stellung. Siegfried Nestriepke, der wichtige Mentor der<br />
<strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>bewegung, hatte sich 1928 als Geschäftsführer<br />
aus der Verbandsarbeit und nun auch als Generalsekretär<br />
aus dem Verein sowie als Verwaltungsdirektor<br />
aus dem Theater am Bülowplatz zurückgezogen.<br />
Curt Baake eröffnete am 19. Dezember 1933 eine<br />
Hauptversammlung mit der Feststellung, dass er auf die<br />
Einberufung einer Mitgliederversammlung und auf Wahlen<br />
verzichte. „An die Stele des Wahlsystems ist überall<br />
das Prinzip der straffen, verantwortlichen Führung<br />
getreten. Es muss auch für uns gelten.“ In einer neuen<br />
Satzung bekam der Erste Vorsitzende das Recht, die<br />
weiteren Positionen zu besetzen.<br />
Offenbar versuchte Baake durch Anpassung, den<br />
Verein zu retten. 1932 hatte Heinz Hilpert die Leitung<br />
des Theaters am Bülowplatz übernommen und setzte<br />
auf besonders prominente Darsteller, nicht auf politisches<br />
Engagement. Er wechselte 1934 ans Deutsche<br />
Theater, das Max Reinhardt dem deutschen Volke ü-<br />
bergeben hatte.<br />
Nicht nur die Weltwirtschaftskrise hatte den Mitgliederbestand<br />
schrumpfen lassen, jetzt traten auch<br />
Privattheater und Abonnementsgesellschaften mit niedrigen<br />
Eintrittspreisen als Konkurrenten auf. Das veranlasste<br />
den Verein, für 1934/35 vom Reichsministerium<br />
6<br />
für Volksaufklärung und Propaganda eine bedeutende<br />
finanzielle Unterstützung zu erbitten. Gleichzeitig wurde<br />
der Vorstand der <strong>Volksbühne</strong> veranlasst, in einer neuen<br />
Satzung die Mitwirkung des Reichsministeriums festzuschreiben.<br />
Der geschäftsführende Vorstand der <strong>Volksbühne</strong> trat<br />
am 26. Februar 1926 zurück. Curt Baake teilte dem<br />
Reichskulturamtsleiter Moraller mit, dass der Vorstand<br />
ihn am 8. April 1935 zum Ersten Vorsitzenden berufen<br />
habe. Am 14. September wurde dem Amtsgericht ein<br />
nunmehr politisch besetzter Vorstand mitgeteilt.<br />
Moraller dankte Baake, der von nun an eine Pension<br />
erhielt, in einem Brief vom 21. Oktober 1935. Daraus<br />
ein Auszug: „Ich weiß, dass Ihre Arbeit für die Entwicklung<br />
des Vereinsnicht vergeblich gewesen ist… Mit Ihnen<br />
hoffe ich, dass es der <strong>Volksbühne</strong> auch in Zukunft<br />
gelingen wird, ihre kulturellen Aufgaben zum Wohl der<br />
Allgemeinheit zu erfüllen. In diesem Sinne drücke ich<br />
Ihnen wärmstens die Hand und verbleibe mit deutschem<br />
Gruß und Heil Hitler gez. Moraller.“ DH<br />
Über die <strong>Volksbühne</strong> zu<br />
„Theater heute“<br />
In<br />
memoriam<br />
Henning<br />
Rieschieter<br />
Am 22. Mai <strong>2013</strong> starb in <strong>Berlin</strong> im Alter von 86 Jahren<br />
Prof. Dr. Henning Rischbieter. In Hannover geboren,<br />
studierte er nach seiner Verwundung im Krieg, die ihm<br />
seinen linken Unterarm kostete, in Göttingen Geschichte<br />
und Germanistik. Seine Dissertation schrieb er über<br />
die vom Preußisch-Französischen Handelsvertrag von<br />
1862 ausgelöste Zollvereins-Krise. Zum Theater fand er<br />
über die <strong>Volksbühne</strong>. Hier entstand 1960 „Theater heute“,<br />
die heute noch bestehende Zeitschrift, mit der er<br />
elementar neue Strömungen unterstützte und die ihr in<br />
Insiderkreisen den Namen „Theater Bremen“ einbrachten.<br />
Von Bremen brach PeterStein zur neuen „<strong>Berlin</strong>er<br />
Schaubühne“ auf. Mit „Theater heute“ trug Rischbieter<br />
1964 zur Gründung des <strong>Berlin</strong>er Theatertreffens bei.<br />
Von 1977 bis 1995 avancierte er zum Professor für<br />
Theaterwissenschaft an der <strong>Freie</strong>n Universität <strong>Berlin</strong>.1994<br />
wurde er Mitglied der Akademie der Künste.<br />
Das Internationale Theater-Institut widmete ihm in diesem,<br />
seinem Todesjahr den jährlich vergebenen Preis.<br />
Auf Henning Rischbieter gehen etliche Publikationen<br />
zurück. 2009 schrieb er seine Erinnerungen „Schreiben<br />
Knappwurst abends Gäste“, die im Kampen Verlag,<br />
Springe, erschien und in der er auch seinen Einstieg in<br />
die Theaterwelt durch die <strong>Volksbühne</strong> Hannover und<br />
das Entstehen der Zeitschrift „Theater heute“ in seinem<br />
dortigen Geschäftszimmer schilderte. Dass er den<br />
<strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>verband als zögerlich beschrieb, die Zeitschrift<br />
zu übernehmen, muss man aus der Zeit heraus<br />
verstehen. Immerhin ermöglichte die <strong>Volksbühne</strong> den<br />
Start mit einem Darlehen von 30.000 DM.