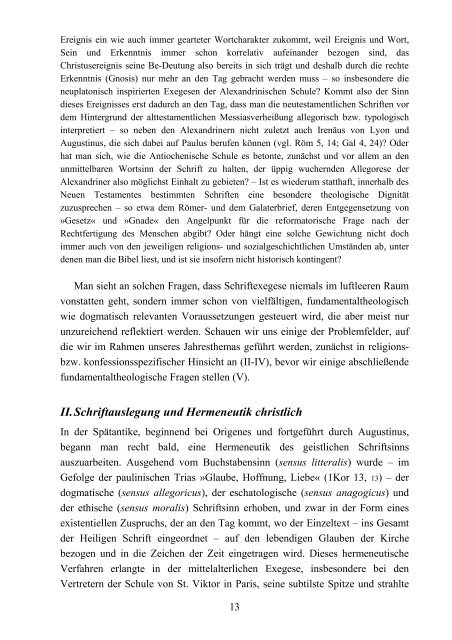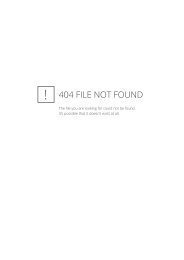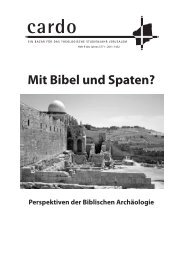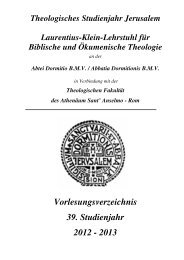Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ereignis ein wie auch immer gearteter Wortcharakter zukommt, weil Ereignis und Wort,<br />
Sein und Erkenntnis immer schon korrelativ aufeinander bezogen sind, das<br />
Christusereignis seine Be-Deutung also bereits in sich trägt und deshalb durch die rechte<br />
Erkenntnis (Gnosis) nur mehr an den Tag gebracht werden muss – so insbesondere die<br />
neuplatonisch inspirierten Exegesen der Alexandrinischen Schule? Kommt also der Sinn<br />
dieses Ereignisses erst dadurch an den Tag, dass man die neutestamentlichen Schriften vor<br />
dem Hintergrund der alttestamentlichen Messiasverheißung allegorisch bzw. typologisch<br />
interpretiert – so neben den Alexandrinern nicht zuletzt auch Irenäus von Lyon und<br />
Augustinus, die sich dabei auf Paulus berufen können (vgl. Röm 5, 14; Gal 4, 24)? Oder<br />
hat man sich, wie die Antiochenische Schule es betonte, zunächst und vor allem an den<br />
unmittelbaren Wortsinn der Schrift zu halten, der üppig wuchernden Allegorese der<br />
Alexandriner also möglichst Einhalt zu gebieten? – Ist es wiederum statthaft, innerhalb des<br />
Neuen Testamentes bestimmten Schriften eine besondere theologische Dignität<br />
zuzusprechen – so etwa dem Römer- und dem Galaterbrief, deren Entgegensetzung von<br />
»Gesetz« und »Gnade« den Angelpunkt für die reformatorische Frage nach der<br />
Rechtfertigung des Menschen abgibt? Oder hängt eine solche Gewichtung nicht doch<br />
immer auch von den jeweiligen religions- und sozialgeschichtlichen Umständen ab, unter<br />
denen man die Bibel liest, und ist sie insofern nicht historisch kontingent?<br />
Man sieht an solchen Fragen, dass Schriftexegese niemals im luftleeren Raum<br />
vonstatten geht, sondern immer schon von vielfältigen, fundamentaltheologisch<br />
wie dogmatisch relevanten Voraussetzungen gesteuert wird, die aber meist nur<br />
unzureichend reflektiert werden. Schauen wir uns einige der Problemfelder, auf<br />
die wir im Rahmen unseres Jahresthemas geführt werden, zunächst in religionsbzw.<br />
konfessionsspezifischer Hinsicht an (II-IV), bevor wir einige abschließende<br />
fundamentaltheologische Fragen stellen (V).<br />
II.Schriftauslegung und Hermeneutik christlich<br />
In der Spätantike, beginnend bei Origenes und fortgeführt durch Augustinus,<br />
begann man recht bald, eine Hermeneutik des geistlichen Schriftsinns<br />
auszuarbeiten. Ausgehend vom Buchstabensinn (sensus litteralis) wurde – im<br />
Gefolge der paulinischen Trias »Glaube, Hoffnung, Liebe« (1Kor 13, 13) – der<br />
dogmatische (sensus allegoricus), der eschatologische (sensus anagogicus) und<br />
der ethische (sensus moralis) Schriftsinn erhoben, und zwar in der Form eines<br />
existentiellen Zuspruchs, der an den Tag kommt, wo der Einzeltext – ins Gesamt<br />
der Heiligen Schrift eingeordnet – auf den lebendigen Glauben der Kirche<br />
bezogen und in die Zeichen der Zeit eingetragen wird. Dieses hermeneutische<br />
Verfahren erlangte in der mittelalterlichen Exegese, insbesondere bei den<br />
Vertretern der Schule von St. Viktor in Paris, seine subtilste Spitze und strahlte<br />
13