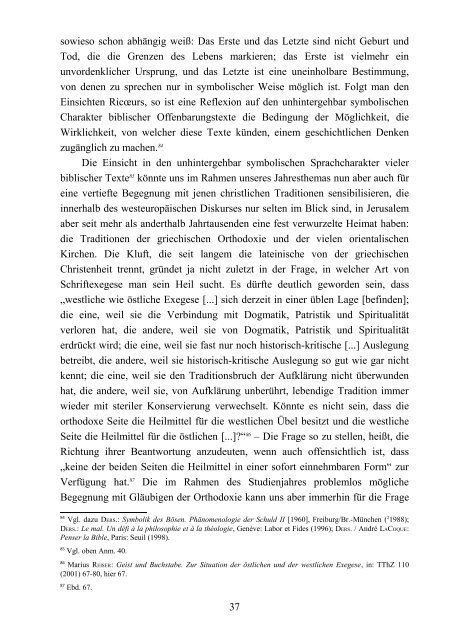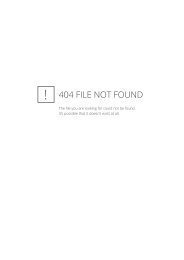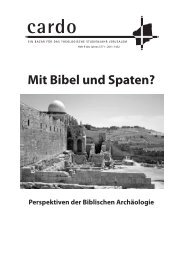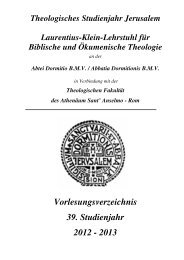Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sowieso schon abhängig weiß: Das Erste und das Letzte sind nicht Geburt und<br />
Tod, die die Grenzen des Lebens markieren; das Erste ist vielmehr ein<br />
unvordenklicher Ursprung, und das Letzte ist eine uneinholbare Bestimmung,<br />
von denen zu sprechen nur in symbolischer Weise möglich ist. Folgt man den<br />
Einsichten Ricœurs, so ist eine Reflexion auf den unhintergehbar symbolischen<br />
Charakter biblischer Offenbarungstexte die Bedingung der Möglichkeit, die<br />
Wirklichkeit, von welcher diese Texte künden, einem geschichtlichen Denken<br />
zugänglich zu machen. 84<br />
Die Einsicht in den unhintergehbar symbolischen Sprachcharakter vieler<br />
biblischer Texte 85 könnte uns im Rahmen unseres Jahresthemas nun aber auch für<br />
eine vertiefte Begegnung mit jenen christlichen Traditionen sensibilisieren, die<br />
innerhalb des westeuropäischen Diskurses nur selten im Blick sind, in <strong>Jerusalem</strong><br />
aber seit mehr als anderthalb Jahrtausenden eine fest verwurzelte Heimat haben:<br />
die Traditionen der griechischen Orthodoxie und der vielen orientalischen<br />
Kirchen. Die Kluft, die seit langem die lateinische von der griechischen<br />
Christenheit trennt, gründet ja nicht zuletzt in der Frage, in welcher Art von<br />
Schriftexegese man sein Heil sucht. Es dürfte deutlich geworden sein, dass<br />
„westliche wie östliche Exegese [...] sich derzeit in einer üblen Lage [befinden];<br />
die eine, weil sie die Verbindung mit Dogmatik, Patristik und Spiritualität<br />
verloren hat, die andere, weil sie von Dogmatik, Patristik und Spiritualität<br />
erdrückt wird; die eine, weil sie fast nur noch historisch-kritische [...] Auslegung<br />
betreibt, die andere, weil sie historisch-kritische Auslegung so gut wie gar nicht<br />
kennt; die eine, weil sie den Traditionsbruch der Aufklärung nicht überwunden<br />
hat, die andere, weil sie, von Aufklärung unberührt, lebendige Tradition immer<br />
wieder mit steriler Konservierung verwechselt. Könnte es nicht sein, dass die<br />
orthodoxe Seite die Heilmittel für die westlichen Übel besitzt und die westliche<br />
Seite die Heilmittel für die östlichen [...]?“ 86 – Die Frage so zu stellen, heißt, die<br />
Richtung ihrer Beantwortung anzudeuten, wenn auch offensichtlich ist, dass<br />
„keine der beiden Seiten die Heilmittel in einer sofort einnehmbaren Form“ zur<br />
Verfügung hat. 87 Die im Rahmen des <strong>Studienjahr</strong>es problemlos mögliche<br />
Begegnung mit Gläubigen der Orthodoxie kann uns aber immerhin für die Frage<br />
84<br />
Vgl. dazu DERS.: Symbolik des Bösen. Phänomenologie der Schuld II [1960], Freiburg/Br.-München ( 2 1988);<br />
DERS.: Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Genève: Labor et Fides (1996); DERS. / André LACOQUE:<br />
Penser la Bible, Paris: Seuil (1998).<br />
85<br />
Vgl. oben Anm. 40.<br />
86<br />
Marius REISER: Geist und Buchstabe. Zur Situation der östlichen und der westlichen Exegese, in: TThZ 110<br />
(2001) 67-80, hier 67.<br />
87<br />
Ebd. 67.<br />
37