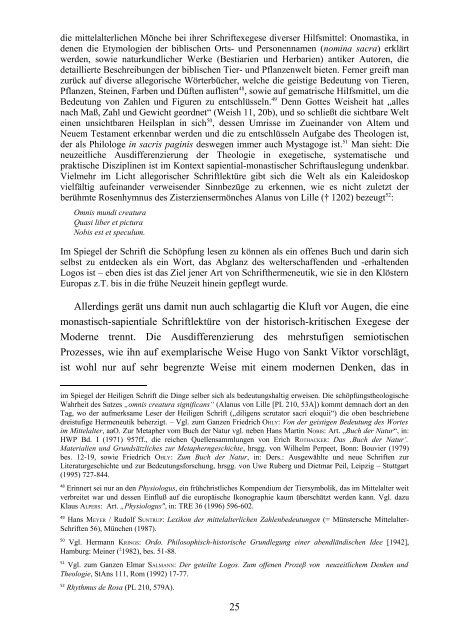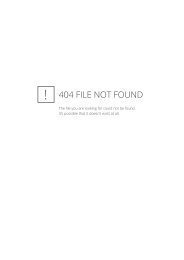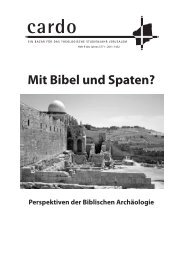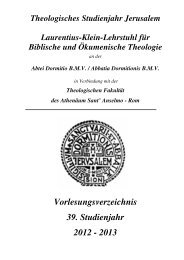Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die mittelalterlichen Mönche bei ihrer Schriftexegese diverser Hilfsmittel: Onomastika, in<br />
denen die Etymologien der biblischen Orts- und Personennamen (nomina sacra) erklärt<br />
werden, sowie naturkundlicher Werke (Bestiarien und Herbarien) antiker Autoren, die<br />
detaillierte Beschreibungen der biblischen Tier- und Pflanzenwelt bieten. Ferner greift man<br />
zurück auf diverse allegorische Wörterbücher, welche die geistige Bedeutung von Tieren,<br />
Pflanzen, Steinen, Farben und Düften auflisten 48 , sowie auf gematrische Hilfsmittel, um die<br />
Bedeutung von Zahlen und Figuren zu entschlüsseln. 49 Denn Gottes Weisheit hat „alles<br />
nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet“ (Weish 11, 20b), und so schließt die sichtbare Welt<br />
einen unsichtbaren Heilsplan in sich 50 , dessen Umrisse im Zueinander von Altem und<br />
Neuem Testament erkennbar werden und die zu entschlüsseln Aufgabe des Theologen ist,<br />
der als Philologe in sacris paginis deswegen immer auch Mystagoge ist. 51 Man sieht: Die<br />
neuzeitliche Ausdifferenzierung der Theologie in exegetische, systematische und<br />
praktische Disziplinen ist im Kontext sapiential-monastischer Schriftauslegung undenkbar.<br />
Vielmehr im Licht allegorischer Schriftlektüre gibt sich die Welt als ein Kaleidoskop<br />
vielfältig aufeinander verweisender Sinnbezüge zu erkennen, wie es nicht zuletzt der<br />
berühmte Rosenhymnus des Zisterziensermönches Alanus von Lille († 1202) bezeugt 52 :<br />
Omnis mundi creatura<br />
Quasi liber et pictura<br />
Nobis est et speculum.<br />
Im Spiegel der Schrift die Schöpfung lesen zu können als ein offenes Buch und darin sich<br />
selbst zu entdecken als ein Wort, das Abglanz des welterschaffenden und -erhaltenden<br />
Logos ist – eben dies ist das Ziel jener Art von Schrifthermeneutik, wie sie in den Klöstern<br />
Europas z.T. bis in die frühe Neuzeit hinein gepflegt wurde.<br />
Allerdings gerät uns damit nun auch schlagartig die Kluft vor Augen, die eine<br />
monastisch-sapientiale Schriftlektüre von der historisch-kritischen Exegese der<br />
Moderne trennt. Die Ausdifferenzierung des mehrstufigen semiotischen<br />
Prozesses, wie ihn auf exemplarische Weise Hugo von Sankt Viktor vorschlägt,<br />
ist wohl nur auf sehr begrenzte Weise mit einem modernen Denken, das in<br />
im Spiegel der Heiligen Schrift die Dinge selber sich als bedeutungshaltig erweisen. Die schöpfungstheologische<br />
Wahrheit des Satzes „omnis creatura significans“ (Alanus von Lille [PL 210, 53A]) kommt demnach dort an den<br />
Tag, wo der aufmerksame Leser der Heiligen Schrift („diligens scrutator sacri eloquii“) die oben beschriebene<br />
dreistufige Hermeneutik beherzigt. – Vgl. zum Ganzen Friedrich OHLY: Von der geistigen Bedeutung des Wortes<br />
im Mittelalter, aaO. Zur Metapher vom Buch der Natur vgl. neben Hans Martin NOBIS: Art. „Buch der Natur“, in:<br />
HWP Bd. I (1971) 957ff., die reichen Quellensammlungen von Erich ROTHACKER: Das ‚Buch der Natur‘.<br />
Materialien und Grundsätzliches zur Metapherngeschichte, hrsgg. von Wilhelm Perpeet, Bonn: Bouvier (1979)<br />
bes. 12-19, sowie Friedrich OHLY: Zum Buch der Natur, in: Ders.: Ausgewählte und neue Schriften zur<br />
Literaturgeschichte und zur Bedeutungsforschung, hrsgg. von Uwe Ruberg und Dietmar Peil, Leipzig – Stuttgart<br />
(1995) 727-844.<br />
48<br />
Erinnert sei nur an den Physiologus, ein frühchristliches Kompendium der Tiersymbolik, das im Mittelalter weit<br />
verbreitet war und dessen Einfluß auf die europäische Ikonographie kaum überschätzt werden kann. Vgl. dazu<br />
Klaus ALPERS: Art. „Physiologus", in: TRE 36 (1996) 596-602.<br />
49<br />
Hans MEYER / Rudolf SUNTRUP: Lexikon der mittelalterlichen Zahlenbedeutungen (= Münstersche Mittelalter-<br />
Schriften 56), München (1987).<br />
50<br />
Vgl. Hermann KRINGS: Ordo. Philosophisch-historische Grundlegung einer abendländischen Idee [1942],<br />
Hamburg: Meiner ( 2 1982), bes. 51-88.<br />
51<br />
Vgl. zum Ganzen Elmar SALMANN: Der geteilte Logos. Zum offenen Prozeß von neuzeitlichem Denken und<br />
Theologie, StAns 111, Rom (1992) 17-77.<br />
52<br />
Rhythmus de Rosa (PL 210, 579A).<br />
25