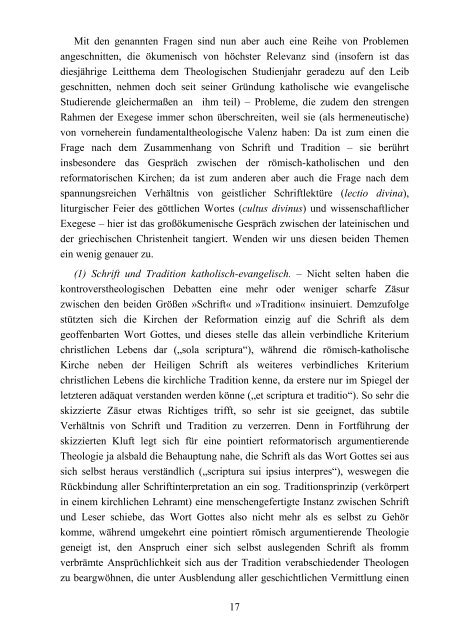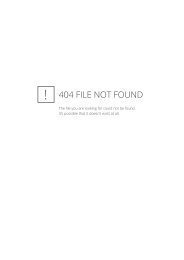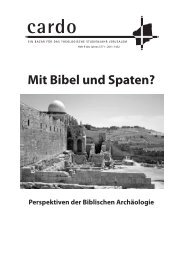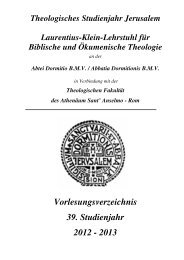Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Mit den genannten Fragen sind nun aber auch eine Reihe von Problemen<br />
angeschnitten, die ökumenisch von höchster Relevanz sind (insofern ist das<br />
diesjährige Leitthema dem Theologischen <strong>Studienjahr</strong> geradezu auf den Leib<br />
geschnitten, nehmen doch seit seiner Gründung katholische wie evangelische<br />
Studierende gleichermaßen an ihm teil) – Probleme, die zudem den strengen<br />
Rahmen der Exegese immer schon überschreiten, weil sie (als hermeneutische)<br />
von vorneherein fundamentaltheologische Valenz haben: Da ist zum einen die<br />
Frage nach dem Zusammenhang von Schrift und Tradition – sie berührt<br />
insbesondere das Gespräch zwischen der römisch-katholischen und den<br />
reformatorischen Kirchen; da ist zum anderen aber auch die Frage nach dem<br />
spannungsreichen Verhältnis von geistlicher Schriftlektüre (lectio divina),<br />
liturgischer Feier des göttlichen Wortes (cultus divinus) und wissenschaftlicher<br />
Exegese – hier ist das großökumenische Gespräch zwischen der lateinischen und<br />
der griechischen Christenheit tangiert. Wenden wir uns diesen beiden Themen<br />
ein wenig genauer zu.<br />
(1) Schrift und Tradition katholisch-evangelisch. – Nicht selten haben die<br />
kontroverstheologischen Debatten eine mehr oder weniger scharfe Zäsur<br />
zwischen den beiden Größen »Schrift« und »Tradition« insinuiert. Demzufolge<br />
stützten sich die Kirchen der Reformation einzig auf die Schrift als dem<br />
geoffenbarten Wort Gottes, und dieses stelle das allein verbindliche Kriterium<br />
christlichen Lebens dar („sola scriptura“), während die römisch-katholische<br />
Kirche neben der Heiligen Schrift als weiteres verbindliches Kriterium<br />
christlichen Lebens die kirchliche Tradition kenne, da erstere nur im Spiegel der<br />
letzteren adäquat verstanden werden könne („et scriptura et traditio“). So sehr die<br />
skizzierte Zäsur etwas Richtiges trifft, so sehr ist sie geeignet, das subtile<br />
Verhältnis von Schrift und Tradition zu verzerren. Denn in Fortführung der<br />
skizzierten Kluft legt sich für eine pointiert reformatorisch argumentierende<br />
Theologie ja alsbald die Behauptung nahe, die Schrift als das Wort Gottes sei aus<br />
sich selbst heraus verständlich („scriptura sui ipsius interpres“), weswegen die<br />
Rückbindung aller Schriftinterpretation an ein sog. Traditionsprinzip (verkörpert<br />
in einem kirchlichen Lehramt) eine menschengefertigte Instanz zwischen Schrift<br />
und Leser schiebe, das Wort Gottes also nicht mehr als es selbst zu Gehör<br />
komme, während umgekehrt eine pointiert römisch argumentierende Theologie<br />
geneigt ist, den Anspruch einer sich selbst auslegenden Schrift als fromm<br />
verbrämte Ansprüchlichkeit sich aus der Tradition verabschiedender Theologen<br />
zu beargwöhnen, die unter Ausblendung aller geschichtlichen Vermittlung einen<br />
17