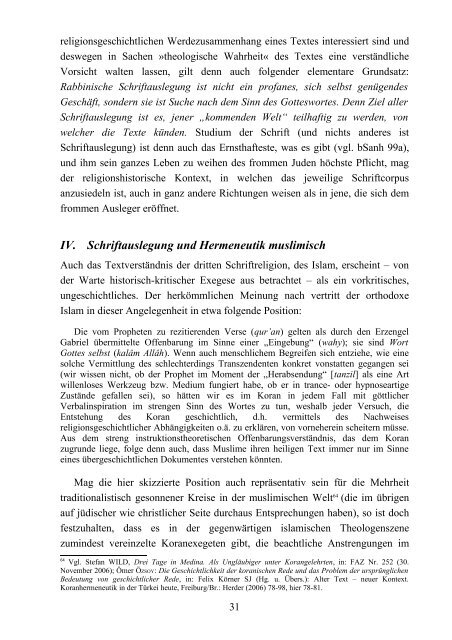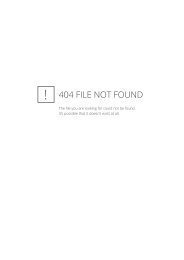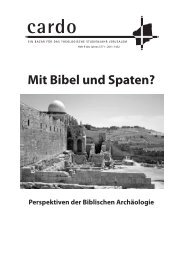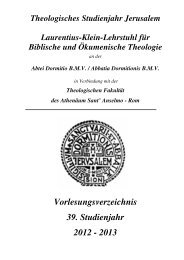Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Apg 8, 30 - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eligionsgeschichtlichen Werdezusammenhang eines Textes interessiert sind und<br />
deswegen in Sachen »theologische Wahrheit« des Textes eine verständliche<br />
Vorsicht walten lassen, gilt denn auch folgender elementare Grundsatz:<br />
Rabbinische Schriftauslegung ist nicht ein profanes, sich selbst genügendes<br />
Geschäft, sondern sie ist Suche nach dem Sinn des Gotteswortes. Denn Ziel aller<br />
Schriftauslegung ist es, jener „kommenden Welt“ teilhaftig zu werden, von<br />
welcher die Texte künden. Studium der Schrift (und nichts anderes ist<br />
Schriftauslegung) ist denn auch das Ernsthafteste, was es gibt (vgl. bSanh 99a),<br />
und ihm sein ganzes Leben zu weihen des frommen Juden höchste Pflicht, mag<br />
der religionshistorische Kontext, in welchen das jeweilige Schriftcorpus<br />
anzusiedeln ist, auch in ganz andere Richtungen weisen als in jene, die sich dem<br />
frommen Ausleger eröffnet.<br />
IV.<br />
Schriftauslegung und Hermeneutik muslimisch<br />
Auch das Textverständnis der dritten Schriftreligion, des Islam, erscheint – von<br />
der Warte historisch-kritischer Exegese aus betrachtet – als ein vorkritisches,<br />
ungeschichtliches. Der herkömmlichen Meinung nach vertritt der orthodoxe<br />
Islam in dieser Angelegenheit in etwa folgende Position:<br />
Die vom Propheten zu rezitierenden Verse (qur’an) gelten als durch den Erzengel<br />
Gabriel übermittelte Offenbarung im Sinne einer „Eingebung“ (wahy); sie sind Wort<br />
Gottes selbst (kalâm Allâh). Wenn auch menschlichem Begreifen sich entziehe, wie eine<br />
solche Vermittlung des schlechterdings Transzendenten konkret vonstatten gegangen sei<br />
(wir wissen nicht, ob der Prophet im Moment der „Herabsendung“ [tanzil] als eine Art<br />
willenloses Werkzeug bzw. Medium fungiert habe, ob er in trance- oder hypnoseartige<br />
Zustände gefallen sei), so hätten wir es im Koran in jedem Fall mit göttlicher<br />
Verbalinspiration im strengen Sinn des Wortes zu tun, weshalb jeder Versuch, die<br />
Entstehung des Koran geschichtlich, d.h. vermittels des Nachweises<br />
religionsgeschichtlicher Abhängigkeiten o.ä. zu erklären, von vorneherein scheitern müsse.<br />
Aus dem streng instruktionstheoretischen Offenbarungsverständnis, das dem Koran<br />
zugrunde liege, folge denn auch, dass Muslime ihren heiligen Text immer nur im Sinne<br />
eines übergeschichtlichen Dokumentes verstehen könnten.<br />
Mag die hier skizzierte Position auch repräsentativ sein für die Mehrheit<br />
traditionalistisch gesonnener Kreise in der muslimischen Welt 64 (die im übrigen<br />
auf jüdischer wie christlicher Seite durchaus Entsprechungen haben), so ist doch<br />
festzuhalten, dass es in der gegenwärtigen islamischen Theologenszene<br />
zumindest vereinzelte Koranexegeten gibt, die beachtliche Anstrengungen im<br />
64<br />
Vgl. Stefan WILD, Drei Tage in Medina. Als Ungläubiger unter Korangelehrten, in: FAZ Nr. 252 (<strong>30</strong>.<br />
November 2006); Ömer ÖZSOY: Die Geschichtlichkeit der koranischen Rede und das Problem der ursprünglichen<br />
Bedeutung von geschichtlicher Rede, in: Felix Körner SJ (Hg. u. Übers.): Alter Text – neuer Kontext.<br />
Koranhermeneutik in der Türkei heute, Freiburg/Br.: Herder (2006) 78-98, hier 78-81.<br />
31