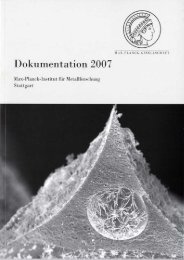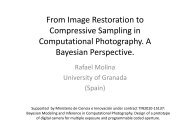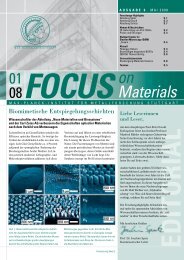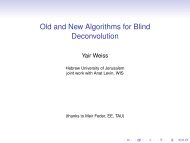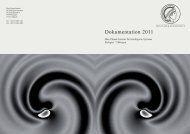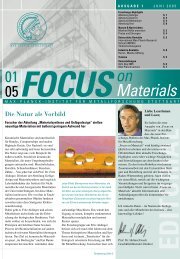Dokumentation 2008 - Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Dokumentation 2008 - Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Dokumentation 2008 - Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Dokumentation</strong> <strong>2008</strong> Tätigkeitsberichte im Jahrbuch der MPG (<strong>2008</strong>)<br />
Martin, Raquel | Nanostrukturierte Oberächen <strong>für</strong> biomedizinische Anwendungen Tätigkeitsbericht <strong>2008</strong><br />
Die BCML-Technik erzeugt also eine „bioaktive Ummantelung“ mit<br />
(i) einem ausgewählten chemischen Signal, das mit der Oberäche verbunden ist,<br />
(ii) einem kontrollierten Abstand zwischen den chemischen Signalen auf der Nanometerskala, und<br />
(iii) einer denierten Steigkeit des Substrats.<br />
Diese drei Parameter sind da<strong>für</strong> bekannt, das Zellverhalten zu beeinussen. Wir variieren diese systematisch<br />
auf unseren Substraten, sodass zahlreiche Zellantworten ausgelöst werden können.<br />
Die BCML-Technologie bietet mehrere Vorteile, die sehr wertvoll beim Gestalten von medizinischen<br />
Instrumenten sind. Zu den wichtigsten Vorzügen zählt, dass, abhängig vom Design der BCML-Nanostrukturen,<br />
sehr bestimmt die Anhaftung eines ganz bestimmten Zelltyps gefördert wird. Außerdem<br />
können die Nanostrukturen auf ebenen und auf gewölbten Objekten, auf organischen und anorganischen<br />
Materialien gestaltet werden – und das auf kostengünstige Art und auch auf größeren Flächen<br />
(bis hin zu einer Größe im Quadratmeterbereich, Abb. 2 ). Eine solche Kombination von Vorteilen<br />
erreicht keine andere bekannte Nanolithograetechnik.<br />
Abb. 2: Die BCML-Technologie ist vielseitig einsetzbar: Parameter, die eingestellt werden können zur Nutzung<br />
der BCML-Technologie.<br />
Urheber: <strong>Max</strong>-<strong>Planck</strong>-<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Metallforschung<br />
Die Produkte<br />
Im Januar 2009 zählt das Team von Dr. Martin neben ihr einen weiteren Wissenschaftler, drei Doktoranden<br />
und einen Techniker. Die Forschungsgruppe entwickelt drei verschiedene Produkte.<br />
1.) Ein nicht-invasiver, vorgeburtlicher Diagnostiktest<br />
Die aktuellen pränatalen Diagnostiktests umfassen zellgenetische Analysen, die das Chromosomenmaterial<br />
numerisch und strukturell untersuchen. Da<strong>für</strong> ist es nötig, Gewebe des Fötus zu erhalten, das die<br />
ganze genetische Information besitzt. Bis jetzt werden die Probenentnahme von fötalem Gewebe nur<br />
mittels Fruchtwasserentnahme und Chorionzottenbiopsie vorgenommen. Beides sind invasive Methoden<br />
mit großen Nachteilen: Sie erhöhen z. B. das Risiko einer Fehlgeburt. Zudem muss man relativ<br />
lang auf das Ergebnis warten. Folglich besteht ein bisher unerfüllter Bedarf an nicht-invasiven, pränatalen<br />
Diagnosetechniken, die überzeugend Abnormalitäten bei einem Fötus in einem frühen Stadium<br />
der Schwangerschaft identizieren.<br />
Ein möglicher Ansatz wäre, die intakten Fötuszellen aus dem Mutterblut zu analysieren. Solche neuartigen<br />
Tests, die auf zirkulierenden Fötuszellen basieren, könnten die invasiven Methoden wie Fruchtwasseruntersuchung<br />
und Chorionzottenbiopsie reduzieren oder sogar überüssig machen. Jedoch<br />
© <strong>2008</strong> <strong>Max</strong>-<strong>Planck</strong>-Gesellschaft www.mpg.de<br />
61