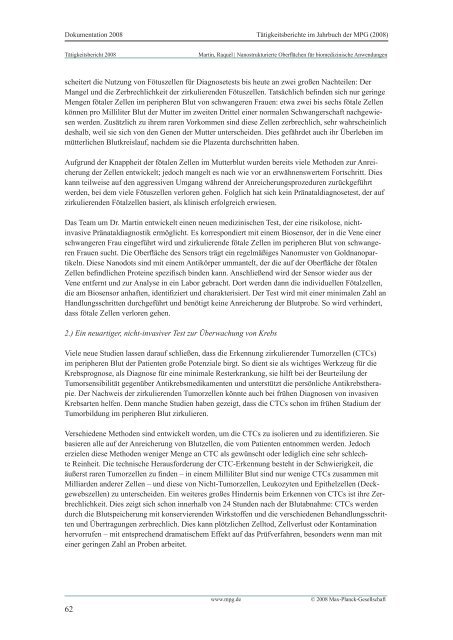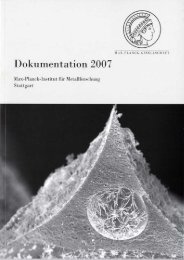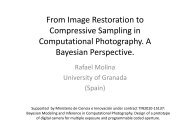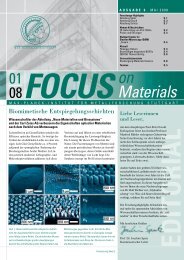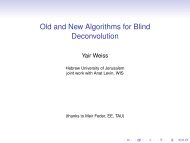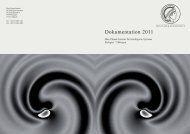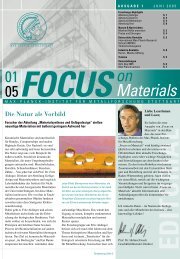Dokumentation 2008 - Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Dokumentation 2008 - Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Dokumentation 2008 - Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Dokumentation</strong> <strong>2008</strong> Tätigkeitsberichte im Jahrbuch der MPG (<strong>2008</strong>)<br />
Tätigkeitsbericht <strong>2008</strong><br />
Martin, Raquel | Nanostrukturierte Oberächen <strong>für</strong> biomedizinische Anwendungen<br />
scheitert die Nutzung von Fötuszellen <strong>für</strong> Diagnosetests bis heute an zwei großen Nachteilen: Der<br />
Mangel und die Zerbrechlichkeit der zirkulierenden Fötuszellen. Tatsächlich benden sich nur geringe<br />
Mengen fötaler Zellen im peripheren Blut von schwangeren Frauen: etwa zwei bis sechs fötale Zellen<br />
können pro Milliliter Blut der Mutter im zweiten Drittel einer normalen Schwangerschaft nachgewiesen<br />
werden. Zusätzlich zu ihrem raren Vorkommen sind diese Zellen zerbrechlich, sehr wahrscheinlich<br />
deshalb, weil sie sich von den Genen der Mutter unterscheiden. Dies gefährdet auch ihr Überleben im<br />
mütterlichen Blutkreislauf, nachdem sie die Plazenta durchschritten haben.<br />
Aufgrund der Knappheit der fötalen Zellen im Mutterblut wurden bereits viele Methoden zur Anreicherung<br />
der Zellen entwickelt; jedoch mangelt es nach wie vor an erwähnenswertem Fortschritt. Dies<br />
kann teilweise auf den aggressiven Umgang während der Anreicherungsprozeduren zurückgeführt<br />
werden, bei dem viele Fötuszellen verloren gehen. Folglich hat sich kein Pränataldiagnosetest, der auf<br />
zirkulierenden Fötalzellen basiert, als klinisch erfolgreich erwiesen.<br />
Das Team um Dr. Martin entwickelt einen neuen medizinischen Test, der eine risikolose, nichtinvasive<br />
Pränataldiagnostik ermöglicht. Es korrespondiert mit einem Biosensor, der in die Vene einer<br />
schwangeren Frau eingeführt wird und zirkulierende fötale Zellen im peripheren Blut von schwangeren<br />
Frauen sucht. Die Oberäche des Sensors trägt ein regelmäßiges Nanomuster von Goldnanopartikeln.<br />
Diese Nanodots sind mit einem Antikörper ummantelt, der die auf der Oberäche der fötalen<br />
Zellen bendlichen Proteine spezisch binden kann. Anschließend wird der Sensor wieder aus der<br />
Vene entfernt und zur Analyse in ein Labor gebracht. Dort werden dann die individuellen Fötalzellen,<br />
die am Biosensor anhaften, identiziert und charakterisiert. Der Test wird mit einer minimalen Zahl an<br />
Handlungsschritten durchgeführt und benötigt keine Anreicherung der Blutprobe. So wird verhindert,<br />
dass fötale Zellen verloren gehen.<br />
2.) Ein neuartiger, nicht-invasiver Test zur Überwachung von Krebs<br />
Viele neue Studien lassen darauf schließen, dass die Erkennung zirkulierender Tumorzellen (CTCs)<br />
im peripheren Blut der Patienten große Potenziale birgt. So dient sie als wichtiges Werkzeug <strong>für</strong> die<br />
Krebsprognose, als Diagnose <strong>für</strong> eine minimale Resterkrankung, sie hilft bei der Beurteilung der<br />
Tumorsensibilität gegenüber Antikrebsmedikamenten und unterstützt die persönliche Antikrebstherapie.<br />
Der Nachweis der zirkulierenden Tumorzellen könnte auch bei frühen Diagnosen von invasiven<br />
Krebsarten helfen. Denn manche Studien haben gezeigt, dass die CTCs schon im frühen Stadium der<br />
Tumorbildung im peripheren Blut zirkulieren.<br />
Verschiedene Methoden sind entwickelt worden, um die CTCs zu isolieren und zu identizieren. Sie<br />
basieren alle auf der Anreicherung von Blutzellen, die vom Patienten entnommen werden. Jedoch<br />
erzielen diese Methoden weniger Menge an CTC als gewünscht oder lediglich eine sehr schlechte<br />
Reinheit. Die technische Herausforderung der CTC-Erkennung besteht in der Schwierigkeit, die<br />
äußerst raren Tumorzellen zu nden – in einem Milliliter Blut sind nur wenige CTCs zusammen mit<br />
Milliarden anderer Zellen – und diese von Nicht-Tumorzellen, Leukozyten und Epithelzellen (Deckgewebszellen)<br />
zu unterscheiden. Ein weiteres großes Hindernis beim Erkennen von CTCs ist ihre Zerbrechlichkeit.<br />
Dies zeigt sich schon innerhalb von 24 Stunden nach der Blutabnahme: CTCs werden<br />
durch die Blutspeicherung mit konservierenden Wirkstoffen und die verschiedenen Behandlungsschritten<br />
und Übertragungen zerbrechlich. Dies kann plötzlichen Zelltod, Zellverlust oder Kontamination<br />
hervorrufen – mit entsprechend dramatischem Effekt auf das Prüfverfahren, besonders wenn man mit<br />
einer geringen Zahl an Proben arbeitet.<br />
62<br />
www.mpg.de<br />
© <strong>2008</strong> <strong>Max</strong>-<strong>Planck</strong>-Gesellschaft