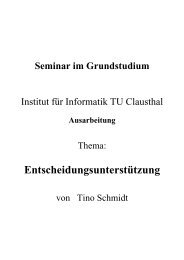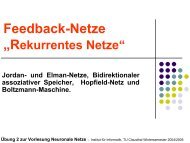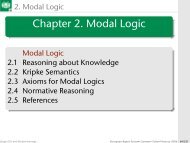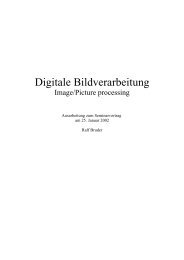Ergonomie von Präsentationen - Institut für Informatik
Ergonomie von Präsentationen - Institut für Informatik
Ergonomie von Präsentationen - Institut für Informatik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fläche nicht mehr besonders auf und der Effekt der Betonung fällt weg. Ausserdem wirkt eine bunte<br />
Darstellung leicht unübersichtlich, weil der Zuhörer nicht so schnell überblickt, was das eigentlich<br />
Wichtige ist. Des weiteren hat jeder einen eigenen Geschmack und bei Verwendung vieler Farben<br />
stösst man leicht an die Geschmacksgrenzen des Publikums. Wer will schon, dass der eigene Vortrag<br />
als „der, mit den grässlichen Farben“ in Erinnerung bleibt, anstatt die wichtigen Inhalte?<br />
Für gute Erkennbarkeit sorgt hoher Kontrast. Tannengrüne Schrift auf olivgrünem Hintergrund ist<br />
kaum bis gar nicht erkennbar. Schrift sollte dunkel auf hellem Hintergrund sein, da sich dies in<br />
unserer Wahrnehmung eingeprägt hat.<br />
1.5.Das Verständnis<br />
Das Verständnis ist wohl einer der wichtigste Punkte, auf den es Rücksicht zu nehmen gilt. Die<br />
Situation ist folgende: Der Vortragende beschäftigt sich tage-, wochen-, monate- oder sogar jahrelang<br />
mit einem Thema und soll nun darüber einen Vortrag halten. Er muss sich dabei einige sehr<br />
wichtige Fragen stellen: „Was möchte ich meinen Zuhörern vermitteln?“ und „Wie verstehen sie es<br />
am besten?“. Auf die erste Frage gehe ich im zweiten Kapitel noch ein. Zur zweiten Frage gibt es<br />
viele Antworten, die alle zu nennen, ein eigenständiges Thema wäre. Ich möchte daher nur auf die<br />
meiner Meinung nach wichtigsten Punkte eingehen. Da wäre zunächst einmal die Vermeidung <strong>von</strong><br />
Tabellen. In der kurzen Zeit, wo eine Folie mit einer Tabelle gezeigt wird, ist es kaum möglich, diese<br />
komplett zu lesen und zu verstehen. Dazu kommt, dass der Zuhörer nebenbei auch noch den<br />
Ausführungen des Vortragenden zu folgen hat. Das Verständnis mag, ebenso wie das Gedächtnis<br />
(siehe auch 1.6.), keine Zahlen. Tabellen müssen in Diagramme oder äquivalente Darstellungen<br />
übersetzt werden. Bei diesen ist darauf zu achten, dass sie immer vollständig, präzise und kurz beschriftet<br />
sind. Abkürzungen werden immer dafür sorgen, dass sich das Auditorium fragt, ob es alles<br />
richtig verstanden hat und sich nie sicher ist. Ausser allgegenwärtigen Abkürzungen wie beispielsweise<br />
z.B., s.o., o.ä., usw., etc., Einheiten-Abkürzungen wie m für Meter, kg für Kilogramm,<br />
sind Abkürzungen zu vermeiden. Bei Fachpublikum ist dieser Bereich der gängigen Abkürzungen<br />
natürlich je nach Fachrichtung zu erweitern. Kein Physiker wird fragen, wofür N bei einer Kraftangabe<br />
steht. Es ist jedoch immer nur <strong>von</strong> absolutem Grundwissen als Wissensbasis beim Publikum<br />
auszugehen. Ähnliches wie für Abkürzungen gilt auch für Formeln: Je heterogener das Publikum ist,<br />
desto weniger Formeln dürfen in den Vortrag. Formeln brauchen viel Konzentration und Zeit, um<br />
verstanden zu werden. Ersteres sollte zu grossen Teilen auf den Ausführungen des Vortragenden<br />
liegen und zweiteres ist selten genug vorhanden (siehe auch Kapitel 3, "Das Problem Zeitnot").<br />
Symmetrische Schemata und Abbildungen müssen immer komplett dargestellt werden. Sicher kann<br />
sich der Zuhörer die andere Hälfte denken, aber dies kostet Zeit und Aufmerksamkeit.<br />
Für das Auditorium ist es leichter, Differenzen als absolute Grössen zu erfassen. Wenn beispielsweise<br />
- 6 -