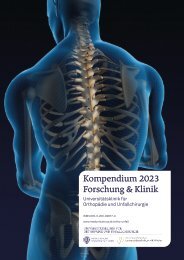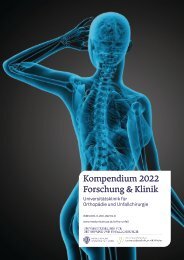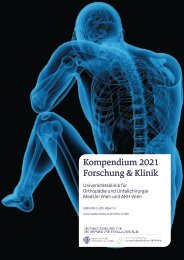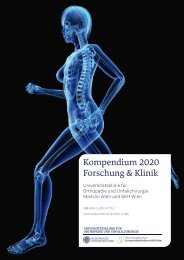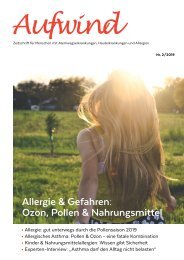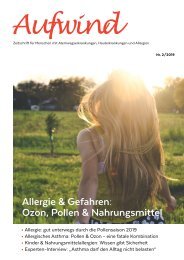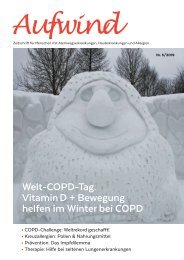KONGRESSJOURNAL 2014 public
Das Fachmagazin wurde beim Kongress für Allgemeinmedizin publiziert. Die Inhalte setzen sich aus Live-Berichten, Vorträgen und Interviews mit Referenten zusammen. Die Fachinserate werden hier nicht angezeigt, da diese nicht für die Öffentlichkeit erlaubt sind. Graz/29. November 2014
Das Fachmagazin wurde beim Kongress für Allgemeinmedizin publiziert. Die Inhalte setzen sich aus Live-Berichten, Vorträgen und Interviews mit Referenten zusammen. Die Fachinserate werden hier nicht angezeigt, da diese nicht für die Öffentlichkeit erlaubt sind. Graz/29. November 2014
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bei Typ-2-Diabetes<br />
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Gut gerüstet –<br />
einfach sicher fühlen!<br />
AT/JEN/00021 07.11.<strong>2014</strong><br />
Fachkurzinformation auf Seite 28<br />
Kongress_Journal_covercorner_10.11.14.indd 1 14.11.14 10:40<br />
Offizielle Kongresszeitung der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin Graz/29. November <strong>2014</strong><br />
45. Kongress für Allgemeinmedizin<br />
Der jugendliche Patient<br />
in der Allgemeinpraxis<br />
Interview mit Dr. Reinhold Glehr<br />
Viel in Bewegung<br />
Über den Hausarzt<br />
als zentrale Schnittstelle<br />
wird in der<br />
Politik schon lange<br />
diskutiert. Ergebnisse<br />
gibt es aber<br />
kaum. Dennoch<br />
sieht ÖGAM-Präsident<br />
Dr. Reinhold<br />
Glehr derzeit viel Bewegung in der Politik<br />
und hofft darauf, dass die Stellung der<br />
Allgemeinmedizin in Österreich endlich<br />
aufgewertet wird. Seite 14<br />
Müde Jugendliche<br />
Die Eulen der Nacht<br />
Ins Bett gehen die jugendlichen Nachteulen<br />
erst nach Mitternacht. „Dies führt<br />
zu einer verkürzten Gesamtschlafdauer<br />
und einem Schlafdefizit“, erklärte Prim.<br />
Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl. TV, Handy<br />
und Social Media bzw. Internet sind<br />
zusätzliche Schlafräuber. Seite 16<br />
Sexualmedizin<br />
Tanz der Hormone<br />
Für Pubertierende sind die Eltern vernunftgesteuert,<br />
langweilig, nicht offen<br />
für Neues, peinlich und uncool. Letztlich<br />
ist die Erwachsenenwelt nicht mehr die<br />
Welt der Pubertierenden. „Neue Verhaltensmuster<br />
müssen sich aber erst etablieren,“<br />
so Dr. Elia Bragagna. Seite 26
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
IMPRESSUM<br />
Medieneigentümer & Herausgeber:<br />
Crisafulli & Stodulka<br />
Unlimited Media GmbH<br />
Unlimited Media<br />
Verlag & Redaktion:<br />
Salierigasse 26/4, 1180 Wien<br />
Kontakt:<br />
office@unlimitedmedia.at,<br />
Thomas Stodulka: 0699/11 08 92 73<br />
unlimitedmedia.at, zoe.imwebtv.at<br />
Chefredaktion:<br />
Thomas Stodulka, Eliana Crisafulli,<br />
INHALT<br />
4 Kongressleiter Dr. Walter Fiala im Interview<br />
6 Polypharmazie: Wirkung & Wechselwirkung<br />
6 Österreichischer Impfplan <strong>2014</strong>: Impfen in der Praxis<br />
8 Impressionen <strong>2014</strong>: Kongress im Bild<br />
10 Allergien im Jugendalter: Es liegt was in der Luft<br />
10 Kinder- und Jugendpsychiatrie: Angst, Panik und Depression<br />
12 Junge Allgemeinmediziner Österreich: Nachwuchs-Schwierigkeiten<br />
13 Homöopathie bei Kindern und Jugendlichen<br />
14 Allgemeinmedizin in Österreich: Dr. Reinhold Glehr im Interview<br />
16 Müde Jugendliche: Wenn die Nacht zum Tag wird<br />
17 Logotherapie & Existenzanalyse: Christoph Schlick im Interview<br />
18 Welt-Diabetes-Tag: Dem Diabetes ins Gesicht schauen<br />
20 Drogenmissbrauch und häufig verwendete Substanzen<br />
21 Allergien und Intoleranzen: Wenn etwas nicht vertragen wird<br />
22 Adipositas bei Jugendlichen: Kampf dem Obelix-Syndrom<br />
24 Seltene Erkrankungen in der Allgemeinpraxis<br />
26 Interview mit Dr. Elia Bragagna: Tanz der Hormone<br />
27 Männer, Tattoos, Piercing: Haut und Körper als Symbol<br />
30 Schulungsinitiative: Inhalieren richtig gemacht<br />
Lektorat: Alexandra Lechner<br />
Art Direktion & Layout:<br />
Unlimited Media<br />
Anzeigenberatung:<br />
Alexandra Szczepanik, WebOwls;<br />
franke media kg, www.frankemedia.at;<br />
Clemens Lindinger<br />
Druck:<br />
Druckerei Odysseus Stavros<br />
Vrachoritis GmbH,<br />
Haideäckerstraße 1, 2325 Himberg<br />
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit<br />
wird auf eine geschlechtsspezifische<br />
Differenzierung verzichtet.<br />
Entsprechende Begriffe gelten im<br />
Sinne der Gleichbehandlung für<br />
beide Geschlechter. In den Texten<br />
wird durchgängig die männliche<br />
Form benutzt. Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes<br />
sind diese Bezeichnungen<br />
als nicht geschlechtsspezifisch<br />
zu betrachten.<br />
Offizielle Kongresszeitung der<br />
Steirischen Akademie für<br />
Allgemeinmedizin<br />
Graz <strong>2014</strong> <strong>KONGRESSJOURNAL</strong> 3
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Kongressleiter Dr. Walter Fiala im Interview<br />
Der Kongress boomt:<br />
1.800 Teilnehmer<br />
Seit 45 Jahren treffen sich Österreichs Allgemeinmediziner Ende<br />
November in der Stadthalle Graz zur Fortbildung, zum Erfahrungs-<br />
und zum Informationsaustausch. Auch heuer werden<br />
insgesamt 1.800 Kongressbesucher erwartet. Während andere<br />
Kongresse unter schwindenden Teilnehmerzahlen und leeren<br />
Ausstellerhallen leiden, boomt Graz. Wir baten Dr. Walter Fiala<br />
gleich am Eröffnungstag zum Gespräch. Im Interview erklärt der<br />
Kongressleiter, was die Steirische Akademie für Allgemein- und<br />
Familienmedizin (STAFAM) anders macht als die anderen.<br />
Dr. Walter Fiala freute sich schon<br />
am Eröffnungstag auf die vielen<br />
angemeldeten Teilnehmer.<br />
Foto: Siss Furgler<br />
Was ist das Besondere an diesem<br />
Kongress, dass er auch nach 45<br />
Jahren so gut funktioniert?<br />
Die Besonderheit besteht darin,<br />
dass an drei Tagen ein Generalthema<br />
in Vorträgen und Seminaren<br />
aufbereitet wird. Die Themen und<br />
Vortragenden werden vom Vorstand<br />
der STAFAM nach den Bedürfnissen<br />
der Allgemeinmedizin ausgesucht.<br />
Wir ersuchen alle Vortragenden nur<br />
die deutsche Sprache zu verwenden,<br />
auch bei den Projektionen. Es behindert<br />
die Konzentration, wenn der<br />
Vortragende Deutsch spricht und auf<br />
den Dias eine andere Sprache aufscheint.<br />
Wir ersuchen auch, alle Abkürzungen<br />
auszuschreiben. Täglich<br />
werden neue Kürzel erfunden und es<br />
grenzt an Hochmut vorauszusetzen,<br />
dass jeder Teilnehmer alle kennen<br />
muss. Und wir versuchen, Vortragende<br />
zu ermutigen, auf Statistiken und<br />
Studien zu verzichten. Vielmehr geht<br />
es um deren eigene Erfahrungen.<br />
Wie wichtig ist für den<br />
Allgemeinmediziner Fortbildung?<br />
Ein großer Allgemeinmediziner, Gerhart<br />
Tutsch, hat gesagt: „Der Allgemeinmediziner<br />
muss wissen, was<br />
es gibt, und können, was er tut!“ Im<br />
raschen Wechsel und der Zunahme<br />
des Wissens ist der Allgemeinmediziner<br />
besonders gefordert, er soll<br />
sich in fast allen medizinischen Wissensgebieten<br />
auskennen. Und dies<br />
vor dem Hintergrund der enormen<br />
Überbelastung in den Ordinationen.<br />
Zudem sind wir die einzige Berufsgruppe<br />
der Welt, die Fortbildung in<br />
ihrer Freizeit – oder Dienstzeit mit<br />
Bezahlung einer Vertretung – auf eigene<br />
Kosten betreibt, die sich nicht<br />
gleich in Mehrverdienst umsetzen<br />
lässt, wie etwa Ultraschall- und Endoskopiekurse<br />
für Internisten.<br />
Was erwartet die Teilnehmer<br />
heuer beim Kongress?<br />
Freilich sind wir an neuesten Ergebnissen<br />
aus der Forschung interessiert,<br />
aber wichtiger sind uns die persönlichen<br />
Erfahrungen unserer Vortragenden,<br />
denen wir auch ohne lange<br />
Aufzählungen von Statistiken und<br />
Studien vertrauen. Die Pharmazeutische<br />
Ausstellung und das Abendprogramm<br />
geben zusätzlich Raum<br />
und Zeit für Gedankenaustausch, der<br />
genauso wichtig ist wie die Wissensvermittlung<br />
im Vortragssaal.<br />
Diesmal lautet das Thema: Jugend.<br />
Welche Highlights gibt es?<br />
Bei der jugendlichen Patientengruppe<br />
ist es wichtig, das Vertrauen<br />
zu gewinnen. Kein Jugendlicher will<br />
krank sein, außer in akuten Situationen.<br />
Von Psyche über Sucht, Verletzungen,<br />
Stoffwechselerkrankungen<br />
bis hin zur Sexualität deckt der<br />
Kongress viele Behandlungssituationen<br />
ab. Sehr wichtig ist uns auch<br />
der Festvortrag, der uns zeigen wird,<br />
dass die Jugend immer ein Spiegel<br />
unserer Gesellschaft ist. Nur durch<br />
die Änderung unseres Verhaltens ist<br />
die Jugend positiv beeinflussbar.<br />
Gibt es schon ein Kongressthema<br />
für das Jahr 2015?<br />
Für das nächste Jahr haben wir ein<br />
ungemein spannendes und herausforderndes<br />
Thema gewählt: Der<br />
Mensch zwischen Naturwissenschaft<br />
und Heilkunst. Darauf freuen<br />
wir uns schon heute.<br />
Infos zum Kongress 2015<br />
und eine komplette<br />
Kongressnachlese finden Sie auch<br />
im Internet: www.stafam.at<br />
4 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Impressionen <strong>2014</strong><br />
Kongress<br />
im Bild<br />
Jugendliche zum Thema des<br />
Kongresses zu machen, war keine<br />
leichte Aufgabe. Zudem sind und<br />
waren Jugendliche immer ein<br />
Spiegelbild der Gesellschaft. Auch<br />
heute sind Drogen, Pornofilme und<br />
Lokale, die rund um die Uhr offen<br />
haben, keine isolierten Probleme<br />
der Jugend, sondern dienen vor<br />
allem den Erwachsenen für deren<br />
Gewinnmaximierung.<br />
„Aber der Kongress ist gut gelungen,<br />
die Themen sind vielfältig, interessant<br />
und praxisnah“, freute sich<br />
Kongressleiter Dr. Walter Fiala bei<br />
der Eröffnungsrede am Donnerstag.<br />
Zum 45. Mal treffen sich <strong>2014</strong><br />
die Allgemeinmediziner in Graz,<br />
insgesamt 60.000 teilnehmende<br />
Besucher stellen der Steirischen<br />
Akademie für Allgemeinmedizin ein<br />
besonderes Zeugnis aus. Dass die<br />
Ärztinnen und Ärzte, deren Mitarbeiter<br />
und auch die Aussteller begeistert<br />
waren, bezeugt nicht zuletzt<br />
diese Fotocollage. Das Thema des<br />
nächsten Kongresses steht auch<br />
schon fest: Der Mensch zwischen<br />
Naturwissenschaft und Heilkunst.<br />
8 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
9 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Polypharmazie<br />
Wirkung & Wechselwirkung<br />
Polypharmazie ist in der Allgemeinpraxis ein breiter und wichtiger<br />
Themenkomplex. Allerdings existiert nicht einmal eine einheitliche<br />
Definition des Begriffs. Jedes einzelne Medikament hat nicht nur Wirkung,<br />
sondern auch Nebenwirkungen. Je mehr Medikamente ein Patient<br />
einnimmt, umso größer ist auch die Gefahr einer Polypharmazie.<br />
Das Gefahrenpotential steigert sich<br />
vor allem bei älteren und multimorbiden<br />
Patienten und solchen,<br />
die in Behandlung mehrerer Ärzte<br />
oder Spitäler stehen. Dr. Reinhild<br />
Höfler, niedergelassene Ärztin für<br />
Allgemeinmedizin in Graz, Lehrbeauftragte<br />
für Allgemeinmedizin an<br />
der MUG, sieht das Problem aber<br />
nicht nur aus der Sicht der Verschreiber:<br />
„Teilweise ist die Verordnung<br />
mehrerer bis vieler Medikamente<br />
unumgänglich. Oft handelt<br />
es sich aber um zusätzliche, unbeabsichtigte<br />
oder sogar unbemerkte<br />
Einnahme von Medikamenten oder<br />
pharmakologisch wirksamer Substanzen.<br />
Hier wird die Polypharmazie<br />
zum Problem, das nur alle gemeinsam<br />
lösen können.“<br />
Über das Thema „gewohnheitsmäßige<br />
Eigenmedikation“ erfährt oftmals<br />
die Assistentin viel mehr Details. Die<br />
Patienten plaudern gerne über Ratschläge<br />
von Nachbarn, alte Hausmittel<br />
und Tipps aus Zeitschriften. Der<br />
behandelnde Arzt muss dafür schon<br />
sehr gezielt nachfragen. Häufig ist den<br />
Patienten gar nicht bewusst, dass<br />
auch pflanzliche Substanzen – zum<br />
Beispiel in Tees – eine Arzneimittelwirkung<br />
haben. Dadurch sind aber<br />
auch Wechselwirkungen mit verordneten<br />
Medikamenten möglich.<br />
Auch viele weitere Faktoren, unter<br />
anderem nicht gewartete Medikamentenlisten<br />
sowie wechselnde<br />
Betreuungspersonen und dadurch<br />
entstehende Kommunikationsprobleme<br />
oder Verwechslungen durch<br />
unterschiedliche Handelsnamen von<br />
Medikamenten bei gleichen Wirkstoffen<br />
können ein folgenschweres aber<br />
vermeidbares Problem darstellen.<br />
Foto: Dr. Reinhild Höfler<br />
Österreichischer Impfplan <strong>2014</strong><br />
Impfen<br />
in der Praxis<br />
Jedes Jahr wird der Impfplan<br />
in Österreich in enger Zusammenarbeit<br />
zwischen dem BM für<br />
Gesundheit und Experten des<br />
Nationalen Impfgremiums überarbeitet.<br />
In seinem Seminar gibt<br />
Univ.-Prof. Dr. Ingomar Mutz,<br />
einen Überblick über die wichtigsten<br />
Fakten und Neuheiten.<br />
Bei der heurigen Neuauflage ging es<br />
darum, einen einfacheren Überblick<br />
über aktuelle, zur Verfügung stehende<br />
Impfungen zu geben. Auch wird eine<br />
bessere Differenzierung zwischen jenen<br />
Kernimpfungen getroffen, welche<br />
im Rahmen des kostenlosen Kinderimpfprogramms<br />
von der Öffentlichkeit<br />
getragen werden, und anderen<br />
wichtigen Impfungen, welche nicht<br />
im öffentlichen Impfkonzept bereitgestellt,<br />
aber dennoch für den Individualschutz<br />
empfohlen werden.<br />
Der Impfplan Österreich <strong>2014</strong> enthält<br />
mehrere signifikante Veränderungen.<br />
Eine davon ist etwa die Aufnahme<br />
der HPV-Impfung in das öffentlich finanzierte<br />
Schulkinderimpfprogramm<br />
für Buben und Mädchen. Weiters enthält<br />
der Plan wichtige Informationen<br />
über die Ausweitung der kostenlosen<br />
Masern-Mumps-Röteln-Impfung<br />
und die Aufhebung der Altersgrenze<br />
von 45 Jahren. Im Seminar gibt Ingomar<br />
Mutz aber nicht nur einen umfassenden<br />
Überblick über Impfen in der<br />
Praxis, sondern geht auf die Themen<br />
Impfaufklärung, Impftechnik, Nebenwirkungen,<br />
Impfängste, Besonderheiten<br />
in der Schwangerschaft, bei<br />
Reisen sowie die neueren Impfungen<br />
gegen Humane Papillomviren, Herpes<br />
zoster und Meningokokken B ein.<br />
Ärzteseminar: „Impfen in der Praxis“<br />
SA 9.00 – 12.00<br />
6 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Allergien im Jugendalter<br />
Es liegt was in der Luft<br />
Allergien und Asthma sind<br />
gerade bei Jugendlichen ein<br />
weltweites Problem. Denn in<br />
vielen Ländern, wie auch in<br />
Österreich, gibt es einen Anstieg<br />
der Erkrankungshäufigkeit<br />
bei der allergischen Rhinitis –<br />
Tendenz weiterhin steigend.<br />
Prim. Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak, Allergiezentrum<br />
Wien West, ging in seinem<br />
Vortrag auf den epidemiologischen<br />
Hintergrund ein. Frühzeitiger Allergenkontakt,<br />
Umweltschadstoffe und<br />
mangelnde Schutzfaktoren sind die<br />
Probleme. Er erörterte auch die Frage,<br />
warum Kinder und Jugendliche überhaupt<br />
Allergien bekommen. Wichtig<br />
ist in diesem Zusammenhang das<br />
Immunsystem, denn es kann sich<br />
unter verschiedenen Einflussfaktoren<br />
entweder in Richtung Allergie<br />
oder Toleranz entwickeln. Bestehen<br />
einmal allergieverdächtige Symptome,<br />
ist die richtige und rechtzeitige<br />
Diagnostik relevant. Die Anamnese<br />
ist hier immer noch das wichtigste<br />
Tool des Allergologen. Meist folgen<br />
ein Haut-Allergietest und/oder die<br />
Bestimmung spezifischer IgE im Serum<br />
des Patienten. Bei bestimmten<br />
Fragestellungen ist auch eine Komponentendiagnostik<br />
hilfreich. „Auch<br />
der Allergen-Chip kann einen guten<br />
Einblick in das spezifische Profil eines<br />
Allergiepatienten geben, ist aber nicht<br />
in jedem Fall indiziert“, so Fritz Horak.<br />
Die richtige Therapie ist bei allen<br />
Allergien entscheidend. Neben der<br />
Allergenkarenz, die nicht für jedes Allergen<br />
gleich gut möglich ist, sind die<br />
symptomatische Therapie und die<br />
spezifische Immuntherapie wichtige<br />
Säulen in der Behandlung. Für<br />
die symptomatische Therapie liegen<br />
je nach Symptomatik verschiedene<br />
Leitlinien vor, die ein meist stufenweises<br />
Vorgehen nahelegen. Lokale<br />
Therapiemaßnahmen stehen hier<br />
systemischen Ansätzen gegenüber.<br />
Die spezifische Immuntherapie ist die<br />
wichtige dritte Säule in der Behandlung.<br />
Sie ist die einzige kausale Therapieform,<br />
die das Immunsystem nachhaltig<br />
positiv beeinflussen kann. Dabei<br />
kommt es vor allem auf eine richtige<br />
Patienten- und Präparate-Auswahl<br />
Prim. Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak:<br />
„Frühzeitiger Allergenkontakt,<br />
Umweltschadstoffe und mangelnde<br />
Schutzfaktoren sind die Probleme.“<br />
an, um einen guten Therapieerfolg zu<br />
gewährleisten. Dadurch wird auch das<br />
Risiko von Nebenwirkungen gering<br />
gehalten. Fritz Horak: „Die Zukunft der<br />
Allergologie ist aber weiterhin spannend.<br />
In wenigen Jahren werden neue<br />
Tabletten-Anwendungen der sublingualen<br />
Immuntherapie auf den Markt<br />
kommen. Außerdem wird an weiteren<br />
Applikationswegen der spezifischen<br />
Immuntherapie gearbeitet.“<br />
Infos: www.allergiezentrum.at<br />
Foto: privat<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
Angst, Panik und Depression<br />
Schon die Brüder Grimm schrieben<br />
in ihren Märchen über „Einen,<br />
der auszog, das Fürchten zu lernen“.<br />
Dr. Thomas Kröpfl, Graz: „Viele Kinder<br />
und Jugendliche brauchen das<br />
heute nicht. Leider haben rund 20<br />
Prozent der Kinder und Jugendlichen<br />
psychische oder psychosoziale<br />
Probleme.“ Sie leiden an Ängsten,<br />
Depressionen, sie werden gemobbt<br />
oder schikaniert und schweben dabei<br />
manchmal sogar in Suizidgefahr. Leider<br />
sind viele Angststörungen stabil,<br />
sind also Grundlage für psychische<br />
Störungen im Erwachsenenalter.<br />
Die gute Nachricht: Diese Probleme<br />
sind behandelbar, aber sie müssen<br />
rechtzeitig erkannt werden. Für den<br />
Allgemeinmediziner ist wichtig, die<br />
Ängste der kleinen Patienten ernst zu<br />
nehmen. Auch sollte er sehr genau<br />
auf den Zeitpunkt des Auftretens, die<br />
Dauer und Ausprägung der Angstsymptomatik<br />
achten. Immerhin verüben<br />
acht bis neun Prozent der Jugendlichen<br />
einen Suizidversuch und<br />
einer von 1.500 Jugendlichen stirbt.<br />
10 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Junge Allgemeinmediziner Österreich<br />
Nachwuchs-Schwierigkeiten<br />
Die Allgemeinmedizin in<br />
Österreich steckt momentan<br />
in einer schwierigen Phase.<br />
„Die Ausbildungsreform ist<br />
nicht der große Wurf, den wir<br />
uns erhofft haben“, erklärt<br />
Dr. Maria Wendler, Ärztin in<br />
Ausbildung zum Fach Allgemeinmedizin<br />
in Linz, Mitglied<br />
der JAMÖ – Junge Allgemeinmedizin<br />
Österreich.<br />
Infos für Jungmediziner: Angebote, Aktivitäten und Vernetzungsmöglichkeiten<br />
Fotos: Unlimited Media<br />
Dr. Maria Wendler<br />
Es gibt immer noch keinen Facharzt<br />
für Allgemeinmedizin, die Ausbildungsstellen<br />
für Sonderfächer sind<br />
im Vergleich zu vor wenigen Jahren<br />
leicht zu haben und die Reform der<br />
Primärversorgung gibt zwar Hoffnung<br />
für die Zukunft, besteht bisher<br />
aber nur aus schönen Worten. „Unter<br />
solchen Umständen ist es besonders<br />
wichtig, dass wir unsere eigenen Ressourcen<br />
mobilisieren - als Individuen<br />
und als Interessensgemeinschaft. Vor<br />
allem als junge Allgemeinmediziner<br />
müssen wir uns untereinander mehr<br />
vernetzen“, so Dr. Maria Wendler. Es<br />
geht darum, Erfahrungen auszutauschen<br />
und Strategien zu entwickeln,<br />
um den widrigen Umständen zu<br />
trotzen. Maria Wendler: „Unser Ziel<br />
ist es ja, gute Allgemeinmediziner zu<br />
werden. Um das zu erreichen, müssen<br />
wir aber aktiv die Entwicklung im<br />
positiven Sinne mitgestalten.“<br />
Deshalb nutzen die Mitglieder der<br />
JAMÖ den Grazer Kongress für Allgemeinmedizin,<br />
um am JAMÖ-<br />
Stand über ihre Aktivitäten und<br />
Angebote zu sprechen: etwa den<br />
„Journal Club Primary Care“ in Wien,<br />
ein internationales Austauschprogramm,<br />
oder die Förderung der<br />
Teilnahme an internationalen Kongressen.<br />
Der Workshop beim Allgemeinmedizinkongress<br />
diente vor<br />
allem der Kommunikation und der<br />
Vernetzung. In den letzten Jahren hat<br />
er sich zu einer Plattform für den Austausch<br />
zwischen erfahrenen Hausärzten,<br />
jungen Allgemeinmedizinern,<br />
Turnusärzten und sogar Studenten<br />
entwickelt. Mittlerweile ist der JAMÖ-<br />
Workshop ein Fixpunkt im Kongressprogramm.<br />
Maria Wendler: „Als eine<br />
der größten, regelmäßigen Allgemeinmedizinveranstaltungen<br />
in Österreich<br />
ist der Kongress eine willkommene<br />
Gelegenheit, sich zusammenzufinden<br />
und Neuigkeiten zu diskutieren.“<br />
Im Zentrum standen Fragen aus<br />
dem Bereich der postgraduellen<br />
Ausbildung, zum Beispiel: Wie reagieren<br />
die Krankenhäuser in den<br />
verschiedenen Regionen auf die sinkende<br />
Verfügbarkeit von Allgemeinmedizin-Turnusärzten?<br />
Aber es wurde<br />
auch über die Auswirkungen auf<br />
die Ausbildungsqualität diskutiert.<br />
Welche Verbesserungsbestrebungen<br />
gibt es und wie kann man sie vielleicht<br />
im eigenen Umfeld umsetzen?<br />
Andere Themen waren die Visionen<br />
der Jungmediziner, die Zukunft der<br />
Allgemeinmedizin, Forschung, aber<br />
auch neue Arbeitsstrukturen.<br />
Die JAMÖ freut vor allem die Teilnahme<br />
der unterschiedlichen Grupen.<br />
Für Studenten war der Workshop<br />
eine gute Gelegenheit, sich für<br />
die zukünftigen Herausforderungen<br />
zu wappnen, um das Bestmögliche<br />
aus Studium und Turnus herauszuholen.<br />
Ärzte, die den Turnus bereits<br />
hinter sich haben, diskutierten<br />
über Vertretungen oder die ersten<br />
Schritte in der eigenen Niederlassung.<br />
Aber auch erfahrene Hausärzte<br />
nutzten die Möglichkeit, ihren<br />
Erfahrungsschatz zur Verfügung zu<br />
stellen und die Sichtweisen der neuen<br />
Generationen kennen zu lernen.<br />
WEITERE INFOS:<br />
www.jamoe.at<br />
www.facebook.com/jungeallgemeinmedizin<br />
www.twitter.com/jungeAM<br />
12 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Homöopathie bei Kindern und Jugendlichen<br />
Ähnliches mit Ähnlichem behandeln<br />
Homöopathie behandelt individuell<br />
jede Person nach ihren<br />
Stärken und Schwächen in ihrer<br />
Gesamtheit. Nach Hahnemann<br />
(1755 bis 1843) gilt die Ähnlichkeitsregel,<br />
die besagt, dass eine<br />
Arznei das heilen kann, was sie<br />
selber darstellt.<br />
Dr. Holger Förster<br />
Ärzteseminar: „Homöopathie bei<br />
Jugendlichen“, SA 14.30 – 17.30<br />
Foto: privat<br />
Globuli sind vor allem bei viralen<br />
Infekten, allergischen Problemen oder<br />
Schlafstörungen höchst wirksam.<br />
„Homöopathie ist ein allgemein anerkanntes<br />
Naturheilverfahren, welches<br />
das gesamte Spektrum körperlicher,<br />
seelischer und geistiger<br />
Charakteristika von Kindern und Jugendlichen,<br />
die erkrankt sind, mit in<br />
die Behandlung einbezieht“, erklärt<br />
Dr. Holger Förster, Facharzt für Kinder-<br />
und Jugendheilkunde, Salzburg.<br />
In der homöopathischen Sprechstunde<br />
mit Jugendlichen geht es oft<br />
um allgemeinmedizinische Themen<br />
wie rezidivierende Infekte, Allergien,<br />
aber auch um spezielle Themen des<br />
Adoleszenten wie Akne, Regelbeschwerden,<br />
Körperwahrnehmungsstörungen<br />
bis hin zur Anorexie. Ein<br />
großes Thema sind auch „psychosomatische“<br />
Beschwerden in Form<br />
von Ticks, Kopf-Bauchschmerzen,<br />
Stottern und die Problembereiche<br />
Schlafen und Schule bis hin zu ADHS,<br />
Angststörungen und Depression.<br />
Homöopathie ist eine Regulationstherapie,<br />
das heißt, sie kann Veränderungen<br />
im Organismus positiv<br />
beeinflussen, solange keine strukturellen,<br />
materiellen Ursachen vorliegen.<br />
Holger Förster: „Wir wählen Arzneien<br />
aus dem pflanzlichen, tierischen, mineralischen<br />
Bereich in potenzierter<br />
Form üblicherweise als Globuli oder<br />
Tropfen. Neben der Therapie von<br />
einfachen viralen Infekten, die uns<br />
jetzt besonders begleiten, bewährt<br />
sich Homöopathie vor allem bei allergischen<br />
Problemen wie Pollinose<br />
oder Asthma und Verhaltensauffälligkeiten,<br />
sichtbar in Schulproblemen,<br />
Schlafstörungen oder auch im Formenkreis<br />
des ADHS.“<br />
Foto: Unlimited Media<br />
Besonderes Augenmerk wird naturgemäß<br />
auf die Anamnese gelegt,<br />
die bei Jugendlichen meist schwierig<br />
ist. Wichtig ist es, die Gesamtheit<br />
des Menschen zu erfassen und somit<br />
sind alle Eindrücke während eines<br />
homöopathischen Gespräches<br />
wichtig und vielleicht auch unwichtig<br />
erscheinende Nebensächlichkeiten<br />
zielführend bei der Wahl der Arznei.<br />
Im zweiten Schritt muss eine Arznei<br />
gesucht werden, die den gefundenen<br />
Charakteristika möglichst nahe<br />
kommt: Ähnliches mit Ähnlichem behandeln.<br />
Dabei kann man sich diverser<br />
Fragebögen bedienen, um schließlich<br />
aus Lehrbüchern, Algorithmentafeln<br />
oder Computerprogrammen eine<br />
gute Arznei zu finden. Eingegangen<br />
wird bei der komplexen Suche nach<br />
der richtigen homöopathischen Arznei<br />
aber auch auf bewährte Indikationen,<br />
die mit guter Sicherheit schnell zum<br />
Erfolg führen können. Holger Förster:<br />
„Wenngleich wir noch immer nicht<br />
die Wirkung der Homöopathie naturwissenschaftlich<br />
erklären können, so<br />
sehen wir doch im täglichen Umgang<br />
mit dieser Therapieform die teilweise<br />
verblüffende Wirksamkeit — auch an<br />
denen, die nicht daran glauben.“<br />
Infos: www.dr-foerster.at<br />
HILFE BEI<br />
DURCHSCHLAFSTÖRUNGEN:<br />
• Belladonna:<br />
plötzliches Auffahren aus Schlaf,<br />
heftiges Schreien, Zähneknirschen,<br />
rotes Gesicht, Schwitzen<br />
• Cypripedium:<br />
wacht munter auf und will spielen<br />
• Jalapa: schreit stundenlang<br />
• Zincum valerianum:<br />
allgemeine Unruhe, schweres<br />
Ein- und Durchschlafen<br />
Graz <strong>2014</strong> <strong>KONGRESSJOURNAL</strong> 13
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Allgemeinmedizin in Österreich: Dr. Reinhold Glehr im Interview<br />
„Viel in Bewegung“<br />
Über den Hausarzt als zentrale Schnittstelle wird in der Politik schon<br />
lange diskutiert. Ergebnisse gibt es aber kaum. Dennoch sieht<br />
Dr. Reinhold Glehr, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für<br />
Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM), derzeit viel Bewegung<br />
und hofft auf eine Neuordnung der Arbeitsverteilung zwischen<br />
stationärem und ambulantem Bereich.<br />
Wie sehen Sie die Stellung der Allgemeinmedizin<br />
in Österreich?<br />
Im österreichischen Gesundheitssystem<br />
ist derzeit viel in Bewegung. Mit<br />
dem Zielsteuerungsvertrag zwischen<br />
Bund und Ländern 2013 wurden<br />
strategische Ziele mit Programmcharakter<br />
für die Neuordnung der Arbeitsverteilung<br />
zwischen stationärem<br />
und ambulantem Bereich vereinbart.<br />
Multiprofessionelle, interdisziplinär<br />
organisierte Versorgungsformen unter<br />
einem Dach sollen eine wohnortnahe,<br />
permanent zugängliche Gesundheitsversorgung<br />
sicherstellen.<br />
Bestehende Ordinationen werden<br />
verbindlicher in Netzwerken zusammenarbeiten.<br />
An der Konkretisierung<br />
mit einer gestärkten Allgemeinmedizin<br />
wird intensiv gearbeitet. Wie die<br />
Umsetzung jedoch erfolgt, ist schwer<br />
abzusehen. Zu hoffen ist, dass Bewährtes<br />
im Eifer der Reform nicht<br />
zerstört und die Qualität der Versorgung<br />
nicht verschlechtert werden.<br />
Wird der Nachwuchs auf das Berufsleben<br />
als „Niedergelassener“<br />
gut vorbereitet?<br />
In der nun im Nationalrat verabschiedeten<br />
Ärztegesetznovelle hat sich viel<br />
geändert. Endlich soll nun die verpflichtende<br />
Lehrpraxis im Fach Allgemeinmedizin<br />
Wirklichkeit werden:<br />
im Umfang von sechs Monaten bei<br />
freiberuflichen Ärzten. Gleichzeitig<br />
wird der Allgemeinmedizin-Turnus<br />
als „Approbationsausbildung für alle<br />
Ärzte“ durch den neunmonatigen<br />
Common-Trunc ersetzt. Danach erfolgt<br />
die Entscheidung für die jeweilige<br />
Fachausbildung – auch in Richtung<br />
Allgemeinmedizin.<br />
Vor allem die Lehrpraxis ist ja ein<br />
Problemfall der letzten Jahre ...<br />
Die noch nicht gesicherte Finanzierung<br />
der Lehrpraxis ist wohl das entscheidende<br />
Kriterium. Wichtig wird<br />
aber auch sein, dass die Weiterbildung<br />
zum Arzt für Allgemeinmedizin in der<br />
vorgeschriebenen Zeit absolviert werden<br />
kann. Da müssen sich Kammer,<br />
Träger und niedergelassener Bereich<br />
sinnvoll einigen. Das bereits gestartete<br />
„Lehrpraxismodell Vorarlberg“<br />
mit Beteiligung von Bund, Land, Ärztekammer<br />
und Sozialversicherung<br />
stimmt mit seinen Qualitätskriterien<br />
und dem fugenlosen Wechsel in die<br />
Lehrpraxis aber hoffnungsvoll.<br />
In Deutschland fehlen schon viele<br />
Allgemeinmediziner. Haben wir<br />
auch in Österreich ein Problem<br />
beim Nachwuchs?<br />
Dr. Reinhold Glehr: „Wir haben in<br />
Europa ja keinen absoluten Mangel an<br />
Ärzten, sondern eher einen strukturellen,<br />
der aus Versäumnissen der letzten<br />
Jahre resultiert.“<br />
Die Rahmenbedingungen werden<br />
sich dem Bedarf rasch anpassen<br />
müssen, sonst ist dieselbe Problematik<br />
wie in Deutschland zu erwarten.<br />
Wir haben in Europa ja keinen absoluten<br />
Mangel an Ärzten, sondern eher<br />
einen strukturellen, der aus Versäumnissen<br />
der letzten Jahre resultiert.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen<br />
Krankenhaus und niedergelassener<br />
Praxis funktioniert nicht überall.<br />
Gibt es Lösungen für ein besseres<br />
Schnittstellenmanagement?<br />
Die Ärztenetzwerke nach dem Modell<br />
Styriamed.net stellen hier eine Entwicklung<br />
dar, die auch den Konzepten<br />
der Gesundheitssystem-Reform<br />
entspricht. Gemeinsam erarbeitete<br />
Regeln der Zusammenarbeit, bessere<br />
Kommunikation über Dringlichkeit,<br />
Öffnungszeiten und Urlaubszeiten,<br />
Telefonhotline für Nachfragen, bessere<br />
Definition des betreuenden Arztes,<br />
gemeinsame medizinische und<br />
organisatorische Meetings und ein<br />
gemeinsames Fehlermanagement<br />
können die Probleme an den Schnittstellen<br />
vermindern.<br />
Foto: privat<br />
14 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Müde Jugendliche<br />
Wenn die Nacht zum Tag wird<br />
Immer wieder sind auch Ärzte<br />
mit dem Problem Müdigkeit<br />
bei Jugendlichen konfrontiert.<br />
Schüler fallen durch Konzentrationsprobleme<br />
und schlechte<br />
Schulleistungen, Lehrlinge<br />
durch Fehlleistungen, aber<br />
auch durch eine erhöhte<br />
Unfallgefährdung auf.<br />
Prinzipiell ist eine veränderte Schlafgewohnheit<br />
in der Pubertät durchaus<br />
natürlich, da die Jugendlichen<br />
in relativ kurzer Zeit ihre gesamten<br />
Verhaltensmuster ändern. Ins Bett<br />
geht man erst nach Mitternacht. Dies<br />
führt zu einer verkürzten Gesamtschlafdauer<br />
und einem Schlafdefizit.<br />
TV, Handy und Social Media bzw.<br />
Internet sind zusätzliche Schlafräuber.<br />
„Die Verschiebung des Schlafes<br />
nach hinten geht auch mit hormonellen<br />
Verschiebungen einher“, erklärt<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold<br />
Kerbl, LKH Leoben. Verantwortlich<br />
dafür sind in erster Linie Cortisol und<br />
Melatonin. Wobei nicht ganz klar ist,<br />
ob die Hormone das Schlafverhalten<br />
beeinflussen oder umgekehrt.<br />
An Wochenenden kommt es durch<br />
den sozialen Gruppendruck zu einer<br />
zusätzlichen Schlafphasenverschiebung.<br />
Fortgehen bis in die frühen<br />
Morgenstunden und Schlaf bis am<br />
Nachmittag bringen das System<br />
umso mehr aus dem Gleichgewicht.<br />
Zwar wird das während der Schuloder<br />
Arbeitswoche angesammelte<br />
Schlafdefizit zum Teil kompensiert,<br />
gleichzeitig aber rächt sich dies am<br />
Montagmorgen, wenn die Jugendlichen<br />
für die Schule oder die Arbeit<br />
um 6:00 Uhr oder noch früher aufstehen<br />
müssen. „Müdigkeit kann bei<br />
Jugendlichen viele Ursachen haben,<br />
Jugendliche Nachteulen: Ins Bett geht man erst nach Mitternacht. Dies führt zu<br />
einer verkürzten Gesamtschlafdauer und einem Schlafdefizit. TV, Handy und<br />
Social Media bzw. Internet sind zusätzliche Schlafräuber.<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl:<br />
„Müdigkeit kann bei Jugendlichen viele<br />
Ursachen haben, auch organische –<br />
und die gehören abgeklärt.“<br />
auch organische – und die gehören<br />
abgeklärt“, meint Reinhold Kerbl. Es<br />
kann zum Beispiel eine Schlafapnoe<br />
(am häufigsten), ein Hypoventilationssyndrom,<br />
eine Anämie, ein<br />
Chronic-fatigue-Syndrom vorliegen<br />
oder auch eine psychische Erkrankung,<br />
vor allem eine Depression.<br />
Wenn mögliche organische Ursachen<br />
ausgeschlossen wurden, zielt<br />
ein erster Ansatz zur Hilfe auf eine<br />
Verhaltensänderung ab: Schlafhygiene,<br />
vernünftiger Gebrauch von<br />
Handy, TV und Internet, Vermeidung<br />
überlangen Fortgehens.<br />
In punkto medikamentöser Behandlung<br />
kann Melatonin in Betracht gezogen<br />
werden. Dies kann zu einer<br />
Vorverlagerung des Schlafbeginns<br />
und somit zu einer Verlängerung der<br />
Gesamtschlafdauer führen. Reinhold<br />
Kerbl: „Melatonin ist zwar als Medikament<br />
für Kinder nicht zugelassen,<br />
jedoch auch als Nahrungsergänzung<br />
erhältlich. Es ist im Grunde eine<br />
harmlose Substanz mit so gut wie<br />
keinen Nebenwirkungen.“ Trotzdem<br />
ist eine medikamentöse Therapie<br />
nicht erste Wahl und sollte auf seltene<br />
oder mit anderen Mitteln nicht<br />
beherrschbare Fälle beschränkt bleiben.<br />
Das gilt ebenfalls für das Wachstumshormon,<br />
das nur im extremen<br />
Ausnahmefall einer pathologischen<br />
Schlafphasenverschiebung indiziert<br />
ist. Auch eine Lichttherapie kann hilfreich<br />
sein. Ein vermehrter Blauanteil<br />
in den Morgenstunden und ein erhöhter<br />
Rotanteil in den Abendstunden<br />
fördern den gesunden Schlaf<br />
und tragen zu einer Normalisierung<br />
der Melatoninproduktion bei.<br />
Foto: privat<br />
16 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Logotherapie & Existenzanalyse: Christoph Schlick im Interview<br />
Suche nach Sinn und Werten<br />
Gerade bei Jugendlichen können Aggression und auch Depression<br />
eine Folge von nicht gefundenem bzw. verlorenem Sinn sein.<br />
Christoph Schlick, Leiter des Institutes für Logotherapie und<br />
Existenzanalyse in Salzburg, verfügt über eine langjährige Erfahrung<br />
in Forschung und Lehre, Beratung und Therapie nach Frankls<br />
Logotherapie und Existenzanalyse. Im Interview sprach er über<br />
sinnorientierte Psychotherapie, der Suche nach Sinn und Werten,<br />
aber auch über Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Wie können Logotherapie und Existenzanalyse<br />
helfen?<br />
Es geht um ein Menschenbild, das<br />
die Person in ihrer Freiheit und Verantwortung<br />
ernst nimmt. Der Mensch<br />
will sinnorientiert leben, er will Werte<br />
in den vielfältigen Situationen des<br />
Lebens finden und verwirklichen,<br />
sagt ihr Begründer, der Wiener Arzt<br />
und Philosoph Viktor E. Frankl. Mit<br />
der Existenzanalyse gibt uns Frankl<br />
Werkzeuge mit auf den Weg, um die<br />
Möglichkeiten, Wertigkeiten und den<br />
Sinn des eigenen Lebens zu entdecken.<br />
Die Logotherapie ist Lebenshilfe,<br />
um den erkannten Sinn auch<br />
im privaten und beruflichen Alltag<br />
ein- und umzusetzen.<br />
Ist die Suche nach dem Sinn bei<br />
Jugendlichen ein wichtiges Thema?<br />
Jugendliche sind sowieso unsicher,<br />
hinzu kommen die Pubertät und das<br />
Überangebot an Sinn und Werten.<br />
Daher geht es um die Frage: Wie können<br />
sich junge Menschen orientieren?<br />
Können sie sich überhaupt entscheiden?<br />
Viele Jugendliche kommen aus<br />
Familien, in denen sich die Strukturen<br />
immer mehr auflösen und sie immer<br />
weniger übernehmen können.<br />
Was wollen Sie dem Arzt vermitteln?<br />
In der sinnorientierten Psychotherapie<br />
geht es um Menschen, denen<br />
das Wofür fehlt. Dadurch tun sie sich<br />
schwer in ihrer Entwicklung und beruflichen<br />
Orientierung. Mir geht es<br />
nicht um Gesellschaftskritik, Ärzte<br />
sollten die Zusammenhänge kennen.<br />
Wenn ein Jugendlicher über<br />
körperliche Probleme spricht, steckt<br />
vielleicht eine psychische Verunsicherung<br />
dahinter.<br />
Christoph Schlick: „Die Logotherapie<br />
ist Lebenshilfe, um den erkannten<br />
Sinn auch im privaten und beruflichen<br />
Alltag ein- und umzusetzen.“<br />
Welche Tipps gibt es?<br />
Die Frage nach dem Sinn kann man<br />
nie direkt stellen. Besser ist: Was ist<br />
dir als Jugendlicher wichtig? Wenn<br />
ein junger Mensch dabei zu stottern<br />
beginnt, hat er Probleme oder keinen<br />
Halt. Im nächsten Schritt geht es<br />
darum, ihm zu helfen. Welche Tipps<br />
kann man dem Jugendlichen geben?<br />
Hat er eine Aufgabe? Wie schaut seine<br />
Beziehungsstruktur aus? Hat er<br />
Vertrauenspersonen? Hat er jemanden,<br />
mit dem er wirklich gut reden<br />
kann – nicht nur seine „oberflächlichen“,<br />
pubertierenden Freunde, die<br />
ähnliche Probleme haben. Hat er nur<br />
seine Eltern, von denen er sich lösen<br />
muss? Das wären die ersten Themen.<br />
Mein Grundansatz auf dieser Lösungsebene<br />
sind gut gelebte Beziehungen.<br />
Das muss man lernen: mit<br />
sich selbst in Bezug zu sein, zu wissen,<br />
wie es mir geht, was ich brauche.<br />
Welche Beziehung gibt es zu anderen<br />
Menschen? Welche Aufgaben<br />
habe ich? Wie ist der Bezug zur Welt,<br />
zur Natur, zur Kultur? Interessant ist,<br />
dass Jugendliche, die sich in irgendeiner<br />
Form musisch betätigen – sie<br />
müssen nicht musikalisch sein –, weniger<br />
gefährdet sind, eine Krise zu haben.<br />
Sie haben einen anderen Bezug<br />
zur Welt als Jugendliche, die nur am<br />
Konsum interessiert sind.<br />
Der Hausarzt wird meist nur der<br />
erste Ansprechpartner sein, nicht<br />
der Therapeut.<br />
Ja und es ist auch nicht notwendig,<br />
diese Jugendlichen in Therapie zu<br />
schicken. Der Arzt muss erkennen,<br />
dass es nicht um rasches Verschreiben<br />
eines Medikaments geht. Wichtig<br />
ist die Frage nach einem intakten<br />
Beziehungsnetz. Gerade bei jungen<br />
Menschen herrscht hier ein Defizit,<br />
daran sollte man immer denken.<br />
Infos: www.sinnzentrum.at<br />
Foto: Christian Jungwirth<br />
Graz <strong>2014</strong> <strong>KONGRESSJOURNAL</strong> 17
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Welt-Diabetes-Tag<br />
Dem Diabetes ins Gesicht schauen<br />
Etwa acht bis neun Prozent aller<br />
Menschen in Österreich leiden<br />
laut Diabetes-Bericht 2013<br />
an Diabetes. Sechs Prozent<br />
(430.000 Menschen) haben<br />
einen ärztlich diagnostizierten<br />
Diabetes, weitere 150.000 bis<br />
200.000 sind noch nicht diagnostiziert.<br />
Anlässlich des Welt-<br />
Diabetes-Tags am 14.11.<strong>2014</strong><br />
wies die Österreichische Diabetes<br />
Gesellschaft (ÖDG) auf die Gefahren<br />
des Diabetes mellitus hin.<br />
„Aufgrund des steigenden Lebensalters<br />
wird sich die Zahl der Betroffenen<br />
noch weiter erhöhen. Darum<br />
möchten wir einmal mehr darauf<br />
aufmerksam machen, was Diabetes<br />
bedeutet. Und zwar nicht nur<br />
für die Betroffenen – sowohl jene,<br />
die es wissen, als auch jene, die<br />
sich gar nicht bewusst über ihre<br />
Erkrankung sind – und ihre Angehörigen,<br />
sondern auch für das österreichische<br />
Gesundheitssystem<br />
und unsere Gesellschaft“, erklärt<br />
Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher,<br />
Hanuschkrankenhaus, Vorsitzender<br />
der ÖDG. Immerhin gibt es in Österreich<br />
rund 10.000 Todesfälle als<br />
Folge von Diabetes, 2.500 Amputationen,<br />
300 neue Dialysepatienten<br />
und 200 neu erblindete Patienten.<br />
Dieser Gefahr des Diabetes blickt<br />
man buchstäblich ins Auge, wenn<br />
man den Logos der ÖDG-Initiative<br />
„Face Diabetes“ begegnet. Mit dieser<br />
Initiative weist die ÖDG darauf hin,<br />
dass sich einerseits die Betroffenen<br />
täglich mit ihrer chronischen Erkrankung<br />
und deren Management auseinandersetzen<br />
müssen, aber auch<br />
die österreichische Politik, die Gesellschaft<br />
und alle Menschen. Anlässlich<br />
Am Welt-Diabetes-Tag erstrahlen<br />
bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten<br />
auf der ganzen Welt in<br />
Blau. Heuer war erstmals das Wiener<br />
Riesenrad dabei.<br />
des Welt-Diabetes-Tags veranstaltet<br />
die Initiative eine Reihe von Aktivitäten,<br />
um die öffentliche Wahrnehmung<br />
für Diabetes und seine Prävention<br />
zu schärfen. Zum einen wird<br />
das von einem Augenpaar getragene<br />
Logo „Face Diabetes“ im öffentlichen<br />
Raum projiziert, etwa in Wien, Am<br />
Graben und an der stark befahrenen<br />
Altmannsdorfer Straße. Außerdem<br />
werden im November öffentliche Verkehrsmittel<br />
in den Landeshauptstädten<br />
Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg<br />
Foto: Public Health PR<br />
und Linz mit dem „Face Diabetes“-<br />
Logo gebrandet. Ein TV-Spot mit Dirk<br />
Stermann, ein Quiz mit Gewinnspiel,<br />
ein Newsletter und alle Aktivitäten der<br />
Initiative sind auf der Website nachzulesen:<br />
www.facediabetes.at.<br />
Seit 2008 erstrahlen am Welt-Diabetes-Tag,<br />
am 14. November, bekannte<br />
Gebäude und Sehenswürdigkeiten<br />
auf der ganzen Welt in Blau. Die World<br />
Diabetes Day Monument Challenge<br />
wurde von der International Diabetes<br />
Federation (IDF) ins Leben gerufen.<br />
Auf Initiative der ÖDG werden auch<br />
<strong>2014</strong> (bis Ende November) wieder<br />
ausgewählte österreichische Bauwerke<br />
in blaues Licht getaucht: das Wiener<br />
Riesenrad, der Hochstrahlbrunnen<br />
am Schwarzenbergplatz in Wien, das<br />
Grazer Rathaus, das Ars Electronica<br />
Center in Linz, das Bregenzer Festspielhaus,<br />
Salzburg Congress und das<br />
Stadttheater Hallein. International<br />
sind unter anderem das Empire State<br />
Building in New York, das London Eye<br />
und die Bronzefigur „Die Kleine Meerjungfrau“<br />
in Kopenhagen dabei.<br />
Weitere Infos:<br />
www.facediabetes.at<br />
www.oedg.org<br />
18 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Verfügbar sind viele unterschiedliche und bunte Drogen, wirklich nennenswert verwendet wird aber meist Cannabis.<br />
Drogenmissbrauch und häufig verwendete Substanzen<br />
Über Cannabis, Opioide und Ecstasy<br />
Aktuelle Daten des Wiener Suchtmittelmonitorings zeigen keine Veränderungen<br />
des Drogenkonsums. Cannabis ist nach wie vor die einzige<br />
illegale Droge mit einer nennenswerten Konsumprävalenz. Befragungen<br />
unter Studierenden zeigen, dass in dieser Gruppe Alkohol eine<br />
wesentlich größere Gefahr darstellt als der Konsum illegaler Drogen.<br />
Der Konsum neuer psychoaktiver Substanzen spielt kaum eine Rolle.<br />
Konsumerfahrungen mit illegalen<br />
Drogen finden sich in Österreich<br />
am häufigsten bei Cannabis mit<br />
Prävalenzraten von etwa 30 bis 40<br />
Prozent bei jungen Erwachsenen.<br />
In den meisten Repräsentativstudien<br />
finden sich Konsumerfahrungen<br />
von zwei bis vier Prozent für „Ecstasy“,<br />
Kokain und Amphetamine und<br />
von ein bis zwei Prozent für Opiate.<br />
Beim problematischen Drogenkonsum<br />
in Österreich macht der Opioidkonsum<br />
– meist kombiniert mit anderen<br />
Substanzen – aktuell das Gros<br />
aus. Problematisch bezieht sich dabei<br />
in erster Linie auf das Konsumverhalten<br />
und nicht auf die Substanz selbst.<br />
Als problematisch wird Drogenkonsum<br />
dann bezeichnet, wenn dieser<br />
mit körperlichen, psychischen und/<br />
oder sozialen Problemen einhergeht.<br />
OA Dr. Rainer Schmid, Toxikologische<br />
Intensivstation im Wilhelminenspital<br />
Wien: „Etwa 90 Prozent aller Personen<br />
in drogenspezifischer Betreuung<br />
haben die Leitdroge Opioide. Aktuell<br />
gibt es zwischen 30.000 und 34.000<br />
Personen mit problematischem Drogenkonsum<br />
unter Beteiligung von<br />
Opioiden.“ Etwa die Hälfte davon lebt<br />
in Wien. Eine Drogensucht tritt nach<br />
wie vor in Ballungszentren häufiger<br />
auf als in ländlichen Gebieten. Allerdings<br />
steigen die Zahlen in den anderen<br />
Bundesländern, während in Wien<br />
die Prävalenzzahlen in den letzten<br />
Jahren stagnieren.<br />
Ein häufiges Problem stellt die Überdosierung<br />
von Opioiden dar – hier<br />
wiederum von Substitutionspräparaten,<br />
welche intravenös, peroral,<br />
aber auch geraucht oder gesnifft<br />
appliziert werden. Besonders wegen<br />
der Atemdepression entstehen<br />
lebensbedrohliche Zustandsbilder.<br />
Reine Heroinüberdosierungen sind<br />
mittlerweile sehr selten geworden.<br />
Kokain ist ein Alkaloid und ein starkes<br />
Stimulans. Das geruchlose Pulver<br />
wird meist geschnupft, gelegentlich<br />
intravenös oder inhalativ<br />
missbraucht. Ein Strecken mit zu viel<br />
Strychnin kann toxische Symptome<br />
verursachen! In erster Linie wird das<br />
ZNS aktiviert (Euphorie, Unruhe, Tremor,<br />
Halluzinationen, Krämpfe) aber<br />
auch Angst, paranoide Symptome,<br />
Suizidtendenz kommen vor. Probleme<br />
kann es auch mit Koronarspasmen,<br />
Palpitationen, Thoraxschmerz<br />
oder Hypertension geben.<br />
Cathinonderivat (Cath/Quat-Strauch)<br />
ist ein fein- bis grobkristallines Pulver<br />
und wird meist gesnifft, seltener<br />
geschluckt. Es hat eine typisch aufputschende,<br />
antriebsteigernde Wirkung,<br />
wird von den Konsumenten<br />
auch als bewusstseinserweiternd beschrieben.<br />
Ecstasy ist eine Sammelbezeichnung<br />
für eine Vielzahl von<br />
Phenylethylaminen, meist Mischformen,<br />
im Idealfall reines Methylendioxy-Methylamphetamin.<br />
Crystal Meth hat als Grundstoff<br />
Ephedrin (Ephedra-Kraut) und kann<br />
sehr einfach chemisch synthetisiert<br />
werden. Als Reaktionsprodukt<br />
kommt es als hoch reine Substanz<br />
in kristalliner Form auf den Markt.<br />
Ephedrin und Pseudoephedrin sind<br />
auch in frei verkäuflichen Erkältungsmitteln<br />
zu finden.<br />
WEITERE INFOS:<br />
www.a-k-n.at/dokumente<br />
www.partypack.de<br />
www.checkyourdrugs.at<br />
www.bmg.gv.at<br />
20 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Adipositas bei Jugendlichen in Österreich<br />
Kampf dem Obelix-Syndrom<br />
Übergewicht und Adipositas<br />
bei Kindern und Jugendlichen<br />
werden verursacht durch das<br />
Zusammenspielen von Erbanlagen<br />
und der Umwelt. OA<br />
Dr. Daniel Weghuber, Salzburg:<br />
„Die Erbanlagen unserer Gesellschaft<br />
haben sich in den letzten<br />
Jahrzehnten nicht geändert,<br />
sehr wohl aber die Bedingungen,<br />
unter denen wir leben.“ Auf<br />
Lebensstil, Lebensumstände<br />
und die Umwelt muss daher<br />
vermehrt geachtet werden – vor<br />
allem bei der Prävention und<br />
der Therapie von kindlicher oder<br />
jugendlicher Adipositas.<br />
Übergewicht und Adipositas treten<br />
in Österreich bei immer mehr Kindern<br />
und Jugendlichen auf – Tendenz<br />
weiter steigend. Für eine erfolgreiche<br />
Therapie ist aber nicht nur der Blick<br />
auf die Waage entscheidend, sondern<br />
eine interdisziplinäre Betreuung im<br />
Team. Diagnostik und Therapie müssen<br />
auf andere medizinische Disziplinen<br />
ausgeweitet werden. Bauch- und<br />
Halsumfang, Haut, Bewegungsapparat<br />
und Atmung sind ebenso wichtige<br />
Parameter, die in Diagnostik und<br />
Therapie einbezogen werden müssen.<br />
Zudem führt nur eine interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit im Team<br />
zum Erfolg. Der Arzt ist dabei am<br />
wenigsten gefragt. Wichtiger sind Experten<br />
aus den Bereichen Ernährung,<br />
Bewegung und Psychologie. „Darüber<br />
hinaus ist wichtig, dass dieses<br />
Team die Betroffenen nachhaltig und<br />
über einen langen Zeitraum betreut“,<br />
so Daniel Weghuber.<br />
Das ist natürlich viel Aufwand, aber<br />
internationale Studien zeigten deutlich,<br />
dass andere Maßnahmen keinen<br />
OA Dr. Daniel Weghuber: „Als Experten<br />
und als Gesellschaft müssen wir<br />
Methoden entwickeln, die alle Betroffenen<br />
bestmöglich erreichen.“<br />
dauerhaften Erfolg bringen. Ein Großteil<br />
der Angebote führt bei den Übergewichtigen<br />
nicht zum Ziel – eben der<br />
Gewichtsabnahme. Diese ist heute<br />
auch nicht mehr das primäre und alleinige<br />
Bestreben, es geht vor allem<br />
darum, Bewusstsein und Verständnis<br />
zu erzeugen und in die Therapie, neben<br />
medizinischen Werten, verstärkt<br />
psychologische Aspekte und natürlich<br />
Bewegung einzubeziehen.<br />
Daniel Weghuber: „Wichtig sind<br />
auch sportmedizinische Variablen.<br />
Tests können zeigen, ob jemand<br />
körperlich fit oder unfit ist – und das<br />
ist entscheidender als das Gewicht,<br />
Foto: privat<br />
das die Waage anzeigt.“ Ein weiteres<br />
Problem ist die soziale Ungerechtigkeit.<br />
Da ausgeklügelte und wirksame<br />
Programme viel Zeit und Geld<br />
benötigen, werden die Teilnehmer<br />
ganz gezielt ausgewählt – ob sie<br />
erfolgreich sein werden oder nicht.<br />
Daniel Weghuber: „Das bedingt die<br />
Tatsache, dass viele junge Menschen,<br />
die eine Therapie benötigen,<br />
diese nicht erhalten. Als Experten<br />
und als Gesellschaft müssen wir<br />
daher Methoden entwickeln, die alle<br />
Betroffenen bestmöglich erreichen.“<br />
Umweltfaktoren, Ernährung und<br />
Bewegung spielen auch eine große<br />
Rolle in der Prävention von Adipositas.<br />
„Der Stein der Weisen wurde<br />
dafür noch nicht gefunden“, so der<br />
Salzburger Experte. Aber es gibt eindeutige<br />
Hinweise, dass Prävention<br />
möglichst früh passieren sollte – am<br />
besten schon während der Schwangerschaft<br />
oder im Baby-Alter.<br />
Prävention ist aber nicht nur Thema<br />
jedes Einzelnen, es hat immer auch<br />
eine gesellschaftliche Dimension.<br />
Diese reicht von politischen Maßnahmen<br />
– wie der Kennzeichnung<br />
und Besteuerung von Nahrungsmitteln<br />
– bis hin zur Forderung nach täglichem<br />
Turnunterricht in der Schule.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.gewichtig.at<br />
22 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Interview mit Sexualmedizinerin Dr. Elia Bragagna<br />
Tanz der Hormone<br />
Pubertät ist die Zeit, in der uns<br />
unsere Kinder zu entgleiten<br />
scheinen. Sie werden unberechenbarer<br />
und sie wandeln sich.<br />
Im Interview spricht Sexualmedizinerin<br />
Dr. Elia Bragagna über<br />
die Pubertät, welche Veränderungen<br />
stattfinden und die Kluft<br />
zwischen Jugendlichen und<br />
Erwachsenen.<br />
Wieso ist für Erwachsene der<br />
Umgang mit Pubertierenden so<br />
schwierig?<br />
Eigentlich erwarten Erwachsene<br />
berechenbare Reaktionen und die<br />
Fähigkeit, selbst unter starken Emotionen<br />
komplexe soziale Situationen<br />
zu meistern. Für Pubertierende sind<br />
die Eltern vernunftgesteuert, langweilig,<br />
nicht offen für Neues, in ihrer<br />
alten Zeit gefangen, peinlich oder<br />
uncool. Letztlich ist die Erwachsenenwelt<br />
nicht mehr die Welt der Pubertierenden.<br />
Anerzogene Verhaltensmuster<br />
gelten nicht mehr, neue<br />
müssen sich erst etablieren.<br />
Was bewirken die großen körperlichen<br />
Veränderungen in dieser Zeit?<br />
Auf der körperlichen Ebene durchlaufen<br />
Jungendliche sichtbare und<br />
unsichtbare Veränderungen. Zu den<br />
sichtbaren gehören die Geschlechtsreife,<br />
die erste Menstruation und die<br />
erste Ejakulation. Diese Veränderungen<br />
können das Gefühl der Zugehörigkeit<br />
zum eigenen Geschlecht<br />
verstärken oder verunsichern. Sehr<br />
belastend werden deswegen in dieser<br />
Zeit sichtbare Erkrankungen empfunden,<br />
etwa Akne, Psoriasis, Narben,<br />
Alopecia areata oder Adipositas.<br />
Dazu kommen noch unsichtbare<br />
Auswirkungen, die es den Jugendlichen<br />
schwer machen, den neuen<br />
Platz in der Welt der Pubertierenden<br />
einzunehmen: Depression, Schizophrenie,<br />
Epilepsie, Asthma oder auch<br />
onkologische Erkrankungen.<br />
Vor allem die Gedankenwelt scheint<br />
neu geordnet zu werden. Die Fähigkeiten<br />
eines Teenagers entwickeln<br />
sich in Reihenfolge des Gehirnumbaus.<br />
Zuerst reift die Körperbeherrschung,<br />
dann die Sprachkompetenz<br />
und das abstrakte Denken, als Letztes<br />
Sozialkompetenz und Empathie.<br />
Damit beginnt die Erprobung<br />
neuer Fähigkeiten und das Belohnungssystem<br />
der Eltern verliert an<br />
Einfluss. Das ZNS-Areal für Selbstdisziplin,<br />
Selbstkontrolle, Urteilsund<br />
Einfühlungsvermögen, Planen,<br />
Konzentration, Motivation, der frontale<br />
Cortex, reift sehr spät, erst um<br />
das 20. Lebensjahr. Bei den Mädchen<br />
ist dieser Reifungsprozess ein<br />
bis zwei Jahre früher abgeschlossen.<br />
Dr. Elia Bragagna: „Jugendliche<br />
brauchen positive Bewältigungsstrategien<br />
und Begleitung durch<br />
die Phase der Pubertät.“<br />
Welche Rolle spielen die Hormone?<br />
Das wird unterschiedlich bewertet,<br />
aber Hormone spielen eine wichtige<br />
Rolle. Die steigenden Hormonspiegel<br />
bereiten das ZNS während der<br />
Pubertät auf neue Verhaltensweisen<br />
vor. Die hormonellen Hauptakteure,<br />
wie Testosteron, Östrogen, Prolaktin,<br />
Cortisol, Oxytocin, Vasopressin und<br />
der Botenstoff Dopamin beeinflussen<br />
einander immer gegenseitig. Die<br />
Epiphyse schüttet das Hormon Melatonin<br />
täglich zwei Stunden später<br />
aus als vorher, mit der Folge, dass<br />
die Jugendlichen erst später einschlafen<br />
und morgens unausgeschlafen<br />
und müde sind. Mädchen<br />
und Burschen entwickeln einen<br />
grundsätzlich anderen Sprachgebrauch.<br />
Burschen reden eher über<br />
konkrete Dinge und unpersönliche<br />
Themen, während die Mädchen<br />
Mitgefühl ausdrücken. Kein Wunder,<br />
dass sie einander nicht verstehen!<br />
Was passiert bei den männlichen<br />
Jugendlichen konkret?<br />
Männliche Jugendliche erleben einen<br />
Testosteron-Tsunami. Die Schaltkreise<br />
für sexuelles Verlangen sind<br />
doppelt so groß wie bei Frauen. Sie<br />
konzentrieren sich auf sexuell attraktive<br />
Frauen. Das Paarungsverhalten<br />
und das Bedürfnis nach Sexualität<br />
werden stimuliert. Sie müssen sich<br />
Themen wie Konkurrenzkampf, Dominanzstreben<br />
und Statusdenken<br />
stellen und sind dabei auch noch<br />
ungeduldig und reizbar. Der Dopaminspiegel<br />
steigt kontinuierlich und<br />
verstärkt die sexuelle Motivation um<br />
das Zwei- bis Zweieinhalbfache gegenüber<br />
weiblichen Pubertierenden.<br />
95 Prozent der männlichen Pubertierenden<br />
masturbieren etwa drei<br />
Mal täglich, während 71 Prozent der<br />
weiblichen Jugendlichen es ein Mal<br />
täglich machen.<br />
Foto: Hergott Ricardo<br />
26 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Und bei den Mädchen?<br />
Die jungen Frauen erleben mit dem<br />
Beginn des monatlichen Zyklus<br />
sich täglich verändernde körperliche<br />
und emotionale Rahmenbedingungen.<br />
Sie erleben Gefühle intensiver,<br />
empfinden Stress stärker, machen<br />
sich Sorgen wegen des Aussehens,<br />
denken häufiger an Jungs, reden<br />
mehr, pflegen engeren Kontakt zu<br />
Gleichaltrigen und haben ein stärkeres<br />
Bedürfnis nach sozialer Bindung.<br />
Sie sind bestrebt, eine Beziehung<br />
um jeden Preis aufrecht zu erhalten.<br />
Wie kann der Erwachsene Jugendliche<br />
unterstützen?<br />
Jugendliche brauchen positive Bewältigungsstrategien<br />
und Begleitung<br />
durch die Phase der Pubertät.<br />
Hilfreich ist, wenn Eltern, Pädagogen,<br />
Ärzte, Erwachsene um diese<br />
Männliche Jugendliche erleben einen Testosteron-Tsunami. Sie konzentrieren<br />
sich auf sexuell attraktive Frauen. Das Paarungsverhalten und das Bedürfnis<br />
nach Sexualität werden stimuliert.<br />
neurobiologischen Vorgänge wissen,<br />
milde sind und gleichzeitig für sie<br />
den präfrontalen Cortex konstruktiv<br />
ersetzen. Ärzte können durch eine<br />
sexualmedizinische Haltung im Praxisalltag<br />
sexual relevante Erkrankungen<br />
erkennen, behandeln und dadurch<br />
Sexualstörungen verhindern.<br />
Für die sexuelle Zukunft der Betroffenen<br />
werden hier Weichen gestellt.<br />
Männer, Tattoos, Piercing<br />
Haut und Körper als Symbol<br />
Tattoos und Piercings erfreuen<br />
sich in der westlichen Welt steigender<br />
Beliebtheit. Etwa jeder<br />
fünfte Österreicher trägt eine Tätowierung.<br />
Die Diskussionen über<br />
gesundheitliche Risiken beschäftigen<br />
seit langem die Medizin.<br />
Dr. Georg Pfau, Sexualmediziner und<br />
Männerarzt in Linz: „Beim Tätowieren<br />
werden Farbstoffe in die Haut eingebracht,<br />
die dann von Makrophagen<br />
‚gefressen‘ und so fixiert werden.“<br />
Unter Piercing versteht man das Anbringen<br />
von Schmuckstücken an den<br />
verschiedensten Körperteilen. Es wird<br />
geschätzt, dass in Österreich etwa<br />
500.000 Personen ein Piercing tragen.<br />
Tattoos und Piercings sollen vor<br />
allem die sexuelle Attraktivität betonen.<br />
Männer benützen die Sexualität<br />
zur Selbstdarstellung, sie neigen dazu<br />
ihre „Männlichkeit“ zu unterstreichen.<br />
Die Motive sind daher Totenköpfe<br />
oder Raubtiere. Ganz grundsätzlich<br />
dient das Tätowieren aber auch dem<br />
Protest gegen das Establishment,<br />
dessen Motor das von den bürgerlichen<br />
Schichten gepflegte Stigma<br />
gegenüber Tätowierten ist. Andere<br />
Motive sind die Dokumentation einer<br />
Zusammengehörigkeit, die Institutionalisierung<br />
einer Beziehung oder das<br />
Symbol für die Zugehörigkeit zu einer<br />
okkulten Vereinigung.<br />
Mögliche Komplikationen sind Entzündungen,<br />
Infektionen, Allergien<br />
und Tumore. Georg Pfau: „Fest steht,<br />
dass die Beurteilung der Prävalenz<br />
von Komplikationen schwer fällt,<br />
weil Tattoo- und Piercingstudios außerhalb<br />
der Medizin tätig sind.“ Die<br />
Zusammensetzung der Farbstoffe<br />
wird häufig als „Betriebsgeheimnis“<br />
betrachtet. Ärzte fordern seit langem<br />
die Standardisierung der Farbstoffzusammensetzung.<br />
„Das Hauptproblem<br />
liegt aber ganz woanders.<br />
Früher oder später wollen 50 Prozent<br />
ihre Tattoos wieder los zu werden<br />
- möglichst ohne Narben oder<br />
Rückstände.“ Allerdings ist es nach<br />
Durchsicht der Datenlage bis heute<br />
nicht möglich, Tattoos verlässlich<br />
spur- und narbenlos zu entfernen,<br />
auch nicht unter Zuhilfenahme modernster<br />
Techniken wie Laser.<br />
WEITERE INFOS:<br />
www.maennerarzt-linz.at<br />
www.sexualmedizin-linz.at<br />
27 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
Seltene Erkrankungen in der Allgemeinpraxis<br />
Der Hausarzt sieht’s ein Mal im Jahr<br />
In der Europäischen Union werden seltene Erkrankungen über ihre Häufigkeit definiert.<br />
Ein Krankheitsbild gilt dann als selten, wenn zu einem beliebig wählbaren Stichtag nicht<br />
mehr als fünf von zehntausend Einwohnern in der EU an dieser Krankheit leiden. Es ist also<br />
höchstens eine unter zweitausend Personen betroffen. Europaweit leiden Schätzungen<br />
zufolge aber rund 36 Millionen Menschen an seltenen Erkrankungen.<br />
Hinter dem Sammelbegriff „seltene<br />
Erkrankungen“ verbergen sich<br />
geschätzte 6.000 bis 8.000 unterschiedliche<br />
Krankheitsbilder, die in<br />
ihrer Gesamtheit sechs bis acht Prozent<br />
der (europäischen) Gesamtbevölkerung<br />
betreffen. Ein Großteil<br />
davon ist chronisch, oftmals lebensbedrohlich<br />
und nur selten heilbar –<br />
von der European Medicines Agency<br />
(EMA) wurden in den letzten elf<br />
Jahren 67 Orphan Drugs für die EU<br />
zugelassen.<br />
„Seltene Erkrankungen stellen nicht<br />
nur die Patienten, sondern auch die<br />
Ärzte vor schwierige Herausforderungen“,<br />
erklärt Dr. Erwin Rebhandl,<br />
Arzt für Allgemeinmedizin und Präsident<br />
der AM PLUS (Initiative für<br />
Allgemeinmedizin und Gesundheit).<br />
Der Allgemeinmediziner übernimmt<br />
für Menschen mit seltenen Erkrankungen<br />
eine wichtige Funktion, vom<br />
ersten Verdacht über die Einleitung<br />
der notwendigen Abklärung bis hin<br />
EINFACHE SUCHE AUF WWW.SYMPTOMSUCHE.AT<br />
Für die Suche nach möglichen seltenen<br />
Erkrankungen müssen mindestens zwei<br />
Symptome oder ein Leitsymptom eingegeben<br />
werden. Je mehr Symptome<br />
eingegeben werden, umso größer ist<br />
auch die Wahrscheinlichkeit einer Verdachtsdiagnose.<br />
Die Ergebnisse zeigen<br />
jeweils die für die Begriffe möglicherweise<br />
zutreffenden, im System hinterlegten<br />
Erkrankungen an. Jede Erkrankung wird zudem ausführlich beschrieben und es<br />
finden sich Angaben über spezialisierte Zentren für allfällige Überweisungen.<br />
Dr. Erwin Rebhandl: „Seltene Erkrankungen<br />
stellen nicht nur die Patienten,<br />
sondern auch die Ärzte vor schwierige<br />
Herausforderungen.“<br />
zur langfristigen Begleitung. Häufig<br />
müssen Menschen mit einer seltenen<br />
Erkrankung einen langwierigen<br />
Weg durch das Gesundheitswesen<br />
auf sich nehmen, ehe schlussendlich<br />
eine korrekte Diagnose gestellt wird.<br />
Im Schnitt kann das drei bis vier Jahre<br />
dauern, so der „Ergebnisbericht<br />
Seltene Erkrankungen“, den Gesundheit<br />
Österreich und das Bundesministerium<br />
für Gesundheit 2012 erstellt<br />
haben. Erwin Rebhandl: „Umso<br />
wichtiger ist es, Wissen über diese Erkrankungen<br />
gebündelt zu sammeln,<br />
um Betroffenen so rasch wie möglich<br />
Hilfe zukommen zu lassen.“<br />
Eine Unterstützung zur rascheren<br />
Diagnosestellung ist die Symptomdatenbank<br />
www.symptomsuche.at.<br />
Die Initiative AM PLUS hat dieses Tool<br />
gemeinsam mit pharmazeutischen<br />
Unternehmen geschaffen, um Allgemeinmedizinern<br />
zu helfen, auf<br />
Basis unterschiedlicher Symptome<br />
nach möglichen seltenen Erkrankungen<br />
zu suchen und diese schon<br />
frühzeitig auszuschließen beziehungsweise<br />
einzugrenzen. Zusätzlich<br />
erhalten die Mediziner Ratschläge<br />
zur Überweisung von Patienten<br />
an spezialisierte Zentren.<br />
Erwin Rebhandl: „In einer Hausarztpraxis<br />
findet man durchschnittlich<br />
ein bis zwei Mal im Jahr so eine Erkrankung.“<br />
Die Symptomdatenbank<br />
ist eine einfache Möglichkeit, bei<br />
Verdacht auf seltene Erkrankungen<br />
relativ rasch genauere Informationen<br />
zu generieren und eine erste Anlaufstelle<br />
zu finden, die eine exakte Diagnosestellung<br />
ermöglicht. Die Datenbank<br />
wird mit Unterstützung von<br />
Experten laufend erweitert. Derzeit<br />
sind etwa 24 Krankheitsbilder online<br />
gestellt, weitere werden folgen.<br />
Foto: Unlimited Media<br />
24 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>
KONGRESS<br />
JOURNAL<br />
„Stand der Dinge“: Alle Inhalationssysteme und Inhalationshilfen werden hier erklärt<br />
Fotos: Unlimited Media<br />
Schulungsinitiative Inhalationssysteme<br />
Inhalieren richtig gemacht<br />
Trotz modernster Medikamente ist das Management von Asthma<br />
und COPD leider nicht optimal. Viele Patienten machen Fehler bei<br />
der Bedienung ihrer Inhalationsgeräte. Helfen kann letztlich nur<br />
die richtige Schulung. Die Steirische Akademie für Allgemein -<br />
medizin und die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie<br />
(ÖGP) haben deshalb beim 45. Kongress für Allgemeinmedizin<br />
eine Schulungsinitiative gestartet.<br />
Im Foyer der Stadthalle Graz sind<br />
alle Inhalationssysteme und Inhalationshilfen<br />
ausgestellt und werden<br />
erklärt. Die wissenschaftliche<br />
Leitung liegt bei Dr. Daniel Doberer<br />
und Priv.-Doz. Dr. Georg-Christian<br />
Funk. Daniel Doberer: „Das Problem<br />
ist, dass bis zu 70 Prozent<br />
aller Patienten bei der Inhalation<br />
ihres Asthma- oder COPD-Medikaments<br />
Fehler machen. Dadurch<br />
kommt das Medikament gar nicht<br />
erst in die Lunge.“ Oft liegt dies an<br />
der zu komplizierten Handhabung<br />
des Inhalationsgerätes oder auch<br />
an einer fehlenden Schulung. „In<br />
den letzten zwei bis drei Jahren<br />
sind sehr viele neue Geräte auf den<br />
Markt gekommen. Bei dieser breiten<br />
Produktpalette behält selbst ein<br />
Pulmologe kaum den Überblick“,<br />
erklärt der Lungenfachmann. Für<br />
den Hausarzt oder gar den Patienten<br />
wird die richtige Handhabung<br />
mit den neuen Geräten natürlich<br />
immer schwieriger. Aber gerade der<br />
Hausarzt ist oft erster Ansprechpartner<br />
und langjähriger Wegbegleiter<br />
bei der Behandlung von COPD<br />
und Asthma. Daniel Doberer: „Ob<br />
der Patient vom Allgemeinmediziner,<br />
vom Facharzt oder von einem<br />
Atemtherapeuten eingeschult wird,<br />
ist letztlich egal. Wichtig ist, dass die<br />
Schulung am verwendeten Gerät<br />
auch wirklich durchgeführt wird. Dafür<br />
muss der Arzt sorgen, es sollte<br />
nie passieren, dass nur das Medikament<br />
verschrieben wird.“<br />
Am Stand der Schulungsinitiative gibt<br />
es bis Kongressende auch Videos der<br />
ÖGP, eine unterstützende App und<br />
jede Menge Informationsmaterial<br />
rund um Asthma und COPD. Daniel<br />
Doberer sieht seine Funktion vor<br />
Ort aber nicht als Lehrer, sondern als<br />
Teilnehmer an den Diskussionen der<br />
Kolleginnen und Kollegen, in die „wir<br />
als Experten unseren Beitrag einfließen<br />
lassen werden“.<br />
Das Schulungsteam: Ingrid Schmidt, MSc, Dr. Daniel Doberer und Jeanette Valda, MSc<br />
30 <strong>KONGRESSJOURNAL</strong>Graz <strong>2014</strong>