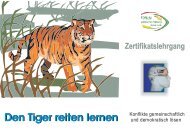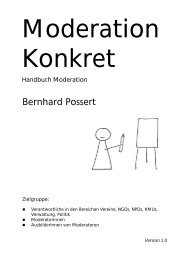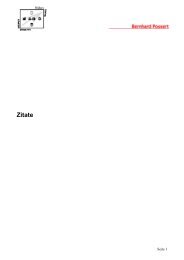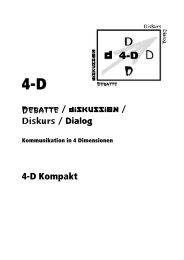Wirtschaftsethik â
Wirtschaftsethik â
Wirtschaftsethik â
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wirtschaftsethik</strong> –<br />
Eine Annäherung von unterschiedlichen Perspektiven<br />
Spricht man mit Menschen über <strong>Wirtschaftsethik</strong>, so wird diese oft vorschnell auf Fragen<br />
der sozialen Verantwortung von Unternehmen reduziert. Der Gedanke der corporate social<br />
responsibility (CSR) scheint in den letzten Jahren alle anderen wirtschaftsethischen<br />
Fragestellungen verdrängt zu haben. Dies ist insofern positiv, weil es gelungen ist, damit<br />
einen Bereich in den Mittelpunkt der Diskussion zu bringen, der bis dahin eher<br />
vernachlässigt wurde. Zu verdanken ist dies der sich zunehmenden durchsetzenden<br />
Einsicht, dass Unternehmen sich nicht von ihrer Verbindung zum sozialen und politischen<br />
Kontext lösen können. 1<br />
von MMag. Dr. Harald Stelzer<br />
In Zusammenhang mit der sozialen Verantwortung wird<br />
immer mehr darüber nachgedacht, wie Profit in einem<br />
größeren Kontext von Produktivität und sozialer<br />
Verantwortung gedacht werden kann und wie Unternehmen<br />
als komplexe Gemeinschaften am besten sowohl den<br />
Interessen der eigenen Angestellten als auch der sie<br />
umgebenden Gesellschaft dienen können. Der Zweck des<br />
Unternehmens wird dann nicht in der Profitmaximierung<br />
gesehen, sondern als Dienst an der Öffentlichkeit<br />
verstanden, indem die gewünschten und wünschenswerten<br />
Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, ohne<br />
dadurch die Gesellschaft und ihre Bürger in Gefahr zu<br />
bringen. 2<br />
Andererseits wird die <strong>Wirtschaftsethik</strong> durch diese Reduktion<br />
auf die soziale Verantwortung von Unternehmen stark<br />
reduziert und oft auf die Ebene des mittleren und höheren<br />
Managements großer Unternehmen abgeschoben. Dadurch<br />
scheint sie sowohl mit der wirtschaftlichen Praxis von Kleinund<br />
Mittelbetrieben als auch mit den Handlungen der<br />
einzelnen Menschen in ihren Unternehmen, Organisationen<br />
und Institutionen sowie mit dem gesellschaftspolitischen<br />
Bereich oder dem Verhalten als KonsumentIn nichts mehr<br />
zu tun zu haben. Es verwundert daher nicht, wenn viele<br />
Menschen die Auseinandersetzung mit wirtschaftsethischen<br />
Fragen für sich persönlich als entbehrlich ansehen und die<br />
Verantwortung an andere Stellen delegieren.<br />
Ein breiteres Verständnis von <strong>Wirtschaftsethik</strong> zeigt jedoch,<br />
dass dieses Thema uns alle angeht, nicht nur als<br />
UnternehmerInnen, sondern auch als ArbeitnehmerInnen,<br />
KonsumentenInnen und BürgerInnen. So verstanden<br />
erstreckt sich die <strong>Wirtschaftsethik</strong> von Fragen der<br />
gesellschaftlichen Grundeinstellung über die<br />
Implementierung ethischer Grundsätze in Unternehmen<br />
bis hin zu den konkreten Handlungen der Individuen.<br />
Dementsprechend können drei Ebenen unterschieden<br />
werden:<br />
a) die gesellschaftliche Ebene, wo es um Fragen der<br />
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der<br />
Eigentumsverhältnisse und Wirtschaftsordnung, der<br />
Steuer- und Sozialpolitik, des Verhältnis zwischen<br />
Gesellschaft, Staat und Unternehmen geht.<br />
b) die unternehmerische Ebene, die sich mit den ethischen<br />
Normen und den Werten in Unternehmen sowie mit<br />
deren sozialer Verantwortung beschäftigt.<br />
c) die individuelle Ebene, die sich mit den persönlichen<br />
Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen der<br />
einzelnen wirtschaftlichen Akteure auseinandersetzt.<br />
Auf allen drei Ebenen können wiederum drei<br />
unterschiedliche Realisierungsebenen von ethischen<br />
Grundsätzen feststellen werden:<br />
a) die Mentalitätsebene, in der die hinter den<br />
wirtschaftlichen Handlungen befindlichen Ideologien,<br />
Weltanschauungen, Werte und Idee im Mittelpunkt der<br />
Betrachtung stehen;<br />
b) die Entscheidungsebene, die sich mit unterschiedlichen<br />
Formen der Entscheidungsfindung beschäftigt;<br />
c) und die Handlungsebene, die auf die Handlungsabläufe<br />
und -möglichkeiten Bezug nimmt.<br />
Aus der Kombination dieser Ebenen ergeben sich neun<br />
Felder, die in die wirtschaftsethischen Überlegungen mit<br />
einzubeziehen sind. Diese Ebenen sind in der Graphik<br />
symbolhaft darstellt. Wobei klar wird, dass alle neun Felder<br />
auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind und sich<br />
gegenseitig verstärkende Feedbackschleifen beinhalten.<br />
Die gesellschaftliche Ebene ist bestimmend für die<br />
Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns und hängt<br />
von den vorherrschenden Weltanschauungen und Ideen<br />
ab. Die Politik, welche auf der Entscheidungsebene die<br />
gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft, und der staatlich<br />
bürokratische Apparat, welcher diese auf der<br />
Handlungsebene durchsetz, reagieren langfristig durch den<br />
Druck der öffentlichen Meinung sowie periodische Wahlen<br />
auf Veränderungen im Bereich der Ideen und Ideologien.<br />
Natürlich spielen gerade im wirtschaftlichen Bereich auch<br />
internationale Entwicklungen eine entscheidende Rolle, so<br />
dass die eigenständigen Entscheidungs- und<br />
20 doppel punkt 2/2006
Handlungsspielräume staatlicher Regierungen oft stark<br />
eingeschränkt sind. Auch gilt es in der Politik einer Vielzahl<br />
von Forderungen unterschiedlicher Interessensgruppen zu<br />
berücksichtigen, die teilweise miteinander in Widerspruch<br />
stehen. Dies wird deutlich, wenn man sich wesentliche<br />
Fragestellungen der <strong>Wirtschaftsethik</strong> auf der<br />
gesellschaftlichen Ebene vergegenwärtigt, wie jene nach der<br />
sozialen Gerechtigkeit in Hinblick auf die Verteilung von<br />
Arbeit, Gütern und Abgaben, der wirtschaftlichen Fairness<br />
oder der erlaubten staatlichen Eingriffe in ein freies<br />
Wirtschaftssystem.<br />
Wesentlich für die Anwendbarkeit wirtschaftethischer<br />
Überlegungen auf die Unternehmensebene, wobei man<br />
hier auch von Unternehmensethik spricht, ist die<br />
Ausgangsüberlegung, inwiefern Unternehmen selbst<br />
bestimmte Entscheidungs- und Handlungsspielräume<br />
besitzen. Sind diese stark beschränkt, dann gibt es auch<br />
kaum Platz für ethische Überlegungen. Wird etwa das<br />
Gewinnziel als das alleinige Ziel des realen Wirtschaftens<br />
angesehen, so wie dies in der traditionellen neoklassischen<br />
Gleichgewichts- bzw. Wettbewerbstheorie angenommen<br />
wird, dann gibt es in einem solchen freien Wirtschaftssystem<br />
nur eine einzige Verantwortung für die Beteiligen, nämlich<br />
die verfügbaren Mittel möglichst gewinnbringend<br />
einzusetzen und das Unternehmen unter dem<br />
Gesichtspunkt der größtmöglichen Profitabilität zu führen. 3<br />
Diese verkürzte Sichtweise wirtschaftlichen Handelns als<br />
bloßes Streben nach Profit ist jedoch nicht nur in der Theorie,<br />
sondern auch in der Praxis nicht allgemein anerkannt.<br />
Unternehmen haben durchaus Entscheidungs- und<br />
Handlungsspielräume und damit eine entsprechende<br />
Verantwortung gegenüber ihren Zielsetzungen und<br />
Verhaltensweisen. Verantwortungsvolles wirtschaftliches<br />
Handeln hat die Interessen derjenigen Gruppen<br />
(Stakeholder) zu berücksichtigen, die von den jeweiligen<br />
Handlungen betroffen sind sowie legitime Erwartungen<br />
und Rechte in Bezug auf diese haben. Dazu zählen etwa die<br />
Angestellten, die Kunden, die Lieferanten, die Aktionäre<br />
und Investoren, aber auch die soziale Umgebung und die<br />
Gesellschaft als ganzes. Es ist jedoch von der jeweiligen<br />
Situation abhängig, welche Interessen in die Überlegungen<br />
konkret miteinbezogen werden, und welches Gewicht ihnen<br />
zugestanden wird.<br />
Moderne Unternehmensethik hat es also nicht einfach mit<br />
dem Aufstellen eines bestimmten Kataloges von Normen<br />
zu tun, den man nur festlegen muss und der dann auf ewig<br />
in jeder Situation als legitime Orientierung für<br />
unternehmerisches Handeln in Anspruch genommen<br />
werden kann. Substantielle moralische Orientierungen<br />
müssen immer situationsgerecht verfolgt werden. Es gilt<br />
ständig die Situation zu bestimmen, in der gehandelt werden<br />
soll, die Normen festzulegen, an denen man sich<br />
doppel punkt 2/2006<br />
21
Unternehmensführung um<br />
eine dauerhafte Anstrengung.<br />
Ethische Überlegungen dürfe<br />
daher nicht, wie dies von Klaus<br />
Leisinger in seinem<br />
Eröffnungsstatement der<br />
diesjährigen Konferenz des<br />
Europäischen Netzwerks für<br />
<strong>Wirtschaftsethik</strong> (EBEN)<br />
formuliert wurde, als<br />
Zuckerguss verstanden<br />
werden, sondern müssen einen Teil des Kuchen selbst<br />
bilden, d.h. sich in den täglichen Handlungen des<br />
Unternehmens wieder finden. In diesem Sinn betonen auch<br />
Hans Lenk und Matthias Maring, dass das Prüffeld für<br />
unternehmensethische Überlegungen und Überzeugungen<br />
nicht die wohlfeilen Sonntagsreden sind, die als Ausrede-,<br />
Alibi- und Ablenkungsstrategien dienen können, sondern<br />
die konkreten Handlungen der Wirtschaftsakteure. 4<br />
Dies hat zweitens auch einen weit reichenden Einfluss auf<br />
die Entwicklung und Umsetzung von ethischen Richtlinien<br />
im einzelnen Unternehmen. 5 Es ist dann nicht genug,<br />
Arbeitsgrundsätzen und ethische Richtlinien per Fax oder<br />
E-Mail an die Arbeitskräfte weiterzugeben und zu erwarten,<br />
dass sie automatisch angewendet werden. Die<br />
MitarbeiterInnen müssen an konkreten ethischen<br />
Überlegungen teilnehmen, um die Anwendung von<br />
abstrakten ethischen Prinzipien zu verstehen und auch um<br />
mögliche Konflikte zwischen ihren privaten<br />
Moralvorstellungen und ihren beruflichen Richtlinien<br />
vorhersehen und lösen zu können.<br />
Dieser Einbeziehung kommt auch deshalb eine so große<br />
Bedeutung zu, weil wirtschaftliches Handeln letztlich immer<br />
durch die Handlungen einzelner Individuen realisiert wird.<br />
Es gilt bei wirtschaftsethischen Überlegungen deshalb auch<br />
die individuelle Ebene mit einzubeziehen, die sich mit dem<br />
Verhalten der einzelnen Menschen und den diesem<br />
zugrunde liegenden Einstellungen, Werten und<br />
Wahrnehmungen beschäftigt. Die typische moralische<br />
Situation wird allgemein als individuelle<br />
Entscheidungssituation<br />
aufgefasst, in welcher der<br />
einzelne entscheidet, was<br />
zu tun richtig oder falsch<br />
ist. In diesem Sinn ist auch<br />
die traditionelle<br />
philosophische Betonung<br />
der Autonomie des<br />
einzelnen Menschen zu<br />
verstehen.<br />
Zugleich wird diese<br />
Sichtweise der individuellen<br />
Verantwortung gerade in<br />
der <strong>Wirtschaftsethik</strong> immer wieder in Frage gestellt. Denn<br />
das Handeln der einzelnen Wirtschaftsubjekte ist immer<br />
ein vernetztes Handeln, d.h. die wirtschaftlichen<br />
Entscheidungen und Handlungen des einzelnen sind<br />
Elemente eines komplexen Handlungssystems. So schließt<br />
die eigene Handlung an Handlungen anderer an und löst<br />
bei anderen Reaktionen aus, wobei wir es immer auch mit<br />
nicht beabsichtigten und nicht erwarteten Konsequenzen<br />
und sich positiv bzw.<br />
negativ verstärkenden<br />
Rückkopplungseffekten<br />
zu tun haben. Die<br />
meisten Handlungen<br />
sind auch mulitkausal<br />
bedingt, so dass ganze<br />
Handlungsketten in<br />
Wechselwirkung<br />
aufeinander bezogen<br />
sind. 6 Diese<br />
Komplexität macht<br />
deutlich, dass Wirtschaft<br />
sich als soziale Praxis<br />
verstehen lässt, und<br />
nicht als die Aktivität isolierter Individuen. Wirtschaftliches<br />
Handeln findet aufgrund von institutionalisierten Regeln<br />
und Praktiken statt, die auch den einfachsten Formen des<br />
Austausches und der vertraglichen Verpflichtungen<br />
zugrunde liegen.<br />
Hieraus ergibt sich das Problem der Zuordnung von<br />
Verantwortung im Bereich des wirtschaftlichen Handelns.<br />
Kann ein Unternehmen moralisch verantwortlich sein, für<br />
Handlungen, die von einzelnen Individuen durchgeführt<br />
werden Ist es auf der anderen Seite möglich, Individuen,<br />
welche nach Prinzipien handeln, die mit den Leitlinien des<br />
Unternehmens übereinstimmen, für alle Folgen ihres<br />
Handelns verantwortlich zu machen Hierbei ist auch zu<br />
berücksichtigen, dass viele Resultate in Unternehmen durch<br />
eine Vielzahl einzelner Handlungen zustande kommen, die<br />
von den handelnden Akteuren in ihre Vernetztheit oft gar<br />
nicht erkannt und durchschaut werden können. Eine<br />
praktische Lösung für die bestehende Vernetzung von<br />
individueller und kollektiver Verantwortung in<br />
Unternehmen muss wohl auf mehreren Ebenen ansetzen:<br />
bei den Leitlinien, ethischen Grundsätzen und<br />
Zielsetzungen des Unternehmens, bei der Vorbildwirkung<br />
und dem Führungsstil der jeweiligen Führungskräfte, bei<br />
der Hilfestellung bei Entscheidungen in schwierigen<br />
Situationen, bei der Sensibilisierung für die mit der eigenen<br />
Rolle verbundene Verantwortung und bei der Klarheit der<br />
Sprache für Konsequenzen unethischen Verhaltens.<br />
22 doppel punkt 2/2006
Durch diese mit wirtschaftsethischen Fragestellungen<br />
verbundene Komplexität hat sich in den letzten Jahren auch<br />
ein eigener Beratungszweig etabliert. In dieser<br />
wirtschaftsethischen Beratung kann es nicht darum gehen,<br />
mit dem Zeigefinger zu agieren und Unternehmen<br />
prinzipiell ein unethisches Verhalten vorzuwerfen, was viele<br />
Unternehmer vor einem Sich-Einlassen auf<br />
wirtschaftsethische Fragestellungen zurückschrecken lassen<br />
würde. Andererseits müssen Probleme offen angesprochen<br />
und Schwachstellen im Unternehmen aufgezeigt werden.<br />
Ebenso ist es notwendig, ein Bewusstsein auf<br />
unternehmerischer Seite zu entwickeln, dass die Ausrichtung<br />
eines Unternehmens auf sozial verantwortliches Verhalten,<br />
keine einmalige Angelegenheit ist, sondern nur durch ein<br />
ständiges Bemühen in den alltäglichen Handlungen und<br />
Entscheidungssituationen der in ihm tätigen Menschen<br />
gelingen kann.<br />
Die gute Nachricht ist jedoch, dass ethisch<br />
verantwortungsvolles Handeln und das Streben nach<br />
Gewinn sich nicht diametral gegenüberstehen müssen, wie<br />
auch Claus Hipp, Chef des bekannten Baby- und<br />
Kindernahrungskonzerns vor kurzem in einem Referat im<br />
Steirischen Wirtschaftsclub betont hat. Für eine nachhaltige<br />
Unternehmensentwicklung bringt eine solche Ausrichtung<br />
Vorteile, die sich auf lange Sicht auch rechnen. So steigt etwa<br />
die Motivation der Mitarbeiter, die sich als Teil eines<br />
verantwortlich agierenden Unternehmens fühlen, welches<br />
seine Rolle in der Gesellschaft bewusst gestaltet. Auch wird<br />
sozial verantwortungsvolles Verhalten auch von Kunden,<br />
Wirtschaftspartnern sowie dem öffentlichen und<br />
zivilgesellschaftlichen Bereich immer mehr nachgefragt und<br />
unterstützt. Die Umsetzung unternehmensethischer<br />
Prinzipien kann so als ein wichtiger Teil der Marktposition<br />
von Unternehmen im 21. Jahrhundert verstanden werden.<br />
Fußnoten<br />
1 Robert Davies: ,The Business Community: Social Responsibility and Corporate Values’, in: Making Globalization Good. The<br />
moral Challenges of Global Capitalism, ed. By John H. Dunning. Oxford 2003. S. 301.<br />
2 Robert C. Solomon, ,Business Ethics’, in: A Companion to Ethics, ed. by Peter Singer. Oxford 1991. S. 356.<br />
3 Vgl. hierzu etwa den berühmten Artikel von Milton Friedmann in The New York Times Magazin mit dem aussagekräftigen<br />
Titel: ,The social responsibility of business is to increase its profits’ vom 13. September 1970, S. 32-33.<br />
4 Vgl. Hans Lenk und Matthias Maring, ‚<strong>Wirtschaftsethik</strong> – ein Widerspruch in sich selbst’, in: Ethik in der Wirtschaft. Chancen<br />
verantwortlichen Handelns, hrsg. v. Hans Lenk u.a. Stuttgart 1996. S. 19 f.<br />
5 Vgl. Albert Löhr. ‚Die Marktwirtschaft braucht Unternehmensethik’, in: Ethik in der Wirtschaft. Chancen verantwortlichen<br />
Handelns, hrsg. v. Hans Lenk u.a. Stuttgart 1996. S 59.<br />
6 Friedhelm Hengsbach, ‚Gerechtigkeit in der Marktwirtschaft’, in: Ethik in der Wirtschaft. Chancen verantwortlichen Handelns,<br />
hrsg. v. Hans Lenk u.a. Stuttgart 1996. S 29.<br />
MMag. Dr. Harald Stelzer<br />
Philosoph, Soziologe, Unternehmensberater, Lebensberater, Trainer, wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
und Lehrbeauftragter an der Universität Graz, Gründer von SPOD Consulting und Gesellschafter<br />
von facilitation.at, Vorsitzender der Landesgruppe Steiermark des Österreichischen Netzwerks für<br />
<strong>Wirtschaftsethik</strong>.<br />
Sein Interesse gilt der nachhaltigen Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung; in seiner Arbeit<br />
beschäftigt er sich u.a. mit Leitbildentwicklung, unternehmensethischen Fragestellungen, Projekt-,<br />
Konflikt- und Selbstmanagement und philosophischen Ansätzen der Lebensgestaltung.<br />
Kontakt: office@spod.at<br />
doppel punkt 2/2006<br />
23