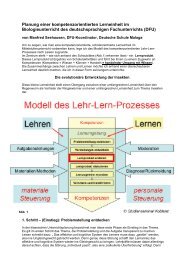Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
le“ lässt sich dieser Befund zeigen. Die Ballade 6 findet sich im „Buch der Lieder“ (1827) im ersten<br />
Zyklus „Die Nordsee“ und hier an neunter Stelle. In der gesichteten Forschungsliteratur wird auf diesen<br />
Text nicht explizit eingegangen. Im Folgenden soll er unter zwei (fach-)methodischen Prämissen<br />
betrachtet werden: Zum einen der strukturalistischen Perspektive von R. Jakobson. Er vermutete in<br />
seinem Aufsatz „Die Dominante“ u.a., dass es eine Hierarchie von bedeutsamen Strukturen gibt, und<br />
nicht alle Textbausteine für eine Interpretation in gleicher Weise prägend sind. Zum anderen soll die<br />
rezeptionsästhetische Sichtweise, wie sie von W. Iser erschlossen wurde, Beachtung finden. Damit<br />
steht im Blickfeld nicht nur die Textstruktur, sondern auch ihre Bedeutung für den Rezeptionsakt 7 .<br />
Wesentlich für die Wahrnehmung der Ballade ist das offene Plotschema. Nachdem in der ersten Stro-<br />
phe ein idyllischer Naturzustand 8 auf dem Ozean beschrieben und hierfür sowohl visuelle, als auch<br />
auditive und taktile Reize geliefert werden, wendet sich der Fokus in der zweiten und dritten Strophe<br />
den Ereignissen und sozialen Konflikten an Bord eines Schiffes zu: Während der Bootsmann schläft,<br />
arbeitet der Schiffsjunge „segelflickend“. Warum er dabei „wehmütig“ und „schmerzlich“ aufblickt,<br />
wird mit der vierten Strophe geklärt: Vor ihm steht der Kapitän des Schiffes und beschuldigt ihn roh,<br />
einen Hering aus seiner Tonne gestohlen zu haben. Danach bricht das Geschehen ab, der Blick wendet<br />
sich mit der fünften Strophe wieder der Wasseroberfläche zu, wo ein „kluges Fischlein“ glücklich<br />
schwimmt. In der abschließenden sechsten Strophe wird dieses Fischlein von einer Möwe gefasst und<br />
- so lässt sich vermuten - wenig später verspeist.<br />
Schwierig ist der Plot zu rekonstruieren, weil er durch wenigstens zwei Leerstellen ‚gebrochen’ wird:<br />
Zum einen ist die Zäsur zwischen der vierten und der fünften Strophe zu diskutieren, denn wie gehö-<br />
ren die beiden Abschnitte zusammen? Sind sie Teil ein und derselben Geschichte, nur mit wechselnden<br />
Perspektiven? Geht es zunächst um einen Disput zwischen Kapitän und Schiffsjungen, um die<br />
Frage nach dem Verbleib des fehlenden Fisches? Und wird dieser Handlungsstrang schlicht mit dem<br />
Blick über die Rehling auf die ruhige Wasseroberfläche und die Tierwelt relativiert und beendet? Oder<br />
werden zwei Geschichten parallel dargestellt, der soziale Konflikt um einen Diebstahl und der natürli-<br />
che Nahrungserwerb unter Tieren? Infolgedessen wäre die Frage nach der Beziehung dieser beiden<br />
narrativen Schemata zu beantworten.<br />
Zum anderen wird eine Leerstelle mit dem Vorwurf des Kapitäns eröffnet. Tatsächlich lässt sich die<br />
Frage nach dem fehlenden Hering nicht eindeutig beantworten. Die Textbasis erlaubt verschiedene<br />
Thesen. Diese werden entweder durch semantische Felder im Text angeregt oder über das allgemeine<br />
Wissen des Lesers gestützt: Hat der Bootsmann den Fisch verspeist, immerhin wird sein „Bauch“ erwähnt<br />
und darauf verwiesen, dass er schläft (womöglich zur Verdauung). Oder hat doch der Junge den<br />
Hering gegessen? Mit den Wortfeldern „Maul“ und den (zuckenden) „Wangen“ wird eine solche Variante<br />
zumindest nahe gelegt. Oder hat sich der Fisch selbst (reflexartig) befreit und wird deshalb als<br />
„kluges Fischlein“ apostrophiert? Auch die Möwe kommt als potenzielle Kandidatin, nämlich als<br />
Wiederholungstäterin in Frage.<br />
Diese Offenheit (Polyvalenz) hat wenigstens zwei Konsequenzen: Einerseits widersetzt sich der Text<br />
einer einfachen, vorschnellen Wertung. Der Leser wird vor eine Fülle von denkbaren Konstellationen<br />
gestellt. Andererseits wird die Verantwortung für den Plot und seine moralische Bedeutung auf den<br />
Leser übertragen. Er wird zum Teilhaber des Erzählvorganges und seiner ethischen Implikationen.<br />
Beispielsweise kann er das Gedicht im Sinne einer Parallelität (oder eines Kontrastes) von Zivilisation<br />
und Natur lesen, aber auch als kriminalistische Verwicklung, er kann die Ballade als Abbildung eines<br />
herrschaftlichen Konfliktes zwischen Kapitän und Schiffsjungen verstehen, aber auch als Kritik an<br />
einer monokausalen Weltsicht. Doch um diese möglichen Lesarten geht es in der anstehenden Lehr-<br />
probenstunde nicht. Vielmehr sollen die für diese Deutungsansätze grundlegenden Strukturen er-<br />
schlossen werden. Damit stehen zunächst der Plot und seine Leerstellenmuster im Zentrum der Analyse.<br />
Der weitere formale Aufbau des Gedichtes (sechs Strophen á vier Verse, reimlos, vierhebige Trochäen,<br />
präsentisches Erzählen, fehlendes lyrisches Ich, Wiederholung des Schlüsselwortes „Meeresstille“)<br />
kann ebenso als zweitrangig betrachtet werden, wie seine Beziehung zu benachbarten Texten 9 .<br />
4. Didaktische Überlegungen<br />
6 Vgl. zur begrifflichen Unterscheidung von Ballade und Romanze: Giese, 1994, S.31. Scholz, 1983, S.35f.<br />
7 Vgl. Jakobson, 1987, S.258-264. Iser, 1975, S.228-252.<br />
8 Vgl. zur kontrastiven Bedeutung der Natur in Heines Lyrik: Giese, 1994, S.19-21.<br />
9 Vgl. zur Makrostruktur der Gedichtsammlung ebd. S.29f.<br />
4