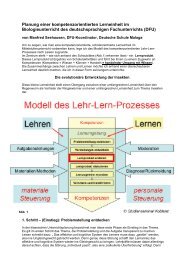Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
Lfd.<br />
Nr.<br />
1<br />
Zum Zweiten muss auf die zentrale Sozialform der Lehrprobenstunde, die Gruppenarbeit, eingegangen<br />
werden. Bereits in den „Anmerkungen zur Lerngruppe“ wurde darauf verwiesen, dass die Klasse im<br />
Umgang mit der Gruppenarbeit, und hier bei der Aufgabenverteilung erste Routinen entwickelt hat.<br />
Doch nicht nur diese allgemeine Form der Selbstorganisation erscheint aus pädagogischer Hinsicht<br />
wertvoll. Zugleich wird der Austausch von fachlichem Wissen und Lektüreerfahrungen, von Wahr-<br />
nehmungsmustern und Perspektiven und damit der für die Stunde wichtige Prozess eines Gedankenaustausches<br />
angeregt, der produktorientiert und nicht oberflächlich verlaufen soll. Überdies werden<br />
die soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler trainiert. Die Klasse erkennt die Vorteile der<br />
Gruppenarbeit bereits an, muss es aber lernen, noch effektiver zu arbeiten. Deshalb wird zu Beginn<br />
dieser Arbeitsphase eine Zeitvorgabe von zwölf Minuten bekannt gegeben. Ferner wurde bereits auf<br />
die Zusammensetzung der Gruppen (sechs Gruppen mit je vier- bzw. fünf Mitgliedern) vor der Unterrichtseinheit<br />
durch den Lehrer eingewirkt. Damit sollte vermieden werden, dass sich Schülerinnen und<br />
Schüler zusammenfinden, die nicht gut zusammenarbeiten, sich ablenken bzw. paralysieren. Außerdem<br />
wurden die Leistungsstärkeren auf verschiedene Gruppen verteilt. Auch die Sitzordnung wurde<br />
zugunsten der gewählten Sozialform verändert (Gruppenarbeitstische, symmetrisch angeordnet).<br />
Die Betreuung der Gruppenarbeit soll sich vorrangig an den Ergebnissen der aktuellen Forschung orientieren<br />
17 . Dazu gehört insbesondere die Erteilung kombinierter Arbeitsaufträge (mündlich und<br />
schriftlich) sowie der Versuch, mögliche Lehrerinterventionen während der eigentlichen Gruppenarbeitsphase<br />
zu vermeiden.<br />
Zum Dritten muss auf die Präsentationsmodi der Klasse, vor allem auf deren bisherige Erfahrungen<br />
hingewiesen werden: Einerseits sind die Schülerinnen und Schüler der 6d den Umgang mit Folien<br />
gewohnt. Dabei ist es häufig so, dass die Ergebnisse nicht nur verbal, sondern auch in Form eines<br />
Schaubildes aufgezeichnet werden. Dessen Gestaltung folgt entweder dem Schema eines Mind-<br />
Mapping oder der Imagination der Textwelt. Dabei ist die Verwendung verschiedener Farben beinahe<br />
schon selbstverständlich 18 . Damit wird nicht nur die Präsentation der Schüler interessanter und ver-<br />
ständlicher, auch der mnemotechnische Aspekt sollte als Gewinn verbucht werden: Denn Menschen<br />
behalten bildhafte Frames leichter als sprachliche Abstraktionen. Andererseits sind die Schülerinnen<br />
und Schüler an erste Bausteine eines Kurzvortrages herangeführt worden. Damit wird den Anforderungen<br />
des schulinternen Methodenkonzepts (Modul I) entsprochen 19 . Die wesentlichen Kriterien<br />
wurden der neueren fachdidaktischen Literatur entnommen 20 und als Organisationshilfe in der Klasse<br />
ausgeteilt. Ziel dieser Methode ist es, das freie Sprechen nach Stichwörtern und zugleich das aufmerksame,<br />
kritische Zuhören zu schulen. Dementsprechend und zugleich zur Sicherung der präsentierten<br />
Ergebnisse sollen jeweils nach jedem Kurzreferat ein oder zwei Mitglieder aus anderen Gruppen die<br />
vorgestellten Befunde wiederholen. Diese Wiederholungen werden an der Tafel festgehalten.<br />
Zum Vierten muss schließlich auf die Frage eingegangen werden, ob und inwieweit die Schülerinnen<br />
und Schüler der 6d im Unterricht mitschreiben 21 . Zugunsten einer besseren und kontinuierlichen Aufmerksamkeit,<br />
ohne Unterbrechungen und Phasen des Stillstandes (Phasen des reinen Abschreibens)<br />
sollen deshalb die wesentlichen Elemente des Unterrichtsverlaufes – die Leitfrage, stichwortartig die<br />
Lösungsansätze der Gruppen sowie das Leerstellenmodell – auf drei DIN A 2 Blättern als Reihe fest-<br />
gehalten werden. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt nicht nur in einer anhaltenden Aufmerksamkeit.<br />
Überdies können die Plakate aller Stunden der Unterrichtseinheit im Klassenraum als Erinnerungshilfen<br />
ausgehängt und als Ergebnis für die eigene Mappe kopiert werden.<br />
7. Geplanter Unterrichtsverlauf<br />
Unterrichtsphase -<br />
didaktische Funktion<br />
Hinführung /<br />
Problemorientierung<br />
10 min<br />
Geplantes Lehrerverhalten Handlungsvarianten<br />
der Schüler<br />
- Begrüßung<br />
- Rezitation: „Meeresstille“<br />
- Rezitation: „Meeresstille“<br />
- stille Lektüre<br />
- anschließend stille Lektüre<br />
- S geben Textverständnis wieder<br />
- S werden aufgefordert, den Plot wie- und formulieren aufgrund der<br />
derzugeben (Brainstorming)<br />
verschiedenen Versionen eine<br />
17 Vgl. Dann, Diegritz, Rosenbusch, 1999.<br />
18 Vgl. Rinke, Menzel, 2000, S.28ff.<br />
19 Vgl. Golberg, 2006, S.2.<br />
20 Vgl. Klösel, Lüthen, 2000, S.53-56.<br />
21 Vgl. zu dem Problem: Nohl, 2000, S.48-52. Winzer, 2001, S.126.<br />
Sozialform –<br />
Medien<br />
UG<br />
Plakat<br />
Kopie, Folie<br />
8