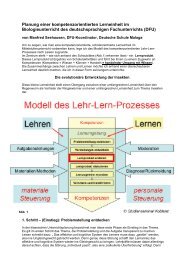Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Musterbeispiel Gedichtinterpretation - Praktikum macht Schule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
de wird durch die Sichtweise und die Arbeitseinstellung der Klasse geprägt. Nur wenn kein Schüler<br />
eine Rezitation des Gedichtes vorbereitet haben sollte, ist der Text vom Lehrer vorzutragen.<br />
Nach dem Vortrag bekommt die Lerngruppe die Möglichkeit, die Ballade nochmals leise zu lesen. Sie<br />
wird als Folie neben der Tafel an die Wand projiziert. Zum einen kann damit die Gefahr von Ver-<br />
ständnisschwierigkeiten, die aus der Rezitation resultieren könnten, verringert werden, zum anderen<br />
wird die zunächst auditive Rezeption visuell unterstützt.<br />
Im Anschluss haben die Schülerinnen und Schüler den Handlungsverlauf der Ballade mit eigenen<br />
Worten wiederzugeben. Die in der Sachanalyse herausgestellte Offenheit des Gedichtes gilt es dabei<br />
zu bewahren und als Ausgangspunkt einer differenzierten, den subjektiven Eindrücken am Text nach-<br />
spürenden Wahrnehmung fruchtbar zu machen. Davon, dass die Ballade Gefühle der Irritation und des<br />
Zweifels auslöst, sich einem raschen und vor allem unzweideutigen Verständnis verweigert und dadurch<br />
zum textnahen Lesen herausfordert, ist auszugehen. Die verschiedenen Betrachtungsweisen der<br />
Schülerinnen und Schüler sollen stichwortartig festgehalten werden. Allerdings ist an dieser Stelle<br />
eine Einschränkung zu treffen: Denn es muss davon ausgegangen werden, dass die Wortmeldungen<br />
aus der Klasse vorrangig das in der „Sachanalyse“ als zweite Leerstelle ausgewiesene Strukturelement<br />
problematisieren, mithin den Konflikt um den verlorenen Fisch ansprechen. Die Zäsur zwischen der<br />
vierten und der fünften Strophe, die auf einer Metaebene die Möglichkeit eröffnet, dass zwei narrative<br />
Schemata in einem lyrischen Text nebeneinander gestellt wurden, erscheint als zu kompliziert und<br />
ungewöhnlich, als dass sie in dieser Alterstufe bereits entdeckt wird. Am Ende dieser Phase - es ist<br />
davon auszugehen, dass die Ballade von den Schülerinnen und Schülern u.a. als Geschichte einer har-<br />
ten Bestrafung, als Geschichte eines Irrtums oder als Geschichte eines klugen und zugleich leichtsinnigen<br />
Fisches wiedergegeben wird - soll die Lerngruppe aus dem Konflikt der so unterschiedlichen<br />
Wahrnehmungen eine Problemfrage (im Sinne einer Leitfrage oder eines „Prüfauftrages“) für den<br />
weiteren Unterricht entwickeln und formulieren. Einer schwierigen Situation lässt sich hier voraus-<br />
schauend begegnen: Sollten die Schülerinnen und Schüler keine divergierenden Positionen über den<br />
Handlungsverlauf der Ballade entwerfen, lässt sich der Konflikt für eine Leitfrage auch über fingierte<br />
gegensätzliche Aussagen, die als Zitate auf einer Folie fixiert sind (s. Anhang), provozieren. Auch das<br />
gegenteilige Problem muss in Rechnung gestellt werden: Danach ist darauf zu achten, dass nicht zu<br />
viele verschiedene Deutungen bereits in dieser Phase geäußert werden. Tatsächlich sollte für die Ent-<br />
wicklung einer Problemstellung schon eine Differenz von zwei Positionen genügen.<br />
Im nachfolgenden Abschnitt gilt es für die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, ihre bisherigen Thesen<br />
am Text zu überprüfen, zu verfeinern, zu diskutieren und mögliche Antworten in einem kleinen<br />
Vortrag zu bündeln. Dabei können sie sich auch an den schon im Unterricht in Klasse 5 erarbeiteten<br />
Strukturkenntnissen (etwa zum Plot, zur Figurenkonstellation, zur Zäsur, zur Leerstelle, zur Pointe)<br />
und Arbeitstechniken (z.B. zur Herstellung von Schaubildern) orientieren.<br />
In der anschließenden Auswertungsphase haben die Gruppen dann ihre Ergebnisse in einem kleinen<br />
Vortrag vor der Klasse (von vorn) zu präsentieren. Die Resultate sind zu sammeln, zu hinterfragen und<br />
zu vergleichen. In jedem Fall erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sich die Ballade einer definitiven<br />
Aussage über den Handlungsverlauf entzieht, und verschiedene Lesarten offeriert. Ob alle<br />
Gruppen in dieser Phase zu Wort kommen, hängt davon ab, inwieweit bis zum Ende neue inhaltliche<br />
Akzente gesetzt werden können und ob sämtliche Teams auf eine Vorstellung drängen. Überdies muss<br />
auf einen zeitlichen Spielraum für den Abschluss der Stunde geachtet werden.<br />
Im folgenden Unterrichtsgespräch gilt es die Konsequenzen aus den präsentierten empirischen Befunden<br />
zu ziehen. Über die Konfrontation mit den bislang erarbeiteten Fachbegriffen und hier insbesonde-<br />
re dem in den vorangegangenen Stunden ausdifferenzierten Leerstellenbegriff (eindeutig / zweideutig)<br />
sollten die Schülerinnen und Schüler die Mehrdeutigkeit der Leerstelle als grundlegendes Textordnungsprinzip<br />
der Ballade von H. Heine erkennen und benennen können. Denkbar ist an dieser Stelle<br />
auch die Option, den diskutierten Sachverhalt an der Tafel graphisch darstellen zu lassen. Die Schülerinnen<br />
und Schüler könnten die Leerstelle z.B. im Sinne eines sich öffnenden Gleises skizzieren.<br />
Am Ende der Stunde steht zur Sicherung die Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsschritte und<br />
Resultate an. Zur weiteren Vertiefung der Ergebnisse sollen die Schülerinnen und Schüler zu Hause<br />
den Plot aus der Sicht des Schiffsjungen nacherzählen. Damit wird die Möglichkeit eingeräumt, aus<br />
veränderter Perspektive das Geschehen produktiv zu überdenken und aus den in der Stunde erschlossenen<br />
Lesarten die glaubhafteste Version auszuwählen. Dies wiederum setzt einen kritischen Ver-<br />
gleich voraus. - Für den Fall, dass der geplante Unterrichtsverlauf nicht in der Zeit von 45 Minuten zu<br />
bewältigen ist, weil beispielsweise die Präsentationen zu lange dauern, lässt sich die Hausaufgabe<br />
auch als Stundenabschluss vor der Phase der begrifflichen Abstraktion stellen. Für den Fall, dass die<br />
6