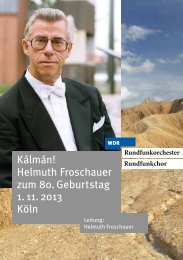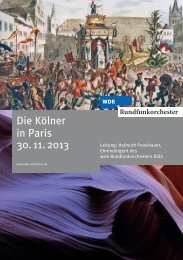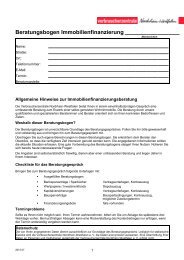Arsch huh, Zäng ussenander! - WDR.de
Arsch huh, Zäng ussenander! - WDR.de
Arsch huh, Zäng ussenander! - WDR.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>de</strong>r für die Gesellschaft und die Medien / Viele Beispiele aus <strong>de</strong>m Leben <strong>de</strong>s wdr<br />
elfalt keine Zukunft<br />
NACHTRAG<br />
Pflege von SeniorInnen mit Migrationshintergrund<br />
spezialisiert.<br />
Sie hat Schwierigkeiten, genügend<br />
türkischsprachige Mitarbeiterinnen<br />
zu fin<strong>de</strong>n: „Viele Familien<br />
wollen nicht, dass die muslimischen<br />
Frauen allein in frem<strong>de</strong><br />
Häuser gehen.“ Integration, so<br />
fin<strong>de</strong>t sie, sei nicht nur die Bringschuld<br />
<strong>de</strong>r Politik. „Die Migrantinnen<br />
und Migranten müssen<br />
sich auch mal selbst klar darüber<br />
wer<strong>de</strong>n, was sie wollen“, for<strong>de</strong>rte<br />
Auch privat treffen 66 Prozent <strong>de</strong>r<br />
wdr-Mitarbeiter im Familien- und<br />
Freun<strong>de</strong>skreis min<strong>de</strong>stens einmal<br />
in <strong>de</strong>r Woche auf Menschen mit<br />
verschie<strong>de</strong>nsten internationalen<br />
Hintergrün<strong>de</strong>n. Über soziale Medien<br />
im Internet sind es 55 Prozent.<br />
Unter an<strong>de</strong>rem dieses Ergebnis zeige,<br />
so Schmitz weiter, „dass wir im<br />
wdr Vielfalt als Normalität leben.<br />
Und das fin<strong>de</strong> ich gut so.“ Auch<br />
<strong>de</strong>n regelmäßigen interkulturellen<br />
Umgang über die alltägliche Arbeit<br />
wertet er positiv. „Das ist sicherlich<br />
ein Resultat unserer langjährigen Bemühungen.<br />
Allerdings gibt es keine<br />
Vergleichszahlen, weil wir die Ersten<br />
sind, die danach gefragt haben.“<br />
Fotos: wdr/Sachs<br />
sie auf <strong>de</strong>r wdr-Veranstaltung:<br />
„Erst dann kann die Politik uns<br />
als Partner betrachten und nicht<br />
als Problem.“<br />
Tina Jelveh kam mit acht Jahren<br />
aus <strong>de</strong>m Iran nach Deutschland.<br />
2009 wur<strong>de</strong> die Stu<strong>de</strong>ntin <strong>de</strong>r<br />
evangelischen Theologie mit 24<br />
Jahren für Bündnis 90 / Die Grünen<br />
in Herne zur Bürgermeisterin<br />
gewählt. „Warum gibt es so etwas<br />
nicht öfter“, wollte Mo<strong>de</strong>ratorin<br />
Atalay wissen. Jelvehs Erklärung:<br />
Drei Prozent <strong>de</strong>r Befragten haben<br />
keine <strong>de</strong>utsche Staatsangehörigkeit.<br />
Von <strong>de</strong>r 97-prozentigen<br />
Mehrheit <strong>de</strong>r „Pass-Deutschen“<br />
besitzen wie<strong>de</strong>rum 3,5 Prozent<br />
min<strong>de</strong>stens eine weitere Staatsangehörigkeit.<br />
Knapp sieben Prozent<br />
aller wdr-Mitarbeiter sind im Ausland<br />
geboren. Und fast 14 Prozent<br />
<strong>de</strong>r Belegschaft haben Eltern, die<br />
im Ausland geboren wur<strong>de</strong>n.<br />
Etwa zehn Prozent haben schon<br />
einmal ein Jahr im Ausland verbracht<br />
– entwe<strong>de</strong>r beruflich, während<br />
ihrer Ausbildung o<strong>de</strong>r privat.<br />
Am häufigsten genannt wur<strong>de</strong>n die<br />
USA, gefolgt von Frankreich und<br />
England. Aber auch Kanada, Chile,<br />
„Jahrzehntelang hat Deutschland<br />
negiert, ein Einwan<strong>de</strong>rungsland<br />
zu sein. Das hat die Migrantinnen<br />
und Migranten nicht gera<strong>de</strong> ermutigt,<br />
sich in <strong>de</strong>n Kommunen zu<br />
engagieren.“ Eine Erklärung bot<br />
Guntram Schnei<strong>de</strong>r an: „Weil es<br />
in <strong>de</strong>r Bevölkerung immer noch<br />
zu viele Vorbehalte gibt“; als Integrationsminister<br />
bekomme er<br />
täglich sehr viel rassistische und<br />
antisemitische Post.<br />
In <strong>de</strong>utschen Behör<strong>de</strong>n haben<br />
zwölf Prozent <strong>de</strong>r MitarbeiterInnen<br />
einen Migrationshintergrund.<br />
„Mehr wäre besser“,<br />
sagte Schnei<strong>de</strong>r und plädierte für<br />
anonymisierte Bewerbungen. Er<br />
lenkte jedoch auch <strong>de</strong>n Blick auf<br />
die soziale Herkunft. In Duisburg<br />
und Gelsenkirchen gebe es<br />
beispielsweise Jugendliche – mit<br />
und ohne Migrationshintergrund<br />
–, die noch nie aus ihrem Stadtteil<br />
herausgekommen seien, „noch<br />
nicht mal zum Auswärtsspiel“.<br />
„Interkulturelle Öffnung“, so<br />
<strong>de</strong>r Minister, „ist eben auch eine<br />
Frage <strong>de</strong>s Einkommens und <strong>de</strong>r<br />
Bildung.“<br />
Die Rolle <strong>de</strong>r Medien<br />
„Eine mediale Parallelgesellschaft<br />
gibt es <strong>de</strong>nnoch nicht in Deutschland“,<br />
sagte Erk Simon, Leiter <strong>de</strong>r<br />
wdr-Medienforschung. Einer<br />
Studie von ard und zdf zufolge<br />
nutzten nur 14 Prozent <strong>de</strong>r in<br />
Deutschland leben<strong>de</strong>n MigrantInnen<br />
ausschließlich Medien in<br />
ihrer Muttersprache. Nicht zuletzt<br />
<strong>de</strong>shalb seien seit 1992 auch Menschen<br />
mit Migrationshintergrund<br />
ins so genannte „Panel“ (die Zuschauergruppe,<br />
anhand <strong>de</strong>rer die<br />
Einschaltquoten in Deutschland<br />
gemessen wer<strong>de</strong>n) aufgenommen<br />
wor<strong>de</strong>n. Allerdings nur solche aus<br />
EU-Län<strong>de</strong>rn, erklärte Simon, womit<br />
die Türkei als Herkunftsland<br />
<strong>de</strong>r größten Einwan<strong>de</strong>rungsgruppe<br />
in Deutschland wegfalle.<br />
Vielfalt in <strong>de</strong>n Medien<br />
Die zweite Podiumsdiskussion <strong>de</strong>s<br />
Tages beschäftigte sich mit Vielfalt<br />
in <strong>de</strong>n Medien, also mit <strong>de</strong>r<br />
Frage, ob und wie MigrantInnen<br />
<strong>de</strong>n Alltag <strong>de</strong>r wdr-Beschäftigten<br />
Norwegen und Südafrika gehören<br />
ebenso wie Libanon, Bhutan und<br />
Neuseeland zu <strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn, in<br />
<strong>de</strong>nen wdr-Mitarbeiter zeitweise<br />
gelebt haben.<br />
Rund 84 Prozent <strong>de</strong>r Befragten<br />
sprechen neben Deutsch eine weitere<br />
Sprache. Mehr als die Hälfte<br />
kann zwei weitere Sprachen, ein<br />
Fünftel sogar drei. Am weitesten<br />
verbreitet ist dabei Englisch, gefolgt<br />
von Französisch, Spanisch und<br />
Türkisch. Aber auch weniger geläufige<br />
Sprachen wie Farsi, Kisuaheli,<br />
Romanes und Vietnamesisch zählen<br />
dazu. Insgesamt beherrschen die<br />
wdr-Mitarbeiter 48 verschie<strong>de</strong>ne<br />
Sprachen. Sascha Woltersdorf<br />
in <strong>de</strong>n Medien vorkommen, aber<br />
auch, ob und wie sie an <strong>de</strong>r Medienproduktion<br />
beteiligt sind. Der<br />
Verein „Neue <strong>de</strong>utsche Medienmacher“<br />
(NDM) geht davon aus,<br />
dass da ein Zusammenhang besteht,<br />
und engagiert sich <strong>de</strong>shalb<br />
für mehr Vielfalt in <strong>de</strong>n Medien<br />
und mehr Perspektiven in <strong>de</strong>r Berichterstattung.<br />
„Man kann die<br />
Frau im Kopftuch auch mal zum<br />
Parkplatzproblem in <strong>de</strong>r Stadt<br />
befragen, statt sie stumm einzublen<strong>de</strong>n,<br />
wenn es um Integrationsprobleme<br />
geht“, regte zum Beispiel<br />
die Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r NDM, Sheila<br />
Mysorekar, an. Dafür brauche es<br />
aber mehr „Auslän<strong>de</strong>rInnen“ im<br />
seriösen Journalismus und nicht<br />
nur in <strong>de</strong>r Unterhaltung.<br />
Hier komme allerdings gera<strong>de</strong> etwas<br />
in Bewegung, doch: „Bis wir<br />
eine afro<strong>de</strong>utsche Tagesschau-<br />
Sprecherin haben, wird es wohl<br />
noch dauern.“ Auch Sonia Seymor<br />
Mikich, Tochter einer Deutschen<br />
und eines Serben, in England geboren<br />
und aufgewachsen, wünscht<br />
sich, dass ReporterInnen mit an<strong>de</strong>ren<br />
als europäisch-<strong>de</strong>utschen<br />
kulturellen Wurzeln Normalität<br />
wer<strong>de</strong>n und dass sie nicht nur Integrationsthemen<br />
bearbeiten dürfen.<br />
Nach und nach erobern aber schon<br />
fremd klingen<strong>de</strong> Namen die Bildschirme.<br />
Großen Nachholbedarf<br />
haben jedoch die Printmedien:<br />
Hier hat nur ein Prozent <strong>de</strong>r Belegschaft<br />
eine Zuwan<strong>de</strong>rungsgeschichte.<br />
Staatsministerin Böhmer<br />
for<strong>de</strong>rte in Köln <strong>de</strong>shalb Maßnahmen<br />
wie Mentoring-Programme<br />
und interkulturelle Expertendatenbanken:<br />
„Es wird Zeit, vom<br />
Regionalexpress in <strong>de</strong>n ICE umzusteigen.“<br />
Unterschie<strong>de</strong><br />
In drei Workshops befassten sich<br />
Arbeitsgruppen mit interkultureller<br />
Öffnung im Hinblick auf Personalmarketing<br />
und Unternehmenskommunikation<br />
sowie mit Vielfalt<br />
im Arbeitsalltag und stellten ihre<br />
Ergebnisse anschließend vor. Der<br />
wdr-Integrationsbeauftragte<br />
Zambonini fasste <strong>de</strong>n Tag wie folgt<br />
zusammen: „Es hat sich in <strong>de</strong>n<br />
Diskussionen und insbeson<strong>de</strong>re<br />
in <strong>de</strong>n Workshops gezeigt, dass<br />
im Zentrum die Frage steht, wie<br />
man mit Unterschie<strong>de</strong>n umgeht,<br />
egal ob sich diese auf die Herkunft,<br />
die Religion, das Geschlecht, das<br />
Alter, eine Behin<strong>de</strong>rung o<strong>de</strong>r etwas<br />
an<strong>de</strong>res beziehen.“ In Zukunft<br />
müsse man das Thema Diversity<br />
umfassend angehen.<br />
Ein Anfang sei bereits gemacht:<br />
Zambonini arbeitet bei Führungskräfte-Schulungen<br />
mit <strong>de</strong>r<br />
Gleichstellungsbeauftragten <strong>de</strong>s<br />
wdr, Wilhelmine Piter, zusammen.<br />
Wichtig sei auch, so Zambonini,<br />
Zielvereinbarungen festzulegen<br />
und <strong>de</strong>ren Umsetzung<br />
nachzuhalten, damit Vielfalt und<br />
gegenseitige Wertschätzung als<br />
Unternehmenskultur kein Lippenbekenntnis<br />
blieben.<br />
<br />
Christine Schilha<br />
wdr-Intendantin Monika Piel bei <strong>de</strong>r<br />
Eröffnung <strong>de</strong>s Kongresses<br />
Gualtiero Zambonini im Gespräch mit<br />
Mo<strong>de</strong>ratorin Pinar Atalay<br />
Unternehmerin Zeynep Babadagi-<br />
Hardt, Geschäftsführerin „Die Pflegezentrale<br />
GmbH“<br />
Dr. Ahmet Lokurlu, Geschäftsführer<br />
<strong>de</strong>r SOLITEM GmbH und Europäischer-<br />
Solarpreis-Träger<br />
V. l. n. r.: Mo<strong>de</strong>rator Till Nassif, Dr.<br />
Ahmet Lokurlu und Michael Schmidt,<br />
Vorstandsvorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r BP Europa<br />
Udo Behren<strong>de</strong>s, Kölner Polizeichef<br />
<strong>WDR</strong>PRINT · Dezember 2012 13