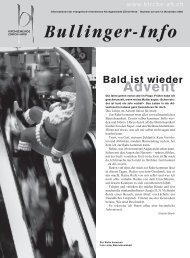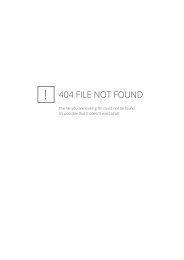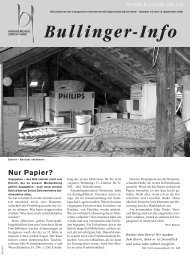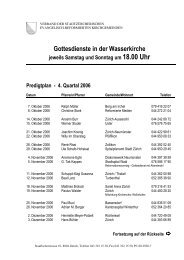Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Zürich</strong>s reformierte <strong><strong>Kirche</strong>n</strong> im überblick<br />
Die <strong>Stadt</strong>kirchen <strong>der</strong> Reformatoren<br />
Am 11. September 1526 «tett meister Ulrich<br />
Zw<strong>in</strong>gli die erst predigt im nüwen predigtstuel»,<br />
berichtet <strong>der</strong> Chronist Bernhard<br />
Wyss; und He<strong>in</strong>rich Bull<strong>in</strong>ger überliefert <br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> Reformationsgeschichte: «Und am 8.<br />
July [1526] namm man die fronaltarste<strong>in</strong> zuo<br />
dem Frowenmünster, zuo Predigern, Barfüssern<br />
und August<strong>in</strong>ern, und fürt sie zuo dem<br />
grossen Münster. Da ward e<strong>in</strong> nüwe Cantzel,<br />
uss ermellten ste<strong>in</strong>en gebuwen: und ward<br />
<strong>der</strong> alltarste<strong>in</strong> von den predigern, alls <strong>der</strong><br />
längist was, <strong>in</strong> mitten geleit, das er fürgieng,<br />
<strong>in</strong> die Cantzel daruff jetzund <strong>der</strong> predicant<br />
stadt.» 1 Die Errichtung des Kanzellettners<br />
im Grossmünster ist nach dem Entfernen <strong>der</strong><br />
mittelalterlichen Kulte<strong>in</strong>richtungen die erste<br />
bauliche Massnahme für den reformierten<br />
Predigtgottesdienst. Zwei Darstellungen von<br />
Zw<strong>in</strong>glis Kanzellettner zeigt die Chronik des<br />
Johannes Wick zu den Jahren 1572 und 1586:<br />
Auf <strong>der</strong> Mauerkrone axial vorspr<strong>in</strong>gend <strong>der</strong><br />
Kanzelkorb, die seitlichen Brüstungen des<br />
Lettners zum Chorbogen leicht nach vorn<br />
abgew<strong>in</strong>kelt. E<strong>in</strong> ähnlicher Kanzellettner<br />
wird 1527 <strong>in</strong> St. Peter errichtet, <strong>der</strong> Taufste<strong>in</strong><br />
anstelle des alten Hochaltars im Chor<br />
gesetzt. 1598 bildet Ste<strong>in</strong>metz Rütschi den<br />
heute bestehenden Taufste<strong>in</strong> mit Deckel und<br />
Tischbrett für die Feier des Abendmahls, <strong>der</strong><br />
unter <strong>der</strong> Kanzel aufgestellt wird. So stehen<br />
Kanzel und Taufste<strong>in</strong> im Zentrum <strong>der</strong> versammelten<br />
Geme<strong>in</strong>de.<br />
Mit den Pfarr-, Stifts- und Klosterkirchen<br />
verfügt die <strong>Stadt</strong> über zahlreiche und genügend<br />
grosse Versammlungsstätten. Für die<br />
<strong>Stadt</strong>bevölkerung genügen Grossmünster,<br />
Fraumünster und St. Peter, die übrigen <strong><strong>Kirche</strong>n</strong><br />
dienen nunmehr an<strong>der</strong>en Zwecken. Kirchliche<br />
Zusammenkünfte, so hält das zweite Helvetische<br />
Bekenntnis fest, s<strong>in</strong>d nötig, «um dem<br />
Volke das Wort Gottes ordnungsgemäss zu<br />
verkündigen, um öffentliche Bitte und Gebet<br />
zu tun, die Sakramente ordnungsgemäss zu<br />
feiern und für die Armen, für alle nötigen<br />
Aufwendungen <strong>der</strong> <strong>Kirche</strong> [...] Beiträge zu<br />
sammeln.» 2 Wohl wohnt Gott nicht «<strong>in</strong> Tempeln<br />
von Händen gemacht», auch ist das Beten<br />
nicht an e<strong>in</strong>e bestimmte Stätte gebunden;<br />
doch es s<strong>in</strong>d heilige Orte, «die Gott und se<strong>in</strong>er<br />
Anbetung gewidmet s<strong>in</strong>d». Der Raum, <strong>in</strong> dem<br />
sich die Gläubigen versammeln, soll «würdig<br />
und <strong>der</strong> <strong>Kirche</strong> Gottes <strong>in</strong> je<strong>der</strong> H<strong>in</strong>sicht angemessen<br />
se<strong>in</strong>.» Und ganz im reformatorischen<br />
Geist ermahnt das Helvetische Bekenntnis,<br />
den grössten Teil des Gottesdienstes auf die<br />
Lehre des Evangeliums zu verwenden. Auf<br />
ideale Weise verwirklicht <strong>der</strong> Kanzellettner<br />
diese Anweisung, <strong>der</strong> mit dem Taufste<strong>in</strong> davor<br />
im Blickfeld <strong>der</strong> versammelten Geme<strong>in</strong>de<br />
steht.<br />
Die Predigerkirche<br />
Die Predigerkirche dient nach <strong>der</strong> Aufhebung<br />
des Dom<strong>in</strong>ikanerklosters als Kornschütte<br />
(Chor) und Trotte (Langhaus); seit 1542<br />
trennt e<strong>in</strong>e Wand die beiden Räume. Die<br />
Bewohner des Nie<strong>der</strong>dorfes besuchen den<br />
Gottesdienst im Erdgeschoss des Chores. 1607<br />
beschliesst <strong>der</strong> Rat, das Langhaus <strong>der</strong> neuen<br />
Predigergeme<strong>in</strong>de zu übergeben. 1611–14<br />
wird die romanische Bettelordenskirche zur<br />
reformierten Predigerkirche umgestaltet.<br />
An<strong>der</strong>s als zur Zeit <strong>der</strong> Reformation genügt<br />
die schlichte Anpassung an die Erfor<strong>der</strong>nisse<br />
des Gottesdienstes nicht mehr; hier entsteht<br />
e<strong>in</strong> neuer <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>raum, <strong>der</strong> sich an den<br />
Meisterwerken <strong>der</strong> Zeit misst. Der Dachstuhl<br />
wird erhöht, e<strong>in</strong> Tonnengewölbe aus Holz<br />
e<strong>in</strong>gebaut. Neu s<strong>in</strong>d die Stuckaturen an<br />
Wänden und Gewölben, Girlanden und Ranken<br />
<strong>in</strong> regelmässig wechselnden geometrischen<br />
Rahmen – e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> frühen Stuckdekorationen<br />
<strong>der</strong> deutschen Schweiz, die an St. Michael <strong>in</strong><br />
München er<strong>in</strong>nert. Die Stuckateure haben ihre<br />
Arbeit signiert: Die Gruppe leitete Ulrich Oeri<br />
(1567–1631), <strong>der</strong> zuvor zusammen mit den<br />
Tess<strong>in</strong>ern Antonio und Pietro Castello u. a.<br />
im Kloster Wett<strong>in</strong>gen gearbeitet hatte. Nun<br />
ist aber die Predigerkirche ke<strong>in</strong>e katholische<br />
<strong>Kirche</strong> und ihr Langhaus vom Chor baulich<br />
getrennt. Wie wird hier e<strong>in</strong> frühbarocker Predigtraum<br />
gestaltet Die Kanzel wird erhöht<br />
<strong><strong>Kirche</strong>n</strong> im kommunalen Inventar