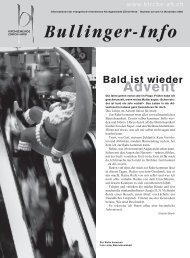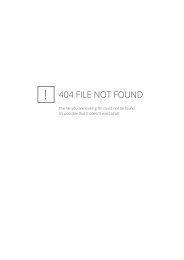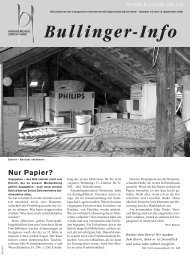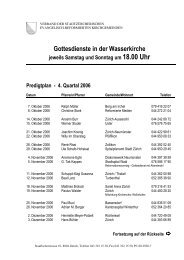Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Paillard (geb. 1923). Die Bauart <strong>der</strong> expressiven<br />
Staffelung <strong>der</strong> Kuben mit vielen Ecken,<br />
Vor- und Rücksprüngen ist im Schweizerischen<br />
<strong><strong>Kirche</strong>n</strong>bau <strong>der</strong> sechziger und frühen siebziger<br />
Jahre verbreitet – ausser <strong>in</strong> <strong>Zürich</strong>, wo die<br />
<strong>Kirche</strong> Saatlen typologisch e<strong>in</strong>e Ausnahme<br />
darstellt. Der e<strong>in</strong>geschränkte Bauplatz führt<br />
dazu, die <strong>Kirche</strong> im Obergeschoss zu platzieren.<br />
Der Architekt gestaltet sie als Würfel,<br />
<strong>der</strong> sich aus den Nebenbauten emporhebt<br />
und e<strong>in</strong>zig vom Eckturm überragt wird. Der<br />
zentrale Lichte<strong>in</strong>fall im Innern geschieht aus<br />
dem Turm. Aber die E<strong>in</strong>richtung im quadratischen<br />
Raum ist nicht danach ausgerichtet.<br />
Kanzel und Abendmahltisch stehen frontal<br />
<strong>der</strong> (un-) beweglichen Bestuhlung gegenüber.<br />
Das orthogonale Pr<strong>in</strong>zip stellt den Blickpunkt<br />
<strong>in</strong> die Ecke.<br />
In <strong>Zürich</strong> erstarrt <strong>der</strong> reformierte wie katholische<br />
Sakralbau zwischen 1960 und 1975 <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er formalistischen Mo<strong>der</strong>nität. Es entstehen<br />
würfelförmige Kuben, im Innern meist<br />
dem Deckenrand entlang <strong>in</strong>direkt belichtet<br />
– architektonisch ansprechende Räume, wie<br />
die Neue <strong>Kirche</strong> Affoltern 21 . Die Frage nach<br />
den Möglichkeiten, wie sich e<strong>in</strong>e <strong>Kirche</strong> dar<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>richten kann, bleibt zweitrangig. Sakralbau<br />
ist jedoch mehr: Im Zentrum steht die Frage,<br />
wie die Geme<strong>in</strong>de Gottesdienst feiert. Die<br />
Antwort dazu soll das Fundament se<strong>in</strong>, auf<br />
dem gebaut wird. «Bauen für die <strong>Kirche</strong>» 22<br />
geschieht aus dem Selbstverständnis <strong>der</strong><br />
Geme<strong>in</strong>de und mit Hilfe des Architekten, <strong>der</strong><br />
entwirft und baut, umwelt- und sozialverträglich<br />
baut. Es ist e<strong>in</strong> Öffnen von Innen<br />
nach Aussen: Städteplaner und Städtebauer<br />
mögen darob nicht erschrecken. E<strong>in</strong> bee<strong>in</strong>druckendes<br />
Beispiel ist die Andreaskirche im<br />
Heiligfeld. Jakob Padrutt (1908–1960) gew<strong>in</strong>nt<br />
1956–1957 e<strong>in</strong>en zweistufigen Wettbewerb,<br />
bis zu se<strong>in</strong>em Tod arbeitet er am Projekt<br />
weiter. Mit <strong>der</strong> Ausführung 1965–1966 wird<br />
die Architektengeme<strong>in</strong>schaft Frank Bolliger<br />
(geb. 1932), He<strong>in</strong>z Hönger (1930–1990) und<br />
Werner Dubach (geb. 1933) betraut. Der fensterlose,<br />
mit Granitplatten verkleidete Würfel<br />
wird optisch auf e<strong>in</strong>en Glassockel bzw. auf<br />
die Stahlstützen gestellt. Der grossflächige<br />
Mittelteil des Daches ist aus <strong>der</strong> Vogelperspektive<br />
betrachtet wie e<strong>in</strong> Atrium nach<br />
<strong>in</strong>nen abgesenkt. Aus <strong>der</strong> Mitte verteilt sich<br />
das Licht, dr<strong>in</strong>gt durch die Glaswände des<br />
«Dachhofs» <strong>in</strong>s Innere, wird vom Dachrand<br />
und <strong>der</strong> Aussenwand reflektiert und von <strong>der</strong><br />
Rasterdecke gebrochen. E<strong>in</strong>drucksvoll ist auch<br />
die künstliche Ausleuchtung des <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>raums:<br />
Strahlen von Licht und Schatten <strong>der</strong><br />
nicht sichtbaren Lichtquellen bündeln sich<br />
<strong>in</strong> den Ecken und auf dem Wandkreuz h<strong>in</strong>ter<br />
Abendmahltisch und Kanzel. Die Sitzbänke<br />
s<strong>in</strong>d auf drei Seiten verteilt. Die Geschlossenheit<br />
lädt zur konzentrierten Meditation e<strong>in</strong>,<br />
nicht ablenkend, aber auch nicht e<strong>in</strong>engend.<br />
Die Andreaskirche wetteifert nicht mit den<br />
Hochhäusern des Quartiers, aber sie wird als<br />
e<strong>in</strong> beson<strong>der</strong>es Gebäude mit e<strong>in</strong>er beson<strong>der</strong>en<br />
Funktion wahrgenommen und akzeptiert.<br />
Schlussgedanken<br />
Dieser Überblick zeichnet e<strong>in</strong> eher sprödes<br />
Bild des reformierten <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>baus <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Zürich</strong>. In gewisser Weise entspricht<br />
dieses Bild dem reformierten <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>verständnis.<br />
Gleichwohl wurde an an<strong>der</strong>n Orten<br />
baufreudiger, aufwendiger und auch mo<strong>der</strong>ner<br />
gebaut: Querovale, stützenlose Räume,<br />
reich dekoriert, später avantgardistisch und<br />
richtungweisend. Die Unterschiede bestehen<br />
bereits zwischen Kanton und <strong>Stadt</strong> <strong>Zürich</strong> und<br />
auch zur evangelisch-lutherischen Geme<strong>in</strong>de<br />
<strong>in</strong> Unterstrass mit dem zeltdachförmigen<br />
Sichtbetonbau <strong>der</strong> Mart<strong>in</strong>-Luther-<strong>Kirche</strong>.<br />
Spärlich s<strong>in</strong>d die Momente, wo grundsätzlich<br />
über den <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>bau nachgedacht wird. Sie<br />
beschränken sich auf die Zeit <strong>der</strong> Reformation<br />
bis h<strong>in</strong> zum Zweiten Helvetischen Bekenntnis<br />
von 1566, <strong>in</strong> <strong>der</strong> die mittelalterlichen <strong><strong>Kirche</strong>n</strong><br />
umgenutzt wurden. Später s<strong>in</strong>d es die Jahre<br />
von 1890 bis 1910, <strong>in</strong> denen grosse <strong><strong>Kirche</strong>n</strong><br />
gebaut werden und <strong>in</strong>tensiv über ihre Bauweise<br />
nachgedacht wird. Paul Reber trifft<br />
den Kern, wenn er <strong>in</strong> den Basler Nachrichten<br />
schreibt: «An Stelle dessen, was verdrängt<br />
<strong><strong>Kirche</strong>n</strong> im kommunalen Inventar 21