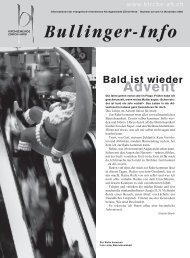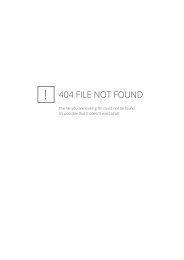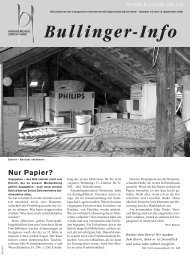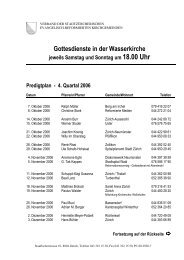Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Reformierte Kirchen der Stadt Zürich - Kirche in Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
400 Personen zu bauen. Das 1857 von Johann<br />
Jakob Breit<strong>in</strong>ger (1814–1880) vorgelegte Projekt<br />
gefällt und wird 1858–1860 ausgeführt<br />
als kle<strong>in</strong>e, dem Gelände angepasste Halle im<br />
Stil englischer Tudorgotik.<br />
Zur gleichen Zeit ist <strong>in</strong> Basel die neugotische<br />
Elisabethenkirche im Bau, die, wie<br />
e<strong>in</strong> mittelalterliches Bauwerk von e<strong>in</strong>er<br />
Bauhütte erstellt, im beson<strong>der</strong>n die jungen<br />
Architekten fasz<strong>in</strong>iert. Zu ihnen gehört Paul<br />
Reber (1835–1908). Er beschäftigt sich mit<br />
mittelalterlicher Baukunst, nimmt erfolgreich<br />
an Wettbewerben teil. In <strong>Zürich</strong> kann er<br />
1883–1884 die <strong>Kirche</strong> Unterstrass als Ersatz für<br />
die alte Moritzkapelle bauen. Der neugotische<br />
Sichtbackste<strong>in</strong>bau ist längsgerichtet, über<br />
dem E<strong>in</strong>gang erhebt sich <strong>der</strong> Fassadenturm. Bis<br />
zum Umbau von 1962 waren <strong>in</strong> <strong>der</strong> Saalkirche<br />
auf drei Seiten Emporen e<strong>in</strong>gebaut, die Orgel<br />
befand sich anfangs über dem E<strong>in</strong>gang. Aussen<br />
ist <strong>der</strong> Chor <strong>in</strong> den orthogonalen Baukubus<br />
<strong>in</strong>tegriert, an<strong>der</strong>s im Innern: Im schmalen<br />
Chorbogen steht die Kanzel, die Rückwand<br />
trennt das dah<strong>in</strong>ter liegende Unterrichtszimmer<br />
vom <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>raum. Die Estrade über dem<br />
Zimmer ist nicht abgeschlossen, <strong>der</strong> Blick<br />
von den <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>bänken reicht <strong>in</strong> die Tiefe bis<br />
zum grossen Masswerkfenster – e<strong>in</strong>e gotische<br />
<strong>Kirche</strong> mit Langhaus und erhöhtem Chor für<br />
den reformierten Gottesdienst.<br />
Paul Reber erkennt den Wi<strong>der</strong>spruch; <strong>in</strong> den<br />
Basler Nachrichten schreibt er: «Diese mittelalterlichen<br />
<strong><strong>Kirche</strong>n</strong>bauwerke waren für<br />
den katholischen Gottesdienst bestimmt, bei<br />
welchem <strong>der</strong> Altardienst e<strong>in</strong>e hervorragende<br />
Bedeutung hat, die durch den Chorbau <strong>in</strong><br />
ausdrucksvoller Weise stilistisch motiviert<br />
wurde. Für den protestantischen Cultus hat<br />
aber <strong>der</strong> Chorbau, die Priesterkirche, ke<strong>in</strong>e<br />
Berechtigung mehr [...] Wird aber <strong>der</strong> Altar<br />
mit dem Chorbau preisgegeben, so tritt die<br />
Frage <strong>in</strong> den Vor<strong>der</strong>grund: Was wollen wir an<br />
se<strong>in</strong>e Stelle setzen Die Antwort liegt nahe; an<br />
Stelle dessen, was verdrängt wird, trete das,<br />
was den Kern des reformierten Gottesdienstes<br />
bildet: das von <strong>der</strong> Kanzel verkündete Wort.<br />
Nicht bescheiden an e<strong>in</strong>e Säule gedrückt,<br />
o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>em Schwalbenneste gleich an e<strong>in</strong>en<br />
Eckpfeiler <strong>der</strong> Vierung geheftet, soll die Kanzel<br />
<strong>der</strong> Geme<strong>in</strong>de gegenübergestellt werden.<br />
Die Kanzel gehört <strong>in</strong> die Mitte, <strong>in</strong> den vollen<br />
Gesichtskreis <strong>der</strong> <strong>Kirche</strong>. Wir wollen e<strong>in</strong>e<br />
Prediger- und ke<strong>in</strong>e Opferkirche, <strong>in</strong> welcher<br />
<strong>der</strong> Redner von allen Seiten gut gesehen und<br />
deutlich verstanden wird.» 5<br />
Ähnliche For<strong>der</strong>ungen an den evangelischen<br />
<strong><strong>Kirche</strong>n</strong>bau s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Deutschland zu hören. 1891<br />
veröffentlicht die Wiesbadener Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong><br />
Zusammenarbeit mit Pfarrer und Architekt e<strong>in</strong><br />
Programm, das Richtl<strong>in</strong>ien für den <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>bau<br />
festlegt (sog. Wiesbadener Manifest).<br />
Die Wiesbadener R<strong>in</strong>gkirche, 1892–1894 von<br />
Architekt Johannes Otzen (1839–1911) erbaut,<br />
bildet e<strong>in</strong>en quadratischen Mittelraum, <strong>der</strong><br />
sich zu vier Konchen erweitert. Paul Reber<br />
orientiert sich an diesem Bautyp, <strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Deutschen Bauzeitung publiziert ist. 6 Unmittelbar<br />
davon bee<strong>in</strong>flusst s<strong>in</strong>d die <strong><strong>Kirche</strong>n</strong> von<br />
Wiedikon und Wetzikon. Für die <strong>Kirche</strong> Bühl <strong>in</strong><br />
Wiedikon erhält Paul Reber 1894 den Auftrag,<br />
die Bauzeit dauert vom Sommer 1895 bis zum<br />
Spätherbst 1896. Es gel<strong>in</strong>gt dem Architekten,<br />
mit den Stilmitteln des Historismus e<strong>in</strong>en<br />
neuen, reformierten <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>raum zu schaffen.<br />
Der zur <strong>Stadt</strong> h<strong>in</strong> orientierten Schaufassade<br />
folgt e<strong>in</strong> verkürztes Langhaus, das sich nach<br />
zwei Fensterachsen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e grosse Dreikonchenanlage<br />
öffnet. Betont ist <strong>der</strong> Raum <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Mitte mit dem Taufste<strong>in</strong> und dem doppelstöckigen<br />
Predigtstuhl. Die Kanzelwand trennt<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> mittleren Konche den erdgeschossigen<br />
Unterrichtsraum vom <strong><strong>Kirche</strong>n</strong>raum. Darüber<br />
bef<strong>in</strong>det sich die grossflächige Empore mit <strong>der</strong><br />
Orgel. Der offene Raum h<strong>in</strong>ter <strong>der</strong> Kanzel wird<br />
so <strong>in</strong> den Gottesdienst mite<strong>in</strong>bezogen, an<strong>der</strong>s<br />
als bei <strong>der</strong> <strong>Kirche</strong> Unterstrass. Emporen gibt<br />
es auch <strong>in</strong> den Seitenarmen und im Langhaus.<br />
Die Geme<strong>in</strong>de schart sich von drei Seiten her<br />
und auf zwei Ebenen um die doppelstöckige<br />
Kanzel. Das untere Rednerpult genügt für<br />
e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Zuhörerschaft, die Kanzel auf<br />
<strong><strong>Kirche</strong>n</strong> im kommunalen Inventar 13