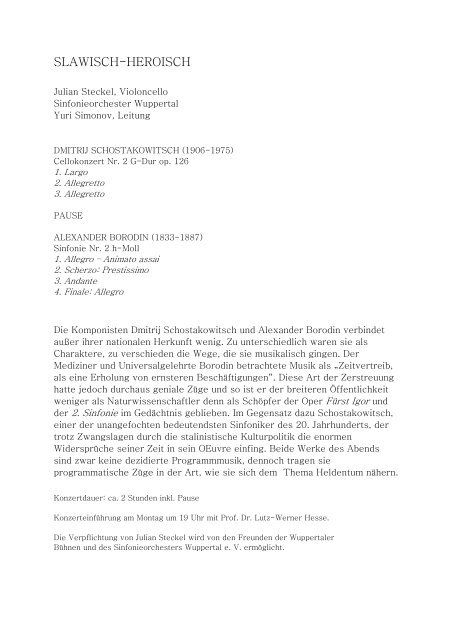SLAWISCH-HEROISCH - Sinfonieorchester Wuppertal
SLAWISCH-HEROISCH - Sinfonieorchester Wuppertal
SLAWISCH-HEROISCH - Sinfonieorchester Wuppertal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>SLAWISCH</strong>-<strong>HEROISCH</strong><br />
Julian Steckel, Violoncello<br />
<strong>Sinfonieorchester</strong> <strong>Wuppertal</strong><br />
Yuri Simonov, Leitung<br />
DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH (1906-1975)<br />
Cellokonzert Nr. 2 G-Dur op. 126<br />
1. Largo<br />
2. Allegretto<br />
3. Allegretto<br />
PAUSE<br />
ALEXANDER BORODIN (1833-1887)<br />
Sinfonie Nr. 2 h-Moll<br />
1. Allegro – Animato assai<br />
2. Scherzo: Prestissimo<br />
3. Andante<br />
4. Finale: Allegro<br />
Die Komponisten Dmitrij Schostakowitsch und Alexander Borodin verbindet<br />
außer ihrer nationalen Herkunft wenig. Zu unterschiedlich waren sie als<br />
Charaktere, zu verschieden die Wege, die sie musikalisch gingen. Der<br />
Mediziner und Universalgelehrte Borodin betrachtete Musik als „Zeitvertreib,<br />
als eine Erholung von ernsteren Beschäftigungen“. Diese Art der Zerstreuung<br />
hatte jedoch durchaus geniale Züge und so ist er der breiteren Öffentlichkeit<br />
weniger als Naturwissenschaftler denn als Schöpfer der Oper Fürst Igor und<br />
der 2. Sinfonie im Gedächtnis geblieben. Im Gegensatz dazu Schostakowitsch,<br />
einer der unangefochten bedeutendsten Sinfoniker des 20. Jahrhunderts, der<br />
trotz Zwangslagen durch die stalinistische Kulturpolitik die enormen<br />
Widersprüche seiner Zeit in sein OEuvre einfing. Beide Werke des Abends<br />
sind zwar keine dezidierte Programmmusik, dennoch tragen sie<br />
programmatische Züge in der Art, wie sie sich dem Thema Heldentum nähern.<br />
Konzertdauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause<br />
Konzerteinführung am Montag um 19 Uhr mit Prof. Dr. Lutz-Werner Hesse.<br />
Die Verpflichtung von Julian Steckel wird von den Freunden der <strong>Wuppertal</strong>er<br />
Bühnen und des <strong>Sinfonieorchester</strong>s <strong>Wuppertal</strong> e. V. ermöglicht.
DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH<br />
Cellokonzert Nr. 2 G-Dur op. 126<br />
Entstehung: Januar bis April 1966<br />
Uraufführung: 25. September 1966, Moskau<br />
Ein paar Takte nur, und doch vermitteln sie die Illusion einer einsamen<br />
Tundra. Sie weiten sich in der Folge als weitgehend trostloses Lamento, das<br />
den Solisten allein auf sinfonischem Hochplateau im eisigen Wind stehen lässt.<br />
Schnell wird klar: Dieses düster vergrübelte Werk hat rein gar nichts mit<br />
einem brillanten Solokonzert zu tun, bei dem eitle Leistungsschau zu Markte<br />
getragen wird. Es ist geradezu ein erschütternder Gegenentwurf zur<br />
klassisch-romantischen Ausgestaltung dieser Gattung. Nur der Inhalt zählt<br />
und Schostakowitsch hat aus leidvoller Erfahrung wahrhaft Substantielles zu<br />
erzählen. Unmittelbar nach der Uraufführung des ersten Cello-Konzerts 1959<br />
traf Schostakowitsch ein Schock: die Diagnose seines unheilbaren Rückenleidens,<br />
gepaart in der Folge mit weiteren gesundheitlichen Rückschlägen.<br />
1966 erkrankte Schostakowitsch erneut.<br />
Das zweite Konzert entstand zu großen Teilen während eines Sanatoriumsaufenthalts<br />
im April 1966 und wurde im September des gleichen Jahres von<br />
Mstislav Rostropowitsch im Moskauer Konservatorium zum 60. Geburtstag<br />
des Komponisten uraufgeführt. Ohne sich in fragwürdigen Deutungsregionen<br />
zu verlieren: Seine verschlechterte körperliche Verfassung hat sicher Spuren<br />
in der herben Klangsprache hinterlassen. Doch das Konzert als bloße<br />
Auseinandersetzung mit dem Abebben des Lebens zu deuten, griffe zu kurz.<br />
Zumal sich schon in seiner mittleren Schaffensperiode ein Hauptthema seiner<br />
Arbeit herauskristallisierte: das Drama des Individuums gegen das Böse und<br />
dessen Demaskierung. Diese Leitmotive waren autobiografisch motiviert.<br />
Mehrfach wurde der Komponist von der repressiven Staatsmacht bedroht, was<br />
ihn wiederholt in existentielle Krisen warf. Daran änderte auch die zeitweilige<br />
offizielle Hochschätzung nichts. Bereits 1936 diffamierte die “Prawda“ seine<br />
Werke als dekadent und verurteilte ihn als ideologiefeindlichen Musiker. 1948<br />
nahm die öffentliche Denunziation von Schostakowitsch durch Kulturoffizielle,<br />
ebenso wie die seiner Komponistenkollegen Prokofjew, Chatschaturjan und<br />
Mjaskowski, konkretere und schärfere Formen an. Schostakowitsch verlas<br />
daraufhin eine demütigende Selbstanklage vor einem offiziellen Treffen<br />
sowjetischer Tonkünstler, das einberufen worden war, um seinen<br />
„Formalismus“ zu verurteilen.<br />
Schostakowitsch kam mit dem Leben davon. Andere Freunde und Bekannte<br />
verschwanden und kehrten nie zurück. Unzweifelhaft hat ihn sein<br />
musikalischer Ruhm gerettet. Doch gleichzeitig hatte ihn diese Erfahrung<br />
erschüttert, und er versuchte, sich fortan aus den politischen Turbulenzen<br />
herauszuhalten und auf das Komponieren zu konzentrieren.<br />
Allerdings wäre die Schlussfolgerung, hierin den bedingungslosen Kniefall vor<br />
der Doktrin des “sozialistischen Realismus“ zu sehen, falsch. Schostakowitsch<br />
verlegte sich auf sublimere Formen des Widerstands, indem er etwa das
geforderte Pathos zwar lieferte, aber durch hohle Phrasen konterkarierte. In<br />
den großen Gattungen Symphonie, Streichquartett und Konzert, die in der<br />
Regel auf die semantische Präzisierung eines Textes verzichten und in der<br />
inhaltlichen Unbestimmtheit ihrer musikalischen Chiffren unterschiedliche<br />
Interpretationen zulassen, fand er einen geradezu idealen Schutzraum, um in<br />
den Zeiten des stalinistischen Regimes künstlerisch und auch ganz real zu<br />
überleben. In der barbarischen Motorik, die durch manche Werke<br />
Schostakowitschs fegt, hat man oft die Knochenmühle des Stalin-Terrors<br />
vermutet: Das Individuum wird von einer gnadenlosen Maschinerie<br />
aufgerieben und vernichtet.<br />
Im 2. Cello-Konzert bekommt die Polarität zwischen Subjekt und dem Bösen<br />
eine plastische Verkörperung und erreicht eine neue Qualität. Wurde in<br />
früheren Werken der Hauptkonflikt schon im ersten Satz ausgetragen,<br />
erscheint zunächst ein tragisches Largo gespannt-expressiven Charakters als<br />
retardierendes Moment.<br />
Die Demaskierung des Primitiven, der menschenfeindlichen Kräfte erfolgt erst<br />
im Allegretto unter Verwendung des Straßenliedes “Kupitje bubliki!“ (“Kauft<br />
Kringel!“) aus dem Odessa der 1920er Jahre. Es erscheint betont alltäglich,<br />
sogar platt überzeichnet, verwandelt sich in seinem Automatismus dann aber<br />
in eine schrecklich wirkende Kraft, die alles auf ihrem Weg zerstört.<br />
Die Einleitung zum Finale geriert sich als Kulminationszone, als Ergebnis der<br />
Steigerung im 2. Satz und zornigen Reaktion des Bewusstseins, ein Protest auf<br />
alles Antimenschliche. Doch das Ende erscheint tragisch. Nach Rückgriffen<br />
auf Material des Kopfsatzes endet das Konzert in einem düsteren Epilog.<br />
Ermattet klingt es auf einem einzigen Cello-Ton aus, vom Schlagwerk in<br />
leeren Quinten und Oktaven 16 Takte umspielt. Im letzten Moment behält das<br />
„Ich“ durch einen vielsagenden, trotzigen Akzent doch das letzte Wort. Das<br />
Aufbegehren einer von Selbstverlust bedrohten Persönlichkeit Dann wäre<br />
durch Standhaftigkeit das Subjekt schlussendlich zum versehrten, aber<br />
obsiegenden Helden geworden.
ALEXANDER BORODIN<br />
Sinfonie Nr. 2 h-Moll<br />
Entstehung: 1869 – 1876<br />
Uraufführung: 26. Februar (10. März) 1877<br />
St. Petersburg<br />
Der Heroismus in Borodins 2. Sinfonie stammt dagegen aus einer Epoche, die<br />
ihre Helden noch aus den Reihen kampferprobter Haudegen rekrutierte. Von<br />
Mussorgski als „slawische Eroica“ gepriesen, wurde sie früher zudem mit dem<br />
Beinamen „Heldensymphonie“ versehen, aber seit Helden durch den Wahnsinn<br />
zweier Weltkriege aus der Mode kamen, wird dieser Titel kaum mehr genannt.<br />
Dennoch ist es Borodin gelungen, einem verklärten Russlandmythos ein<br />
musikalisches Denkmal zu setzen. Er entwirft Visionen von altslawischen<br />
Kriegsszenen und Festivitäten, deren Bildhaftigkeit und Emotionalität man<br />
heute bestaunt und mit distanzierter Sympathie hört.<br />
Zu bedenken ist dabei, dass der Arzt und Chemieprofessor eigentlich kaum<br />
Zeit für die Muse hatte, auch wenn er munter auf Flöte, Klavier und Cello<br />
dilettierte. Man kann Mily Balakirews Hartnäckigkeit nachvollziehen, der es<br />
als völlig inakzeptabel empfand, ein solches Talent zu verschwenden und<br />
Borodin oftmals zu überzeugen versuchte, seine eigentliche Berufung in der<br />
Komposition und nicht in der Chemie zu sehen. Immerhin: Seine Beharrlichkeit<br />
zahlte sich aus und Balakirew gewann ab 1862 einen neuen Schüler, der trotz<br />
Berufstätigkeit noch en passant Harmonielehre- und Kompositionskenntnisse<br />
bei ihm vertiefte.<br />
Die äußeren Rahmenbedingungen blieben gleichwohl eher hemmend. Aus<br />
Rimskij-Korsakows Erinnerung lässt sich entnehmen, dass der<br />
Teilzeitkomponist auch dann, wenn ihn musikalische Fragen beschäftigten, in<br />
Gedanken zur Hälfte bei seinen Reagenzien war. „Hatte er seine Arbeit<br />
beendet, machten wir es uns in der Wohnung bequem und musizierten oder<br />
unterhielten uns über Musik. Mitten im Gespräch sprang er auf und rannte ins<br />
Laboratorium, um nachzuschauen, ob dort nicht etwas ausgebrannt oder<br />
übergekocht sei.“.<br />
Borodin war ein schwerer Fall für seine musikalischen Freunde. Bald gingen<br />
sie sogar dazu über, ihm statt Gesundheit lange Phasen der Bettlägerigkeit zu<br />
wünschen. Denn krankheitsbedingt befreit von Vorlesungen, Sitzungen,<br />
Prüfungen und Laborarbeiten, pflegte der ruhelose Gelehrte solche Tage für<br />
die Niederschrift von Noten statt chemischer Formeln zu nutzen. Nun war<br />
Borodin selten krank, weshalb kaum ein Werk zügig zu Ende gebracht wurde.<br />
Für seine Oper Fürst Igor benötigte er unglaubliche achtzehn Jahre, um sie<br />
dann als Torso zu hinterlassen.<br />
Zeitgleich entstand seine h-Moll Sinfonie wegen allzu robuster Gesundheit in<br />
der vergleichsweise kurzen Zeit von sieben Jahren. Es wurde sein größter<br />
Wurf. Der berühmte Kritiker und Musikschriftsteller Wladimir Stassow<br />
glaubte, in ihr „den Geiste eines alten russischen Epos“ zu entdecken. Von<br />
ihm sind angebliche Hauptzüge eines inoffiziellen “Programms“ überliefert.
„Borodin selbst erzählte mir mehrmals, dass er im Adagio die Figur des<br />
(legendären Sängers) Bajan darstellen wollte, im ersten Satz eine<br />
Versammlung russischer Helden und im Finale die Szene eines Gelages der<br />
Helden.“ Die musikalische Umsetzung des historisierenden Stoffes lässt sich<br />
ohne weiteres nachvollziehen, etwa im harfenbegleiteten Barden-Thema des<br />
langsamen Satzes. Nur hier bleibt Zeit zum Innehalten, auch wenn der sanfte<br />
Ton seines Beginns täuscht und sich der Satz zu einer Musik von aufgewühlterzählerischer<br />
Intensität entwickelt.<br />
Der Klangcharakter der Sinfonie ist insgesamt patriotisch gehalten und drückt<br />
die ernste Bewunderung der Kraft und spirituelle Integrität der Heroen aus<br />
alter Zeit aus, die Russland vor seinen damaligen Feinden bewahrte. Borodin<br />
hatte offensichtlich eine instinktive Affinität zu den legendären Figuren aus<br />
einer sagenhaften, längst versunkenen Epoche russischer Geschichte, die er<br />
in seiner Musik glaubhaft portraitierte.<br />
Matthias Schneider-Dominco