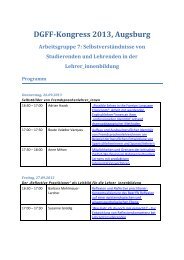Arbeitsgruppe 10
Arbeitsgruppe 10
Arbeitsgruppe 10
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sadoja, Kira: Herkunftssprachlicher Unterricht Russisch in<br />
NRW: Tendenzen und Perspektiven<br />
Mitte der 60er Jahre hat das Land Nordrhein-Westfalen den sog. muttersprachlichen<br />
Unterricht in mehreren Sprachen auf schulischer Ebene eingeführt, u.a. auch in Russisch. Das<br />
hatte ursprünglich zum Ziel, Kinder und Jugendliche aus ausländischen Familien<br />
(Gastarbeiter, Flüchtlinge etc.) auf die Rückkehr in das Heimatland vorzubereiten. Seitdem<br />
haben sich Ziele, Aufgaben und Inhalte dieses Unterrichts sowie die Zielgruppe selbst<br />
bedeutend verändert: Anstatt der Vorbereitung auf Reintegration steht heute der Erhalt der<br />
Mehrsprachigkeit im Vordergrund, das Unterrichtsangebot hat einen flächendeckenden<br />
systematischen Charakter (von Klasse 1 bis <strong>10</strong>) angenommen, anstelle von „Muttersprache“<br />
wird der Begriff „Herkunftssprache“ verwendet. Die sprachlichen Voraussetzungen für die<br />
Teilnahme bleiben jedoch weiterhin bestehen: das Vorhanden der familiär erworbenen<br />
herkunftssprachlichen Kompetenzen.<br />
Die Schüler, die heute am Herkunftssprachenunterricht (HSU) Russisch teilnehmen, gehören<br />
meistens zur zweiten oder dritten Generation der Auswanderer aus den Ländern der<br />
ehemaligen UdSSR, wachsen häufig schon von Geburt an zweisprachig auf und kommen<br />
zunehmend aus „gemischten“ Familien, in denen ein Elternteil nicht-russischsprachiger<br />
(überwiegend deutscher) Herkunft ist.<br />
Die Beobachtungen aus der Unterrichtspraxis zeigen, dass die Russischkenntnisse dieser<br />
Kinder sich sehr voneinander unterscheiden und unter dem Einfluss mehrerer Faktoren<br />
stehen, wie z.B. dem Bildungshintergrund der Familie, dem sozialen Umfeld des Kindes, der<br />
Intensität der bestehenden verwandtschaftlichen Beziehungen zu Russland, dem Einfluss der<br />
deutschen Sprache, der Dialekte des Herkunftslandes, dem Zeitpunkt des Beginns des<br />
systematischen Erlernens der russischen Sprache, der Inanspruchnahme des privaten<br />
Russisch-Unterrichtsangebotes im Elementar- und Primarbereich. Viele Faktoren spiegeln<br />
sich auch in der Motivation wieder Russisch weiter zu lernen und tragen zum<br />
kontinuierlichen und erfolgreichen Lernen bei. Die größten Sprachdefizite zeigen sich im<br />
lexikalischen Bereich (oft geringer, einseitiger und auf den täglichen Gebrauch beschränkter<br />
Wortschatz, wenig entwickelte Synonymie/ Antonymie, Entlehnungen und Übernahmen aus<br />
dem Deutschen). Viele Kinder haben Probleme phonetischer und prosodischer Art, die<br />
meisten morphologisch-syntaktischen Schwierigkeiten liegen im Bereich der Kongruenz und<br />
der Satzstellung.<br />
So trifft man im Unterricht immer seltener auf Kinder, deren sprachliches Kompetenzniveau<br />
im Russischen dem Sprachniveau gleichaltriger Kinder im Herkunftsland entspricht. Je<br />
peripherer der Unterrichtsort in der Kulturlandschaft der russischsprachigen Emigration<br />
liegt, desto gravierender sind die Niveauunterschiede. Das macht die Bildung homogener<br />
Gruppen nach Jahrgangsstufen in Anbetracht der in letzter Zeit ständig steigenden<br />
Neuanmeldungen immer problematischer und stellt die HSU-Lehrkräfte vor enorme