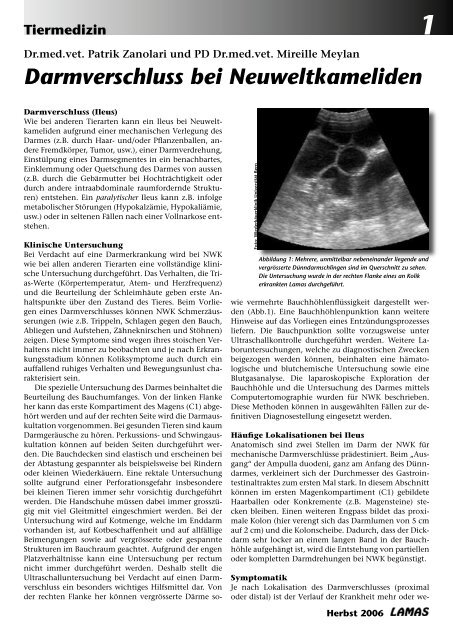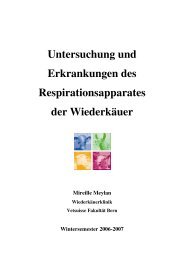Darmverschluss bei Neuweltkameliden - Universität Bern
Darmverschluss bei Neuweltkameliden - Universität Bern
Darmverschluss bei Neuweltkameliden - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tiermedizin<br />
Dr.med.vet. Patrik Zanolari und PD Dr.med.vet. Mireille Meylan<br />
<strong>Darmverschluss</strong> <strong>bei</strong> <strong>Neuweltkameliden</strong><br />
<strong>Darmverschluss</strong> (Ileus)<br />
Wie <strong>bei</strong> anderen Tierarten kann ein Ileus <strong>bei</strong> <strong>Neuweltkameliden</strong><br />
aufgrund einer mechanischen Verlegung des<br />
Darmes (z.B. durch Haar- und/oder Pfl anzenballen, andere<br />
Fremdkörper, Tumor, usw.), einer Darmverdrehung,<br />
Einstülpung eines Darmsegmentes in ein benachbartes,<br />
Einklemmung oder Quetschung des Darmes von aussen<br />
(z.B. durch die Gebärmutter <strong>bei</strong> Hochträchtigkeit oder<br />
durch andere intraabdominale raumfordernde Strukturen)<br />
entstehen. Ein paralytischer Ileus kann z.B. infolge<br />
metabolischer Störungen (Hypokalzämie, Hypokaliämie,<br />
usw.) oder in seltenen Fällen nach einer Vollnarkose entstehen.<br />
Klinische Untersuchung<br />
Bei Verdacht auf eine Darmerkrankung wird <strong>bei</strong> NWK<br />
wie <strong>bei</strong> allen anderen Tierarten eine vollständige klinische<br />
Untersuchung durchgeführt. Das Verhalten, die Trias-Werte<br />
(Körpertemperatur, Atem- und Herzfrequenz)<br />
und die Beurteilung der Schleimhäute geben erste Anhaltspunkte<br />
über den Zustand des Tieres. Beim Vorliegen<br />
eines <strong>Darmverschluss</strong>es können NWK Schmerzäusserungen<br />
(wie z.B. Trippeln, Schlagen gegen den Bauch,<br />
Abliegen und Aufstehen, Zähneknirschen und Stöhnen)<br />
zeigen. Diese Symptome sind wegen ihres stoischen Verhaltens<br />
nicht immer zu beobachten und je nach Erkrankungsstadium<br />
können Koliksymptome auch durch ein<br />
auffallend ruhiges Verhalten und Bewegungsunlust charakterisiert<br />
sein.<br />
Die spezielle Untersuchung des Darmes <strong>bei</strong>nhaltet die<br />
Beurteilung des Bauchumfanges. Von der linken Flanke<br />
her kann das erste Kompartiment des Magens (C1) abgehört<br />
werden und auf der rechten Seite wird die Darmauskultation<br />
vorgenommen. Bei gesunden Tieren sind kaum<br />
Darmgeräusche zu hören. Perkussions- und Schwingauskultation<br />
können auf <strong>bei</strong>den Seiten durchgeführt werden.<br />
Die Bauchdecken sind elastisch und erscheinen <strong>bei</strong><br />
der Abtastung gespannter als <strong>bei</strong>spielsweise <strong>bei</strong> Rindern<br />
oder kleinen Wiederkäuern. Eine rektale Untersuchung<br />
sollte aufgrund einer Perforationsgefahr insbesondere<br />
<strong>bei</strong> kleinen Tieren immer sehr vorsichtig durchgeführt<br />
werden. Die Handschuhe müssen da<strong>bei</strong> immer grosszügig<br />
mit viel Gleitmittel eingeschmiert werden. Bei der<br />
Untersuchung wird auf Kotmenge, welche im Enddarm<br />
vorhanden ist, auf Kotbeschaffenheit und auf allfällige<br />
Beimengungen sowie auf vergrösserte oder gespannte<br />
Strukturen im Bauchraum geachtet. Aufgrund der engen<br />
Platzverhältnisse kann eine Untersuchung per rectum<br />
nicht immer durchgeführt werden. Deshalb stellt die<br />
Ultraschalluntersuchung <strong>bei</strong> Verdacht auf einen <strong>Darmverschluss</strong><br />
ein besonders wichtiges Hilfsmittel dar. Von<br />
der rechten Flanke her können vergrösserte Därme so-<br />
Foto: Wiederkäuerklinik <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />
Herbst 2006<br />
1<br />
Abbildung 1: Mehrere, unmittelbar nebeneinander liegende und<br />
vergrösserte Dünndarmschlingen sind im Querschnitt zu sehen.<br />
Die Untersuchung wurde in der rechten Flanke eines an Kolik<br />
erkrankten Lamas durchgeführt.<br />
wie vermehrte Bauchhöhlenfl üssigkeit dargestellt werden<br />
(Abb.1). Eine Bauchhöhlenpunktion kann weitere<br />
Hinweise auf das Vorliegen eines Entzündungsprozesses<br />
liefern. Die Bauchpunktion sollte vorzugsweise unter<br />
Ultraschallkontrolle durchgeführt werden. Weitere Laboruntersuchungen,<br />
welche zu diagnostischen Zwecken<br />
<strong>bei</strong>gezogen werden können, <strong>bei</strong>nhalten eine hämatologische<br />
und blutchemische Untersuchung sowie eine<br />
Blutgasanalyse. Die laparoskopische Exploration der<br />
Bauchhöhle und die Untersuchung des Darmes mittels<br />
Computertomographie wurden für NWK beschrieben.<br />
Diese Methoden können in ausgewählten Fällen zur defi<br />
nitiven Diagnosestellung eingesetzt werden.<br />
Häufi ge Lokalisationen <strong>bei</strong> Ileus<br />
Anatomisch sind zwei Stellen im Darm der NWK für<br />
mechanische Darmverschlüsse prädestiniert. Beim „Ausgang“<br />
der Ampulla duodeni, ganz am Anfang des Dünndarmes,<br />
verkleinert sich der Durchmesser des Gastrointestinaltraktes<br />
zum ersten Mal stark. In diesem Abschnitt<br />
können im ersten Magenkompartiment (C1) gebildete<br />
Haarballen oder Konkremente (z.B. Magensteine) stecken<br />
bleiben. Einen weiteren Engpass bildet das proximale<br />
Kolon (hier verengt sich das Darmlumen von 5 cm<br />
auf 2 cm) und die Kolonscheibe. Dadurch, dass der Dickdarm<br />
sehr locker an einem langen Band in der Bauchhöhle<br />
aufgehängt ist, wird die Entstehung von partiellen<br />
oder kompletten Darmdrehungen <strong>bei</strong> NWK begünstigt.<br />
Symptomatik<br />
Je nach Lokalisation des <strong>Darmverschluss</strong>es (proximal<br />
oder distal) ist der Verlauf der Krankheit mehr oder we-
2<br />
niger akut. Krankheitszeichen zeigen sich in Abdominalschmerzen<br />
kombiniert mit Fressunlust, abnormalen<br />
Vitalparametern (wie z.B. erhöhte Herz- und Atemfrequenz)<br />
und Kotverhalten. Dies sind ernstzunehmende<br />
Symptome, die <strong>bei</strong> Lamas und Alpakas erst <strong>bei</strong> schweren<br />
Störungen manifest werden.<br />
Der Ultraschall bietet in der Beurteilung des Darmes<br />
eine grosse Hilfe. Die Darstellung vergrösserter Därme,<br />
welche allenfalls den ganzen Bauchraum auf der rechten<br />
Seite füllen und da<strong>bei</strong> eine typische kuboide Form annehmen,<br />
können auf einen <strong>Darmverschluss</strong> hindeuten.<br />
Liegt schon eine Bauchfellentzündung vor, ist mit einer<br />
erhöhten Menge an freier Flüssigkeit im Bauch, welche<br />
Beimengungen wie Fibrinfetzen enthalten kann, zu<br />
rechnen. Eine Punktion kann dann das Vorliegen einer<br />
Entzündung in der Bauchhöhle und/oder eines Risses eines<br />
Abdominalorganes bestätigten.<br />
Im roten Blutbild ist <strong>bei</strong> einem Ileus höchstens eine<br />
Hämokonzentration festzustellen. Im weissen Blutbild<br />
kann je nach Typ und Schweregrad der Krankheit einerseits<br />
<strong>bei</strong> „einfachem“ mechanischem Verschluss oder im<br />
Anfangsstadium z.B. einer Einstülpung des Darmes nur<br />
ein Stress-Blutbild vorliegen, andererseits, wenn eine<br />
Darmwandnekrose oder ein Darmwandriss mit nachfolgender<br />
Bauchfellentzündung einsetzt, kommen Anzeichen<br />
einer Entzündung und/oder Toxämie dazu.<br />
Bei Darmverschlüssen im proximalen Bereich sind<br />
die Veränderungen in der Blutchemie und der Blutgas-<br />
Herbst 2006<br />
Tiermedizin<br />
analyse gleich wie <strong>bei</strong> anderen Tierarten, einhergehend<br />
mit einer hypochlorämischen, hypokaliämischen metabolischen<br />
Alkalose. Bei Vorliegen eines entzündlichen<br />
Prozesses (wie z.B. einer Bauchfellentzündung) ist der<br />
Gesamtproteingehalt und die Fibrinogenkonzentration<br />
im Blut meistens erhöht. Weiter kann der Chloridgehalt<br />
im Mageninhalt, wie <strong>bei</strong> Kühen mit Labmagenerkrankungen<br />
oder Ileus im proximalen Dünndarm, infolge<br />
Rückfluss von Sekret aus dem „echten“ Magen (C3) erhöht<br />
sein. Darmverschlüsse im distalen Bereich zeigen<br />
meistens keine typischen Veränderungen im Blut oder<br />
im Magensaft.<br />
Differentialdiagnosen<br />
Einfache Obstipationen führen zu ähnlichen, wenn<br />
auch weniger ausgeprägten klinischen Symptomen verglichen<br />
mit einem vollständigen <strong>Darmverschluss</strong>. Sollte<br />
Kot im Rektum noch vorhanden sein, darf dies nicht als<br />
endgültiger Beweis gegen einen Ileus gebraucht werden.<br />
Bei einem kompletten Verschluss im proximalen Bereich<br />
kann immer noch Inhalt aus den weiter distal gelegenen<br />
Darmabschnitten über eine gewisse Zeit zum Rektum<br />
weitertransportiert werden. Der Kot kann trockener als<br />
normal und mit Schleim überzogen sein, da die Transitzeit<br />
verlängert ist.<br />
Koliksymptome, vergrösserter Bauchumfang und Anzeichen<br />
einer fortschreitenden Toxämie können auch<br />
<strong>bei</strong> Erkrankungen im Bereich des Harnapparates, insbesondere<br />
<strong>bei</strong> Harnsteinkrankheit, eventuell mit Riss der<br />
ableitenden Harnwege und nachfolgender Entstehung<br />
eines Uroperitonäums, beobachtet werden.<br />
Bei Stuten im letzten Trimester der Trächtigkeit muss<br />
immer an eine Störung im Zusammenhang mit der<br />
Trächtigkeit oder einer angehenden Geburt gedacht werden.<br />
Kurz nach einer Geburt können Verletzungen in<br />
den Geburtswegen (z.B. Uterusriss, Scheidenverletzungen)<br />
zu Symptomen führen, welche denjenigen eines<br />
<strong>Darmverschluss</strong>es sehr ähnlich sind.<br />
Schmerzsymptome und ein gespanntes Abdomen<br />
wurden <strong>bei</strong> Geschwürsbildung im Verdauungstrakt,<br />
insbesondere im dritten Magenkompartiment (C3) beschrieben.<br />
Solche Geschwüre führen zu recht unspezifischen<br />
Krankheitssymptomen und sind kaum eindeutig<br />
als Hauptkrankheitsursache zu diagnostizieren (jedenfalls<br />
solange die Geschwüre nicht durchgebrochen sind<br />
und zu einer Bauchfellentzündung geführt haben).<br />
Schwere Darmentzündungen können ebenfalls Koliksymptome<br />
und Tenesmus (Kotdrang) hervorrufen.<br />
Therapie<br />
Die grosse Herausforderung <strong>bei</strong> der klinischen Beurteilung<br />
von NWK mit Koliksymptomen ist die Entscheidung,<br />
ob eine medikamentelle Therapie zum Erfolg<br />
führen wird oder ob ein chirurgischer Eingriff dazu erforderlich<br />
ist. Bauchhöhlenoperationen setzen dann in<br />
den allermeisten Fällen eine Vollnarkose voraus, was für<br />
das Tier eine grosse Belastung darstellt.
Tiermedizin<br />
Werden NWK mit starken Schmerzen oder in einem<br />
fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung vorgestellt,<br />
muss in der Regel schnell gehandelt werden. Eine retrospektive<br />
Studie <strong>bei</strong> NWK, die wegen akuten Verdauungsstörungen<br />
in eine Klinik in den USA überwiesen worden<br />
sind, konnte nur eine enttäuschend tiefe Überlebensrate<br />
von 40.7 % (11 von 27 Tieren) verzeichnet werden. Die<br />
Autoren haben dies auf das meistens schon sehr weit<br />
fortgeschrittene Krankheitsstadium zurückgeführt. Folglich<br />
empfehlen sie, <strong>bei</strong> ernsthaftem Verdacht auf Ileus<br />
möglichst rasch zur Operation zu schreiten. Verschiedene<br />
publizierte Fallberichte bestätigen, dass die Diagnose<br />
eines <strong>Darmverschluss</strong>es oft erst spät im Krankheitsverlauf<br />
gestellt werden kann. Somit wird die Prognose negativ<br />
beeinflusst, wenn der chirurgische Eingriff (zu) spät<br />
erfolgt.<br />
In manchen Fällen kann eine medikamentelle Therapie<br />
mit Infusionen, krampflösende Substanzen/Schmerzmitteln<br />
und milden Abführmitteln eingeleitet werden.<br />
Liegen aber starke und/oder therapieresistente Abdominalschmerzen,<br />
vollständiges Kotverhalten, positive Rektal-<br />
und/oder Ultraschallbefunde vor und deuten Bauchhöhlenpunktat<br />
auf eine angehende Entzündung sowie<br />
die Laborbefunde auf einen <strong>Darmverschluss</strong> hin, wird<br />
dringend eine Probelaparotomie empfohlen.<br />
Prognose<br />
Die Prognose richtet sich nach Art der Läsion sowie<br />
Stadium und Schweregrad der Erkrankung. Wie weiter<br />
oben bereits erwähnt, ist die Prognose massgebend von<br />
der Dauer der Erkrankung abhängig. Bei NWK wird sie<br />
massgeblich von der Tatsache negativ beeinflusst, dass<br />
die Symptome wegen der stoischen Natur der Tiere häufig<br />
erst spät im Krankheitsverlauf erkannt werden.<br />
Korrespondenz:<br />
Wiederkäuerklinik, Vetsuisse Fakultät <strong>Bern</strong><br />
Bremgartenstr. 109a, PF 8466, CH-3001 <strong>Bern</strong><br />
patrik.zanolari@knp.unibe.ch<br />
www.wiederkaeuerklinik.ch<br />
Literaturangaben:<br />
Krammer’s Llamas<br />
• spezialisiert auf Llamazucht<br />
• über 120 Tiere<br />
• Deckpool mit Garantie<br />
• Verkauf von Edeltieren<br />
• Europas größter Lama-Zuchtbetrieb<br />
www.lamagestuet.at +43 (0)650/36 00 581<br />
Anderson D.E., Gaughan E.M., Baird A.N., Lin H.C., Pugh<br />
D.G. (1996): „Laparoscopic surgical approach and anatomy<br />
of the abdomen in llamas“. J. Am. Vet. Med. Assoc. 208 (1):<br />
111–116.<br />
Bedford S.J., Hawes M., Paradis M.R., Mort J.D., Hinrichs K.<br />
(1996): „Peritonitis associated with passage of the placenta<br />
into the abdominal cavity in a llama“. J. Am. Vet. Med. Assoc.<br />
209 (11): 194–195.<br />
Bickers R.J., Templer A., Cebra C.K., Kaneps A.J. (2000): „Diagnosis<br />
and treatment of torsion of the spiral colon in an alpaca“.<br />
J. Am. Vet. Med. Assoc. 216 (3): 380–382.<br />
Boileau M.J., Streeter R.N., Step D.L., Washburn K.E. (2003):<br />
„Colocolic intussusception in a 12-year-old llama“. J. Vet. Intern.<br />
Med. 17: 937–939.<br />
Cebra C.K., Cebra M.L., Garry F.B., Larsen R.S., Baxter G.M.<br />
(1998): „Acute gastrointestinal disease in 27 New World Camelids:<br />
Clinical and surgical findings“. Vet. Surg. 27: 112–<br />
121.<br />
Cebra C.K., Watrous B.J., Cebra M.L. (2002): „Transabdominal<br />
ultrasonographic appearance of the gastrointestinal viscera<br />
of healthy llamas and alpacas“. Vet. Radiol. Ultrasound. 43<br />
(4): 359–366.<br />
Costarella C.E., Anderson D.E. (1999): Ileocecocolic intussuception<br />
in a one-month-old llama“. J. Am. Vet. Med. Assoc. 214<br />
(11): 1672–1673.<br />
Fowler M.E. (1998): „Digestive System“, In „Medicine and<br />
Surgery of South American Camelids“, 2d edition, Iowa State<br />
University Press: pp. 305–359.<br />
Larsen R.S., Cebra C.K. (1999): „What is your diagnosis?“. J.<br />
Am. Vet. Med. Assoc. 214 (2): 919–192.<br />
Steffen S., Grunert E. (1995): „Mastdarmperforation <strong>bei</strong> einer<br />
Lamastute infolge einer Trächtigkeitsuntersuchung (tierärztliches<br />
Gutachten)“. Dtsch. Tierärztl. Wschr. 102: 330–331.<br />
Sullivan E.K., Callan R.J., Holt T.N., Van Metre D.C. (2005):<br />
„Trichobezoar duodenal obstruction in New World Camelids“.<br />
Vet. Surg. 34: 524–529.<br />
Turner A.S. (1989): „Surgical conditions in the llama“. Vet.<br />
Clin. North Am., Food Anim. Pract. 5 (1): 81–99.<br />
Van Hoogmoed L., Roberts G., Snyder J.R., Yarbrough T., Harmon<br />
F. (1998): „Use of computed tomography to evaluate<br />
the intestinal tract of adult llamas“. Vet. Radiol. Ultrasound. 39<br />
(2): 117–122.<br />
Herbst 2006<br />
3