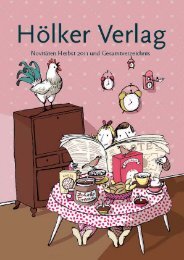HOLLY-JANE RAHLENS
HOLLY-JANE RAHLENS
HOLLY-JANE RAHLENS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>HOLLY</strong>-<strong>JANE</strong> <strong>RAHLENS</strong><br />
Wie man richtig küsst<br />
Aus dem Amerikanischen von Sabine Ludwig
Prolog<br />
AN JENEM NACHMITTAG, als ich meine Mutter mit Sammy Rosetti im Bett erwischte,<br />
wusste ich: Es kann nur noch schlimmer werden. Wie konnte sie es wagen? Woher<br />
nahm sie das Recht? Da lag sie, ausgestreckt auf dem Hotelbett, die Bettdecke<br />
zerwühlt, die Schuhe weggeschleudert, die Beine nackt, das Haar aufgelöst. Ich war<br />
entsetzt!<br />
Im ersten Moment kam ich gar nicht auf die Idee, dass sie da im Bett mit<br />
Sammy war. Wieso auch? Sammy gehörte mir.<br />
Ich machte noch ein, zwei Schritte. Jetzt würde meine Mutter mich sicher gleich<br />
bemerken. Aber sie war wie in einer anderen Welt, atmete schwer und hielt das<br />
Objekt der Begierde fest umklammert. Fassungslos beobachtete ich, wie die rechte<br />
Hand meiner Mutter für einen Augenblick von Sammy abließ, dann gierig wieder<br />
zugriff und ... umblätterte.<br />
Ich weiß noch, wie ich dachte: Was liest die denn da? Was für ein Buch ist so<br />
fesselnd, dass sie mich noch nicht mal reinkommen hört?, als mir die<br />
aufgeschlagene Seite ins Auge stach. Leuchtblaue Markierungen und<br />
neonpinkfarbene Wellenlinien am Rand. Markierungen, die ich nur zu gut kannte: Sie<br />
stammten von mir. Meine Mutter las mein Buch. Wie man richtig küsst von Samantha<br />
T. Rosetti. Sammy. Mein Sex-Ratgeber!<br />
Ich wusste sogar, auf welcher Seite sie war: 53. Im Kapitel So wird ein Strip erst<br />
richtig hip! Den markierten Absatz kannte ich praktisch auswendig. Wenn ihr beide<br />
Lust habt, aber euch noch nicht so ganz entspannt fühlt, dann versucht es doch<br />
einmal im Dunkeln. Den Zusatztipp dazu hatte ich eingekreist und mit einem<br />
Ausrufezeichen versehen: Solltet ihr einen von diesen niedlichen Leuchtkulis haben,<br />
könnt ihr ihn abwechselnd auf klitzekleinen Zonen des Partners aufleuchten lassen –<br />
hier ein Bauchnabel, da ein großer Zeh, dort ein Ohrläppchen oder ein<br />
Ellbogen. Macht ein Spiel daraus. Das bricht das Eis. Und ist außerdem sehr sexy.<br />
Mein Magen krampfte sich zusammen. Mist! Jetzt wusste meine Mutter, warum<br />
ich mir gestern genau so einen Leuchtkuli gekauft hatte.<br />
Mir wurde heiß. Und dann kalt. Eine Sekunde lang war ich kurz davor, zu<br />
explodieren, vor Wut zu platzen, in der nächsten hatte ich das Gefühl aus lauter<br />
Scham zu einem Nichts zu schrumpfen.<br />
Meine Mutter hob ihren frisch gespitzten Stift und drehte sich zum Licht.<br />
Wahrscheinlich wollte sie etwas in ihr Notizbuch schreiben, das neben ihr lag. Und
da entdeckte sie mich, oder besser: mein verschwommenes Spiegelbild im Fenster.<br />
»Oh!«, schnappte sie nach Luft. »Du meine Güte! Hast du mich erschreckt, Renée!<br />
Ich hab dich gar nicht gehört!«<br />
Als wären meine Beine sprachgesteuert, machte ich einen verzweifelten Satz<br />
nach vorne und griff nach dem Buch. »Das ist meins!«<br />
zurück?«<br />
Meine Mutter setzte sich auf und zog ihren Rock über die Beine. »Schon wieder<br />
»Was machst du mit meinem Buch?«<br />
Meine Mutter hob die Hände und öffnete den Mund, als ob sie etwas sagen<br />
wollte, aber nichts kam heraus. Nun ja, was hätte sie auch sagen können? Sie war<br />
schuldig. Im Sinne der Anklage. Punkt.<br />
»Du schnüffelst also jetzt in meinem Koffer rum?«, sagte ich und wedelte bei<br />
jedem Wort dramatisch mit dem Buch.<br />
Der lange, fließende Seidenschal meiner Mutter glitt zu Boden und landete dort<br />
neben einem zerknüllten Müsliriegelpapier. Mit diesem Gesichtsausdruck, den ich<br />
nur zu gut kannte, ihrem Nun-lass-uns-doch-bitte-vernünftig-sein-und-uns-so-wie-<br />
erwachsene-Leute-benehmen-Gesichtsausdruck,-sah sie mich an. »Es war in<br />
deinem Wäschesack«, sagte sie ruhig und hob ihren Schal und das Müsliriegelpapier<br />
auf. »Du hast doch gesagt, dass deine Unterwäsche gewaschen werden soll.«<br />
Oh nein! Wie war das nur passiert? Wie konnte ich vergessen, dass ich das<br />
Buch in meinem Wäschesack versteckt hatte?<br />
»Ich hatte keine Ahnung, dass es da drin war«, fuhr meine Mutter fort. Dabei<br />
zog sie ihr Oberteil über die Hüften und strich es glatt. Es war weit geschnitten, wie<br />
alles, was sie in letzter Zeit trug. »Das Zimmermädchen hat es mit deiner<br />
Unterwäsche zum Waschen gegeben. Die Hausdame hat es zurückgebracht und ...«<br />
»... dich freundlich darum gebeten, es zu lesen!«<br />
Ich nahm meinen Rucksack ab und stopfte das Buch hinein. Nichts war vor<br />
dieser Frau sicher!<br />
Meine Mutter ging an den Schreibtisch, warf das Müsliriegelpapier in den<br />
Papierkorb, schlang sich den Seidenschal um den Hals und griff nach einer<br />
Haarspange, die neben dem Telefon lag. Dann zwirbelte sie ihren dicken Zopf am<br />
Hinterkopf zusammen und steckte ihn fest.<br />
Ehrlich gesagt, ich finde, sie sollte den Zopf abschneiden und sich einen<br />
ordentlichen Haarschnitt verpassen lassen. Und wenn sie schon dabei ist, dann sollte
sie auch gleich ihr Blond auffrischen und das Grau abdecken. Und sich ein paar<br />
anständige Klamotten kaufen. Ich meine, sie könnte doch wenigstens versuchen,<br />
zumindest ein bisschen cool auszusehen, oder ist das zu viel verlangt? Es erwartet ja<br />
keiner, dass sie cool ist.<br />
»Schwitzt du nicht?«, sagte meine Mutter und starrte auf meine Beine.<br />
Ich trug meine kniehohen, schwarzen Lederstiefel, die mit den Schnallen an der<br />
Seite, schwarze Netzstrümpfe mit einem Loch am rechten Knie und einem auf dem<br />
linken Oberschenkel, und meinen Schottenmini. Das Ablenkungsmanöver konnte sie<br />
sich sparen, ich antwortete nicht.<br />
»Es tut mir Leid, Liebes«, sprach sie weiter. »Bitte entschuldige. Du hast ja<br />
Recht. Ich hätte das Buch nicht öffnen sollen.« Sie ging zum Sofa und grinste mich<br />
an. Ich sah ein paar Müsliriegelkrümel zwischen ihren Vorderzähnen. »Aber ich finde<br />
den Titel einfach genial. Wie man richtig küsst. Sex-Ratschläge für Anfänger jeden<br />
Alters. Wie kann man da widerstehen? Es ist nie zu spät, etwas dazuzulernen.« Sie<br />
zwinkerte mir zu, als ob wir Verschworene wären, zum gleichen Team gehörten.<br />
Es ist nie zu spät, dazuzulernen. Kotz, würg.<br />
»Ich brauche deine Absolution nicht«, sagte ich.<br />
»Renée ...«, hob sie mit ruhiger Stimme an und ging am Sofa vorbei.<br />
»Ich weiß, wie ich heiße!«, langsam wurde ich laut. »Begreifst du nicht? Es ist<br />
mir egal, was du denkst. Schnurzegal! Scheißegal! Kackegal! Ich lese, was ich lesen<br />
will, ob du es gut findest oder nicht!«<br />
Meine Mutter seufzte tief, zog die Schultern hoch und ließ sie wieder sinken. Als<br />
laste das Gewicht der ganzen Welt auf ihnen. Dann machte sie einen Schritt auf mich<br />
zu, aber ich drehte mich weg. Im Spiegel sah ich, wie sie resigniert die Hände hob<br />
und sich dem Thermostat zuwandte. Sie drehte am Schalter herum.<br />
»Renée«, sagte sie schließlich, »du bist sauer. Das ist okay. Du darfst sauer<br />
sein.«<br />
Ich fuhr herum. »Oh, danke. Vielen herzlichen Dank, dass du mir<br />
freundlicherweise gestattest, sauer zu sein.«<br />
»Du klingst so wütend.«<br />
»Ich klinge nicht wütend, Mama, ich bin wütend!«<br />
Ich griff nach meinem Rucksack.<br />
»Setz dich bitte.« Meine Mutter ließ sich auf dem Sofa nieder. Es war ein<br />
hässliches Sofa, braun und fleckig. Sie klopfte auf das Kissen neben sich. »Komm.«
»Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich zu dir setze und mir anhöre, dass<br />
ich das Buch mit Absicht in meinem Wäschesack vergessen habe, damit du es<br />
findest? Das ist es doch, was du sagen willst, stimmt’s?«<br />
Statt einer Antwort fragte sie: »Hast du das Internetcafé gefunden?«<br />
»Mama!«<br />
»Ah, ich verstehe. Deswegen bist du so sauer.«<br />
»Hörst du mir eigentlich zu? Ich hab gesagt, ich bin sauer, weil ich mich über<br />
dich ärgere. Ich ertrage es nicht, wenn du in meinem Leben rumspionierst.«<br />
»Es tut mir Leid, dass das passiert ist, Renée. Ehrlich. Aber ich hab nicht<br />
rumspioniert. Ich habe nur ein rein berufliches Interesse an dem Werk einer<br />
populären Sexualwissenschaftlerin gezeigt. Das muss ich doch bei meinem Job.«<br />
»Damit entschuldigst du immer alles! ›Bei meinem Job.‹«<br />
Ihr Job! Grrr!<br />
Okay. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt: »Die Kleine da hat ein großes<br />
Autoritätsproblem.« Und wisst ihr was? Ihr habt Recht. Ich hab tatsächlich eins. Und<br />
glaubt mir, ihr hättet auch eins, wenn eure Mutter Dr. Edda Mommsen-Brody wäre,<br />
dem Rest der Welt bekannt als Dr. Mom, unangefochtene Autorität in Sachen<br />
Elternfragen. Nur weil sie sechs erfolgreiche Bücher über Erziehung geschrieben und<br />
alle vierzehn Tage eine Eltern-Kolumne in der Veronika veröffentlicht, glaubt diese<br />
Frau doch tatsächlich, seit der Erfindung der Wegwerfwindel wäre in Sachen<br />
Kinderaufzucht nichts Großartigeres passiert als sie. Und was das Schlimmste ist:<br />
Alle anderen denken genauso. Das reicht, um jede geistig normal entwickelte<br />
Zehntklässlerin in den Wahnsinn zu treiben, zurück ins Bett – oder aus einem<br />
Dreisternehotel. Ich wählte Letzteres.<br />
»Ich wünschte, du würdest ein anderes Ventil für deine Wut finden«, sagte<br />
meine Mutter.<br />
»Werd ich auch!«, sagte ich drohend, warf meinen Rucksack über die Schulter<br />
und ging zur Tür. »Ganz bestimmt! Wart’s nur ab!«<br />
Und so hab ich alles aufgeschrieben, die wahre Geschichte, und zwar meine<br />
Version, die von Renée Bella Brody, fünfzehn. Und dieses Buch, das verspreche ich<br />
euch, wird nicht in einem Wäschesack landen!
Erstes Kapitel<br />
In der Hölle der Hormone<br />
MEINE GESCHICHTE BEGINNT ein paar Wochen vor dem Tag, an dem ich meine Mutter<br />
in jenem schäbigen Mannheimer Hotelzimmer mit Sammy erwischte. Sie fing beim<br />
Schwimmtraining an. Und zwar an dem Nachmittag, als Philipp mich im<br />
Schwimmbecken packte, unter Wasser zog und küsste.<br />
Philipp sieht verdammt gut aus. Stil hat er auch noch. Aber er ist nicht einfach<br />
nur ein schöner Kleiderständer. Er ist einer der wenigen Jungs an der Schule, der<br />
echtes Charisma hat. Das steckt in der Chemie, glaub ich. Wenn ich zufällig in einen<br />
Raum geriete, in dem er mit hundert anderen Jungs stünde, würde ich auch mit<br />
verbundenen Augen automatisch auf ihn zusteuern – sogar rückwärts. Und auf<br />
Stöckelschuhen! So stark ist seine Ausstrahlung. Ein Supermagnet.<br />
Obwohl ich Philipp schon ewig kenne – seit ich denken kann, ist er an der Mark-<br />
Twain-Schule eine Klasse über mir –, hatte ich kaum etwas mit ihm zu tun. Bis<br />
letzten Herbst, da wurde er Mitglied in der Schwimm-AG.<br />
Nach einem üblen Skateboardunfall, der ihm eine tiefe Narbe auf dem linken<br />
Arm und eine zweite quer durch die rechte Augenbraue bescherte, tauschte er das<br />
Skateboard gegen das Sprungbrett ein. Ins Gespräch gekommen waren wir trotzdem<br />
noch nicht – bis zu dem Tag vor ein paar Wochen, kurz vor Ende des Schuljahres.<br />
Ich saß im Bus, auf dem Weg nach Hause, schaute aus dem Fenster und hing<br />
meinen Gedanken nach. Plötzlich spürte ich etwas, das größer war als ich, eine<br />
ungeheuere Anziehungskraft in der Luft, die mich zwang, meinen Kopf zu drehen.<br />
Und da war er. Als hätte er sich aus dem Nichts materialisiert, saß er an meiner Seite<br />
und lächelte. Mit diesen unglaublich blauen Augen. Ich holte tief Luft, als ob ich<br />
gerade in eine riesige Welle eintauchen wollte und nicht wusste, wie lange ich unter<br />
Wasser bleiben müsste. Es war aufregend. Und irgendwie auch ein bisschen<br />
beängstigend.<br />
»Du warst ja gar nicht bei den Churchill-Schwimmwettkämpfen«, sagte er.<br />
»Ging nicht«, antwortete ich. Was gelogen war: Es wäre sehr wohl gegangen.<br />
Ich hatte nicht gewollt. Ich hatte keine Lust auf Fritzi gehabt und die ist in der<br />
Churchill-Mannschaft.
Fritzi und ich waren mal befreundet. Meine Mutter erzählt gern, wir seien schon<br />
Freundinnen gewesen, als wir noch nicht mal auf der Welt waren, weil sie zusammen<br />
mit Fritzis Mutter den Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat. Auch danach waren<br />
unsere Mütter wie ein Team. Zwangsläufig verbrachten Fritzi und ich ebenfalls viel<br />
Zeit miteinander. Was wir ganz schön fanden. So richtig eng wurden wir jedoch erst<br />
als Teenager, als aus unserer Liebe zu Märchenprinzen eine Leidenschaft für Könige<br />
wurde, sprich: für die Kings of Prussia. Die größte Rockband aller Zeiten in<br />
Deutschland, Europa, sämtlichen anderen Kontinenten und dem Rest des<br />
Universums. Darüber waren wir uns einig. Strittig war nur, wer der bessere Musiker<br />
war: Leadsänger und Songwriter Gregor Rogatzki, alias The Great Gatzki (meine<br />
allererste Wahl), oder Komponist und Gitarrist Arno Noni Nissen (Fritzis Favorit).<br />
Also, obwohl wir in verschiedene Schulen gingen – Fritzi in die Churchill, die<br />
deutsch-britische Schule, und ich in die Twain, die deutsch-amerikanische –, wir<br />
waren gute Freundinnen. Vielleicht wären wir sogar beste Freundinnen geworden.<br />
Aber letzten Herbst war es dann plötzlich vorbei.<br />
»Du wärst bestimmt Erste geworden«, sagte Philipp. »Du bist schneller als<br />
jedes Churchill-Mädchen.«<br />
Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich schnell. Ich wusste aber nicht, dass er das je<br />
bemerkt hätte. Mein Magen schlug einen dreifachen Salto.<br />
Ich betrachtete Philipp genauer. Trotz seiner Narbe quer durch die Augenbraue<br />
– oder vielleicht gerade deswegen – war er das perfekte männliche Titelmodel.<br />
Hinreißend, aber nicht makellos. Sein Körper war kräftig, aber nicht von<br />
hochgetunten Muskeln verunstaltet, die sich bei der kleinsten Bewegung aufblähen.<br />
Trotzdem sahen seine Arme stark aus. Nur sein Haar war einen Tick zu kurz. Unser<br />
Schwimmtrainer, Herr Trockenbrodt, hatte Philipp zwei Wochen zuvor überredet, sich<br />
die blonden Dreadlocks abzuschneiden. Er sagte, er hätte sie lange genug geduldet,<br />
aber sie würden das Ergebnis der ganzen Mannschaft verschlechtern. Ich glaube,<br />
Herr Trockenbrodt hat damit übertrieben, aber Philipp zeigte außerordentlichen<br />
Teamgeist und ließ sich die Haare schon am nächsten Tag abschneiden.<br />
Nach Philipps Bemerkung über das Churchill-Wettschwimmen quatschten wir<br />
ein bisschen über unsere Ferienpläne. Ich erzählte von meiner geplanten New-York-<br />
Reise und er, dass er eine Sprachschule in Barcelona besuchen würde. An mehr<br />
erinnere ich mich nicht. Die dreifachen Saltos lenkten mich wahrscheinlich zu sehr<br />
ab. Oder ich war von Philipps Erscheinung so geblendet, dass ich mich nicht mehr an
jedes Detail erinnere. Er trug nämlich eine neonorangefarbene Weste – so eine, die<br />
sonst Bauarbeiter haben, oder Bergleute, oder Männer, die Bahngleise reparieren –,<br />
und diese Weste war so grell, dass vor meinen Augen Punkte tanzten.<br />
Eine Woche später geschah es dann also, beim Schwimmtraining. Ich war<br />
bereits seit mehr als fünfundvierzig Minuten im Wasser, hatte Bahn um Bahn<br />
zurückgelegt, Runde für Runde, Zug um Zug.<br />
Wenn ich schwimme, passiert etwas in mir. Nach ein paar Minuten bin ich<br />
plötzlich ganz woanders. Schwer zu sagen, wo, aber es ist ein Ort, an dem ich mich<br />
immer weiter vorwärts bewege, irgendwohin, wo alles von mir abfällt – Tageszeit,<br />
Kopfschmerzen, Sorgen – und ich Teil des Wassers werde, des Lichts, des mich<br />
umgebenden dumpfen Lärms.<br />
konnte.<br />
Ich liebe das. Und brauche es inzwischen auch. Mehr als ich mir je vorstellen<br />
Aber es ist anstrengend. Körperlich. Und geistig. Nach dem Schwimmen<br />
brauche ich immer ein paar Minuten, um wieder in der Erdatmosphäre anzukommen.<br />
An jenem Montag setzte ich mich neben die Leiter auf den Beckenrand, ganz in der<br />
Nähe des Springturms und ließ die Beine im Wasser baumeln. Das war die beste<br />
Methode, um wieder zu mir zu kommen. Und die beste Methode so zu tun, als würde<br />
ich meinen eigenen Gedanken nachhängen, während ich doch eigentlich Philipp bei<br />
seinen Sprüngen vom Dreimeterbrett beobachtete. Ich sah zu, wie er zuerst einen<br />
gestreckten Kopfsprung rückwärts machte, und dann einen Delfinsalto, beide Male<br />
stand er auf dem Sprungbrett rücklings zu mir und dem Becken. Ob er überhaupt<br />
wusste, dass ich ihn beobachtete? Beim dritten Sprung stand er mit dem Blick nach<br />
vorn. Himmel, sah der gut aus in seinen schwarzen Stretchshorts! Geschmeidig und<br />
selbstbewusst. Die meisten Jungs in der Schwimm-AG tragen knappe Badehosen,<br />
die aussehen wie Bikini-Unterteile. Thanks, but no thanks.<br />
Egal, nun stand Philipp also auf dem Sprungbrett, gerade wollte er springen –<br />
da drehte er seinen Kopf nach links und warf mir einen Blick zu. Wusch! – breitete<br />
sich eine Wärmewelle in meinem Körper aus, vom Bauch bis in die Brust. War ich<br />
froh, dass ich meinen schwarzen Badeanzug trug, und nicht den roten. Der<br />
Schwarze sitzt um den Busen einfach besser.<br />
Mit einem gestreckten Auerbach schoss Philipp ins Wasser, kam wieder hoch,<br />
kraulte zu der Leiter auf der anderen Beckenseite und stieg aus dem Wasser.
Als er zum vierten Mal oben stand, er lächelte mir vor dem Sprung zu. Jetzt<br />
breitete sich die Wärme bis hinunter in meine Füße aus, die noch im Wasser<br />
baumelten. Mittlerweile war mir so heiß, dass es mich nicht überrascht hätte, wenn<br />
meine Zehen das Wasser wie ein Tauchsieder zum Kochen gebracht hätten. Als<br />
Philipp dann mit einer halben Schraube sauber eintauchte, ging mir endlich auf, dass<br />
er diese Kunststücke vielleicht nur für mich vorführte. Und als ich die Kontur seines<br />
Körpers unter Wasser auf mich zugleiten sah, überlegte ich, ob er sich zu mir<br />
genauso hingezogen fühlte wie ich mich zu ihm.<br />
er.<br />
Einen knappen Meter vor mir tauchte er auf. »Du bist ja ganz trocken«, sagte<br />
»Na und?«, sagte ich, überrascht, dass ich trotz meiner Aufregung überhaupt<br />
ein Wort rausbrachte.<br />
Philipp spritzte mich nass.<br />
»Hör auf, du Scheusal!«, kreischte ich.<br />
Noch nie war ich so entzückt gewesen!<br />
Er kitzelte meine rechte Fußsohle. Ich hielt mich an der Leiter fest und<br />
versuchte ihn abzuwehren. Er kitzelte meinen linken Fuß, dann zog er daran. Ich gab<br />
auf und ließ mich ins Wasser plumpsen. Er packte mich an den Hüften und zog mich<br />
zu sich. Und ehe ich mich versah, hielt ich mich an seinen Schultern fest. Um das<br />
Gleichgewicht nicht zu verlieren, griff er nach der Leiter. Dabei fiel mir seine Narbe<br />
am Arm ins Auge. Noch nie war ich ihr – und ihm! – so nahe gekommen. Die Narbe<br />
war ein fünfzehn Zentimeter langer Striemen und noch ganz rosa.<br />
»Zweiunddreißig«, sagte er. »Es waren zweiunddreißig Kreuzstiche – falls du<br />
gerade zählst.«<br />
Ich machte große Augen. »Das hat bestimmt wehgetan.«<br />
»Hab ich nicht mitgekriegt. Die haben mich gedopt. Du hättest die Wunde<br />
sehen sollen, bevor sie genäht wurde. Mein Arm sah wie Hackfleisch aus. Kannst<br />
gern mal anfassen, wenn du willst.«<br />
Ich blickte ihn fragend an.<br />
»Nein wirklich, ist in Ordnung«, sagte er.<br />
Die Narbe unter meinen Fingerspitzen fühlte sich seltsam an. Das Gewebe<br />
zwischen den Stichen war gleichzeitig weich und fest, die Stiche selbst kleine<br />
erhabene Punkte. Wie Blindenschrift. Ich-habe-gelitten, konnte man auf der Haut<br />
lesen. Sehr sexy.
»Tut’s noch weh?«, fragte ich, während meine Finger wie hypnotisiert über die<br />
Narbe strichen, auf und ab, hin und her.<br />
»Uh-uuh«, machte er leise. Es klang fast wie ein tiefer Seufzer. Er hatte die<br />
Augen geschlossen.<br />
Philipps rechte Hand ließ von meiner Hüfte ab und suchte meine Hand. Einen<br />
Moment lang trieben wir so, losgelöst von der Zeit. Ein vor Nässe glänzender, braun<br />
gebrannter Arm lag auf seiner Schulter. Unsere ineinander verschlungenen Beine<br />
paddelten im Gleichtakt. Sein fester Körper presste sich gegen meinen, mein weicher<br />
gegen seinen. Dann verhakten sich unsere Finger und er zog mich hinab.<br />
Als wir untertauchten, ließen wir die zappelnden Körper der anderen weit über<br />
uns. Luftblasen. Gedämpfte Stimmen. Unsere Köpfe bohrten sich durch das<br />
dickflüssige türkisfarbene Wasser, tiefer, tiefer und immer tiefer bis auf den Grund<br />
des Beckens.<br />
Meine Ohren ploppten zu.<br />
Unsere Münder trafen aufeinander.<br />
Philipp legte die Hände auf meinen Busen. Hey – der ging aber ran! Aber es<br />
gab keinen Anlass zur Klage: Es fühlte sich einfach zu gut an.<br />
Und dann, bevor ich überhaupt diesen wahrhaft feuchten Kuss und das Gefühl<br />
seiner Finger, die durch den Badeanzug meine Brust betasteten, genießen konnte,<br />
schossen wir schon wieder an die Oberfläche.<br />
Nach Luft schnappend tauchten wir auf. Überall Gelächter. Schreie. Eine<br />
Schaumstoffwurfscheibe sauste an uns vorbei. Herr Trockenbrodt pfiff.<br />
»Ups!«, machte Philipps Kumpel Philip Eins, als wir – plop! – ganz in seiner<br />
Nähe auftauchten. Philip Eins (weil er nur ein P am Ende hat) und mein Philipp alias<br />
Philipp Zwei (zwei P am Ende) waren dicke Freunde.<br />
»Wo habt ihr denn gesteckt?«, fragte Philip Eins. »Eben wart ihr noch da und<br />
dann wart ihr weg.«<br />
Ha ha.<br />
Philip Eins johlte und schlug Philipp Zwei auf den Rücken. Der revanchierte<br />
sich, indem er den Kopf von Philip Eins untertauchte. Philip Eins wand sich aus der<br />
Umklammerung und schwamm fort.<br />
»Am Mittwoch gehen wir ins Kino. Um zu feiern«, sagte Philipp Zwei zu mir.<br />
»Feiern?«<br />
»Ferien.«
»Ach so.«<br />
Da kann man sehen, was Philipp bei mir anrichtete. Wie konnte ich nur<br />
vergessen, dass die Schule fast vorbei war? Früher bin ich ganz gern hingegangen,<br />
aber dieses Jahr war knochenhart. Gut, dass bald Ferien waren.<br />
»Kommste mit?«, fragte er.<br />
Ob ich mitkomme? Was für eine Frage! Hunderteins Prozent hoch zehn!<br />
»Vielleicht«, sagte ich.<br />
Mein Herz hüpfte von einem Tausendmeterbrett.<br />
Meine Ohren ploppten wieder auf.<br />
Ich hing an der Angel.<br />
Ein Date! Am Mittwoch! Mit Philipp! Meine Füße kamen gar nicht mehr auf dem<br />
Erdboden an, so schwebte ich vor mich dahin. Ich musste es jemandem erzählen.<br />
Aber wem? Vor acht Monaten hätte ich keine Sekunde zu Hause sein können, ohne<br />
mein Handy zu schnappen und Fritzi ein SMS zu schicken: Must c u! Und sie hätte<br />
mir sofort geantwortet: Give me 5! Dann wäre ich auf mein Skateboard gesprungen<br />
und die Clausewitzstraße Richtung Norden zur Giesebrechtstraße gerast. Und sie<br />
wäre vor ihrem Haus in der Niebuhrstraße auf ihr Skateboard gehüpft und Richtung<br />
Westen geflitzt. Ich sehe ihr langes blondes Haar förmlich vor mir. Genau fünf<br />
Minuten später hätten wir uns an dem Brunnen gegenüber vom Café Richter<br />
getroffen.<br />
Wenn wir noch Freundinnen wären, hätte es sich genauso abgespielt. Aber wir<br />
waren’s nicht mehr. Also musste Alina herhalten, meine augenblicklich beste<br />
Freundin.<br />
Alina war nicht sehr beeindruckt. Für sie war ein Flirt unter Wasser Kinderkram.<br />
Darüber war sie längst hinaus und schon beim Ernst – oder beim Spaß? – des<br />
Lebens angelangt. Schließlich ist sie seit sechs Monaten keine Jungfrau mehr.<br />
Bisher war Alina allerdings immer ziemlich geizig mit Auskünften in Sachen<br />
Sex, auch wenn ich sie richtig auszuquetschen versuchte. Doch die Chancen, dass<br />
ich selbst bald in die Geheimnisse des Frauseins eingeweiht würde, standen ja nicht<br />
schlecht, und so hoffte ich, sie würde endlich mit ein paar Fakten rausrücken.<br />
Alina stand vor dem Spiegel und übte eine Schrittkombination aus ihrem<br />
Modern-Dance-Kurs. Sie will mal Schauspielerin werden und hat bereits bei zwei
Musicalcastings in Berlin und Hamburg mitgemacht. Genommen wurde sie zwar<br />
nicht, aber sie gibt nicht auf. Und übt weiter.<br />
»Beschreib es mal«, sagte ich, während sie ihre Hüften zweimal nach rechts<br />
und zweimal nach links wippen ließ.<br />
»Was beschreiben?«, fragte Alina.<br />
»Es. Beschreib es.«<br />
»Oh«, sagte sie. Das klang so begeistert, als sollte sie Matheaufgaben machen.<br />
»Na ja ... es ist ... gut.«<br />
Während sie sprach, heftete sie die Augen auf den Spiegel, mich sah sie kaum<br />
an. Tatsächlich starrt sie ziemlich oft in den Spiegel, aber ich denke, wenn ich so<br />
aussehen würde wie sie, würde ich mich auch dauernd bewundern. Nicht, dass ich<br />
nicht gut aussehe. Ich glaube, ich bin ganz in Ordnung. Ziemlich groß, halblanges<br />
widerspenstiges dunkles Haar, dunkle Augen und helle Haut. Das Einzige an mir,<br />
das mir nicht gefällt, sind meine Lippen, die müssten voller sein. So wie die von<br />
Alina. Alina hat auch einen richtig schönen Busen: groß und frech nach oben. Meiner<br />
springt einem lange nicht so schnell ins Auge. Manchmal finde ich allerdings, dass<br />
Alina ein bisschen zu sehr mit ihrem Busen angibt, auch wenn der zusammen mit<br />
ihrem hennaroten Haar und den großen blauen Augen wirklich toll aussieht. Das<br />
Coolste an Alina ist aber das Piercing in ihrer linken Augenbraue – ein zwölf Gramm<br />
schwerer Silberring – und der Glitzerstecker in ihrem linken Nasenflügel.<br />
Seit einiger Zeit spielte ich ja auch mit dem Gedanken, mir ein paar Piercings<br />
machen zu lassen. Vielleicht sogar ein Tattoo. Ein kleines. Da, wo kaum einer es<br />
sieht. Auf dem Po zum Beispiel. Einen Schmetterling. Oder eine kleine Sonne.<br />
Vielleicht einen Halbmond. Ein englischer Cousin von Fritzi, der in einem Aquarium<br />
arbeitet, hat sich einen Piranha in den Oberarm ätzen lassen. Er sagt, es habe<br />
höllisch wehgetan, aber nicht so sehr wie echte Piranhabisse. Trotzdem wollte ich<br />
doch lieber erst mal mit den Piercings anfangen. Ich dachte an Stecker und/oder<br />
Ringe im Ohr. Ein Ring im Bauchnabel wäre auch nicht schlecht, nur bin ich absolut<br />
sicher, dass Herr Trockenbrodt davon nicht sehr begeistert wäre. Meine Mutter erst<br />
recht nicht. »Du hast genug Silber am Körper, um einen Tisch für sechs Leute zu<br />
decken«, würde sie sicher sagen. Und dann eine Kolumne darüber schreiben: Von<br />
der Silbergabel zum Silbernabel.<br />
»Okay, es ist also gut«, sagte ich zu Alina. »Aber wie gut?«<br />
»Na ja, es ist ... gut-gut.« Alina beugte ihre Knie zum Demi-Plié.
»Mehr«, sagte ich.<br />
»Mehr was?« Sie erhob sich auf die Zehenspitzen.<br />
Ihr müsst wissen: Alina war nicht immer die Hellste. Manchmal frage ich mich<br />
wirklich, was ich an ihr finde.<br />
»Mehr Beschreibung«, sagte ich.<br />
Alina streckte ihre Beine. »Ach so. Na ja, es ist ... sehr gut-gut.«<br />
»Äußerst präzise. Du solltest Schriftstellerin werden.«<br />
»Haha.«<br />
Sie drehte ihre Beine zum Grand-Plié, richtete sich mittendrin jedoch auf und<br />
warf mir einen ängstlichen Blick zu. »Sag mal, du quetschst mich doch nicht für deine<br />
Mutter aus, oder?«<br />
»Nee – diesmal schreib ich selbst«, nahm ich sie auf den Arm. »Für die<br />
Schülerzeitung. Sex in the City School. Aber natürlich ändere ich deinen Namen.«<br />
»Mich würden trotzdem alle erkennen. Ich meine, wie viele Schlampen, die<br />
auch noch gut aussehen, gibt’s schon an unserer Schule?«<br />
schreiben.<br />
Wir mussten so lachen, dass ich überlegte, die Geschichte wirklich zu<br />
»Wie auch immer«, sagte sie. »Ich wünschte nur, du hättest endlich Sex, statt<br />
immer nur drüber zu reden.«<br />
Sie hatte natürlich Recht. Learning by doing ist einfach unschlagbar.<br />
»Bingo«, sagte ich. »Aber vielleicht kauf ich mir trotzdem noch ein Buch – nur<br />
für den Notfall.«<br />
Alina dachte einen Moment nach, dann sagte sie: »Du meinst einen<br />
Ratgeber?«<br />
gut.«<br />
»Vielleicht.«<br />
»Also ... wenn du Hilfe brauchst ...«<br />
Ich lachte. »Danke, ich kann lesen.«<br />
»Aber ich kann dir sagen, ob die Beschreibungen stimmen.«<br />
»Klar«, sagte ich. »Du könntest sie für mich beurteilen. Gut. Gut-gut. Sehr gut-<br />
Sie drohte mir mit dem Finger. »Pass auf, Renée.«<br />
»Nein, ehrlich«, sagte ich. »Ich brauche keine Hilfe. Ob er gut ist oder nicht, das<br />
krieg ich schon selbst raus. Ich werde es fühlen, wenn ich drin lese.«<br />
»Fühlen?«
»Ja. Da unten.«<br />
Sie sah nach unten, dann wieder hoch. »Wo unten?«<br />
»Also wirklich«, sagte ich. »Wenn du nicht weißt, was da unten ist, solltest du<br />
dir vielleicht auch einen Ratgeber zulegen.«<br />
Wir bekamen noch einen Lachanfall. Tatsächlich lachte Alina so sehr, dass sie<br />
überlegte, ob nicht sie den Artikel für die Schülerzeitung schreiben sollte.<br />
Die Wahrheit ist: Als ich mit Alina sprach, hatte ich bereits einen Sexratgeber.<br />
Sammy. Ich wollte es ihr bloß nicht gleich sagen. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht<br />
weil ich damals dachte, sie muss ja nicht immer alles über mich wissen.<br />
Sammy hatte ich mir für meine Reise nach New York gekauft, wo so ein<br />
Ratgeber bestimmt nützlich sein würde. Hoffentlich! Ich zählte schon die Tage, die<br />
Stunden, die Minuten und die Sekunden bis zur Abreise. Als Philipp mich tief unten<br />
im Schwimmbecken küsste, trennten mich genau sechs Tage, vier Stunden und<br />
zwölf Minuten von Manhattan und der Freiheit. In Anbetracht meiner gerade<br />
aufblühenden Romanze hatte das natürlich auch was Tragisches. Nichtsdestotrotz<br />
war ich fest davon überzeugt, dass das wilde Leben in New York meine Sehnsucht<br />
nach Philipp bestimmt ein Weilchen ertragbar machen würde.<br />
In New York wollte ich meine Exbabysitterin Nelly besuchen. Vor zwei Jahren<br />
hatte sie ihren Abschluss an der Twain gemacht und ein Stipendium an der<br />
Columbia-Universität bekommen. Dort studiert sie jetzt Physik. In diesem Jahr wollte<br />
sie nicht wie sonst ihre Ferien in Berlin verbringen, sondern das Appartement ihres<br />
Onkels auf Manhattans Upper West Side hüten. Und dabei würde ich ihr helfen.<br />
Nelly war die große Schwester, die ich mir immer gewünscht hatte. Selbst als<br />
ich keinen Babysitter mehr brauchte, waren wir in Kontakt geblieben. Ein bisschen ist<br />
sie mein Vorbild – obwohl ich keinerlei Absicht habe, wie sie Kosmologin zu werden.<br />
Ich bin wirklich nicht gerade auf den Kopf gefallen, aber wenn Nelly von Roten<br />
Riesen und Blauer Spektralverschiebung redet, versuche ich das gar nicht erst zu<br />
begreifen, sondern genieße einfach nur den Klang der Worte.<br />
Was ich an Nelly so mag, ist, dass sie einen immer wieder zum Staunen bringt.<br />
Das war schon so, als ich klein war. Eines Abends zum Beispiel erzählte sie mir beim<br />
Zubettbringen, dass sie jetzt ihre Trigonometrie-Hausaufgaben machen würde. Ich<br />
hatte keine Ahnung, was Trigonometrie war, aber es klang nicht sehr aufregend, also<br />
ging ich freiwillig ins Bett.
Zwei Stunden später wurde ich wach und ging Nelly suchen. Ich fand sie mit<br />
Max, einem Jungen aus der Highschool, der Länge nach auf unserem Sofa.<br />
Mucksmäuschenstill sah ich eine Weile zu, wie die zwei Trigonometrie machten. Ich<br />
glaube, damals habe ich zum ersten Mal begriffen, dass es Sachen im Leben gibt,<br />
die einfach interessanter sind, als zu schlafen.<br />
Nelly in New York zu besuchen war meine Idee gewesen. Ulf Krauss, der<br />
Verleger meiner Mutter, wollte sie auf eine Lesereise schicken, aber sie hatte<br />
abgelehnt – »wegen Renée«, wie sie sagte.<br />
Also, die Sache stellte ich natürlich sofort klar!<br />
»Um mich mach dir keine Sorgen«, sagte ich zu ihr. »Es wird dir gut tun, mal<br />
rauszukommen.«<br />
»Mir gut tun?«<br />
»Ach Mama, bitte! Du weißt genau, was ich meine!«<br />
Erstaunlicherweise gab meine Mutter nicht nur für die Lesereise grünes Licht,<br />
sondern auch für meinen New-York-Besuch bei Nelly. (Vermutlich hatte sie Nelly nie<br />
auf unserem Sofa beim Trigonometriemachen erwischt.)<br />
Kaum hatte meine Mutter sich entschieden, nahmen ihre amerikanischen<br />
Freundinnen, Becky Bernstein und Nellys Mutter, Lucy Bloom-Edelmeister, sie zu<br />
einem Einkaufsbummel mit. Zur Lesereise wollten sie meine Mutter endlich von<br />
ihrem Waldorflehrerin-Look befreien, den sie in den letzten Monaten angenommen<br />
hatte. Lucy hat einen wahnsinnig guten Geschmack, und Becky, deren zweiter Name<br />
»Schnäppchen« lautet, weiß immer, wo’s die besten Klamotten zu den günstigsten<br />
Preisen gibt. Sie versuchten ihr Bestes, den Modesinn meiner Mutter wieder zu<br />
erwecken, aber leider ohne großen Erfolg. Immerhin schafften sie es, sie mir eine<br />
Zeit lang vom Hals zu halten – Luft!<br />
New York! Vier ganze Wochen lang würde ich das ewige Tap-Tap-Tappeti-Tap<br />
meiner Mutter auf den Computertasten nicht ertragen müssen. Ihre schlechte Laune,<br />
ihre wallenden Capes, ihre blumengemusterten Hosen und vor allem ihren<br />
zerschlissenen Frotteebademantel, den sie tagein, tagaus trug. Igitt. Vielleicht würde<br />
sie ja sogar so vernünftig sein, ihn in meiner Abwesenheit wegzuwerfen.<br />
»Was stört dich an meinem Bademantel?«, wollte meine Mutter wissen. »Beim<br />
Arbeiten will ich es bequem haben.«<br />
»Dann zieh einen Jogginganzug an oder so was«, sagte ich. »Ich meine, ich<br />
komme aus der Schule und du läufst immer noch im Bademantel rum. Ich kann
niemanden mit nach Hause bringen. Die denken doch, du wärst gerade erst<br />
aufgestanden.«<br />
»Vielleicht bin ich das ja auch«, sagte sie. Ihre Augen forderten mich zum<br />
Kampf heraus.<br />
»Aber muss das jeder wissen? Die Nachbarn? Der Briefträger? Meine<br />
Freunde? Das ist peinlich!«<br />
»Sei nicht albern«, sagte sie und riss einen Mandelmüsliriegel auf. »Und<br />
überhaupt, es ist mein Körper. Ich schlafe so lange wie nötig und ziehe an, was ich<br />
will. End of story.«<br />
Langsam wurde meine Mutter sauer. Gut, dachte ich mir, jetzt piesacke ich sie<br />
noch ein bisschen. Aber dann entdeckte ich dieses gewisse Glitzern in ihren Augen,<br />
diesen Das-könnte-eine-witzige-Glosse-abgeben-Blick. Ich sah schon, wie es in<br />
ihrem Gehirn tickte und sie sich im Geist Notizen machte. Das Frottee-Verbot war<br />
vielleicht schon der Titel für ihre nächste Kolumne. Jetzt reichte es mir. Bevor sie<br />
noch mehr aus mir quetschen konnte, lief ich aus der Küche. Ich meine, wer will sich<br />
schon die ganze Zeit Sorgen darüber machen, ob das, was man zufällig beim<br />
Abendessen sagt, zum Frühstück in der Zeitung steht? Oder?<br />
Okay, ich gebe es zu, es gab mal eine Zeit, da machte es mir nichts aus, dass<br />
meine Mutter über mich schrieb. Sicher, ein paar der Geschichten waren peinlich,<br />
aber ich war stolz darauf, im Mittelpunkt zu stehen. Doch wenn es jetzt etwas gab,<br />
was ich auf gar keinen Fall wollte, dann, dass Dr. Mom über mein Sexleben schrieb.<br />
Das würde mich umbringen! Tausendfach! Es ist schlimm genug, dass die ganze<br />
Welt weiß, wann ich meinen ersten Zahn verloren, meine Tage das erste Mal<br />
bekommen und meinen ersten Pickel ausgedrückt habe. Aber niemand wird je<br />
erfahren, wann ich es das erste Mal mache. Hun-dert-pro-zen-tig nicht!<br />
»Sei nicht albern, Renée«, sagte meine Mutter vor ein paar Wochen zu mir.<br />
»Warum sollte ich darüber schreiben? Glaubst du etwa, ich kenne meine Grenzen<br />
nicht? Das ist doch deine Privatangelegenheit.«<br />
»Aha. Und meine Pickel? Und meine Tage? Sind die etwa nicht privat? Warum<br />
muss jeder wissen, wann ich meinen Eisprung habe?«<br />
»Ich wusste nicht, dass dich das so stört.«<br />
»Tut es aber.«
»Na, dann werde ich vorsichtiger sein. Es tut mir Leid.« Doch dann konnte sie<br />
kaum ein Lächeln unterdrücken und fügte hinzu: »Aber du musst zugeben: Die<br />
Geschichten waren gut.«<br />
»Kapierst du’s denn nicht?«, rief ich. »Das ist das Problem mit dir. Du denkst,<br />
irgendwas könnte eine Wahnsinnsstory abgeben, und plötzlich gehört es dir. Habt ihr<br />
Schriftsteller überhaupt keine Skrupel? Hab ich gar keine Rechte?«<br />
Wenn man eine skrupellose Mutter hat, muss man höllisch aufpassen. Zum<br />
Beispiel auf etwas wie Sammy. Ich konnte das Buch nicht einfach offen herumliegen<br />
lassen. Wenn doch, würde ich in der nächsten Veronika unter Garantie eine Kolumne<br />
mit dem Titel Rosetti berät Renée lesen. Um Sammy zu kaufen, ging ich sogar extra<br />
in eine anonyme Riesenbuchhandlung. Dort besteht weniger Gefahr,<br />
Aufmerksamkeit zu erregen, oder von einer der Buchhändlerinnen erkannt zu<br />
werden. Ich sag’s nicht gern, aber vor ein paar Jahren habe ich mich zusammen mit<br />
Dr. Mom fürs Cover von Die Mamaprotokolle fotografieren lassen. Und natürlich<br />
wurde genau dies Buch zum Bestseller. 247.652 Exemplare sind allein von der<br />
Hardcoverausgabe verkauft. Was bedeutet: ein Bild von mir auf dem Titel von<br />
247.652 Büchern! Und dann gibt’s noch die Taschenbuchausgabe. Und<br />
Übersetzungen in elf Sprachen – acht davon mit unserem Foto! Grrr!<br />
»Damals warst du elf«, sagte meine Mutter, als wir neulich darüber sprachen,<br />
»und jetzt bist du fünfzehn. Kein Mensch erkennt dich mehr.«<br />
»Buchhändlerinnen schon – die haben alle Adleraugen!«<br />
Kaum war ich von Alina-es-ist-sehr-gut-gut wieder zu Hause, nahm ich mir Wie man<br />
richtig küsst vor. Ich schlug das Buch auf und landete im Kapitel In der Hölle der<br />
Hormone.<br />
Jeder weiß, las ich, dass heranwachsende Jungs nur eins im Sinn haben. Vom<br />
Testosteron gebeutelt, denken, atmen und träumen sie nur von Sex. Und die<br />
Mädchen? Von ihren Hormonen, die verrückt vor Verlangen auf der Suche nach den<br />
Y-Chromosomen dieser Welt sind, hört man wenig. Was nicht bedeutet, dass<br />
Mädchen kein Sexualleben haben. Und mit ein wenig Glück wirst auch du deins<br />
entdecken – wenn du es nicht schon getan hast.<br />
Ich hatte!<br />
Natürlich wusste ich auch eine ganze Menge von den theoretischen Sachen,<br />
über die Sammy schreibt, von Hormonen und Empfängnisverhütung und wo was im
Körper steckt. Nicht umsonst habe ich zwei intensive Sexualkundekurse über mich<br />
ergehen lassen. Das erste Mal in der siebten Klasse, als wir in Bio so nützliche Dinge<br />
lernten wie ein Kondom auszupacken und es über eine Banane zu ziehen. Frau<br />
Grubmann, unsere Biologielehrerin, zeigte uns allerdings nie solche Bilder wie die,<br />
die es in Sammy gibt.<br />
Ich blätterte durch Wie man richtig küsst, bis ich zu den Abbildungen des<br />
männlichen Glieds kam. Zweiundzwanzig Illustrationen gab es da – ich zählte durch.<br />
Elf hängend, elf stehend. Aufmerksam studierte ich, wie einige in schlaffem Zustand<br />
nach rechts oder links baumelten, wie verschrumpelt sie aussahen. Im erigierten<br />
Zustand bogen sich einige nach oben, manche zeigten sogar nach unten, andere<br />
schossen wie Riesenchampignons nach vorn oder standen kerzengerade wie dicker<br />
Beelitzer Spargel.<br />
Ich legte das Buch wieder hin und versuchte mich daran zu erinnern, wie<br />
Timmy Haases Steifer ausgesehen hatte. Aber ich wusste es nicht mehr. Jedenfalls<br />
nicht so genau.<br />
Timmy war in meinem zweiten Sexualkundekurs. Dieser Kurs fand immer mal<br />
wieder auf dem Fußboden von Alinas Wohnzimmer statt. Wenn ihre Mutter ausging,<br />
durfte Alina Freunde (sprich: Jungs) einladen. Manchmal kam ich auch. Am Anfang<br />
schauten wir immer Videos und eine Stunde später lag ich knutschend mit meinem<br />
Typen auf dem Teppich, während Alina und ihr Typ – meistens Diego – sich in ihr<br />
Zimmer zurückzogen.<br />
Eines Abends machten Timmy und ich mal wieder so rum. Bevor ich wusste,<br />
wie mir geschah, hatte er mir seinen Steifen in die Hand bugsiert. Es war der erste,<br />
den ich jemals anfasste. Den von Mischa Hacker hab ich ein-, zweimal durch seine<br />
Unterhose angefasst. Okay, dreimal. Aber das hier war etwas anderes. Der war<br />
richtig in meiner Hand.<br />
Interessiert hielt ich ihn fest.<br />
Aber dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. Allgemein natürlich schon, aber<br />
nicht im Detail. Dazu hatte Frau Grubmann uns nichts beigebracht. Aus der Schule<br />
wusste ich alles über Kondome und Bananen, aber über einen lebendigen,<br />
pulsierenden Penis? In meiner Hand? Wie viel Druck sollte ich ausüben? Musste<br />
man das ganze Ding reiben oder nur eine bestimmte Stelle? Ich hatte eine<br />
Lieblingsstelle, vielleicht er auch?
Timmy merkte meine Unerfahrenheit jedoch nicht mal. Er kam fast sofort. Und<br />
dann wurde er innerhalb von Sekunden – die Geschwindigkeit war verblüffend –<br />
schlapp und weich. In meiner Hand! Klebrig vom Sperma erinnerte mich das an die<br />
großen Glibberquallen, in denen Fritzi und ich immer rumstocherten, wenn sie in<br />
Cornwall ans Ufer gespült wurden. Matschig und wabbelig.<br />
Nach dem Erlebnis mit Timmy beschloss ich, mir einen Sex-Ratgeber<br />
zuzulegen. Ich wollte, musste mich genauestens informieren.<br />
Ich klappte Sammy zu und legte mich auf mein Bett. Wie wohl Philipps Steifer<br />
aussah? Sich anfühlte? Vielleicht konnte er mich nach seinem Sprachkurs in<br />
Barcelona noch ein paar Tage in New York besuchen. Ich würde in der<br />
Internationalen Ankunftshalle des Kennedy Airport auf ihn warten, und ihn unter<br />
Tausenden an seiner neonorangefarbenen Weste erkennen. Dann würden wir den<br />
Flughafenbus in die Stadt nehmen. Den ganzen Weg nach Manhattan würden wir<br />
uns in die Augen schauen – aber uns nicht küssen. Nicht in der Öffentlichkeit. Nicht<br />
in einem Bus. Nicht in New York. Für so was sind die Amerikaner viel zu prüde.<br />
Ich verlagerte mein Gewicht und Sammy fiel zu Boden. Aber das nahm ich nur<br />
noch halb wahr. Ich legte den Kopf auf das Kissen und einen Finger auf meine<br />
Lieblingsstelle ...<br />
Sex in einem Tagtraum ist viel bequemer als das Rumgeknutsche bei Alina auf dem<br />
Fußboden. Vor allem wegen des kratzigen Wohnzimmerteppichs. Davon abgesehen<br />
macht mir Knutschen echt Spaß, auch wenn ich eins zugeben muss: In meiner<br />
Fantasie hat die Liebe noch mehr Zartheit, Raffinesse. Und Erotik. Im wirklichen<br />
Leben ist nicht immer alles so perfekt, wie man es gern hätte. Zum Beispiel habe ich<br />
jedes Mal Angst, dass Alinas Mutter plötzlich auftaucht. Das wäre so peinlich – ich<br />
würde sterben! Oder ich mach mir einen Kopf darum, meine Zunge beim Küssen zu<br />
viel (oder zu wenig) zu bewegen. Oder der Typ drückt mich oder tut mir sonst weh,<br />
wie bei dem einen Mal mit Timmy. Sein mit Nieten gespickter Gürtel lag auf dem<br />
Boden. Als er es irgendwie schaffte, sich auf mich zu legen, kippte ich direkt darauf.<br />
Das fühlte sich an, als würde meine Wirbelsäule an zwanzig Stellen gleichzeitig<br />
durchbohrt. Oder wie damals bei der Geschichte mit Mischa Hacker und dem<br />
Kapuzen-Sweatshirt. Mischa wollte mir das Sweatshirt über den Kopf ziehen und<br />
meine Arme waren schon draußen. Aber dann schnürte er mir mit der Kapuzenkordel
fast die Luft ab. Wir versuchten den Knoten aufzukriegen, schafften es nicht und<br />
machten einfach so weiter, aber das Sweatshirt hing wie ein Lappen um meinen Hals<br />
und war ständig im Weg. Schließlich hörten wir auf: Irgendwie war uns die Lust<br />
vergangen. Zu Hause musste ich die Kordel mit einer Schere aufschneiden. Mist,<br />
dachte ich, warum war mir das vorhin nicht eingefallen? Aber wenn jemand an<br />
deinem Busen angedockt ist und man schon ganz kribbelig zwischen den Beinen ist,<br />
fällt das praktische Denken wohl flach.<br />
Was ich sagen will, ist: In meiner Fantasie sind meine Partner immer perfekt.<br />
Und ich auch. Ich bin irgendwie so selbstbewusst und ich bestimme die Spielregeln.<br />
Wenn mir etwas gefällt – zum Beispiel Flirten –, tue ich es. Mag ich etwas nicht –<br />
zum Beispiel in die Duftwolke einer muffeligen Achselhöhle zu geraten –, findet es<br />
nicht statt. Regie, Schnitt, Kostüme und Ausstattung: Alles habe ich in der Hand. Ich<br />
bin der Star und – natürlich – die Drehbuchautorin. In einer Situation, in der der Sex<br />
absolut toll ist und eigentlich nicht besser werden kann, ich es aber trotzdem noch<br />
toller haben will, führt Drehbuchautorin Renée einfach einen neuen Darsteller ein,<br />
zum Beispiel DJ Joey McDee aus Brooklyn, New York. Er hat lange, rastlose Finger,<br />
die buchstäblich über sein Mischpult tanzen. Er trägt ein schwarzes ärmelloses T-<br />
Shirt, fünf winzige Silberringe in jedem Ohr und hautenge schwarze Lederhosen.<br />
Absolut cool gehe ich zu ihm hin, gebe ihm die nagelneue Kings-of-Prussia-CD und<br />
bitte ihn, das Stück Hugs and Küsse aufzulegen. Wie bei fast allen Kings-of-Prussia-<br />
Songs ist der englische Text durch ein paar deutsche Wörter aufgepeppt. Joey<br />
schaut erst die CD an, dann schaut er mich an. »Was bitte sind Küsse?«, fragt er.<br />
Und ich zeige es ihm. Mehrmals. Mit Zunge. Und er nimmt mich fest in die Arme –<br />
hugs kennt er natürlich schon.<br />
Ich versinke in Joeys grünen Augen. Augen wie Laserstrahlen, die meine<br />
Kleider wegbrennen, Schicht für Schicht. Zuerst meine Jacke, dann meine Bluse,<br />
dann meinen BH. Augen, die mich entkleiden wie sanfte Fingerspitzen ...<br />
Kein Wunder, dass ich so scharf auf New York war. Tausende von Männern<br />
warteten sehnsüchtig auf meine Ankunft. Aber davor hatte ich noch ein echtes,<br />
wirkliches Date mit Philipp. Zusammen mit Alina, Diego, Laura Rummler, Jakob<br />
Kohlmeier und Philip Eins wollten wir ins Kino gehen.<br />
Meiner Mutter erzählte ich natürlich nichts davon. Ich hatte mir angewöhnt,<br />
Verabredungen vor ihr zu verheimlichen. Ich erzählte ihr, dass ich mit Alina<br />
weggehen würde und dass es spät werden könnte. Wenn sie gewusst hätte! Was für
eine Kolumne hätte sie dann wieder geschrieben? Vielleicht: Liebe in den Zeiten von<br />
Caffè Latte.<br />
Nach dem Kino gingen wir ins Starbucks. Eingequetscht saß ich zwischen Philip Eins<br />
und Philipp Zwei. Uns gegenüber unterhielten sich Alina und Laura aufgeregt über<br />
das Konzert der Kings of Prussia Ende Juli. Das war wirklich der einzige<br />
Wermutstropfen an meiner New-York-Reise: Ich würde The Great Gatzki in der<br />
Waldbühne verpassen.<br />
»Wie können die nur mitten im Sommer ein Konzert geben, wenn kein Schwein<br />
in Berlin ist?«, sagte ich. »Das ist doch total beknackt.«<br />
»Also, ich bin da«, sagte Alina und zuckte mit den Schultern.<br />
»Zu blöd, dass sie die Concorde aus dem Verkehr gezogen haben«, sagte ich.<br />
»Sonst würde ich übers Wochenende herjetten. Aber das ist ...« Meine Stimme<br />
stockte. Unter dem Tisch rechts von mir presste Philipp Zwei seinen Schenkel gegen<br />
meinen. Und Philip Eins, der links von mir saß, tat das Gleiche. Ich glaube nicht,<br />
dass die anderen am Tisch etwas davon mitbekamen. Genauso wenig, wie Philip<br />
Eins bemerkte, was Philipp Zwei tat. Und umgekehrt. Egal: Ihre Ahnungslosigkeit<br />
machte die Sache für mich natürlich besonders prickelnd. Erst als ich merkte, wie ich<br />
rot wurde und immer heftiger atmen musste, wurde es mir etwas unheimlich. Würde<br />
nicht doch jemand merken, was da unter der Tischplatte abging? Vielleicht sollte ich<br />
lieber vorsichtig sein und den Spaß beenden? Doch dann, plötzlich, merkte ich, wie<br />
Philipp Zwei die Hand auf meinen Oberschenkel legte, unter meinem Rock. Warm<br />
war sie, diese Hand, schön fühlte sie sich an. Als ob sie dort hingehörte. Jetzt konnte<br />
und wollte ich das Vergnügen nicht beenden, rührte mich nicht, konnte mich nicht<br />
mehr bewegen. Ich wollte genau so sitzen bleiben, für immer und ewig,<br />
eingequetscht zwischen Philip Eins und Philipp Zwei, die warme Hand von Philipp<br />
Zwei auf meinem Schenkel und einen Caffè Latte vor mir.<br />
Aber dann spürte ich links die Hand von Philip Eins auf meinem anderen<br />
Schenkel. Nur war seine Hand kalt und rau. Philip Eins ist Mitglied in einem<br />
Ruderclub am Wannsee und seine Handflächen sind schwielig und voller Blasen.<br />
Unnötig zu sagen, dass die Hand von Philip Eins den Zauber brach. Ich<br />
verlagerte mein Gewicht. Mit einem Ruck setzten sich beide Philip(p)s wieder gerade<br />
hin.
sagte ich.<br />
Ich stand auf, griff meine Tasche und räusperte mich. »Bin gleich wieder da«,<br />
Alina sah mich an, sie hatte nichts bemerkt. Ich schon. Auf dem Weg zum<br />
Damenklo fühlte ich die Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen. War ich froh, dass<br />
sich bei Mädchen die Erregung nicht gleich so unübersehbar zeigt wie bei Jungs.<br />
Stellt euch mal vor, eure Brüste würden plötzlich steif, wenn ihr erregt seid. Würden<br />
verrückt spielen und zehn Zentimeter emporwachsen. Bei dem Gedanken musste ich<br />
kichern.<br />
Unterwäschedesigner müssten dann völlig neue, extrem dehnbare BHs<br />
entwerfen. Gipfelstürmer wäre ein witziger Name dafür. Ich musste plötzlich an Fritzi<br />
denken. Wenn sie mit mir im Café gewesen wäre, hätte sie bestimmt nicht nur<br />
mitgekriegt, was unter dem Tisch vor sich ging, sie wäre auch mit mir aufs Klo<br />
gegangen und hätte jedes Detail aus mir rausgequetscht. Und dann hätten wir<br />
Namen für die elastischen BHs erfunden. Erekta-Bra, Höhenflieger, Busenständer<br />
(Kurz: BS). Wir hätten uns halb totgelacht. Und wären sehr erleichtert gewesen, dass<br />
niemand mitbekam, vor allem keine Jungs, was in der Hölle der Hormone mit uns<br />
geschah.<br />
Als ich zu unserem Tisch zurückkehrte, war bereits alles im Aufbruch. Philipp musste<br />
gehen, weil er seine Großeltern auf dem Land besuchen wollte und deshalb früh<br />
aufstehen musste. Das war hart: So bald schon verließ er Berlin?<br />
»Wann kommst du wieder?«, fragte ich. Hoffentlich Freitag oder wenigstens<br />
Samstag.<br />
»Sonntagabend.«<br />
Eine Welle der Enttäuschung breitete sich in mir aus. Sonntagabend? Dann<br />
würde ich ihn erst nach New York wieder sehen – bis dahin war es eine Ewigkeit!<br />
Philipp muss meine Enttäuschung gespürt haben. Vielleicht stand sie auch in<br />
fetten Druckbuchstaben auf meiner Stirn. Auf jeden Fall sagte er: »Ich bring dich<br />
noch zum Bus.«<br />
Meine Laune besserte sich. Vielleicht würden wir uns ja zum Abschied küssen?<br />
Aber als wir aus dem Café kamen, sahen wir meinen Bus schon um die Ecke<br />
biegen und zur Haltestelle an der nächsten Kreuzung fahren. Philipp griff nach<br />
meiner Hand. Ich hätte alles dafür gegeben, den Bus zu verpassen, um mit ihm auf<br />
den nächsten warten zu können. Aber er flog mit mir durch die warme Berliner Nacht.
Keine Sekunde zu früh, atemlos, den ungeduldigen Blick des Busfahrers im Nacken,<br />
verabschiedeten wir uns. Philipps Kuss war ungeschickt, zungenlos, aber lang<br />
genug, um den Kaffee auf seinen Lippen zu schmecken.<br />
»Grüß New York von mir«, sagte er.<br />
»Ich mail dir«, sagte ich.<br />
Ich sauste zum Oberdeck. Als der Bus mit einem Ruck losfuhr, stürzte ich zum<br />
Fenster am Busende, um noch einmal Philipp sehen zu können. Aber durch die<br />
Spiegelung in den Scheiben konnte ich kaum etwas erkennen. Verzweifelt suchten<br />
meine Augen nach der orangefarbenen Weste, diesem einen von Billionen<br />
Farbflecken inmitten der leuchtenden Berliner Nacht.<br />
Aber Philipp war verschwunden.<br />
Ich spürte eine Hand auf der Schulter und drehte mich um.<br />
»Überraschung«, sagte Philipp und strahlte mich an.<br />
Ich bekam den Mund nicht zu, was praktisch war, da er mich dann küsste.<br />
Diesmal war es ein langer Kuss. Aber leider irgendwie schlabberig. Ziemlich<br />
enttäuschend. Philipps Zunge war überall, fuhr suchend in meinem Mund herum.<br />
Und seine Lippen saugten sich so fest an meine, dass es fast wehtat. Ich versuchte<br />
seine Zunge mit meiner zu bändigen, aber er kapierte nicht, was ich wollte. Und um<br />
ehrlich zu sein: Obwohl es mir schmeichelte, dass er mich küssen wollte, war mir<br />
schon vorher beim Kuss vor dem Busfahrer ein bisschen unwohl gewesen. Hier im<br />
Bus, vor all den Leuten, war es mir nun richtig peinlich.<br />
Vorsichtig löste ich mich von ihm. Hab ich was falsch gemacht?, fragten seine<br />
Augen. Er tat mir Leid. Schließlich war es nicht seine Schuld, dass ich so genaue<br />
Vorstellungen vom Küssen habe.<br />
»Deine Lippen schmecken gut«, sagte ich, um sein Selbstbewusstsein wieder<br />
aufzupäppeln. »Wie Caffè Latte.«<br />
Philipp lachte erleichtert. Und dann nahm er meine Hand. Und dann schauten<br />
wir uns an. Er sah so gut aus. Einfach umwerfend. Wen kümmerte es schon, dass<br />
seine Zunge noch ein bisschen untrainiert war?<br />
Am Adenauer Platz stiegen wir aus. Ich überlegte, ob er mich wohl noch einmal<br />
küssen würde, bevor er hinunter zur U-Bahn ging. Ich hätte nichts dagegen gehabt.<br />
Vielleicht klappte es ja diesmal besser.
standen.<br />
»Danke fürs Begleiten«, sagte ich, als wir vor dem Eingang zur U-Bahn<br />
»Ist doch klar«, sagte er.<br />
Unsere Augen saugten sich aneinander fest. Zwischen uns und einem neuen<br />
Kuss fehlten nur noch ein paar Zentimeter.<br />
»Habta mal ’n bisschen Kleingeld?«, lallte es da hinter uns.<br />
Es war ein Mann im Wintermantel. Mitten im Sommer. Sicher ein Obdachloser.<br />
Philipp hatte ein paar Cent in der Tasche. Er gab sie dem Mann. Der nickte und ging<br />
dann die Stufen zur U-Bahn hinunter. Sein ranziger Geruch hing noch in der Luft.<br />
Nicht sehr romantisch.<br />
»Also«, sagte Philipp und rümpfte die Nase, »wir sehen uns.«<br />
»Ich schreib dir«, versprach ich.<br />
Am nächsten Morgen beim Frühstück bemerkte ich, wie meine Mutter mich prüfend<br />
ansah. Ich wurde rot. Ahnte sie etwa, was am Abend zuvor passiert war? Mit Philipp?<br />
Wie auch immer, ich schwor mir hoch und heilig: Wenn die Zeit kommt und ich es tun<br />
würde, brauchte ich einen Sicherheitsabstand von mindestens fünfhundert<br />
Kilometern zwischen ihr und mir. Wenn nicht mehr!<br />
Das Klingeln des Telefons zerriss meine Gedanken.<br />
Meine Mutter ging in ihrem Arbeitszimmer ans Telefon. Ich schlürfte weiter<br />
meinen Tee, aber der Ton ihrer Stimme ließ mich aufhorchen. Sie schien besorgt.<br />
Offensichtlich war irgendetwas nicht in Ordnung. Ich stand auf. Mein Herz klopfte so<br />
schnell, dass es schneller an der Zimmertür war als ich.<br />
»Lucy, beruhige dich«, hörte ich sie sagen. »Ich bin sicher, alles wird gut ... Halt<br />
uns auf dem Laufenden.«<br />
Lucy? Nellys Mutter? Was mochte passiert sein? Vielleicht ja nichts. So tough<br />
Lucy auftrat: Passierte mal was, reagierte sie gerne leicht hysterisch.<br />
Meine Mutter legte auf und drehte sich zu mir. »Nelly hatte einen Unfall.«<br />
»Einen Unfall?«, stieß ich hervor und hielt mich an einem Regal fest.<br />
»Nein, nein. Es ist nichts Schlimmes, Liebling.« Meine Mutter legte mir<br />
beruhigend die Hand auf die Schulter und drückte sie. »Nelly ist in Ordnung. Es ist<br />
nur das Bein.«<br />
»Das Bein?«
»Sie hat sich das Bein gebrochen. Beim Fußballspielen. Sie liegt im<br />
Krankenhaus. In New York.«<br />
liegen?<br />
»Im Krankenhaus?« Nelly war unverwundbar. Wie konnte sie im Krankenhaus<br />
»Nur für ein, zwei Tage, Schatz«, sagte meine Mutter beruhigend. »Bis alles<br />
durchgecheckt ist. Aber sie glauben nicht, dass es irgendwelche Komplikationen<br />
gibt.«<br />
»Gott sei Dank«, sagte ich erleichtert.<br />
Wir setzten uns wieder an den Tisch. Ich nahm einen Schluck Tee. Meine<br />
Mutter nahm einen Schluck Kaffee. Ein paar Sekunden vergingen. Und dann –<br />
endlich – begriff ich. Ich sah meine Mutter an. Sie wich meinem Blick aus.<br />
»Und?«, fragte ich.<br />
»Nelly kann nicht zu ihrem Onkel. Es gibt dort keinen Fahrstuhl. Und ihr Zimmer<br />
im Studentenwohnheim ist schon belegt.«<br />
»Was bedeutet das im Klartext?«, fragte ich. Ich ahnte Schlimmes.<br />
Meine Mutter holte tief Luft. »Ich denke, das bedeutet«, sagte sie, die Stimme<br />
ganz leise, »dass deine Reise nach New York leider ausfällt.«<br />
Zweites Kapitel<br />
Nein!<br />
MEINE MUTTER IST eine große Befürworterin des Wortes ja. In ihrem ersten Buch Mein<br />
Leben im Kinderzimmer – dem Versuch, einen ernsthaften Erziehungsratgeber zu<br />
schreiben, bevor sie als Familienhumoristin berühmt wurde – heißt es: Warum sich<br />
ärgern über Kinderärger? Es ist doch angenehmer, wenn Ihr Sohn vor Freude<br />
Luftsprünge macht als vor Wut an die Decke springt. Eine warmherzige Umarmung<br />
macht bestimmt sowohl Ihnen als auch Ihrer kleinen Tochter mehr Spaß als ein<br />
hitziger Streit. Das heißt nicht, dass Sie Ihren Kindern alles erlauben sollen: Aber<br />
gehen Sie unnötigen Konfrontationen aus dem Weg. Wenn Sie nicht ›ja‹ sagen<br />
können, dann vermeiden Sie trotzdem ein definitives ›nein‹. Versuchen Sie das, was<br />
Sie wollen, positiv auszudrücken. Sie glauben vielleicht, ›nein‹ zu sagen sei leichter<br />
als lange Erklärungen. Aber in den meisten Fällen ist genau das der falsche Weg.
Danke, Dr. Mom. Dank dir hab ich jahrelang in der irrigen Annahme gelebt,<br />
dass ich immer alles bekomme, was ich will. Mann, war ich blöd!<br />
»Mama«, habe ich beispielsweise gesagt, »kann ich zu Laura gehen?«<br />
Auf so was hätten die meisten Mütter geantwortet: »Bist du taub? Ich hab dir<br />
doch gesagt, dass du keinen Schritt aus dem Haus machst, bevor die Schularbeiten<br />
nicht erledigt sind!«<br />
Meine Mutter war aber nicht wie andere Mütter. »Aber ja, natürlich, mein<br />
Schatz«, hat sie geantwortet. »Natürlich kannst du zu Laura. Sobald du mit den<br />
Hausaufgaben fertig bist.«<br />
»Ja? Ich darf? Super!«, jubelte ich, stürzte mich auf meine Hausaufgaben und<br />
latschte dann später brav zu meiner Freundin. »Mama«, bettelte ich im<br />
Spielzeugladen. »Kann ich das Puppenhaus da drüben haben? Bitte Mama! Bitte,<br />
bitte!«<br />
Die meisten Mütter hätten gesagt: »Nein, kommt nicht in Frage! Dieser Mist<br />
kostet über hundert Euro!«<br />
Aber meine Mutter pflegte in so einem Fall zu sagen: »Ein Puppenhaus? Na ja,<br />
ich werd’s mir überlegen.«<br />
Und ich wartete glücklich darauf, dass sie es sich überlegte, denn sie hatte ja<br />
nicht nein gesagt, oder?<br />
Aber schließlich kam ich hinter ihre Tricks. Und damit war die Erziehung nicht<br />
mehr ganz so einfach für Dr. Mom. Sorgenfalten erschienen auf ihrer Stirn und<br />
Steine bildeten sich in ihrer Galle. Schwarze Flecken tanzten vor ihren von Migräne<br />
geplagten Augen. Dennoch strengte sie sich an, das N-Wort nicht zu benutzen.<br />
Kompromiss war ihr neues Zauberwort. Auf den Schock, den ihr jüngstes,<br />
unqualifiziertes, unverhältnismäßiges, unerbittliches Nein bei mir auslöste, war ich<br />
deshalb nicht vorbereitet.<br />
»Nein, Renée! Nein! Auf gar keinen Fall! Nein!«, schleuderte sie mir entgegen.<br />
»Aber ...«<br />
»Eine Fünfzehnjährige? Allein in New York? Niemals! Wir sind hier in keinem<br />
Hollywoodfilm! Das ist das wirkliche Leben.«<br />
Wir waren in der Küche. Es war sechs Uhr abends, einige Stunden nach Lucys<br />
Anruf. Meine Mutter, immer noch im Bademantel, bereitete das Abendbrot vor.<br />
»Kannst du es dir nicht doch noch einmal überlegen?«, fragte ich.
Meine Mutter putzte grüne Bohnen. Sie legte das Messer auf den Tisch. »Da<br />
gibt es nichts zu überlegen. New York ist ein gefährliches Pflaster. Vor allem für<br />
Nicht-New-Yorker. Und erst recht für ein so junges Mädchen wie dich. Noch dazu<br />
Ausländerin. Keine Diskussion mehr.« Sie nahm ihr Messer, aber bevor sie mit den<br />
Bohnen weitermachte, setzte sie noch hinzu: »End of story.«<br />
Meine Mutter sagte ständig end of story. Das hatte sie von Lucy und Becky<br />
aufgeschnappt. Es klang so seltsam, wenn sie es sagte, und jetzt, in dieser Situation,<br />
brachte es mich richtig auf die Palme. Vielleicht waren wir wirklich am Ende<br />
angelangt. Und doch wollte ich mich nicht so leicht geschlagen geben. Ich stand da<br />
und überlegte meinen nächsten Schritt.<br />
Den ganzen Nachmittag hatte ich über andere Möglichkeiten nachgedacht.<br />
Viele waren es nicht. Plan A (Renée allein in New York) konnte nicht durchgeführt<br />
werden. Also musste Plan B in Kraft treten.<br />
Ich sah meine Mutter an. Bestimmt hatte sie noch einen Trumpf im Ärmel. Ich<br />
legte die Schalter um. All systems go!<br />
»Du hast wahrscheinlich wirklich Recht«, sagte ich, ging hinüber zur<br />
Besteckschublade und holte ein Messer heraus. »New York ist nicht der richtige Ort<br />
für mich. Allein.« Ich setzte mich an den Tisch und nahm eine grüne Bohne. »Es ist<br />
ja eine gefährliche Stadt.« Ich schnitt die Bohnenenden ab.<br />
»Danke für die Hilfe, Schatz«, sagte meine Mutter. »Aber die Antwort auf deine<br />
nächste Frage ist auch nein.«<br />
»Wovon sprichst du?«<br />
»Nein«, wiederholte sie mit etwas mehr Nachdruck.<br />
»Nein was?« Sie konnte unmöglich wissen, was ich vorhatte.<br />
»Nein, du kannst nicht allein zu Hause bleiben, während ich auf Lesereise<br />
gehe«, sagte sie.<br />
Okay, meine Mutter hat ihren Doktor ja nicht geschenkt bekommen, sie ist alles<br />
andere als blöd. Aber trotzdem: Konnte sie jetzt auch noch Gedanken lesen? Wusste<br />
sie, dass Philipp am Sonntagabend zurückkommen und erst am Donnerstag nach<br />
Spanien fahren würde? Es war schlimm, dass ich mir New York abschminken musste<br />
– aber vier Tage allein mit Philipp, während meine Mutter irgendwo in der Pampa<br />
war, wären eine echte Alternative gewesen.<br />
»Warum nicht?«, wollte ich wissen.<br />
»Da könnte ja was-weiß-ich passieren.«
Yep. Sie konnte Gedanken lesen.<br />
»Du hast kein Vertrauen zu mir!«, sagte ich.<br />
»Darum geht’s nicht!«<br />
»Worum denn?«<br />
Meine Mutter stand auf, ging zum Spülbecken und drehte den Wasserhahn an.<br />
Sie wusch die Bohnen im kalten Wasser und wandte mir den Rücken zu. Ihre<br />
Stimme war betont heiter.<br />
»Ich hab mit Fritzi und Gisela gesprochen. Beide würden sich sehr freuen,<br />
wenn du mit nach Cornwall kämst.«<br />
Ich wusste doch, dass sie mir mit irgendeinem Schwachsinn kommen würde.<br />
»Ich will aber nicht!«, schrie ich. »Wie konntest du sie anrufen, ohne mich zu<br />
fragen?«<br />
Meine Mutter sah mich an. »Fritzi vermisst dich, Schatz.«<br />
»Ist mir scheißegal!« Ich stand auf.<br />
»Du hast ihr Cottage doch immer so gemocht«, sagte meine Mutter leise.<br />
Ich ging aus der Küche. Ein Klumpen aus Tränen saß in meinem Hals. Ich<br />
versuchte ihn zu schlucken, aber er saß fest. Ich ließ mich aufs Bett fallen und<br />
vergrub den Kopf unter dem Kissen.<br />
Etwas später, als der Klumpen aus Tränen so klein geworden war, dass ich ihn<br />
endlich, ohne loszuheulen, schlucken konnte, legte ich die Kings of Prussia auf. So<br />
laut, dass meiner Mutter die Ohren wehtaten, aber mein Trommelfell nicht platzte.<br />
Die Kings of Prussia sind schlicht die beste Band der Welt, machen eine Mischung<br />
aus allem, was gut ist in der Musik: ein bisschen Punk, ein bisschen Ska, eine Prise<br />
Poesie, eine Scheibe Sozialkritik, etwas Swing, ja sogar Liebesballaden. Und jede<br />
Menge Gitarreneinsätze. Von allem nur das Beste. Glaubt mir, die Kings of Prussia<br />
sind nicht königlich – sie sind göttlich!<br />
Meine Mutter grillte auf der Terrasse Schweinekoteletts. Wahrscheinlich wollte sie<br />
mich wegen der verpfuschten Reise trösten. Sie weiß, wie sehr ich Grillkoteletts<br />
liebe, nur Wan-Tan-Suppe mag ich noch lieber. Auf Platz drei kommt Marzipan.<br />
»Ich habe mir überlegt, dass du in der Zeit bei Oma Ulli sein könntest«, begann<br />
meine Mutter, als wir uns zum Essen setzten. »Sie kann wegen Martha nicht<br />
herkommen, weil sie Martha nicht allein in Hannover lassen will.«
Oma Ulli hatte vor ein paar Monaten ihre gebrechliche alte Tante Martha bei<br />
sich aufgenommen, nachdem Martha, die allein lebte, schwer gestürzt war.<br />
»Da gibt’s doch keinen Platz für mich«, sagte ich zu meiner Mutter. Ich liebe<br />
meine Oma Ulli, aber der Gedanke daran, drei Wochen lang bei ihr auf der<br />
Wohnzimmercouch zu schlafen, behagte mir überhaupt nicht.<br />
»Das kommt alles so kurzfristig. Wir haben keine große Wahl«, sagte meine<br />
Mutter. Dann schwieg sie einen Moment und holte tief Luft. »Und was ist mit Alina<br />
und ihrer Mutter? Vielleicht kannst du mit ihnen in den Urlaub fahren.«<br />
»Alina?«, fragte ich ungläubig. »Alina?«<br />
Meine Mutter wusste wirklich nicht mehr weiter. Sie war alles andere als ein<br />
Alina-Fan. Wir hatten letztes Weihnachten sogar einen kleinen Streit wegen ihr. Es<br />
ging um Sex. Wir hatten auch vorher schon über Sex gesprochen. Immerhin ist Dr.<br />
Mom ja Ehrenpräsidentin im Club der Großartigsten Mütter der Welt, und wie jedes<br />
Mitglied dieses Clubs glaubt sie, die Erfindung der Aufklärung ginge ganz allein auf<br />
sie zurück. Doch es war das erste Mal, dass sie sich dabei über mich ärgerte. In<br />
einem schwachen Moment war ich so dumm gewesen und hatte meiner Mutter<br />
erzählt, dass Alina schon mit einem Jungen geschlafen hatte.<br />
»Und Alinas Mutter fand das total in Ordnung«, hatte ich erzählt. »Sie ist so<br />
cool, sie ist sogar mit Alina zum Arzt gegangen, um ihr die Pille verschreiben zu<br />
lassen.«<br />
»Das nennst du cool?«, sagte meine Mutter.<br />
Ich sah meine Mutter erstaunt an, sie war sonst nicht so schnell mit ihrem Urteil.<br />
»Alina ist erst vierzehn«, sagte sie. Sie fühlte sich verpflichtet, mir eine<br />
Erklärung zu geben. »Das ist einfach zu früh.«<br />
»Wer sagt das?«<br />
Die Augen meiner Mutter verengten sich.<br />
»Und wenn sie will?«, setzte ich noch eins drauf.<br />
Nun weiteten sich ihre Augen.<br />
Vielleicht war ich zu weit gegangen.<br />
»Renée, willst du mir damit zu verstehen geben, dass du es willst?«, fragte sie.<br />
Oh nein! Wieso hatte ich dieses Thema überhaupt angeschnitten? Am liebsten<br />
hätte ich mich in Luft aufgelöst. Auf der Stelle. Ich konnte mit ihr nicht über Sex<br />
reden. Mit Alina ja. Und mit Fritzi. Sogar mit Frau Grubmann. Aber nicht mit Dr. Mom!<br />
Ich sah schon die Überschrift ihrer Kolumne vor mir: ›Sex‹, sagte sie!
Fast wollte ich schon klein beigeben – um des lieben Friedens willen, und auch,<br />
um meine Privatsphäre zu schützen, da sagte sie: »Du hast erst etwas davon, wenn<br />
dein Kopf die Entwicklung deines Körpers eingeholt hat. In dem Gebiet kenne ich<br />
mich aus.«<br />
»Ach? Willst du damit sagen, dass du mit vierzehn Sex hattest, aber nichts<br />
davon gehabt hast?«<br />
Sie rollte mit den Augen. »Als ich vierzehn war, hatte ich Ideale. Ich habe meine<br />
Energie da reingesteckt, anderen zu helfen. Ich hab zum Beispiel ehrenamtlich als<br />
Schwesternhelferin gearbeitet.«<br />
»Wow«, sagte ich. »Ich wette, das hat bestimmt mehr Spaß gemacht als Sex.«<br />
Ich hatte das gar nicht komisch gemeint, aber meine Mutter fing an zu lachen.<br />
Sie hatte in letzter Zeit nicht viel gelacht, es hörte sich nett an. Und bevor ich es<br />
begriff, lachte auch ich.<br />
»Oh ja! Ich muss Alina unbedingt davon erzählen«, sagte ich, als wir uns wieder<br />
etwas beruhigt hatten. »Sie wird es bestimmt toll finden, als Schwesternhelferin die<br />
Kacke von fremden Pos abzuwischen.«<br />
Meine Mutter warf ein Sofakissen nach mir. »Du bist absolut respektlos! Raus<br />
mit dir!«, rief sie und hatte schon wieder einen Lachanfall.<br />
Ich grinste und machte meinen Abgang.<br />
Diesmal hatten wir die Kurve gekriegt. Aber wie würde es beim nächsten Mal<br />
sein? Seither haben wir jedenfalls nie wieder über Sex gesprochen. Und auch nicht<br />
mehr über Alina oder ihre Mutter. Umso überraschender, dass ich jetzt plötzlich mit<br />
den beiden in die Ferien fahren sollte.<br />
»Geht nicht«, sagte ich. »Alina verreist nicht mit ihrer Mutter, sondern mit ihrem<br />
Vater und seiner neuen Frau. Nach Sardinien. Ihr Vater möchte gerne, dass die<br />
beiden miteinander vertraut werden. »Ich glaube kaum, dass sie mich dabeihaben<br />
wollen«, sagte ich und nagte einen Kotelettknochen ab.<br />
Meine Mutter stöhnte laut. »Dann bleibt keine andere Wahl als ...«<br />
»Nein!«, rief ich. »Auf gar keinen Fall! Nein!«<br />
»Renée, es gibt keine Alternative. Um dich in einem Ferienlager oder zu einem<br />
Schüleraustausch anzumelden, ist es zu spät ...«<br />
»Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will einfach nicht!«<br />
»Dann fahr mit Fritzi nach England.«<br />
»Nein!«
Ich wollte meine Zeit nicht mit Fritzi und ihren Eltern verbringen. Ihre Sind-wir-<br />
nicht-eine-glückliche-Familie-Gesichter machten mich krank. Ich wollte auch nicht auf<br />
einer Couch im Wohnzimmer meiner Oma schlafen. Ich wollte nach New York. Oder<br />
allein in Berlin bleiben, mit Philipp. Musste ich jetzt wirklich mit meiner Mutter auf<br />
Lesereise gehen? Wie sollte ich das überleben? Wie sollte ich es überstehen, drei<br />
ganze Wochen mit Dr. Mom zusammengekettet zu sein?<br />
»Renée, sei doch mal ein bisschen offen. Lass dich doch überraschen«, sagte<br />
meine Mutter und nahm sich eine zweite Portion Bohnen. »Du kriegst was von der<br />
Welt zu sehen.«<br />
»Die Welt. Na toll. Schwedt an der Oder. Das war schon immer mein Traum.«<br />
»Okay, es sind auch ein paar Buchhandlungen in Kleinstädten dabei. Aber<br />
einige Großstädte sind auch dabei. Mannheim, Leipzig, München, Hamburg.«<br />
»Mannheim!«, sagte ich und rollte mit den Augen.<br />
»Und die Ostsee, Renée. Der Darß. Es wird dir gefallen. Und eine ganze<br />
Woche in den Alpen, auf Schloss Koppenbach.«<br />
Meine Mutter sprach oft von Schloss Koppenbach. Sie hatte mir mal einen<br />
Zeitungsartikel gezeigt. Ein alter Schulfreund von ihr aus Hannover, Niels Riethmann,<br />
ein intellektueller Typ mit Nickelbrille, hatte den ganzen Schlosskomplex von einem<br />
bayerischen Onkel geerbt. Innerhalb von zwei Jahren hatte er ihn in ein luxuriöses<br />
Wellnesshotel mit gehobenem Kulturprogramm verwandelt. Es gab klassische<br />
Konzerte, Jazzsessions und literarische Abende. Medizinische Koryphäen hielten<br />
Vorträge über die Heilkraft von Pflanzen.<br />
»Klingt echt aufregend«, sagte ich.<br />
Dann zog ich alle Register. Wenn ich zu Hause in Berlin bleiben dürfte,<br />
versprach ich, sie alle zwei Stunden anzurufen. Versprach, mein Handy immer<br />
angeschaltet zu lassen. Schwor, dass kein einziger Junge jemals auch nur den<br />
kleinen Zeh in die Wohnung setzen würde. (Ob ich das Versprechen halten konnte,<br />
wusste ich nicht, aber darüber konnte ich mir ja später einen Kopf machen.) Ich<br />
versprach, mir jeden Tag drei ausgewogene Mahlzeiten zuzubereiten, dreimal mit<br />
Obst und zweimal mit Gemüse dabei. Ich versprach sogar, ihr einen neuen<br />
Frotteebademantel zu schenken.<br />
Doch sie rollte nur mit den Augen und seufzte.<br />
Und dann, als das Essen vorbei war. Das allerschlimmste Horrorszenario.<br />
»Bitte!«, bettelte ich.
»Es reicht, Renée! Es reicht. Nein! End of story!«<br />
Meine Mutter massierte sich leidvoll die Stirn. Geschah ihr nur recht. Warum<br />
war sie so vernagelt? Und warum trug sie um acht Uhr abends immer noch diesen<br />
miefigen Bademantel?<br />
»Wir haben das alles x-mal durchgekaut!« Ungeduldig sprang meine Mutter<br />
vom Tisch auf und räumte die Gläser ab. Dabei schwappte ein Rest Wein auf ihren<br />
Bademantel.<br />
»Warum lässt du dir nichts sagen?«, sagte ich.<br />
Meine Mutter knallte die Gläser auf den Tresen und ich hörte einen Knacks. Sie<br />
drehte sich zu mir. »Ich soll mir etwas sagen lassen? Ich? Und was ist mit dir? Du<br />
bist fünfzehn! Wenn hier jemand etwas gesagt kriegt, dann du! Ich kann dich nicht<br />
allein in der Stadt lassen. Wenn etwas passiert, das würde ich mir nie verzeihen.«<br />
»Was soll schon passieren?«<br />
Sie fuhr herum, stürzte sich auf das Spülbecken und drehte das Wasser an. Mit<br />
einem angefeuchteten Lappen versuchte sie den Weinfleck aus dem Bademantel zu<br />
rubbeln. Dann kam sie wieder zum Tisch, griff sich einen Teller und ging zum<br />
Geschirrspüler.<br />
»Du behandelst mich wie ein Kind!«, schrie ich.<br />
Mit dem Teller in der Hand drehte sie sich wieder zu mir und schrie noch lauter<br />
zurück: »Weil du eins bist!«<br />
»Daddy hätte mir erlaubt, allein hier zu bleiben! Das weiß ich. Das weiß ich<br />
ganz genau!«<br />
Beim Wort Daddy brachen alle Dämme. Ich sprach es so gut wie nie aus. Und<br />
als ich hörte, wie dieses Daddy einfach so aus meinem Mund purzelte, ungebeten,<br />
dachte ich, ich würde zerspringen. Wie das Glas auf dem Tresen. »Warum bist nicht<br />
du gestorben?«, rief ich. »Warum musste er sterben? Warum er? Warum Daddy?«<br />
Meine Mutter erstarrte. Noch immer hielt sie den Teller in der Hand.<br />
Schweineknochen und Fettaugen schwammen in einer Lache rötlicher Soße.<br />
Obenauf lagen eine Gabel und ein Messer. Meine Mutter öffnete den Mund, aber<br />
nichts kam heraus.<br />
Und dann sah ich, dass sie Tränen in den Augen hatte.<br />
Angewidert, wütend, drehte ich mich um und stürmte aus der Küche. Hinter mir<br />
hörte ich, wie Messer und Gabel vom Teller rutschten. Scheppernd landeten sie auf<br />
dem Fliesenboden.
Am nächsten Morgen klopfte meine Mutter an meine Tür. Sie war ungeschminkt, trug<br />
nicht mal Lippenstift, ihr Haar hatte sie zum Zopf geflochten, ihre Augen waren<br />
verquollen. »Ich fahre nach Weißensee«, sagte sie gelassen. »Willst du mit?«<br />
»Nein, danke.«<br />
Sie nickte. Und ging.<br />
Ich setzte mir wieder die Kopfhörer auf. Die Kings of Prussia. Wenigstens<br />
konnte ich jetzt zu ihrem Konzert. Mein Trostpreis.<br />
Ich fahre nach Weißensee. Willst du mit? Das fragte sie mich immer. Und<br />
immer sagte ich nein.<br />
Ich fuhr nie mit nach Weißensee. Thanks, but no thanks – auf Friedhöfe kann<br />
ich gut verzichten. Nach der Andacht bin ich nicht hingegangen. Als der Grabstein<br />
aufgestellt wurde, nicht. Nicht, nachdem meine Mutter von den schönen roten,<br />
goldenen und gelben Blättern dort erzählte, nicht, als sie nach Hause kam und sagte,<br />
es sei dort so friedlich, und still, mit dem frisch gefallenen Schnee, und ganz sicher<br />
nicht, als sie sagte, alles dort grüne und blühe, eine schöne letzte Ruhestätte<br />
eigentlich. Nee nee. Ich war nie dort. Und ich werde nie hingehen. End of story.<br />
Drittes Kapitel<br />
Meine Familie, meine Geister<br />
DIE NORDDEUTSCHE TIEFEBENE flog vorbei. Flaches, graugrünes Land. Ein paar<br />
Bäume und ein vom Regen schmutziger Himmel. Ich machte ein Foto. Komisch: Das<br />
Bild im Display sah genauso aus wie das, was ich zehn Minuten vorher gemacht<br />
hatte. Weniger komisch: Das nächste Foto würde wahrscheinlich genauso aussehen.<br />
Trüb und öde.<br />
Ich gähnte, dann blickte ich den Gang hinunter zu dem Mann im weißen<br />
Leinenanzug, der ein paar Reihen entfernt von uns etwas in seinen Laptop tippte.<br />
Für mich war er viel zu alt, so gegen Ende dreißig, aber er sah sehr gut aus. Gleich<br />
als er in unseren Wagen stieg, war er mir aufgefallen: sein sommerlicher,<br />
zerknitterter weißer Leinenanzug, sein langer schwarzer Pferdeschwanz – The Great<br />
Gatzki hatte auch so einen. Manche Männer sind einfach mit Geschmack gesegnet.
Und mit einer guten Figur. Wie Philipp hatte der Mann im weißen Leinenanzug breite<br />
Schultern und schmale Hüften. Und er war auch ungefähr gleich groß, wobei Philipp<br />
wahrscheinlich noch größer würde.<br />
Der Mann im weißen Leinenanzug hatte meinen Blick wohl gespürt. Er hob den<br />
Kopf und unsere Augen trafen sich.<br />
Ich schaute weg.<br />
Meine Mutter schien heute etwas angespannt. Sie richtete sich auf und schaute<br />
mich über den Rand ihrer Brille an, dann las sie weiter in dem New Yorker, den ich in<br />
Berlin am Bahnhof gekauft hatte. Um sie daran zu erinnern, was sie mir angetan<br />
hatte.<br />
Ich ließ mich in meinen Sitz zurückfallen. Vor dem Fenster immer das Gleiche:<br />
platte, graugrüne Erde, Bäume und ein schmutziggrauer Himmel. Ich sah auf die Uhr.<br />
Genau jetzt war Philipp auf dem Weg nach Barcelona. Wir hatten uns noch nicht<br />
einmal verabschiedet. Jedenfalls nicht richtig.<br />
Ich nahm meinen Discman heraus und legte das dritte Album der Kings of<br />
Prussia, The Garden of Delight, auf.<br />
Ich versenkte mich in meinen Lesestoff: den Tour-Plan meiner Mutter, während<br />
The Great Gatzki Liebesballaden sang.<br />
Sitting by the Sonnenblumen<br />
I try with all my might<br />
To bring back our garden of delight.<br />
Oben auf der ersten Seite stand groß: Dr. Mom liest. Der Plan enthielt alle<br />
Termine: wo sie von wem abgeholt werden würde, die Adressen ihrer Hotels,<br />
Veranstaltungsorte mit Telefonnummern, Zugverbindungen, alternative Routen.<br />
Heute war Donnerstag, Tag fünf. Planmäßig waren wir unterwegs von<br />
Tangermünde nach Stadthagen. In Hannover wollten wir als Zwischenstopp eine<br />
ausgedehnte Mittagspause mit Oma Ulli einlegen und um acht Uhr abends hatte<br />
meine Mutter eine Lesung in ...<br />
Aha! Vielleicht war es das. Oma Ulli! Vielleicht war meine Mutter deshalb so<br />
angespannt.<br />
Meine Mutter spürte meinen Blick und sah auf.<br />
»Was ist?«, fragte sie.
»Du bist so nervös heute Morgen.«<br />
Sie zuckte mit den Schultern. »Lesereisen sind anstrengend.«<br />
Wem sagte sie das. Die vergangenen vier Tage waren wir die Provinz einmal<br />
rauf und runter getourt, hauptsächlich im Osten, kreuz und quer, von Süd nach Nord<br />
und von Nord nach Süd. Am Sonntag waren wir von Berlin nach Leipzig gefahren.<br />
Am Montag reisten wir dann wieder Richtung Norden nach Magdeburg. Am Dienstag<br />
nahmen wir den Zug und fuhren eine Stunde südwestlich nach Halberstadt. Gestern<br />
waren wir in Tangermünde. Die Reise war eine nicht enden wollende Folge von<br />
größeren und kleineren Städten, Hotels und Bahnhöfen. Gut, dass meine Mutter mir<br />
ihre Kamera gegeben hatte. So wusste ich zumindest immer, wo ich in der Nacht<br />
zuvor gewesen war – wenn ich mich denn erinnern wollte. Ich schloss die Augen, um<br />
mich auf die Kings of Prussia zu konzentrieren.<br />
Lying by the dying Veilchen<br />
I try with all my might<br />
To bring back our garden of delight.<br />
Ich schaute wieder auf den Plan, strich alle Orte durch, in denen wir schon gewesen<br />
waren, und studierte die kommenden. Morgen ging’s nach Mannheim. Dann<br />
Hamburg. Am Sonntag würden wir nach Nordosten fahren, nach Zingst auf dem<br />
Darß. Darauf folgte der bayerische Teil der Reise. München. Und schließlich eine<br />
ganze Woche auf Schloss Koppenbach, eineinhalb Zugstunden von München<br />
entfernt in den Alpen. Im Schloss fand eine Tagung statt, an der meine Mutter<br />
teilnehmen würde. Außerdem hatte sie noch ein paar Lesungen in der näheren<br />
Umgebung.<br />
Ich wickelte einen Big Red aus und schob ihn mir in den Mund.<br />
Wie konnte mir das passieren? Mir, Renée Bella Brody? Wie konnte ich mich<br />
drei ganze Wochen von einem Bummelzug zum nächsten schleppen lassen, der uns<br />
von einer grauen, grässlichen Stadt zum nächsten Kuhkaff brachte. Drei Wochen<br />
lang Koffer ein- und auspacken, marode Hotelbetten, das Schnarchen meiner Mutter,<br />
ihr Atmen in meinem Rücken. Drei Wochen lang mit anhören, wie Dr. Mom<br />
zermürbten Eltern erzählt, wie sie sprechen müssen, damit die Kinder ihnen zuhören,<br />
und wie sie zuhören müssen, damit die Kinder mit ihnen sprechen.<br />
Ich drehte die Musik etwas lauter:
Waiting near the wispy Weiden<br />
I try with all my might<br />
To bring back our garden of delight<br />
Oooh, call in the night.<br />
Ich blickte auf. Der Mann im weißen Leinenanzug sah mich schon wieder an. Ich<br />
schaute runter auf den Tisch und griff nach dem Psychologie-Heute-Heft meiner<br />
Mutter.<br />
Kurze Zeit später stand der Mann im Leinenanzug auf. Meine Augen klebten an<br />
der Zeitschrift.<br />
Als er vorbeiging, roch es heftig nach seinem Eau de Cologne. Meine Mutter las<br />
immer noch im New Yorker.<br />
Ich blickte auf die Uhr. Noch vierzig Minuten bis Hannover.<br />
Jetzt fiel die ganze Band in den Schlussrefrain ein, Arno, Wilko und Jona.<br />
Roaming near the dear red Rosen<br />
I try with all my might<br />
To remember our garden of delight.<br />
Ich starrte aus dem Fenster. Es war schmutzig, die Scheibe von gleichmäßigen<br />
grauen Streifen durchzogen. Offensichtlich hatte jemand mit einem dreckigen<br />
Lappen geputzt.<br />
Obwohl Philipp heute unterwegs nach Spanien war und eh nicht so gern<br />
telefonierte, holte ich mein Handy raus. Philipp vergaß seins ständig, hatte es sogar<br />
bei seinen Großeltern nicht dabeigehabt. Als klar war, dass ich mit meiner Mutter auf<br />
Lesereise gehen musste, hatte ich ihm auf die Mailbox gesprochen. Vielleicht<br />
konnten wir uns ja doch noch vor seiner Abreise treffen? Aber keine Antwort.<br />
Schließlich erreichten wir uns dann am Sonntagabend am Telefon. Ich war bereits in<br />
Leipzig und er gerade von seinen Großeltern zurückgekommen. Er wusste noch nicht<br />
einmal, dass ich angerufen hatte: Sein Akku war leer gewesen und er lud ihn gerade<br />
erst in diesem Moment auf. Das muss man sich mal vorstellen: Mit dem einzigen<br />
sechzehnjährigen Jungen auf der Welt, der keine innige Beziehung zu seinem Handy<br />
pflegt, muss ich etwas haben!
Wahrscheinlich hatte ich insgeheim gehofft, dass Philipp über meine<br />
veränderten Ferienpläne überglücklich sein würde, dass er mich nach meiner Route<br />
fragen und sich unbedingt irgendwo unterwegs mit mir treffen wollte, bevor er nach<br />
Spanien flog. In Magdeburg vielleicht. Oder in Halberstadt. War doch alles möglich.<br />
Aber es kam ihm gar nicht in den Sinn.<br />
»Du bist in Leipzig?«, sagte er. »Schön.«<br />
»Na ja.«<br />
Schweigen.<br />
»Es ist ein bisschen ... also ... einsam«, sagte ich dann. »Meine Mutter muss<br />
die ganze Zeit arbeiten.«<br />
»Verstehe.«<br />
Wieder Schweigen.<br />
»Morgen bin ich in Magdeburg«, sagte ich und hob meine Stimme am Ende wie<br />
zu einer Frage.<br />
»Oh, Magdeburg«, sagte er. »Cool.«<br />
»Ja, ziemlich cool.«<br />
Schweigen.<br />
»Mit dem ICE ist man da von Berlin aus in nur einer Stunde«, sagte ich.<br />
»Ach, wirklich?«<br />
Und das war’s.<br />
Zwei Tage brauchte ich, um meine Enttäuschung zu überwinden. Schließlich<br />
beschloss ich, dass Philipp von seinem Besuch bei den Großeltern völlig ausgelaugt<br />
gewesen sein musste, oder vielleicht waren ja auch seine Eltern im Zimmer, als ich<br />
anrief. Oder ein Freund. Na klar! Ich wette, Philip Eins war gerade da und mein<br />
Philipp wollte nicht, dass der mitbekam, mit wem er telefonierte.<br />
Also verzieh ich ihm und schickte ihm gestern Abend von Tangermünde aus<br />
eine Mail.<br />
Vielleicht lag ihm Schreiben ja mehr.<br />
Das war wirklich zu hoffen.<br />
Fahrende Züge sind für Handys der Tod: Kein Empfang. Dabei wartete ich auf eine<br />
SMS von Alina. Normalerweise simsten wir uns mindestens einmal am Tag.<br />
Am Montag schickte ich ihr »Langeweile in Leipzig«. Sie schrieb zurück »Sex<br />
auf Sardinien«. Es war ein bisschen wie Pingpong. Ich: »Hilfe – Halberstadt!« Sie:
»Männer am Mittelmeer.« Ich: »Magdeburg und Mutterzoff.« Sie: »Irre nach Italos.«<br />
Mann, die hatte echt nur eins im Kopf.<br />
Im Fenster: Noch mehr vom Ewiggleichen.<br />
The Great Gatzki war gerade bei Hugs and Küsse:<br />
Hugs and Küsse because I miss ya<br />
Hugs and Küsse because I need ya.<br />
Ich blätterte in Psychologie Heute. Auf der letzten Seite fand ich eine Anzeige<br />
für die Tagung auf Schloss Koppenbach, Erziehung im neuen Millennium.<br />
»Sind alle auf dem Schloss Psychologen?«, fragte ich meine Mutter und<br />
machte die Musik etwas leiser. »Oder Sozialarbeiter? Und Familienberater?« Der<br />
Gedanke daran ließ mich schaudern.<br />
»Um Gottes willen, nein! Wir sind etwa fünfundsiebzig Tagungsteilnehmer. Aber<br />
die normalen Hotelgäste können auch zu den Veranstaltungen kommen. Niels sagte,<br />
das Hotel sei ausgebucht, also müssen da noch ungefähr zweihundert Leute mehr<br />
sein. Davon hoffentlich viele Eltern, die sich für unsere Arbeit interessieren.«<br />
Ich drehte The Great Gatzki wieder laut und machte eine Kaugummiblase. Sie<br />
platzte auf meiner Oberlippe und ich schob sie mit der Zunge zurück in den Mund.<br />
Mmmm. Meine Lippen fühlten sich seidig, weich und prall an.<br />
Ich zog meinen Taschenspiegel heraus und warf einen Blick hinein. Ja, definitiv:<br />
Meine Lippen sahen viel voller aus. Meine neue Lippenvergrößerungscreme für volle,<br />
sinnliche Lippen war einfach fantastisch. LipLuv. Das Beste, was man für 19,90 Euro<br />
bekam, wenn man nicht gerade Silikon spritzen wollte. Vielleicht liegt es an meinen<br />
Lippen, dass der Mann im weißen Leinenanzug mich anschaut.<br />
Ich legte frischen Lipgloss auf.<br />
Hugs and Küsse because I love ya<br />
Hugs and Küsse because I want ya.<br />
»Wie findest du meine Lippen?«, fragte ich meine Mutter.<br />
»Ach, Renée«, sagte sie und schaute kurz auf meine Lippen. »Sei nicht albern.<br />
Deine Lippen sehen aus wie immer. LipLuv! Wenn etwas so klingt, als sei es zu<br />
schön, um wahr zu sein, dann ist es zu schön, um wahr zu sein.«
Was war das denn schon wieder für ein Spruch – darum ging’s doch gar nicht!<br />
»Wenn etwas so klingt, als sei es zu schön, um wahr zu sein, dann ist es zu schön,<br />
um wahr zu sein«, spottete ich. »Schreib da drüber doch einfach ein Buch.« Ich<br />
schoss hoch, drehte mich um und stieß – Kopf voran – mit einem weißen<br />
Leinenanzug zusammen.<br />
Mist!<br />
»Tschuldigung«, murmelte ich zur Leinenschulter, die nun mit Lipgloss<br />
verschmiert war.<br />
Ich flüchtete mich in Richtung Klo, aber leider nicht schnell genug: »Verzeihen<br />
Sie die Störung«, hörte ich den Mann im weißen Leinenanzug zu meiner Mutter<br />
sagen, »aber ich wollte Ihnen unbedingt sagen, dass meine Frau und ich all Ihre<br />
Bücher haben. Sie haben uns so geholfen, unseren kleinen Sohn besser zu<br />
verstehen.«<br />
albern.<br />
O Gott – das war ja oberpeinlich! Meine Mutter hatte wirklich Recht: Ich war<br />
Ich konnte sein Gesicht jetzt nicht sehen, aber sicher sah der Mann im weißen<br />
Leinenanzug gerade genauso bescheuert aus wie alle, wenn sie sich meiner Mutter<br />
vorstellen. Einfach dämlich. Übereifrig. Wie große, schlabbernde Hunde. Freundlich<br />
bis zum Erbrechen. Kennen dich nicht mal, stürzen sich aber gleich auf dich,<br />
schnüffeln rum, geben Pfötchen, lecken dir mit ihren dicken feuchten Sabberzungen<br />
übers Gesicht, so begeistert sind sie, Dr. Edda Mommsen-Brody, die großartigste<br />
Mutter der Welt, kennen zu lernen.<br />
Ha! Die Vorstellung war einfach grotesk. Die großartigste Mutter der Welt.<br />
Wenn die nur wüssten! Wüssten, wie Dr. Mom mit ihrer Perfektion die eigene Tochter<br />
quält. Mit dem Anschein von Perfektion – denn meine Mutter war alles andere als<br />
perfekt. Wenigstens nicht mehr. Ich meine, man muss ja nur mal an ihren Zustand im<br />
letzten Herbst denken. Nach dem Unfall.<br />
Ich reg mich ja jetzt noch ziemlich über den miefenden Frotteebademantel auf,<br />
den sie tagein, tagaus zu Hause trägt. Trotzdem ist eine Mutter im<br />
Frotteebademantel ein Riesenfortschritt im Vergleich zu einer Mutter, die sich einen<br />
ganzen Monat lang im Bett vergräbt, ohne auch nur einmal die Wäsche zu wechseln.<br />
Ein, zwei Wochen vor Trauer im Bett zu liegen – das kann man ja noch akzeptieren.<br />
Aber meine Mutter brauchte mehr als vier Wochen, um endlich wieder aus dem Bett<br />
zu steigen und zumindest mal den ekligen Bademantel anzuziehen. Aus dem Haus
ging sie aber kaum. Noch nicht mal zum Einkaufen. Vom ersten Tag an machte ich<br />
den Haushalt.<br />
»Aber Renée«, sagte sie und setzte sich in ihrem Bett auf, »das musst du nicht.<br />
Gisela sagte, sie würde das tun.«<br />
»Ist schon in Ordnung«, sagte ich und räumte ihren schmutzigen Becher weg.<br />
Sie wollte doch ihre Freundin Gisela genauso wenig in der Wohnung haben wie ich.<br />
Sie zuckte mit den Schultern, seufzte, gab mir EC-Karte, Geheimzahl und<br />
schließlich ihre Einkaufsliste: Pfefferminztee, Salzbrezeln und Taschentücher. Das<br />
war’s. Davon lebte sie. Wochenlang. Die Wohnung verließ sie nur alle paar Tage, um<br />
zu einer Kollegin zu gehen, Ingrid Goethe, eine Therapeutin.<br />
»Solltest du nicht vielleicht auch mit jemandem sprechen?«, fragte sie mich.<br />
»Worüber?«, antwortete ich, leerte eine neue Tüte Salzbrezeln in eine Schüssel<br />
und stellte sie auf ihren Nachttisch.<br />
»Es gibt gute Therapeuten, die Erfahrungen mit Jugendlichen in deiner<br />
Situation haben. Die wissen, wie man mit Trauer ...«<br />
»Hör mal, Mama!« Ich erhob die Stimme, um den Klumpen aus Schmerz,<br />
diesen Tränenklumpen, der meine Kehle verstopfte, zurückzudrängen. »Ich hab dir<br />
schon gesagt, es ist alles okay! Ich brauche niemanden. Darf ich dich daran erinnern:<br />
Ich bin diejenige, die jeden Morgen aufsteht. Ich komm schon klar. Allein.«<br />
»Mein Liebes, es ist nicht gut, wenn du es nicht rauslässt.«<br />
»Wenn ich was nicht rauslasse?«<br />
Ich knüllte die hundertste Salzbrezeltüte zu einem Ball zusammen und schmiss<br />
sie Richtung Papierkorb. Dabei öffnete sich der Ball und Krümel und Salzkörner<br />
rieselten auf das Parkett.<br />
»Oh nein«, sagte meine Mutter und ließ sich erschöpft zurückfallen. Salz auf<br />
dem Fußboden war zu viel für sie.<br />
Für mich auch.<br />
Ich stampfte aus dem Zimmer. Unter den dicken Sohlen meiner Stiefel hörte ich<br />
Salz und Krümel knirschen. Die Kratzer im Parkett konnte ich fast vor mir sehen.<br />
Du musst es einfach rauslassen. Ich konnte das nicht mehr hören. Meine<br />
Mutter. Fritzis Mutter Gisela. Oma Ulli. Die Schulpsychologin.<br />
»Kennst du den Unterschied zwischen Schmerz und Trauer?«, fragte mich<br />
Serena Kirschner, unsere Schulpsychologin, und zog an ihrer Zigarette.
Ich antwortete nicht. Sah nur ihre Hände an. Ihre Nagelhaut war rissig und die<br />
Nägel kurz geschnitten. Zu kurz. Bestimmt kaute sie die Nägel und feilte sie ab,<br />
damit es keiner merkte. Außerdem waren ihre Fingerspitzen gelb verfärbt. Entweder<br />
hatte sie Gelbsucht oder es kam vom Nikotin. Eine Schulpsychologin, die Nägel kaut<br />
und raucht. Tolles Vorbild.<br />
»Wenn jemand, den man liebt, fort ist, fühlen wir Schmerz«, sagte Frau<br />
Kirschner und nahm einen weiteren Zug. »Trauern wiederum bedeutet, dem<br />
Schmerz Ausdruck zu verleihen. Ihn rauszulassen. Ihn zu akzeptieren. Sich mit ihm<br />
zu versöhnen. Die Wunde heilen zu lassen.«<br />
Ich sagte nichts. Ich hatte mich an mein Schweigen gewöhnt. Die Menschen um<br />
mich herum ebenfalls.<br />
»Weinen ist eine Art zu trauern«, sagte sie. »Eine der besten. Aber es gibt viele<br />
andere Möglichkeiten. Manche Menschen pflanzen Bäume für ihre Lieben, die nun<br />
tot sind. Andere malen Bilder.« Dann schlug sie vor, ich sollte ein paar Zeilen an<br />
meinen Vater auf einen biologisch abbaubaren, mit Treibgas gefüllten Ballon<br />
schreiben und ihn zum Himmel aufsteigen lassen.<br />
»In Amerika macht man das«, sagte sie.<br />
Superidee: Sonntagfrüh, ich, oben auf dem windigen Teufelsberg mit den<br />
Drachenjunkies. »Hey Dad«, würde ich Richtung Himmel rufen, »hörst du mich? Tut<br />
mir Leid, dass ich mich nicht von dir verabschieden konnte. Aber hier kommt ein<br />
Ballon für dich geflogen, der ist hundert Prozent biologisch abbaubar und es steht<br />
was für dich drauf.«<br />
Thanks, but no thanks.<br />
Ich stand auf. »Sind wir jetzt fertig, Frau Kirschner? Kann ich jetzt gehen?«<br />
Frau Kirschner zog an ihrer Zigarette, dann nickte sie. Und ich ging.<br />
Gisela, Fritzis Mutter, schenkte mir ein Tagebuch. »Da könntest du alles<br />
reinschreiben«, sagte sie. »Ich weiß, dass du gern schreibst.«<br />
»Ich hab genug Hausaufgaben«, sagte ich und beließ es dabei. Aber das in<br />
Hanfleinen gebundene Buch nahm ich trotzdem gern mit. So viel schönes blankes<br />
Papier sollte nicht in irgendeiner fremden Schublade landen.<br />
Herr Trockenbrodt, der Schwimmtrainer, war der Einzige, der mir einen wirklich<br />
vernünftigen Rat gab.<br />
»Schwimm«, sagte er. »Nur das will ich von dir.«<br />
»Schwimmen?«
»Ja. Nur schwimmen.«<br />
Und das tat ich. Herr Trockenbrodt ließ mich Runde um Runde schwimmen. Ich<br />
musste nicht an Wettkämpfen teilnehmen, mich nicht um meinen Stil kümmern, nicht<br />
auf Zeit schwimmen und keine Gruppenspiele mitmachen. Manchmal machte ich mit.<br />
Aber nicht, weil ich gemusst hätte. Ich musste nur zum Training kommen. Und<br />
schwimmen.<br />
Als ich zu meinem Platz zurückkehrte, machte der Mann im weißen Leinenanzug<br />
sich zum Aussteigen fertig. Meine Mutter hatte nun den Laptop vor sich und<br />
knabberte auf einem ihrer Mandelmüsliriegel herum. Als sie letzten Dezember,<br />
rechtzeitig zu Weihnachten, endlich aus dem Bett gestiegen war und wieder etwas<br />
gesündere Mahlzeiten zu sich nahm, hatte ihre Salzbrezelsucht nachgelassen. Dafür<br />
kamen die Mandelmüsliriegel dran.<br />
»Willst du einen?«, fragte meine Mutter und hielt mir einen Müsliriegel hin.<br />
»Igitt«, sagte ich. Also wirklich. Wie kann sie dieses Körnerzeug nur essen?<br />
Ich blätterte wieder in Psychologie Heute. Eine nüchtern aussehende Frau um<br />
die fünfzig lächelte mich angestrengt an. Um den Hals trug sie einen fließenden, rosa<br />
Schal. Dr. Reintraut Mehlitz, las ich, bietet ein außerordentlich effektives<br />
Coachingprogramm für Menschen jeder Alters- und Berufsgruppe zum Thema<br />
Zielsetzung. In Basiskursen führt sie ihre Klienten durch einen leicht verständlichen<br />
Zielsetzungsprozess, die Aufbaukurse dienen dazu, die einmal gesteckten Ziele fest<br />
im Auge zu behalten und weiterzuverfolgen, bis sie erreicht sind.<br />
Gähn. Schnarch. Zzzzz.<br />
Ich schloss die Augen. Wirklich schade, dass ich mir meine Zeit im Zug nicht<br />
ein wenig mit Sammy vertreiben konnte. Sie hätte mich zumindest wach gehalten.<br />
»Was liest du da?«, fragte meine Mutter mit Blick auf ihr Psychologie Heute.<br />
Ich verdrehte die Augen. »Ziele«, sagte ich und ahmte eine<br />
Nachrichtensprecherin nach: »Einer der größten Fehler, den man bei der Verfolgung<br />
seiner Ziele machen kann, ist, sich zu verzetteln. Stattdessen sollte man seine Kräfte<br />
– wie einen Laserstrahl – ausschließlich auf eine Idee, ein Projekt oder ein Ziel<br />
richten.«<br />
Anstandshalber lächelte meine Mutter über meine Parodie. »Reintraut wird<br />
auch bei der Tagung sein. Sie hält einen Vortrag.«<br />
»Oh, lass mich raten: Wie erzeuge ich zielsicher Langeweile?«
»Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen«, seufzte meine Mutter.<br />
»Wegen Oma Ulli«, neckte ich.<br />
»Also wirklich, Renée!«<br />
»War nur’n Witz.«<br />
Bestimmt war es Oma Ulli.<br />
Meine Mutter wandte sich wieder ihrem Laptop zu. Klickety-klack-klickety-klack<br />
machten ihre Finger auf der Tastatur. Was mochte sie da schreiben? Jedenfalls<br />
keine Kolumne. Normalerweise schrieb sie immer alle sechs Monate zwölf Stück auf<br />
einmal. Die nächsten waren erst wieder im November dran.<br />
Ich schob das Heft weg. Ziele! So’n Quatsch! Wozu Ziele, wenn aus heiterem<br />
Himmel alles in Scherben gehen kann?<br />
Andererseits hat es auch sein Gutes, wenn man weiß, was man will. Ich zum<br />
Beispiel wusste ganz genau, dass ich mit Philipp schlafen wollte, also konnte ich<br />
mich gezielt darauf vorbereiten. LipLuv war der erste Schritt in die Richtung.<br />
Piercings ein weiterer. Die Recherche in Sache Sex (Sammy) lief ja bereits.<br />
Ich schielte auf den Laptop. Meine Mutter beantwortete gerade eine Mail.<br />
Wahrscheinlich schrieb sie an Ulf Krauss, diese Laus, ihren Verleger. Meine Mutter<br />
hat auf der ganzen Welt Freunde, Leute, die sie von Konferenzen kennt, Leute, die<br />
ihre Bücher lesen oder verlegen, und mit allen hält sie Kontakt via E-Mail. Aber von<br />
Ulf Krauss hat sie mit Abstand die meisten. Um die zweihundertzwanzig. Das weiß<br />
ich, weil ich vor einigen Wochen, als mein Computer in der Reparatur war und ich<br />
ihren benutzen durfte, den Ordner im offenen Mailprogramm gesehen habe. Ob sie<br />
ihm wohl genauso viele E-Mails zurückgeschrieben hatte? Ich schaute unter<br />
»gesendet« nach, ordnete die Einträge alphabetisch, und tatsächlich, da waren die<br />
Mails an ihn. Einige Betreffzeilen klangen total langweilig (Re: Buchumschlag, Re:<br />
Lesereise?, Re: No Subject), aber ein paar versprachen mehr (Re: Wow! Mehr!<br />
Sofort!, Re: Wir sehn uns in Hamburg).<br />
Meine Neugierde war geweckt. War Ulf Krauss der Grund, warum sie neulich in<br />
Hamburg übernachtet hatte? Wie konnte sie nur? Nach all dem, was passiert ist? Es<br />
war noch nicht mal ein Jahr her. Und außerdem, Ulf Krauss war sechzig! Und sein<br />
Bauch! Total abtörnend. Wie ein Fußball, aus dem die Luft rausgegangen ist,<br />
schwappt er über seine Hose. Das ist eklig – überhaupt nicht wie bei meinem Vater,<br />
dessen Bäuchlein nur ein klein bisschen wackelte, wenn er lachte. Gott. Meine
Mutter und Ulf Krauss. Dabei hatte sie mir so gut wie hochheilig versprochen, dass<br />
sie nichts mit Männern anfangen würde. Zumindest nicht für lange Zeit.<br />
Vor ungefähr zwei Monaten platzierten Becky und Lucy bei einer Dinner-Party<br />
meine Mutter neben einen geschiedenen Bekannten der beiden – absichtlich,<br />
natürlich. Als ich davon Wind bekam, reagierte ich panisch. Und da sagte meine<br />
Mutter, dass sie alles Mögliche im Kopf hätte, nur keinen neuen Mann.<br />
»Schatz«, hatte sie gesagt, »Es gibt auf der Welt nur sehr wenige Männer wie<br />
deinen Vater. Wenn du einen, nur einen Bo im Leben triffst, kannst du dich glücklich<br />
schätzen. Und das tue ich. Ich habe Glück gehabt. Und du auch, so einen Vater<br />
gehabt zu haben.«<br />
Ich weiß noch, wie sich meine Kehle zusammenzog, als sie das sagte, als ob<br />
ein harter Klumpen in meiner Luftröhre steckte. Aber dann strich mir meine Mutter<br />
über die Stirn, so wie sie es früher immer gemacht hatte, als ich noch klein war und<br />
nicht einschlafen konnte, und es ging mir besser.<br />
»Ich brauche keinen neuen Mann in meinem Leben. Mein Leben ist ausgefüllt.<br />
Ich habe alles, was ich brauche«, sagte sie. »Ich habe dich. Ich habe meine Arbeit.<br />
Ich habe meine Freundinnen ...«<br />
»Deine Freundinnen, die Kupplerinnen«, sagte ich.<br />
Sie lachte. »Ja, meine Freundinnen, die Kupplerinnen. Und ... und ich habe<br />
mehr als genug zum Leben. Genug zu essen ...«<br />
»Salzbrezeln zum Beispiel.«<br />
»Richtig. Meine Salzbrezeln. Und nicht zu vergessen: meine Müsliriegel.«<br />
Und dann lachte ich auch.<br />
Und wir sprachen nie wieder über Männer.<br />
Aber was, bitte schön, hatten zweihundertzwanzig Mails von Ulf Krauss in<br />
ihrem Computer zu suchen? Das wollte ich wissen. Als ich am nächsten Tag ihre<br />
Mails auf ihrem Laptop abrufen wollte, entdeckte ich, dass sie ihr Mailprogramm mit<br />
einem Passwort geschützt hatte. Sie befürchtete wohl einen Eingriff in ihr Privatleben<br />
oder wollte mich einfach nicht in Versuchung führen. Ich schämte mich und hatte ein<br />
schrecklich schlechtes Gewissen, aber ich muss zugeben: Ich hab trotzdem<br />
versucht, das Passwort zu knacken. Ich gab ihren Geburtstag ein, ihren<br />
Mädchennamen, meinen Namen und meinen Geburtstag. Danach versuchte ich es<br />
mit dem Namen meines Vaters – Boris »Bo« Ralph Brody –, und dann tippte ich auch<br />
noch den Namen seines Tonstudios ein: Botown. Nichts funktionierte.
Ich sah über die Schulter meiner Mutter, konnte aber nicht erkennen, ob sie an Ulf<br />
Krauss schrieb oder nicht. Der Zug fuhr langsam. Wir waren kurz vor Wolfsburg. Ich<br />
zog mein Handy raus und sah auf das Display: keine Nachricht. Aber jemand hatte<br />
angerufen, ohne etwas auf die Mailbox zu sprechen. Ich guckte bei den entgangenen<br />
Anrufen nach. Meine Mutter spürte wohl meine Aufregung und drehte sich zu mir um.<br />
Zu meiner großen Enttäuschung stammte der Anruf nicht von Philipp, sondern von<br />
Fritzi. Was wollte die denn? Bei ihrem letzten Anruf, und das war eine Ewigkeit her,<br />
hatte ich gesagt, dass ich keine Zeit hätte und sie zurückrufen würde. Hatte ich zwar<br />
nie getan, aber manche Leute geben eben nie auf.<br />
»Wer war’s?«, fragte meine Mutter.<br />
»Weiß nicht. Wahrscheinlich hat sich jemand verwählt«, sagte ich.<br />
Wir fuhren nun am Gebäudekomplex der Autostadt vorbei. Wolfsburg. Heimat<br />
von Volkswagen. Das war immer mein liebster Teil der Reise von Berlin zu Oma Ulli<br />
gewesen. Ich mochte, wie das blanke, klare Glas und der silberne Stahl der Pavillons<br />
in der Sonne glitzerten, mochte die roten Ziegel der alten Fabrikgebäude, die grüne<br />
Hügellandschaft. Das erinnerte mich immer an die Miniaturstädte, die mein Vater und<br />
ich aus den Platinen und Elektrochips bauten, die wir in seinem Tonstudio „Botown“<br />
fanden.<br />
Eines Tages, ich war ungefähr acht, entdeckte ich in Botown ein kaputtes<br />
Faxgerät, das mein Vater auseinander genommen hatte. Verheißungsvoll glitzernd<br />
lag die Platine vor mir. Ich nahm sie in die Hand. Sie sah aus wie eine Stadt aus der<br />
Vogelperspektive. Wie Los Angeles, wenn man von den Hollywood Hills oder von<br />
einem Hochhaus darauf schaut.<br />
Danach begann ich ausrangierte Geräte auseinander zu nehmen. Dabei bekam<br />
ich leider kaum was über Elektronik mit – was mein Vater gern gehabt hätte –, wurde<br />
dafür aber sehr geschickt mit Werkzeugen. Ich bestaunte die Kabel im Innern der<br />
Maschinen und verflocht sie zu Spaghettischnüren in Knallorange, Bonbonrosa,<br />
Ozeanblau und Sonnengelb. Die seltsamen Strukturen und Pfade auf den Platten,<br />
die Schaltpläne, konnten mich stundenlang fesseln. Für Ingenieure und Elektriker<br />
sind diese Muster wie ein technischer Straßenplan, für mich waren es Wanderwege,<br />
Teiche, Flüsse. Manchmal kratzte ich in die Platinen Straßennamen, wie ich sie aus<br />
den Vororten Südkaliforniens kannte, wo mein Vater aufgewachsen war: Voltage<br />
Valley, Battery Bend, Oscillator Alley, LED Lane.
Als wir damit fertig waren, Teile zusammenzusetzen und neue hinzuzufügen,<br />
sah unsere erste neue Platine tatsächlich aus wie der Fabrikkomplex in Wolfsburg<br />
aus der Vogelperspektive. Ich nannte sie Voltsburg. Die zweite hieß Schaltstadt.<br />
Eines unserer Werke erinnerte mich an den John Wayne Airport in Santa Ana in<br />
Kalifornien, deshalb nannte ich es Aeroporta Santa Analoga. Die letzte Ministadt, die<br />
mein Vater und ich gemeinsam bauten, ähnelte einer dieser südkalifornischen<br />
Retortenstädte wie Rancho Santa Margarita, wo meine Grandma Myrna lebt. In<br />
unserem Rancho Santa Modulator gab es sogar einen Golfplatz.<br />
»Ich bin der Techniker in der Familie«, pflegte mein Vater zu sagen, »deine<br />
Mutter ist die Intellektuelle. Und du bist die Künstlerin. Die Dichterin.«<br />
»Wiedersehen«, rief der Mann im weißen Leinenanzug meiner Mutter zu, als er den<br />
Wagen verließ.”<br />
Meine Mutter lächelte ihm zu. »Er hat erzählt«, sagte sie dann, »dass er mit<br />
seiner Frau bei der Leipziger Lesung war.«<br />
Leipzig. Grrr! Als meine Mutter Bücher signierte, erkannte mich jemand vom<br />
Cover der Mamaprotokolle und wollte doch tatsächlich ein Autogramm von mir. Und<br />
dann noch jemand. Das war unter Garantie die letzte Lesung von Dr. Mom, auf die<br />
ich gegangen bin.<br />
Meine Mutter hatte wie meistens vier Geschichten gelesen, Familienanekdoten.<br />
Ihre Texte sind schon ziemlich witzig, wenn man sie liest, aber wenn Dr. Mom sie vor<br />
Publikum vorträgt, wirken sie noch viel komischer. Selbst langweilige Fragen<br />
beantwortet sie voll Humor und schafft es jedes Mal, die Leute zum Lachen zu<br />
bringen. Es ist schon erstaunlich, wie diese komische Seite vor Publikum zu Tage<br />
tritt. Sie inszeniert sogar die Bühne, ihr Lieblingsrequisit ist eine Vase mit<br />
Leuchttulpen, die mein Vater ihr mal vor langer Zeit geschenkt hat.<br />
Während der Lesung beobachtete ich sie, sah das Strahlen in ihren Augen,<br />
sah, wie lebendig sie war, wie glücklich es sie machte, mit zweihundert Müttern und<br />
Vätern zu scherzen, und ich begriff, wie sehr sie sich seit letztem Herbst verändert,<br />
wie viel sie verloren hatte. Diese Edda wollte ich zurück, die lustige Edda, die uns<br />
zum Lachen brachte, die mich zum Lachen brachte. Nicht die Edda, die den ganzen<br />
Tag in einem ekligen Bademantel herumsaß und Mandelmüsliriegel knabberte.<br />
»Renée?«, hörte ich meine Mutter sagen.
Erschrocken drehte ich mich zu ihr um.<br />
»Alles in Ordnung?«, fragte sie.<br />
»Klar.«<br />
»Du siehst irgendwie ... traurig aus.«<br />
»Bin ich aber nicht«, antwortete ich mürrisch.<br />
Jemand klopfte ans Fenster. Wir fuhren zusammen. Der Mann im weißen<br />
Leinenanzug winkte vom Bahnsteig zum Abschied. Meine Mutter winkte zurück, und<br />
er drehte sich um und verschwand in der Menge.<br />
»Wie kannst du nur?«, sagte ich.<br />
»Du solltest netter zu meinen Lesern sein, Renée«, neckte sie mich. »Denk nur:<br />
Sie finanzieren dir mal dein Studium.«<br />
»Haha!“ machte ich, wobei sie wahrscheinlich sogar Recht hatte. Insbesondere<br />
wenn ich in den USA studieren würde. Und genau das war der Wunsch meines<br />
Vaters. Er wollte, dass ich an eine richtig tolle Universität gehe, wie Berkeley, wo er<br />
selbst Student war und meine Mutter promovierte.<br />
Ich sehe ihn vor mir, wie er sich zu meiner Mutter umdrehte, ihr liebevoll den<br />
Hintern tätschelte und sagte: »Berkeley. Erinnerst du dich, Edda? Da fing es an.«<br />
»Es«, das waren sie, meine Eltern, als Einheit. Und schließlich dann ich.<br />
Boris Ralph Brody, genannt “Bo” gebürtig in Mission Viejo in Südkalifornien, leitete<br />
ein Tonstudio oben im Norden, in San Francisco, als er meine Mutter, eine<br />
Doktorandin mit einem Berkeley-Stipendium, kennen lernte. »Er war witzig, ohne<br />
jemals darum bemüht zu wirken«, erzählte sie mir einmal. »Sogar wenn er ernst war,<br />
brachte er einen zum Lachen. Er war so unbeschwert.«<br />
»Na klar«, sagte mein Vater dann. »Sie hatte diese intellektuellen deutschen<br />
Typen satt. Die großen, blassen Kerle mit den langen, fettigen Haaren, den<br />
Drahtgestellbrillen, den Birkenstocklatschen, den langen, schmutzigen<br />
Fingernägeln.«<br />
Wenn mein Vater das sagte, mussten wir lachen, denn diese Beschreibung<br />
passte haargenau auf seinen besten Freund Arthur Anderson, Fritzis Vater, der<br />
allerdings Engländer war und außerdem kein Uni-Typ. Als Landschaftsgärtner bekam<br />
er die Erde kaum aus den Nägeln. Ganz nebenbei, Birkenstocks trug er nur im<br />
Sommer, in den Ferien in Cornwall.
Aber es stimmt, dass mein Vater anders war als der typische Deutsche. Sein<br />
Haar war dunkel, fast schwarz, lockig und dicht. Und er war nicht sehr groß, ein<br />
wenig rundlich, wie ein freundlicher Bär, mit rötlichen Wangen.<br />
»Ich mag’s, wenn was dran ist«, pflegte meine Mutter zu sagen und kniff ihn in<br />
die Speckröllchen an seinem Bauch.<br />
Edda hingegen hatte nicht eine Fettzelle am Körper.<br />
»Außer vorne oben«, sagte mein Vater.<br />
Ihm zufolge war Edda der Inbegriff des deutschen Fräuleins. Glatte blonde<br />
Haare. Blaue Augen. Groß. Schlank. Außen tough und innen weich. »Und schöne<br />
dicke Möpse.«<br />
»Bo!«, protestierte meine Mutter dann. «Wie kannst du nur in Gegenwart deiner<br />
Tochter so reden? Wenn du schon ordinär sein musst, könntest du nicht wenigstens<br />
›große Brüste‹ sagen?«<br />
»Könnte ich schon, Schatz – wenn du welche hättest. Hast du aber nicht. Du<br />
hast Möpse. Große schöne Möpse. Und ich liebe sie.«<br />
Und dann sagte er zu mir: »Hör mal. Deine Mutter hat ein Superhirn und das<br />
liebe ich auch. Aber das weiß sie schon. Es sind die Möpse, an die ich sie immer<br />
erinnern muss.«<br />
Meine Mutter kicherte, packte mich und sagte: »Hör bloß nicht auf deinen Vater.<br />
Er ist unverbesserlich. Er hängt zu viel mit Rockmusikern rum.«<br />
Zu seiner Ehrenrettung muss gesagt werden, dass mein Vater mit diesen<br />
Sprüchen in meiner Gegenwart irgendwann aufhörte. So vor ungefähr zwei oder drei<br />
Jahren. Ungefähr zu der Zeit, als ich selbst Möpse bekam. Ich meine natürlich<br />
Brüste. Damals hörte er auch damit auf, mich hochzuheben und wie ein wild<br />
gewordener Zirkusartist herumzuschwingen. »Ach«, sagte er, gerührt und mit Tränen<br />
in den Augen, »meine kleine Rebella wird erwachsen.«<br />
Rebella. Das war der Kosename meines Vaters für mich. Seit ich zwei war und<br />
ein richtiger Wirbelwind. Renée Bella. Abgekürzt: Rebella. Auch nach der Trotzphase<br />
blieb der Spitzname an mir kleben. Und ich habe ihn immer geliebt. Rebella. Der<br />
Name erinnerte mich daran, was ich immer war und immer sein werde. Daddys<br />
kleines Mädchen. Rebella.
Als der Zug weiter Richtung Hannover fuhr, setzte ich mir wieder Kopfhörer auf und<br />
hörte Let Me Be Your Heinzelmännchen. Das war einer meiner Lieblingssongs von<br />
der ersten CD Work Through the Night. Der CD, die die Band über Nacht in die<br />
internationalen Charts gebracht hatte.<br />
Let me be your Heinzelmännchen<br />
I can be so fine and handsome<br />
Let me find some wood for you<br />
Light your fire the whole night through<br />
Loving you the whole night through.<br />
Oooo. Oooo.<br />
Mein Vater machte sich über Gatzki und Co. gerne lustig. Ich werde nie vergessen,<br />
wie er eines Abends vor ungefähr fünf Jahren nach Hause kam und zu meiner Mutter<br />
und mir sagte: »Heute waren ein paar Berliner Jungs im Studio. Nennen sich die<br />
Kings of Prussia. Die machen mich krank. Musik wie ’ne Endlosschleife. Immer die<br />
gleichen drei Akkorde und ein paar läppische Na-Na-Na-Harmonien dazu. Kings of<br />
Prussia, wenn ich das schon höre … Königliche Furzkanonen, das würde passen!«<br />
Er zog sich die Schuhe aus. »Und dann musste ich mir den ganzen Tag diese<br />
bescheuerten Texte anhören. Jeder Kirchenchor hat geistreichere Sachen drauf.«<br />
Er lag auf dem Sofa, legte die Füße auf die Polster und den Kopf in den Schoß<br />
meiner Mutter. »Aber die werden wie eine Bombe einschlagen«, sagte er. »Damit<br />
muss ich leben.« Er hob seinen Kopf und sah mich an. »Ihr Grünschnäbel werdet die<br />
Texte für tiefgründig halten.« Er verdrehte die Augen, griff nach der Fernbedienung<br />
und stellte klassische Musik an – zur Beruhigung. Rock und Pop, das war sein Job,<br />
aber zu Hause hörte er nur Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Chopin. Er liebte<br />
sie alle. Vor allem Chopin. »Ich kann mich nicht länger konzentrieren«, sagte meine<br />
Mutter und ließ sich in den Sitz zurückfallen. Sie nahm ihre Brille ab und rieb sie mit<br />
einem Tuch sauber.<br />
Ich schloss die Kamera an ihrem Laptop an. Ich wollte für Philipp ein hübsches<br />
Foto von mir aussuchen.<br />
»Hoffentlich ist es keine Migräne«, sagte meine Mutter und rieb Daumen und<br />
Zeigefinger auf ihrer Nasenwurzel. Dann langte sie in ihre Tasche und zog eine<br />
kleine Flasche Mineralwasser und eine Packung Kopfschmerztabletten heraus.
»Vielleicht kann Oma Ulli die Kopfschmerzen wegmassieren«, sagte ich.<br />
Meine Mutter verzog das Gesicht. »Ich wette, sie wird es versuchen.«<br />
Ich wandte mich wieder dem Laptop zu. Staunend sah ich zu, wie ein Foto nach<br />
dem anderen auf dem Bildschirm erschien, ein Wasserfall aus Bildern. Faszinierend.<br />
Die letzten Bilder zeigten eine Kirche, die ich noch nie gesehen hatte, und dann<br />
eine Orgel.<br />
»Wo war das denn?«, fragte ich.<br />
Meine Mutter beugte sich vor. »Der Dom in Magdeburg. Du hattest keine Lust<br />
mitzukommen, erinnerst du dich?«<br />
Das tat ich. Es klingt noch in meinen Ohren, wie ich sagte: »Ich geh doch sonst<br />
nie in die Kirche, warum also in den Ferien?« Während sich meine Mutter als<br />
Freizeithistorikerin im Magdeburger Dom betätigte, war ich auf der Suche nach einer<br />
Lippenvergrößerungscreme gewesen, hatte LipLuv gefunden und ging dann in<br />
unserem Hotelpool schwimmen.<br />
Schließlich fand ich im Laptop ein schönes, ziemlich untypisches Porträt von<br />
mir. In Gedanken versunken sitze ich da, schaue in die Ferne, weder lächelnd noch<br />
ernst. Einfach da. Nachdenklich. Ich mochte es sehr, auch wegen des vielen Rosa<br />
und Rot. Ich trug mein rosa geblümtes rückenfreies Top und die roten<br />
Glitzerohrringe, die Fritzi mir letzten Sommer aus London mitgebracht hatte. Und ich<br />
sitze<br />
vor einem riesigen Erdbeereisbecher. Alles war rosa, sogar meine Wangen. Und<br />
mein Lippenstift. Das Bild haben wir am Donnerstag in einem Café in Halberstadt<br />
gemacht, wo meine Mutter mich praktisch gezwungen hatte, das alte jüdische Viertel<br />
mit ihr anzuschauen.<br />
»Ich hab keine Lust!«, hatte ich im Pensionszimmer protestiert. »Alte Häuser<br />
anglotzen ist öde.«<br />
»Mensch, Renée, sei nicht so vernagelt! Das ist doch deine Geschichte.«<br />
Und sie meinte nicht die deutsche Geschichte. Sie meinte meine. Die<br />
Geschichte meiner Familie. Ein Teil meiner Ururgroßeltern väterlicherseits, Benjamin<br />
und Alma Nussbaum, stammten nämlich aus Halberstadt.<br />
»Keiner von meinen Freunden muss auf den Spuren seiner Ahnen rumlatschen!<br />
Warum ich?«, widersprach ich. »Du brauchst doch nur Stoff für deine blöden<br />
Kolumnen! Renée buddelt nach ihren Wurzeln oder so was.«<br />
»Unsinn! Du bist einfach nur stur.«
Das stimmt. Ich war stur. Vielleicht, weil sie es so sehr wollte. Weil sie mir keine<br />
Wahl ließ.<br />
Wie auch immer, ich ging mit.<br />
Und eigentlich war es auch gar nicht so übel. Aber gesagt hab ich ihr das<br />
natürlich nicht.<br />
Im Café gab mir meine Mutter eine Nachhilfestunde in Familiengeschichte. Ich sollte<br />
den Nussbaum-Stammbaum in allen Details intus haben und fühlte mich wie bei<br />
einem Prep-Kurs für den PISA-Test.<br />
»Benjamin Nussbaum, oder genauer Dr. Benjamin Nussbaum«, begann sie,<br />
»war Metallurge. Er und seine Frau Alma sind deine Ururgroßeltern väterlicherseits.<br />
Und ihre Tochter war ...?«<br />
»Bella«, sagte ich und erinnerte mich an ein Bild, das bei meiner Grandma<br />
Myrna hängt.<br />
»Genau. Von ihr hast du deinen zweiten Vornamen. Bella. Sie wurde 1898<br />
geboren. Zu der Zeit war Halberstadt eine florierende Stadt, in der viele Juden lebten.<br />
Benjamins Kupferfabrik gehörte zum Beispiel einer jüdischen Familie. Und als die<br />
Inhaber jemanden für die Leitung ihrer neuen Niederlassung in Chicago brauchten,<br />
schickten sie Benjamin rüber. Und wer ging mit?«<br />
Ich verdrehte die Augen. »Seine Frau Alma und die Tochter Bella«, sagte ich.<br />
»Daddys Großmutter.«<br />
»Genau.«<br />
Bestimmt würde es mir leichter fallen, all die Namen zu behalten, wenn ich erst<br />
mal den Ort vor mir sah.<br />
»Bella«, erzählte meine Mutter weiter, »heiratete dann einen Amerikaner. Einen<br />
Juden, der aus Polen eingewandert war. Sydney. Sydney wer?«<br />
»Mama, es reicht, bitte!«<br />
»Sydney Brody. Und deren Sohn, Bella und Sydney Brodys Sohn, war Murray,<br />
dein ...«<br />
»Mama!«<br />
»Er war dein Großvater väterlicherseits«, lachte sie, amüsiert über meine<br />
Ungeduld. »Grandpa Murray. Er starb, bevor du auf die Welt kamst. Der Sohn von<br />
Bella und Sydney. Grandma Myrnas Mann. Daddys Vater.«<br />
Ich stöhnte.
»Interessant«, sagte eine Stimme. Wir sahen hoch. Es war die Kellnerin. Wie<br />
lange stand sie da schon?<br />
Wir lachten und bestellten.<br />
Als die Kellnerin wieder weg war, meine Mutter zog einen Stadtplan von<br />
Halberstadt aus der Tasche. »Westendorf«, sagte sie suchend und nahm die Brille<br />
ab, um besser sehen zu können. »Das Haus der Nussbaums lag an einem Fußweg<br />
namens Plantage. Er führte mitten durch einen Park hinter der Straße Westendorf,<br />
die nur ein paar Minuten von der Mikwe entfernt war.«<br />
Ich wusste, was eine Mikwe war – das rituelle Bad, zu dem jüdisch-orthodoxe<br />
Frauen sieben Tage nach dem Ende ihrer Menstruation gehen. Offensichtlich wollte<br />
Gott, dass sie sich vor dem ersten Sex nach ihren Tagen gründlich reinigten.<br />
»Wusstest du, dass Daddy mit Grandma Myrna hier in Halberstadt war?«, sagte<br />
meine Mutter und suchte mit dem Finger auf der Karte immer noch nach diesem<br />
Westendorf. »Ein paar Jahre nach dem Fall der Mauer. Sie wollten Bellas Haus<br />
finden.«<br />
»Wirklich?«<br />
»Du warst damals drei oder vier. Und du warst krank, deshalb bin ich mit dir zu<br />
Hause geblieben. Aber dein Vater und Myrna sind gefahren. Myrna war ganz erpicht<br />
darauf. Sie sagte, sie hätte ihre Schwiegermutter gern gehabt, und wollte endlich<br />
sehen, wo sie aufgewachsen war. Und Daddy, dieser sentimentale Kerl, wollte<br />
natürlich so gern ... sehen, wo ...«<br />
Die Stimme meiner Mutter brach ab. Sie biss auf ihre Unterlippe und versuchte<br />
die Tränen zurückzuhalten. Oh nee! Das fehlte mir gerade noch. Ich griff nach<br />
meinem Wasserglas. Ihre Tränen fühlte ich jetzt in mir, in meinem Hals. Ich spülte<br />
den Klumpen mit Wasser hinunter. Ein Schluck, noch ein Schluck. Noch einer. Meine<br />
Mutter zog ein Tempo aus ihrer Tasche (sie schleppte das Zeug immer noch<br />
tonnenweise mit sich herum – für alle Fälle) und trocknete sich die Augen. Ich<br />
brauchte kein Taschentuch.<br />
»Daddy erzählte, wie Bella an dem alten Haus gehangen hatte«, sagte meine<br />
Mutter und schnäuzte sich, »dass sie oft von dem Garten sprach. Sie erinnerte sich<br />
an eine riesige Kastanie. Und an den Geruch des Flieders vor ihrem Fenster. Daddy<br />
sagte, sie hätte immer Fliederparfüm getragen. Das war ihr Lieblingsduft. Und seiner<br />
auch.« Meine Mutter sah mich an, ihre Augen waren immer noch feucht. »Weißt du,<br />
bevor du geboren warst, waren wir einmal im KaDeWe ein Geschenk kaufen, ein
Parfüm. Wir testeten dies und jenes, und plötzlich wurde er ganz aufgeregt. ›Das ist<br />
Bella‹, sagte er. ›Ich kann sie riechen! Das ist ihr Parfüm.‹ Er wollte, dass ich es mir<br />
kaufe, aber ich weigerte mich. Der Duft erinnerte mich an die alten Damen in meiner<br />
Kinderzeit, die immer in Cafés herumsaßen und Cognac tranken. Und außerdem,<br />
welche junge Frau möchte so riechen wie die Großmutter ihres Mannes?«<br />
»Glaubst du, der Flieder ist noch da? Und die Kastanie? Das Haus. Das wäre<br />
lustig!«, sagte ich. Jetzt interessierte es mich doch, zu sehen, wie Bella gelebt hatte.<br />
Vielleicht konnten wir ja anklopfen und einen Blick in ihr Haus werfen.<br />
»Das Haus stand damals zwar noch, aber es war eine Ruine. Auch die Altstadt<br />
muss ziemlich trostlos ausgesehen haben. Im Krieg war der Park bombardiert<br />
worden. Was stehen blieb, verfiel später. Die Ostdeutschen waren an der Geschichte<br />
Halberstadts nicht sehr interessiert, jüdisch oder nicht.«<br />
»Auch die Mikwe? Die hätte ich gern gesehen.«<br />
»Dein Vater und Myrna konnten sie nicht finden. ›Ein was?‹, haben die Leute<br />
gesagt. ›Ein jüdisches Badehaus? In Halberstadt? Juden in Halberstadt?‹ Daddy<br />
erzählte, man hätte sie wie Verrückte angeschaut.« Schweigend löffelten meine<br />
Mutter und ich unsere Eisbecher, jede hing ihren eigenen Gedanken nach. Mir fiel<br />
wieder das Foto von Bella ein, das bei meiner Grandma Myrna hängt. Darauf trägt<br />
sie eines dieser formlosen Charleston-Kleider, aber man sieht doch, dass sie drall<br />
war und ziemliche Kurven hatte. Das Bild war aufgenommen worden, kurz bevor sie<br />
mit Murray, meinem zukünftigen Großvater, schwanger wurde. Mit dem Arm um ihren<br />
Mann, Sydney Brody, steht sie vor der Apotheke, die Sydney gerade in San Diego<br />
eröffnet hatte.<br />
»Also, war sie schön? Oder war sie schön?«, hatte mein Vater immer wieder<br />
gesagt.<br />
»Na ja – sie hatte auf jeden Fall große Möpse«, sagte ich.<br />
»Renée!«, rief meine Großmutter schockiert.<br />
Böse sah meine Mutter meinen Vater an. »Da siehst du’s, Bo. Hab ich’s dir<br />
nicht gesagt?«<br />
Mein Vater lachte sich schlapp. Er lachte so sehr, dass ihm die Tränen übers<br />
Gesicht liefen. Er lachte überhaupt viel und gern. Dann musste er immer seine Brille<br />
abnehmen und die Augen mit einem Tuch trocknen. Und mit einem anderen Tuch<br />
putzte er seine Brille. Das Schildpattgestell gab ihm einen intellektuellen Touch.<br />
Überhaupt sah er nicht aus wie die meisten Typen im Musikgeschäft, trug weder
Lederklamotten noch Strubbelhaar noch Gürtel mit Nieten oder Spikes, die mehr wie<br />
Folterinstrumente aus der Spanischen Inquisition aussahen als ein Modeaccessoire.<br />
Klick!<br />
Ich guckte meine Mutter an. Sie hatte gerade einen Schnappschuss von mir<br />
gemacht. Die Komposition aus Rosa und Erdbeereis.<br />
Als meine Mutter und ich zehn Jahre nach meinem Vater und meiner Großmutter<br />
nach Halberstadt kamen, freuten wir uns, dass die paar historischen Gebäude, die<br />
den Krieg und die Vernachlässigung in der DDR überstanden hatten, inzwischen<br />
restauriert worden waren.<br />
»Es sieht gar nicht mehr nach Osten aus«, sagte meine Mutter. Sie hatte Recht.<br />
Wir waren durch kleinere ostdeutsche Städte mit dem Zug gefahren, viele waren<br />
grau und farblos, ganze Stadtteile voll zerfallener Häuser, dunkel, mit ungepflasterten<br />
Straßen, in den Fabriken kein Glas in den Fenstern, stattdessen gähnende Löcher,<br />
wie Augenhöhlen in einem Totenschädel. Genauso sah das Haus von Alma und<br />
Benjamin in der Plantage Nr. 6 aus – das Skelett einer ehemals prächtigen Villa. Kein<br />
richtiger Garten, kein Fliederbusch, keine Spitzenvorhänge. Aber die Kastanie war<br />
noch da. Das zumindest war tröstlich.<br />
Die Altstadt von Halberstadt hingegen glich einem schönen alten Bild: bunt<br />
gestrichene Häuser mit roten Dächern und Fachwerk. Es sah schön aus, wirkte aber<br />
eigenartig verlassen, wie eine Geisterstadt.<br />
»Das passt«, sagte meine Mutter. »Hier gibt’s so viele Geister.«<br />
Wir schlenderten durch die engen Gassen und grüßten die stummen Geister.<br />
Juden wie die Nussbaums, die hier einmal glücklich gelebt und dann glücklich ein<br />
neues Leben in einer neuen Welt begonnen hatten. Juden, die mit ein paar hastig<br />
gepackten Habseligkeiten in Todesangst geflohen waren. Und Juden, die es nicht<br />
mehr geschafft haben, sich zu retten, die man wie Vieh zusammengetrieben und<br />
ermordet hatte. So viele Geister.<br />
Meine Geister. Meine Familie.<br />
Wir haben die Mikwe gefunden! Als im jüdischen Viertel vor ein paar Jahren<br />
Ausgrabungen gemacht wurden, hatte man sie freigelegt und das alte Badehaus zu<br />
einem Museum gemacht. Die Mikwe war eine gigantische Badewanne, fast ein<br />
Schwimmbecken. Als ich so dastand und hineinschaute, ich versuchte mir meine
Ururgroßmutter Alma hier vorzustellen. Sieben Tage nach dem Ende ihrer Regel<br />
tauchte sie ins Wasser. Sauber gewaschen und kurz vor dem Eisprung (die Gesetze<br />
der alten Juden waren gar nicht blöd!), würde sie nach Hause gehen und Sex mit<br />
ihrem Ehemann Benjamin haben. Sie würde Bella bekommen, die wiederum Murray<br />
bekam, der Bo bekam, der wiederum mich zeugte.<br />
Ich muss zugeben, dass ich mich ein wenig seltsam fühlte, als ich so dastand.<br />
Man muss sich das mal vorstellen: Ohne die Mikwe, diese unterirdisch, mit<br />
Harzwasser gespeiste Badewanne, würde es mich heute gar nicht geben.<br />
Was wohl meine Ururgroßmutter gedacht haben mochte, als sie ins Wasser<br />
tauchte? Wusste sie, dass ihr Eisprung bevorstand? Freute sie sich darauf, mit<br />
Benjamin, Dr. Benjamin Nussbaum, dem Metallurgen zu schlafen? Oder biss sie nur<br />
die Zähne zusammen, zog sich aus und ließ es über sich ergehen? Liebte sie ihn?<br />
War sie scharf auf ihn? Ich war fasziniert. Ich meine, wie viele Leute kriegen schon<br />
den Ort zu sehen, wo ihre Ururgroßmutter davon geträumt hat, was sie am Abend mit<br />
ihrem Mann im Schlafzimmer machen würde?<br />
Ein unangenehmes Rascheln riss mich aus meinen Gedanken. Ich sah meine Mutter<br />
an. Schon wieder ein neuer Müsliriegel! Das war heute ihr zweiter. Sie biss ein Stück<br />
ab. Und kaute. Einmal ... zweimal ... dreimal ... bis hin zu hundertzwölfmal gekaut ...<br />
hundertdreizehn ... Schließlich hörte sie auf zu kauen ... nein, halt! Ihre Zähne<br />
setzten sich noch mal in Bewegung ... und dann ... Schluss.<br />
Pro Riegel musste sie hundertvierzehnmal kauen. Bei mindestens zwei Riegeln<br />
am Tag zweihundertachtundzwanzigmal. Das entsprach<br />
zweitausendzweihundertachtzig in zehn Tagen. In zwanzig Tagen würde sie also<br />
mindestens viertausendfünfhundertsechzigmal Mandelmüsliriegel kauen. Kamen<br />
noch zweihundertachtundzwanzig für Tag einundzwanzig hinzu, das machte genau<br />
viertausendsiebenhundertachtundachtzig – und ich war dazu verdammt, jede<br />
einzelne Kaubewegung mitzuerleben!<br />
»Möchtest du einen?«, fragte meine Mutter.<br />
»Du weißt doch, dass ich Müsliriegel nicht ausstehen kann.« Konnte sie<br />
Gedanken lesen? Das war ja direkt unheimlich.<br />
»Renée, lass uns versuchen, das Beste aus unserer Reise zu machen«, sagte<br />
sie. »Okay? Ich möchte nicht, dass noch einmal so etwas passiert wie gestern in<br />
Tangermünde.«
Tangermünde. Das war gestern. Mittwoch. Am Sonntag waren wir in Leipzig.<br />
Montag Magdeburg. Dienstag Halberstadt. Mittwoch Tangermünde.<br />
Wir kamen mittags an. Die Stadt sah aus wie aus einem Märchenbuch: hohe<br />
Stadttore, kunstvoller gotischer Backstein, gewundene Sträßchen, Fachwerkhäuser.<br />
Ich freute mich darauf, dort herumzuspazieren, die verborgenen Stufen zu einem<br />
Verlies zu entdecken und die mittelalterlichen Folterinstrumente zu fotografieren. Ich<br />
überlegte, ob irgendwo ein Keuschheitsgürtel ausgestellt sein mochte. Das wäre<br />
doch mal was!<br />
Aber dann, als wir in der Touristeninformation waren, entdeckte ich auf einer<br />
Landkarte, dass Berlin keine hundert Kilometer von Tangermünde entfernt war. Ohne<br />
ein Wort zu sagen, packte ich meinen Rucksack und stürmte aus dem Büro, meine<br />
Mutter mir nach.<br />
»Renée, was ist los? Was soll das?«, wollte sie wissen.<br />
Die Wahrheit war, ich hätte es ihr nicht erklären können, selbst wenn ich gewollt<br />
hätte. Jetzt, mit ein wenig Abstand, glaube ich, dass ich mich einfach ärgerte. Und<br />
zwar über mich selbst. Die ganze Zeit hatte ich gehofft, dass Philipp mich einen Tag<br />
besuchen, mich einfach überraschen würde. Wie im Bus in Berlin. Dass er plötzlich<br />
wie ein edler Ritter in goldener Rüstung auftauchen und durch den mittelalterlichen<br />
Burggraben zu meinem Hotel reiten würde. Und als ich dann auf der Karte in der<br />
Touristeninformation sah, dass Berlin nur einen Katzensprung entfernt war, gab mir<br />
das einen richtigen Schlag. Warum war er nicht gekommen? Es wäre so einfach<br />
gewesen. Und dann ging mir auf: Wäre ich nicht so versessen darauf gewesen, dass<br />
er mich besucht, hätte ich draufkommen können, ihn zu besuchen.<br />
Aber dafür war es jetzt zu spät.<br />
»Was ist denn los?«, beharrte meine Mutter.<br />
»Ich will nach Hause«, sagte ich. »Ich fühle mich hier wie eingekerkert.«<br />
»Und ich bin die böse Hexe, die dich eingeschlossen hat, richtig? Ach, Renée«,<br />
sagte sie seufzend. »Das haben wir doch alles schon durchgekaut. Ich will nicht,<br />
dass du in Berlin allein bist. Kannst du die Situation nicht einfach akzeptieren? Am<br />
Sonntag sind wir am Meer. Relax.«<br />
»Du kannst relaxen. Ich gehe jetzt zurück in die Folterkammer.«<br />
»Wie bitte?«<br />
»Ich geh ins Hotelzimmer.«
Auf dem Weg zurück ins Tangermünder Hotel überlegte ich, ob ich nicht<br />
vielleicht doch nach Berlin fahren sollte. Einfach abhauen. Aber dann fiel mir ein,<br />
dass keiner meiner Freunde in der Stadt war. Philipp nicht, Alina nicht. Selbst meine<br />
Exfreundinnen Annika und Laura waren irgendwo unterwegs. Nicht zu vergessen<br />
Fritzi, die mir eine Mail geschickt hatte. Ich hatte sie entdeckt, als ich nachsah, ob mir<br />
irgendjemand (sprich Philipp) geschrieben hatte. Wie immer löschte ich Fritzis Mail,<br />
ohne sie gelesen zu haben. Ich schrieb Philipp: Tangermünde ist unglaublich! Als ob<br />
man in eine Zeitmaschine steigt und im Mittelalter aufwacht. Wünschte, du wärst hier:<br />
An die meisten Typen in dieser Stadt kommt man nämlich nicht ran. Sie tragen alle<br />
Rüstung. Haha.<br />
In Tangermünde standen die Sterne einfach nicht gut für mich: Das Schwimmbad<br />
war hoffnungslos überfüllt.<br />
Nach dem Schwimmversuch döste ich etwas und guckte fern. Gelangweilt griff<br />
ich mir Sammy und las das Kapitel: So wird ein Strip erst richtig hip! Und danach:<br />
Kann Sex allein auch besser sein? Ich probierte ein paar der Tipps aus letzterem<br />
Kapitel aus, döste dann noch ein wenig, holte mir eine doppelte Portion Wan-Tan-<br />
Suppe von einem China-Imbiss und duschte. Als ich rauskam, war der Spiegel vom<br />
Dampf beschlagen. Ich malte ein Herz auf das Glas. Und dann einen Pfeil durch das<br />
Herz. In das Herz schrieb ich Philipp & Renée 4 ever.<br />
Für immer?<br />
Ich strich das ever aus und schrieb now. Philipp & Renée 4 now. Ja, das war<br />
besser. Etwas realistischer. Nur keine zu hohen Erwartungen.<br />
Aber war es denn wirklich für jetzt? Warum war er nicht nach Magdeburg<br />
gekommen? Oder nach Halberstadt?<br />
Ich zog mein Nachthemd an und machte mich fertig fürs Bett.<br />
Als ich mir ein paar Minuten später im Bad die Haare bürstete, waren der<br />
Dampf und mein Herz spurlos in der dünnen Luft von Tangermünde verschwunden.<br />
Am nächsten Morgen wachte ich auf, als meine Mutter ins Bad ging.<br />
»Alles klar?«, rief sie gegen das Rauschen der Dusche an.<br />
Ich sagte nichts, sondern dachte: Nein, nichts ist klar. Philipp hat nicht<br />
angerufen.
»Es scheint heute wieder kühl zu werden«, sagte meine Mutter. »Und denk<br />
dran, wir treffen Oma Ulli zum Mittagessen.« Sie drehte sich zu mir um. »Zieh dir<br />
bitte was Hübsches an.«<br />
»Was soll das denn heißen? Zieh dir was Hübsches an?«<br />
Meine Mutter stellte das Wasser ab und wrang ihr Haar aus. Sie antwortete<br />
nicht gleich. »Renée, ich mein ja nur«, sagte sie dann und stieg aus der<br />
Duschkabine, »du siehst Oma Ulli nicht so oft. Also könntest du ruhig etwas Nettes<br />
anziehen.«<br />
»Hör doch auf! Dir geht’s gar nicht um Oma Ulli. Dir gefällt’s nicht, wie ich mich<br />
anziehe. Hast du Angst, wegen mir aufzufallen?«<br />
Ich sah, wie meine Mutter innerlich bis zehn zählte, bevor sie antwortete. Sie<br />
nahm ihr Handtuch und sagte gelassen: »Warum ziehst du nicht das Seidenkleid an,<br />
das Grandma Myrna dir geschickt hat? Es ist hübsch, und es macht eine gute Figur –<br />
ohne dass du halb nackt dastehst.«<br />
Ich hätte das Kleid noch nicht mal auf die Reise mitgenommen. Meine Mutter<br />
hatte es in ihren Koffer gepackt, für alle Fälle. Es war ein seidenes Hemdblusenkleid,<br />
bedruckt mit grellbunten Blumen. Sehr kalifornisch. Ich sehe darin wie eine<br />
minderjährige Hausfrau aus San Diego aus, die gerade einen Sonntagsausflug nach<br />
Seaworld macht. Im klassischen Sinn war es aber eigentlich ganz hübsch und –<br />
unter uns –, ich hatte es heute ursprünglich für meine Großmutter anziehen wollen.<br />
Hatte ich.<br />
»Ich zieh an, was ich anziehen will«, sagte ich. »Und ganz bestimmt nicht<br />
Grandma Myrnas Kleid.«<br />
Ich stürmte aus dem Bad und schnappte mir meinen Jeansrock. Er war gerade<br />
lang genug, um meinen Hintern zu bedecken – aber kurz genug, dass man zweimal<br />
guckte. Der Saum war ausgefranst, was schön trashig wirkte und super zu meinem<br />
bauchfreien, ärmellosen Che-Guevara-Oberteil passte.<br />
Ich ging zurück ins Bad. »Das ziehe ich an«, sagte ich demonstrativ.<br />
Meine Mutter setzte ihre Brille auf, schaute meinen Rock und das Top an,<br />
zuckte mit den Schultern und begann ihr Haar zu fönen.<br />
Ich drehte mich zum Spiegel, um meine Zähne zu putzen ... und bekam fast<br />
einen Herzanfall!<br />
Direkt vor uns auf dem Badezimmerspiegel waren mein Herz und mein Pfeil:<br />
Renée & Philipp 4 now. Oh nein! Durch den Dampf der Dusche war die Schrift wieder
aufgetaucht! »Scheiße!«, rief ich und griff ein Handtuch. Mit einem Wischer war das<br />
Herz weg. Zurück blieb nur das zweite P von Philipp.<br />
Endlich kam unser Zug in Hannover an. Auf dem Bahnsteig winkte uns Oma Ulli mit<br />
zwei Rosen zu.<br />
»Sie weiß, dass wir nur unterwegs sind, aber sie bringt Blumen«, sagte meine<br />
Mutter und seufzte.<br />
Oma Ulli umarmte mich. Oder besser gesagt: zerquetschte mich. Sie war nicht<br />
groß, aber breit, und ihre Brust war eine echte Waffe.<br />
»Du siehst ja halb verhungert aus«, sagte sie zu mir, öffnete die Arme und<br />
ersparte mir damit einen schrecklichen Erstickungstod. Zu meiner Mutter sagte sie:<br />
»Kriegt das Kind denn nichts zu essen?«<br />
»Mutti, bitte!«, sagte meine Mutter und hob unser Gepäck auf einen Kofferkuli.<br />
Ich zwinkerte meiner Großmutter zu. Weiter so, Oma, dachte ich. Mach ihr die<br />
Hölle heiß!<br />
Oma Ulli zwinkerte zurück. Für eine Siebzigjährige war sie ziemlich stark<br />
geschminkt: Lidschatten, Wimperntusche, Rouge, knallroter Lippenstift. Dazu trug sie<br />
noch jede Menge Modeschmuck: eine ebenso knallrote Kette mit walnussgroßen<br />
Glasperlen und ungefähr zwanzig Armreifen an jedem Handgelenk. Sie klingelten,<br />
als sie mir meine Rose entgegenstreckte.<br />
Ich roch daran. »Mmmm, die duften gut.«<br />
»Von Opas Rosenstrauch aus der Laubenkolonie.«<br />
»Mutti«, sagte meine Mutter angespannt. »Das ist eine nette Geste, aber<br />
zufälligerweise habe ich keine Vase im Koffer.«<br />
»Hast du doch!«, sagte ich und dachte an die Vase mit den Tulpen, die sie auf<br />
der Bühne benutzte.<br />
Meine Mutter schaute ungeduldig zum Himmel. »Das ist eine Bühnenrequisite.<br />
Und außerdem nicht wasserfest.«<br />
Oma Ulli beachtete sie nicht. »Dein Großvater hat den Rosenstrauch am Tag<br />
deiner Geburt gepflanzt«, sagte sie zu mir und hielt meine Hand fest. »Wenn diese<br />
Rose verwelkt ist, dann schneide die Blüte ab und leg sie in ein Buch zum Pressen.<br />
Wenn du dann irgendwann später zufällig auf sie stößt, versuch dich daran zu<br />
erinnern, wie du heute warst und wie sehr du seither gewachsen bist, wie du dich<br />
verändert hast.«
»Ach, Oma«, sagte ich bewegt, »das ist so lieb von dir.«<br />
Ich hatte diese Geschichte schon tausend Mal gehört und kann das mit<br />
mindestens doppelt so viel gepressten Rosen beweisen. Trotzdem war ich gerührt.<br />
Oma Ulli legte ihren Arm um meine Taille, und dann legte ich meinen Arm um<br />
ihre, und wir gingen zusammen zum Fahrstuhl.<br />
»Wie geht’s Tante Martha?«, fragte meine Mutter.<br />
»Den Umständen entsprechend.«<br />
Sie sprachen so leise, dass ich sie kaum verstehen konnte, obwohl ich unter<br />
meinen Fingern Oma Ullis Stimme vibrieren spürte. Ich sah auf ihren Bauch, aber er<br />
war unter dem Zelt verborgen, das sie trug. Es war eine Art Kaftan aus Polyester mit<br />
langen Schlitzen in den Ärmeln, die etwas Haut sehen ließen. Ein langes, fließendes<br />
blau-weißes Gewand mit griechischen Motiven darauf: der Akropolis, vielen Säulen,<br />
Retsinaflaschen, Ziegen, Weinblättern und ein paar Göttern – Athene, Aphrodite,<br />
Poseidon. Ein bisschen unruhig, nicht? Jedenfalls verbarg der Schnitt dieses<br />
Gewandes das meiste von ihr. Mit Ausnahme ihres Busens – der ließ sich einfach<br />
nicht verstecken. Kurz überlegte ich, wie sie sich BHs kaufte. Gab es ihre Größe im<br />
Laden oder musste sie sich extra welche anfertigen lassen?<br />
Oma Ulli küsste mich auf die Wange. »Ach, ist das schön, dich zu sehen!<br />
»Schhhh!«, schnappte meine Mutter. »Sei doch nicht so laut.«<br />
»Sie hat Kopfschmerzen«, sagte ich.<br />
»Oh, ich werde dich massieren«, sagte Oma Ulli.<br />
Meine Mutter verzog das Gesicht.<br />
Ja, meine Großmutter war laut. Auffallend. Was die Mode betraf jenseits von<br />
Gut und Böse. Aber sie war einfach toll.<br />
»Schön, dass du’s luftig hast«, sagte meine Großmutter und tätschelte meinen<br />
Bauch.<br />
»Du auch«, sagte ich und zeigte auf ihre Ärmel.<br />
Sie zündete sich eine Zigarette an. »Der Trick, meine kleine Schnecke, ist,<br />
immer das richtige Stück Haut zur richtigen Zeit zu zeigen: Wer blutjung ist, kann sich<br />
bauchfrei und Mini leisten, Frauen in den besten Jahren zeigen ihr Dekolleté – und<br />
Alte den Ellenbogen.« Sie hustete.<br />
»Mutti«, sagte meine Mutter mit einem Blick auf die Zigarette.<br />
Meine Großmutter, die als die einzige rauchende Atemtherapeutin der Welt in<br />
die Annalen der Geschichte eingehen wird, musterte jetzt meine Mutter in ihrem
formlosen Leinenkleid und dem langen Chiffonschal. »Du, meine Liebe, bist<br />
eigentlich in der Dekolleté-Phase.«<br />
nicht?«<br />
»Mutti, bitte!«, sagte meine Mutter. »Ich bin auf Lesereise, verstehst du das<br />
Meine Großmutter und ich warfen uns Blicke zu, aber ich hing bald meinen<br />
eigenen Gedanken nach. Der genervte Ton meiner Mutter kam mir bekannt vor. Und<br />
dann ging es mir schlagartig auf. Natürlich. Sie klang genau wie ich.<br />
»Schau dir ihre Augen an, Edda. Das sind die von Papa. Und seine hohen<br />
Wangenknochen hat sie auch.«<br />
Meine Mutter blickte von ihrem Reiseplan auf. »Hmm, ja«, sagte sie, in<br />
Gedanken ganz woanders. Sie sah auf die Uhr an der Wand. »In zwanzig Minuten<br />
müssen wir los, Mutti.«<br />
»Und diese Haare«, sagte meine Oma und fuhr mir durch meine dunklen<br />
Haare. »Solche tollen Haare. Und die ganze Mundpartie. Die Lippen, feine schmale<br />
Lippen, genau wie er.«<br />
»Schmale Lippen!«, schrie ich beleidigt auf. »Du hast doch einen Knick in der<br />
Optik! Ich hab volle Lippen!«<br />
»Ich glaube, Mutti«, sagte meine Mutter, »da bist du ins Fettnäpfchen<br />
getreten.«<br />
»Hältst du dich da bitte raus?«, sagte ich zu meiner Mutter.<br />
Ihre Augen wurden ganz groß. Die meiner Oma womöglich noch größer. Sie<br />
zog mich an sich. Sie roch gut. Wie unser Weichspüler mit Apfelblüten- und<br />
Vanilleduft.<br />
»Renée, du bist eine große Schönheit«, sagte Oma Ulli. »Selbst wenn du<br />
deinem Opa ähnlich siehst, Gott hab ihn selig.«<br />
Oma Ulli sah meine Mutter an.<br />
Meine Mutter schaute weg.<br />
»Vielleicht sollte ich euch zwei allein lassen, damit ihr in Ruhe über mich reden<br />
könnt«, sagte ich.<br />
»Renée«, begann meine Mutter.<br />
»Edda!«, unterbrach meine Großmutter. »Lass mich mal.« Sie zeigte auf<br />
meinen Teller. »Du hast ja kaum was gegessen, Renée.« Sie sah meine Mutter an.<br />
»Edda, isst sie immer wie ein Spatz?«
»Es schmeckt mir nicht, das ist alles«, sagte ich und verzog das Gesicht beim<br />
Anblick des halb verspeisten, von Apfelmus durchweichten und<br />
mikrowellenverstrahlten Kartoffelpuffers.<br />
»Du bist doch nur Haut und Knochen«, sagte Oma Ulli. Sie sah wieder meine<br />
Mutter an. »Habt ihr euch eigentlich ständig in der Wolle?«<br />
Mir war nicht ganz klar, wen sie das fragte.<br />
»Ich wusste, dass du wieder damit anfangen würdest, Mutti«, sagte meine<br />
Mutter. »Überlass das mir. Okay? Uns geht’s gut. Alles im grünen Bereich. Es ist nur<br />
... nur ...« Sie sah mich an. »Es ist nur die Pubertät.«<br />
»Die Pubertät?«, schrie ich auf. »Und was ist mit dir? Vielleicht sind die<br />
Wechseljahre schuld!«<br />
»Hört auf, ihr beiden«, sagte Oma Ulli.<br />
»Mutti, bitte!«, sagte meine Mutter streng.<br />
Oma Ulli achtete nicht auf sie und nahm meine Hände. Ihre waren warm. Und<br />
stark. »Wie geht es dir?«, fragte sie leise, fast flüsternd. Sie sah mich forschend an.<br />
Und plötzlich fühlte ich den harten Klumpen in meinem Hals. Größer als je<br />
zuvor.<br />
»Ach, meine kleine Schnecke«, sagte sie und strich mir über die Wange.<br />
Ich nahm all meine Kraft zusammen, um den Klumpen herunterzuschlucken.<br />
Meine Großmutter schien das zu spüren, denn sie legte mir eine Hand in den Nacken<br />
und drückte mit der anderen vorsichtig auf meinen Brustkorb. »Du musst es<br />
herauslassen. Du musst wieder anfangen zu atmen.«<br />
Ich holte tief Luft – aber nicht, weil sie das wollte, sondern weil ich nur so die<br />
Tränen unterdrücken konnte.<br />
»Renée«, sagte Oma Ulli, »deine Mutter will dich nicht unter Druck setzen, aber<br />
...«<br />
»Hör auf damit!«, fauchte meine Mutter. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich<br />
nicht ...«<br />
»Was hat sie dir erzählt?«, fragte ich meine Oma. »Was?«<br />
»Sie hat mir gar nichts erzählt. Außerdem hätte sie mir nichts erzählen können,<br />
was ich nicht ohnehin schon wüsste.« Meine Großmutter drückte meine Hand.<br />
»Schneckelchen«, sagte sie, »du musst es rauslassen. Wenn du es nicht rauslässt,<br />
wird der Schmerz für immer an deinem Herzen nagen.«