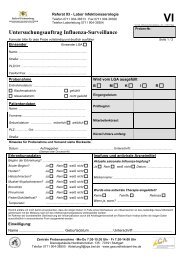Praxishefte • Band 4 Gesunde Kinder – gleiche Chancen für alle?
Praxishefte • Band 4 Gesunde Kinder – gleiche Chancen für alle?
Praxishefte • Band 4 Gesunde Kinder – gleiche Chancen für alle?
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
lögd Landesinstitut<br />
<strong>für</strong> den Öffentlichen<br />
Gesundheitsdienst NRW<br />
ISBN 3-88139-092-8<br />
lögd<br />
<strong>Gesunde</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>–</strong> <strong>gleiche</strong> <strong>Chancen</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>? <strong>•</strong> Ein Leitfaden <strong>für</strong> den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Förderung gesundheitlicher Teilhabe<br />
<strong>Gesunde</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>gleiche</strong> <strong>Chancen</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>?<br />
lögd: <strong>Praxishefte</strong> <strong>•</strong> <strong>Band</strong> 4<br />
Ein Leitfaden <strong>für</strong> den Öffentlichen<br />
Gesundheitsdienst zur Förderung<br />
gesundheitlicher Teilhabe<br />
lögd<br />
Landesinstitut<br />
<strong>für</strong> den Öffentlichen<br />
Gesundheitsdienst NRW
<strong>Gesunde</strong> <strong>Kinder</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>gleiche</strong> <strong>Chancen</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>?<br />
Ein Leitfaden <strong>für</strong> den Öffentlichen Gesundheitsdienst<br />
zur Förderung gesundheitlicher Teilhabe<br />
von<br />
Jutta Kamensky<br />
unter Mitarbeit von<br />
Dr. Andreas Mielck<br />
Dr. Antje Richter<br />
Monika Gickeleiter
Impressum:<br />
Herausgeber:<br />
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg und Landesinstitut <strong>für</strong> den Öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd)<br />
Druck und Verlag:<br />
Landesinstitut <strong>für</strong> den Öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd)<br />
Leitung: Dr. Helmut Brand<br />
Westerfeldstr. 35-37<br />
33611 Bielefeld<br />
Telefon 0521/8007-0<br />
Telefax 0521/8007-200<br />
Redaktion: Manfred Dickersbach (lögd), Barbara Leykamm (Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg),<br />
Gestaltung: Evi Buschlinger, Martina Stille<br />
Die Fotos sind Teil der Wanderausstellung „Kennen wir uns? Straßenkinder fotografieren ihre Welt“ - eine Aktion von<br />
Off-Road-Kids e.V. und Vodafone. Weitere Infos: www.offroadkids.de<br />
Das lögd ist eine Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen und gehört zum Geschäftsbereich des Ministeriums <strong>für</strong> Gesundheit,<br />
Soziales, Frauen und Familie.<br />
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung von lögd und Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.<br />
ISBN 3-88139-116-9<br />
Bielefeld, 2003<br />
Kontakt Baden-Württemberg:<br />
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg<br />
Wiederholdstr. 15<br />
70174 Stuttgart<br />
Telefon 0711/1849-326<br />
Telefax 0711/1849-325<br />
E-mail: leykamm@lga.bwl.de<br />
www.landesgesundheitsamt.de
Inhaltsverzeichnis<br />
Zur Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
Kapitel 1 Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
1.1 Soziale Ungleichheit - ein Einstieg ins Thema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
1.2 Gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland: Daten und Fakten . . . . . . . . . . . 11<br />
1.3 Soziale Ungleichheit vor Ort: Daten und Fakten aus Nordrhein-Westfalen<br />
und Baden-Württemberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
1.4 Ansätze zur Erklärung und Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit . . 23<br />
Kapitel 2 <strong>Kinder</strong> und Jugendliche - die wichtigste Zielgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
2.1 Soziale Ungleichheit und die Folgen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
<strong>–</strong> eine Einstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
2.2 Gesundheitsverhalten von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
<strong>–</strong> das Beispiel Ernährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
2.3 Risiko Alleinerziehen: Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen aus<br />
Ein-Eltern-Familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
2.4 Strategien und Ressourcen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zur<br />
Bewältigung von Armut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
Kapitel 3 Hilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
3.1 <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> benachteiligte <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche: Zielbereiche und Leitsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
3.2 Das professionelle Hilfesystem - was es (nicht) leistet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
3.3 Wenn Hilfe nicht ankommt - Barrieren <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung . . . . . . . . . 56<br />
3.4 Die Rolle des ÖGD im Hilfesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />
Kapitel 4 Die lokale Praxis oder „Wie gehen Sie vor?“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
4.1 Sie machen eine Bestandsaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />
4.2 Sie finden Prioritäten und planen Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />
4.3 Sie bringen Ihr Projekt in die Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />
Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
3
4<br />
Teil I. Zur Einführung<br />
Zur Einführung<br />
Armut und soziale Benachteiligung sind auch in unserer Wohlstandsgesellschaft keine Fremdwörter<br />
mehr. Dies ist nicht erst seit Erscheinen des Armutsberichts der Bundesregierung so.<br />
Auch wenn Armut unterschiedlich definiert werden kann <strong>–</strong> soziale Benachteiligung wird im gesellschaftlichen<br />
Alltag zunehmend sichtbar; die Schere zwischen Arm und Reich klafft offensichtlich<br />
immer weiter auseinander.<br />
Davon bleibt auch der Gesundheitsbereich nicht unberührt. Der Zusammenhang zwischen<br />
Armut und Reichtum, Krankheit und Gesundheit ist mittlerweile kaum noch zu bestreiten. Unbestreitbar<br />
ist aber auch, dass das große Thema Armut und Gesundheit nicht mehr in den engen<br />
Grenzen des Gesundheitssektors zu bewältigen ist. Hier ist ein bereichs- und politikfelderübergreifendes<br />
Vorgehen angezeigt; die gesamtgesellschaftliche Dimension des Themas ist in übergreifenden<br />
strukturbezogenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Gesundheitsförderung und -versorgung<br />
müssen sich mit Jugendhilfe und Drogenprävention, mit Wohlfahrtsverbänden, mit<br />
Handlungsfeldern des Sozial- und Umweltbereichs, aber auch des Wohnungsbaus, der Raumplanung<br />
oder der Wirtschaftsentwicklung sinnvoll verzahnen.<br />
Dem Öffentlichen Gesundheitsdienst kommt hierbei eine besondere Rolle zu. Nicht nur,<br />
weil er die Geschäftsführung bzw. Koordination der kommunalen Gesundheitskonferenzen oder<br />
Regionalen Arbeitsgemeinschaften innehat, zur Bündelung der Kräfte im Gesundheitswesen<br />
beitragen und wichtige Steuerungsimpulse geben kann. Sondern auch, weil er aufgrund seiner<br />
Einbindung in die kommunale Verwaltung prädestiniert ist, Brücken herzustellen <strong>–</strong> zu anderen<br />
Bereichen von Politik und Administration, aber auch zwischen handelnder Basis und den lokalen<br />
Gremien der Planung und Entscheidungsfindung. Der ÖGD transportiert das Thema Armut<br />
und Gesundheit auf die politische Ebene. Er vertritt die Forderung nach einer Verringerung der<br />
sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit auf <strong>alle</strong>n Schauplätzen gesundheitspolitischer Diskussion<br />
<strong>–</strong> in konkreten Basisprojekten, in Ausschüssen, verwaltungsintern, bereichsübergreifend<br />
im Gesundheitswesen, politikfelderübergreifend etwa in Prozessen der Stadtentwicklungsplanung.<br />
Er kann dazu beitragen, das kommunalpolitische Klima zu prägen, zu wandeln und den<br />
Gedanken einer gemeinschaftlichen Verantwortung <strong>für</strong> sozial Benachteiligte weiter zu verankern.<br />
Deshalb haben wir in diesem Praxisheft die Rolle des ÖGD (wieder) besonders hervorgehoben.<br />
Sicher gehört einiges der oben skizzierten Rollenbeschreibung noch in den Bereich der<br />
Zukunftsvision. Wir wollen aber mit unserem Heft erste Schritte in diese Richtung aufzeigen,<br />
dabei den gegebenen Rahmen und die in <strong>alle</strong>r Regel begrenzten Ressourcen <strong>–</strong> kurz: das Machbare<br />
<strong>–</strong> nicht aus dem Auge verlieren.<br />
Gleichzeitig setzen wir einen Schwerpunkt, der uns aus pragmatischen und inhaltlichen<br />
Überlegungen <strong>gleiche</strong>rmaßen geboten scheint <strong>–</strong> wir konzentrieren uns auf die Gesundheit von<br />
sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Gesellschaftlicher Frieden, Stabilität und allgemeine<br />
Lebenszufriedenheit in unserem Land hängen wesentlich davon ab, ob es gelingt,<br />
nachwachsenden Generationen gleichverteilte <strong>Chancen</strong> zu bieten <strong>–</strong> auf Wohlstand, Integration,<br />
gesellschaftliche Anerkennung und natürlich auch Gesundheit.<br />
Dabei ist es uns <strong>–</strong> wie immer bei den <strong>Praxishefte</strong>n <strong>–</strong> wichtig, Theorie und Praxis zu verbinden,<br />
erarbeitetes Know-How zugänglich zu machen und Einsteigern und „alten Hasen“ gleich-
Teil I. Zur Einführung<br />
ermaßen nützlich zu sein. Wir akzeptieren dabei notgedrungen, dass nicht jeder Leser von jedem<br />
Kapitel gleichviel profitiert. Zögern Sie deshalb nicht, das Heft <strong>für</strong> sich zu einem Steinbruch zu<br />
machen, und greifen Sie die Abschnitte heraus, die Ihnen hilfreich sind. Wir haben uns bemüht,<br />
die einzelnen Kapitel <strong>für</strong> sich stehen zu lassen und auch <strong>für</strong> diejenigen verständlich zu gestalten,<br />
die das Heft nicht von Seite 1 an durcharbeiten wollen.<br />
Wir sind uns bewusst, dass wir mit dem Thema „Gesundheit <strong>für</strong> sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong><br />
und Jugendliche“ ein breites Feld aufgreifen und ein ehrgeiziges Ziel in Angriff nehmen.<br />
Nennenswerte Fortschritte können auf Dauer nur durch Bündelung der Kräfte innerhalb und<br />
außerhalb des Gesundheitswesens und durch neue politische Prioriäten erreicht werden. Aber<br />
auch hier liegt der Anfang im Kleinen. Bezogen auf die Rolle des ÖGD wollen wir den Einstieg<br />
ins Thema veranschaulichen, erleichtern und zur Initiative ermutigen.<br />
Jutta Kamensky, Barbara Leykamm, Manfred Dickersbach<br />
Ulm, Stuttgart, Bielefeld im Januar 2003<br />
5
6<br />
Notizen
Ruth Wir müssen draußen bleiben?<br />
Foto: www.offroadkids.de<br />
7
8<br />
Soziale Ungleichheit in<br />
Deutschland<br />
Definitionen von Armut<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
1. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
1.1 Soziale Ungleichheit <strong>–</strong> ein Einstieg ins Thema<br />
1.2 Gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland: Daten und Fakten<br />
1.3 Soziale Ungleichheit vor Ort: Daten und Fakten aus Nordrhein-Westfalen<br />
und Baden-Württemberg<br />
1.4 Ansätze zur Erklärung und Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit<br />
1.1 Soziale Ungleichheit <strong>–</strong> ein Einstieg ins Thema<br />
Notleidende Familien in den Ländern der Dritten Welt, Straßenkinder in Südamerika und die<br />
Opfer von Kriegen und anderen Katastrophen prägen unser Bild von „Armut“. Dieser Eindruck<br />
von Armut in Verbindung mit Hunger, Elend und Obdachlosigkeit macht es schwer, zu glauben,<br />
dass selbst in Deutschland Menschen am Existenzminimum leben. Armut klopft aber mittlerweile<br />
auch an die Türen des Wohlstands. Sie hat hier nur andere Dimensionen und Bezugsgrößen<br />
als in Ländern der Dritten Welt (Gillen/Möller 1992).<br />
Einen allgemeingültigen Maßstab <strong>für</strong> Armut <strong>–</strong> d.h. eine verbindliche offizielle Armutsgrenze<br />
gibt es in Deutschland bislang nicht. Je nach Interessenlage finden unterschiedliche Konzepte<br />
Anwendung, die sich im Wesentlichen an der Verfügbarkeit materieller Ressourcen orientieren.<br />
Gesellschaftliche oder politische Akteure legen in der Regel die Grenze fest, ab wann ein<br />
Mensch von Armut betroffen ist (Kamensky/Zenz 2001). Das stimmt bedenklich, weil das Verfahren<br />
zur Messung einen erheblichen Einfluss auf Umfang und Struktur des Armutspotentials<br />
hat (Hanesch et al. 2000).<br />
Armut in Deutschland ist eine relative Größe, d.h. ob Familien und Haushalte als arm zu bezeichnen<br />
sind, hängt davon ab, in welcher Lebenslage sie sich relativ zum Wohlfahrtsstandard<br />
der Gesamtbevölkerung befinden.<br />
Relative Armut nach der Definition des Rates der EU von 1984<br />
„Relativ arm“ sind Personen oder Familien, die über so geringe Mittel verfügen,<br />
dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat,<br />
in dem sie leben, als annehmbares Minimum gesehen wird.<br />
Einkommensarmut<br />
Einkommensarm sind Personen oder Familien, wenn sie über weniger als<br />
50 % des durchschnittlichen Nettoeinkommens in der Bundesrepublik<br />
Deutschland verfügen.
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Politisch-normative Armut<br />
Arm ist, wer Anspruch auf Sozialhilfe hat. Der Indikator <strong>für</strong> Armut ist hier<br />
insbesondere der Bezug der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt. Als Bemessungsgrundlage<br />
<strong>für</strong> die Sozialhilfe gelten 40 % des durchschnittlichen<br />
Nettoeinkommens (Hartmann 1986).<br />
Verdeckte Armut<br />
Wer über weniger als 40 % des Durchschnittseinkommens verfügt und<br />
trotzdem beim Sozialamt keine Hilfe zum Lebensunterhalt beantragt, ist<br />
„verdeckt arm“. Es wird geschätzt, dass die Dunkelziffer bei ca. 50 % liegt.<br />
D.h. die Hälfte <strong>alle</strong>r sozialhilfeberechtigten Haushalte ziehen es vor, ohne<br />
die staatliche Unterstützung zu existieren, aus welchen Gründen auch immer<br />
(Hartmann 1981; Hauser/Hübinger 1993; Neumann/Hertz 1998).<br />
Arm nach dem Lebenslagenkonzept<br />
Armut ist ein mehrdimensionales Phänomen, denn neben dem Einkommen<br />
umfasst die Lebenslage einer Person noch weitere Dimensionen wie Wohnen,<br />
Bildung, Gesundheit, Familiensituation, Freizeit und soziales Netzwerk.<br />
Eine „Unterversorgung“ liegt vor, wenn der Handlungsspielraum<br />
von Personen eingeschränkt ist und eine gleichberechtigte Teilhabe an den<br />
Aktivitäten und Lebensbedingungen der Gesellschaft unmöglich ist. Arm<br />
nach dem Lebenslagenkonzept sind Menschen dann, wenn sie in einem<br />
oder in mehreren Lebensbereichen unterversorgt sind (Döring et al. 1990;<br />
Bundesministerium 2001).<br />
In der Bundesrepublik Deutschland geht es weniger um Armut als „Kampf um das rein physische<br />
Überleben“. Vielmehr steht die zunehmende soziale Ungleichheit in der Bevölkerung im<br />
Blickpunkt, sowie der damit verbundene un<strong>gleiche</strong> Zugang zu (u.a. gesundheitlichen) Gütern,<br />
Dienstleistungen und <strong>Chancen</strong> und die Nachteile, die das <strong>alle</strong>s mit sich bringt.<br />
In den letzten Jahren wurden diverse Berichte über das Ausmaß der Einkommens-Armut in<br />
Deutschland publiziert. Hervorzuheben sind hier v.a. die drei folgenden:<br />
<strong>•</strong> Armutsbericht der Hans-Böckler-Stiftung, des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands<br />
(Hanesch et al. 2000)<br />
<strong>•</strong> Erster Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (vorgelegt im April 2001).<br />
<strong>•</strong> Sozialbericht 2000 der Arbeiterwohlfahrt (AWO): „Gute Kindheit <strong>–</strong> Schlechte Kindheit. Armut<br />
und Zukunftschancen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen in Deutschland“ (vorgelegt im<br />
Oktober 2000).<br />
Im Armutsbericht von W. Hanesch et al. (2000) wird Einkommens-Armut z.B. über den allgemein<br />
üblichen Indikator „50% oder weniger des durchschnittlichen Netto-Haushaltseinkommens“<br />
definiert, wobei in die Berechnung des „gewichteten Pro-Kopf-Einkommens“ (in der<br />
wissenschaftlichen Terminologie auch „Äquivalenz-Einkommen“ genannt) sowohl Anzahl als<br />
auch Alter der Haushaltsmitglieder eingehen (ebenda, S. 51). Im Jahr 1998 verfügten die Haus-<br />
9
10<br />
Ausmaß der sozialen<br />
Ungleichheit<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche sind<br />
besonders häufig von Armut<br />
betroffen<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
halte in Deutschland über ein „gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen“ von durchschnittlich 1.062<br />
Euro (2.077 DM). Die Armutsgrenze lag somit bei 530 Euro (1.038,50 DM) (ebenda, S. 54).<br />
Nach diesen Berechnungen waren 1998 in Deutschland ca. 9,1 % der Bevölkerung von Einkommens-Armut<br />
betroffen. Die Unterteilung nach Altersgruppen zeigt ein eindeutiges Bild: Die<br />
Einkommens-Armut von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen hat in Deutschland in den letzten Jahren erheblich<br />
zugenommen. Sie ist mit 14,2 % am höchsten, und mit zunehmendem Alter sinkt die Armutsquote<br />
kontinuierlich ab bis hin zu 3,3 % bei den über 76-Jährigen (vgl. Tabelle 1).<br />
Tabelle 1: Einkommens-Armut in Deutschland, 1998 (Angaben in %)<br />
Anteil in der Bevölkerung Anteil in Einkommens-<br />
Armut a<br />
Bevölkerung insgesamt<br />
Alter<br />
100 9,1<br />
- bis 15 Jahre 17,1 14,2<br />
- 16 bis 30 Jahre 18,1 13,2<br />
- 31 bis 45 Jahre 23,8 9,1<br />
- 46 bis 60 Jahre 19,8 6,0<br />
- 61 bis 75 Jahre 15,5 4,8<br />
- 76 Jahre und älter 5,7 3,3<br />
Haushaltsgröße<br />
- 1 Person 16,3 7,2<br />
- 2 Personen 29,0 5,0<br />
- 3 Personen 20,1 8,0<br />
- 4 Personen 23,0 10,4<br />
- 5 oder mehr Personen 11,6 21,4<br />
Haushaltstyp<br />
- Single 16,9 7,2<br />
- Paar, ohne mindj. Kind(er) 26,5 3,7<br />
- Paar, mit mindj. Kind(ern) 37,8 11,9<br />
- Eineltern, mit mindj. Kind(ern) 3,5 29,9<br />
- Eineltern, mit erw. Kind(ern) 15,3 8,9<br />
a: 50 % oder weniger des durchschnittlichen Netto-Haushaltseinkommens<br />
Quelle: Hanesch et al. 2000 (S. 81-83)<br />
Die Unterteilung nach Haushaltsgröße und -typ (vgl. Tabelle 1) bietet eine erste Antwort auf die<br />
Frage, warum die Einkommens-Armut vor <strong>alle</strong>m bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen so verbreitet ist:<br />
große Familien, Paare mit <strong>Kinder</strong>n und vor <strong>alle</strong>m Alleinerziehende leben besonders häufig am<br />
Existenzminimum.<br />
Auch andere Berichte weisen immer wieder darauf hin, dass die Einkommens-Armut bei<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen besonders groß ist. Im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung<br />
wird Einkommens-Armut u.a. über den Indikator „Empfang von Sozialhilfe“ definiert:<br />
„Unter den Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt waren <strong>Kinder</strong> unter 18 Jahren mit rd.<br />
1,1 Million die größte Gruppe. Die Sozialhilfequote von <strong>Kinder</strong>n unter 18 Jahren war mit 6,8 %<br />
fast doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt und hat sich seit 1982 im früheren
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Bundesgebiet mehr als verdreifacht. (...) Das mit Abstand höchste Sozialhilferisiko (28,1 %)<br />
hatten Haushalte <strong>alle</strong>inerziehender Frauen. Mehr als die Hälfte <strong>alle</strong>r <strong>Kinder</strong> unter 18 Jahren im<br />
Sozialhilfebezug wuchs im Haushalt von Alleinerziehenden auf“ (S. XXII).<br />
Die Ursachen, weswegen immer mehr deutsche Bürgerinnen und Bürger einkommensarm<br />
sind, liegen hauptsächlich in Arbeitslosigkeit, <strong>Kinder</strong>reichtum, Alleinerziehen und Nationalität<br />
begründet. Als das größte Risiko, den Lebensunterhalt nicht mehr ausreichend aus eigener Kraft<br />
finanzieren zu können, gilt der Verlust des Arbeitsplatzes. Da es sich bei Arbeitslosen häufig um<br />
Personen handelt, die eine Familie oder wenigstens eine „Teil-Familie“ haben, sind so auch die<br />
<strong>Kinder</strong> von der finanziellen Not ihrer Eltern betroffen. Im Jahr 1996 gab es in Deutschland z.B.<br />
1,8 Millionen <strong>Kinder</strong> unter 18 Jahren, von denen ein oder beide Elternteile keine Arbeit hatten<br />
(Klocke/Hurrelmann 1998).<br />
Scheidung bzw. Trennung kommen als weitere Ursache <strong>für</strong> das Leben am Existenzminimum<br />
hinzu. Ebenso birgt die Geburt eines Kindes ein Armutsrisiko. Bei zwei Drittel <strong>alle</strong>r geschiedenen<br />
Ehen sind <strong>Kinder</strong> mitbetroffen. Selbst wenn <strong>alle</strong>inerziehende Mütter oder Väter berufstätig<br />
sind, bedeutet das <strong>–</strong> aufgrund der häufig niedrigen Lohnsätze <strong>–</strong> oft noch keine Lösung der finanziellen<br />
Misere. Armut in Deutschland ist auch eine Armut von Familienhaushalten. <strong>Kinder</strong> kosten<br />
Geld und werden so zum „Einkommensproblem“ der Eltern. Pro Monat benötigen Eltern <strong>für</strong> ein<br />
Kind zwischen 250 und 400 Euro, was in kinderreichen Familien gewaltig am Budget zehrt<br />
(Deutscher <strong>Kinder</strong>schutzbund 1998). <strong>Kinder</strong>reichtum gilt deshalb als weiterer Risikofaktor <strong>für</strong><br />
Armut. Überdurchschnittlich von Armut betroffen sind die Haushalte von ausländischen Mitbürgern<br />
<strong>–</strong> nicht zuletzt deshalb, weil diese Familien einen großen Teil der sogenannten „kinderreichen<br />
Familien“ ausmachen. Zwei- bis dreimal höher als die Quote der Gesamtbevölkerung stellen<br />
sich die Armutsquoten von Ausländern, aber auch von Spätaussiedlern dar. Besonders betroffen<br />
vom Leben am Existenzminimum sind die türkischen Mitbürger (Hanesch et al. 2000).<br />
Dem Sozialbericht 2000 der Arbeiterwohlfahrt liegt als Definition von Armut der Lebenslagenansatz<br />
zugrunde. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: „Wie erlebt ein Kind die Armut?“<br />
Demnach besteht die Armut bei <strong>Kinder</strong>n aus den folgenden fünf Komponenten:<br />
<strong>•</strong> niedriges Einkommen<br />
<strong>•</strong> unzureichende materielle Grundversorgung (Wohnen, Nahrung, Kleidung etc.)<br />
<strong>•</strong> unzureichende Förderung der kognitiven, sprachlichen und kulturellen Kompetenzen<br />
<strong>•</strong> unzureichende Förderung der sozialen Kontakte und der sozialen Kompetenzen<br />
<strong>•</strong> unzureichende Förderung der körperlichen Entwicklung, schlechter Gesundheitszustand<br />
Fazit und Ausgangslage <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung von sozial benachteiligten<br />
Menschen:<br />
Wieviele Menschen sind von sozialer Ungleichheit betroffen (im Jahr 1998)?<br />
<strong>•</strong> 9,1 % der deutschen Bevölkerung sind einkommensarm.<br />
<strong>•</strong> 14,2 % der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen wachsen in einkommensarmen<br />
Familien auf.<br />
<strong>•</strong> 1,1 Millionen <strong>Kinder</strong> unter 18 Jahren leben von Sozialhilfe.<br />
<strong>•</strong> 17 % <strong>alle</strong>r Familien in Deutschland sind Ein-Eltern-Familien.<br />
<strong>•</strong> Ein Drittel <strong>alle</strong>r Ein-Eltern-Familien bezieht Sozialhilfe.<br />
11<br />
<strong>Kinder</strong>armut in Deutschland<br />
<strong>–</strong> Warum?
12<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Welche Zielgruppen ergeben sich <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung?<br />
<strong>•</strong> Angehörige aus einkommensarmen Familien<br />
<strong>•</strong> Arbeitslose und Familienangehörige<br />
<strong>•</strong> Alleinerziehende<br />
<strong>•</strong> <strong>Kinder</strong>reiche Familien<br />
<strong>•</strong> Ausländische Mitbürger(innen)<br />
Zum Vertiefen:<br />
AWO Bundesverband e.V. (2000): AWO-Sozialbericht 2000. Gute Kindheit <strong>–</strong> Schlechte Kindheit.<br />
Armut und Zukunftschancen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen in Deutschland. Bonn<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (2001): Lebenslagen in Deutschland.<br />
Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn<br />
Deutscher <strong>Kinder</strong>schutzbund Bundesverband e.V., Hannover; Volkswagen AG, Kommunikation<br />
Wolfsburg (Hrsg.) (1998): Taschenbuch der <strong>Kinder</strong>presse. Remagen-Rolandseck<br />
Döring, D.; Hanesch, W.; Huster, E.U. (Hrsg.) (1990): Armut im Wohlstand. Frankfurt/Main<br />
Gillen, G.; Möller, M. (1992): Anschluß verpaßt. Armut in Deutschland. Bonn<br />
Hanesch, W.; Krause, P.; Bäcker, G.; Maschke, M.; Otto, B. (2000): Armut und Ungleichheit<br />
in Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans-Böckler-Stiftung, des DGB und des Paritätischen<br />
Wohlfahrtsverbands. Reinbek<br />
Hartmann, H. (1981): Sozialhilfebedürftigkeit und „Dunkelziffer der Armut“. Schriftenreihe<br />
des Bundesministers <strong>für</strong> Jugend, Familie und Gesundheit. <strong>Band</strong> 98. Stuttgart<br />
Hartmann, H. (1986): Offizielle und alternative Armutsgrenzen in der Bundesrepublik. In:<br />
Blätter der Wohlfahrtspflege. 133. Jg. S. 259-261<br />
Hauser, R.; Hübinger, W. (1993): Arme unter uns. Teil 1: Ergebnisse und Konsequenzen der<br />
Caritas-Armutsuntersuchung. Hrsgg. vom Deutschen Caritasverband. Freiburg im Breisgau<br />
Kamensky, J.; Zenz, H. (2001): Armut <strong>–</strong> Lebenslagen und Konsequenzen. Ursachen, Ausmaß<br />
und Bewältigung sozialer Ungleichheit am Beispiel des Landkreises Neu-Ulm. Ulm<br />
Klocke, A., Hurrelmann K. (Hrsg.) (1998): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. Opladen<br />
Neumann, U.; Hertz, M. (1998): Verdeckte Armut in Deutschland. Forschungsbericht im Auftrag<br />
der Friedrich-Ebert-Stiftung. ISL Institut <strong>für</strong> Sozialberichterstattung und Lebenslagenforschung.<br />
Frankfurt am Main
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
1.2 Gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland: Daten und Fakten<br />
Gesundheitliche Ungleichheit beschreibt den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und<br />
Gesundheitszustand. Die Ergebnisse verschiedener Berichte über Art und Ausmaß der gesundheitlichen<br />
Ungleichheit zeigen deutlich, dass Personen mit niedrigem sozio-ökonomischen Status<br />
zumeist eine besonders hohe Mortalität und Morbidität aufweisen (Mielck 2000a; Helmert<br />
et al. 2000; Laaser et al. 2000; Mielck 2000b; Mielck/Bloomfield 2001).<br />
<strong>•</strong> Erwachsene ohne Abitur weisen eine kürzere Lebenserwartung auf als Erwachsene mit Abitur,<br />
<strong>•</strong> die Sterblichkeit bei Un- und Angelernten ist höher als bei oberen Angestellten,<br />
<strong>•</strong> die Sterblichkeit in der unteren Einkommensgruppe ist höher als in der oberen,<br />
<strong>•</strong> die Überlebenszeit nach einem Erst-Infarkt bei Erwachsenen mit geringem beruflichen Status<br />
ist kürzer als bei Erwachsenen mit höherem beruflichen Status.<br />
<strong>•</strong> Erwachsene mit Haupt- oder Realschulabschluss erleiden häufiger einen Herzinfarkt als Erwachsene<br />
mit Abitur oder Fachhochschulabschluss,<br />
<strong>•</strong> die Prävalenz psychischer Störungen bei Erwachsenen ist mit niedrigem beruflichen Status<br />
größer als bei Erwachsenen mit höherem beruflichen Status,<br />
<strong>•</strong> Erwachsene aus der unteren Einkommensgruppe antworten bei der Frage nach dem allgemeinen<br />
Gesundheitszustand häufiger mit „schlecht“ als Erwachsene aus der oberen Einkommensgruppe,<br />
<strong>•</strong> <strong>alle</strong>inerziehende Mütter weisen eine höhere Morbidität auf als die anderen Mütter.<br />
Gesundheitliche Ungleichheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
Studien zur gesundheitlichen Ungleichheit beziehen sich meist auf die Altersspanne zwischen<br />
20 und 65 Jahre, d.h. auf das erwerbsfähige Alter. Die wenigen Untersuchungen aus Deutschland<br />
über jüngere Altersgruppen deuten jedoch darauf hin, dass bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
ähnliche sozio-ökonomische Unterschiede im Gesundheitszustand vorhanden sind wie bei den<br />
20- bis 65-Jährigen (Behörde 1996, Hurrelmann 2000, Mielck 2001, Siegrist et al. 1997). Mit<br />
anderen Worten: Auch bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen ist der Gesundheitszustand in der unteren<br />
Statusgruppe meistens erheblich schlechter als in der oberen Statusgruppe. Arme <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche sind häufiger körperlich krank und weisen mehr psychische und psychosomatische<br />
Störungen auf als <strong>Kinder</strong> aus bessergestellten Familien. Die wichtigsten Ausnahmen von dieser<br />
Regel bilden Allergien und Hauterkrankungen. Offenbar sind sie bei den <strong>Kinder</strong>n aus der unteren<br />
Statusgruppe seltener als bei den <strong>Kinder</strong>n aus der oberen Statusgruppe <strong>–</strong> die Ursachen dieser<br />
„umgekehrten“ gesundheitlichen Ungleichheit liegen jedoch noch weitgehend im Dunkeln<br />
(Bolte 2000, Heinrich et al. 2000).<br />
Eine von diesen wenigen Studien ist die 1994 durchgeführte Befragung von 3.328 Schülern<br />
zwischen 11 und 15 Jahren in Nordrhein-Westfalen (Klocke/Hurrelmann 1995). Um den sozialen<br />
Status zu bestimmen, wurden die Schüler gefragt, welchen Bildungsabschluss und welchen<br />
Beruf ihre Eltern haben, wie viele PKW's ihre Eltern besitzen, wie viele Urlaubsreisen die Familie<br />
im letzten Jahr unternommen hat, und ob der Schüler ein eigenes Zimmer hat. Nach Zu-<br />
13<br />
Forschungsergebnisse zur<br />
Mortalität <strong>–</strong> Beispiele<br />
Forschungsergebnisse zur<br />
Morbidität <strong>–</strong> Beispiele<br />
Studien zur gesundheitlichen<br />
Ungleichheit
14<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
sammenfassung dieser Angaben wurden fünf soziale Schichten unterschieden. Die Fragen zum<br />
Gesundheitszustand betrafen sowohl physische wie auch psychische Beschwerden.<br />
Die subjektive Wahrnehmung des eigenen Gesundheitszustandes hängt stark vom sozio-ökonomischen<br />
Status ab. So verwundert es nicht, dass sich die Schüler aus der unteren Statusgruppe<br />
erheblich kränker fühlen als die Schüler aus der oberen (vgl. Tabelle 2). Während z.B. nur 1 %<br />
der Schüler aus der oberen Gruppe sich täglich oder öfters pro Woche gesundheitlich schlecht<br />
fühlt, waren dies in der unteren Gruppe 16 %. Bei einer Bewertung dieses eklatanten Unterschiedes<br />
muss jedoch berücksichtigt werden, dass hier (etwas überspitzt formuliert) zwei extreme<br />
Gruppen verglichen werden <strong>–</strong> die ganz Reichen mit den ganz Armen. In einer später vorgestellten<br />
Auswertung dieser Daten wurden die Schüler in fünf gleich große Gruppen (d.h. in Quintile)<br />
unterschieden. Hier ist das Ausmaß der gesundheitlichen Ungleichheit daher nicht so groß.<br />
Tabelle 2: Soziale Schicht und Gesundheit bei Schulkindern<br />
Prävalenz (Angaben in %) a<br />
S o z i a l e S c h i c h t d e r E l t e r n b<br />
1 2 3 4 5 Insg.<br />
(unten) (oben)<br />
Anteil in der Stichprobe 5,3 38,1 24,2 26,2 6,2 100,0<br />
Allgemein schlechter<br />
Gesundheitszustand<br />
16 7 8 5 1 7<br />
c<br />
Kopfschmerzen c 22 11 13 11 9 12<br />
Rückenschmerzen c 16 10 9 7 7 9<br />
Nervosität c 22 12 15 13 8 13<br />
schlechtes Einschlafen c 26 17 18 15 16 17<br />
Hilflosigkeit d 14 7 6 5 3 6<br />
Einsamkeit e 19 14 9 8 9 11<br />
a: Kontrolle von Alter und Geschlecht bei Vergleich zwischen sozialen Schichten<br />
b: Index aus Ausbildung und Beruf der Eltern, finanzielle Lage der Familie<br />
c: täglich oder öfters pro Woche; d: immer oder sehr oft; e: sehr oft oder ziemlich oft<br />
Stichprobe: 3.328 Schüler (11-15 Jahre) in Nordrhein-Westfalen<br />
Datenbasis: Befragung 1994, Quelle: Klocke/Hurrelmann 1995<br />
Einen weiteren Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n fand eine Befragung<br />
zur Schuleingangsuntersuchung 1994 im Land Brandenburg heraus. 15 % der <strong>Kinder</strong> von<br />
arbeitslosen Eltern hatten Sprech- und Stimmstörungen, aber nur 10 % der <strong>Kinder</strong> von nichtarbeitslosen<br />
Eltern. Geistige Leistungsschwächen wiesen 11 % der armen <strong>Kinder</strong> zu 3,6 % der reicheren<br />
auf. 4,5 % bzw. 3,2 % neigten zu Übergewicht. 21,4 % der <strong>Kinder</strong> von arbeitslosen Eltern<br />
bzw. 11,4 % lebten in Wohnungen, die von Schimmelpilzen bef<strong>alle</strong>n sind.<br />
In der 1997 durchgeführten Dritten Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS III) wurden 1.043<br />
Jugendliche im Alter von 12 Jahren aus den alten und neuen Bundesländern von Zahnärzten<br />
untersucht (Micheelis/Reich 1999). Die Zahngesundheit ist in der unteren Bildungsgruppe erheblich<br />
schlechter als in der oberen (vgl. Tabelle 3). Ähnliche Ergebnisse wurden in der Studie<br />
auch <strong>für</strong> die beiden Altersgruppen 35-44 Jahre bzw. 65-74 Jahre gefunden.
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Tabelle 3: Schulbildung der Eltern und Zahngesundheit der <strong>Kinder</strong><br />
Schlechte Zahngesundheit (in %)<br />
S c h u l b i l d u n g d e r E l t e r n a<br />
niedrig mittel hoch<br />
Anteil in der Stichprobe 40,4 34,9 24,7<br />
Plaque in großer Menge vorhanden 2,9 2,8 1,9<br />
Starkes Zahnfleischbluten 9,2 6,1 3,2<br />
a: niedrig: Volksschulabschluss, Abschluss der 8. Klasse oder kein Schulabschluss<br />
mittel: Mittlere Reife, Abschluss 10. Klasse (POS);<br />
hoch: Fachhochschulreife oder Abitur<br />
Stichprobe: 715 bzw. 328 Jugendliche (12 Jahre, Deutsche, alte bzw. neue Bundesländer)<br />
Datenbasis: Befragung/Untersuchung 1997 in den alten und neuen Bundesländern<br />
Quelle: Micheelis/Reich 1999<br />
Gesundheitliche Ungleichheit trifft die <strong>Kinder</strong> bedauerlicherweise oft schon im Säuglingsalter.<br />
Damit liegt nahe, dass Gesundheitsförderung von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
bereits vor der Geburt beginnen muss.<br />
<strong>Kinder</strong>, Armut und die Folgen <strong>für</strong> die Gesundheit <strong>–</strong> ein Überblick<br />
Quellen: Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (2000): <strong>Kinder</strong>gesundheit in<br />
Baden-Württemberg; Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (1998):<br />
Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
Bezüglich... ... bedeutet Armut<br />
<strong>•</strong> Vorgeburtliche Versorgung Schlechtere Energie- und Nährstoffversorgung<br />
sowie häufige Anämien ihrer Mütter<br />
<strong>•</strong> Geburt Geburtsgewicht ist häufig unter 2500 g, Risiko<br />
von Totgeburten ist erhöht.<br />
<strong>•</strong> Stillzeit Säuglinge werden seltener und kürzer gestillt.<br />
<strong>•</strong> Versorgung mit Vitaminen Versorgung mit Calcium, Vitamin C, Folsäure<br />
und Mineralstoffen und Eisen ist vor <strong>alle</strong>m bei Schulkindern im<br />
Alter von 10 <strong>–</strong> 15 Jahren unzureichend. Bei<br />
Mädchen ist dieses Versorgungsdefizit noch<br />
ausgeprägter als bei Jungen.<br />
<strong>•</strong> Zuckerverbrauch Höhere Zufuhr von Zucker<br />
<strong>•</strong> Anteil gesättigter Fettsäuren Höhere Zufuhr von gesättigten Fettsäuren<br />
<strong>•</strong> Ballaststoffaufnahme Niedrigere Zufuhr von Ballaststoffen<br />
<strong>•</strong> Zahngesundheit <strong>Kinder</strong> haben häufiger Karies<br />
<strong>•</strong> Wachstum <strong>Kinder</strong> wachsen langsamer<br />
<strong>•</strong> Körpergewicht Sowohl Adipositas als auch Untergewicht<br />
kommt häufiger vor als bei anderen <strong>Kinder</strong>n.<br />
<strong>•</strong> Blutfettwerte Häufiger erhöhte Blutfettwerte<br />
<strong>•</strong> Anämien, Infektionskrankheiten Bei Säuglingen findet man öfter Anämien<br />
und Infektionskrankheiten<br />
15<br />
Zahngesundheit der <strong>Kinder</strong>
16<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
<strong>•</strong> Knochenmasse Schulkinder im Alter von 10 bis 15 Jahren<br />
haben eine geringere Knochenmasse.<br />
<strong>•</strong> Mortalitätsrate Unfälle enden bei armen <strong>Kinder</strong>n 2 <strong>–</strong> 3 mal<br />
öfter mit dem Tod als bei <strong>Kinder</strong>n aus<br />
höheren Sozialschichten.<br />
<strong>•</strong> Chronische Krankheiten Häufiger chronische Krankheiten<br />
<strong>•</strong> Suchtverhalten Bereitschaft zu gesundheitsschädigendem<br />
Verhalten erhöht: Rauchen, Alkohol,<br />
Drogenkonsum<br />
<strong>•</strong> Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 werden seltener in Anspruch<br />
genommen.<br />
<strong>•</strong> Impfungen Werden seltener in Anspruch genommen<br />
<strong>•</strong> Motorische Koordination Störungen sind häufig anzutreffen<br />
<strong>•</strong> Sprachstörungen Arme <strong>Kinder</strong> haben häufiger Sprachstörungen.<br />
<strong>•</strong> Entwicklung allgemein Entwicklung häufig verzögert<br />
<strong>•</strong> Verhalten Häufiger auffällig als bei <strong>Kinder</strong>n aus besser<br />
gestellten Familien<br />
Zum Vertiefen:<br />
Behörde <strong>für</strong> Arbeit, Gesundheit und Soziales der Freien und Hansestadt Hamburg (Hrsg.)<br />
(1996): Armut und Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n in Hamburg. Dokumentation der Fachtagung am<br />
20. November 1995. Hamburg<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (1998): Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n <strong>–</strong> Epidemiologische<br />
Grundlagen <strong>–</strong> Dokumentation einer Expertentagung. Köln<br />
Bolte, G. (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n. Über den Zusammenhang<br />
von Indikatoren der sozialen Lage mit immunologischen Parametern und respiratorischen<br />
Erkrankungen am Beispiel einer umweltepidemiologischen Studie. Regensburg<br />
Heinrich, J.; Mielck, A.; Schäfer, I.; Mey, W. (2000): Social inequality and environmentally-related<br />
diseases in Germany. Review of empirical results. Sozial- und Präventivmedizin 45: S.<br />
106-118<br />
Helmert, U.; Bammann, K.; Voges, W.; Müller, R. (Hrsg.) (2000): Müssen Arme früher<br />
sterben? Soziale Ungleichheit und Gesundheit in Deutschland. Weinheim und München<br />
Hurrelmann, K. (2000): Gesundheitsrisiken von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n. In: Altgeld, T.;<br />
Hofrichter, P. (Hrsg.): Reiches Land <strong>–</strong> kranke <strong>Kinder</strong>? Frankfurt am Main. S. 21-29<br />
Klocke, A., Hurrelmann, K. (1995): Armut und Gesundheit. Inwieweit sind <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
betroffen? Zeitschrift <strong>für</strong> Gesundheitswissenschaften, 2. Beiheft: S. 138-151
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Laaser, U.; Gebhardt, K.; Kemper, P. (Hrsg.) (2000): Gesundheit und soziale Benachteiligung.<br />
Lage<br />
Micheelis, W.; Reich, E. (Gesamtbearbeitung) (1999): Dritte Deutsche Mundgesundheitsstudie<br />
(DMS III). Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ), Deutscher Ärzte-Verlag, Köln<br />
Mielck, A. (2000a): Soziale Ungleichheit und Gesundheit: Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze,<br />
Interventionsmöglichkeiten. Bern et al.<br />
Mielck, A. (2000b): Fortschritte bei der Erklärung von gesundheitlicher Ungleichheit und bei<br />
der Entwicklung von Interventionsmaßnahmen (Editorial). Zeitschrift <strong>für</strong> Gesundheitswissenschaften<br />
8: S. 194-197<br />
Mielck, A.; Bloomfield, K. (Hrsg.) (2001): Sozial-Epidemiologie. Einführung in die Grundlagen,<br />
Ergebnisse und Umsetzungsmöglichkeiten. Weinheim<br />
Mielck, A. (2001): Armut und Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen: Ergebnisse der sozial-epidemiologischen<br />
Forschung in Deutschland. In: Klocke, A.; Hurrelmann, K. (Hrsg.)<br />
(2001): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Opladen. S.<br />
230-253<br />
Robert-Koch-Institut (Hrsg.) (2001): Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 03/01:<br />
Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Verfasst von Prof. Dr. Andreas Klocke. Berlin<br />
Siegrist, J.; Frühbuß, J.; Grebe, A. (1997): Soziale <strong>Chancen</strong>gleichheit <strong>für</strong> die Gesundheit von<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Expertise im Auftrag des Bundesministeriums <strong>für</strong> Gesundheit.<br />
Düsseldorf<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (2000): <strong>Kinder</strong>gesundheit in Baden-Württemberg.<br />
Stuttgart<br />
17
18<br />
Soziale Ungleichheit<br />
und Armut<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
1.3 Soziale Ungleichheit vor Ort: Daten und Fakten aus NRW<br />
und Baden-Württemberg<br />
Soziale Ungleichheit in Nordrhein-Westfalen<br />
<strong>•</strong> Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsstärkste Bundesland mit 18 Millionen gemeldeten<br />
Einwohnern. D.h. mehr als ein Fünftel der Bevölkerung der BRD (21,8 %)<br />
lebt in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung lag 1995 nach<br />
Angaben des Mikrozensus bei 10,8 %.<br />
<strong>•</strong> 2 Millionen Menschen und damit 11,5 % der Bürger in Nordrhein-Westfalen lebten<br />
1995 in Armut (50 %-Armutsgrenze) im Gegensatz zur gesamten Armutsquote in<br />
Westdeutschland von 10,1 %.<br />
<strong>•</strong> Von diesen 2 Millionen Armen in NRW war die Hälfte weiblich und knapp jede dritte<br />
Person (32,6 %) unter 15 Jahre alt. Mehr als jeder Dritte (35 %) in der Armutspopulation<br />
hatte eine nichtdeutsche Nationalität.<br />
<strong>•</strong> Nahezu 4 von 10 armen Personen gehören Haushalten mit 5 und mehr Personen an.<br />
14,9 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze sind Alleinerziehenden-Haushalte.<br />
<strong>•</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche sind auch in NRW die am meisten von Armut bedrohte und<br />
betroffene Personengruppe.<br />
<strong>•</strong> Von den knapp 2,9 Millionen Sozialhilfeempfängern in der Bundesrepublik Deutschland<br />
(außerhalb von Einrichtungen) wohnten 1997 fast 700.000 Personen in NRW. Als<br />
größtes Bundesland verzeichnete NRW damit auch den größten Anteil an <strong>alle</strong>n in<br />
Deutschland lebenden Sozialhilfebeziehern. Im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg<br />
leben in NRW drei mal so viele Hilfebezieher. Unter <strong>alle</strong>n 16 Bundesländern<br />
wies NRW auch den höchsten Anteil weiblicher Sozialhilfeempfänger (58 %) auf.<br />
<strong>•</strong> Die meisten Sozialhilfebezieher finden sich in der Gruppe der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen<br />
sowie der Erwachsenen im mittleren Alter. 262.000 (38 %) der Sozialhilfeempfänger<br />
sind unter 18 Jahre, 51 % zwischen 18 und 59 Jahre, knapp 11 % 60 Jahre<br />
und älter und 7 % 65 Jahre und älter.<br />
<strong>•</strong> Insgesamt lebten 30 % <strong>alle</strong>r sozialhilfebeziehenden Personen in Bedarfsgemeinschaften<br />
von <strong>alle</strong>inerziehenden Frauen. 48 % der Minderjährigen war diesem Haushaltstyp<br />
zuzuordnen. Die Hälfte <strong>alle</strong>r <strong>Kinder</strong> von Alleinerziehenden war noch keine 7 Jahre alt.<br />
<strong>•</strong> 22,4 % und damit mehr als jede 5. Person unter 15 Jahren wächst in einem Haushalt<br />
an der Armutsgrenze auf. Diese Quote liegt doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
<strong>•</strong> Mit der <strong>Kinder</strong>zahl steigt das Armutsrisiko überproportional an. 1995 zählte NRW<br />
ca. 288.000 Haushalte mit mindestens drei <strong>Kinder</strong>n unter 18 Jahren. Annähernd<br />
123.000 Sozialhilfebezieher (18 %) lebten in einem sogenannten kinderreichen Haushalt.<br />
In 42 % der Fälle waren die Mütter oder Väter <strong>alle</strong>inerziehend.<br />
<strong>•</strong> Alleinerziehende und ihre <strong>Kinder</strong> sind in NRW in hohem Maße auf die Sozialhilfe angewiesen.<br />
Im Vergleich zu Ehepaaren mit <strong>Kinder</strong>n sind Alleinerziehende 10 mal mehr<br />
gefährdet, von Sozialhilfe leben zu müssen. Das Risiko steigt, umso mehr <strong>Kinder</strong> im<br />
Haushalt leben. Bei drei und mehr <strong>Kinder</strong>n liegt die Wahrscheinlichkeit, Sozialhilfe zu<br />
benötigen, bei 60 %.<br />
<strong>•</strong> Der Anteil der ausländischen Mitbürger an den Sozialhilfebeziehern lag bei 24 % (d.h.<br />
jeder vierte Sozialhilfeempfänger in NRW war 1997 nichtdeutscher Nationalität), bei<br />
einer Sozialhilfedichte von 7,9 %. Die Quote der deutschen Sozialhilfebezieher war<br />
mit 3,2 % weniger als halb so hoch. Hilfsbedürftige Ausländerinnen und Ausländer<br />
lebten <strong>alle</strong>rdings viel häufiger in Ehen als Deutsche. Alleinerziehende Haushalte mit<br />
nichtdeutschem Haushaltsvorstand in der Sozialhilfe belaufen sich auf 16 %.<br />
<strong>•</strong> In NRW lebt nahezu die Hälfte der Bevölkerung in einer Großstadt (47,4 %). Die<br />
Großstädte in NRW hatten im Durchschnitt die höchsten Armutsquoten. Insgesamt<br />
13.1 % der Bevölkerung in Städten mit über 500.000 Einwohnern fielen unter die Armutsgrenze.<br />
<strong>•</strong> Im Ruhrgebiet und in Kreisen am Rande von NRW sind die meisten Armen zu Hause.<br />
Die niedrigsten Armutsquoten findet man in ländlichen Kreisen rund um Düsseldorf<br />
und Köln und südlich des Ruhrgebiets.<br />
<strong>•</strong> Die Mehrzahl der Kreise weist niedrigere Sozialhilfedichten auf als die Städte. Auch<br />
die ausländische Bevölkerung unter den Sozialhilfebeziehern konzentriert sich in den<br />
Städten.<br />
<strong>•</strong> In den kreisfreien Städten ist das Sozialhilferisiko <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> besonders hoch. Bezogen<br />
auf Erwachsene gibt es mit zunehmendem Alter nur noch kleine Dichteunterschiede<br />
zwischen den Kreisen und den kreisfreien Städten.<br />
Fazit: Arme Familien und Alleinerziehende mit ihren <strong>Kinder</strong>n bleiben in den<br />
industriellen Ballungsräumen.<br />
<strong>•</strong> Im Ruhrgebiet gibt es so viele Sozialhilfeempfänger wie Gelsenkirchen Einwohner<br />
hat, nämlich ca. 250.000 Personen. D.h.: Mehr als ein Drittel <strong>alle</strong>r Sozialhilfebezieher<br />
in NRW lebten 1997 im Ruhrgebiet (35,7 %). Davon waren 92.153 Personen minderjährig<br />
(13 % <strong>alle</strong>r Sozialhilfebezieher). In Dortmund lebte sogar jedes 7. Kind unter 7<br />
Jahren von Sozialhilfe (entspricht 14,3 %). Rechnet man diese Zahlen auf durchschnittliche<br />
Grundschul-Klassenstärken um, so könnte man daraus ca. 200 Klassen<br />
Sozialhilfeempfänger<br />
Regionale Unterschiede<br />
19
20<br />
Viele <strong>Kinder</strong><br />
erhalten Sozialhilfe<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
pro Jahrgangsstufe mit <strong>Kinder</strong>n bilden, die unter Armutsbedingungen aufwachsen<br />
(Kersting 2000).<br />
<strong>•</strong> Fast sechs von zehn (58 %) Sozialhilfebeziehenden im Ruhrgebiet lebten Ende 1997<br />
in einem Haushalt mit Kind(ern). Der größte Anteil an armen Personen (31 %) fiel davon<br />
auf die Alleinerziehenden-Haushalte.<br />
<strong>•</strong> Die Hälfte <strong>alle</strong>r minderjährigen Sozialhilfebezieher im Ruhrgebiet gehörte einem Alleinerziehenden-Haushalt<br />
an. Von diesen war wiederum die Hälfte noch keine 7 Jahre<br />
alt und somit auf verlässliche und kontinuierliche Betreuung angewiesen.<br />
Im Ruhrgebiet entwickelt sich laut der Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum<br />
Armut zu einem Massenphänomen.<br />
Tabelle 4: Betroffenheit von Einkommensarmut in Nordrhein-Westfalen<br />
Jahr 40 % Grenze<br />
1991 <strong>–</strong> 1997 in %<br />
50 % Grenze 60 % Grenze<br />
1991 3,6 8,3 17,9<br />
1992 2,7 8,8 19,4<br />
1993 3,8 10,4 22,4<br />
1994 3,6 10,7 21,5<br />
1995 5,3 11,5 20,5<br />
1996 3,4 10,0 19,4<br />
1997* 2,7 8,4 18,0<br />
Quelle: SOEP 1991-1997 und eigene Berechnungen Ruhr-Universität Bochum<br />
*Vorläufiges Ergebnis<br />
Soziale Ungleichheit in Baden-Württemberg<br />
<strong>•</strong> Die Gesamtbevölkerung Baden-Württembergs betrug 2001 (Mikrozensus)<br />
10.537.700 Einwohner.<br />
<strong>•</strong> Ende 1998 nahm Baden-Württemberg mit einem <strong>Kinder</strong>anteil von 16,9 % den ersten<br />
Platz unter den alten Bundesländern ein.<br />
<strong>•</strong> 1998 lebten in Baden-Württemberg 1.303.828 ausländische Mitbürger. Das entspricht<br />
einem Anteil von 12,5 % an der Gesamtbevölkerung. Unter den <strong>Kinder</strong>n ist der Ausländeranteil<br />
mit 14,5 % höher.<br />
<strong>•</strong> Im Jahr 2000 lebten in Baden-Württemberg 209.044 Menschen von Sozialhilfe, das<br />
entspricht einer Sozialhilfedichte von 2,0 % (2,8 Millionen und 3,4 % in der gesamten<br />
Bundesrepublik, 1999).
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
<strong>•</strong> Knapp 40 % der Sozialhilfeempfänger in Baden-Württemberg sind <strong>Kinder</strong> unter 18<br />
Jahren. Jedes 18. Kind unter 7 Jahren (5,4 %) wächst mit Sozialhilfe auf. Dagegen beziehen<br />
nur 1 % <strong>alle</strong>r Personen über 64 Jahre 1998 laufende Hilfe zum Lebensunterhalt.<br />
<strong>•</strong> 1998 hatten ein Drittel bis die Hälfte <strong>alle</strong>r Sozialhilfeempfänger in Baden-Württemberg<br />
keinen beruflichen Bildungsabschluss.<br />
<strong>•</strong> Über ein Viertel <strong>alle</strong>r Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt waren 1998 Alleinerziehende. Der Ausländeranteil an den Sozialhilfeempfängern<br />
beträgt ebenfalls etwa ein Viertel.<br />
<strong>•</strong> Im Jahr 1998 lag die Sozialhilfequote in der deutschen Bevölkerung Baden-Württembergs<br />
bei 2,0 %, in der ausländischen Bevölkerung knapp unter 5 %. Im Vergleich dazu<br />
beträgt die Sozialhilfequote bei Alleinerziehenden unabhängig von der Nationalität<br />
mit knapp 19 % das Vierfache der Quote in der ausländischen Bevölkerung und liegt<br />
damit mehr als achtmal so hoch wie die Quote in der Gesamtbevölkerung (2,3 %).<br />
<strong>•</strong> Besonders armutsgefährdet sind Haushalte von Alleinerziehenden und von Familien<br />
mit drei und mehr <strong>Kinder</strong>n.<br />
Sozialhilfe<br />
21
22<br />
Deutlich mehr<br />
Sozialhilfeempfänger<br />
in großen Städten<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
<strong>•</strong> Während 2000 die Sozialhilfequote in der Gesamtbevölkerung unter 18 Jahren im<br />
Landesdurchschnitt 3,8 % beträgt, leben in den Stadtkreisen Mannheim (12,5 %),<br />
Freiburg (9,7 %), Karlsruhe (7,9 %), Stuttgart (7,2 %) und Heilbronn (7,2 %) wesentlich<br />
mehr <strong>Kinder</strong> unter 18 Jahren am Existenzminimum.<br />
Zum Vertiefen:<br />
Hank, K.; Kersting, V.; Langenhoff, G.; Strohmeier, K.P. (Ruhr-Universität Bochum <strong>–</strong> Zentrum<br />
<strong>für</strong> interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung, ZEFIR) (2000): Armut in Nordrhein-Westfalen.<br />
Umfang und Struktur des Armutspotentials. Bochum.<br />
Kersting, V., Ruhr-Universität Bochum <strong>–</strong> ZEFIR: <strong>Kinder</strong>armut im Ruhrgebiet. Fakten eines<br />
Armutszeugnisses der Region. Referat auf der GEW-Konferenz „<strong>Kinder</strong>armut im Ruhrgebiet“<br />
am 2.2.2000 in Gelsenkirchen<br />
Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt (Hrsg.) (2001): Armut in Stuttgart. Quantitative und<br />
qualitative Analysen. Sozialbericht 1. Stuttgart<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit dem Landesgesundheitsamt<br />
Baden-Württemberg, (2000): <strong>Kinder</strong>gesundheit in Baden-Württemberg. Stuttgart
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
1.4 Ansätze zur Erklärung und Verringerung der gesundheitlichen<br />
Ungleichheit<br />
Bei der Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheit wird meistens zwischen den beiden folgenden<br />
grundlegenden Hypothesen unterschieden:<br />
<strong>•</strong> Der sozio-ökonomische Status beeinflusst den Gesundheitszustand<br />
(plakativ formuliert: „Armut macht krank“)<br />
<strong>•</strong> der Gesundheitszustand beeinflusst den sozio-ökonomischen Status<br />
(plakativ formuliert: „Krankheit macht arm“)<br />
Die in Deutschland diskutierten Erklärungsansätze beziehen sich meistens auf die erste Hypothese.<br />
In der zweiten Hypothese wird das Problem angesprochen, dass die Gefahr eines sozialen<br />
Abstiegs bei kranken Personen häufig größer ist als bei gesunden; es wird jedoch davon ausgegangen,<br />
dass der Zusammenhang „Krankheit macht arm“ bei uns nicht so bedeutend ist wie<br />
der Zusammenhang „Armut macht krank“.<br />
Für den Zusammenhang „Armut macht krank“ kommt eine Vielzahl von Erklärungsansätzen<br />
in die Diskussion:<br />
<strong>•</strong> Arbeitsbedingungen: Von vielen physischen und psychischen Arbeitsbelastungen <strong>–</strong> z.B.<br />
körperlich schwerer Arbeit, Lärm, Eintönigkeit, geringen Möglichkeiten des Mitentscheidens<br />
<strong>–</strong> sind die Erwerbstätigen in der unteren Statusgruppe besonders stark betroffen.<br />
<strong>•</strong> Wohnbedingungen: Die Angehörigen der unteren Statusgruppe wohnen besonders häufig<br />
an verkehrsreichen Straßen, und die Luftverschmutzung ist in den Arbeiterwohngebieten<br />
höher als in anderen Wohngebieten.<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsgefährdendes Verhalten: Die meisten Ergebnisse liegen <strong>für</strong> Rauchen, Übergewicht,<br />
Bluthochdruck und Mangel an sportlicher Betätigung vor. Die Prävalenz dieser<br />
zentralen kardiovaskulären Risikofaktoren ist in den unteren Statusgruppen besonders<br />
hoch. Auch zur Ernährung sind mehrere Untersuchungen vorhanden, und sie lassen keinen<br />
Zweifel daran, dass die Ernährung in den status-niedrigen Gruppen zumeist ungesünder<br />
ist als in den status-hohen.<br />
<strong>•</strong> Vorsorge-Verhalten: Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen werden in den unteren<br />
Statusgruppen seltener in Anspruch genommen als in den oberen.<br />
<strong>•</strong> Gesundheitliche Versorgung: Erwachsene mit niedriger Schulbildung sind mit der ambulanten<br />
Versorgung unzufriedener als Erwachsene mit höherer Schulbildung. Bei statusniedrigen<br />
Personen fehlen erheblich mehr Zähne als bei status-hohen.<br />
Von einer ausreichenden Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheit sind wir jedoch noch<br />
weit entfernt, denn wir wissen sehr wenig darüber,<br />
<strong>•</strong> wie groß der Anteil der einzelnen Faktoren an der Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheit<br />
ist, und wie sich die einzelnen Faktoren gegenseitig beeinflussen.<br />
Armut macht krank <strong>–</strong><br />
Erklärungsansätze<br />
23
24<br />
Erklärung der<br />
gesundheitlichen<br />
Ungleichheit bei <strong>Kinder</strong>n<br />
und Jugendlichen<br />
Ansätze zur Verringerung<br />
der sozialen Ungleichheit<br />
Kurz- und mittelfristig<br />
planen<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
<strong>•</strong> ob und wie sich eine gesundheitliche Benachteiligung im Kindesalter bis in das Erwachsenenalter<br />
hinein fortsetzen kann.<br />
<strong>•</strong> wie sozial benachteiligte Personen selber ihre gesundheitliche Benachteiligung erklären.<br />
Die meisten der oben genannten Ansätze zur Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheit lassen<br />
sich auf <strong>Kinder</strong> und Jugendliche übertragen. Wenig sinnvoll ist eine direkte Übertragung nur<br />
beim Ansatz „Arbeitsbedingungen“. Sind jedoch die Eltern der unteren Statusgruppe durch ihre<br />
Arbeitsbedingungen physisch und psychisch besonders stark belastet, dann wird dies auch auf<br />
ihre <strong>Kinder</strong> ausstrahlen. In diesem Sinne bieten die Arbeitsbedingungen bei den Erwachsenen<br />
auch einen wichtigen Ansatz zur Erklärung der gesundheitlichen Ungleichheiten bei den <strong>Kinder</strong>n.<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche aus der unteren Statusgruppe sind erheblich größeren gesundheitlichen<br />
Belastungen ausgesetzt als die besser gestellten <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen. Bezogen auf<br />
die Wohnbedingungen wurde z.B. festgestellt, dass <strong>Kinder</strong> aus den unteren Statusgruppen häufiger<br />
als andere <strong>Kinder</strong> an Hauptverkehrsstraßen und in Regionen mit erhöhter Konzentration an<br />
Außenluft-Schadstoffen wohnen. Schüler aus der unteren Statusgruppe ernähren sich besonders<br />
ungesund. Empirische Ergebnisse liegen vor <strong>alle</strong>m zum Rauchen vor. Mit zunehmendem sozioökonomischem<br />
Status nimmt das Rauchen bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen <strong>–</strong> auch bei ihren Eltern<br />
<strong>–</strong> immer weiter ab. Bezogen auf das Vorsorge-Verhalten ist z.B. die Teilnahme an den U1bis<br />
U9 Untersuchungen bei den unteren Statusgruppen besonders niedrig (Robert-Koch-Institut<br />
2001). Bezogen auf die gesundheitliche Versorgung von erkrankten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
liegen bisher keine größeren Untersuchungen über statusspezifische Unterschiede vor.<br />
Auf einer sehr allgemeinen Ebene besteht kein Zweifel daran, was zur Erreichung des Ziels<br />
„Verbesserung des Gesundheitszustandes in den unteren Statusgruppen“ getan werden sollte.<br />
Wir wissen sehr viel über die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung bzw. der primären, sekundären<br />
und tertiären Prävention <strong>–</strong> jetzt geht es um die praktische Umsetzung bei den Angehörigen<br />
der unteren Statusgruppen.<br />
Auf einer etwas konkreteren Ebene lassen sich die folgenden Ansatzpunkte zur Verringerung<br />
der gesundheitlichen Ungleichheit unterscheiden: Zum einen die Verringerung der sozialen Ungleichheit<br />
(d.h. Verringerung der Unterschiede in der schulischen und beruflichen Ausbildung,<br />
im beruflichen Status und im Nettoeinkommen), und zum anderen die Verbesserung der Gesundheits-<strong>Chancen</strong><br />
von status-niedrigen Personen, d.h.:<br />
<strong>•</strong> Verringerung ihrer Expositionen gegenüber gesundheitsgefährdenden Umweltbedingungen<br />
<strong>•</strong> Verstärkung ihrer gesundheitsfördernden Umweltbedingungen<br />
<strong>•</strong> Verbesserung ihrer präventiven und kurativen gesundheitlichen Versorgung<br />
<strong>•</strong> Verbesserung ihres Gesundheitsverhaltens<br />
<strong>•</strong> Verbesserung ihrer beruflichen und finanziellen Absicherung bei Krankheit<br />
Die Verringerung der sozialen Ungleichheit würde das Problem quasi an der Wurzel anpacken.<br />
Dies setzt jedoch fundamentale strukturelle Veränderungen voraus, die (wenn überhaupt) nur in<br />
langfristigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen erreicht werden können. Die Bemühungen<br />
um eine kurz- und mittelfristige Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit sind ver-
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
mutlich erfolgreicher, wenn sie sich zunächst auf die Verbesserung der Gesundheits-<strong>Chancen</strong><br />
von status-niedrigen Personen konzentrieren.<br />
Es ist nicht einfach, einen aktuellen Überblick über die Maßnahmen der Gesundheitsförderung<br />
zu erhalten, die sich auch und vor <strong>alle</strong>m an die sozial Benachteiligten richten. In Deutschland<br />
ist u.E. bisher viermal versucht worden, eine derartige Bestandsaufnahme zu erstellen:<br />
<strong>•</strong> Die erste Übersicht stammt aus Baden-Württemberg (Sozialministerium 1996).<br />
<strong>•</strong> Die zweite Übersicht stammt aus Niedersachsen (Hofrichter/Deneke 2000). Im Rahmen<br />
der niedersächsischen Landesarmutskonferenz hat sich dort 1996 der Arbeitskreis „Armut<br />
und Gesundheit“ gebildet; er wird seitdem von der Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit<br />
Niedersachsen e.V. aus organisiert.<br />
<strong>•</strong> Die dritte Übersicht wurde im Institut <strong>für</strong> Medizinische Soziologie der Heinrich-Heine-<br />
Universität in Düsseldorf erstellt. Im Rahmen des „European Network of Health Promotion<br />
Agencies (ENHPA)“ wurde das Projekt „Tackling Inequalities in Health“ durchgeführt.<br />
Es hatte zum Ziel, die „bisherigen Strategien der Gesundheitsförderung, die auf<br />
sozial und wirtschaftlich benachteiligte Gruppen gerichtet sind, (...) zu analysieren und<br />
die praktischen Möglichkeiten zur Verringerung dieses Problems darzustellen“ (BZgA<br />
2001, S. 3).<br />
<strong>•</strong> Gemeinsam mit Partnern aus Großbritannien und Schweden wurde im Rahmen eines<br />
von der EU finanzierten Projektes versucht, die Gesundheitsförderungs-Maßnahmen zu<br />
finden, die nachweislich zu einer Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit bei<br />
<strong>Kinder</strong>n geführt haben. Die Suche beschränkte sich dabei auf publizierte Studien aus den<br />
westeuropäischen Staaten. Insgesamt wurden ca. 40 Maßnahmen gefunden, aber davon<br />
stammte keine aus Deutschland (Mielck et al. 2000).<br />
Auff<strong>alle</strong>nd ist zunächst, dass diese Aktivitäten <strong>alle</strong> relativ neuen Datums sind. Offenbar wird in<br />
Deutschland erst seit wenigen Jahren versucht, die Gesundheitsförderung sozial Benachteiligter<br />
systematisch zu erfassen. Noch wichtiger ist jedoch eine andere Feststellung: Uns fehlt ein<br />
System, das es uns ermöglichen würde, aus den Erfahrungen der bereits durchgeführten Projekte<br />
zu lernen. Wir wissen zu wenig darüber, wo welche Projekte durchgeführt werden und wie erfolgreich<br />
diese Projekte waren.<br />
Die Frage, welche Gesundheitsförderungs-Maßnahmen nachweisbar zu einer Verringerung<br />
der gesundheitlichen Ungleichheit geführt haben, und was diese Maßnahmen auszeichnet, ist<br />
hier nur durch Rückgriff auf Erfahrungen aus dem Ausland zu beantworten. Als Beispiel kann<br />
die oben angesprochene Studie gelten, die im Rahmen eines von der EU finanzierten Projektes<br />
gemeinsam mit Partnern aus Großbritannien und Schweden durchgeführt wurde (Mielck et al.<br />
2000).<br />
Vermutlich lassen sich die Eigenschaften dieser Projekte (siehe Auflistung unten) auch auf<br />
Projekte in Deutschland übertragen. Dies entbindet uns jedoch nicht von der Aufgabe, eigene<br />
Gesundheitsförderungs-Maßnahmen <strong>für</strong> sozial Benachteiligte zu entwickeln und aus diesen Erfahrungen<br />
zu lernen.<br />
25<br />
Gesundheitsförderung <strong>für</strong><br />
sozial Benachteiligte <strong>–</strong><br />
Ansätze in Deutschland<br />
Erfahrungen aus<br />
dem Ausland
26<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Erfolgreiche Projekte zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit<br />
bei <strong>Kinder</strong>n haben folgende Eigenschaften (laut Erfahrungen aus dem Ausland):<br />
<strong>•</strong> energisches und intensives Engagement<br />
<strong>•</strong> sorgfältige Bedarfsanalyse vor Beginn der Intervention<br />
<strong>•</strong> Verknüpfung verschiedener Ansätze und Disziplinen<br />
<strong>•</strong> sorgfältige Auswahl und Ausbildung der vor Ort tätigen Vertrauenspersonen<br />
<strong>•</strong> Partizipation der Zielgruppe bei Planung und Durchführung der Maßnahme<br />
<strong>•</strong> persönliche Einladung der Personen aus der Zielgruppe (z.B. telephonisch<br />
durch Ärzte), persönlicher und enger Kontakt mit den Personen aus der<br />
Zielgruppe (Treffen unter vier Augen, in kleinen Gruppen etc.)<br />
<strong>•</strong> Vermittlung von Wissen und von Fertigkeiten<br />
<strong>•</strong> Anpassung an die regionalen Umstände.<br />
Fazit <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung von sozial benachteiligten Menschen:<br />
Gesundheitliche Ungleichheit bei armen <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen: Warum?<br />
<strong>•</strong> Schlechte Arbeitsbedingungen der Eltern<br />
<strong>•</strong> Schlechte Wohnbedingungen<br />
<strong>•</strong> Häufig gesundheitsschädigendes Verhalten in Form von Rauchen, ungesunder<br />
Ernährung und Bewegungsmangel<br />
<strong>•</strong> Schlechteres Vorsorge-Verhalten: Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen<br />
sowie Impfungen werden selten in Anspruch genommen<br />
<strong>•</strong> Schlechte gesundheitliche Versorgung<br />
Wodurch könnte sich die gesundheitliche Ungleichheit verringern?<br />
<strong>•</strong> Verringerung der Expositionen gegenüber gesundheitsgefährdenden Umweltbedingungen<br />
<strong>•</strong> Verstärkung der gesundheitsfördernden Lebensbedingungen<br />
<strong>•</strong> Verbesserung der präventiven und kurativen gesundheitlichen Versorgung<br />
<strong>•</strong> Verbesserung des Gesundheitsverhaltens<br />
<strong>•</strong> Verbesserung der Bildungschancen<br />
<strong>•</strong> Verbesserung der beruflichen und finanziellen Absicherung bei Krankheit<br />
<strong>•</strong> Stärkung der Bewältigungsressourcen
Zum Vertiefen:<br />
Teil I. Die Grundlagen oder „Was sollten Sie wissen?“<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (2001): „Tackling Inequalities in Health“<br />
<strong>–</strong> ein Projekt des „European Network of Health Promotion Agencies“ (ENHPA) zur Gesundheitsförderung<br />
bei sozial Benachteiligten. Abschlussbericht <strong>für</strong> das deutsche Teilprojekt.<br />
Vorgelegt von Prof. Dr. Johannes Siegrist und Dr. Ljiljana Joksimovic (Universität Düsseldorf,<br />
Institut <strong>für</strong> Medizinische Soziologie)<br />
Hofrichter, P.; Deneke, C. (Hrsg.) (2000): Armut und Gesundheit. Praxisprojekte aus Gesundheits-<br />
und Sozialarbeit in Niedersachsen. Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit Nds. e.V.,<br />
Zentrum <strong>für</strong> Angewandte Gesundheitswissenschaften der Fachhochschule Nordostniedersachsen<br />
und der Universität Lüneburg. Lüneburg<br />
Mielck, A.; Graham, H.; Bremberg, S. (2000): Armut macht auch <strong>Kinder</strong> krank. Können Strategien<br />
der Gesundheitsförderung gesundheitliche <strong>Chancen</strong>gleichheit schaffen? Empirische<br />
Ergebnisse aus Westeuropa. 6. bundesweiter Kongress „Armut und Gesundheit“. Berlin, 1.-<br />
2. Dezember 2000<br />
Robert-Koch-Institut (Hrsg.) (2001): Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 03/01:<br />
Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Verfasst von Prof. Dr. Andreas Klocke. Berlin<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (1996): Gesundheitsförderung mit sozial Benachteiligten.<br />
Eine Bestandsaufnahme von Initiativen, Projekten und kontinuierlichen Angeboten.<br />
Stuttgart<br />
27
28<br />
Notizen
Nicole T. Fürsorge<br />
Foto: www.offroadkids.de<br />
29
30<br />
Wenige Erkenntnisse<br />
über subjektives<br />
Erleben von Armut<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
2. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
2.1 Soziale Ungleichheit und die Folgen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong><br />
eine Einstimmung<br />
2.2 Gesundheitsverhalten von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und<br />
Jugendlichen <strong>–</strong> das Beispiel Ernährung<br />
2.3 Risiko Alleinerziehen: Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendliche<br />
aus Ein-Eltern-Familien<br />
2.4 Strategien und Ressourcen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zur<br />
Bewältigung von Armut<br />
2.1 Soziale Ungleichheit und die Folgen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong><br />
eine Einstimmung<br />
Die Folgen von Armut in den Familien sind vielfältig und tiefgreifend <strong>–</strong> das wurde oben wiederholt<br />
angedeutet. Belastende Lebensbedingungen, ein ungünstiges Gesundheitsverhalten, Unterschiede<br />
in der gesundheitlichen Versorgung und nicht zuletzt unzureichende Ressourcen zur Bewältigung<br />
des Ganzen beeinflussen neben dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden auch<br />
die Entwicklung und Lebenschancen der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen.<br />
Der 10jährige Clemens lebt mit seinen Eltern und den 4 jüngeren Geschwistern im<br />
sozialen Brennpunkt in Großburgfeld-Süd. Seit 4 Jahren ist sein Papa arbeitslos,<br />
was ihm gegenüber seinen Schulkameraden schrecklich peinlich ist. Mama hat <strong>für</strong><br />
ihn keine Zeit und scheint auch sonst mit <strong>alle</strong>m überfordert: Die Wohnung gleicht<br />
einer Müllhalde, der Schuldenberg steigt ins Unermessliche und im Kühlschrank<br />
herrscht oft gähnende Leere. Clemens geht nicht gerne in die Schule, weil er dort<br />
von den anderen oft gehänselt wird. Er schämt sich <strong>für</strong> seine altmodische Büchertasche,<br />
die zerschlissene no-name-Jeans, seine schlechten Zeugnisse und da<strong>für</strong>, dass<br />
er nachmittags immer auf seine kleinen Geschwister aufpassen muss und nicht zum<br />
Spielen darf. Clemens hätte so viele große und kleine Wünsche, wie <strong>alle</strong> Jungs in<br />
seinem Alter. Kaum angefangen, seiner Mutter davon zu erzählen, weiß er schon die<br />
Antwort: „Sei still, wir haben kein Geld.“<br />
Wir kennen Daten und Fakten über soziale und gesundheitliche Ungleichheit aus empirischen<br />
Studien. Aber wir wissen wenig über diejenigen, die sich hinter diesen Zahlen und Statistiken<br />
verbergen: die betroffenen <strong>Kinder</strong>, Jugendlichen und ihre Eltern. Wie aber <strong>Kinder</strong> das Aufwachsen<br />
in Armut erleben, welche Konsequenzen es <strong>für</strong> sie hat und wie ihnen bei der Bewältigung<br />
ihrer schwierigen Situation geholfen werden könnte, ist wissenschaftlich kaum erfasst. Le-
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
benslagenorientierte Gesundheitsförderung <strong>für</strong> sozial Benachteiligte funktioniert nicht gut ohne<br />
Einblick in das, was <strong>für</strong> die Betroffenen „Alltag“ ist.<br />
Der Lebensstandard von <strong>Kinder</strong>n bestimmt sich über das Einkommen der Eltern. Damit haben<br />
<strong>Kinder</strong>, die in Armutshaushalten aufwachsen, kaum eine Chance, dieser Situation mit eigenen<br />
Anstrengungen zu entkommen, denn sie sind auf ihre Eltern angewiesen und materiell von<br />
ihnen abhängig (Mansel/Brinkhoff 1998). Werden <strong>Kinder</strong> in eine solche Lebenslage hineingeboren,<br />
kennen sie kein anderes Leben als das mit finanzieller und sozialer Benachteiligung.<br />
Geld ist häufig ein Thema in sozial benachteiligten Familien <strong>–</strong> auch <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen.<br />
Sie schämen sich <strong>für</strong> die Situation ihrer Eltern und sind zudem in der schwierigen<br />
Lage, das <strong>alle</strong>s nach draußen schlecht verschweigen zu können. Die Angst vor der Stigmatisierung<br />
setzt die <strong>Kinder</strong> unter Druck und führt zum Abbruch ihrer sozialen Kontakte. Am meisten<br />
leiden die <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen wohl unter der Tatsache, dass sie „nicht mithalten können“.<br />
Sie sind und sie fühlen sich sozial ausgegrenzt. Im schlimmsten Fall kommt es zu depressiven<br />
Störungen und Selbstwertkrisen. Wenn solche psychischen Beschwerden im Kindes- und Jugendalter<br />
auftreten, können sie negative Entwicklungen in Gang setzen, die ein ganzes Leben<br />
lang prägen (Klocke/Hurrelmann 1998).<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche, denen schon an der Kleidung die finanzielle Misere der Familie anzusehen<br />
ist, werden schnell zu Außenseitern abgestempelt: keine Freunde, keine Markenkleidung,<br />
keine Schulausflüge, keine Mitgliedschaft im Sportverein, kein Urlaub in Mallorca, ein<br />
altes Fahrrad oder keines. Sofern irgendwie erschwinglich, setzen deshalb manche Eltern <strong>alle</strong>s<br />
daran, ihren Sprösslingen diese Akzeptanzprobleme in Schule und Freundeskreis zu ersparen.<br />
Zum Teil versuchen sie, den <strong>Kinder</strong>n das <strong>gleiche</strong> zu bieten, was die Freunde in der Clique auch<br />
besitzen. Das gelingt entweder über die drastische Reduzierung der elterlichen Bedürfnisse<br />
oder hin und wieder auch über Privatschulden. Auf viele Aktionen, bei denen es darum geht, mit<br />
Gleichaltrigen etwas zu tun, müssten die <strong>Kinder</strong> ansonsten verzichten. Ein Kind büßt schnell an<br />
Wertschätzung in der Gleichaltrigengruppe ein, wenn es den ganz normalen Standard nicht erreicht<br />
(Mansel/Neubauer 1998).<br />
Manche Probleme wären <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong> sicher besser zu bewältigen, wenn sie unter ihren<br />
Kameraden in der Schule auf Verständnis und Unterstützung hoffen könnten. Das erweist sich<br />
in der Praxis aber als schwierig. Im heutigen Schulsystem stoßen Lehrer mit dem Wunsch, die<br />
sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong> besonders zu unterstützen, schnell an die Grenze ihrer Belastbarkeit<br />
(Andrä 2000).<br />
Auch zu Hause lauern die Einschränkungen beim Spielen und Hausaufgaben machen. Der oft<br />
beengte Wohnraum lässt den <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen wenig bis gar keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen.<br />
Häufig gibt es keinen Platz in der Wohnung, an dem die Hausaufgaben in Ruhe erledigt<br />
werden können. Nervosität und Konzentrationsstörungen folgen fast zwangsläufig. Mit andauernder<br />
Armut verschlechtert sich oft das Klima in der Familie. Konflikte und Spannungen<br />
sind unumgänglich und werden meistens nicht konstruktiv gelöst <strong>–</strong> mit dem Nebeneffekt, dass<br />
die <strong>Kinder</strong> so wahrscheinlich kaum soziale Kompetenzen erwerben.<br />
<strong>Kinder</strong> lernen am Modell, und wenn die Vorbilder mit verfügbaren Finanzen schlecht umgehen<br />
können, dann verwundert es nicht, dass sich auch die <strong>Kinder</strong> damit schwer tun. Laut einer<br />
Befragung der Universität Oldenburg würden 64,5 % der Schüler aus 7.-10. Klassen sich eher<br />
verschulden als auf Anschaffungen verzichten. Aus Studien mit Erwachsenen ist bekannt, dass<br />
Überschuldung Folgen <strong>für</strong> die Gesundheit hat. Vor <strong>alle</strong>m psychosomatische und Sucht-Erkran-<br />
31<br />
Aufwachsen mit wenig Geld<br />
Konflikte und Spannungen<br />
Überschuldung <strong>–</strong> Beginn<br />
eines Teufelskreises
32<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
kungen kommen bei überschuldeten Personen häufig vor (Zimmermann 2000). Schulden zu machen<br />
erweitert nur kurzfristig den Handlungsspielraum, langfristig schränkt es die Perspektiven<br />
der Jugendlichen entscheidend ein <strong>–</strong> als Auslöser und Triebfeder eines Teufelskreises, dem die<br />
Betroffenen kaum mehr entkommen.<br />
Zum Vertiefen:<br />
Andrä, H. (2000): Begleiterscheinungen und psychosoziale Folgen von <strong>Kinder</strong>armut: Möglichkeiten<br />
pädagogischer Interventionen. In: Butterwegge, C. (Hrsg.): <strong>Kinder</strong>armut in Deutschland.<br />
Ursachen, Erscheinungsformen und Gegenmaßnahmen. Frankfurt am Main<br />
Andreß, H.-J. (1999): Leben in Armut: Analysen der Verhaltensweisen armer Haushalte mit<br />
Umfragedaten. Opladen<br />
Iben, G. (Hrsg.) (1998): Kindheit und Armut. Analyse und Projekte. Münster<br />
Kamensky, J.; Heusohn, L.; Klemm, U. (Hrsg.) (2000): Kindheit und Armut in Deutschland:<br />
Beiträge zur Analyse, Prävention und Intervention. Ulm<br />
Klocke, A.; Hurrelmann, K. (Hrsg.) (1998): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. Umfang, Auswirkungen<br />
und Konsequenzen. Opladen<br />
Mansel, J.; Neubauer, G. (Hrsg.) (1998): Armut und soziale Ungleichheit bei <strong>Kinder</strong>n. Opladen<br />
Mansel, J.; Brinkhoff, K.-P. (Hrsg.) (1998): Armut im Jugendalter. Soziale Ungleichheit, Gettoisierung<br />
und die psychosozialen Folgen. Weinheim/München<br />
Otto, U. (Hrsg.) (1997): Aufwachsen in Armut. Erfahrungswelten und soziale Lagen von<br />
<strong>Kinder</strong>n armer Familien. Opladen<br />
Zimmermann, G. E. (2000): Ansätze zur Operationalisierung von Armut und Unterversorgung<br />
im Kindes- und Jugendalter. In: Butterwegge, C. (Hrsg.): <strong>Kinder</strong>armut in Deutschland. Frankfurt.<br />
S. 59-77
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
2.2 Gesundheitsverhalten von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und<br />
Jugendlichen <strong>–</strong> das Beispiel Ernährung<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien weisen vielfach <strong>–</strong> ebenso wie ihre<br />
Eltern <strong>–</strong> ein ungünstiges Gesundheitsverhalten auf. Dies zu ändern, ist schwierig, wenn die guten<br />
Vorbilder fehlen, weil die Eltern auch nicht über die entsprechenden Kompetenzen und die<br />
Bereitschaft zur praktischen Umsetzung verfügen.<br />
Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum als Risikofaktoren<br />
<strong>für</strong> viele Erkrankungen sind bei armen <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen häufiger anzutreffen<br />
als bei ihren Altersgenossen aus oberen sozialen Schichten. Bedenklich muss die Erkenntnis<br />
stimmen, dass Gesundheitsverhalten in der Kindheit gelernt und so im Erwachsenenalter<br />
beibehalten wird (Kamensky 2000a; Langnäse et al. 2000).<br />
Die Datenlage zum Ernährungsverhalten von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
in Deutschland bietet keine Grundlage <strong>für</strong> differenzierte Erkenntnisse. So ist man bei der<br />
Beschreibung des Essverhaltens dieser Gruppe vermehrt auf die Schilderungen von Sozialarbeitern,<br />
Lehrern oder <strong>Kinder</strong>ärzten angewiesen.<br />
Dennoch: Die Universität Bielefeld befragte in ihrer Untersuchung 3.328 Schüler auch zum<br />
Thema Ernährung. Die <strong>Kinder</strong> aus der unteren sozialen Schicht ernährten sich im Vergleich zur<br />
oberen deutlich ungesünder (Klocke 1995) (Tabelle 5). So essen die ärmeren <strong>Kinder</strong> z.B. weniger<br />
Vollkornbrot, Obst und Gemüse als die <strong>Kinder</strong> aus bessergestellten Familien. Da<strong>für</strong> konsumieren<br />
sie mehr Chips und Pommes Frites. Es wird vermutet, dass auch hier das Ernährungsverhalten<br />
der Eltern eine große Rolle spielt. Für Chips und Pommes Frites gäbe es durchaus billigere<br />
Alternativen. Offensichtlich wird dabei weniger auf das Einkommen als auf den<br />
psychosozialen Zusatznutzen dieser Lebensmittel geachtet.<br />
Tabelle 5: Ernährung der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen nach sozialer Ungleichheit<br />
(Alter: 11 <strong>–</strong> 15 Jahre)<br />
Soziale Lage<br />
Lebensmittel „arme <strong>Kinder</strong>“ in % „reiche <strong>Kinder</strong>“ in %<br />
Gemüse wöchentlich 48 54<br />
Obst, mehrmals täglich 32 42<br />
Vollkornbrot, täglich 26 51<br />
Vollmilch, mehrmals täglich 31 43<br />
Chips, täglich 54 36<br />
Pommes Frites, wöchentlich 55 37<br />
Hamburger, Hot Dogs, wöchentlich 23 22<br />
Cola, Fanta, täglich 45 28<br />
Süßigkeiten, mehrmals täglich 30 25<br />
Kaffee, wöchentlich 37 24<br />
Datenbasis: Health Behaviour in School-Age Children, Survey,<br />
Universität Bielefeld 1994, Quelle: Klocke 1995<br />
Sellin und Besselmann (1987) stellten ebenfalls fest, dass im Sozialhilfeempfängerhaushalt mit<br />
<strong>Kinder</strong>n weitgehend auf Fleisch, frisches Obst und Gemüse verzichtet wurde. Ebenso berichten<br />
Arme <strong>Kinder</strong> essen<br />
und trinken ungesund<br />
33
34<br />
Verzicht auf Frühstück<br />
Gesundheit kein<br />
vorrangiges Thema<br />
Auch ein Thema: Rauchen,<br />
Alkohol und Drogen<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
die Mitarbeiter einer <strong>Kinder</strong>tagesstätte in einem sozialen Brennpunkt in Bremen, dass viele <strong>Kinder</strong><br />
nicht frühstücken und kein Pausenbrot mit in die Schule bekommen. Für die Schüler ist das<br />
Mittagessen im Hort dann oft die erste <strong>–</strong> und zum Teil auch die einzige warme <strong>–</strong> Mahlzeit am<br />
Tag (Busch-Geertsema/Ruhstrat 1993). Im Sozialbericht 2000 der Arbeiterwohlfahrt wird ebenfalls<br />
bestätigt, dass arme <strong>Kinder</strong> oft hungrig in den <strong>Kinder</strong>garten bzw. in die Schule gehen müssen.<br />
Sie wirken zudem ungepflegt, vernachlässigt und viele von ihnen zeigen Entwicklungsverzögerungen<br />
(AWO 2000).<br />
Fehl- und Mangelernährung ist unter <strong>Kinder</strong>n, die in Armut aufwachsen, weit verbreitet<br />
(Köttgen 2000; Dangschat 2000). Die Folgen der ungesunden Ernährung manifestieren sich<br />
nicht selten im Erwachsenenalter in Form von Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.<br />
Weiterhin wurde in der Bielefelder Studie untersucht, welche Faktoren das Ernährungsverhalten<br />
beeinflussen. Positiv wirken sich die Unterstützung durch die Eltern und die Einbindung<br />
in eine Gleichaltrigengruppe aus. <strong>Kinder</strong>, die sich in der Schule wohl fühlen und auch regelmäßig<br />
Sport treiben, achten mehr auf ihre Ernährung. Dagegen erwiesen sich ein umfangreicher<br />
Fernsehkonsum und die soziale Ungleichheit selbst als ungünstig <strong>für</strong> das Essverhalten. Ebenfalls<br />
von Nachteil ist es, wenn die <strong>Kinder</strong> viele Abende außer Haus verbringen (Klocke 1995),<br />
wo dann die elterliche „Kontrolle“ völlig außen vor ist.<br />
In der Studie der Universität Ulm zum „Ernährungsverhalten von Sozialhilfeempfängerinnen“<br />
setzten die befragten Mütter <strong>alle</strong>s daran, dass ihre <strong>Kinder</strong> von den Einsparungen am Essen<br />
nichts bemerkten. Zum Teil tun sie das, um so ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen (Kamensky<br />
2000a). D.h. die Mütter sind in armen Familien noch schlechter ernährt als die <strong>Kinder</strong>, wenn<br />
sie zugunsten anderer verzichten. Die Frage, wie gesund und vollwertig ihre eigene Ernährung<br />
ist, steht bei armen Frauen meist nicht im Vordergrund. Vorrangig widmen sie ihre Aufmerksamkeit<br />
der Bewältigung ihrer Lebensumstände. Die (oft erfolglose) Suche nach einem Arbeitsplatz,<br />
die Bewältigung der Schuldenlast, das Aufbringen der Miete, die vielen Belastungen<br />
einer Alleinerziehenden <strong>–</strong> dagegen erscheint das Thema Gesundheit <strong>für</strong> die Frauen kaum bedeutend<br />
(Kamensky 2000b).<br />
Neben ungesunder Ernährung sind gesundheitsschädigende Verhaltensweisen wie Rauchen,<br />
Alkoholgenuss und Drogenkonsum bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen aus der unteren sozialen<br />
Schicht relativ oft zu beobachten (Mielck 1998). Scholz und Kaltenbach (1995) fanden z.B. heraus,<br />
dass der Anteil der Raucher in der Hauptschule im Vergleich zu Realschule und Gymnasium<br />
am höchsten ist. Auch rauchten deutlich mehr Eltern von Hauptschülern als andere Eltern.<br />
In Anbetracht der realen Lage der Betroffenen ist die These nachzuvollziehen, dass Armut den<br />
Genussmittelkonsum ansteigen läßt. Kaffee, Zigaretten und Alkohol haben zweifellos eine entspannende<br />
Wirkung, auch wenn das Budget dadurch noch kleiner wird (Kamensky 1995; Roth<br />
1992).
Zum Vertiefen:<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
AWO Bundesverband e.V. (2000): AWO-Sozialbericht 2000. Gute Kindheit <strong>–</strong> Schlechte Kindheit.<br />
Armut und Zukunftschancen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen in Deutschland. Bonn<br />
Bieligk, A. (1996): Die armen <strong>Kinder</strong> <strong>–</strong> Armut und Unterversorgung bei <strong>Kinder</strong>n, Belastungen<br />
und ihre Bewältigung. Essen<br />
Busch-Geertsema, V.; Ruhstrat, E.-U. (1993): „Das macht die Seele so kaputt...“. Armut in<br />
Bremen. Bremen<br />
Dangschat, J.S. (2000): Armut und eingeschränkte Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
in ihrem Stadtteilbezug. In: Altgeld, T.; Hofrichter P. (Hrsg.): Reiches Land <strong>–</strong> kranke<br />
<strong>Kinder</strong>? Frankfurt am Main. S. 155-178<br />
Kamensky, J. (1995): Essen und Ernähren mit Sozialhilfe <strong>–</strong> Ein Bericht aus der Praxis. In:<br />
Barlösius, Eva; Feichtinger, Elfriede; Köhler, Barbara Maria (Hrsg.): Ernährung in der Armut.<br />
Gesundheitliche, soziale und kulturelle Folgen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin. S.<br />
237-253<br />
Kamensky, J: (2000a): <strong>Kinder</strong>armut: Folgen <strong>für</strong> die Ernährung. In: Kamensky, J.; Heusohn,<br />
L.; Klemm, U. (Hrsg.) (2000): Kindheit und Armut in Deutschland: Beiträge zur Analyse, Prävention<br />
und Intervention. Ulm. S. 86-106<br />
Kamensky, J. (2000b): Ernährung und Sozialhilfe: Ergebnisse eines Forschungsprojekts. In:<br />
Hofrichter, P.; Altgeld, T. (Hrsg.): Suppenküchen im Schlaraffenland <strong>–</strong> Armut und Ernährung<br />
von Familien und <strong>Kinder</strong>n in Deutschland. Hannover. S. 37-43<br />
Klocke, A. (1995): Der Einfluss sozialer Ungleichheit auf das Ernährungsverhalten im <strong>Kinder</strong>-<br />
und Jugendalter. In: E. Barlösius/E. Feichtinger/B. M. Köhler (Hrsg.): Ernährung in der Armut.<br />
Gesundheitliche, soziale und kulturelle Folgen in der Bundesrepublik. Berlin. S. 185-203<br />
Koettgen, C. (2000): In der Seele verletzt. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche im sozialen Abseits. In: Altgeld,<br />
T.; Hofrichter P. (Hrsg.): Reiches Land <strong>–</strong> kranke <strong>Kinder</strong>? Frankfurt am Main. S. 75-88<br />
Langnäse, K.; Mast, M.; Müller, M.J. (2000): Sozialer Status, Ernährung und Gesundheit.<br />
Akt. Ernähr. Med. 25: S. 16-19<br />
Mielck, A. (1998): Armut und Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen: Ergebnisse der sozial-epidemiologischen<br />
Forschung in Deutschland. In: Klocke, A.; Hurrelmann, K. (Hrsg.):<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. Opladen, S. 225-249<br />
Robert-Koch-Instititut (Hrsg.) (2001): Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 03/01:<br />
Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Verfasst von Prof. Dr. Andreas Klocke. Berlin<br />
35
36<br />
Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n<br />
und Jugendlichen aus<br />
Ein-Eltern-Familien<br />
Junge Mütter besonders<br />
betroffen<br />
Alleinerziehende Mütter<br />
haben schlechtere<br />
Schulbildung<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Roth, R. (1992): Über den Monat am Ende des Geldes. Frankfurt am Main<br />
Scholz, M.; Kaltenbach, M. (1995): Zigaretten-, Alkohol- und Drogenkonsum bei 12- bis<br />
13jährigen Jugendlichen <strong>–</strong> eine anonyme Befragung bei 2979 Schülern. In: Gesundheitswesen,<br />
57, 1995<br />
Sellin, C.; Besselmann, K. (1987): Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Not und<br />
Verarmung. Untersuchung im Auftrag des Diakonischen Werkes der EKD. Köln<br />
2.3 Risiko Alleinerziehen<br />
<strong>Kinder</strong> aus Ein-Eltern-Familien unterscheiden sich hinsichtlich verschiedener Gesundheitsrisiken<br />
deutlich von <strong>Kinder</strong>n aus Zwei-Eltern-Familien. Dies betrifft im Wesentlichen die psychische<br />
Entwicklung, die Nutzung präventiver Maßnahmen (Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen,<br />
Impfungen) sowie die Erkrankungs- und Unfallhäufigkeit. Der Mangel an finanziellen<br />
Ressourcen ist dabei nur eine von vielen Ursachen (Montgomery et al. 1996).<br />
Eine im Rahmen der Einschulungsuntersuchung in den Jahren 1996 und 1998 von der Universität<br />
Ulm in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Ulm durchgeführte Studie bei 3.131<br />
<strong>Kinder</strong>n lieferte wertvolle Hinweise zur gesundheitlichen Situation von <strong>Kinder</strong>n aus Ein-Eltern-<br />
Familien (Gickeleiter 2000). 2.686 der <strong>Kinder</strong> im Alter zwischen 5 und 6 Jahren lebten zum<br />
Zeitpunkt der Untersuchungen in Ulm in einer Familie mit zwei Eltern. In reinen Ein-Eltern-Familien<br />
wuchsen 307 <strong>Kinder</strong> (9,9 %) auf, die meistens deutscher Herkunft waren.<br />
Das Alter der <strong>alle</strong>inerziehenden Mütter war durchschnittlich niedriger als bei den nicht <strong>alle</strong>inerziehenden<br />
Müttern. Dies ist vor <strong>alle</strong>m auf den großen Anteil der Alleinerziehenden bei den<br />
sehr jungen Müttern zurückzuführen. Mütter unter 25 Jahren hatten ein 2,5-faches Risiko <strong>alle</strong>inerziehend<br />
zu sein im Vergleich zu den Müttern zwischen 30 und 40 Jahren. In den Altersgruppen<br />
über 40 Jahre bestanden keine gravierenden Unterschiede. Das weist darauf hin, dass das<br />
Augenmerk in der Gesundheitsförderung noch immer besonders auf die sehr jungen Mütter ausgerichtet<br />
sein muss.<br />
Auch bei den Unterschieden in der Schulbildung zwischen den beiden Familienformen<br />
machte sich das Alter der Mutter bemerkbar. Alleinerziehende Frauen haben häufiger keinen<br />
Abschluss (6,3 %) oder einen Hauptschulabschluss (38,3 %) als Frauen aus Zwei-Eltern-Familien<br />
(5,0 % und 33,6 %), und Frauen aus Zwei-Eltern-Familien sind sehr viel häufiger in der Kategorie<br />
„Abitur“ vertreten (26,8 % zu 19,8 %). Eine Erklärung hier<strong>für</strong> könnte das jüngere Alter<br />
der <strong>alle</strong>inerziehenden Mütter sein, die möglicherweise durch ihre frühe Schwangerschaft und<br />
Geburt die begonnene Schulausbildung nicht beendet haben.
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
In den Wohnungen der Ein-Eltern-Familien wurde viel häufiger geraucht als bei den Zwei-Eltern-Familien.<br />
40,2 % der Ein-Eltern-Familien <strong>–</strong> aber nur 28,8 % der Zwei-Eltern-Familien <strong>–</strong><br />
gaben an, dass in ihrer Wohnung geraucht wird. Im Ernährungsverhalten unterschieden sich die<br />
beiden Gruppen kaum. Die körperliche Untersuchung der <strong>Kinder</strong> ergab, dass <strong>Kinder</strong> aus Ein-Eltern-Familien<br />
durchschnittlich größer und schwerer waren als die <strong>Kinder</strong> aus Zwei-Eltern-Familien.<br />
Als Ursache <strong>für</strong> Übergewicht im Kindesalter wird neben den Ernährungsfaktoren auch<br />
die Dauer des Fernsehkonsums gesehen und damit einhergehend fehlende körperliche Betätigung<br />
(Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung 1994). Wenn nur ein Erwachsener<br />
<strong>für</strong> die Betreuung des Kindes zuständig ist, ist die Zeit knapper bemessen, die er mit dem<br />
Kind verbringen kann. Außerdem ist es aus zeitlichen Gründen oft nicht möglich, die <strong>Kinder</strong> in<br />
einen Sportverein zu bringen und von dort wieder abzuholen. Sportliche Betätigung ist zudem<br />
häufig mit Kosten verbunden und die finanziellen Mittel sind bei Ein-Eltern-Familien deutlich<br />
geringer als bei Zwei-Eltern-Familien.<br />
<strong>Kinder</strong> Alleinerziehender sind seltener geimpft als <strong>Kinder</strong> aus Zwei-Eltern-Familien. Bei<br />
fünf von acht abgefragten Impfungen bestanden geringere Impfraten bei den <strong>Kinder</strong>n aus Ein-<br />
Eltern-Familien. Vorsorgeuntersuchungen und Impfberatungstermine <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> nehmen <strong>alle</strong>inerziehende<br />
Eltern seltener wahr als Eltern der Zwei-Eltern-Familien (Fleming/Charlton<br />
1998; Lutz 1990; Fergusson et al. 1981). Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass <strong>alle</strong>inerziehende<br />
Eltern den <strong>Kinder</strong>arzt nicht vorbeugend aufsuchen, sondern nur im Krankheitsfall der<br />
<strong>Kinder</strong>. Dieser Umstand könnte u.a. durch den Zeitmangel in Ein-Eltern-Familien erklärt werden.<br />
Es fällt auf, dass Unterschiede zwischen Ein-Eltern-Familien und Zwei-Eltern-Familien besonders<br />
in Bezug auf psychosomatische Komponenten diskutiert werden. Gastrointestinale Beschwerden,<br />
besonders Bauchschmerzen, sind im Kindesalter ein häufiger Symptomkomplex<br />
Rauchen, Übergewicht,<br />
Bewegungsmangel<br />
Geringere Vorsorge<br />
37
38<br />
Vermehrt psychische<br />
Krankheitsursachen<br />
Alleinerziehende Mütter<br />
häufiger krank<br />
Ansätze <strong>für</strong> die<br />
Gesundheitsförderung<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
und oft Ausdruck eines psychosomatischen Geschehens (Illing/Spranger 1993; Adler et al.<br />
1998). <strong>Kinder</strong> aus Ein-Eltern-Familien klagten 1,9 mal mehr über häufige Bauchschmerzepisoden<br />
als <strong>Kinder</strong> aus Zwei-Eltern-Familien. Auch die Angabe, manchmal Durchfall zu haben,<br />
machten die <strong>Kinder</strong> der Ein-Eltern-Familien öfters. Beides deutet auf vermehrten Stress oder<br />
psychischen Druck hin. Neurodermitits, Ekzeme und das Asthma zählen ebenfalls zu den Erkrankungen,<br />
auf die der psychische Zustand und die sozialen Umstände einen Einfluss haben<br />
(Adler et al. 1998). <strong>Kinder</strong> <strong>alle</strong>inerziehender Eltern der Ulmer Untersuchung hatten ein signifikant<br />
erhöhtes Risiko einer Hautkrankheit. Noch höher lag das Risiko <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> aus Ein-Eltern-<br />
Familien bei asthmatischen Symptomen.<br />
Die Ulmer Studie zeigt deutlich, dass <strong>Kinder</strong> von Alleinerziehenden auch dann ein höheres<br />
Erkrankungsrisiko haben, wenn es keine Unterschiede gibt hinsichtlich Schulbildung, Erwerbstätigkeit<br />
und Alter der Mütter, Nationalität, Anzahl der Geschwister und Rauchen in der Wohnung.<br />
Gesundheitliche Ungleichheit zwischen diesen beiden Familienformen hat also noch andere<br />
Gründe.<br />
Es gibt viele Erklärungsmodelle <strong>für</strong> diese Ergebnisse. Die kindlichen Symptome werden von<br />
Alleinerziehenden oft ernster interpretiert. Es ist kein zweiter Erwachsener da, der die Symptome<br />
mitbeurteilt, der die Verantwortung teilt und der mitentscheidet. Alleinerziehende Mütter<br />
sind vielfältigen Belastungen ausgesetzt (Arbeit, Kind, ständiger Zeitdruck und oft finanzielle<br />
Sorgen) und die <strong>Kinder</strong> reagieren auf Stress mit psychosomatischen Beschwerden. In zahlreichen<br />
Studien wurde nachgewiesen, dass der Gesundheitszustand <strong>alle</strong>inerziehender Mütter deutlich<br />
schlechter ist als der von verheirateten Müttern (Shouls et al. 1999; Benzeval 1998; Baker/Taylor<br />
1997; Compas/Williams 1990). Die Auswirkungen der gesundheitlichen Verfassung<br />
der Mütter auf das Wohlbefinden der <strong>Kinder</strong> ist nicht zu unterschätzen. Van den Bosch et al.<br />
(1993) beschrieben in ihrer Studie, dass die Morbidität der Mutter der wichtigste Einflussfaktor<br />
<strong>für</strong> die Morbidität des Kindes ist. Sie hat einen höheren Einfluss als die soziale Klasse.<br />
Handlungsbedarf zeichnet sich deutlich ab bei der Impfrate der <strong>Kinder</strong> von Alleinerziehenden<br />
und der mäßigen Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen. Gesundheitsberatungen<br />
und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen sollten niederschwellig in <strong>Kinder</strong>gärten und<br />
Schulen durchgeführt würden. Eine Kooperation von öffentlichem Gesundheitsdienst mit den<br />
niedergelassenen <strong>Kinder</strong>ärzten wäre hier sehr von Vorteil.<br />
Alleinerziehende Mütter sollten spätestens mit der Geburt ihres Kindes eine aufmerksame<br />
Zuwendung erhalten, wie zum Beispiel im Bremer Modellprojekt der „Familienhebamme“. In<br />
Bremen betreuen Hebammen <strong>alle</strong>instehende Mütter nach der Geburt mindestens sechs Monate<br />
lang zu Hause weiter. Das Hamburger Modell der Behörde <strong>für</strong> Arbeit unterstützt Eltern, deren<br />
<strong>Kinder</strong> erkrankt sind, durch den Besuch von <strong>Kinder</strong>krankenschwestern.<br />
Als hilfreich <strong>für</strong> die <strong>alle</strong>inerziehenden Mütter erwies sich auch die ärztliche Beratung in<br />
Mütterzentren (Angebote vor Ort) oder die Einrichtung einer Gesundheitsberatungsstelle im sozialen<br />
Brennpunkt (dezentrale Versorgung). Im Münchner Stadtteil „Hasenbergl-Nord“ wurde<br />
z.B. bereits vor zwanzig Jahren eine solche dezentrale Gesundheitsberatungsstelle als Außenstelle<br />
der Gesundheitsbehörde Münchens eingerichtet und blieb bisher die einzige ihrer Art.<br />
Dort kümmern sich ein <strong>Kinder</strong>arzt, eine Arzthelferin, eine <strong>Kinder</strong>krankenschwester und eine<br />
Sozialpädagogin um die kleinen und großen <strong>–</strong> nicht nur gesundheitlichen <strong>–</strong> Probleme der Bewohner.<br />
Dem großen Engagement der Mitarbeiter und ihrem breiten Angebot (von regelmäßigen<br />
Sprechstunden, Hausbesuchen, Kursen, Gesprächskreisen über Ernährungsberatung und
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Ausstellungen bis hin zu Mitmachaktionen und Sommerfesten) und der hervorragenden Kooperation<br />
mit sämtlichen Einrichtungen vor Ort ist es zu verdanken, dass die Bewohner im Hasenbergl<br />
diese Einrichtung gerne und zahlreich in Anspruch nehmen (Trumpp 2000; Weißbacher<br />
2002).<br />
Nicht zuletzt muss das Problem der Vereinbarung von Berufstätigkeit und <strong>Kinder</strong>erziehung<br />
an der Wurzel gepackt werden. Dies ist langfristig nicht ohne tiefgreifende strukturelle Änderungen<br />
möglich (und sprengt damit den Rahmen dieses <strong>Praxishefte</strong>s). Es liegt auf der Hand,<br />
dass in diesem Zusammenhang wieder über den Ausbau an <strong>Kinder</strong>betreuungsangeboten nachgedacht<br />
werden muss.<br />
Die Situation von Alleinerziehenden und deren <strong>Kinder</strong>n <strong>–</strong> Fazit <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung:<br />
<strong>Kinder</strong> aus Ein-Eltern-Familien unterscheiden sich von <strong>Kinder</strong>n aus<br />
Zwei-Eltern-Familien so:<br />
Sie zeigen mehr Auffälligkeiten in der psychischen Entwicklung.<br />
Sie nehmen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen weniger in Anspruch.<br />
Sie haben mehr Unfälle.<br />
Sie leiden häufiger unter Bauchschmerzen, Hauterkrankungen und<br />
Asthmaerkrankungen.<br />
Alleinerziehende unterscheiden sich von Frauen aus Zwei-Eltern-Familien so:<br />
Sie sind häufig junge Mütter (unter 25 Jahren).<br />
Sie haben öfter keinen oder einen niedrigen Bildungsabschluss.<br />
Sie rauchen häufiger.<br />
Gesundheitliche Unterschiede von <strong>Kinder</strong>n aus Ein-Eltern-Familien könnten<br />
folgende Ursachen haben:<br />
Zeitmangel der Mutter<br />
Stress und Überforderung<br />
Schlechter gesundheitlicher Zustand der Mutter als wichtiger Einflussfaktor auf<br />
die Gesundheit der <strong>Kinder</strong><br />
Dieser Handlungsbedarf resultiert daraus:<br />
Verbesserung der Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen und<br />
Impfungen.<br />
Gesundheitsförderung und Suchtprävention der <strong>alle</strong>inerziehenden Mütter<br />
(Väter).<br />
Einrichtung niedrigschwelliger und wenig zeitintensiver Angebote.<br />
Integration von Gesundheitsberatung und Impfung in den Lebensbereich der<br />
<strong>Kinder</strong> (<strong>Kinder</strong>garten, Schule).<br />
Gesundheitsberatung ab der Schwangerschaft z.B. durch eine „Familienhebamme“.<br />
39
40<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Aufsuchende Beratungs- und Betreuungsangebote z.B. durch <strong>Kinder</strong>krankenschwestern.<br />
Flexible <strong>Kinder</strong>betreuungsangebote schaffen.<br />
Zum Vertiefen:<br />
Adler, R.H.; Hermann, J.M.; Köhle, K.; Schonecke O.W.; von Uexküll, T.; Wesiack, W. (Hrsg.)<br />
(1998): Psychosomatische Medizin. München<br />
Benzeval, M. (1998): The self-reported health status of lone parents. In: Soc Sci Med 46, S.<br />
1337-1353<br />
Baker, D.; Taylor, H. (1997): Inequality in health and health service use for mothers of young<br />
children in south west England. In: Journal of Epidemiology and Community Health 51, S. 75-79<br />
Compas, B.E.; Williams, R.A. (1990): Stress, coping, and adjustment in mothers and young<br />
adolescents in single- and two-parent-families. In: Am J. Commun. Psychol. 18, S. 525-545<br />
Fergusson, D.M.; Horwood, J.; Shannon, F.T. (1981): Birth placement and child health. In: NZ<br />
Med J 93, S. 37-41<br />
Fleming, D.M.; Charlton, J.R.H. (1998): Morbidity and healthcare utilisation in households<br />
with one adult: a comparative study. In: BMJ 316, S. 1572-1576<br />
Gickeleiter, M. (2000): Der Gesundheitszustand von <strong>Kinder</strong>n aus Ein-Eltern-Familien. Magisterarbeit<br />
im Aufbaustudiengang Gesundheitswissenschaften an der Universität Ulm. Unveröffentlichtes<br />
Manuskript<br />
Illing, S.; Spranger, S. (Hrsg.) (1993): Klinikleitfaden Pädiatrie. Neckarsulm, Stuttgart<br />
Lutz, M.E. (1990): The effects of family structure and regular places of care on preventive health<br />
care for children. In: Health Val Health Behav Education Promotion 14, S. 38-45<br />
Montgomery, L.E.; Kiely J.L.; Pappas, G. (1996): The effects of poverty, race and family structure<br />
on US children`s health: data from NHIS, 1978 through 1980 and 1989 through 1991.<br />
In: American Journal of Public Health 86, S. 1401-1405<br />
Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (Hrsg.) (1994):<br />
Zur gesundheitlichen Lage der <strong>Kinder</strong> in Baden-Württemberg. Stuttgart<br />
Shouls, S.; Whitehead, M.; Burström, B.; Diderichsen, F. (1999): The health and the socioeconomic<br />
circumstances of British lone mothers over the last two decades. In: Pupul Trends 95,<br />
S. 41-46
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Trumpp, P. (2000): Gesundheit und psychische Befindlichkeit von <strong>Kinder</strong>n in Armutsverhältnissen.<br />
In: Kamensky, J.; Heusohn, L.; Klemm, U. (Hrsg.): Kindheit und Armut in Deutschland.<br />
Beiträge zur Analyse, Prävention und Intervention. Ulm.<br />
Weißbacher, S. (2002): Dezentraler Ansatz in einem sozialen Brennpunkt Münchens <strong>–</strong> Gesundheitsberatungsstelle<br />
Hasenbergl-Nord. In: Mielck, A.; Abel, M.; Heinemann, H.; Stender,<br />
K.-P. (Hrsg.): Städte und Gesundheit. Projekte zur <strong>Chancen</strong>gleichheit. Lage. S. 149-168<br />
2.4 Strategien und Ressourcen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zur<br />
Bewältigung von Armut<br />
Früh im Leben erfahrene Armut verstärkt langfristig Ängstlichkeit und Depressivität. Das Gefühl<br />
Opfer zu sein, bleibt <strong>Kinder</strong>n arbeitsloser Eltern noch Jahrzehnte später erhalten, ebenso eine<br />
erhöhte Anfälligkeit <strong>für</strong> Stress (Krappmann 2000; Schindler et al. 1990). Die damit verbundenen<br />
Selbstabwertungen können die eigene Identität sehr dauerhaft formen. Sie erzeugen bei<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen genau wie bei Erwachsenen in unterschiedlichem Maß Niedergeschlagenheit,<br />
Hilflosigkeit und Rückzug, ebenso wie Ärger und aggressives Verhalten.<br />
Sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong> verarbeiten Belastungen und Konflikte überwiegend selbstbezogen<br />
<strong>–</strong> sie versuchen, mit ihren Problemen <strong>alle</strong>in fertig zu werden. Dabei bemühen sie sich, die<br />
eigenen Einstellungen und Emotionen zu steuern und zu regulieren. In Interviews einer Studie<br />
mit betroffenen Grundschulkindern (Richter 2000) finden sich zahlreiche Beispiele, die den<br />
Umgang mit verschiedenen Belastungssituationen illustrieren.<br />
Ein Achtjähriger äußert sich auf die Frage nach Einladungen zu <strong>Kinder</strong>geburtstagen, einem<br />
wichtigen kinderkulturellen Ereignis in dieser Altersstufe, wie folgt:<br />
Frage: Wirst du auch manchmal zum Geburtstag eingeladen?<br />
Antwort: Ja. Mehrmals. ...Aber öfter bei den Mädchen.<br />
Frage: Und was tust du dann?<br />
Antwort: Ja, meistens gehe ich nicht hin, weil, ja, ich gehe einfach nicht gerne zu den Mädchen.<br />
Dann müssen wir wieder Geschenke kaufen und dann ist wieder <strong>alle</strong>s so teuer.<br />
Frage: Und ist es jetzt mehr, weil du nicht gerne zu den Mädchen eingeladen wirst oder ist es eher<br />
wegen der Geschenke?<br />
Antwort: Es ist auch so wegen der Geschenke, weil wir müssen dann immer so viel kaufen, dann<br />
haben wir schon wieder Geld weniger.<br />
Ein zehnjähriger Junge regelt dieses Finanzproblem, indem er sich bescheiden zurücknimmt:<br />
Frage: Du kannst ja einfach mal erzählen, von deinem letzten Geburtstag. Was ihr gemacht habt.<br />
Antwort: Auf dem letzten Geburtstag, da hab ich also nur mit den Älteren gefeiert und dann, aber<br />
so mit den <strong>Kinder</strong>n....... Also da, also da fehlte uns........ also, hatten wir ...... da hab ich keinen<br />
<strong>Kinder</strong>geburtstag gefeiert, sondern nur Elterngeburtstag. Also es kamen nur die Erwachsenen.<br />
Frage: Du sagst gerade, <strong>Kinder</strong>geburtstag hast du nicht gefeiert, da fehlte euch? Was fehlte euch da?<br />
Selbstbezogene<br />
Bewältigungsstrategien<br />
41
42<br />
Weniger häufig:<br />
Bewältigung über Gewalt<br />
und Aggression<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Antwort: Also da fehlte uns so ... Also wie soll ich das jetzt sagen? Hm. Also, wir hatten nicht genug<br />
Geld ... da wollte meine Mama nur mit Erwachsenen feiern. Mir war das recht. Mir war das<br />
egal.<br />
Belastungen werden im Rückgriff auf eigene Ressourcen bewältigt. Zerstörerisches Verhalten<br />
gegenüber Gegenständen oder Mitschüler(inne)n scheint als mögliche Konfliktlösung eher<br />
nachgeordnet zu sein. Trotzdem kommt auch das vor. Ein Zehnjähriger schildert die Konflikte,<br />
in die er verwickelt ist:<br />
Letzten Geburtstag hab ich von meiner Tante einen Rucksack bekommen und noch irgendwas. Und<br />
kurzfristig hab ich <strong>für</strong> einen Tornister 40 Mark bekommen, mein Ledertornister, der sieht ja noch<br />
gut aus. Den hast du ja bestimmt schon gesehen?<br />
Frage: Ich glaube ja, wenn du so vorbeigelaufen bist. Und, bist stolz darauf, auf deinen Ledertornister?<br />
Antwort: Ja. Der ist besser. Dann lästern die anderen nicht, dass man nur so'n einfachen hat.<br />
Frage: Kennst du das, dass die das gemacht haben? Wie machen die das?<br />
Antwort: Paar aus unserer Klasse, sechs Stück, haben gesagt: kannst dir keinen Tornister leisten<br />
und so was. Weil ich neidisch war, dass die einen Ledertornister hatten und ich hab keinen bekommen.<br />
Das war ja, weil meine Eltern so oft umgezogen sind und, weil wir neue Möbel kaufen<br />
mussten.<br />
Frage: Ja, und dann, was haben die anderen <strong>Kinder</strong> dann gemacht?<br />
Antwort: Haben gesagt: hast kein Geld und so was.<br />
Frage: Wie findest du das, wenn die das sagen?<br />
Antwort: Doof. Da hab ich mich zuerst auch aufgeregt, deswegen hab ich auch Ärger bekommen<br />
und wegen einem Schüler habe ich von meiner Mutter Ärger bekommen.<br />
Frage: Was war da los?<br />
Antwort: Ja, das war bei D., der hat mich gehänselt und ohne Grund gehauen, aus Spaß sagte er,<br />
und dann hab ich zurückgehauen und da hab ich auch gesagt, Spaß, da dachte er nicht mehr, das<br />
ist Spaß, hat er immer mit kloppen angefangen und deswegen habe ich Ärger bekommen von meiner<br />
Mutter, dass ich mich dauernd klopp in der Schule.<br />
Aber auch andere Bewältigungsmethoden finden sich (Hölscher 2001). Zu den gesellschaftlich<br />
legitimierten Formen dieser Reaktionsweisen gehören Musizieren oder Sport, die von<br />
den Jugendlichen als befreiend wahrgenommen werden.<br />
„Wenn es mir nicht so gut geht, dann geh ich oft joggen, weil das tut total gut und dann machen<br />
wir einen Spaziergang und ich kann die Gedanken wieder frei kriegen. Ich denke darüber nach,<br />
was ich daran unternehmen kann, dass sich irgendetwas verändert.“<br />
Häufiger berichten die Befragten jedoch über ihre Versuche, die Situation <strong>für</strong> sich umzudeuten<br />
oder „auf bessere Zeiten“ zu warten. Jugendliche beschreiben ihre Versuche, Schwierigkeiten<br />
zu verdrängen und sich von ihren Sorgen abzulenken, wie folgt:
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
„So meistens will ich das gar nicht lösen. Da versuch ich irgendwie auf andere Gedanken zu<br />
kommen, ich verdräng das, oder so. <strong>–</strong> Wie schaffst du das? <strong>–</strong> Das ist natürlich nicht leicht, wenn<br />
es etwas Größeres ist, aber ich weiß nicht, ich denk dann einfach an irgendwas anderes, beschäftige<br />
mich mit Sachen, die ich sonst gern mach. Und dann will ich das vergessen.“<br />
Auch hier begegnet das Kind seinen Schwierigkeiten mit dem Rückzug auf sich selbst und<br />
auf eigene Ressourcen, auch wenn es damit letztlich überfordert ist. Angst vor Stigmatisierung,<br />
Verleugnung der eigenen Situation vor sich selbst und anderen und Rückzug oder Abbruch von<br />
Kontakten führen jedoch in die soziale Isolation mit fatalen Folgen <strong>für</strong> die weitere Alltagsorganisation.<br />
Armut erhöht das Risiko von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen, krank zu werden, sich psychisch<br />
nicht wohlzufühlen, auf schlechte soziale Integration und nur mäßige Erfolge in der Schule zu<br />
haben. Und dennoch gibt es zahlreiche arme <strong>Kinder</strong>, die hier keine Auffälligkeiten zeigen. In deren<br />
Umfeld sind schützende Faktoren zu finden, die Defizite und Unterversorgung aus<strong>gleiche</strong>n<br />
(Krappmann 2000).<br />
Insbesondere die Unterstützung von seiten der Eltern hat einen positiven Effekt auf die Entwicklung<br />
der <strong>Kinder</strong>, ebenso wie ein förderliches Schulklima (Walper 1995; Rutter 1998; Hölscher<br />
2001). Andere Faktoren, die eine erhebliche Rolle spielen, sind das Geschlecht und das Alter,<br />
in dem die Unterversorgungslage eintritt. Im Kindesalter können betroffene Mädchen eher<br />
auf Ressourcen im näheren Umfeld zurückgreifen als Jungen, denen in diesem Alter generell eine<br />
erhöhte Verwundbarkeit zugesprochen wird. Eine große Rolle spielt dabei die Fähigkeit der<br />
Mädchen, sich gegenseitig zu unterstützen, Freundschaften einzugehen. Eine enge emotionale<br />
Verbundenheit der Mädchen mit der Mutter wirkt sich ebenfalls positiv aus, wenn es darum<br />
geht, hinreichende Freundschaftsnetzwerke aufzubauen (Rutter 1998; Elder/Caspi 1991; Richter<br />
2000).<br />
Diese Fähigkeit wird bereits im Kindesalter ausgebildet und bedarf der Förderung. Es ist zu<br />
vermuten, dass sich ein Defizit in diesem Bereich <strong>für</strong> die Jungen im weiteren Lebensverlauf negativ<br />
auswirkt (Keupp 1987; Walper 1995; Nestmann 1992). Sozial benachteiligte Jungen nehmen<br />
Freundschaftskontakte weniger engagiert wahr, ziehen sich schneller zurück und gehen von<br />
einer negativeren Selbsteinschätzung aus. Außerdem sind sie im Vergleich zu gleichaltrigen Jungen<br />
aus besser gestellten Familien seltener in Sport- oder anderen Vereinen engagiert und fühlen<br />
sich selbst weniger fähig zur Lösung von Konflikten.<br />
Mädchen weisen im Vergleich zu Jungen eher im jugendlichen Alter eine erhöhte Verwundbarkeit<br />
auf. Sie leiden dann mehr unter dem Gefühl, nicht mithalten zu können, und haben wenig<br />
Selbstvertrauen (Hölscher 2001). Sie haben seltener eine beste Freundin oder einen besten<br />
Freund. Zwar sind sie genauso oft Mitglied einer Clique wie andere Mädchen, sie verbringen<br />
aber weniger Zeit mit ihrer Clique. Es ist anzunehmen, dass in dieser Lebensphase die durch die<br />
Armut bedingte Belastung und eine entwicklungsbedingte Verwundbarkeit zusammentreffen.<br />
Auch auf eine angespannte Atmosphäre im Elternhaus reagieren Mädchen in diesem Alter<br />
sensibler. Jungen sind oft nicht mehr so stark an das Elternhaus gebunden, leiden daher weniger<br />
unter dieser Familienatmosphäre bzw. suchen mehr Anschluss an Gleichaltrige. Für beide<br />
Geschlechter gilt, dass insbesondere ein bester Freund/eine beste Freundin und die Zugehörigkeit<br />
zu einer größeren Freundschaftsgruppe positive Auswirkungen hat (Ulich 1988; Elder/Caspi<br />
1991; Walper 1995; Richter 2000; Hölscher 2001).<br />
Rückzug = Isolation<br />
Schützende Prozesse<br />
Negatives Selbstbild<br />
besonders bei Jungen<br />
43<br />
Mädchen besonders im Jugendalter<br />
verwundbar
44<br />
Wichtigste Ressource:<br />
soziale Integration<br />
Schulische<br />
Unterstützungsformen<br />
Sportvereine:<br />
Zugangsbarrieren abbauen<br />
Trennungsbelastungen<br />
verringern<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Auch profitieren <strong>Kinder</strong> von einer außerhäuslichen Betreuung in ihrer Sozialentwicklung und<br />
ihren Schulleistungen.<br />
Sich nicht geschlechtsstereotyp zu verhalten, gilt bei Mädchen wie Jungen als eine weitere<br />
Ressource. Gleiches gilt <strong>für</strong> die Fähigkeit, überwiegend positive Reaktionen in der Umwelt hervorzurufen<br />
und eine hohe Erwartung an sich selbst, die Kontrolle über das eigene Tun zu behalten.<br />
Die Integration in Vereine, Freundschaftsgruppen oder Ähnliches fördern die erwähnten<br />
wichtigen sozialen Ressourcen weiter.<br />
Ansatzpunkte <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung<br />
Die wichtigste Prämisse vorweg: Gesundheitsförderung sollte Gesundheitsressourcen stärken<br />
und an den Lebensbedingungen der Menschen ansetzen.<br />
Im schulischen Alltag beeinflussen in erster Linie das Klassenklima und das Verhalten der<br />
Lehrer die Lage von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler<br />
sind häufig darauf angewiesen, dass Lehrer und Sozialarbeiter sie auf wahrgenommene Probleme<br />
ansprechen, denn sie gehen mit solchen Anliegen nur selten von sich aus auf Erwachsene<br />
zu. Eine Sensibilisierung <strong>für</strong> Armutslagen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen und die Einbeziehung<br />
von Schulsozialarbeitern und Beratungslehrern sind erste Schritte. Betreuungsprojekte, die<br />
Frühstück, Mittagessen, Hilfe bei den Hausaufgaben, gezielte Förderung im Sprachbereich und<br />
Spiel- und Freizeitangebote bereitstellen, unterstützen <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armutslagen<br />
gezielt (vgl. dazu die gemeinsamen Richtlinien und Handlungsempfehlungen der gesetzlichen<br />
Krankenkassen zur Umsetzung des § 20 SGB V). Beispiele <strong>für</strong> die gesundheitsfördernden Wirkungen<br />
in diesem Sinne finden sich beim OPUS <strong>–</strong> Projekt (OPUS-Tagungsdokumentation<br />
1999).<br />
Eine gesundheitsfördernde und gesellschaftlich integrative Wirkung liegt im regelmäßigen<br />
sportlichen Engagement. Hierbei müssen sozial benachteiligte Mädchen besonders gefördert<br />
und direkt zur Teilnahme aufgefordert werden. Die Schwellen <strong>für</strong> eine kontinuierliche und längere<br />
Teilnahme über das Kindesalter hinaus sind sonst oft zu hoch. Generell gilt, dass <strong>alle</strong> Angebote<br />
<strong>für</strong> Mädchen und Jungen auf niedrigschwellige Zugangsbedingungen hin untersucht<br />
werden müssen (Brinkhoff/Mansel 1997).<br />
Nach Hölscher (2001) berichten Jugendliche, die das Scheidungsverfahren ihrer Eltern aktuell<br />
erleben, dass sie mit dieser Situation <strong>alle</strong>in zurechtkommen müssen. Gleichzeitig ergibt<br />
sich plötzlich eine finanzielle Notlage, mit der sie nicht umgehen können. Gleichaltrigen Freunden<br />
oder Freundinnen können sie ihre Sorgen kaum mitteilen, gegenüber Erwachsenen ist die<br />
Hemmschwelle oft zu hoch. Die ihnen im Verlauf von Trennungs- und Scheidungsverfahren zustehenden<br />
Beratungs- und Unterstützungsangebote nach §§ 17 und 18 KJHG (<strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfegesetz)<br />
müssen von ihnen nahe stehenden Unterstützungspersonen stärker eingefordert<br />
werden. Jugendliche brauchen diese Hilfe insbesondere während und nach Abschluss des Verfahrens.<br />
Denkbar wäre in diesen Fällen eine enge Kooperation zwischen (<strong>Kinder</strong>-)Arztpraxen<br />
und Beratungsstellen, um <strong>Kinder</strong>n, Jugendlichen und Erwachsenen z.B. in den Praxisräumen die<br />
Möglichkeit zum Gespräch anzubieten.
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Folgen der Armut <strong>für</strong> das psychosoziale Wohlbefinden der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen:<br />
Fazit <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung<br />
Arme <strong>Kinder</strong> und Jugendliche verarbeiten Belastungen und Konflikte häufig<br />
mit Ängstlichkeit und Depressivität.<br />
Schwierigkeiten werden oft verdrängt.<br />
Die eigene Situation wird auch vor anderen verleugnet. Dadurch kommt es<br />
zum Abbruch sozialer Kontakte.<br />
Hilflosigkeit und Rückzug auf sich selbst und auf die eigenen Ressourcen, aber<br />
auch Ärger, aggressives und normenverletztendes Verhalten sind bei armen<br />
<strong>Kinder</strong>n häufig anzutreffen.<br />
Arme <strong>Kinder</strong> haben Angst vor Stigmatisierung und leiden unter dem Gefühl<br />
der Einsamkeit.<br />
<strong>Kinder</strong> erleben die Arbeitslosigkeit ihrer Eltern als Opfer und sind anfälliger<br />
gegen Stress.<br />
Mädchen leiden im Jugendalter mehr als die Jungen unter dem Gefühl, nicht<br />
mithalten zu können. Das Selbstvertrauen der Mädchen ist auffällig niedrig.<br />
Mädchen im Jugendalter belastet die angespannte Atmosphäre im Elternhaus<br />
stärker als die Jungen.<br />
Protektive Faktoren <strong>für</strong> die Gesundheit armer <strong>Kinder</strong>:<br />
Gute Beziehung zu den Eltern und deren Unterstützung<br />
Förderliches Schulklima<br />
Geschlecht: weiblich. (Mädchen greifen eher auf Ressourcen im näheren Umfeld<br />
zurück als Jungen. Mädchen können besser soziale Netzwerke knüpfen<br />
als Jungen.)<br />
Ein(e) beste(r) Freund(in) oder die Zugehörigkeit zu einer Gleichaltrigengruppe<br />
Musizieren und Sport<br />
Erfolg in der Schule<br />
Handlungsbedarf zur Verringerung von Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen:<br />
Förderung der sozialen Ressourcen<br />
Angebote der außerhäuslichen Betreuung<br />
Integration der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen in Vereine, Freundschaftsgruppen<br />
oder andere Bezugssysteme<br />
Zugangsbarrieren niedrig halten bei Vereinsangeboten<br />
Die Schule könnte zur Verringerung der Armutsfolgen helfen durch:<br />
Vermittlung von Bewältigungskompetenzen<br />
Psychosoziale Unterstützung durch die Lehrer oder Schulsozialarbeiter<br />
Sensibilisierung der Klassenkameraden bzgl. Armut<br />
Angebot von Betreuungsprojekten wie z.B. Frühstück, Pausenbrot, Mittagstisch,<br />
Hilfe bei den Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten<br />
45
46<br />
Teil II. <strong>Kinder</strong> und Jugendliche <strong>–</strong> die wichtigste Zielgruppe<br />
Zum Vertiefen:<br />
Brinkhoff, K.-P.; Mansel, J. (1997): Soziale Ungleichheit, Sportengagement und psychosoziales<br />
Befinden im Jugendalter. In: Mansel, J.; Brinkhoff, K.-P.(Hrsg.): Armut im Jugendalter. Soziale<br />
Ungleichheit, Ghettoisierung und die psychosozialen Folgen. Weinheim und München.<br />
Elder, B.G.; Caspi, A.(1991): Lebensverläufe im Wandel der Gesellschaft: Soziologische und<br />
Psychologische Perspektiven. In: Engfer, A.: Minsel, B.; Walper, S. (Hrsg.): Zeit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>!<br />
<strong>Kinder</strong> in Familie und Gesellschaft. Weinheim.<br />
Hölscher, P. (2001): Mädchen und Jungen in Armut. Lebenslagen und Bewältigungsstrategien<br />
materiell deprivierter Jugendlicher. Dissertation in der Fakultät der Rehabilitationswissenschaften<br />
der Universität Dortmund. Dortmund<br />
Keupp, H.; Röhrle, B. (Hrsg.) (1987): Soziale Netzwerke. Frankfurt am Main<br />
Krappmann, L. (2000): <strong>Kinder</strong>armut. Expertise im Auftrag des Bundesministeriums <strong>für</strong> Familie,<br />
Senioren, Frauen und Jugend. Berlin<br />
Mädchen in Bewegung: Tagungsdokumentation der Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit<br />
Niedersachsen und des nds. Ministeriums <strong>für</strong> Frauen, Arbeit und Soziales, 2001<br />
Nestmann, F.; Schmerl, C. (Hrsg.) (1992): Frauen <strong>–</strong> das hilfreiche Geschlecht. Dienst am<br />
Nächsten oder soziales Expertentum? Reinbeck.<br />
OPUS-Tagungsdokumentation vom 27.4.1999: Balance halten ... <strong>Chancen</strong> <strong>für</strong> ein gesundes<br />
Gleichgewicht im Lebensraum Schule.<br />
Richter, A. (2000): Wie erleben und bewältigen <strong>Kinder</strong> Armut? Eine qualitative Studie über<br />
die Belastungen aus Unterversorgungslagen und ihre Bewältigung aus subjektiver Sicht von<br />
Grundschulkindern einer ländlichen Region. Aachen<br />
Rutter, M. (1998): Psychosocial Adversity: Risk, Resilience and Recovery. Unveröffentlichtes<br />
Manuskript.<br />
Schindler, H.; Wacker, A.; Wetzels, P. (Hrsg.) (1990): Familienleben in der Arbeitslosigkeit. Ergebnisse<br />
neuer europäischer Studien. Heidelberg.<br />
Ulich, M. (1988): Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen.<br />
Sonderdruck aus: Zeitschrift <strong>für</strong> Entwicklungspsychologie u. Pädagogische Psychologie.<br />
Bd. XX, Heft 2 146-166.<br />
Walper, S. (1995): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. In: Bieback, K.-J.; Milz, H. (Hrsg.): Neue<br />
Armut. Frankfurt/New York
Ute G. Ruhekissen<br />
Foto: www.offroadkids.de<br />
47
48<br />
Teil III. Hilfen<br />
3. Hilfen<br />
3.1 <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> arme <strong>Kinder</strong> und Jugendliche:<br />
Zielbereiche und Leitsätze<br />
3.2 Das professionelle Hilfesystem <strong>–</strong> was es (nicht) leistet.<br />
3.3 Wenn Hilfe nicht ankommt <strong>–</strong> Barrieren <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung<br />
3.4 Die Rolle des ÖGD im Hilfesystem<br />
3.1 <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> benachteiligte <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche: Zielbereiche und Leitsätze<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit wird seit vielen Jahren in Veröffentlichungen und Programmatiken<br />
thematisiert. Strategien und Handlungsfelder sind formuliert, aber die Umsetzung<br />
in regionale oder überregionale Aktivitäten steht noch am Anfang. Gesundheitsbezogene Angebote<br />
gibt es genug. Nur sind diese Angebote nicht <strong>alle</strong>n in <strong>gleiche</strong>m Maß zugänglich. Und <strong>Kinder</strong><br />
und Jugendliche haben auf Dauer am meisten an den Folgen gesundheitlicher Benachteiligung<br />
zu tragen.<br />
Die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung <strong>für</strong> sozial<br />
benachteiligte <strong>Kinder</strong> und Jugendliche benötigt Ziele. Sie dienen sowohl als Basis <strong>für</strong> die Konzeption<br />
als auch als Kriterien <strong>für</strong> die Evaluation von Projekten und die Bewertung bereits vorhandener<br />
Hilfsangebote. In der Ottawa-Charta von 1986 wurden Handlungsfelder der Gesundheitsförderung<br />
definiert, die hier nachfolgend als Zielbereiche dargestellt werden. Um diese Ziele<br />
zu erreichen, muss die Gesundheitsförderung <strong>für</strong> sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche bestimmten Anforderungen entsprechen.<br />
Ziele Anforderungen<br />
Gesundheitsförderung will... Gesundheitsförderung <strong>für</strong> sozial benachteiligte<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche...<br />
eine gesundheitsförderliche<br />
Gesamtpolitik entwickeln<br />
<strong>•</strong> ist mehr als medizinische und soziale Versorgung<br />
<strong>•</strong> muss auf mehreren Ebenen und Politiksektoren ein<br />
Anliegen sein: Sozial-, Gesundheits-, Familien- und<br />
Bildungspolitik<br />
<strong>•</strong> sensibilisiert Verantwortliche und Entscheidungsträger<br />
<strong>für</strong> die Reduzierung un<strong>gleiche</strong>r Gesundheitschancen<br />
<strong>•</strong> macht den Handlungsbedarf offenkundig durch<br />
kontinuierliche Berichterstattung
Ziele Anforderungen<br />
gesundheitsförderliche<br />
Lebenswelten schaffen<br />
die Gesundheitsdienste neu<br />
orientieren<br />
gesundheitsbezogene<br />
Gemeinschaftsaktionen<br />
unterstützen<br />
persönliche Kompetenzen<br />
entwickeln helfen<br />
Teil III. Hilfen<br />
<strong>•</strong> übernimmt Verantwortung und wird aktiv<br />
<strong>•</strong> handelt vernetzt und interdisziplinär<br />
<strong>•</strong> ermöglicht <strong>alle</strong>n <strong>Kinder</strong>n, Jugendlichen und ihren<br />
Eltern den <strong>gleiche</strong>n Zugang zur Gesundheit.<br />
<strong>•</strong> verbessert die Lebensbedingungen von <strong>Kinder</strong>n<br />
und Eltern z.B. durch Verringerung der Arbeitslosigkeit<br />
der Eltern, Verbesserung der Vereinbarkeit<br />
von Erwerbstätigkeit und Erziehung, Verringerung<br />
der Einkommensarmut, Bereitstellen eines Angebots<br />
an niedrigschwelligen Maßnahmen <strong>für</strong> betroffene<br />
Familien<br />
<strong>•</strong> schafft Lebensbedingungen und Strukturen, die gesundheitsförderliches<br />
Handeln ermöglichen<br />
<strong>•</strong> entwickelt lebenslagenorientierte Projekte<br />
<strong>•</strong> arbeitet in Settings: <strong>Kinder</strong>garten, Schule, Stadtteil,<br />
Jugendzentrum...<br />
<strong>•</strong> verbessert die kommunale Infrastruktur: unterversorgte<br />
Wohnviertel brauchen Betreuungs-, Bildungs-<br />
und Freizeitangebote<br />
<strong>•</strong> fördert Fachkompetenzen und bietet Fortbildung an<br />
<strong>•</strong> kooperiert mit Experten und Einrichtungen vor Ort<br />
<strong>•</strong> vernetzt und koordiniert Angebote<br />
<strong>•</strong> verbindet Gesundheits- mit Sozialberichterstattung<br />
<strong>•</strong> bevorzugt und fördert gemeinschaftliche Aktionen,<br />
die dennoch mit individuellen Bedürfnissen übereinstimmen<br />
<strong>•</strong> arbeitet interdisziplinär<br />
<strong>•</strong> bezieht Betroffene in Entscheidungen und die<br />
Durchführung von Aktivitäten mit ein<br />
<strong>•</strong> fördert flächendeckende gesundheitsförderliche<br />
Strukturen<br />
<strong>•</strong> stärkt soziale und gesundheitsbezogene Kompetenzen<br />
der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen und ihrer<br />
Eltern<br />
<strong>•</strong> nutzt vorhandene Ressourcen der Betroffenen<br />
<strong>•</strong> sorgt <strong>für</strong> die Ausbildung von Fachkräften<br />
<strong>•</strong> berücksichtigt die Bedürfnisse, Werte und<br />
Einstellungen der Menschen<br />
<strong>•</strong> ist Hilfe zur Selbsthilfe und fördert Autonomie und<br />
Eigenverantwortung<br />
49
50<br />
Teil III. Hilfen<br />
Da<strong>für</strong> bieten sich <strong>–</strong> wieder in Anlehnung an die Ottawa-Charta <strong>–</strong> folgende übergreifende Strategien<br />
an:<br />
Interessen vertreten<br />
„Ein guter Gesundheitszustand ist eine wesentliche Bedingung <strong>für</strong> soziale, ökonomische<br />
und persönliche Entwicklung und ein entscheidender Bestandteil der<br />
Lebensqualität. Politische, ökonomische, soziale, kulturelle, biologische sowie<br />
Umwelt und Verhaltensfaktoren können <strong>alle</strong> entweder der Gesundheit zuträglich<br />
sein oder auch sie schädigen. Gesundheitsförderndes Handeln zielt darauf<br />
ab, durch aktives anwaltschaftliches Eintreten diese Faktoren positiv zu beeinflussen<br />
und der Gesundheit zuträglich zu machen.“<br />
Befähigen und ermöglichen<br />
„Gesundheitsförderung ist auf <strong>Chancen</strong>gleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit<br />
gerichtet. Gesundheitsförderliches Handeln bemüht sich darum, bestehende<br />
soziale Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern sowie <strong>gleiche</strong><br />
Möglichkeiten und Voraussetzungen zu schaffen, damit <strong>alle</strong> Menschen befähigt<br />
werden, ihr größtmögliches Gesundheitspotential zu verwirklichen. Dies umfasst<br />
sowohl Geborgenheit und Verwurzelung in einer unterstützenden sozialen Umwelt,<br />
den Zugang zu <strong>alle</strong>n wesentlichen Informationen und die Entfaltung von<br />
praktischen Fertigkeiten als auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in Bezug<br />
auf die persönliche Gesundheit treffen zu können. Menschen können ihr Gesundheitspotential<br />
nur dann weitestgehend entfalten, wenn sie auf die Faktoren,<br />
die ihre Gesundheit beeinflussen, auch Einfluss nehmen können ....“<br />
Vermitteln und vernetzen<br />
„Der Gesundheitssektor <strong>alle</strong>in ist nicht in der Lage, die Voraussetzungen und guten<br />
Perspektiven <strong>für</strong> die Gesundheit zu garantieren. Gesundheitsförderung verlangt<br />
vielmehr ein koordiniertes Zusammenwirken unter Beteiligung der Verantwortlichen<br />
in Regierungen, im Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssektor, in<br />
nichtstaatlichen und selbstorganisierten Verbänden und Initiativen sowie in lokalen<br />
Institutionen, in der Industrie und in den Medien. Menschen in <strong>alle</strong>n Lebensbereichen<br />
sind daran zu beteiligen als Einzelne, als Familien und als Gemeinschaften.<br />
Die Berufsgruppen und sozialen Gruppierungen sowie die Mitarbeiter<br />
des Gesundheitswesens tragen große Verantwortung <strong>für</strong> eine gesundheitsorientierte<br />
Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Interessen in der<br />
Gesellschaft.“ (Ottawa-Charta 1986)
Zum Vertiefen:<br />
Teil III. Hilfen<br />
Amann, G.; Wipplinger, R. (Hrsg.) (1998): Gesundheitsförderung <strong>–</strong> Ein multidimensionales<br />
Tätigkeitsfeld. Tübingen<br />
Franke, M.; Geene, R.; Luber, E. (Hrsg.) (1999): Armut und Gesundheit. Berlin<br />
Ottawa-Charta (1986)<br />
3.2 Das professionelle Hilfesystem <strong>–</strong> was es (nicht) leistet<br />
Welche Maßnahmen gibt es auf Bundesebene? <strong>–</strong> Eine Auswahl<br />
Soziale Benachteiligung von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen und deren Gesundheit wird zunehmend<br />
zu einem sozialpolitischen Thema. So wurde die Bekämpfung der Armut in der Koalitonsvereinbarung<br />
zwischen SPD und Bündnis 90/ die Grünen vom 20.10.1998 als ein Schwerpunkt der<br />
Politik der neuen Bundesregierung festgelegt. Im Frühjahr 2001 erschien daraufhin der erste<br />
„Armuts- und Reichtumsbericht“ <strong>für</strong> die Bundesrepublik Deutschland.<br />
Das Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit richtete im Januar 2000 eine Arbeitsgruppe „Armut<br />
und Gesundheit“ ein, der Vertreter von Bund und Land, der Krankenkassen, der Kassenärztlichen<br />
Bundesvereinigung, der Bundesärztekammer, des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und<br />
Experten aus Wissenschaft und Praxis angehören. Diese Arbeitsgruppe hat das Ziel, Armut<br />
nach dem Lebenslagenansatz zu untersuchen und Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung<br />
der Situation aufzuzeigen. Empfehlungen zu den Themen „Gesundheitliche Versorgung Obdachloser“<br />
sowie „Migration und Gesundheit“ existieren bereits.<br />
Die Krankenkassen erhielten mit der Neufassung des § 20 SGB V die Möglichkeit, mit ihren<br />
Leistungen zur Primärprävention einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit<br />
von Gesundheitschancen zu erbringen. Damit bleibt zu hoffen, dass sich die Krankenkassen<br />
verstärkt auch an der Finanzierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung armer<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendlicher beteiligen. Im Leitfaden der Spitzenverbände der Krankenkassen „Gemeinsame<br />
und einheitliche Handlungsfelder und Kriterien zur Umsetzung von § 20 Abs. 1 und<br />
2 SGB V“ (Juni 2000) heißt es in der Präambel: „Maßnahmen zur Primärprävention sollen den<br />
allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminderung<br />
sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen leisten.“ Es werden spezifische und niedrigschwellige<br />
Zugangswege angeregt, insbesondere der Zugang über Settings.<br />
Zur Verhältnisprävention in der Kommune bietet das Bund-Länder-Programm „Stadtteile<br />
mit besonderem Entwicklungsbedarf <strong>–</strong> die soziale Stadt“ den Akteuren vor Ort eine Möglichkeit,<br />
auch auf gegebene Strukturen einzuwirken. Ca. 50 Millionen Euro stellt die Bundesregierung<br />
von 1999 <strong>–</strong> 2003 da<strong>für</strong> zur Verfügung. 249 Gebiete in 184 Städten und Gemeinden beteiligen<br />
sich derzeit an diesem Programm.<br />
„Entwicklung und <strong>Chancen</strong> junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ ist ein weiteres<br />
Programm des Bundesministeriums <strong>für</strong> Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in dem auf Pro-<br />
51<br />
BMfG-Arbeitsgruppe<br />
„Armut und Gesundheit“<br />
§20 SGB V <strong>–</strong> die Krankenkassen<br />
als Gesundheitsförderer<br />
Bund-Länder-Programme
52<br />
Sozial- und Gesundheitsberichterstattung<br />
<strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendhilfegesetz<br />
Teil III. Hilfen<br />
bleme und Schwierigkeiten junger Menschen in sozialen Brennpunkten eingegangen und auf<br />
bessere Voraussetzungen <strong>für</strong> ihre Zukunft hingewirkt wird.<br />
Auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wird der Einfluss der sozialen Lage<br />
auf die Gesundheit mittlerweile berücksichtigt. So gab kürzlich das Robert-Koch-Institut eine<br />
Schrift zum Thema „Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen und die Auswirkung auf die Gesundheit“<br />
heraus (Robert Koch-Institut 2001).<br />
Welche Maßnahmen gibt es auf Landesebene? <strong>–</strong> Einige Beispiele<br />
Soziale Benachteiligung hat als politisches Thema seit einiger Zeit auch in den Ländern und<br />
Kommunen an Stellenwert gewonnen. Viele Kommunen haben Armuts- bzw. Sozialberichte erstellt.<br />
Unterschiedliche Zielsetzungen und Aufträge liegen diesen Veröffentlichungen zugrunde,<br />
was eine Vergleichbarkeit schwierig macht. Art und Ausmaß der Handlungsempfehlungen variieren.<br />
Eher selten berücksichtigen Verfasser von Sozialberichten das Thema Gesundheit. In einzelnen<br />
Fällen erscheint ein Kapitel „Behinderte“ unter dem Stichwort „Hilfe in besonderen Lebenslagen“.<br />
Insgesamt aber gibt es meistens weder eine Bestandsaufnahme der Folgen von Armut<br />
<strong>für</strong> das körperliche und seelische Wohlbefinden noch entsprechende Empfehlungen <strong>für</strong><br />
Maßnahmen. Für die Praktiker in der sozialen Arbeit und Gesundheitsförderung bleibt zu wünschen,<br />
dass „Armut und Gesundheit“ in diesen Berichten zukünftig mit mehr Leben gefüllt wird<br />
und klarere Bezüge sowie konkretere Ansätze <strong>für</strong> Veränderungen aufgezeigt werden.<br />
Nicht viel anders stellt sich die Situation bei den Gesundheitsberichten dar. Auch hier wird<br />
die Darstellung von Einflüssen der sozialen Schicht auf die Gesundheit noch sehr zurückhaltend<br />
gehandhabt.<br />
Ausnahmen bestätigen die Regel. Nordrhein-Westfalen etwa bezieht das Thema „Soziale<br />
Ungleichheit und Gesundheit“ bereits in die Leitliniendiskussion mit ein. Auch in einigen kommunalen<br />
Gesundheitsberichten gibt es hier klare Bezüge. Im Stuttgarter Gesundheitsbericht<br />
und im Bericht zur <strong>Kinder</strong>gesundheit von Baden-Württemberg wurde Armut im Zusammenhang<br />
mit Gesundheit als eigenes Kapitel aufgenommen.<br />
Die Verbindung von Gesundheits- und Sozialberichterstattung <strong>–</strong> möglichst mit kleinräumiger<br />
Darstellung <strong>–</strong> sollte zum Standard werden, denn in der Praxis bestätigt sich immer wieder:<br />
das Eine kann ohne das Andere nicht viel bewirken. Wenn auf dieser Ebene bereits kooperiert<br />
würde, könnte man sich später bei der Suche nach kompetenten Partnern zur Vernetzung und<br />
Unterstützung viel Zeit und Kraft sparen.<br />
Welche gesetzlichen und institutionalisierten Hilfen gibt es? <strong>–</strong> Anregungen<br />
und Stichpunkte<br />
Der Anspruch des <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), <strong>alle</strong> jungen Menschen in ihrer<br />
individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu<br />
vermeiden bzw. abzubauen, enthält im Prinzip auch die Forderung nach <strong>Chancen</strong>gleichheit und<br />
Gesundheit <strong>–</strong> wenngleich aus der Sicht des Jugendamts Gesundheit im engeren Sinn nicht das<br />
vordergründige Thema ist.
Angebotsformen der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen sind:<br />
Teil III. Hilfen<br />
<strong>•</strong> Der Rechtsanspruch auf einen <strong>Kinder</strong>gartenplatz eröffnet <strong>Kinder</strong>n im Vorschulalter die<br />
Möglichkeit, ein soziales Miteinander zu üben.<br />
<strong>•</strong> Mit den Angeboten zur Ganztagsbetreuung wird auch schulpflichtigen <strong>Kinder</strong>n das<br />
Erproben von sozialen Kompetenzen ermöglicht.<br />
<strong>•</strong> Die Reform des Landesjugendplans im Jahr 1999 war Grundlage da<strong>für</strong>, Angebote <strong>für</strong><br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Notlagen und Konfliktsituationen fördern zu können.<br />
<strong>•</strong> Sozial schwache Familien werden gezielt unterstützt <strong>–</strong> z.B. über Angebote <strong>für</strong> Erholungsmaßnahmen<br />
<strong>für</strong> Familien mit <strong>Kinder</strong>n.<br />
<strong>•</strong> Den Zugang zu neuen Medien und damit eine Schlüsselqualifikation erhalten sozial<br />
benachteiligte Jugendliche im Rahmen der Jugendsozialarbeit und über Projekte der<br />
Jugendmedienarbeit.<br />
<strong>•</strong> Schulmüde Jugendliche erhalten eine gezielte Förderung in speziellen Angeboten.<br />
<strong>•</strong> Sozial benachteiligten jungen Menschen stehen darüber hinaus spezielle Beratungsangebote<br />
und handwerklich orientierte Projekte offen.<br />
Über eine vertiefte Kooperation von Jugendhilfe und Gesundheitspolitik könnten weitere Verbesserungen<br />
in der Prävention erreicht werden. Folgende Anregungen sind denkbar:<br />
<strong>•</strong> Ein konkretes Zusammenwirken von Jugendhilfe und Gesundheitspolitik sollte besonders<br />
dort angestrebt werden, wo Armut gehäuft auftritt. Insbesondere sollten Kooperationen mit<br />
den Einrichtungen der <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe gesucht werden <strong>–</strong> zur gezielten gesundheitlichen<br />
Förderung und Suchtprävention. Gesundheitsfördernde Interventionen z.B. zur<br />
Gesundheitserziehung im <strong>Kinder</strong>garten könnten gemeinsam mit dem Träger der <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendhilfe durchgeführt werden.<br />
<strong>•</strong> Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der offenen Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit<br />
erweist sich als sinnvoll, weil hier vor <strong>alle</strong>m sozial benachteiligte Jugendliche anzutreffen<br />
sind. Die Jugendwerkeinrichtungen bieten sich als geeignetes Feld <strong>für</strong> präventive Gesundheitspolitik<br />
an, da Jugendliche dort über einen längeren Zeitraum erreichbar sind.<br />
<strong>•</strong> Als Datenbasis <strong>für</strong> die Entwicklung zielgruppenspezfischer Angebote eignen sich die<br />
kommunalen Jugendhilfepläne. Wünschenswert wäre aber auch im Bereich der Jugendhilfeplanung<br />
eine Verbindung mit der Gesundheitsberichterstattung auf kommunaler Ebene.<br />
Die Jugendhilfe in<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
53
54<br />
Die Enquetekommission<br />
„Jugend-Arbeit-Zukunft“<br />
in Baden-Württemberg<br />
Mobile Jugendarbeit<br />
Landesprogramm<br />
„Mutter und Kind“<br />
Landesstiftung<br />
„Familie in Not“<br />
Teil III. Hilfen<br />
Exemplarische Angebote in Baden-Württemberg sind:<br />
<strong>•</strong> Die Enquetekommission „Jugend-Arbeit-Zukunft“ des Landtags stand seit Juni 1997 im<br />
Mittelpunkt des jugendpolitischen Interesses in Baden-Württemberg. Sie wurde beauftragt,<br />
eine Bestandsaufnahme zu erstellen, um daraus praktische Handlungsempfehlungen <strong>für</strong> die<br />
Politik zu formulieren. Der Bericht bewertete die Lebenslage junger Menschen, ihre Zukunftschancen<br />
in Ausbildung und Beruf und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen<br />
und politischen Leben. Handlungsempfehlungen ergaben sich u.a. bei Maßnahmen zur<br />
beruflichen Eingliederung arbeitsloser junger Menschen und zur Suchtvorbeugung, bei der<br />
Integrationsförderung <strong>für</strong> ausländische <strong>Kinder</strong> und Spätaussiedlerkinder, bei der Förderung<br />
der Mobilen Jugendsozialarbeit in Problemgebieten und von Modellen in der Jugendhilfe.<br />
Gemeinsamkeiten des Gesundheitsförderungskonzepts und Leitgedanken der<br />
Jugendhilfe waren Anlass, ein Stadtteilprojekt „Gesundheitsförderung mit Jugendlichen<br />
in Waiblingen-Süd“ in Kooperation von Mobiler Jugendarbeit und<br />
Gesundheitsamt durchzuführen. Ziel war es, die Lebenssituation von sozial benachteiligten<br />
Mädchen und Jungen durch Stärkung ihrer persönlichen und sozialen<br />
Ressourcen zu verbessern. Darüber hinaus sollte die Zusammenarbeit und<br />
Vernetzung im Stadtteil zwischen Bürgern und Experten aus dem Sozial-, Jugend-<br />
und Gesundheitsbereich gefördert werden. Die Projekterfahrungen ergaben,<br />
dass Gesundheitsförderung mit sozial benachteiligten Mädchen und Jungen<br />
kaum über befristete Kursangebote zu erreichen ist, sondern eine kontinuierliche<br />
Gruppenarbeit im Rahmen der mobilen Jugendarbeit erforderlich ist.<br />
<strong>•</strong> Die Mobile Jugendarbeit mit ihrem stadtteilbezogenen, gemeinwesenorientierten Ansatz<br />
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Diese Arbeitsform will Ressourcen der betroffenen jungen<br />
Menschen selbst wie auch aus den Institutionen des Gemeinwesen bündeln. Mobile Jugendarbeit<br />
ist vorrangig in das Lebensfeld der Jugendlichen eingebettet und stellt sich damit<br />
als ein hervorragender Kooperationspartner <strong>für</strong> Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung<br />
von armen <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen dar.<br />
<strong>•</strong> Das Programm „Mutter und Kind“ bietet <strong>alle</strong>inerziehenden Müttern und Vätern finanzielle<br />
und pädagogische Hilfen während der ersten drei Lebensjahre des Kindes. Durch die Inanspruchnahme<br />
kombinierter kommunaler und staatlicher Leistungen (Sozialhilfe und Erziehungszuschlag<br />
des Landes in Höhe von monatlich 306,78 €) bekommen Alleinerziehende<br />
ein sozialpädagogisches Betreuungsangebot, berufliche Beratung und die wirtschaftliche<br />
Grundlage, ihr Kind selbst zu erziehen. Der Erziehungszuschlag wird im Anschluss an das<br />
Bundeserziehungsgeld bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes gezahlt. Eine<br />
Teilzeitbeschäftigung oder eine Ausbildung während der Programmteilnahme ist möglich.<br />
Die Teilnehmerinnen finden sich zu regelmäßigen Gruppentreffen zusammen.<br />
<strong>•</strong> Dort wo andere finanzielle Hilfemöglichkeiten nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig gegeben<br />
sind, tritt die vom Land Baden-Württemberg im Jahr 1980 gegründete Stiftung „Fa-
Teil III. Hilfen<br />
milie in Not“ mit ihren Leistungen <strong>für</strong> werdende Mütter in Not- und Konfliktsituationen ein.<br />
Sie hilft auch Familien, die durch ein schwerwiegendes Ereignis wie Krankheit, Tod, längere<br />
Arbeitslosigkeit, Scheidung oder durch die Geburt eines Kindes in Not geraten sind. In einigen<br />
Kreisen ist Schwangeren und <strong>alle</strong>in Erziehenden die Aufnahme in das Programm<br />
„Mutter und Kind“ möglich.<br />
Wo gibt es Handlungsbedarf?<br />
Eine bundesweite Recherche über Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten (veröffentlicht<br />
im nationalen Abschlussbericht des EU-Projektes „Tackling Inequalities in Health“, herausgegeben<br />
von der BZgA) ergab, dass länderübergreifende Entwicklungsimpulse auf dem Gebiet<br />
der Prävention eher selten sind. Trotz der großen <strong>Band</strong>breite von ermutigenden Einzelprojekten<br />
haben solche Modellvorhaben eine begrenzte Reichweite. Die ungebrochene Brisanz<br />
ungleich verteilter Gesundheitschancen erfordert Vernetzung, Kooperation, Transparenz und<br />
nicht zuletzt den Rückhalt durch die Politik.<br />
Die meisten Projekte, die im Bericht zu „Tackling Inequalities in Health“ ausgewertet wurden,<br />
widmen sich der gesundheitlichen Versorgung und Aufklärung. Wenige Projekte zielen auf<br />
die Stärkung von Ressourcen der Betroffenen. Selten zu finden waren auch mehrdimensionale<br />
Ansätze, die etwa Information, Verhaltensänderung und strukturellen Änderungen verbanden.<br />
Betroffene durften selten aktiv werden.<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
Das müsste eingeführt, ausgebaut oder optimiert werden:<br />
Verbesserte Vernetzung von Bund, Land und Kommune<br />
Verbindung von Gesundheits- und Sozialberichterstattung<br />
Überblick über vorhandene Projekte<br />
Koordination von Projekten, Handlungsfeldern und Kooperationspartnern<br />
Übertragung geeigneter Projekte von der kommunalen Ebene auf die Landesebene<br />
Fachkompetente Informationsstellen und Beratung<br />
Langfristige Projekte mit ganzheitlichem Ansatz: Verhalten, Wissen und Verhältnisse<br />
verbessern (Kombinationsprojekte)<br />
Möglichkeit, längerfristig geeignete Projekte zu finanzieren<br />
Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit<br />
Niedrigschwellige Angebote<br />
Angebote vor Ort zur Beratung, Unterstützung und Entlastung<br />
Integration von Bezugspersonen der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen <strong>–</strong> wie Eltern,<br />
Erzieher, Lehrer, <strong>Kinder</strong>ärzte <strong>–</strong> in entsprechende Maßnahmen<br />
55<br />
Wenig länderübergreifende<br />
Entwicklungen
56<br />
Teil III. Hilfen<br />
Zum Vertiefen:<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (2001): „Tackling Inequalities in Health“<br />
<strong>–</strong> ein Projekt des „European Network of Health Promotion Agencies“ (ENHPA) zur Gesundheitsförderung<br />
bei sozial Benachteiligten. Köln<br />
Kamensky, J.; Zenz, H. (2001): Armut <strong>–</strong> Lebenslagen und Konsequenzen. Ursachen, Ausmaß<br />
und Bewältigung sozialer Ungleichheit am Beispiel des Landkreises Neu-Ulm. Ulm<br />
Laaser, U; Gebhardt, K.; Kemper, P. (Hrsg.) (2001): Gesundheit und soziale Benachteiligung.<br />
Informationssysteme <strong>–</strong> Bedarfsanalysen <strong>–</strong> Interventionen. Verlag Hans Jacobs, Lage<br />
Landeshauptstadt Stuttgart (Referat Soziales, Jugend und Gesundheit, Gesundheitsamt) (Hrsg.)<br />
(2000): Gesundheitsbericht Stuttgart 2000. Stuttgart<br />
Mielck, A. (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze,<br />
Interventionsmöglichkeiten. Bern<br />
Robert Koch-Institut (Hrsg.) 2001: Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen und die Auswirkungen<br />
auf die Gesundheit. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 03/1<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (2000): <strong>Kinder</strong>gesundheit in Baden-Württemberg.<br />
Stuttgart<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (2000): Landesjugendplan 2000/2001. Jugendhilfe in<br />
Baden-Württemberg. Stuttgart<br />
Ministerium <strong>für</strong> Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW (2001): 7. <strong>Kinder</strong>- und Jugendbericht<br />
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.<br />
3.3 Wenn Hilfe nicht ankommt <strong>–</strong> Barrieren <strong>für</strong> die<br />
Gesundheitsförderung<br />
Kennen Sie das?<br />
Aktionstag „Cocktails ohne Alkohol“ auf dem Rathausplatz: „Wir hatten uns<br />
so viel Mühe gegeben, aber die Jugendlichen (die gewünschte Zielgruppe)<br />
hat das wohl nicht interessiert.“<br />
„Patrick hat eine Sprachstörung.“ sagt die Erzieherin. „Seine Mutter will<br />
davon nichts wissen.“<br />
Julia, 14 Jahre, ist stark übergewichtig. Sie würde gerne einen Kurs besuchen<br />
oder mehr Sport treiben. Einen Abnehmkurs <strong>für</strong> Mädchen ihrer Altersgruppe
Teil III. Hilfen<br />
in ihrer Nähe gibt es nicht, der Beitrag im Sportverein ist zu teuer, und zu Hause<br />
findet sie weder Gehör <strong>für</strong> ihr Problem noch ein Interesse an gesunder Ernährung.<br />
Vortrag über Suchtprävention: „Es waren nur 3 Leute da.“<br />
„Den <strong>Kinder</strong>n hat unser Bewegungstag viel Spaß gemacht. Der Elternabend war<br />
gut besucht. Aber: die Eltern, die es eigentlich betrifft, waren wieder nicht da.“<br />
Impfaktion im Gesundheitsamt: „Es kamen nur die Mütter mit ihren <strong>Kinder</strong>n aus<br />
dem „besseren“ Stadtviertel“.<br />
Wenn Ihrem Aktionstag die Teilnehmer fehlen (oder die falschen da sind), dann kann das viele<br />
Gründe haben:<br />
Es könnte sein, dass Ihr Thema an der Zielgruppe vorbei geht, dass Sie Interessen und Bedürfnisse<br />
falsch einschätzen. Vielleicht sind auch Veranstaltungsort und -zeit ungünstig gewählt,<br />
oder der Preis <strong>für</strong> Ihr Angebot ist zu hoch.<br />
Bei der Gesundheitsförderung von sozial Benachteiligten stehen <strong>alle</strong>rdings noch andere<br />
Barrieren zwischen den Gesundheitsanbietern und den potentiellen Nachfragern. Es geht dabei<br />
übergreifend um diese Fragen:<br />
<strong>•</strong> Wie erreichen wir die Zielgruppe besser?<br />
<strong>•</strong> Wie bringen wir zukünftige Akteure (Kooperationspartner, Verantwortliche, Sponsoren) mit<br />
der Zielgruppe zusammen?<br />
<strong>•</strong> Wie überzeuge ich intern (Kollegen, Vorgesetzte), dass ich <strong>für</strong> genau diese Zielgruppe ein<br />
Angebot erstellen möchte?<br />
Der Wunsch, sich gegenseitig besser zu erreichen, erfordert zunächst eine Bestandsaufnahme:<br />
Welche Barrieren existieren? Wodurch entstehen sie überhaupt? Wer oder was erhält sie aufrecht?<br />
Ist irgendwo der Zugang erschwert, tauchen meist immer wieder die <strong>gleiche</strong>n Defizite<br />
auf. Es fehlt an Offenheit, Verständnis, Transparenz und Flexibilität. Ein erster Schritt auf dem<br />
Weg zueinander könnte demnach mit folgenden Überlegungen beginnen: „Was wissen oder denken<br />
wir voneinander und wie gehen wir miteinander um?“<br />
Ein (nicht ganz) fiktives Beispiel aus der Schulpraxis<br />
Das folgende Praxis-Beispiel ist <strong>–</strong> in Ablauf und handelnden Personen <strong>–</strong> bewusst ein wenig zugespitzt.<br />
Der geschilderte Fall soll deutlich machen, dass subjektive Sichtweisen, Einstellungen<br />
und Interessen oft die größten Handlungsbarrieren darstellen. Gesundheitsförderer müssen das<br />
in ihrer Strategie berücksichtigen.<br />
Tina, Jenny, Stefan und Ali sind die Sorgenkinder von Frau Schmelzer, Klassenlehrerin der<br />
Klasse 5a in der Hauptschule einer Kleinstadt. Die <strong>Kinder</strong> kommen täglich ohne Frühstück und<br />
Pausenbrot zum Unterricht und sehen sehr müde aus. Frau Schmelzer teilt dieses Leid mit vielen<br />
Kollegen, die auch über unkonzentrierte Schüler klagen. Tinas Mutter arbeitet morgens ab<br />
6.00 Uhr als Reinigungsfrau in einem Amt und kann sich nicht um das Frühstück kümmern. Der<br />
Vater schläft zu dieser Zeit seinen Rausch aus. Bei Jenny und Stefan wird grundsätzlich nicht gefrühstückt.<br />
Ali hat noch 5 Geschwister und ist komplett sich selbst überlassen. Er bekommt täg-<br />
Barrieren ermitteln und<br />
analysieren<br />
57
58<br />
Teil III. Hilfen<br />
lich Geld mit in die Schule, das er aber lieber in Zigaretten und Comics umsetzt. Gespräche mit<br />
den <strong>Kinder</strong>n verlaufen ohne Erfolg. Die <strong>–</strong> mehrfach versuchte <strong>–</strong> Kontaktaufnahme mit den Eltern<br />
schlägt fehl. Ein gemeinsames Pausenbrot in der Klasse oder die Einrichtung einer <strong>Kinder</strong>tafel<br />
(ein Verpflegungsangebot, wo <strong>Kinder</strong> und Jugendliche kostenlos oder gegen einen minimalen<br />
Unkostenbeitrag mehrmals in der Woche oder auch täglich ein warmes Mittagessen erhalten)<br />
scheitert an den unterschiedlichen Ansichten bezüglich eines Handlungsbedarfs.<br />
Wie denken die Beteiligten über das Problem?<br />
Bürgermeister und Stadtrat:<br />
„Eine <strong>Kinder</strong>tafel einrichten an der Hauptschule? Bloß keine schlafenden Hunde wecken, sonst<br />
möchten <strong>alle</strong> anderen Schulen auch einen gemeinsamen Mittagstisch, und das kann keiner bezahlen.<br />
Richtige Ernährung ist Angelegenheit der Eltern.“<br />
Der Rektor:<br />
„Schlechte Konzentration bei einigen Schülern ist durchaus problematisch. Aber <strong>für</strong> das Pausenbrot<br />
haben wir ja unseren Hausmeister.“<br />
Die Lehrerinnen und Lehrer:<br />
„Das ist ganz typisch <strong>für</strong> die Eltern von solchen <strong>Kinder</strong>n. Schieben die Verantwortung der<br />
Schule zu, und wir müssen sehen, wie wir mit den <strong>Kinder</strong>n zurechtkommen. Täglich ein gemeinsames<br />
Pausenbrot zu veranstalten, wäre schon gut <strong>–</strong> aber wann sollen wir dann den Lernstoff<br />
durchnehmen? Schließlich haben wir einen Lehrplan, der abgearbeitet werden muss. Am<br />
Elternabend haben wir das Thema schon öfters diskutiert, aber diese Eltern zeigen weder Einsicht<br />
noch Interesse.“<br />
Die Eltern:<br />
Mutter von Tina:<br />
„Um was soll ich mich noch <strong>alle</strong>s kümmern? Das Kind ist jetzt 11 Jahre alt und wird sich doch<br />
selbst ein Frühstück machen können. Ständig haben die Lehrer etwas anderes zu nörgeln. Wozu<br />
geht das Kind in die Schule, wenn sie dort nicht in der Lage sind, dem Kind etwas beizubringen?<br />
Zum Elternabend gehe ich nicht, weil ich um 5 Uhr aufstehen muss, um rechtzeitig auf der Arbeit<br />
zu sein. Seit mein Mann seine Arbeit verloren hat, besäuft er sich den ganzen Tag <strong>–</strong> der ist<br />
mir auch keine große Hilfe“.<br />
Mutter von Jenny:<br />
„Wir frühstücken grundsätzlich nicht, weil da<strong>für</strong> keine Zeit ist. Ich habe 4 <strong>Kinder</strong>, die <strong>alle</strong> zur<br />
<strong>gleiche</strong>n Zeit aus dem Haus müssen. Die Nerven habe ich nicht, auch noch jedes Kind zum Frühstück<br />
zu überreden. Das Pausenbrot haben sie <strong>alle</strong> immer wieder mit nach Hause gebracht. Das<br />
ist rausgeworfenes Geld. Die Lehrerin soll sich das mal antun mit 4 minderjährigen <strong>Kinder</strong>n in<br />
einer viel zu kleinen Wohnung.“<br />
Mutter von Stefan:<br />
„Wenn der Junge in der Schule müde ist, dann hat er mal wieder zu lange vor dem Fernseher<br />
gesessen. Aber zu essen bekommt er genug! Der <strong>Kinder</strong>arzt meint wohl auch, der Stefan ist zu
Teil III. Hilfen<br />
dünn, aber das glaube ich nicht. Diese ganzen Broschüren vom Arzt lese ich sowieso nicht, da<br />
kann doch kein Mensch was mit anfangen und was das <strong>alle</strong>s kostet. Zum Elternabend gehe ich<br />
nicht mehr, weil die einen immer so blöd anschauen, wenn man keinen Mann und keine Arbeit<br />
hat. Die meinen immer, ich bin zu <strong>alle</strong>m zu faul. Wenn mein Ex-Mann den Unterhalt bezahlen<br />
würde, dann hätten wir keine Probleme.“<br />
Mutter von Ali:<br />
„Der Junge macht, was er will. Da komme ich nicht mehr weiter. Soll sich doch die Schule darum<br />
kümmern. Die Lehrerin wollte mich schon mal in einen Vortrag schicken über gesunde Ernährung.<br />
Was soll ich da? <strong>–</strong> Ich koche türkisch. Mit dem bisschen Sozialhilfe kann ich sowieso<br />
nur das Nötigste kaufen und Extrageld <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong> muss man ständig erbetteln. Der Sachbearbeiter<br />
redet leicht, ich soll mir Hilfe holen wegen Ali von so einer Erziehungsberatungsstelle.<br />
Hier im Stadtteil gibt es sowas nicht, und das Geld <strong>für</strong> den Bus kann ich woanders besser gebrauchen.“<br />
Die Entscheidungsträger sehen die Dinge aus der Distanz des nicht direkt Betroffenen. Die Lehrer<br />
haben ihre Möglichkeiten ausgeschöpft und brauchen einen Vermittler, neue Strategien und<br />
personelle Unterstützung. Sie wissen wenig über die Lebenslage ihrer Schüler bzw. können<br />
schlecht damit umgehen. Die Eltern verfügen nicht über ausreichende Bewältigungskompetenzen<br />
und haben Angst vor Diskriminierung, keine Zeit oder ganz andere, existentielle Probleme.<br />
Die <strong>Kinder</strong> sitzen zwischen den Stühlen.<br />
Was ist zu tun? <strong>–</strong> Eine Checkliste der Möglichkeiten<br />
<strong>•</strong> Analyse von Bedarf und möglichen Handlungsoptionen vor Ort, z.B. über eine Befragung<br />
(Einverständnis von Schulamt und Beteiligten vor Ort einholen)<br />
<strong>•</strong> Formulierung eines Berichts (in Vorbereitung eines Auswertungsgesprächs, siehe unten,<br />
und ggf. zur Vorlage in Ausschüssen, im Stadtrat, in der Gesundheitskonferenz etc.);<br />
versuchen Sie, das Problem zu objektivieren und in Tatsachenform zu präsentieren.<br />
<strong>•</strong> Auswertung und Besprechung der Befragungsergebnisse im Kreis von Lehrer-, Eltern-,<br />
Schüler- und Politikvertretern, unter Mitwirkung der Schulleitung, des Hausmeisters und<br />
anderer Beteiligter<br />
<strong>•</strong> Ausarbeitung eines Handlungsplans unter Herstellung einer Balance zwischen Wünschenswertem<br />
und Machbarem<br />
<strong>•</strong> Mobilisierung geeigneter Kooperationspartner, „Verbündeter“ und Sponsoren vor Ort<br />
<strong>•</strong> Planung und Durchführung einer Aktion „<strong>Gesunde</strong>s Pausenbrot“ (gemeinsam mit den Schülern)<br />
<strong>•</strong> Einrichtung eines Schülercafés in der Schule, das von den Schülern organisiert wird<br />
<strong>•</strong> Vermittlung einer Fortbildung „<strong>Gesunde</strong> <strong>Kinder</strong>ernährung“ <strong>für</strong> interessierte Lehrer<br />
<strong>•</strong> Einrichtung eines Essenangebots im Stadtteilzentrum, bei dem verschiedene Akteure und<br />
ggf. auch die besserverdienenden Eltern einbezogen werden (z.B. eine <strong>Kinder</strong>tafel, damit<br />
die <strong>Kinder</strong> wenigstens mit einer sicheren Mahlzeit rechnen können)<br />
Handlungsoptionen<br />
59
60<br />
Teil III. Hilfen<br />
<strong>•</strong> Formulierung lebenslagenorientierter Empfehlungen, die die Betroffenen im Alltag umsetzen<br />
können<br />
<strong>•</strong> Einrichtung einer Anlaufstelle in Sachen <strong>Kinder</strong>ernährung, mit Beratungs- und Informationsangeboten<br />
und ggf. <strong>–</strong> je nach Ressourcen (Freiwillige einbinden!) <strong>–</strong> auch aufsuchende Arbeit<br />
Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Sie zeigt aber die Abfolge der wesentlichen prinzipiellen<br />
Handlungsschritte auf, die von der Erfassung und Objektivierung des Tatbestands über<br />
die Einbindung und Aktivierung <strong>alle</strong>r Beteiligten hin zur Planung und Umsetzung einer zunehmend<br />
differenzierten und anspruchsvollen Maßnahmekette reicht. Dabei gilt grundsätzlich:<br />
Auch ein kleiner Einstieg kann ein guter Anfang sein.<br />
Auf den Punkt gebracht <strong>–</strong> die 7 wichtigsten Barrieren zwischen Gesundheitsförderung<br />
und sozial Benachteiligten<br />
1. Informationsdefizite<br />
Sozial benachteiligte Personengruppen wissen wenig über:<br />
<strong>•</strong> Risikoverhalten und die Bewältigung von gesundheitlichen Problemen<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsförderung allgemein und die Umsetzung von Empfehlungen in den Alltag<br />
<strong>•</strong> die Regelversorgung und die relevanten Ansprechpartner<br />
<strong>•</strong> Bedarfe von <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen und besondere Fördermöglichkeiten<br />
<strong>•</strong> ihre Rechte<br />
Die Anbieter von Gesundheitsförderung wissen oft wenig über:<br />
<strong>•</strong> die Zusammenhänge von Armut und Gesundheit<br />
<strong>•</strong> Bedürfnisse, Probleme, Lebenslage und Bedarf der Zielgruppe<br />
<strong>•</strong> das Ausmaß des Armutspotentials vor Ort<br />
<strong>•</strong> mögliche Kooperationspartner<br />
<strong>•</strong> bereits vorhandene Hilfsangebote <strong>für</strong> die Zielgruppe<br />
Hürden überwinden: Wie stellen Sie den Informationsfluss her?<br />
Regelmäßige Berichterstattung über Gesundheit und soziale Lage vor Ort<br />
Bereitstellung und Verbreitung gut aufbereiteter Daten zum Ausmaß<br />
der sozialen Benachteiligung<br />
Herstellung von Transparenz zu Ihren und anderen Angeboten <strong>für</strong><br />
einen besseren Überblick durch den Behördendschungel, z.B. durch<br />
einen Sozial- und/oder Gesundheitswegweiser<br />
Erstellung und/oder Verbreitung lebensstilorientierter Info-Materialien<br />
Einbindung von Betroffenen in Projekte z.B. stadtteilbezogener<br />
Gesundheitsförderung<br />
Erstellung von Leitlinien <strong>für</strong> die Arbeit mit der Gruppe sozial Benachteiligter<br />
Durchführung oder Vermittlung von Multiplikatorenschulungen
2. Fehlende Zeit und mangelnde Mobilität<br />
Teil III. Hilfen<br />
Alleinerziehende Mütter nennen häufig die fehlende <strong>Kinder</strong>betreuung als ein Hindernis bei der<br />
Teilnahme an den Angeboten der Gesundheitsförderung. <strong>Kinder</strong>reiche Familien fühlen sich<br />
überfordert, mit mehreren <strong>Kinder</strong>n zu verschiedenen Angeboten oder Behandlungen zu gehen.<br />
Sie sind ohne eigenes Auto weniger mobil und brauchen Fahrzeit und Geld <strong>für</strong> öffentliche Verkehrsmittel,<br />
die dann auch nur zu bestimmten Zeiten fahren. Länger dauernde Angebote können<br />
wegen der hohen Anforderungen der Alltagsroutine nicht in Anspruch genommen werden.<br />
Hürden überwinden: Wie helfen Sie beim Management von Raum und Zeit?<br />
Arbeiten Sie in Settings und ersparen Sie damit der Zielgruppe Fahrtzeit<br />
und - kosten.<br />
Organisieren Sie <strong>Kinder</strong>betreuung zu Ihren Angeboten.<br />
Die klassische „Komm-Struktur“ (Der Patient kommt zum Arzt) funktioniert<br />
nicht so gut bei sozial benachteiligten Menschen. Besser ist die<br />
„Geh-Struktur“: Bieten Sie Ihr Angebot an den Orten an, wo sich die<br />
Betroffenen auch befinden, wie z.B. im <strong>Kinder</strong>garten, in der Schule, im<br />
Hort, im Stadtteil, in der Entbindungsstation.<br />
Stellen Sie bei der Bekanntmachung Ihres Angebots den Nutzeffekt <strong>für</strong><br />
die Betroffenen deutlich heraus. Wer schon seine rare Zeit auf Ihr Angebot<br />
verwendet, will genau wissen, was er da<strong>für</strong> bekommt.<br />
3. Sprachbarrieren<br />
Viele Personen mit niedrigem sozialen Status verstehen komplexe Gesundheits- und Krankheitssachverhalte<br />
nicht bzw. fühlen sich vom Arzt nicht verstanden. Das Vokabular des durchschnittlichen<br />
sozial benachteiligten Menschen enthält in der Regel keine oder nur wenige medizinische<br />
Fachwörter. Klar und deutlich Beschwerden zu nennen und die Fragen des Arztes<br />
knapp und korrekt zu beantworten, fällt ihnen oft schwer. Problemlösekompetenzen bringen sie<br />
in der Regel nicht mit und sind ihnen aufgrund der Sprachprobleme auch nur schwer zu vermitteln.<br />
Anbieter und Nachfrager gesundheitlicher Leistungen können ihre Erwartungen aneinander<br />
oft nicht adäquat ausdrücken. Verständigungsprobleme resultieren zudem <strong>–</strong> vor <strong>alle</strong>m bei<br />
Migrantinnen und Migranten <strong>–</strong> aus derem Mangel an Deutschkenntnissen, insbesondere bezogen<br />
auf den Bereich Gesundheit.<br />
Hürden überwinden: So verstehen Sie sich besser!<br />
Sprechen Sie klar, deutlich, einfach und konkret.<br />
Begeben Sie sich sprachlich in etwa auf das Niveau ihrer Zielgruppe.<br />
Erklären Sie an Beispielen.<br />
Setzen Sie neben Broschüren auch andere Medien ein wie Schaubilder,<br />
61
62<br />
Teil III. Hilfen<br />
plastische Modelle (Lebensmittelattrappen, Wirbelkörper usw.), Filme<br />
oder auditive Medien.<br />
Nehmen Sie sich die Zeit, wichtige Dinge zu wiederholen.<br />
Vergewissern Sie sich, ob Sie verstanden wurden.<br />
Verfassen oder benutzen Sie Informationsmaterial in mehreren Sprachen.<br />
Nehmen Sie ggf. Kontakt mit Dolmetschern auf.<br />
Denken Sie bei häufigen Kontakten zu sozial Benachteiligten über eine<br />
Fortbildung in klientenzentrierter Gesprächsführung nach.<br />
Versuchen Sie, den Patient in seinem sozialen Kontext zu erfassen und<br />
auch zu verstehen.<br />
4. Angebote ohne Lebenslagenbezug<br />
Viele Angebote zur Gesundheitsförderung sind mittelschichtsorientiert. Sie berücksichtigen weder<br />
Bildungsstand noch Einkommenssituation von sozial Benachteiligten. Auch bei der Auswahl<br />
von Inhalten und Methoden <strong>–</strong> meistens Kurse oder Vorträge <strong>–</strong> findet die Lebenslage der Teilnehmer<br />
wenig Beachtung. <strong>Kinder</strong>, die nicht nur unter Bewegungsmangel leiden, sondern auch<br />
noch schlimme familiäre Konflikte zu erdulden haben, stoßen auf wenig Verständnis <strong>für</strong> ihre Situation.<br />
Tipps und Ratschläge <strong>für</strong> Menschen aus mittleren und oberen sozialen Schichten sind<br />
vielfach im Armutshaushalt nicht in die Praxis umzusetzen.<br />
Was den Zugang <strong>für</strong> sozial Benachteiligte zu solchen Angeboten noch erschwert, ist die Angst,<br />
von den anderen Teilnehmern als „Mensch zweiter Klasse“ identifiziert zu werden. Von der<br />
Kleidung über das nicht vorhandene Fahrrad bis hin zu der „Peinlichkeit“, dass Papa keine Arbeit<br />
hat <strong>–</strong> die anderen könnten es bemerken und verurteilen. Man gehört einfach nicht dazu.<br />
Hürden überwinden: Wie passen Sie Ihre Angebote an die Zielgruppe an?<br />
Gestalten Sie spezifische Angebote sowohl in der Gesundheitsförderung als<br />
auch in der gesundheitlichen Versorgung <strong>für</strong> die Menschen mit sozialer Benachteiligung.<br />
Entwickeln Sie lebenslagenorientierte Projekte, die sich an Bedarf,<br />
Alltag und den Fähig- und Fertigkeiten der Betroffenen orientieren. Aufklärung,<br />
Information und Beratung muss in ganz kleinen Schritten serviert<br />
werden, sonst kann es sein, dass Sie die Zielgruppe überfordern und ihre Bemühungen<br />
nur noch auf Reaktanz stoßen. Binden Sie Kooperationspartner<br />
ein, um der Vielschichtigkeit der Probleme gewachsen zu sein. Prüfen Sie bestehende<br />
Maßnahmen und deren Veranstalter auf die Tauglichkeit <strong>für</strong> die spezielle<br />
Zielgruppe der sozial Benachteiligten.
5. Das Image der Behörde<br />
Teil III. Hilfen<br />
Behörden machen vielen Menschen vordergründig Angst vor:<br />
<strong>•</strong> übermächtiger Autorität<br />
<strong>•</strong> Sanktionierung (wie Kürzung von Leistungen)<br />
<strong>•</strong> mangelndem Datenschutz und nicht eingehaltener Schweigepflicht (z.B. bei der „Amtshilfe“)<br />
<strong>•</strong> der Tatsache, dass man abermals darauf hingewiesen wird, etwas falsch gemacht zu haben,<br />
und unfähig ist, sich selbst zu helfen<br />
<strong>•</strong> der Bewusstwerdung, ein Mensch zweiter Klasse zu sein<br />
<strong>•</strong> Stigmatisierung und Diskriminierung, Ablehnung und Unverständnis<br />
<strong>•</strong> dem Aufwand, sein Problem in Worte fassen und Argumente finden zu müssen.<br />
Viele einkommensschwache Personen haben negative Erfahrungen mit Behörden. Sie können<br />
sich nur schwer vorstellen, dass Amtspersonen ihnen wohlwollend gegenüberstehen.<br />
Hürden überwinden: So schaffen Sie Vertrauen <strong>–</strong> ein Beispiel<br />
Im Sozialamt im Landkreis Neu-Ulm existiert seit 1999 eine Sondersachbearbeitung<br />
<strong>für</strong> <strong>alle</strong>inerziehende Sozialhilfempfänger mit der Zielsetzung, Betroffene<br />
bedarfsgerecht und lebenslagenorientiert zu beraten. Gegenseitiges Vertrauen<br />
sehen die Sachbearbeiter, neben dem Ausbau ihrer Fachkompetenz,<br />
als die Basis der Beratung. So veranstaltete das Sozialamt Neu-Ulm (auf eigene<br />
Kosten) einen Workshop <strong>für</strong> Sachbearbeiter und Betroffene zum „näher<br />
kennenlernen“. Einen ganzen Tag lang wurden in „neutralen“ Räumen Erfahrungen<br />
darüber ausgetauscht, wie jeder den anderen in seiner Rolle erlebt,<br />
Perspektivenwechsel ausprobiert, gegenseitige Erwartungen und Wünsche<br />
herausgearbeitet und Regeln <strong>für</strong> ein konstruktives Miteinander aufgestellt.<br />
Das Klima zwischen Beamten und Hilfebeziehern hat in jedem Fall profitiert.<br />
Die Vorstellung von der „Allmächtigkeit einer Behörde“ könnten Sie auch dadurch mildern,<br />
dass Sie die Zielgruppe <strong>–</strong> soweit wie möglich <strong>–</strong> an Entscheidungen teilhaben lassen. Den Eindruck,<br />
Hilfen würden über den Kopf der Betreffenden hinweg „im Gießkannenprinzip“ verteilt,<br />
kann man der Klientel nicht übel nehmen. Also: Fragen Sie auch mal nach dem individuellen<br />
Bedarf und schaffen Sie Situationen, in denen Betroffene zu Wort kommen.<br />
6. Kognitive Barrieren: Einstellungen, Werte und Prioritäten<br />
Einstellungen steuern Verhaltensweisen. In unteren sozialen Schichten trifft man oft auf Gedanken<br />
und Gewohnheiten, die Gesundheitsförderung schwierig machen. So nehmen manche<br />
Betroffene ihren Bedarf an Gesundheitsförderung und gesundheitlicher Versorgung gar nicht<br />
wahr, weil sie in ihrem Risikoverhalten keine Gefahr sehen.<br />
63
64<br />
Teil III. Hilfen<br />
Übergewicht z.B. ist eher positiv besetzt. Statussymbole in Form materieller Güter erscheinen<br />
wichtiger als immaterielle Werte wie etwa Gesundheit. Wünsche und Probleme der <strong>Kinder</strong> werden<br />
mit einer Extraportion Süßigkeiten kompensiert. Die Teilnahme am „Vegetarischen Kochkurs“<br />
birgt vielleicht das Risiko, dass liebgewonnene Essgewohnheiten sich als gesundheitsschädigend<br />
herausstellen <strong>–</strong> damit ist dann das letzte bisschen Freude am Leben hinfällig.<br />
Mit langfristig andauernder Armutslage macht sich Resignation breit. Wenig Aussicht auf<br />
das Ende der misslichen Situation steigert dieses Gefühl noch. „Was bringt das <strong>alle</strong>s?“ „Gesundheit<br />
ist schon wichtig, aber das löst meine Probleme wie Unterhaltsklagen, Arbeitslosigkeit<br />
und Geldmangel auch nicht.“<br />
Was sozial benachteiligte Menschen über die Bemühungen und Nicht-Bemühungen der Gesundheitsförderer<br />
und Versorger denken, ist kaum wissenschaftlich erforscht.<br />
Kognitive Barrieren gibt es auch auf der Seite der Anbieter von gesundheitsfördernden Aktivitäten.<br />
Die Erfahrung von Projekten mit geringem Erfolg ist beim zweiten Versuch mehr oder<br />
weniger ein großes Hindernis. Maßnahmen <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung sozial Benachteiligter<br />
brauchen einen langen Atem.<br />
Hürden überwinden: Wie berücksichtigen Sie Werte und Einstellungen Ihrer<br />
Zielgruppe?<br />
Hoffen Sie nicht darauf, dass die Betroffenen einen Beratungsbedarf erkennen.<br />
Wirken Sie vorsichtig auf Bewusstseinsbildung hin. Verknüpfen Sie die<br />
Gesundheitsförderung mit anderen Gesprächsanlässen, die die sozial Benachteiligten<br />
vordergründiger wahrnehmen. Laden Sie z.B. nicht zur Gesundheitsförderungsmaßnahme<br />
ein, sondern zum Sommerfest im Stadtteil mit Spiel und<br />
Spaß rund um das leibliche Wohl, und integrieren Sie dort Ihr Angebot. Einstellungen<br />
sind veränderbar durch neue und positive Erfahrungen. Stellen Sie<br />
Möglichkeiten und Räume zur Verfügung <strong>–</strong> <strong>für</strong> neue Erfahrungen, <strong>für</strong> die Steigerung<br />
des Selbstwertgefühls und das Einbringen eigener Kompetenzen. Planen<br />
Sie z.B. mit den <strong>Kinder</strong>n im sozialen Brennpunkt den Bau eines Abenteuerspielplatzes,<br />
rufen Sie zur Gemeinschaftsaktion „Stadtviertelmarathon“ auf,<br />
und machen Sie die Betroffenen zum Organisator. Psychosoziale Probleme haben<br />
Vorrang vor der Verringerung der direkt gesundheitsschädigenden Risikofaktoren<br />
wie Bewegungsmangel oder Rauchen. Respektieren Sie das Wertesystem<br />
von Menschen in benachteiligten Lebenslagen.<br />
7. Finanzen<br />
Gesundheitsförderliches Verhalten bringt häufig zusätzliche Kosten mit sich. Der Beitrag im<br />
Sportverein, eine gesunde Ernährung, Teilnahme an Entspannungskursen, der Kauf eines Fahrrads<br />
etc. erfordern Geld, das man nicht hat. Über Ermäßigungen (oder sogar die Befreiung von<br />
der Zuzahlung beim Zahnersatz) wissen viele Menschen nicht Bescheid. Außerdem müsste man<br />
sie erst beantragen. Das schreckt die Betroffenen ab.
Teil III. Hilfen<br />
Im einkommensschwachen Haushalt dreht sich oft ohnehin <strong>alle</strong>s nur ums Geld. Jede zusätzliche<br />
Ausgabe geht zu Lasten anderer Bedürfnisse. Es ist nur zu gut zu verstehen, dass zuerst einmal<br />
der notwendige Bedarf gedeckt wird und anderes ganz weit hinten ansteht.<br />
Hürden überwinden: Wie machen Sie Gesundheitsförderung <strong>für</strong> wenig Geld?<br />
Versuchen Sie, wenn immer möglich kostenfreie oder zumindest sehr günstige<br />
Angebote zu machen. Das geht nicht ohne Kooperationspartner <strong>–</strong> lokale Sponsoren,<br />
Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen. Die regionale Arbeitsgemeinschaft<br />
oder kommunale Gesundheitskonferenz ist auch hier<strong>für</strong> das erste Diskussionsund<br />
Akquiseforum. Sorgen Sie <strong>für</strong> mehr Information der Zielgruppe über Ansprüche<br />
und Vergünstigungen im gesundheitlichen Versorgungssystem. Die Möglichkeit<br />
einer Krankenkostzulage z.B. ist vielen Sozialhilfeempfängern nicht bekannt.<br />
Vermitteln Sie den Betroffenen gesundheitsförderliche Verhaltensweisen<br />
als finanzierbar und wenig aufwendig <strong>–</strong> bei großem Nutzeffekt.<br />
Zum Vertiefen:<br />
Böhm, B.; Janßen, M.; Legewie, H (1999): Zusammenarbeit professionell gestalten. Praxisleitfaden<br />
<strong>für</strong> Gesundheitsförderung, Sozialarbeit und Umweltschutz. Freiburg im Breisgau<br />
Brucks, U.; v. Salisch, E.; Wahl, W.-B. (1987): Soziale Lage und ärztliche Sprechstunde, Hamburg<br />
Dierks, M.-L. et al. (2001): Patientensouveränität <strong>–</strong> Der autonome Patient im Mittelpunkt. Arbeitsbericht<br />
(Nr. 195) herausgegeben von der Akademie <strong>für</strong> Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg.<br />
Stuttgart<br />
3.4 Die Rolle des ÖGD im Hilfesystem<br />
Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland hat<br />
seit nunmehr 7 Jahren Entschließungen zum Thema „Auswirkungen von sozialer Benachteiligung<br />
auf die Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n“ verabschiedet.<br />
Die GMK fordert:<br />
<strong>•</strong> eine lebenslagenorientierte, vernetzte Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe als prioritäre<br />
Perspektive im Gesundheitswesen,<br />
<strong>•</strong> die Erhöhung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten und die Steigerung der Kompetenzen<br />
<strong>für</strong> die Stärkung der eigenen Gesundheit.<br />
65
66<br />
GMK-Entschließungen<br />
Qualitätsstandards<br />
Symposium „Soziale<br />
Ungleichheit als<br />
Herausforderung <strong>für</strong><br />
Gesundheitsförderung“<br />
Teil III. Hilfen<br />
Einige zentrale Aspekte der Entschließungen der GMK sind dabei:<br />
<strong>•</strong> der Ausbau der Gesundheitsberichterstattung zum Zusammenhang sozialer Mangellagen<br />
und ihrer gesundheitlichen Folgen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche,<br />
<strong>•</strong> der Abbau von Zugangsbarrieren zu gesundheitlichen Versorgungsangeboten,<br />
<strong>•</strong> die Verbesserung der Handlungskompetenzen durch gesundheitsfördernde Aktivitäten, die<br />
als interdisziplinäre und ressortübergreifende Querschnittsaufgabe angelegt sind.<br />
Auch in Bezug auf den ÖGD werden Handlungsmuster formuliert:<br />
<strong>•</strong> Der ÖGD entwickelt kompensatorisch Angebote, soweit andere Akteure die Zielgruppe<br />
nicht angemessen erreichen.<br />
<strong>•</strong> Der ÖGD übernimmt die Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des gesamten Aufgabenfeldes<br />
vor Ort.<br />
<strong>•</strong> Der ÖGD braucht Partner wie z.B. Krankenkassen, Sozialversicherungsträger, <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendärzte, <strong>Kinder</strong>tageseinrichtungen, Sportvereine, den Selbsthilfebereich und Weiterbildungsträger.<br />
Vom Bundesland Hamburg wurden zur Umsetzung dieser Entschließungen Qualitätsstandards<br />
entwickelt. Sie enthalten konkrete Vorschläge zur Verminderung der Auswirkungen von sozialer<br />
Benachteiligung auf die Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n. Angeregt wird dort außerdem ein regelmäßiger<br />
Erfahrungsaustausch des Bundesgesundheitsministeriums und der Länder über erfolgreiche<br />
Maßnahmen und Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu gesundheitsfördernden Angeboten<br />
<strong>für</strong> Benachteiligte.<br />
Entwicklungen in Baden-Württemberg<br />
Vom Symposium „Soziale Ungleichheit als Herausforderung <strong>für</strong> Gesundheitsförderung“, veranstaltet<br />
vom Sozialministerium Baden-Württemberg 1995, gingen landesweite Impulse <strong>für</strong><br />
Gesundheitsförderungsstrategien aus, die auf eine Verbesserung der gesundheitlichen <strong>Chancen</strong><br />
<strong>für</strong> sozial benachteiligte Gruppen hinwirken. Während bisherige Konzepte und Methoden eher<br />
mittelschichtorientiert waren, sollte Gesundheitsförderung zukünftig auf neue Zielgruppen ausgeweitet<br />
werden und methodisch neue Wege einschlagen. Auf überregionaler Ebene wurden<br />
vermehrter Austausch und stärkere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis<br />
gewünscht.<br />
Daraufhin führte das Sozialministerium Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem<br />
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (LGA) 1996 eine Bestandsaufnahme von Projekten<br />
und Initiativen zu „Gesundheitsförderung mit sozial Benachteiligten“ durch. Es konnten 115<br />
Projekte aus unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern mit den Schwerpunkten <strong>Kinder</strong>, Jugendliche
Teil III. Hilfen<br />
und Migranten erfasst werden. Defizite waren hinsichtlich Projekten mit Sozialhilfeempfänger/innen,<br />
alten Menschen und stadtteilbezogenen Aktivitäten zu erkennen. Die Ergebnisse dieser<br />
Bestandsaufnahme <strong>–</strong> die im LGA erhältlich ist <strong>–</strong> wurden im Rahmen von Gesundheitsförderungs-Fachtagungen<br />
mit Gesundheitsämtern diskutiert und bewertet. Die Fachkräfte <strong>für</strong> Gesundheitsförderung<br />
waren übereinstimmend der Meinung, dass die Verringerung gesundheitlicher<br />
Ungleichheiten ein Rahmenziel <strong>für</strong> künftige Angebote der Gesundheitsförderung in Baden-Württemberg<br />
ist (vgl. Fachliche Empfehlungen zu den Schwerpunktaufgaben des ÖGD, LGA 2000).<br />
Im Jahr 2000 gab eine weitere Befragung genauer Aufschluss darüber, in welchen Bereichen<br />
der Gesundheitsförderung die Gesundheitsämter Handlungsbedarf zur Verbesserung gesundheitlichen<br />
<strong>Chancen</strong> sehen. Die Befragungsergebnisse basieren auf einer Rücklaufquote von<br />
70% (entsprechend 27 Bürgermeister-/Landratsämter <strong>–</strong> Gesundheitsämter):<br />
<strong>•</strong> Die Mehrzahl der Gesundheitsämter hält ein stärkeres Engagement des ÖGD <strong>für</strong> erforderlich.<br />
Vorrangige Zielgruppen bzw. Lebenswelten sind aus Sicht der Befragten: <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche, Familien/ Alleinerziehende, Migranten, Schulen, <strong>Kinder</strong>tagesstätten und<br />
Stadtteile/Gemeinden.<br />
<strong>•</strong> Folgende Aufgaben werden dabei dem ÖGD zugewiesen:<br />
- Gesundheitsberichterstattung/Bedarfsermittlung,<br />
- Informations- und Beratungsangebote,<br />
- Koordination und Vernetzung,<br />
- Initiierung von Maßnahmen und<br />
- Herstellung von Öffentlichkeit <strong>für</strong> das Thema.<br />
Verbesserung der Zugangswege, niedrigschwellige Angebote, Vernetzung der Ämter und<br />
Verbesserung der regionalen Infrastruktur sind aus dem Blickwinkel der Gesundheitsämter<br />
die zentralen Handlungsfelder.<br />
Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen<br />
In Nordrhein-Westfalen verabschiedete die 8. Landesgesundheitskonferenz am 16. Juni 1999 eine<br />
Entschließung: „Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in NRW“.<br />
Ausgangspunkt dieser Entschließung war eine Situationsanalyse in Nordrhein-Westfalen<br />
u.a. zum Ausmaß von sozialer Benachteiligung von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen im Bundesland.<br />
In der Entschließung wird u.a. eine bessere Analyse der aktuellen Situation der <strong>Kinder</strong>gesundheit<br />
in Nordrhein-Westfalen, die Entwicklung und Umsetzung prospektiver Studien und Längsschnittuntersuchungen<br />
und der Nachweis der Effizienz von Maßnahmen zur Verbesserung der<br />
<strong>Kinder</strong>gesundheit gefordert.<br />
Die Entschließung gibt Empfehlungen und benennt u.a. folgende notwendigen Schritte:<br />
Stärkung und Entlastung der Familien mit <strong>Kinder</strong>n,<br />
gesundheitspolitische Initiativen in konkreten Handlungsfeldern, die zur<br />
Stärkung der <strong>Kinder</strong>gesundheit beitragen,<br />
67<br />
Bestandsaufnahme zur<br />
„Gesundheitsförderung mit<br />
sozial Benachteiligten“<br />
LGK-Entschließung<br />
„Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche in NRW“
68<br />
LGK-Entschließung „Soziale<br />
Lage und Gesundheit“<br />
ÖGD-Gesetz NRW<br />
Kommunale<br />
Steuerungsgremien<br />
Teil III. Hilfen<br />
Zusammenführung von Gesundheits- und Sozialberichterstattung,<br />
effiziente Durchführung von Maßnahmen der Prävention und Aufklärung<br />
zur Vermeidung und Verringerung der gesundheitlichen Risiken von<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen,<br />
Verstärkung der Gesundheitsförderung in der Schule,<br />
Verstärkung der Elternarbeit sowie der Multiplikatorenschulung von<br />
Lehrern und Erziehern durch die Ärzteschaft, Apothekerschaft, Krankenkassen<br />
und den ÖGD,<br />
Ausbau der Angebote zur Freizeitgestaltung von <strong>Kinder</strong>n und Jugenlichen,<br />
verstärkte Kooperation zwischen Gesundheitswesen, Jugendhilfe und<br />
anderen Politikbereichen als Aufgabe der kommunalen Gesundheitskonferenzen,<br />
Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch verstärkte Anstrengungen im<br />
Bereich der Prävention.<br />
In der 10. Landesgesundheitskonferenz wurde das Thema „Soziale Lage und Gesundheit“ zum<br />
Gegenstand einer umfangreichen Entschließung, die auch der Situation von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
breiten Raum einräumt und zahlreiche Handlungsempfehlungen formuliert. Wenn<br />
hierbei der ÖGD auch nicht explizit im Mittelpunkt steht, so waren viele Bereiche betroffen, die<br />
in der Verantwortung des ÖGD liegen. Die Entschließung kann beim Ministerium <strong>für</strong> Frauen,<br />
Jugend, Familie und Gesundheit NRW (MFJFG) angefordert werden (Tel. 0211/855-5).<br />
§ 14 des ÖGD-Gesetzes von Nordrhein-Westfalen weist auf die vom ÖGD selbst zu erbringenden<br />
sozialkompensatorischen Aufgaben im Bereich soziale Ungleichheit und Gesundheit<br />
hin. Nach § 24 ÖGD-Gesetz NRW sollen zudem die Kommunalen Gesundheitskonferenzen und<br />
ihre Arbeitsgruppen hinsichtlich Beratung und Koordination der gesundheitlichen Versorgung<br />
auf kommunaler Ebene tätig werden.<br />
Sozialkompensatorische Aktivitäten zur <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit<br />
<strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche im Handlungsfeld Kommune<br />
Der Ort, an dem die Mehrzahl gesundheitlicher Aktivitäten <strong>für</strong> sozial Benachteiligte stattfindet,<br />
ist die Kommune. Eben der Ort, an dem sich die Betroffenen befinden. Hier in der Stadt, dem<br />
Stadtteil oder der Gemeinde ist es eine Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in seiner<br />
Funktion als Initiator, Vernetzer und Koordinator an der Zielvereinbarung „Gesundheit <strong>für</strong> <strong>alle</strong>“<br />
mitzuarbeiten. Mit den Regionalen Arbeitsgemeinschaften Gesundheit (RAG) bzw. den kommunalen<br />
Gesundheitskonferenzen steht in den Kommunen ein Instrument zur Verfügung, das weitestgehend<br />
die Versorgungsstruktur der Kommune im Bereich Gesundheit repräsentiert. Gesundheitskonferenzen<br />
und RAGs bieten geradezu ideale Voraussetzungen da<strong>für</strong>, gesundheitliche<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n, Jugendlichen und deren Eltern als bereichsübergreifendes<br />
Thema durch eine Vielzahl verhaltens- und verhältnisorientierter Maßnahmen<br />
aufzugreifen. Durch seine besondere Rolle in diesen Gremien besitzt der ÖGD hier eine wichtige<br />
Steuerungsfunktion.
Teil III. Hilfen<br />
Überträgt man die allgemeinen Anforderungen an die Gesundheitsförderung von sozial benachteiligten<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen auf das Handlungsfeld Kommune, dann lassen sich daraus<br />
zahlreiche Aufgaben <strong>für</strong> den ÖGD, die RAG oder die kommunalen Gesundheitskonferenzen<br />
ableiten. Die anliegende Liste verbindet kleine und große Schritte und erhebt natürlich keinen<br />
Anspruch auf Vollständigkeit:<br />
Aufgaben im Bereich <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendliche in der Kommune<br />
eine kleinräumliche Analyse der gesundheitlichen und sozialen Situation<br />
vor Ort erstellen, die ...<br />
... auf den Entscheidungsspielraum und die Handlungsmöglichkeiten von<br />
Ausschüssen, Beiräten und anderen relevanten Gremien zugeschnitten<br />
ist und erkennbare Dispositionen berücksichtigt,<br />
... der (Fach- und allgemeinen) Öffentlichkeit zugänglich ist,<br />
... Gesundheits-, Sozial- und Jugendberichterstattung verbindet,<br />
... auf die relevante Handlungsebene heruntergebrochen ist (z.B. Stadtteil,<br />
Wohnviertel oder Gemeinde),<br />
... handlungsorientiert, auf das Machbare konzentriert und gut lesbar ist.<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen als<br />
Schwerpunktthema plausibel machen und mit einer kommunalen, lokal<br />
spezifischen Programmatik füllen,<br />
Fachkräfte, Institutionen, potentielle Kooperationspartner und die<br />
Öffentlichkeit <strong>für</strong> das Thema soziale Benachteiligung bei <strong>Kinder</strong>n und<br />
Jugendlichen sensibilisieren und ein Problembewusstsein schaffen,<br />
Partnerschaften <strong>für</strong> Gesundheit innerhalb der Verwaltung, mit verschiedenen<br />
Akteuren des Gesundheitswesens und darüber hinaus festigen und ausbauen,<br />
die gesundheitliche Grundversorgung <strong>für</strong> Randgruppen der Gesellschaft (wie<br />
Obdachlose, Straßenkinder, Prostituierte etc.) sicherstellen,<br />
Projekte entwickeln und durchführen, die...<br />
... sich an der Lebenslage der Betroffenen orientieren,<br />
... bedarfsgerecht sind,<br />
... niedrigschwellig sind,<br />
... komplex sind: Verhalten, Verhältnisse, Gesundheitsförderung und -versorgung<br />
berücksichtigen,<br />
... vorhandene gesundheitlichen Ressourcen der Bevölkerung vor Ort stärken,<br />
... Betroffene in Entscheidungen und Aktivitäten mit einbeziehen<br />
(Empowerment und Selbstmanagement),<br />
69
70<br />
Brückenfunktion des ÖGD<br />
Teil III. Hilfen<br />
... die Gesundheitsgefährdungen der Eltern verringern, um den Gesundheitszustand<br />
der <strong>Kinder</strong> zu verbessern,<br />
konkrete Anstöße geben, Ansatzpunkte <strong>für</strong> Projekte aufzeigen und Kooperationspartner<br />
projektbezogen zusammenbringen,<br />
kommunale Infrastrukturen einrichten bzw. <strong>für</strong> die Nutzung durch sozial Benachteiligte<br />
optimieren (wie z.B. stadtteilbezogene Betreuungs-, Bildungs- und<br />
Freizeitangebote),<br />
Sorge tragen, dass Projekte langfristig finanziell gesichert sind, um eine Kon<br />
tinuität von Inhalten und Betreuungspersonen zu gewährleisten, bzw. Projekte<br />
so zu initiieren und begleiten, dass sie zum „Selbstläufer“ werden,<br />
die Zugangsmöglichkeiten zur Wahrnehmung gesundheitsbezogener Interessen<br />
<strong>für</strong> <strong>alle</strong> Bürger erweitern und eine stärkere Integration von Gesundheitsdiensten<br />
in <strong>Kinder</strong>tagesstätten und Schulen in entsprechenden Stadtteilen ermöglichen<br />
(z.B. ärztliche Sprechstunde im <strong>Kinder</strong>garten),<br />
die Fachkompetenz der Beteiligten durch Information und Beratung erweitern,<br />
z.B. in Form von Multiplikatorenschulungen zu Themen wie Zugangsbarrieren,<br />
zielgruppenbezogenen Strategien, Methoden und Maßnahmen,<br />
Gesundheitsförderung in der Kommune als handlungsleitendes Prinzip im Sinne<br />
einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik verankern.<br />
Diese lange und anspruchsvolle Liste erfordert ein Zusammenwirken vieler Akteure <strong>–</strong> idealerweise<br />
auf der Grundlage von Gesundheitskonferenz oder RAG <strong>–</strong> und einen langen Atem. Der<br />
ÖGD findet sich dabei in einer Schlüsselposition. Wie keine andere Einrichtung nimmt er eine<br />
Brückenfunktion zwischen handelnder Basis und politisch-administrativer Entscheidungsebene<br />
wahr. Das Instrument der Gesundheitsberichterstattung, seine Rolle im Bereich der kommunalen<br />
Koordination und Bündelung der Kräfte prädestinieren ihn <strong>für</strong> Bestandsaufnahmen, Überblicksdarstellungen,<br />
Prioritätenfindung und Entscheidungsvorbereitung. Der ÖGD transportiert<br />
<strong>–</strong> mit Hilfe von Gesundheitskonferenz und RAG <strong>–</strong> das Thema Armut und Gesundheit auf die politische<br />
Ebene; er verbindet Betroffene, handelnde Basis und übergreifende politische Entscheidungsfindung<br />
und kann dazu beitragen, das kommunalpolitische Klima im Sinne einer<br />
stärkeren Öffnung <strong>für</strong> das Thema gesundheitliche Benachteiligung zu prägen und den Gedanken<br />
einer gemeinschaftlichen Verantwortung <strong>für</strong> gesundheitlich Benachteiligte zu forcieren.<br />
Entscheidend ist dabei, dass er in geeigneter Weise die Initiative ergreift. Gefragt sind die<br />
Hinwendung zum Bürger und die offensive „Vermarktung“ des Themas <strong>–</strong> auch und gerade in<br />
der Konkurrenzdiskussion mit anderen Politikfeldern.
Zum Vertiefen:<br />
Teil III. Hilfen<br />
Entschließung der 8. Landesgesundheitskonferenz NRW vom 16. Juni 1999: Gesundheit <strong>für</strong><br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen.<br />
Entschließung der 10. Landesgesundheitskonferenz NRW vom 31. August 2001: Soziale Lage<br />
und Gesundheit.<br />
Ergebnisprotokoll der 73. Gesundheitsministerkonferenz am 28./29. Juni 2000 in Schwerin.<br />
TOP 15: Prävention <strong>–</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche, Bericht der Arbeitsgruppe <strong>–</strong> Antrag Hamburg<br />
Franke, M.; Geene, R.; Luber, E. (Hrsg.) (1999): Armut und Gesundheit. Berlin<br />
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (24.11.2000): Fachliche Empfehlungen zu<br />
Schwerpunktaufgaben des ÖGD. Stuttgart<br />
71
72<br />
Teil III. Notizen
Hardcore Job?<br />
www.offroadkids.de<br />
73
74<br />
Vier Planungsphasen<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
4. Die lokale Praxis oder „Wie gehen Sie vor?“<br />
4.1 Sie machen eine Bestandsaufnahme<br />
4.2 Sie finden Prioritäten und planen Maßnahmen<br />
4.3 Sie bringen Ihr Projekt in die Diskussion<br />
Von der Idee zur Umsetzung <strong>–</strong> einige Prämissen zum Thema Projektplanung<br />
mit sozial Benachteiligten<br />
Vielleicht ist dies Ihr erstes Projekt zum Thema „Soziale Benachteiligung und Gesundheit“.<br />
Selbsterfüllende Prophezeiungen oder die permanente Ahnung vieler Beteiligter begleiten Ihr<br />
Projekt mit gewissen Zweifeln, weil man ja schon weiß, dass die Zielgruppe schwierig ist. Ihre<br />
Vorgesetzten möchten vielleicht ständig auf dem Laufenden gehalten werden, denn das Thema<br />
Armut ist kein besonders attraktives Unterfangen <strong>für</strong> das Image einer Behörde. Nicht zuletzt<br />
übernehmen Sie später vielleicht eine Vorbildfunktion <strong>für</strong> benachbarte Regionen oder Einrichtungen,<br />
und da sollten Sie etwas vorweisen können, was nachahmenswert und machbar ist.<br />
Also gelten die Erfolgskriterien guter Projekte <strong>für</strong> Sie in besonderem Maße: klare Struktur,<br />
gute Planung und Organisation, sensible Umsetzung, verständliche Dokumentation. Wir haben<br />
die praktischen Abläufe <strong>für</strong> Sie in 4 Phasen zusammengefasst: Vorbereitungsphase, Planungsphase,<br />
Durchführungsphase und Evaluationsphase. Sie mögen in Ihrer konkreten Praxis zu anderen<br />
Begrifflichkeiten oder Detailschritten kommen <strong>–</strong> Transparenz über die vorgesehenen Abläufe<br />
und Schrittigkeiten, Rollen, Verantwortlichkeiten, Ziel- und Terminvereinbarungen sind<br />
letztlich <strong>für</strong> eine erfolgreiche Projektplanung unverzichtbar. Das Phasenraster kann dabei hilfreich<br />
sein.<br />
Vorbereitungsphase<br />
Sie haben eine Idee, hören von einem Problem, bekommen einen<br />
Auftrag.<br />
Sie stellen sich die ersten Fragen zur Orientierung<br />
Sie sammeln Daten, Fakten und Informationen.<br />
Sie bringen Ihr Thema in die RAG oder kommunale Gesundheitskonferenz.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Sie analysieren die erhaltenen Daten nach Defiziten, Schwachstellen<br />
und Überangeboten.<br />
Sie befragen Experten und Betroffene nach dem Bedarf.<br />
Sie leiten den konkreten Bedarf aus den vorhandenen Informationen<br />
ab.<br />
Projektideen kommen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zustande. Manchmal ist ein<br />
Hinweis aus der Bevölkerung, von Kollegen, Betroffenen oder aus der Presse der Auslöser, dass<br />
wir einem Thema nachgehen. Es kann aber auch ein explizit formulierter Auftrag, ein Auszug<br />
aus einem Gesundheitsbericht oder ein Vorschlag ihrer eigenen oder einer anderen Institution<br />
sein:<br />
<strong>•</strong> Erzieherinnen erzählen von immer mehr <strong>Kinder</strong>n, die Sprachstörungen haben.<br />
<strong>•</strong> Die Anzahl <strong>alle</strong>inerziehender Mütter mit kleinen <strong>Kinder</strong>n in der Sozialhilfe nimmt ständig<br />
zu, die Anzahl unterhaltszahlender Väter dagegen ab.<br />
<strong>•</strong> In der Grundschule fällt den Lehrern auf, dass viele <strong>Kinder</strong> beim Sport nicht richtig mitmachen<br />
können, weil sie Koordinationsschwierigkeiten haben.<br />
<strong>•</strong> Sie lesen in der Tageszeitung, dass sich die Stadtrandbewohner schon wieder über alkoholisierte<br />
Jugendliche beschweren.<br />
<strong>•</strong> Der Zahnarzt Ihres Vertrauens berichtet Ihnen während der Behandlung von den vielen <strong>Kinder</strong>n<br />
aus dem Stadtviertel Großburgfeld-Nord, bei denen die Mundhygiene sehr zu wünschen<br />
übrig lässt.<br />
<strong>•</strong> Die Schulsozialarbeiterin aus der Hauptschule bittet Sie als Gesundheitsförderer des ÖGD<br />
gezielt um eine Aktion zum Thema: „Schutz vor Hepatitis“, weil bereits zwei Schülerinnen<br />
davon betroffen sind.<br />
<strong>•</strong> Die Schuleingangsuntersuchung in diesem Jahr zeigte deutliche Entwicklungsverzögerungen<br />
bei den <strong>Kinder</strong>n aus dem Stadtviertel mit einem hohen Anteil an Aussiedlern. Ihr Chef<br />
meint, das dürfte nicht so bleiben: „Tun Sie was!“<br />
<strong>•</strong> Die Krankenkasse entschließt sich zur finanziellen Unterstützung eines Projekts im Bereich<br />
„Gesundheit am Arbeitsplatz“ <strong>für</strong> Berufsstarter aus dem sozialen Brennpunkt.<br />
Bevor Sie mit der Planung eines Projekts beginnen, stellen Sie sich die ersten Fragen zur Orientierung:<br />
<strong>•</strong> Wie viele Menschen betrifft das Problem?<br />
<strong>•</strong> Wie gestaltet sich das Problem genauer? Wodurch wird es sichtbar?<br />
<strong>•</strong> Was sind Ursachen und Konsequenzen des Problems? Warum ist das Problem entstanden?<br />
<strong>•</strong> Wie könnte man das Problem bewältigen oder lindern? Liegen die Handlungsoptionen im<br />
Rahmen kommunaler Zuständigkeiten und Möglichkeiten?<br />
<strong>•</strong> Was wurde bisher zur Lösung des Problems unternommen? Von wem?<br />
<strong>•</strong> Warum waren die bisherigen Lösungsversuche nicht erfolgreich?<br />
<strong>•</strong> Wo befinden sich die Menschen, die dieses Problem haben? Lässt sich ein sinnvoller Handlungsraum<br />
abgrenzen?<br />
75<br />
Beispiele <strong>für</strong> Projektanlässe
76<br />
Vorbereitende Fragen zur<br />
Orientierung<br />
Daten <strong>für</strong> ein schwieriges<br />
Thema<br />
Fragen rund um die<br />
Datenakquise<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
<strong>•</strong> Erachten die betroffenen Menschen das Problem auch als Problem? Gibt es Äußerungen von<br />
Betroffenen zum Handlungsbedarf?<br />
<strong>•</strong> Wie kann ich meinem Vorgesetzen, eventuellen Kooperationspartnern und anderen belegen,<br />
dass es sich hier um ein Problem handelt, das aktuell, prioritär und gleichzeitig handhabbar<br />
ist?<br />
<strong>•</strong> Wer kennt das Problem noch? Wer bietet sich als Kooperationspartner an?<br />
<strong>•</strong> Gibt es eine gesetzliche, administrative oder anders formalisierte Handlungsgrundlage?<br />
4.1 Sie machen eine Bestandsaufnahme<br />
Wie analysieren Sie die Situation?<br />
Um herauszufinden, welche Hilfe <strong>für</strong> sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong> und Jugendliche nötig ist,<br />
müssen das Ausmaß der Problematik, die Bedeutung des Themas im kommunalen Kontext sowie<br />
Bestand und Bedarf an Hilfsangeboten erhoben werden. Kurz: Sie brauchen eine Analyse<br />
der Situation nebst einer Dokumentation bereits vorhandener Einrichtungen, Akteure und Maßnahmen,<br />
bevor Sie sich dem Thema widmen und die konkrete Planung angehen können.<br />
Projekte zur Gesundheitsförderung von sozial Benachteiligten benötigen immer noch <strong>–</strong> trotz<br />
vieler Entschließungen und diverser gesetzlicher Regelungen <strong>–</strong> eine besondere Legitimation.<br />
Das unterscheidet diese Aktionen etwa von den bekannten mittelschichtorientierten Präventionskampagnen.<br />
Soziale Benachteiligung ist als politisches Thema nicht immer erwünscht und<br />
das Aufdecken von Problemen in diesem Bereich leider auch nicht. Umso wichtiger ist es, den<br />
kommunalspezifischen Bedarf anhand von Daten und Fakten konkret zu benennen. Auch die<br />
Diskussion in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft bzw. kommunalen Gesundheitskonferenz<br />
wird dadurch erleichtert.<br />
Eine gute Analyse der vorhandenen Angebote schützt Sie zudem davor, das Rad mehrfach<br />
zu erfinden, und führt Sie oft bereits am Anfang Ihrer Arbeit zu geeigneten Kooperationspartnern<br />
und Multiplikatoren.<br />
Grundsätzlich stehen eine Reihe von Datenquellen und Methoden <strong>für</strong> die Bestandsaufnahme<br />
und die Ableitung des Bedarfs zur Verfügung. Die konventionellen Methoden der sozialwissenschaftlichen<br />
Forschung wie umfassende schriftliche Befragungen oder der Einsatz<br />
psychologischer Testverfahren sind bei der besonderen Zielgruppe nur bedingt einsetzbar. Bei<br />
der Erhebung etwa von Bedürfnissen ist deshalb Kreativität gefragt.<br />
Am Anfang einer Bestandsaufnahme stehen folgende Fragen:<br />
Zum welchem Aspekt des Themas brauchen Sie Informationen?<br />
Welche Daten existieren und könnten <strong>für</strong> Sie hilfreich sein?<br />
Wo finden Sie „harte“ Daten?<br />
Wer kann Ihnen bei der Datensuche helfen?<br />
Welche Daten müssen erst erhoben werden?<br />
Wer kann bei der Interpretation der Daten helfen?<br />
Wie erheben Sie die existierenden Maßnahmen?<br />
Wer kann Ihnen weitere Informationen liefern?
Wie kommen Sie an Daten und Fakten?<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
„Harte“ Daten und Fakten zur gesundheitlichen Situation von armen <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
sind rar. Zwar interessiert sich die Wissenschaft zunehmend <strong>für</strong> dieses Thema, aber dennoch<br />
existiert noch immer keine repräsentative Studie dazu. Die kommunale Gesundheitsberichterstattung<br />
entdeckt ganz zaghaft, dass soziale Benachteiligung auch ein Gesundheitsthema ist. Die<br />
Jugendhilfeplanung berücksichtigt durchaus die Angehörigen unterer sozialer Schichten in ihren<br />
Darstellungen, aber Gesundheit <strong>–</strong> einmal abgesehen von Suchterkrankungen <strong>–</strong> wird dort<br />
nicht schwerpunktmäßig thematisiert. Umgekehrt ist Gesundheit auch noch selten Thema in Armuts-<br />
und Sozialberichten. Einen Datenband mit kombinierten Gesundheits- und Sozialindikatoren<br />
<strong>für</strong> <strong>alle</strong> Altersgruppen mit sozialer Benachteiligung werden Sie also nur schwer finden, in<br />
kleineren Regionen so gut wie überhaupt nicht.<br />
Aber es gibt Daten, nicht immer sehr differenziert und nicht immer zu Ihrem Thema, aber<br />
in jedem Fall einen Blick wert. Eine gute Grundlage <strong>für</strong> eine erste Bestandsaufnahme bietet etwa<br />
die Einschulungsuntersuchung, insofern sie kleinräumlich mit sozialen Faktoren in Verbindung<br />
gebracht werden kann. In einigen größeren Städten, wie z.B. in Köln, Düsseldorf, Stuttgart<br />
oder Mannheim, wird das bereits so praktiziert.<br />
Eine häufig genutzte Datenquelle in der Armutsforschung ist die Statistik des Sozialamts. Im<br />
Bereich „Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen“ <strong>alle</strong>rdings ist sie nur wenig aussagekräftig,<br />
weil das kein vorrangiges Thema <strong>für</strong> das Sozialamt ist. Für eine grobe Orientierung über die<br />
Sozialhilfedichte und die Identifikation von Wohngebieten mit einem hohen Anteil sozial Benachteiligter<br />
und deren Altersstruktur und Familienstand kann man aber durchaus auf die Daten<br />
des Sozialamts zurückgreifen. Für die Erhebung von Kausalzusammenhängen (Ursachen und<br />
Folgen von Armut) ist diese Statistik <strong>alle</strong>rdings weniger geeignet. Ob das Sozialamt Ihnen Spezialauswertungen<br />
macht, ist meist Verhandlungssache.<br />
Daten, Fakten und Hintergrundinformationen <strong>–</strong> einige Beispiele:<br />
Wonach suchen Sie? Woher bekommen Sie das?<br />
Überregionale Daten und<br />
Informationen zu Armut und<br />
sozialer Benachteiligung<br />
in Deutschland<br />
<strong>•</strong> Bundesamt <strong>für</strong> Statistik<br />
<strong>•</strong> Landesämter <strong>für</strong> Statistik<br />
<strong>•</strong> Landesjugendämter<br />
<strong>•</strong> Mikrozensus<br />
<strong>•</strong> Sozioökonomisches Panel<br />
<strong>•</strong> Deutsches Jugendinstitut, München<br />
(z.B. Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe)<br />
Armuts- und Sozialberichte:<br />
<strong>•</strong> Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und<br />
Reichtumsbericht der Bundesregierung (vorgelegt im<br />
April 2001)<br />
<strong>•</strong> Armutsberichte der Wohlfahrtsverbände: DPWV,<br />
Caritas, AWO<br />
<strong>•</strong> Armutsbericht der Hans-Böckler-Stiftung, des DGB<br />
und des Paritätischen Wohlfahrtsverbands: Armut<br />
Wenig „harte“ Daten<br />
77<br />
Schuleingangsuntersuchung<br />
Statistik des Sozialamts
78<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Überregionale Daten und<br />
Informationen zur<br />
gesundheitlichen Lage<br />
Überregionale Daten und<br />
Informationen zu sozialer<br />
Benachteiligung und<br />
Gesundheit<br />
und Ungleichheit in Deutschland (erschienen im<br />
November 2000)<br />
<strong>•</strong> Sozialbericht 2000 der Arbeiterwohlfahrt (AWO):<br />
„Gute Kindheit <strong>–</strong> Schlechte Kindheit. Armut und<br />
Zukunftschancen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
in Deutschland“ (vorgelegt im Oktober 2000)<br />
<strong>•</strong> Datenreport des Deutschen <strong>Kinder</strong>schutzbundes<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsberichterstattung des Bundes (Robert-<br />
Koch-Institut, Berlin)<br />
<strong>•</strong> Daten zur gesundheitlichen Versorgung und Gesundheitsbericht<br />
<strong>für</strong> Deutschland (Bundesamt <strong>für</strong> Statistik),<br />
Metzler-Poeschel-Verlag, Stuttgart 1998<br />
<strong>•</strong> Kassenärztliche Bundesvereinigung und Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsindikatoren <strong>für</strong> NRW (lögd)<br />
<strong>•</strong> Settertobulte, W. (2002): Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n<br />
und Jugendlichen in NRW. Sonderbericht im Rahmen<br />
der Gesundheitsberichterstattung NRW im<br />
Auftrag des Ministeriums <strong>für</strong> Frauen, Jugend,<br />
Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
<strong>•</strong> Bericht: <strong>Kinder</strong>gesundheit in Baden-Württemberg<br />
(Sozialministerium Baden-Württemberg, 2000)<br />
<strong>•</strong> Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung<br />
(BZgA) (1998): Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n <strong>–</strong> Epidemiologische<br />
Grundlagen. Dokumentation einer<br />
Expertentagung der BZgA. Reihe Forschung und<br />
Praxis der Gesundheitsförderung, <strong>Band</strong> 3. Köln<br />
<strong>•</strong> BZgA-Bericht (2001): „Tackling Inequalities in<br />
Health“ <strong>–</strong> ein Projekt des Europäischen Netzwerkes<br />
„European Network of Health Promotion Agencies“<br />
(ENHPA) zur Gesundheitsförderung bei sozial<br />
Benachteiligten.<br />
<strong>•</strong> Hitzler, R. (1999): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche an der<br />
Schwelle zum 21. Jahrhundert: Jugendszenen in<br />
Nordrhein-Westfalen. Strukturen und Veränderungen.<br />
Expertise zum 7. <strong>Kinder</strong>- und Jugendbericht<br />
der Landesregierung NRW. (hrsgg. vom<br />
Ministerium <strong>für</strong> Frauen, Jugend, Familie und<br />
Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen,<br />
Düsseldorf)
Regionale Daten zu Armut,<br />
sozialer Benachteiligung und<br />
Gesundheit<br />
Regionale Musterberichte zum<br />
Thema Armut und soziale<br />
Benachteiligung<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Informationen und Daten über <strong>•</strong> Armut in Nordrhein-Westfalen: Umfang und<br />
Armut in Nordrhein-Westfalen Struktur des Armutspotentials, Zentrum <strong>für</strong> interdisziplinäre<br />
Ruhrgebietsforschung (ZEFIR), Ruhr-Universität<br />
Bochum<br />
<strong>•</strong> Daten der Einschulungsuntersuchung (Gesundheitsamt,<br />
LGA, lögd)<br />
<strong>•</strong> Kommunale Gesundheitsberichterstattung<br />
<strong>•</strong> Sozialhilfestatistik (Sozialamt)<br />
<strong>•</strong> Arbeitslosenstatistik (Arbeitsamt)<br />
<strong>•</strong> Jugendhilfeplan (Jugendamt)<br />
<strong>•</strong> Daten des Amtes <strong>für</strong> Ausländerwesen<br />
<strong>•</strong> Sozialdatenatlas <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
(z.B. Landeshauptstadt Stuttgart)<br />
<strong>•</strong> Armuts- und Sozialberichte z.B. aus Bremen,<br />
Düsseldorf, Essen, Gießen, Hamburg, München,<br />
Neu-Ulm oder Stuttgart wie z.B.:<br />
Stadt Essen, Amt <strong>für</strong> Entwicklungsplanung, Statistik,<br />
Stadtforschung und Wahlen: Soziale Ungleichheit im<br />
Stadtgebiet. Kleinräumige Entwicklungen im Zeitraum<br />
31.12.1991 bis 31.12.1994. Kurzfassung.<br />
Beiträge zur Stadtforschung 17/II, Essen 1996,<br />
1. Auflage<br />
Landeshauptstadt Stuttgart (2000):<br />
Armut in Stuttgart <strong>–</strong> Quantitative und qualitative<br />
Analysen, Sozialbericht 1.<br />
Informationen und Daten über <strong>•</strong> Familienwissenschaftliche Forschungsstelle im<br />
Armut von Familien und Allein- Statistischen Landesamt Baden-Württemberg,<br />
erziehenden<br />
Stuttgart<br />
Die gewonnenen Daten, Fakten und Informationen sollten Sie in einem Bericht zusammenfassen<br />
und so aufbereiten, dass Sie nun einen Handlungsbedarf ableiten können.<br />
Sie kennen jetzt z.B.<br />
<strong>•</strong> den Anteil der <strong>Kinder</strong> im Stadtteil Großburgfeld-Ost, die mit Sozialhilfe aufwachsen<br />
(Sozialhilfestatistik),<br />
<strong>•</strong> den Anteil der <strong>Kinder</strong> im Stadtteil Großburgfeld-Graustadt mit Koordinationsschwierigkeiten<br />
und anderen grob- und feinmotorischen Störungen, die mit Sozialhilfe aufwachsen<br />
(kombinierte Schuleingangsuntersuchung mit soziodemographischen Daten),<br />
<strong>•</strong> das Angebot der Schule und des Sportvereins speziell zur Förderung dieser <strong>Kinder</strong> (Befragung<br />
der Lehrer, Veranstaltungskalender)<br />
und können jetzt den Bedarf einkreisen, Prioritäten vorschlagen und Lösungsvorschläge<br />
formulieren.<br />
Handlungsbedarf<br />
formulieren<br />
79
80<br />
Befragungen<br />
Sie interviewen Experten<br />
Sie führen eine schriftliche<br />
Experten-Befragung durch<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Wie erhalten Sie qualitative Informationen?<br />
Harte Daten und Fakten untermauern die Bedeutung des Themas besonders nachdrücklich, stützen<br />
die Legitimation und grenzen die Handlungsfelder räumlich und inhaltlich ein. Entscheidungsträger<br />
stützen sich gern auf solche harten Daten, und manch ideologisch ausgerichteter<br />
Gesundheitsberichterstatter sieht in ihnen die einzig legitimen Handlungsgrundlagen.<br />
Aber nicht zu jeder Fragestellung gibt es harte Daten. Zahlen und Statistiken geben zudem<br />
nur äußerst grob und selektiv über das Leben und die Bedürfnisse der Betroffenen und die strukturellen<br />
Probleme vor Ort Auskunft. Statistiken sagen auch wenig über Angebot und Engagement<br />
diverser Hilfsanbieter in der Region aus. Es liegt auf der Hand, dazu die Akteure und Betroffenen<br />
direkt zu befragen. Beginnen Sie in Ihrer unmittelbaren Nähe, und suchen Sie nach Informationen<br />
in der eigenen Einrichtung (<strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte, Zahnärzte, Prophylaxehelferinnen,<br />
Gesundheitsberichterstattung usw.). Je nach Zeit, Informationsbedarf und eigenen<br />
Möglichkeiten dehnen Sie dann Ihr Befragungsspektrum weiter aus.<br />
Fangen Sie mit den Experten an. Experten sind Menschen, die sich bereits mit dem Thema<br />
oder der Zielgruppe auseinandergesetzt haben bzw. damit arbeiten. Experten sitzen vorzugsweise<br />
direkt vor Ort, ganz nahe an der Zielgruppe. Der Weg zum Experten führt über die Fragen:<br />
Wo befindet sich meine Zielgruppe? Welche Hilfen brauchen die Betroffenen? Wo holen<br />
sie sich die?<br />
Treffen Sie sich z.B. mit dem Leiter des Jugendamts oder des Sozialamts, besuchen Sie die<br />
Sozialarbeiter von Beratungsstellen, gehen Sie in die <strong>Kinder</strong>gärten und sprechen Sie mit den Erzieher(inne)n.<br />
Ggf. bieten sich da<strong>für</strong> Gruppengespräche an. Laden Sie ein zum runden Tisch<br />
oder nutzen Sie eine Arbeitsgruppe der Regionalen Arbeitsgemeinschaft bzw. der kommunalen<br />
Gesundheitskonferenz zum Brainstorming über <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit. Dann können<br />
Sie auch gleich die verschiedenen Interessenlagen abklären. Vergessen Sie aber nicht, vor<br />
den Gesprächskreisen einen kleinen Leitfaden mit den wichtigsten Fragen zu erstellen, die Sie<br />
dort gerne beantwortet haben möchten.<br />
Wenn Sie die Meinung von vielen potentiellen Akteuren zum Thema einholen wollen oder<br />
einen Überblick über bestehende Versorgungsstrukturen brauchen, dann bietet sich eine schriftliche<br />
Befragung an. Die spart Ihnen die Zeit, die Sie ansonsten auf Gespräche verwenden müssen.<br />
Erstellen Sie einen kurzen Fragebogen und einen breit gestreuten Verteiler. Anregungen da<strong>für</strong><br />
hat z.B. das LGA. Sie könnten sich auch an Fachhochschulen, Berufsakademien oder Universitäten<br />
wenden, mit der Bitte um wissenschaftliche Betreuung Ihres Vorhabens. Das lögd<br />
unterstützt schriftliche Befragungen <strong>für</strong> den ÖGD in NRW technisch und organisatorisch.<br />
Schriftliche Befragungen sind bei der Zielgruppe der sozial Benachteiligten in der Regel<br />
nicht von Erfolg gekrönt. Da ist es besser, Sie interviewen die Betroffenen im persönlichen Gespräch<br />
vor Ort.<br />
Menschen sind laut einem Grundsatz der Ottawa-Charta dann am gesündesten, wenn sie ihre<br />
Lebensbedingungen selbst bestimmen können. Arme Menschen befinden sich häufiger in der<br />
Rolle des hilflosen Objekts als des tätigen Subjekts. Sie werden selten in Entscheidungen miteinbezogen<br />
und haben <strong>–</strong> so ist ihre Wahrnehmung <strong>–</strong> viele Pflichten und kaum Rechte. Auch in<br />
der Gesundheitsförderung ist es gängige Praxis, Projekte am runden Tisch zu planen ohne die<br />
Meinung von Betroffenen einzuholen.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Wünsche, Bedürfnisse, Werte und Einstellungen von sozial benachteiligten Menschen sind anders<br />
als bei bessergestellten Personen. Was liegt näher, als die Betroffenen <strong>–</strong> die eigentlichen<br />
Experten vor Ort <strong>–</strong> direkt danach zu fragen? Ein praktisches Beispiel:<br />
Betroffene kommen zu Wort: Situationsanalyse im Stadtviertel<br />
Die Münchner Aktionswerkstatt G`sundheit (MAG`s) ist eine unabhängige<br />
Einrichtung mit dem Auftrag zur kommunalen Gesundheitsförderung in<br />
München. Probleme vor Ort zu erkennen, transparent zu machen und anzugehen<br />
ist ihr Ziel. Bevor die Münchner Aktionswerkstatt G`sundheit mit<br />
Projekten zur Gesundheitsförderung begann, befragte sie die Bewohner(innen)<br />
im Stadtteil Westend danach, wie gesund und wohl sie sich in Ihrem<br />
Stadtviertel fühlen und welchen Anteil daran die Lebensbedingungen im<br />
Stadtteil haben. Die Bürger durften Vorschläge <strong>für</strong> Verbesserungen im Viertel<br />
machen und ihre Bereitschaft signalisieren zur persönlichen Mitarbeit<br />
bei den Aktionen. Sämtliche Aktionen im Münchner Stadtteil Westend werden<br />
nun von und mit den Anwohnern geplant und durchgeführt.<br />
Ansprechpartnerin: Christl Riemer-Metzger, Münchner Aktionswerkstatt<br />
G`sundheit, Bayerstraße 77a, 80335 München, Tel. 089/53 29 56 56<br />
Viele Kommunen haben mittlerweile Erfahrungen mit der Befragung von Bewohnern sozialer<br />
Brennpunkte gemacht. So auch das Stadtteilbüro Eidelstedt-Nord, Bezirksamt Eimsbüttel, Hörgensweg<br />
59 b, 22523 Hamburg. Soziale Stadtteilentwicklung in Eidelsstedt-Nord, die Erstellung<br />
einer „Visitenkarte“ des Stadtteils war hier das Thema.<br />
Hearing <strong>für</strong> <strong>alle</strong>inerziehende Sozialhilfempfänger im Landratsamt Neu-Ulm<br />
Als eine Konsequenz aus dem Sozialbericht 1999 <strong>für</strong> den Landkreis Neu-<br />
Ulm wurde im Sozialamt eine Sondersachbearbeitung <strong>für</strong> <strong>alle</strong>inerziehende<br />
Sozialhilfeempfänger eingerichtet. Diese Modellberatungsstelle hatte zum<br />
Ziel, bedarfsorientiert zu informieren und die Hilfeempfänger an die richtigen<br />
Kooperationspartner weiterzuvermitteln. Dazu war es nötig, Bedarf<br />
und Bedürfnisse der Betroffenen kennenzulernen.<br />
Der Landrat selbst lud deshalb im Juli 2000 <strong>alle</strong> <strong>alle</strong>inerziehenden Sozialhilfeempfänger<br />
ins Landratsamt zu einem Hearing (mit <strong>Kinder</strong>betreuung<br />
durch das Jugendamt) ein, bei dem die Frauen ihre Wünsche und auch Beschwerden<br />
äußern konnten. Die anwesenden Experten aus verschiedenen<br />
Abteilungen des Landratsamts und diversen sozialen Einrichtungen standen<br />
in der Pause Rede und Antwort. Viele Fragen konnten so unmittelbar<br />
geklärt werden.<br />
Nicht zuletzt trugen sowohl die Tatsache, dass der Landrat sich persönlich<br />
<strong>für</strong> die Situation der Betroffenen interessierte, als auch die lockere Atmosphäre<br />
(bei Kaffee und Tee) dazu bei, Image des Sozialamts und Selbst-<br />
81<br />
Sie fragen Betroffene vor Ort<br />
Sie befragen Betroffene und<br />
Experten gemeinsam <strong>–</strong><br />
ein Beispiel
82<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
wertgefühl der Frauen zu stärken. Ansprechpartner: Günther Hock, Sozialamt<br />
Neu-Ulm, Kantstraße 8, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731/7040-260<br />
Wen Sie noch befragen könnten:<br />
<strong>•</strong> Schüler und Lehrer in der Schule,<br />
<strong>•</strong> Jugendliche im Jugendtreff oder im Fast-Food-Restaurant,<br />
<strong>•</strong> wartende Mütter vor dem <strong>Kinder</strong>garten,<br />
<strong>•</strong> <strong>Kinder</strong>ärzte und Hebammen im sozialen Brennpunkt,<br />
<strong>•</strong> Stadtteilbewohner beim Straßenfest,<br />
<strong>•</strong> Sozialhilfeempfänger im Wartesaal vom Sozialamt.<br />
Wo gibt es lesenswerte Projektberichte und -zusammenstellungen?<br />
Die Suche nach bereits vorhandenen Angeboten, Einrichtungen und Projekten ist einfacher,<br />
wenn man schon einmal einen groben Überblick hat, wer sich denn generell auf dem Feld der<br />
Gesundheitsförderung von sozial Benachteiligten engagiert. Falls es in Ihrem Ort keinen sogenannten<br />
„Sozialatlas“ oder „Sozialwegweiser“ gibt, in dem <strong>alle</strong> Einrichtungen mit sozialen und<br />
gesundheitlichen Angeboten aufgelistet sind, dann könnten Sie ihn entweder <strong>–</strong> im Rahmen eines<br />
Projektes <strong>–</strong> erstellen oder sich erst einmal andernorts über modellhafte Hilfen und Projekte<br />
erkundigen. Hier eine <strong>–</strong> sicher wieder nur exemplarische <strong>–</strong> Auflistung, woher Sie Zusammenfassungen<br />
über Projekte, Aktionen und diverse Angebote beziehen können.<br />
Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit<br />
Niedersachsen e.V. in Hannover,<br />
Zentrum <strong>für</strong> Angewandte<br />
Gesundheitswissenschaften der<br />
Fachhochschule Nordostniedersachsen<br />
und der Universität<br />
Lüneburg (2000)<br />
Sozialministerium<br />
Baden-Württemberg (1996)<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong><br />
gesundheitliche Aufklärung<br />
(2001)<br />
Armut und Gesundheit. Praxisprojekte aus<br />
Gesundheits- und Sozialarbeit in Niedersachsen.<br />
Gesundheitsförderung mit sozial Benachteiligten<br />
<strong>–</strong> Eine Bestandsaufnahme von Initiativen,<br />
Projekten und kontinuierlichen Angeboten<br />
„Tackling Inequalities in Health“ <strong>–</strong> ein Projekt<br />
des „European Network of Health Promotion<br />
Agencies“ (ENHPA) zur Gesundheitsförderung<br />
bei sozial Benachteiligten. Abschlussbericht <strong>für</strong><br />
das deutsche Teilprojekt. <strong>–</strong> Erhebung und Auswertung<br />
von Gesundheitsförderungsprojekten<br />
mit sozial Benachteiligten in Deutschland mit<br />
Auflistung einzelner Projekte im Anhang
Landesgesundheitsamt<br />
Baden-Württemberg<br />
Martin Franke, Raimund Geene,<br />
Eva Luber (Hrsg.),<br />
Gesundheit Berlin e.V. /Landesarbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Gesundheitsförderung<br />
Stadt Köln, Gesundheitsamt,<br />
Geschäftsstelle „Kommunale<br />
Gesundheitskonferenz, <strong>Kinder</strong>und<br />
Jugendgesundheitsdienst<br />
Köln“<br />
Gesundheit Berlin e.V.<br />
Mielck. A.; Abel, M.;<br />
Heinemann, H.; Stender, K.-P.<br />
Aktion Jugendschutz,<br />
Landesarbeitsstelle<br />
Baden-Württemberg (2001)<br />
Projekt-Datenbanken im<br />
Internet<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
DOKIS ÖGD: Dokumentations- und Informationssystem<br />
<strong>für</strong> die Bereiche Gesundheitsförderung<br />
und Prävention im ÖGD Baden-Württemberg<br />
Armut und Gesundheit: Armut und Gesundheit<br />
bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen, Armut und Migration,<br />
Armut und Gesundheit bei Frauen, Armut<br />
und Wohnungslosigkeit. Berlin 1999. Materialien<br />
zur Gesundheitsförderung <strong>Band</strong> 1<br />
Projektbericht FAKIR: Förder-Angebote <strong>für</strong><br />
<strong>Kinder</strong> in Regionen mit erhöhtem Hilfebedarf.<br />
Köln, Februar 2001<br />
Tagungsberichte zu den jährlich stattfindenden<br />
Kongressen zu „Armut und Gesundheit“<br />
Auf dem Weg: „<strong>Gesunde</strong> Städte“ <strong>–</strong> Projekte zur<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit (2002)<br />
Jung, lässig & pleite? Konsumlust und Schuldenlast<br />
bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Dokumentation<br />
einer Fachtagung. Der Bericht gibt einen<br />
Einblick in das Thema <strong>Kinder</strong>, Jugendliche<br />
und Schulden, stellt Projekte und Materialen vor.<br />
„Soziale Stadt <strong>–</strong> Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“:www.sozialestadt.de/praxisbeispiele/projekte/<br />
Projektbörse Armut, Deutscher Caritasverband<br />
(www.caritas.de)<br />
83
84<br />
Problem und Bedarf<br />
benennen<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
4.2 Sie finden Prioritäten und planen Maßnahmen<br />
Planungsphase<br />
Ihr Problem wird konkret benannt.<br />
Sie finden Prioritäten und planen eine Maßnahme.<br />
Sie gründen einen Arbeitskreis „Armut und Gesundheit“ innerhalb der<br />
Regionalen Arbeitsgemeinschaft oder Kommunalen Gesundheitskonferenz.<br />
Sie formulieren Ziele und legen Zielgruppen fest.<br />
Sie entwickeln Maßnahmen.<br />
Sie erstellen einen Zeitplan, suchen Kooperationspartner, wählen Methoden<br />
und Medien und klären die Rahmenbedingungen: Ort, Zeit, Geld, Personal<br />
Sie planen und starten Ihre Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Ihr Problem lässt sich nun konkret benennen und in Form eines Handlungsbedarfs formulieren.<br />
Sie haben einen „Ist-Zustand“ dokumentiert <strong>–</strong> der Bedarf ist nun nichts anderes als die Differenz<br />
zwischen Ist-Zustand (sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong> ernähren sich falsch) und Soll-Zustand (es<br />
gibt alternative Ernährungsangebote). Bei der Entwicklung von Maßnahmen ist zudem ausschlaggebend,<br />
welchen expliziten Bedarf die Experten und Betroffenen (wir brauchen eine <strong>Kinder</strong>tafel<br />
im Stadtviertel) geäußert haben.<br />
Sie wissen z.B. nach einer Bestandsaufnahme zum Thema „Gesundheit von Alleinerziehenden<br />
und ihren <strong>Kinder</strong>n“<br />
<strong>•</strong> wie viele Alleinerziehende im Stadtteil Großburgfeld-Süd wohnen,<br />
<strong>•</strong> wie viele <strong>Kinder</strong> in welchem Alter in den Haushalten der Alleinerziehenden im Stadtteil Süd<br />
leben,<br />
<strong>•</strong> wie viele Alleinerziehende beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet sind und dringend auf eine<br />
Stelle hoffen,<br />
<strong>•</strong> wie viele Alleinerziehende aus dem Stadtteil Süd Sozialhilfe beziehen,<br />
<strong>•</strong> wie viele Alleinerziehende psychosomatische Beschwerden haben,<br />
<strong>•</strong> dass Alleinerziehende gerne mehr Entlastung hätten, sie aber da<strong>für</strong> ohne <strong>Kinder</strong>betreuung<br />
keine Zeit und Möglichkeit sehen,<br />
<strong>•</strong> dass die sozialen Beratungsstellen im Stadtteil Süd hoffnungslos personell unterbesetzt sind,<br />
<strong>•</strong> dass ein Entlastungsangebot <strong>für</strong> die Mütter vor Ort nicht vorhanden ist,<br />
<strong>•</strong> dass die Kirche seit Jahren <strong>–</strong> in Ermangelung von Teilnehmern <strong>–</strong> vergeblich versucht, eine<br />
Alleinerziehenden-Gruppe zu gründen.<br />
Es zeichnet sich demnach ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Verbesserung der gesundheitlichen<br />
Situation und der Lebenslage der Alleinerziehenden und ihrer <strong>Kinder</strong> aus dem Stadtteil<br />
Süd ab. Sie diskutieren diese Fragestellung nun z.B. in der regionalen Arbeitsgemeinschaft<br />
oder Kommunalen Gesundheitskonferenz und suchen nach einem speziellen Thema, einer Maßnahme<br />
und einer Strategie, die Gesundheit von Alleinerziehenden und ihren <strong>Kinder</strong>n zu fördern.
Wie finden Sie Prioritäten?<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Warum Sie sich gerade <strong>für</strong> dieses Projektthema entscheiden und nicht <strong>für</strong> jenes, kann viele<br />
Gründe haben und sollte bestimmten Kriterien standhalten. Entscheiden Sie <strong>–</strong> z.B. anhand des<br />
nachfolgenden Katalogs <strong>–</strong> wie Sie Ihre Prioritäten setzen.<br />
Kriterien <strong>für</strong> Prioritäten: Das kann konkret heißen:<br />
Wie dringend muss geholfen<br />
werden?<br />
Ist das Projekt realistisch und<br />
„machbar“?<br />
Ist das Projekt effektiv und<br />
effizient?<br />
Wie ist die Akzeptanz <strong>für</strong> das<br />
Projekt vor Ort?<br />
Hat das Projekt eine gute<br />
Öffentlichkeitswirkung?<br />
Kann das Projekt vorhandene<br />
Strukturen beeinflussen?<br />
Baut das Projekt auf Kooperation<br />
und Vernetzung?<br />
Handelt es sich bei Ihrem Projekt um einen Auftrag /<br />
eine Weisung / einen Wunsch? Was weist auf den<br />
Handlungsbedarf hin?<br />
Welche Rahmenbedingungen liegen vor hinsichtlich<br />
Personal, Kosten, Zeitaufwand, Örtlichkeiten, Fähigkeiten?<br />
Welche Veränderung lassen sich mit welchem Aufwand<br />
erreichen?<br />
Gibt es Interesse am Projekt? Wie stehen die Betroffenen<br />
dazu? Ist mit Ressortegoismen, Konkurrenzen<br />
etc. zu rechnen? Wieviele Teilnehmer und Partner<br />
können aktiviert werden?<br />
Ist das Projekt/Thema gut zu vermarkten? Lassen sich<br />
nachdrückliche Botschaften formulieren? Kann dadurch<br />
das Image der Einrichtung verbessert werden?<br />
Ist das Projekt nachhaltig angelegt? Können Partner<br />
langfristig eingebunden werden? Werden Ergebnisse<br />
dokumentiert und auf weiterführende Handlungsempfehlungen<br />
angelegt?<br />
Sieht das Projektschema eine klare und sinnvolle Rollenverteilung<br />
vor? Ist der Nutzeffekt <strong>für</strong> <strong>alle</strong> Beteiligten<br />
deutlich formuliert? Sind die Entscheidungsstrukturen<br />
transparent und allgemein akzeptiert? Bringen<br />
sich andere mit eigenen Ressourcen ein?<br />
Ist das Thema politisch gewollt? Gibt es Rats-, Ausschuss- oder ähnliche Beschlüsse,<br />
auf die Sie sich beziehen können? Welchen Nutzen<br />
hat Politik von dem Projekt? Lässt sich eine Verzahnung<br />
mit anderen <strong>–</strong> politisch prioritären <strong>–</strong> Vorhaben<br />
herstellen?<br />
85
86<br />
Vorüberlegungen zur<br />
Planung<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Welche Bedeutung hat das Projekt<br />
<strong>für</strong> die RAG bzw. die Kommunale<br />
Gesundheitskonferenz?<br />
Wie planen Sie eine Maßnahme?<br />
Profitiert Ihr Projekt von der Einbindung dieser Gremien?<br />
Ist das Thema <strong>für</strong> die dort eingebundenen Institutionen<br />
von Interesse?<br />
Nun geht es an die inhaltliche Umsetzung Ihres Themas. Die folgenden Vorüberlegungen können<br />
Ihnen bei der Planung helfen:<br />
<strong>•</strong> Welche Erfahrungen habe ich selbst mit der Zielgruppe und dem Thema?<br />
<strong>•</strong> Passt das Thema in das Handlungsspektrum und zum Selbstverständnis Ihrer Einrichtung <strong>–</strong><br />
und zu Ihnen selbst? Wer kann Sie aus Ihrer eigenen Einrichtung unterstützen?<br />
<strong>•</strong> Welche Konzepte gibt es bereits?<br />
<strong>•</strong> Wo und mit wem hat es bereits ein ähnliches Projekt gegeben?<br />
<strong>•</strong> Welche Strategien haben sich bewährt?<br />
<strong>•</strong> Wo treffen Sie die gewünschte Zielgruppe an? Zu welcher Zeit erreichen Sie die Zielgruppe<br />
am besten?<br />
<strong>•</strong> Wie grenzen Sie den Handlungsraum des Projekts ein?<br />
<strong>•</strong> Welche Settings und Kooperationspartner kommen in Frage?<br />
<strong>•</strong> Wer hat bereits Zugang zur Zielgruppe?<br />
<strong>•</strong> Welche Experten könnten Ihnen bei der Konzeption helfen?<br />
<strong>•</strong> Welche Vernetzungen sind vorhanden, könnten entstehen bzw. wären nötig?<br />
<strong>•</strong> Was wird das Projekt kosten? Welche Geldgeber stehen zur Verfügung?<br />
<strong>•</strong> Wieviel Personal ist nötig?<br />
<strong>•</strong> Auf welche Laufzeit ist das Projekt angelegt?<br />
<strong>•</strong> Wie kann man das Projekt öffentlichkeitswirksam gestalten?<br />
<strong>•</strong> Wie erreichen Sie nachhaltige Wirkungen und Strukturveränderungen?<br />
Die eigentliche Planung folgt dann dem folgenden Schema, das hier in einer exemplarischen<br />
Übersicht dargestellt sein soll und das wir anschließend näher ausführen werden:<br />
Planungskriterien Das kann konkret heißen:<br />
Worum geht es? Was ist das<br />
Problem?<br />
Alleinerziehende und ihre <strong>Kinder</strong> haben große gesundheitliche<br />
Probleme, die aus vielfachen Belastungen<br />
ihres Lebensalltags resultieren.<br />
Wie wird das Problem gelöst? Sie planen, initiieren und organisieren verhaltens- und<br />
verhältnisbezogene Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.<br />
Wen möchten Sie mit Ihrem<br />
Projekt erreichen?<br />
Alleinerziehende, deren <strong>Kinder</strong>, Einrichtungen vor<br />
Ort, mögliche Kooperationspartner
Was möchten Sie mit Ihrem<br />
Projekt konkret erreichen?<br />
Welche Strategien und Methoden<br />
setzen Sie ein?<br />
Wer eignet sich als Kooperationspartner?<br />
Welche Rahmenbedingungen<br />
müssen Sie klären?<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Die Maßnahme soll bewirken, dass...<br />
...Alleinerziehende Stress besser bewältigen können,<br />
...mehr Entlastungsangebote vor Ort <strong>für</strong> Familien entstehen,<br />
...<strong>Kinder</strong> Fördermöglichkeiten erhalten hinsichtlich<br />
ihres Gesundheitsverhaltens sowie gesundheitlicher<br />
und sozialer Kompetenzen.Da<strong>für</strong> wollen Sie<br />
langfristig Partner vor Ort finden und dauerhafte<br />
Angebote implementieren.<br />
Sie bieten Gesprächskreise oder Kurse zur Stressbewältigung,<br />
Konfliktbewältigung, Entspannung, Ernährung<br />
etc. an.<br />
Sie organisieren <strong>Kinder</strong>betreuungsangebote.<br />
Sie gehen mit Ihren Angeboten zu den Betroffenen<br />
vor Ort <strong>–</strong> in die <strong>Kinder</strong>gärten, die Schulen, die Mutter-<br />
Kind-Gruppen, auf das Sozialamt.<br />
Sie führen Schulungen <strong>für</strong> lokale Akteure durch.<br />
Ansprechen sollten Sie jeden,...<br />
...der Zugang zur Zielgruppe hat und von den Betroffenen<br />
akzeptiert wird,<br />
...der einschlägige Erfahrungen und Kompetenzen in<br />
der Gesundheitsförderung mitbringt,<br />
...der Entscheidungsbefugnisse hat,<br />
...der über Mittel verfügt. Das können z.B. das Jugendamt,<br />
das Sozialamt, eine Krankenkasse, Wohlfahrtsverbände,<br />
ein Stadtteilzentrum, lokale Initiativen,<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte, Erzieherinnen oder Lehrer sein <strong>–</strong><br />
aber auch Unternehmen vor Ort, der lokale Mittelstand,<br />
diverse Sponsoren. Gute Kooperationen berücksichtigen<br />
die besonderen Möglichkeiten der jeweiligen<br />
Partner.<br />
Um den Umfang, den Wirkungskreis, die inhaltliche<br />
Breite Ihres Angebots festzulegen, sollte feststehen,...<br />
...über welche Ressourcen Ihr Projekt verfügt,<br />
...ob es auf der Ebene eines Stadtteils, eines Wohnviertels,<br />
eines Schuleinzugsbereichs stattfindet,<br />
...wer vor Ort in Ihrem Sinne bereits tätig ist,<br />
...auf welche Dauer das Projekt angelegt ist.<br />
Planungskriterien<br />
87
88<br />
Vielfältige Zielgruppen<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Wie machen Sie Ihr Projekt<br />
bekannt?<br />
Auch das Projekt-Thema soziale Benachteiligung lebt<br />
von einer guten Öffentlichkeitsarbeit. Versuchen Sie...<br />
...der Stigmatisierung und Ausgrenzung der Betroffenen<br />
entgegenzuwirken,<br />
...ein Wir-Gefühl der Betroffenen zu fördern,<br />
...das vage Thema Gesundheit mit konkreten, „alltagstauglichen“<br />
Inhalten zu füllen,<br />
...den Nutzen <strong>für</strong> das Stadt(teil)image zu verdeutlichen,<br />
...die konkrete Wirksamkeit Ihrer Maßnahmen nachzuweisen,<br />
...die Bedeutung des Themas im kommunalpolitischen<br />
Kontext herauszustellen.<br />
Natürlich sind die <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen sozial benachteiligter Eltern die wichtigste Zielgruppe.<br />
Aber ohne die Unterstützung der Familie, ohne eine nachhaltige Vorbildfunktion der Eltern<br />
sind Veränderungen im Gesundheitsverhalten schwer umzusetzen. In dem <strong>gleiche</strong>n Sinne<br />
sind Lehrer(innen) und Erzieher(innen) zu aktivieren. Politiker, Amtsleiter und sonstige Entscheidungsträger<br />
müssen den geeigneten Rahmen schaffen, Ärzte und andere Gesundheitsversorger<br />
die nötige Sensibilität <strong>für</strong> die Betroffenen entwickeln, Bürger sich randständigen Gruppen<br />
öffnen und eine tolerierende und akzeptierende Haltung entwickeln. Gerade dann, wenn Gesundheitsförderung<br />
im Setting angesetzt ist, auf die Veränderung von Verhältnissen abzielt,<br />
wenn die Mitwirkung Vieler erforderlich ist, kann der Begriff „Zielgruppe“ plötzlich sehr weitgespannt<br />
werden und unterschiedliche Maßnahmen und Strategien erfordern.
Ziele: Was möchten Sie mit Ihrem Projekt erreichen?<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Projekte und Maßnahmen brauchen eine klare Richtung. Wenn Sie in diesem Sinne eindeutige<br />
Ziele formulieren, vermeiden Sie Missverständnisse und schaffen gleich zu Beginn Ihrer Projektplanung<br />
eine gute Basis <strong>für</strong> die Maßnahmenfindung und <strong>für</strong> die spätere Evaluation. Dabei ist<br />
es von Vorteil, sich die Ziele während der Planung immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn<br />
im Durcheinander von Vorschlägen die große Richtung einmal verlorengeht. An den Zielen sollten<br />
Sie die Strategien und Ideen messen, die etwa bei Brainstorming-Aktionen gesammelt werden.<br />
Sie fragen sich immer: „Bringt mich diese Überlegung meinem Ziel ein Stückchen näher?“<br />
Ziele sind eine gute Argumentationshilfe, wenn Sie Ihr Projekt den Mitgliedern der Regionalen<br />
Arbeitsgemeinschaft oder Kommunalen Gesundheitskonferenz, möglichen Kooperationspartnern,<br />
Geldgebern oder der Öffentlichkeit vorstellen. Vergessen Sie dabei nicht, mindestens<br />
ein internes Ziel zu formulieren, wie z.B.: „Das Image unserer Behörde soll mit dieser Aktion<br />
verbessert werden.“<br />
Sie können, wenn Sie wollen, bei Ihrer Zielformulierung zwischen allgemeinen und konkreten<br />
Zielen (Grob- und Feinzielen) unterscheiden. Allgemeine Ziele können sich dabei an den<br />
mehrfach erwähnten Prinzipien der Gesundheitsförderung <strong>für</strong> sozial Benachteiligte orientieren:<br />
Die Maßnahme soll dazu beitragen,<br />
<strong>•</strong> mehr gesundheitliche <strong>Chancen</strong>gleichheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zu erreichen,<br />
<strong>•</strong> gesundheitsförderliche Lebenswelten entstehen zu lassen,<br />
<strong>•</strong> die gesundheitliche Versorgung zu verbessern.<br />
Interessanter und aussagekräftiger sind die konkreten Ziele. Strukturbezogene Ziele Ihrer Maßnahme<br />
könnten dabei so aussehen:<br />
Die Maßnahme soll dazu beitragen,<br />
<strong>•</strong> die Kooperation zwischen verschiedenen Sektoren zu verbessern,<br />
<strong>•</strong> die kommunale Infrastruktur in Form von stadtteilbezogenen Betreuungs-, Bildungs- und<br />
Freizeitangeboten auszubauen,<br />
<strong>•</strong> die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe zu verbessern,<br />
<strong>•</strong> Projekte langfristig finanziell abzusichern, um eine Kontinuität von Fördermaßnahmen<br />
und Betreuungspersonen zu gewährleisten,<br />
<strong>•</strong> bessere Unterstützungssysteme <strong>für</strong> Alleinerziehende im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung<br />
bereitzustellen,<br />
<strong>•</strong> Gesundheits- und Sozial- bzw. Jugendberichterstattung zusammenzuführen bzw. zu<br />
qualifizieren mit dem Ziel, den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit<br />
darzustellen,<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsdienste in <strong>Kinder</strong>tagesstätten und Schulen stärker zu integrieren,<br />
<strong>•</strong> das Interesse sozialer Einrichtungen <strong>für</strong> das Thema Armut und Gesundheit zu wecken,<br />
<strong>•</strong> Zugangsbarrieren <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Eltern zur gesundheitlichen Versorgung zu verringern,<br />
<strong>•</strong> die Ressourcen sozial benachteiligter Personen in das Handeln im Stadtteil einzubeziehen.<br />
<strong>•</strong> Frühdiagnostik und Förderung von gefährdeten <strong>Kinder</strong>n im frühen Lebensalter zu<br />
verstärken.<br />
Ziele als Planungshilfen<br />
Strukturbezogene Ziele<br />
89
90<br />
Verhaltensbezogene Ziele<br />
Interne Ziele<br />
In Settings arbeiten<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Verhaltensbezogene Ziele könnten sein:<br />
Die Maßnahme soll dazu beitragen,<br />
<strong>•</strong> das Gesundheitsbewusstsein der Betroffenen zu steigern,<br />
<strong>•</strong> Fähig- und Fertigkeiten <strong>für</strong> gesundheitsförderliches Handeln der <strong>Kinder</strong> und<br />
Jugendlichen zu fördern,<br />
<strong>•</strong> <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen soziale Kompetenzen beizubringen,<br />
<strong>•</strong> Eltern befähigen, Konflikte zu lösen,<br />
<strong>•</strong> <strong>Kinder</strong>n Spaß an Bewegung zu vermitteln,<br />
<strong>•</strong> die Betroffenen zu motivieren und befähigen, sich selbst aktiv <strong>für</strong> ihre Gesundheitsinteressen<br />
einzusetzen,<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsgefährdungen der Eltern aus der unteren sozialen Schicht verringern, um den<br />
Gesundheitszustand der <strong>Kinder</strong> zu verbessern.<br />
Interne Ziele einer Maßnahme könnten so aussehen:<br />
Die Maßnahme soll dazu beitragen,<br />
<strong>•</strong> die Bürgernähe des Gesundheitsamts zu verbessern,<br />
<strong>•</strong> den Bekanntheitsgrad des Gesundheitsamts oder anderer Einrichtungen zu erhöhen,<br />
<strong>•</strong> die Rolle des Gesundheitsamts als bürgernaher Einrichtung und wichtigem<br />
lokalem Akteur angemessen öffentlich darzustellen,<br />
<strong>•</strong> Defizite und Schwachstellen des eigenen Angebots herauszufinden,<br />
<strong>•</strong> die Transparenz des Angebots zu erhöhen,<br />
<strong>•</strong> neue Zielgruppen <strong>für</strong> das Angebot finden,<br />
<strong>•</strong> die interne Kommunikation zu verbessern, kürzere Informationswege zu finden,<br />
<strong>•</strong> Mechanismen <strong>für</strong> gemeinsame Strategiefindung im Kollegenkreis zu entwickeln,<br />
<strong>•</strong> die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen im Haus zu intensivieren,<br />
<strong>•</strong> neue Themen und Angebotsformen zu finden.<br />
Was sind die Prämissen eines erfolgreichen Projekts?<br />
Die Entwicklung eines konkreten Konzepts zur Zielerreichung benötigt in der Regel einige Zeit,<br />
viel Kreativität und den Mut, auch einmal neue Wege zu beschreiten. Besonders dann, wenn Sie<br />
<strong>für</strong> die entsprechende Zielgruppe ein Angebot zum ersten Mal entwickeln. Hier noch einmal <strong>–</strong><br />
in der Übersicht und zur Erinnerung <strong>–</strong> die Prämissen eines erfolgreichen Angebots im Bereich<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong>, Jugendliche und ihre Eltern.<br />
Ihre Maßnahme <strong>für</strong> Betroffene sollte<br />
<strong>•</strong> niedrigschwellig sein: Gehen Sie zur Zielgruppe <strong>–</strong> warten Sie nicht darauf, dass sie zu<br />
Ihnen kommt.<br />
<strong>•</strong> möglichst in Settings stattfinden: Veranstalten Sie Ihre Maßnahme dort, wo Sie die Zielgruppe<br />
antreffen: im <strong>Kinder</strong>garten, in der Schule, im Stadtteil...<br />
<strong>•</strong> bedarfsgerecht sein: Bilden Sie sich im Vorfeld und in Gesprächen mit Betroffenen eine<br />
Meinung, was die Zielgruppe braucht, und gestalten Sie Ihr Angebot entsprechend.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
<strong>•</strong> lebenslagenorientiert sein: Wenn die <strong>Kinder</strong> im Quartier kaum Fahrräder haben, dann<br />
veranstalten Sie keine Fahrrad-R<strong>alle</strong>y.<br />
<strong>•</strong> die Strukturen vor Ort berücksichtigen: Wenn es im Stadtteil keinen Elterntreff gibt, dann ist<br />
es müßig, ihn <strong>für</strong> Projekte einzuplanen.<br />
<strong>•</strong> Betroffene einbeziehen: Die Teilnahme der Betroffenen an Ihrem Projekt ist sicher, wenn die<br />
Zielgruppe das Projektthema selbst ausgewählt und gestaltet hat (Selbstmanagement und<br />
Empowerment).<br />
<strong>•</strong> Eltern und <strong>Kinder</strong> gemeinsam betreffen: Eltern sind Vorbilder und diejenigen, die zu Hause<br />
den Ton angeben.<br />
<strong>•</strong> interdiziplinär und ressortübergreifend angelegt sein: Arbeiten Sie mit vereinten Kräften.<br />
Beteiligen Sie Experten, die sich schon mit relevanten Problemen der Zielgruppe beschäftigt<br />
haben und über einen Zugang zu den Betroffenen verfügen.<br />
<strong>•</strong> Vernetzung und Kooperationen fördern: Sie können das Problem Armut und Gesundheit<br />
nicht <strong>alle</strong>ine bewältigen, weder inhaltlich noch organisatorisch. Also suchen Sie sich Partner,<br />
auf die Sie später auch zurückgreifen können, wenn es darum geht, die Maßnahme langfristig<br />
zu sichern.<br />
<strong>•</strong> in den Methoden auf die Zielgruppe ausgerichtet sein: Wählen Sie eine Strategie, die <strong>für</strong> die<br />
Zielgruppe ansprechend erscheint, wie z.B. Frauenfrühstück statt Vortrag oder sportlichen<br />
Wettkampf <strong>für</strong> Jugendliche statt Aufklärungsmaßnahmen.<br />
<strong>•</strong> ganzheitlich als Kombinationsprojekt gestaltet sein: Verbinden Sie in Ihrem Projekt die<br />
Änderung von Verhalten, die Optimierung der Verhältnisse und die Verbesserung der<br />
Versorgung.<br />
Vergessen Sie nicht: gesundheitsschädigende Verhaltensweisen der betroffenen <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen<br />
sowie ihrer Eltern sind immer eingebettet in einen weiteren Kontext von psychosozialen<br />
Problemen. Belastende und absehbar nicht zu verbessernde Lebensverhältnisse sind kein<br />
guter Rahmen <strong>für</strong> das Einüben von gesundheitsförderlichem Verhalten. Bevor Sie z.B. den Eltern<br />
nahelegen, ihre <strong>Kinder</strong> gesünder zu ernähren, klären Sie erst einmal ab, ob das Thema Ernährung<br />
<strong>für</strong> die Zielgruppe momentan überhaupt Priorität hat. Es könnte sein, dass die Bewältigung<br />
von Beziehungsproblemen oder die desolate Wohnsituation im Moment so belastend<br />
sind, dass <strong>für</strong> andere Themen kein Raum im Kopf ist. Zudem muss Gesundheit <strong>für</strong> die Zielgruppe<br />
finanzierbar und gleichzeitig attraktiv sein. Ein gesundes Pausenbrot hat bei den Betroffenen<br />
in der Regel nicht denselben Stellenwert wie das lang ersehnte Handy. Eine geeignete<br />
Strategie zur Gesundheitsförderung muss den Rahmen im Vorfeld in diesem Sinne sondieren<br />
und in der Projektplanung berücksichtigen.<br />
Ebenso gilt: Auch wenn sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong>, Jugendliche und ihre Eltern <strong>–</strong> das zeigen<br />
viele Forschungsergebnisse <strong>–</strong> sich weniger gesundheitsförderlich verhalten und über geringere<br />
Selbsthilfepotentiale verfügen <strong>–</strong> irgendwelche Ressourcen sind in jedem Fall vorhanden.<br />
Und die heißt es herauszufinden, zu fordern und zu fördern.<br />
Psychosozialen Kontext<br />
berücksichtigen<br />
91
92<br />
Grundfragen der<br />
Themenfindung<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Wie finden Sie relevante Themen und Inhalte?<br />
Überlegen Sie vor der Wahl Ihres konkreten Themas, Ihrer Projekt-Inhalte:<br />
<strong>•</strong> Welche Schwierigkeiten oder Defizite sind besonders gravierend?<br />
<strong>•</strong> Zu welchem Problem lassen sich <strong>–</strong> in dem gegebenen Rahmen <strong>–</strong> umsetzbare Maßnahmen<br />
benennen?<br />
<strong>•</strong> Welche Themen sind <strong>für</strong> mögliche Kooperationspartner interessant?<br />
<strong>•</strong> Was ist an Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Motiven bei den Betroffenen vorhanden?<br />
<strong>•</strong> Welche Erfahrungen und Kenntnisse können vorausgesetzt werden?<br />
<strong>•</strong> Wie können Sie vorhandenes Wissen der Betroffenen nutzen?<br />
<strong>•</strong> Wie belastbar sind die Betroffenen?<br />
<strong>•</strong> Für welche Themen und Aktivitäten können sie angemessen beteiligt und aktiviert werden?
Wo siedeln Sie Ihr Projekt an?<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Projekte, die ohne Berücksichtigung der Lebenswelt z.B. nur auf die Verringerung von Risikofaktoren<br />
abzielen, sind bei sozial benachteiligten Menschen wenig erfolgversprechend. Niedrigschwellige<br />
Angebote, die die Teilnehmer vor Ort einbeziehen und lebenslagenorientiert<br />
sind, werden am besten im Rahmen eines Settings umgesetzt.<br />
Ein Setting gleicht einem Feld oder einem sozialen System, das <strong>alle</strong> relevanten Umweltbedingungen<br />
einer Bevölkerungsgruppe umfasst. Der Setting-Ansatz legt zugrunde, dass Gesundheitsprobleme<br />
einer Bevölkerungsgruppe das Ergebnis wechselseitiger Beziehungen zwischen<br />
ökonomischer, sozialer und institutioneller Umwelt und persönlichem Verhalten sind. Projekte<br />
in einem Setting durchzuführen heißt, die Bedeutung der Rahmenbedingungen zu berücksichtigen,<br />
unter denen die Menschen leben. Gegenstand der Intervention ist danach nicht der Mensch<br />
<strong>alle</strong>ine, sondern die zugehörigen sozialen Systeme wie Stadtteile, Schulen oder <strong>Kinder</strong>gärten.<br />
Die Arbeit im Setting eröffnet zugleich die Möglichkeit, andere Personen oder Einrichtungen als<br />
Kooperationspartner in das Geschehen einzubeziehen, wie Nachbarn, Lehrer, Erzieher oder das<br />
Gemeindezentrum im Stadtteil. Kurz: Projekte im Setting bieten die Chance, Verhalten und Verhältnisse<br />
<strong>gleiche</strong>rmaßen zu beeinflussen.<br />
Zum Vertiefen:<br />
Grossmann, R.; Scala, K. (1994): Gesundheit durch Projekte fördern <strong>–</strong> Ein Konzept zur Gesundheitsförderung<br />
durch Organisationsentwicklung und Projektmanagement. Weinheim<br />
Bundesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit e.V. (Hrsg.) (1999): Gesundheit: Strukturen und Handlungsfelder.<br />
Neuwied<br />
Projekte im<br />
Setting ansiedeln<br />
93
94<br />
Aktivierende Methoden<br />
einsetzen<br />
Betroffene beteiligen<br />
Kombinationsangebote<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Nach welcher Methode gehen Sie vor?<br />
Ihre Ziele und Inhalte sind festgelegt. Jetzt stellt sich die Frage, wie Sie diese Inhalte vermitteln<br />
wollen. Das Methodenspektrum ist denkbar breit gestreut, muss aber letztlich genauso sensibel<br />
und zielgruppenbezogen gehandhabt werden wie Zielformulierung und Themenwahl.<br />
Vermeiden Sie nach Möglichkeit Vorträge <strong>–</strong> wenn sie nicht in ein breiteres Maßnahmespektrum<br />
eingebunden sind. Das würde Ihre Zielgruppe in die Rolle der passiven Zuhörer bringen.<br />
Viele sozial Benachteiligte sind es zudem nicht gewohnt, lange zuzuhören. Vorträge sind keine<br />
gute Methode, neue Erfahrungen zu machen und schon gar nicht, um neue Verhaltensweisen<br />
einzuüben. Aktive Beteiligung ist angesagt.<br />
Bei <strong>Kinder</strong>n stehen sicher spielerische Methoden im Vordergrund. Jugendliche <strong>–</strong> vor <strong>alle</strong>m<br />
die Jungen <strong>–</strong> möchten in der Regel „Action“. Aber auch die Erwachsenen wollen die Möglichkeit<br />
haben, aktiv zu werden, eigenes Können zu beweisen. Beteiligen Sie sie an der Ideenfindung,<br />
an der Planung und Vorbereitung. Weisen Sie Ihnen bei der Durchführung eine aktive Rolle<br />
zu. Führen Sie die Menschen über das Projekt zusammen, lassen Sie sie gemeinsam arbeiten,<br />
stärken Sie das Gemeinschaftsgefühl und ermöglichen Sie Erfolgserlebnisse. Solche Dinge erweisen<br />
sich in einem tieferen Sinne als gesundheitsfördernd und stellen eine gute Basis dar, die<br />
eigentlichen Gesundheitsinhalte „quasi nebenbei“ mit zu vermitteln.<br />
Kleine Methoden-Checkliste<br />
Welche Methoden eignen sich, um die angestrebten Ziele und Inhalte zu<br />
verwirklichen?<br />
Passt die Methode zu Ihnen, zu den Teilnehmern und zu den Rahmenbedingungen?<br />
Werden Verhalten und Verhältnisse <strong>gleiche</strong>rmaßen angesprochen?<br />
Kommen Ihre Kooperationspartner mit Ihrem „Methodencocktail“<br />
zurecht?<br />
Setzt die Methode bei den Bedürfnissen und Interessen der Betroffenen<br />
an?<br />
Ist der Aufwand realistisch und machbar?<br />
Werden die Betroffenen aktiviert und verantwortlich beteiligt?<br />
Werden die Gesundheitsinhalte berücksichtigt, ohne zu stark im<br />
Vordergrund zu stehen?<br />
Kombinationsangebote berücksichtigen Verhalten und Verhältnisse, Gesundheitsförderung und<br />
Gesundheitsversorgung <strong>gleiche</strong>rmaßen. Mehrere Aktionsformen kombinieren verschiedene Methoden<br />
und Zugänge <strong>–</strong> <strong>für</strong> jeden Betroffenen ist etwas dabei, was seine Persönlichkeit und besonderen<br />
Interessen anspricht.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Kombinationsangebot „Tag der Bewegung“: noch einmal ein (nicht ganz) fiktives<br />
Beispiel<br />
Patrick wohnt mit seinen zwei jüngeren Geschwistern und seiner Mutter in sehr beengten<br />
Verhältnissen in Großburgfeld-Süd, einem der sozialen Brennpunkte der Stadt.<br />
In der Wohnung ist eigentlich kein Platz <strong>für</strong> vier Personen, und rund ums Haus fehlt<br />
es gänzlich an Möglichkeiten <strong>für</strong> bewegungsintensive Freizeitbeschäftigungen. Für<br />
den Besuch eines Sportvereins hat die Familie kein Geld. So bleibt wieder nur der<br />
Fernseher als Freizeitbeschäftigung. Vielen anderen Familien im Stadtteil geht es ähnlich.<br />
Das Gesundheitsamt veranstaltet zusammen mit der örtlichen Hauptschule und einer<br />
Krankenkasse einen „Tag der Bewegung“. Der Sportverein stellt da<strong>für</strong> sein Gelände<br />
zur Verfügung. Die Leute sind gespannt <strong>–</strong> auch Patrick freut sich auf das besondere<br />
Ereignis (von denen es in seinem Alltag nicht allzu viele gibt). Seine Mutter ist erst<br />
skeptisch (Was kostet das? Haben wir da<strong>für</strong> die Zeit?). Dann wird sie von Patricks Lehrerin<br />
angesprochen, ob sie nicht bei der Betreuung einer Kleinkind-Gruppe helfen<br />
könnte <strong>–</strong> es kämen auch zwei andere Mütter aus Patricks Klasse <strong>–</strong> und ob sie Ideen<br />
hätte, was man in einer solchen Gruppe machen könnte. Patricks Mutter sagt zu <strong>–</strong> ein<br />
paar Spiele f<strong>alle</strong>n ihr sofort ein; schließlich hat sie selber zwei kleine <strong>Kinder</strong>.<br />
Auf der Veranstaltung teilt sie sich die Betreuungszeiten mit drei anderen Müttern. Im<br />
Team hat man einen Betreuungs- und Spieleplan ausgearbeitet. Alles funktioniert prima.<br />
In ihrer „Freizeit“ <strong>–</strong> ihre <strong>Kinder</strong> sind derweil in der Gruppe gut aufgehoben <strong>–</strong><br />
geht sie über das Gelände und schaut sich die verschiedenen Stände an.<br />
Mitmach-Aktion „<strong>Gesunde</strong>r Rücken“<br />
In einem Zelt macht eine Mitarbeiterin der Krankenkasse vor, wie man etwas <strong>für</strong> seine<br />
Rückengesundheit tun kann. Zahlreiche Menschen machen die Übungen mit. Auch<br />
Patricks Mutter reiht sich ein. Am Ausgang gibt es einen Zettel, wo die wichtigsten<br />
Sachen noch einmal draufstehen. Eigentlich gar nicht so schwer!<br />
Preisausschreiben<br />
Ein nagelneues Fahrrad gibt es zu gewinnen. Das Kaufhaus Meier hat gesponsert. Lose<br />
gibt es umsonst, wenn man ein paar Fragen zu sportlichen Aktivitäten beantwortet.<br />
Da lässt sie sich nicht zweimal bitten <strong>–</strong> und gewinnt einen Trostpreis: einen lustigen<br />
Igelball zur Massage (hat wohl eine Krankenkasse gestiftet).<br />
Diskussion<br />
In einem Zelt sitzen Leute aus ihrem Stadtteil und reden mit einem Vertreter der Stadt<br />
(zumindest sieht der so aus). Da geht es hoch her, obwohl der Stadtvertreter meistens<br />
nur zuhört. Patricks Mutter geht weiter; ihr ist es zu laut da drin. Aber die Leute haben<br />
anscheinend wirklich etwas mitzuteilen.<br />
95
96<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Befragungsaktion<br />
Eine junge Frau geht herum und fragt die Leute nach der Situation im Quartier. Patricks<br />
Mutter berichtet vom gefährlichen Schulweg ihres Sohnes <strong>–</strong> eine dicke Kreuzung<br />
ohne Ampel muss überquert werden. Da wäre um ein Haar letztens ein Kind überfahren<br />
worden. Die Frau schreibt <strong>alle</strong>s auf. Endlich konnte sie das einmal loswerden!<br />
Wettbewerb „Hau den Lukas“<br />
Ein paar Jugendliche messen ihre Kräfte. Das ist nichts <strong>für</strong> sie. Im Vorübergehen sieht<br />
sie, dass ein Mann vom Sportverein sich mit den Jugendlichen unterhält und ihnen Info-Zettel<br />
in die Hand drückt.<br />
Aktionen im Stadtteil<br />
Überall liegen Zettel, die die nächste Veranstaltung ankündigen. „Tag der<br />
Entspannung“ heißt es diesmal, irgendwie geht es um Stress und solche Sachen.<br />
Man kann wieder mitmachen; sie suchen Leute, die helfen und Ideen<br />
haben. Patricks Mutter nimmt einen Zettel mit. Da wird sie mal anrufen!<br />
Nicht <strong>für</strong> jedes Projekt und jede Aktion müssen Sie das Rad neu erfinden. Einige Beispiele da<strong>für</strong>,<br />
wie andere solche Vorhaben angepackt haben, sind im Folgenden aufgelistet:<br />
Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n in der Grundschule in Köln<br />
Ziele Bewegungsförderung vor Ort <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> mit motorischen<br />
Entwicklungsdefiziten<br />
Verbesserung des Ernährungsverhaltens<br />
Fortbildung und Sensibilisierung der Lehrer<br />
Zielgruppe Grundschüler mit überwiegend motorischen Defiziten<br />
der 1. und 2. Klasse und von Vorschul-Klassen<br />
Anzahl der Teilnehmer 10 Stadtteile, 11 Schulen, 700 Schüler<br />
Wo? Köln, Grundschulen in 10 Stadtteilen<br />
Methoden/Themen Zusätzlicher Sportförderunterricht als Ergänzung zum<br />
Schulsport, Aktionen zum Thema <strong>Gesunde</strong> Ernährung,<br />
Multiplikatorenschulung <strong>für</strong> Lehrer. Bei den betreuten<br />
<strong>Kinder</strong>n verbesserten sich dadurch Sozialverhalten,<br />
Motivation, Konzentration und Ausdauer im<br />
Lernverhalten.<br />
Laufzeit 1994 bis Mitte 1997<br />
Projektinitiator Gesundheitsamt Köln<br />
Netzwerk, Kooperation Gesundheitsamt, Schulamt, Schule, Lehrer, Sportund<br />
Bäderamt, Sporthochschule, Sportvereine, Sportlehrer<br />
Finanzierung Mittel der Familie-Ernst-Wendt-Stiftung
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Ergänzende Hilfen <strong>für</strong> auffällige <strong>Kinder</strong> aus sozial benachteiligten Stadtteilen<br />
im <strong>Kinder</strong>garten in Köln<br />
Ziele Erweiterung ambulanter und wohnortnaher Fördermöglichkeiten<br />
von <strong>Kinder</strong>n mit Entwicklungsdefiziten<br />
und Verhaltensauffälligkeiten,<br />
Abstimmung zwischen Kooperationspartnern bzgl.<br />
Früherkennung und Prävention<br />
Ausschöpfung sozialpädagogischer Potentiale, z.B.<br />
Einsatz heilpädagogisch ausgebildeter Übersollkräfte<br />
Zielgruppe Entwicklungs- und verhaltensauffällige <strong>Kinder</strong> im<br />
Vorschulalter<br />
Anzahl der Teilnehmer 24 <strong>Kinder</strong>gärten in 4 Stadtteilen, 120 <strong>Kinder</strong><br />
Wo? <strong>Kinder</strong>gärten in Stadtteilen mit hohem Anteil sozial<br />
benachteiligter Bürger<br />
Methoden/Themen Interdisziplinäre und heilpädagogische Förderung in<br />
Einzel- bzw. Kleinstgruppen, Beratung der Eltern<br />
Laufzeit Seit 1996<br />
Projektinitiator Auftrag des Ausschusses <strong>für</strong> Gesundheitswesen:<br />
Gesundheitsamt Köln<br />
Netzwerk, Kooperation Gesundheitsamt, Jugendamt, Erzieher, Frühfördereinrichtungen,<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte, Familienberatungsstellen,<br />
MCD-Verein, Sportvereine<br />
Finanzierung Krankenkasse bzw. Sozialamt (§§ 39,40 BSHG)<br />
Regionale Gesundheitsförderung <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> im Vorschulalter: Projekt FAKIR (Förder-<br />
Angebote <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> in Regionen mit besonderem Hilfebedarf)<br />
Ziele Erhöhung der Gesundheitschancen sozial benachteiligter<br />
<strong>Kinder</strong> durch:<br />
<strong>•</strong> Früherkennung von Störungen und Einleitung der<br />
notwendigen Hilfen<br />
<strong>•</strong> allgemeine Gesundheitsförderungsmaßnahmen im<br />
<strong>Kinder</strong>garten<br />
<strong>•</strong> gezielte Förderprogramme im <strong>Kinder</strong>garten<br />
<strong>•</strong> gesundheitsbezogene Elternarbeit<br />
<strong>•</strong> Bereitstellung unterstützender Informationen<br />
<strong>•</strong> Stärkung der gesundheitlichen Kompetenzen des<br />
<strong>Kinder</strong>gartenpersonals,<br />
<strong>•</strong> Sensibilisierung der Erzieher(innen) und Eltern <strong>für</strong><br />
die Gesundheit der <strong>Kinder</strong><br />
97
98<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Zielgruppe <strong>alle</strong> <strong>Kinder</strong> ausgewählter <strong>Kinder</strong>tagesstätten sozial benachteiligter<br />
Regionen; Eltern, die ihre <strong>Kinder</strong> nicht<br />
oder erst sehr spät <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong>gärten anmelden<br />
Anzahl der Teilnehmer 15 <strong>Kinder</strong>tagesstätten<br />
<strong>•</strong> gesundheitsfreundliche Gestaltung der Abläufe<br />
im <strong>Kinder</strong>gartenalltag und der räumlichen<br />
Bedingungen<br />
<strong>•</strong> Verbesserung der örtlichen Vernetzung und Kooperation<br />
von <strong>Kinder</strong>tagesstätten mit sozialen Einrichtungen,<br />
Fachdiensten, Praxen und Sportvereinen<br />
Wo? verschiedene Kölner Stadtteile und -viertel, Auswahl<br />
nach den Daten der Jugendhilfeplanung<br />
Methoden/Themen Angebote in methodischer Vielfalt <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>, Erzieherinnen<br />
und Eltern mit Schwerpunkten auf gesunder<br />
Ernährung, Kariesprophylaxe, Bewegungsförderung,<br />
Hilfen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> mit Defiziten (Sprachförderung, soziale<br />
Kompetenzen) und Aktivitäten des <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendgesundheitsdienstes (z.B. um Impflücken zu<br />
schließen).<br />
Durchgeführt wurden u.a.:<br />
Für die Erzieherinnen: Fortbildungen zu den Themen<br />
Motorik, Sprachentwicklung, emotionale Reife, Entwicklungsdiagnostik<br />
oder Bewegungsdiagnostik.<br />
Für die Eltern: Elternabend zum Thema „Psychomotorik“<br />
mit Übersetzung in die türkische Sprache, Arztund<br />
Beratungssprechstunden.<br />
Für die <strong>Kinder</strong>: Reihenuntersuchungen, Sprachförderung,<br />
Sinnesschulung und Bewegungsangebote.<br />
Laufzeit Ab Herbst 1998<br />
Projektinitiator Antrag der SPD-Fraktion, Projekt im Rahmen des<br />
Modellprogramms „Ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen<br />
und sozialen Versorgung“ des Landes<br />
NRW, Arbeitsgruppe „Gesundheitsförderung <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong><br />
im <strong>Kinder</strong>gartenalter in Regionen mit besonderem<br />
Hilfebedarf“<br />
Netzwerk, Kooperation Gesundheitsamt, Jugendamt, <strong>Kinder</strong>gärten, Erzieher,<br />
Eltern, <strong>Kinder</strong>ärzte, Zentrum <strong>für</strong> Frühbehandlung und<br />
Frühförderung, Logopäden, Sportvereine, Sportamt,<br />
BZgA, Sozialpädagogen<br />
Finanzierung Mittel der Ernst-Wendt-Stiftung, Landesmittel
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
„Leben mit <strong>Kinder</strong>n <strong>–</strong> Living together with children“ im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald<br />
Ziele Familien in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen und<br />
eine Verbesserung der familiären Kommunikation bewirken<br />
Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen<br />
bei <strong>Kinder</strong>n vermeiden<br />
Zielgruppe Eltern und Familien mit <strong>Kinder</strong>n<br />
Anzahl der Teilnehmer 100 Familien in der Pilotgemeinde Umkirch. Zudem<br />
100 Familien in Gesprächsrunden („Familientische“)<br />
und 35 Familien in zwei weiteren Gemeinden<br />
Wo? Pilotprojekt in Umkirch. Ausweitung auf weitere Gemeinden<br />
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald<br />
Methoden/Themen <strong>•</strong> Knüpfen von Netzwerken zur Unterstützung von<br />
Familien in interessierten Landkreisgemeinden mit<br />
Experten und Laien aus Verwaltung, Verbänden,<br />
bürgerschaftlichem Engagement, pädagogischpsychologischen<br />
Fachdiensten und den Familien<br />
selbst.<br />
<strong>•</strong> Schaffen von Begegnungs-, Austausch- und Bildungsorten,<br />
wobei an bereits vorhandene Strukturen<br />
angeknüpft wird.<br />
<strong>•</strong> Unterstützung der Familien bei Fragen zur Erziehung<br />
und des Zusammenlebens mit <strong>Kinder</strong>n in Gesprächskreisen.<br />
<strong>•</strong> Entwickeln einer eigenen Projektkultur, die gekennzeichnet<br />
ist durch gemeinsames Lernen von<br />
Familien, Fachleuten und Verwaltung.<br />
Laufzeit Pilotprojekt: 1999 <strong>–</strong> 2001, Ausweitung auf den Landkreis:<br />
2001 <strong>–</strong> 2003<br />
Projektträger Arbeitsgemeinschaft Gesundheit in der Stadt Freiburg<br />
und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit ihrem<br />
Verein „Gesundheit <strong>für</strong> <strong>alle</strong> in der Stadt Freiburg<br />
und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald“<br />
Netzwerk, Kooperation Arbeitsgemeinschaft Gesundheit, Kreisjugendamt,<br />
Deutscher Familienverband (Landesverband Baden-<br />
Württemberg e.V.), Lebenshilfe Müllheim e.V., <strong>Kinder</strong>gärten,<br />
Krabbelgruppen, Elterninitiativen, Wohlfahrtsverbände,<br />
Schulen, Ärzte, Logopäden, Heilpädagogen,<br />
Erziehungsberatungsstellen, Suchtberatungsstellen...<br />
99
100<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Finanzierung<br />
Projektkoordinatorin und<br />
Ansprechpartnerin<br />
„Clever wirtschaften <strong>–</strong> gesund leben“ in Offenburg<br />
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Robert-<br />
Bosch-Stiftung Stuttgart, Karl-Kübel-Stiftung Bensheim,<br />
SM Baden-Württemberg, LGA Baden-Württemberg,<br />
örtliche Gemeindeverwaltungen<br />
Renate Pfumpfei, AG Gesundheit, Starkenstr. 44,<br />
79104 Freiburg, Tel.: 0761/2187-663<br />
Ziele Förderung von Alleinerziehenden mit geringem Einkommen<br />
und von Sozialhilfeempfängern.<br />
Kompetenzen erweitern im Umgang mit Banken und<br />
Versicherungen.<br />
Informationen vermitteln bzgl. Haushaltsorganisation<br />
sowie gesunder und preiswerter Ernährung,<br />
Aufzeigen von „Second Hand“-Einkaufsmöglichkeiten,<br />
Stärkung der Eigeninitiative und Selbsthilfekompetenz,<br />
Förderung von Kontakten zwischen Menschen in ähnlicher<br />
Lebenssituation.<br />
Zielgruppe Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende<br />
Zielgruppenansprache Einbeziehen von Betroffenen in die Planung der Maßnahme<br />
auf der Basis von §§ 18,19 (Hilfe zur Arbeit)<br />
und mit Hilfe der Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen<br />
Dienstes des Landratsamtes.<br />
Wo? Ortenaukreis<br />
Methoden/Themen Tagesveranstaltung mit Vorträgen und Workshops:<br />
Praktische Anleitung zu wirtschaftlichem Handeln.<br />
Themen: Umgang mit Banken und Versicherungen.<br />
Organisation des Haushaltes, <strong>Gesunde</strong> Ernährung<br />
Information über preiswerte Freizeitangebote <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong><br />
und Jugendliche.<br />
<strong>Kinder</strong>betreuung während der Veranstaltung mit Spielen<br />
und Aktivitäten zur Ernährungserziehung und Entspannung.<br />
Laufzeit Seit 1998<br />
Netzwerk, Kooperation Kreissozialamt, Schuldnerberatung des Kreissozialamtes,<br />
Ernährungszentrum Südlicher Oberrhein,<br />
Fachfrauen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>ernährung, Fachschule <strong>für</strong> Sozialpädagogik<br />
Gengenbach, Verbraucherzentrale
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Projektträger Dienst <strong>für</strong> Gesundheitsförderung und soziale Prävention<br />
im Amt <strong>für</strong> Soziale und Psychologische Dienste,<br />
Landratsamt Ortenaukreis<br />
Besonderheiten <strong>•</strong> Bedarfserhebung durch Fragebogenaktion bei <strong>alle</strong>n<br />
Teams der Sozialen Dienste und im Rahmen einer<br />
moderierten Veranstaltung mit Betroffenen<br />
<strong>•</strong> Bildung einer amtsübergreifenden Arbeitsgruppe<br />
zur praktischen Umsetzung<br />
<strong>•</strong> Modellprojekte als Vorläufer<br />
<strong>•</strong> Evaluation durch Teilnehmerbefragung sowie Auswertungsgesprächen<br />
mit den Referenten<br />
Finanzierung Sozialamt, LAG Baden-Württemberg<br />
Projektinitiatorin und<br />
Ansprechpartnerin<br />
Andrea Blaser,<br />
Dienst <strong>für</strong> Gesundheitsförderung und<br />
Soziale Prävention, Landratsamt Ortenaukreis,<br />
Badstraße 20, 77652 Offenburg, Tel.: 0781/805-770<br />
Oft ergibt sich auch die Gelegenheit, im Rahmen größerer Projekte <strong>–</strong> wie Agenda 21 oder <strong>Gesunde</strong>-Städte-Netzwerk<br />
<strong>–</strong> einen Themenschwerpunkt „<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit“<br />
unterzubringen und mit anderen Aktionen zu verknüpfen. Ein Beispiel:<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> in Rostock<br />
Als Mitglied im <strong>Gesunde</strong>-Städte-Netzwerk hat sich die Stadt Rostock vorgenommen,<br />
die bestehenden sozialen und gesundheitlichen <strong>Chancen</strong>ungleichheiten<br />
zu verringern. Koordiniert durch den Bereich Gesundheitsförderung<br />
des Gesundheitsamtes stellt die AG „Kommunale Gesundheitsförderung“<br />
besonders Aktivitäten <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in den Mittelpunkt ihrer<br />
Arbeit. Eine der Plattenbausiedlungen im Nordwesten der Stadt, der Ortsamtsbereich<br />
Evershagen, wurde als Tätigkeitsfeld ausgewählt. In Kooperation<br />
mit den Akteuren des Wohnumfeldverbesserungsprogrammes, den Arbeitskreisen<br />
und Projekten „Gesundheitsfördernde Infrastruktur“, „<strong>Gesunde</strong><br />
Ernährung in der Schule“, „Unfallverhütung bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen“,<br />
„Zukunftswerkstatt Gesundheitssport“ und vielen anderen mehr<br />
sollen im Rahmen des <strong>Gesunde</strong>-Städte-Projekts und des Agenda 21-Prozesses<br />
Nord-West folgende Ziele verwirklicht werden: Entwicklung einer kinderfreundlichen<br />
Politik, Schaffen eines kinderfreundlichen Wohnumfeldes<br />
und Vernetzung der bereits bestehenden gesundheitlichen und sozialen<br />
Versorgungsstrukturen im Stadtteil durch die Organisation einer Stadtteilkonferenz<br />
zum Thema „<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> in<br />
Evershagen“. Die Aktivitäten umfassen u.a. eine Bürger(innen)befragung<br />
zur Zufriedenheit im Ortsteil, Projekte wie „Der gesunde Schulkiosk“ und<br />
„<strong>Kinder</strong>stadtplan Evershagen“, die Gestaltung von <strong>Kinder</strong>spielplätzen mit<br />
101
102<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
<strong>Kinder</strong>beteiligung und die Öffnung von Schulen und KITAS zur Freizeitgestaltung.<br />
Ansprechpartnerin: Dr. Angelika Baumann, Gesundheitsamt Rostock,<br />
St.-Georg-Str. 109, 18055 Rostock, Tel. 0381/3815376<br />
Die Liste ließe sich nahezu beliebig fortsetzen. Im Folgenden sollen anhand von stichwortartig<br />
beschriebenen Projekten aus dem ganzen Bundesgebiet Anregungen <strong>für</strong> Projektthemen geliefert<br />
werden. Das Feld möglicher Aktivitäten ist dabei denkbar groß. Speziell der Zielgruppe <strong>Kinder</strong><br />
und Jugendliche widmen sich <strong>alle</strong>rdings erst verhältnismäßig wenige Aktionen. Deshalb sind<br />
hier auch Beispiele <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung anderer Zielgruppen mit sozialer Benachteiligung<br />
aufgeführt.<br />
Akteure und Projekte zur Gesundheitsförderung von sozial Benachteiligten im<br />
Bundesgebiet <strong>–</strong> eine exemplarische Liste<br />
Akteure Projekte und Aktivitäten<br />
Kreis-Gesundheitsamt Ludwigsburg<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Eva Belzner,<br />
Hindenburgstr. 20/1,<br />
71631 Ludwigsburg,<br />
Tel. 07141/144-1338<br />
Arbeitsgemeinschaft Prävention<br />
und Gesundheitsförderung,<br />
Tübingen<br />
Ansprechpartner:<br />
Dr. Harald Barkhoff,<br />
Wächterstr. 67,<br />
72074 Tübingen<br />
Workshop am <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfetag<br />
2001<br />
„Arm und krank <strong>–</strong> reich und gesund?“ <strong>für</strong> Multiplikatoren<br />
aus dem Bereich der Jugendhilfe mit Kurzvorträgen,<br />
Projektdarstellungen und Erarbeitung<br />
von Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Gesundheitsförderung<br />
von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n<br />
und Jugendlichen<br />
Projekt „Big Girls“<br />
Gruppenangebot <strong>für</strong> 12 <strong>–</strong> 14jährige übergewichtige<br />
Mädchen <strong>für</strong> den Zeitraum von einem Jahr.<br />
Ziele: Übergewicht reduzieren, Selbstbewusstsein<br />
steigern, Bewegungsfreude stärken, Körperbewusstsein<br />
verbessern.<br />
14-tägige Gruppensitzungen: Erfahrungsaustausch,<br />
Spiele, Schminken, Informationen zur gesunden Ernährung,<br />
gemeinsames Kochen. Zweimal pro Woche<br />
Sport. Elternabende zu verschiedenen Themen.<br />
Projekt: „Gesundheitsförderung <strong>für</strong> Auszubildende“<br />
Ziel: Stärkung des Gesundheitsbewusstseins von<br />
Auszubildenden durch neue Unterrichtsverfahren,<br />
die in Kooperation von Berufsschullehrern und<br />
schulexternen Experten (wie psychosoziale Beratungsstellen,<br />
Drogenberatung, Gesundheitsamt,<br />
Krankenkassen) durchgeführt werden. Ca. 140 Berufsschüler<br />
nahmen teil.
Gesundheitsamt Mannheim<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Frau Dr. Engler-Thümmel,<br />
GA Mannheim<br />
Postfach 100014<br />
68149 Mannheim<br />
Tel. 06 21/29 3-0<br />
Kreisjugendring Ravensburg<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Frau Margarete Bareis,<br />
Kreisjugendring Ravensburg<br />
Franz-Stapf-Str. 8<br />
88212 Ravensburg<br />
Landratsamt Karlsruhe, Arbeitskreis:<br />
„Gesundheit und Schulden“<br />
Ansprechpartner:<br />
Martin Siegl-Ostmann,<br />
Regionale Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong><br />
Gesundheitsförderung<br />
Landratsamt Karlsruhe,<br />
Beiertheimer Allee 2,<br />
76126 Karlsruhe<br />
Tel.: 0721/936-5908<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Folgende Projektthemen wurden gemeinsam in Arbeitskreisen<br />
vorbereitet und behandelt: Kommunikation<br />
und Konfliktlösung, belastende Faktoren,<br />
Umgang mit Emotionen und Stress, Identitätsfrage,<br />
Lebensziele, Suchtverhalten Arbeitssicherheit, Ernährung,<br />
HIV-Infektion und Sexualhygiene, Bewegung<br />
und Fitness.<br />
Projekt „Gesundheitsförderung in einem<br />
Stadtteil mit hoher Sozialhilfedichte“<br />
Ziele: Positive Änderung gesundheitsschädlicher<br />
Verhaltensweisen, Stärkung des psychosozialen<br />
Wohlbefindens, Erhöhung der Inanspruchnahme<br />
der jedem Kind zugänglichen Gesundheitsvorsorge.<br />
Zielgruppen: <strong>Kinder</strong>, Jugendliche, Mütter.<br />
Maßnahmen: Gezielte Öffentlichkeitsarbeit <strong>für</strong> die<br />
Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen<br />
und Impfprogramme, Aktionen der Gesundheitsaufklärung<br />
und Information, spezifische Programme<br />
zum Thema Ernährung und zur Hygieneerziehung<br />
in <strong>Kinder</strong>garten und Schule, Ausbau von<br />
Einrichtungen der Infrastruktur wie Spielplätze und<br />
Bürgertreffs, Verbesserung der Gesundheitsvorsorge<br />
z.B. durch die Schulsprechstunde.<br />
„Bewegungstheaterprojekt mit Mädchen“<br />
Ziel: Selbstbestimmte sinnvolle Freizeitgestaltung,<br />
eigene Fähigkeiten entdecken, alternative Ausdrucksformen<br />
finden, Fähigkeiten der Mädchen<br />
aufwerten.<br />
Sozial benachteiligte Mädchen unterschiedlicher<br />
Nationalität erhielten die Möglichkeit, unter theaterpädagogischer<br />
Anleitung selbst gewählte Themen<br />
mit eigenen Methoden und Ausdrucksformen<br />
zu entwickeln.<br />
Zwei Umfragen an Schulen<br />
In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Gesundheit<br />
und Schulden“ werden in verschiedenen Klassenstufen<br />
an Gymnasien Schüler(innen) zur Erwerbs-<br />
und Verschuldenssituation befragt. Ziel ist<br />
es, Datengrundlagen <strong>für</strong> eine zukünftige Präventionsarbeit<br />
zu erhalten.<br />
103
104<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Landratsamt Karlsruhe,<br />
Gesundheitsamt<br />
Beiertheimer Allee 2,<br />
76126 Karlsruhe<br />
Gesundheitsamt Rems-Murr-Kreis<br />
Ansprechpartner:<br />
Karin Müller und Kai Schröder,<br />
Gesundheitsamt Rems-Murr-Kreis,<br />
Bahnhofstraße 1,<br />
71332 Waiblingen,<br />
Tel.: 07151/501-620<br />
Projekt: „Lust auf Leben“<br />
Angstabbau und Persönlichkeitsentwicklung<br />
<strong>für</strong> junge Aussiedlerinnen.<br />
Ziel: Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten<br />
durch Aufzeigen von medizinischen und finanziellen<br />
Hilfen, die den psychischen Druck mildern. Prävention<br />
von Frühgeburten.<br />
An 3 Schulvormittagen wurden mit den Frauen folgende<br />
Themen erarbeitet:<br />
Ausdrucksformen und Begegnung, Distanz und Nähe,<br />
Körperwahrnehmung, Sexualität, Empfängnisverhütung<br />
und Sucht.<br />
Sprechstunde <strong>für</strong> Aussiedler(innen) im Gesundheitsamt<br />
und Führungen durch das Amt zum Abbau der<br />
Ängste vor Behörden.<br />
Projekt: „Gesundheitsförderung und Suchtprävention<br />
mit sozial/-bildungsbenachteiligten<br />
Mädchen und jungen Frauen einer hauswirtschaftlichen<br />
Schule.<br />
Ein Projekt des Gesundheitsamts in Kooperation<br />
mit der Maria-Merian-Schule in Waiblingen und der<br />
Suchtberatung Waiblingen.<br />
Ziel: Sensibilisierung <strong>für</strong> eigene Bedürfnisse, Körperbewusstsein,<br />
Gefühle wahrnehmen und äußern<br />
können, soziale Kompetenz und Stress-Coping-<br />
Strategien entwickeln. Erlebnisorientiertes Vorgehen<br />
wie Tanz, Rollenspiel, Theater, Entspannung,<br />
Massage. Praktisches Tun zu den Themen: Schönheit,<br />
Körper und Identität<br />
Projekt: „Stadtteilbezogene Gesundheitsförderung<br />
mit Jugendlichen in Waiblingen-Süd“.<br />
Ziele: Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen<br />
Bürgern und Experten aus dem Sozial-, Jugend- und<br />
Gesundheitsbereich sowie Erkenntnisgewinn bezüglich<br />
der Umsetzung von Strategien der Gesundheitsförderung<br />
im Jugendbereich. Stärken von Lebenskompetenzen<br />
sozial benachteiligter Jungen und<br />
Mädchen, bessere Gestaltung der Spielflächen im<br />
Stadtteil und mehr Freizeitangebote in Kursform <strong>für</strong><br />
Jugendliche, Eröffnung eines Jugendclubs im Stadtteil,<br />
Stadtteilrundenarbeit.<br />
Maßnahmen: Angebote <strong>für</strong> Mädchen und/oder Jungen<br />
vor <strong>alle</strong>m zur Freizeitgestaltung (wöchentlich
Jugendamt am Landratsamt<br />
Bodenseekreis in Friedrichshafen<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Frau Sabine Braig,<br />
Kreisjugendamt Bodenseekreis,<br />
Albrechtstraße 75,<br />
88045 Friedrichshafen,<br />
Tel.: 07541/2 04-4 43<br />
Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, Soziales,<br />
Gesundheit und Frauen<br />
des Landes Brandenburg<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Frau Bolz, Koordinatorin Prignitzer<br />
Servicestelle Arbeit und Gesundheit,<br />
Heinrich-Heine Platz 4,<br />
19322 Wittenberge<br />
Ortsverband Brake des Deutschen<br />
<strong>Kinder</strong>schutzbundes<br />
Ansprechpartner:<br />
Deutscher <strong>Kinder</strong>schutzbund<br />
Ortsverband Brake e.V.,<br />
Bürgermeister-Müller-Str. 13,<br />
26919 Brake<br />
Tel.: 04401/4588<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
und Ferienprogramme) wie Boote und Seifenkisten<br />
bauen mit Regatta und Seifenkistenrennen, Jazz-<br />
Dance, Selbstverteidigungskurse, Teenieclub und<br />
Aktionen in den Bereichen Körperwahrnehmung<br />
(Schwimmbad, Sauna), Bewegung und Kochen.<br />
„Familientreffs“<br />
als offene, dezentrale und wohnortnahe Anlaufstellen<br />
<strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>, Jugendliche und Familien.<br />
Ziel: Einrichten von präventiven Angeboten, die <strong>für</strong><br />
junge Menschen und ihre Familien positive Lebensbedingungen<br />
und eine kinder- und familienfreundliche<br />
Umwelt schaffen. Selbsthilfegruppen, Ehrenamtliche<br />
und Professionelle bieten Gruppen <strong>für</strong> Eltern<br />
und <strong>Kinder</strong>, Elterngesprächskreise,<br />
Informations- und Beratungsangebote und Kurse<br />
z.B. zur Konfliktbearbeitung und zu Erziehungsfragen<br />
an. Möglichkeit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> zu sozialem Lernen<br />
und Entlastungsangebote <strong>für</strong> Alleinerziehende.<br />
Projekt: „Arbeitslosigkeit und Gesundheit“<br />
<strong>für</strong> langzeitarbeitslose Personen mit gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen im Landkreis<br />
Prignitz.<br />
Ziel: Gesundheit und Vermittlungschancen auf<br />
dem Arbeitsmarkt der betroffenen Personen verbessern.<br />
<strong>•</strong> Einrichtung einer Servicestelle als Beratungs-,<br />
Kontakt- und Informationseinrichtung<br />
<strong>•</strong> einzelfallbezogene Arbeit sowie Koordinationsund<br />
Netzwerkaufgaben<br />
<strong>•</strong> Vermittlung von Bewältigungsstrategien, um<br />
Alltagskompetenzen zu stärken und gesundheitsfördernde<br />
Ressourcen zu mobilisieren<br />
Projekt: „Schulung der Sinne“<br />
<strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> in der Grundschule, die mit einer Lernbehinderung<br />
oder durch aggressives und unsoziales<br />
Verhalten auff<strong>alle</strong>n.<br />
Ziel: Steigerung des Selbstwertgefühls und Vermittlung<br />
sozialer Anerkennung.<br />
Schüler(innen) lernen, den Teufelskreis von Verhaltensauffälligkeiten,<br />
negativer Rückmeldung und eigener<br />
innerer Aggression zu durchbrechen. Metho<br />
105
106<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
AWO Kreisverband Lüneburg,<br />
Ministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />
und Forsten des Landes<br />
Niedersachsen, Sozialministerium<br />
des Landes Niedersachsen<br />
Ansprechpartner:<br />
Günter Wernecke,<br />
AWO Lüneburg/Lüchow-Dannenberg,<br />
Bülows Kamp 35,<br />
21337 Lüneburg<br />
Zentrum <strong>für</strong> Angewandte Gesundheitswissenschaften,<br />
Lüneburg<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Christiane Deneke,<br />
Zentrum <strong>für</strong> Angewandte Gesundheitswissenschaften,<br />
Fachhochschule Nordostniedersachsen,<br />
Wilschenbrucherweg 84a,<br />
21335 Lüneburg<br />
Diakonisches Werk in Hannover<br />
Ansprechpartner:<br />
Hans-Georg Kuhlenkampf,<br />
Diakonisches Werk,<br />
Burgstraße 8/10,<br />
30159 Hannover,<br />
Tel.: 0511/3687134<br />
den werden vermittelt, Gefühle wahrzunehmen und<br />
in konstruktive Bahnen zu lenken. Entwicklung eines<br />
Handbuchs <strong>für</strong> Grundschullehrer.<br />
Projekt: „PreisWerte Ernährung“<br />
<strong>für</strong> sozial benachteiligte Bewohner eines Stadtteils<br />
seit 1996.<br />
Ziel: Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten<br />
der Bewohner(innen) sozialer Brennpunkte sowie<br />
der Versorgung von Schülern. Angebote und Aktivitäten<br />
wurden gemeinsam mit den Teilnehmer (innen)<br />
des Projekts entwickelt: Mittagstisch <strong>für</strong><br />
(Grund-) Schüler, Bewohnerfrühstück, Seminare<br />
zur Ernährung, Projekte im Sinne des Lernortes<br />
Bauernhof, Veröffentlichung eines Kochbuches.<br />
Alle Veranstaltungen waren ausschließlich „Mitmach-Veranstaltungen“<br />
mit aktivierenden und kommunikativen<br />
Anteilen, freiwillig und <strong>alle</strong>n zugänglich.<br />
Das Projekt zeichnet sich aus durch einen sehr<br />
großen Kreis an Kooperationspartnern aus Schulen,<br />
Gesundheitsamt, sozialen Diensten des Stadtteils,<br />
Verbraucherzentrale, der Lüneburger Tafel und dem<br />
Büro der Frauenbeauftragten von Stadt und Landkreis<br />
Lüneburg.<br />
Projekt: „Food and more“:<br />
Ernährungsbezogene Projekte <strong>für</strong> sozial benachteiligte<br />
Jugendliche an fünf norddeutschen Standorten<br />
in Niedersachsen und Hamburg.<br />
Mit niedrigschwelligen Angeboten zur Ernährung<br />
(miteinander kochen und essen) in Einrichtungen<br />
der offenen Jugendarbeit (z.B. in Jugendzentren)<br />
wird versucht, Jugendlichen die Lust an gemeinschaftlichen<br />
Aktionen zu vermitteln.<br />
Projekt: „Nordstädter <strong>Kinder</strong>tafel“<br />
- ein Kooperationsprojekt in einem sozialen Brennpunkt<br />
in Hannover.<br />
Ziel: Versorgung sozial benachteiligter <strong>Kinder</strong> mit<br />
einem warmen Mittagessen. Möglichkeiten schaffen,<br />
Hausaufgaben zu erledigen und die Freizeit zu<br />
verbringen.<br />
Seit 1999 erhalten <strong>Kinder</strong> aus dem Stadtteil täglich<br />
eine warme Mahlzeit in den Räumen der Lutherkir
Multikultureller <strong>Kinder</strong>treff<br />
Einswarden „Blauer Elefant“<br />
des DKSB Nordenham<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Ina Korter,<br />
Niedersachsenstraße 19b,<br />
26943 Nordenham,<br />
Tel.: 04731/3042<br />
Fraueninitiative quirl e.V. Bremen<br />
Elsfether Straße 29,<br />
28219 Bremen<br />
Ansprechpartner:<br />
Schulleiter Herr Schweppe,<br />
Schule an der Fritz-Gansberg Straße,<br />
Fritz-Gansberg Straße 22,<br />
28213 Bremen,<br />
Tel.: 0421/36196020<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
che. Zubereitet wird das Essen von Schülerinnen der<br />
Berufsbildenden Schule 7, Anna-Siemsen-Schule.<br />
Kooperationspartner: Berufsbildende Schule, Diakonisches<br />
Werk <strong>–</strong> Kirchenkreissozialarbeit, Ev.luth.<br />
Lutherkirchengemeinde, SPUNK <strong>–</strong> das <strong>Kinder</strong>haus<br />
vom Verein <strong>für</strong> Sport, Kultur und soziale<br />
Arbeit <strong>–</strong> Spokusa e.V.<br />
Finanziert wird die „Nordstädter <strong>Kinder</strong>tafel“ über<br />
das Sozialamt (eine Stelle <strong>–</strong> „Arbeit statt Sozialhilfe“)<br />
und über Spenden aus der Bevölkerung, von<br />
Firmen, Aktionen und Betriebsfesten.<br />
Projekt „Armut und Gesundheit“<br />
Ziel: Steigerung des Wohlbefindens, bessere Körperpflege,<br />
Spass an Fitness und Bewegung, Erproben<br />
gesunder Ernährung, Persönlichkeitsstärkung,<br />
Suchtprävention.<br />
<strong>Kinder</strong> aus einem sozialen Brennpunkt erhalten Angebote<br />
mit monatlichen Schwerpunkten zu den Themen<br />
Fitness, Schönheit, Gesundheit, Suchtprävention<br />
und Körperpflege.<br />
Projekt in Kooperation mit Gesundheitsamt und<br />
Krankenkassen.<br />
Projekt: „Essen in Schulen“ im Rahmen des<br />
Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“<br />
Ziel: Verknüpfung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen<br />
mit der Essensversorgung<br />
von <strong>Kinder</strong>n in Schulen. Entlastung <strong>für</strong> berufstätige<br />
Eltern und Frauen, die nach der Erziehungsphase<br />
zurück ins Erwerbsleben wollen. Prävention<br />
und Gesundheitserziehung bei <strong>Kinder</strong>n.<br />
In der Schulküche der Schule an der Fritz-Gansberg-Straße<br />
wird <strong>für</strong> Schulkinder vollwertige Gemeinschaftsverpflegung<br />
hergestellt und ausgegeben.<br />
Erwerbslose Frauen werden hier beschäftigt<br />
und qualifiziert. Schulküche beliefert auch andere<br />
Schulen im Umfeld. Das Projekt ist eine gemeinsame<br />
Initiative der Schule an der Fritz-Gansberg-<br />
Straße, des Senators <strong>für</strong> Bildung und Wissenschaft,<br />
des Senators <strong>für</strong> Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend<br />
und Soziales, dem Deutschen Hausfrauenbund<br />
und der Fraueninitiative quirl e.V.<br />
107
108<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und<br />
Gesundheit als<br />
Querschnittsaufgabe<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Stadtteilbüro Eidelstedt-Nord<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Conny Schubecker<br />
Stadtteilbüro Eidelstedt-Nord<br />
Projektentwicklung und<br />
Gemeinwesenarbeit<br />
Hörgensweg 59 b, 22523 Hamburg,<br />
Tel. 040/577891<br />
Zum Vertiefen:<br />
Projekt: Soziale Stadtteilentwicklung<br />
Eidelstedt-Nord „Visitenkarte“<br />
Projekte mit Hilfe des Stadtteilbüros <strong>für</strong> benachteiligte<br />
Menschen aus den Großwohnsiedlungen.<br />
Ziel: Verbesserung der Lebensverhältnisse der benachteiligten<br />
Bevölkerung im Wohngebiet. Aktivitäten<br />
im Bereich Gesundheit und Soziales:<br />
Bewegungsraum <strong>für</strong> psychomotorische Übungen<br />
in der Max-Traeger-Grundschule, Großspielgeräte<br />
auf dem Schulhof der Grundschule Heidacker,<br />
Drogenberatungsstelle Cafe 320 mit Präventionstätigkeit<br />
in Zusammenarbeit mit Schulen, mehrwöchiges<br />
Ferienprojekt „Sommer mit Schirm“ mit<br />
Bewohner(inne)n, Vereinen und Pädagogen,<br />
Schulküchenprojekte mit Zubereitung und Verkauf<br />
von gesundem preiswertem Essen in Schulen in<br />
Verbindung mit ABM-Plätzen, Aktion zur Förderung<br />
der Bewegung, Beteiligungsprojekte wie Bürgerforum<br />
oder Stadtteilbeirat.<br />
Deneke, C.; Kaba-Schönstein, L.; W<strong>alle</strong>r, H. (2000): Gesundheitsförderung sozial Benachteiligter<br />
<strong>–</strong> das Projekt „PreisWerte Ernährung (PWE). In: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit<br />
1, S. 21-26<br />
Hofrichter, P.; Altgeld, T. (Hrsg.) (2000): Suppenküchen im Schlaraffenland <strong>–</strong> Armut und Ernährung<br />
von Familien und <strong>Kinder</strong>n in Deutschland. Hannover<br />
Kooperationspartner und Vernetzung: Wer könnte Sie unterstützen?<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit ist eine Querschnittsaufgabe, die verschiedene Ressorts betrifft<br />
<strong>–</strong> Gesundheit, Soziales und Jugend in vorderster Reihe. Verwaltung, Wissenschaft und Politik<br />
sind gefordert, nach gemeinsamen Handlungsformen und Lösungen zu suchen. Interdisziplinäre<br />
Projekte werden im Zusammenhang mit <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit immer wieder<br />
gefordert.<br />
Die Erfahrung zeigt leider, dass sich bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern<br />
oft Hürden in den Weg stellen. Konkurrenzgedanken, das Gerangel um Zuständigkeiten und die<br />
Angst vor Ressortverlust spielen da eine Rolle. Achten Sie auch darauf, wer sich bei Ihrem Projekt<br />
nur als passives Mitglied einbindet (oder einbinden möchte). Weisen Sie auf die Notwendigkeit<br />
einer sinnvollen und gleichwertigen Arbeitsteilung als wichtige Prämisse von Beginn an<br />
hin.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Mehrfach wurde es schon angedeutet: Gerade bei der Arbeit mit und <strong>für</strong> sozial Benachteiligte<br />
sind Kooperationen unverzichtbar. Die wichtigsten Gründe da<strong>für</strong> sind im Folgenden noch einmal<br />
zusammengefasst:<br />
Als Einzelkämpfer haben Sie bei der Bewältigung sozialer Ungleichheit kaum<br />
<strong>Chancen</strong>: „Soziale Ungleichheit und Gesundheit“ ist ein umfassendes gesellschaftliches<br />
und sozialpolitisches Thema und Problem, das Sie nur ressortübergreifend<br />
bearbeiten können.<br />
Sie verringern Ihre Projekt-Kosten durch Einbindung fremder Ressourcen.<br />
Sie sparen Zeit durch Delegation von Aufgaben und nutzen Synergieeffekte.<br />
Sie profitieren von den Kenntnissen, Kontakten und Aktionsräumen Ihrer<br />
Partner: Jeder Kooperationspartner hat einen eigenen Blickwinkel, entdeckt<br />
andere Ansatzpunkte <strong>für</strong> ein Projekt, sieht andere Lücken in der Versorgung.<br />
Sie erhalten schneller den Zugang zur Zielgruppe, weil ein Partner ihn bereits<br />
besitzt.<br />
Gemeinsam sind Sie stärker, wenn z.B. politische Entscheidungen zu fällen<br />
sind und wenn das „Gewicht“ Ihres Anliegens ermittelt wird.<br />
Ihr Projekt kann breiter gestreut werden durch „Schneeb<strong>alle</strong>ffekte“.<br />
Die Transparenz der Angebote und Strukturen verbessert sich.<br />
Gestalten Sie sich ein Netzwerk, auf das Sie bei Folgeprojekten wieder zurückgreifen können.<br />
Vernetzung verkürzt die Wege der Ratsuchenden und schont deren Frustrationstoleranz, insofern<br />
sie nämlich gleich an die richtige Stelle verwiesen werden und nicht lange im Behördendschungel<br />
umherirren. Viele der sozial Benachteiligten haben Schwierigkeiten, ihr Anliegen und<br />
ihre Wünsche zu artikulieren <strong>–</strong> von der Ermittlung differenzierter Zuständigkeiten ganz zu<br />
schweigen.<br />
Netzwerke zu knüpfen ist aber auch mit der Kunst verbunden, Beziehungen herzustellen und<br />
aufrecht zu erhalten. Gelungene Kooperationen haben gemeinsame Ziele, eine verbindliche<br />
Kooperationsstruktur und ein passendes Schnittstellenmanagement. Netzwerke erfordern ein<br />
hohes Maß an Bereitschaft zur Initiative, Öffnung und Kommunikation.<br />
Anlass zur Hoffnung auf eine verbesserte Kooperations- und Vernetzungskultur geben die in<br />
verschiedenen Kommunen bestehenden Arbeitskreise zum Thema „Armut und Gesundheit“<br />
und natürlich die Regionalen Arbeitsgemeinschaften <strong>für</strong> Gesundheit bzw. die Kommunalen Gesundheitskonferenzen.<br />
Arbeitskreise „Armut und Gesundheit“ gibt es bereits <strong>–</strong> einige Beispiele:<br />
Kommune Kooperationspartner, Themen, Aktivitäten<br />
Schwarzwald-Baar Kreis Arbeitskreis der regionalen Arbeitsgemeinschaft mit Vertretern<br />
aus Volkshochschule, AOK-Ernährungsberatung,<br />
Diakonie-Schuldnerberatung, Caritas, Sozialamt, AG Jugendzahnpflege,<br />
Fachfrauen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>ernährung und Lokaler<br />
Agenda 21:<br />
Gute Gründe <strong>für</strong><br />
Kooperationen<br />
Langfristig denken <strong>–</strong><br />
Netzwerke aufbauen<br />
109
110<br />
Arbeitskreise „Armut und<br />
Gesundheit“ <strong>–</strong> einige<br />
Beispiele<br />
Ansprechpartner finden<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Pressearbeit zu Ernährungsprojekten an Schulen, Erstellung<br />
eines Gesundheitsführers „Preiswert und gesund einkaufen“,<br />
Erstellen eines Marketingkonzepts <strong>für</strong> den Gesundheitsführer,<br />
Recherche über Zugangsmöglichkeiten zu<br />
„Armen“. Fortbildung <strong>für</strong> Familienhelferinnen, Sachbearbeitern<br />
des Sozialamtes zur „Ernährung bei knapper Kasse“,<br />
Aktionen zur Bekämpfung des Analphabetismus.<br />
Bielefeld Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz: Zusatzbefragung<br />
während der Schuleingangsuntersuchungen<br />
zum Thema „Soziale Lage und Gesundheit“ <strong>–</strong> Analyse des<br />
Zusammenhanges zwischen sozialer Lage und Gesundheit<br />
(1996/97)<br />
Düsseldorf Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz: Sondierung<br />
von Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit<br />
der Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger (1997/98), Produktion<br />
und Diskussion eines Armutsberichts<br />
Minden-Lübbecke Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz: Verbesserung<br />
der Erreichbarkeit von sozial benachteiligten<br />
Gruppen und Konzeption präventiver Maßnahmen<br />
Bochum Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz: Feststellung<br />
der Auswirkungen von Armut und Wohnungslosigkeit<br />
auf psychische und physische Gesundheit<br />
Wenn Sie Kooperationspartner suchen, brauchen Sie Ansprechpartner. Das können etwa sein<br />
<strong>•</strong> im <strong>Kinder</strong>garten der/die Leiter(in), die Erzieherinnen, aber auch engagierte Eltern,<br />
<strong>•</strong> in der Schule neben der Schulleitung und den Lehrern auch der Elternbeirat, die Schülermitverwaltung,<br />
der Schulsozialarbeiter oder die Sprecher bestehender örtlicher Schulprojekte,<br />
<strong>•</strong> im Sozialamt der Amtsleiter, die einzelnen Sachbearbeiter, der Schuldnerberater,<br />
<strong>•</strong> im Jugendamt der Amtsleiter, die Sozialarbeiterinnen, der Verantwortliche <strong>für</strong> den<br />
Jugendtreff oder die Zuständige <strong>für</strong> die sozialpädagogische Familienhilfe.<br />
Darüber hinaus finden sich auch in anderen Einrichtungen Personen und Mitarbeiter(innen), die<br />
Kontakte zur Zielgruppe haben. Dazu gehören z.B. Wohlfahrtsverbände, Sozialer Dienst,<br />
Schuldnerberatung, Selbsthilfegruppen, Jugendhilfeplaner oder <strong>Kinder</strong>ärzte.<br />
Andere können einen fachlichen Input leisten. Nehmen wir das Beispiel Ernährungserziehung<br />
<strong>–</strong> da könnten dies die Fachfrauen <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>ernährung (in Baden-Württemberg), die Ernährungszentren,<br />
die Ernährungsberatung der Krankenkassen, die Verbraucherzentrale, Hersteller<br />
<strong>für</strong> Säuglingsnahrung oder (<strong>Kinder</strong>)Ärzte sein.<br />
Wieder andere können finanziell unterstützen, Preise sponsern, sich mit eigenen Aktionen<br />
beteiligen, zur Verpflegung der Teilnehmer beitragen. Da<strong>für</strong> kommen Krankenkassen, Banken
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
und Sparkassen, lokale mittelständische Unternehmen, Nahrungsmittelfirmen, lokale Gastronomie<br />
oder Großküchen in Frage.<br />
Auf „höherer Ebene“, in Beiräten, in Ausschüssen, in den unterschiedlichen Gremien von<br />
Politik und Administration, aber auch bei der Presse und in der Öffentlichkeit können Sie Ihre<br />
Interessen anwaltschaftlich vertreten lassen <strong>–</strong> z.B. durch den Bürgermeister oder eine Stadträtin,<br />
die Sie als Schirmherrin <strong>für</strong> Ihr Projekt gewonnen haben, durch einen lokalen VIP (z.B. bekannter<br />
Schauspieler oder Sportler), den Sie als Sympathieträger und Plakatfigur verpflichten,<br />
durch die Gesundheits- und Sozialdezernentin, die sich ressortbedingt <strong>für</strong> den Zusammenhang<br />
von sozialer Benachteiligung und Gesundheit interessiert.<br />
Natürlich sind auch wieder die RAG oder die Kommunale Gesundheitskonferenz aussichtsreiche<br />
Quellen <strong>für</strong> Kooperationsbeziehungen. Und nicht zuletzt sollten Sie Ihr eigenes Amt nicht<br />
vergessen: Wer ist bei den Betroffenen vor Ort? Wer ist Experte beim Thema Armut und/oder<br />
Gesundheit und/oder <strong>Kinder</strong> und Jugendliche? Wer hat bereits Erfahrung mit Projekten zum<br />
Thema <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit? Bei genauerem Hinschauen ergeben sich manchmal<br />
auch in der nächsten Umgebung überraschende Kooperationsmöglichkeiten.<br />
Die Rahmenbedingungen: Was brauchen Sie <strong>für</strong> ein erfolgreiches Projekt?<br />
Zu einer guten Projekt-Organisation gehört es, die beeinflussbaren und die gegebenen Rahmenbedingungen<br />
einzuplanen. Wo können Sie Einfluss nehmen? Womit müssen Sie sich arrangieren?<br />
Was ist unverzichtbar? Kann man das Projekt an die Rahmenbedingungen anpassen?<br />
Anhand des Beispiels einer Informationsveranstaltung wollen wir <strong>–</strong> ohne Anspruch auf Vollständigkeit<br />
<strong>–</strong> eine exemplarische kleine Liste formulieren:<br />
Der Raum<br />
Um welche Veranstaltungsform handelt es sich (Kurs, Wochenendseminar,<br />
Gesprächskreis, Bürgerversammlung, Aktionsstand, Ausstellung, Sommerfest)?<br />
Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie?<br />
Welche Räumlichkeiten sind im Quartier / in Teilnehmernähe verfügbar?<br />
Gibt es Räume, die kostenlos zur Verfügung stehen?<br />
Wie viele Tische und Stühle benötigen Sie bzw. sind verfügbar?<br />
Erlaubt der Raum ein optimales Arrangement von Tischen und Stühlen?<br />
Welche Sitzgruppierung passt am besten zu Inhalt, Methode und Zielgruppe<br />
Ihrer Veranstaltung?<br />
Welche Materialien sind im Raum vorhanden? Was müssen Sie besorgen?<br />
(Stifte, Papier, Namensschilder, Overhead-Projektor, Tafel, Flip-Chart,<br />
Kücheneinrichtung, Spielsachen)<br />
Ist der Raum hell genug?<br />
Verfügt der Raum über eine Garderobe?<br />
Checkliste<br />
„Rahmenbedingungen“<br />
111<br />
Quellen <strong>für</strong> Kooperationen
112<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Die Zeit<br />
Findet die Veranstaltung zu einer Zeit statt, die <strong>für</strong> die Zielgruppe günstig ist?<br />
Wieviel Zeit sollen Sie ansetzen <strong>–</strong> um Ihre Inhalte und Methoden angemessen<br />
zu berücksichtigen und die Teilnehmer nicht zu überfordern?<br />
An welchem Tag findet die Veranstaltung statt? Sind Sie sicher, dass Ihre Veranstaltung<br />
keine übermächtige Konkurrenz hat (muslimischer Feiertag, Fußballspiel<br />
im Fernsehen, andere Veranstaltungen)?<br />
Die Kosten<br />
Was kostet die Veranstaltung? Was müssen die Teilnehmer bezahlen?<br />
Welche Möglichkeiten der Finanzierung und des Sponsoring gibt es?<br />
Wer kommt als Geldgeber in Frage?<br />
Was bekommen Sie kostenlos (Medien, Tagungsgetränke, Schautafeln,<br />
Broschüren)?<br />
Apropos Kosten: Auch Gesundheitsförderung <strong>für</strong> arme Menschen kostet Geld. Schon in der<br />
Vorbereitungsphase Ihrer Aktion sollten Sie den erforderlichen finanziellen Rahmen gesichert<br />
haben. Eine größere Aussicht auf eine längerfristige Projektförderung haben Sie vielleicht,<br />
wenn Sie mit einer wissenschaftlichen Einrichtung kooperieren, die sich an der Bedarfserhebung<br />
und Evaluation beteiligt und da<strong>für</strong> Forschungsgelder beantragt. Zu diesem Thema haben<br />
wir Ihnen eine Liste zum Ausfüllen abgedruckt.<br />
Wer kommt als Förderer in Frage? Wer könnte das <strong>für</strong> Sie sein?<br />
Landesjugendamt<br />
Jugendamt<br />
Sozialamt<br />
Staatliches Schulamt<br />
Wohlfahrtsverbände<br />
Krankenkassen nach<br />
§ 20 SGB V, Abs. 1:<br />
primäre Prävention,<br />
Schwerpunkt sozial Benachteiligte<br />
§ 20 SGB V, Abs. 2:<br />
betriebliche Gesundheitsförderung<br />
§ 20 SGB V, Abs. 4:<br />
Förderung der Selbsthilfe
Sponsoren<br />
<strong>•</strong> Banken<br />
<strong>•</strong> Betriebe vor Ort<br />
<strong>•</strong> Pharmafirmen<br />
Stiftungen<br />
<strong>•</strong> Wüstenrotstiftung<br />
<strong>•</strong> Kreissparkassen-Stiftung<br />
<strong>•</strong> Bertelsmann-Stiftung<br />
<strong>•</strong> Herzstiftung<br />
usw.<br />
Bürgerschaftliches Engagement<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Außer direkter Finanzhilfe können auch Sachmittel sehr hilfreich sein. Dazu gehören z.B. Demonstrationsmaterial,<br />
kleine Preise <strong>für</strong> Gewinnspiele, Lebensmittel und Getränke <strong>für</strong> Tagungsverpflegungen.<br />
Da<strong>für</strong> kommt eine Vielzahl von Sponsoren in Frage, wie z.B. Optiker, Sportfachgeschäfte,<br />
Sportvereine, Spielwarengeschäfte, Telefonanbieter, Getränkemärkte, Caterer,<br />
Gaststätten, Reformhäuser, Bäcker und Metzger oder Obst- und Gemüsehändler. Oder schalten<br />
Sie sich in große Projekte ein, wie z.B. derzeit die Gesundheitskampagne „5 mal täglich Obst<br />
und Gemüse“, die von der deutschen Krebsgesellschaft koordiniert wird und die viele namhafte<br />
Firmen und Institutionen unterstützen.<br />
Wie werben Sie <strong>für</strong> Ihr Projekt?<br />
Projekte leben von Teilnehmern, aber wie erreichen Sie die? Gehen Sie davon aus, dass sozial<br />
benachteiligte Menschen eher selten bei den üblichen Bildungsträgern anzutreffen sind <strong>–</strong> aus<br />
Gründen, die hier im Heft schon ausführlich geschildert wurden. Sie werden in der Regel die<br />
einschlägigen Veranstaltungskalender und Programme nicht lesen.<br />
Es hat sich bewährt, die Zielgruppe über direkte Ansprachen zu motivieren. Tun Sie das vor<br />
Ort. Das kostenlose Werbemedium „Mundpropaganda“ können Sie vor <strong>alle</strong>m bei Stadtteilaktionen<br />
gut nutzen. Suchen Sie sich Schlüsselpersonen, die einen guten Kontakt zum gewünschten<br />
Teilnehmerkreis haben. Das können Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen sein oder auch<br />
Betroffene, die Sie bereits kennen. Wenn Sie sich vor Augen halten, dass an einem normalen<br />
Vormittag bei jedem Sachbearbeiter im Sozialamt ca. 20 Menschen vorsprechen und jeder Antragsteller<br />
auf Ihr Projekt hingewiesen wird, dann erfahren rund 100 Personen in der Woche von<br />
Ihrem Vorhaben nur durch diesen einen Kollegen.<br />
Denken Sie darüber nach, wer über Adressen von sozial benachteiligten Menschen verfügt.<br />
Diese Kollegen könnten per Rundschreiben, z.B. zusammen mit dem Sozialhilfebescheid, Einladungen<br />
zu Ihrer Maßnahme beilegen. Sollten Sie eine Rückmeldung wünschen, wer teilnimmt,<br />
dann vergessen Sie bitte nicht, auch einen frankierten Briefumschlag hinzuzufügen.<br />
Die Tagespresse wird aus Kostengründen von sozial Benachteiligten eher selten abonniert.<br />
Hilfreiche Sachmittel<br />
Mundpropaganda<br />
113<br />
Multiplikatoren einbinden
114<br />
Wochenblätter anschreiben<br />
Andere Werbetipps<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Bessere <strong>Chancen</strong>, Ihr Projekt bekannt zu machen, bieten die kostenlosen Wochenblätter, die<br />
häufig automatisch in den Briefkästen landen. Für die Bewerbung Ihrer Projekte bei der Zielgruppe<br />
der sozial Benachteiligten haben sich außerdem folgende Vorgehensweisen bewährt:<br />
Arbeiten Sie direkt im Setting: Platzieren Sie Plakate in den Hauseingängen<br />
im sozialen Brennpunkt, nutzen Sie zentrale Anlaufpunkte, um Handzettel<br />
auszuteilen und Mitteilungen auszuhängen, binden Sie lokale Akteure <strong>–</strong> Erzieherinnen,<br />
Beraterinnen, Sozialarbeiter <strong>–</strong> mit ein.<br />
Schon bei der Bewerbung Ihres Projekts gilt: Präsentieren Sie Ihr Projekt als<br />
„aus dem Stadtteil <strong>für</strong> den Stadtteil“. Zeigen Sie Einbindungsmöglichkeiten<br />
auf, verdeutlichen Sie den Betroffenen, dass sie als Akteure gefragt und gewollt<br />
sind.<br />
Nutzen Sie regelmäßige Veranstaltungen im Quartier, wie z.B. den Wochenmarkt<br />
am Samstag, das jährliche Straßenfest, die Weihnachtsfeier im Sportverein,<br />
um auf Ihr Projekt hinzuweisen.<br />
Sprechen Sie gezielt bestehende Gruppierungen an, wie z.B. Mutter-Kind-<br />
Gruppen, Bürgertreffs, Fußball-Teams der „grauen Liga“ oder Jugendgruppen,<br />
und laden Sie sie zur geschlossenen Mitarbeit (und auch Selbstdarstellung)<br />
ein. Im Team ist der Schritt zum aktiven Mitmachen oft leichter <strong>–</strong><br />
außerdem verdeutlichen solche Gruppierungen mögliche soziale Aktivitäten<br />
im Quartier und laden ihrerseits zum Mitmachen ein.<br />
Auch wenn es nüchtern und kalkulierend klingt: Stellen Sie den Nutzeffekt<br />
Ihres Angebots <strong>für</strong> die Betroffenen klar heraus: Was macht Ihr Angebot <strong>für</strong><br />
die Zielgruppe attraktiv? In welchem Verhältnis stehen (Teilnahme-)Aufwand<br />
und Ergebnis?<br />
Durchführungphase<br />
Sie führen die Maßnahme durch oder stehen als Ansprechpartner zur<br />
Verfügung.<br />
Sie dokumentieren bereits das Geschehen.<br />
4.3 Sie bringen Ihr Projekt in die Diskussion<br />
Evaluationsphase<br />
Sie bewerten den Erfolg der Maßnahme.<br />
Sie dokumentieren die Maßnahme und die Ergebnisse der Evaluation.<br />
Sie bringen die Ergebnisse in die Öffentlichkeit.<br />
Sie sorgen <strong>für</strong> die Fortführung Ihrer Maßnahme oder planen weitere<br />
Aktionen.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
„Was kommt raus?“ „Hat es sich gelohnt?“ „Hat sich was verändert?“ „War das ganze Projekt<br />
sinnvoll?“<br />
Diese und andere Fragen wird man Ihnen nach Abschluss des Projekts stellen. Haben Sie Ihre<br />
Aktion gut evaluiert, dann sind die Antworten leicht zu finden. Mit einer Auswertung Ihres<br />
Projekts erhalten Sie nochmals eine gute Legitimation Ihrer Arbeit und der Ihrer Kooperationspartner.<br />
Die Evaluation zeigt zudem Ansätze <strong>für</strong> „Schwachstellen“ auf, falls Sie <strong>–</strong> oder andere<br />
<strong>–</strong> das Projekt wiederholen möchten, und schafft eine Grundlage <strong>für</strong> die spätere Öffentlichkeitsarbeit,<br />
die Kontakte mit der Presse und die Vorstellung der Ergebnisse in Diskussions- bzw. Entscheidungsforen.<br />
Im Bereich Gesundheitsförderung ist die Evaluation in den letzten Jahren im Zuge der Qualitätssicherung<br />
verstärkt ins Blickfeld gerückt. Vorher blieben viele Maßnahmen <strong>–</strong> vor <strong>alle</strong>m der<br />
Krankenkassen <strong>–</strong> ohne dokumentierten Erfolgsnachweis und ohne Bewertung, was letztlich<br />
auch dazu führte, dass deren Effekte angezweifelt wurden. Viele kleinere Projekte werden nicht<br />
evaluiert, da das aufgrund knapper personeller Ressourcen gar nicht leistbar ist. Die Gesundheitsförderung<br />
von sozial benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen muss sich vielerlei Bedenken<br />
schon mit dem Beginn der Maßnahme gef<strong>alle</strong>n lassen. Wenn Sie dann nicht belegen können,<br />
was die Erfolgsindikatoren Ihres Projekts sind, was Sie mit Ihrem Projekt erreichen wollen<br />
bzw. erreicht haben, und dass die aufgewandten Mittel sinnvoll investiert sind, ist es nahe<br />
liegend, dass solche Mittel nicht weiter bewilligt werden.<br />
Vom Nutzen der Evaluation<br />
Wenn Sie Ihr Projekt evaluieren und dokumentieren, dann hat das den Vorteil, dass Sie<br />
<strong>•</strong> die Maßnahme langfristig einrichten können, weil sie weitergefördert wird,<br />
<strong>•</strong> den Teilnehmern bestätigen können, dass Veränderungen möglich sind,<br />
<strong>•</strong> die Teilnehmer eventuell auch <strong>für</strong> die nächste Maßnahme gewinnen,<br />
<strong>•</strong> mitverfolgen können, inwiefern Strukturen sich verändern,<br />
<strong>•</strong> Ihren eigenen Einsatz bewerten und optimieren können, weil Ansätze <strong>für</strong> Änderungen<br />
sichtbar werden,<br />
<strong>•</strong> in der Öffentlichkeit Argumente anführen können <strong>für</strong> die Gesundheitsförderung von<br />
sozial Benachteiligten<br />
<strong>•</strong> eine Grundlage haben <strong>für</strong> Folgeentscheidungen<br />
<strong>•</strong> <strong>für</strong> das Thema Armut auch diejenigen sensibilisieren, die sich darum noch nicht<br />
kümmern.<br />
Evaluationsergebnisse können <strong>für</strong> viele Personengruppen und Einrichtungen eine Grundlage <strong>für</strong><br />
weitere Entscheidungen sein, z.B. <strong>für</strong><br />
<strong>•</strong> die Teilnehmer der Maßnahme,<br />
<strong>•</strong> die Akteure und Kooperationspartner,<br />
<strong>•</strong> den Auftraggeber,<br />
<strong>•</strong> Ihren Vorgesetzten und die Kollegen,<br />
<strong>•</strong> Ihnen übergeordnete Institutionen,<br />
Evaluation =<br />
Qualitätssicherung<br />
Vielfältige Nutzeffekte<br />
Evaluation als<br />
Entscheidungshilfe<br />
115
116<br />
Evaluation von Beginn<br />
an mitdenken<br />
Sie beschreiben<br />
Ihre Maßnahme<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
<strong>•</strong> die Regionale Arbeitsgemeinschaft oder die Kommunale Gesundheitskonferenz,<br />
<strong>•</strong> Arbeitskreise „Armut und Gesundheit“,<br />
<strong>•</strong> andere politische oder administrative Gremien und Entscheidungsträger,<br />
<strong>•</strong> Akteure, die zukünftig solche Projekte durchführen möchten,<br />
usw.<br />
Evaluieren <strong>–</strong> aber wie?<br />
Evaluation beginnt nicht erst mit dem Abschluss eines Projekts. Bereits in der Vorbereitung und<br />
Planung eines Projekts muss die Evaluation in Inhalt und Methode mitgedacht werden.<br />
So gehen Sie vor:<br />
<strong>•</strong> Sie beschreiben die Maßnahme.<br />
<strong>•</strong> Sie bestimmen die Ziele und Fragestellungen der Evaluation.<br />
<strong>•</strong> Sie legen Methodik und Instrumente der Evaluation fest.<br />
<strong>•</strong> Sie formulieren Erfolgsindikatoren.<br />
<strong>•</strong> Sie sammeln und analysieren die Daten.<br />
<strong>•</strong> Sie erstellen einen Bericht.<br />
Um so ausführlicher und klarer Sie die Maßnahme beschreiben, desto leichter wird Ihnen später<br />
das Formulieren von Evaluationszielen, Fragestellungen und Erfolgskriterien f<strong>alle</strong>n. Fassen<br />
Sie also die ganze Projektplanung übersichtlich zusammen: Thema der Maßnahme, Ziele, Zielgruppe,<br />
Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Zeitraum), Inhalte, Verlaufsplan, bisherige Erfahrungen<br />
und Ergebnisse, eingesetzte Methoden und Medien sowie Kooperationspartner. Ein Beispiel:<br />
Maßnahme<br />
Bewegungsförderung <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> aus<br />
einem sozialen Brennpunkt <strong>–</strong> ein<br />
Ergänzungsangebot zum Schulsport<br />
Projektinitiator Gesundheitsamt Großburgfeld<br />
Ziele Das Projekt soll dazu beitragen,<br />
<strong>•</strong> Gesundheit und Gesundheitsverhalten der <strong>Kinder</strong><br />
im Stadtteil zu verbessern,<br />
<strong>•</strong> ein kostenloses Angebot zur Verfügung zu stellen<br />
<strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> mit motorischen Entwicklungs-<br />
Defiziten,<br />
<strong>•</strong> das Bewegungsverhalten dieser <strong>Kinder</strong> zu fördern<br />
und ihnen Spaß an Sport und Bewegung<br />
zu vermitteln,<br />
<strong>•</strong> Konzentration und Ausdauer im Lernverhalten<br />
zu verbessern,<br />
<strong>•</strong> die sozialen Kompetenzen der <strong>Kinder</strong> zu fördern,
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Zielgruppe Grundschüler der 1. und 2. Klasse mit motorischen<br />
Entwicklungsverzögerungen; Grundschullehrer<br />
Anzahl der Teilnehmer 250 Schüler<br />
<strong>•</strong> die Lehrer in diesem Bereich fortzubilden.<br />
Inhalte Körperlicher Allgemeinzustand, Bewegungsförderung,<br />
Sozialverhalten, Lernverhalten<br />
Methoden und Medien Körperliche Untersuchung der <strong>Kinder</strong>, Spiele, Bewegungsübungen,<br />
Kleingruppenarbeit; Geräte, Musik,<br />
Videos, Malbücher<br />
Laufzeit 1999 bis 2002, wöchentlich 2 Stunden<br />
Ort Großburgfeld, 5 Grundschulen in sozialen Brennpunkten,<br />
jeweils in der Sporth<strong>alle</strong><br />
Finanzierung Mittel der örtlichen Krankenkassen<br />
Kooperationspartner Gesundheitsamt, Schulamt, Schule, Lehrer, Sportverein,<br />
Krankenkassen, Krankengymnasten, Bademeister,<br />
<strong>Kinder</strong>arzt<br />
Evaluation ist immer dann besonders wichtig, wenn Entscheidungen zu fällen sind. Die Evaluationsziele<br />
richten Sie entsprechend an den Entscheidungsinhalten aus. Im Bereich Gesundheitsförderung<br />
<strong>für</strong> sozial benachteiligte <strong>Kinder</strong> und Jugendliche könnten z.B. Entscheidungen<br />
anstehen über<br />
<strong>•</strong> die Einführung neuer Interventionsmaßnahmen,<br />
<strong>•</strong> die Ansprache neuer Zielgruppen,<br />
<strong>•</strong> die Fortführung, verstärkte Unterstützung oder Verbesserung von Projekten,<br />
<strong>•</strong> die Optimierung von Versorgungsstrukturen im Stadtviertel,<br />
<strong>•</strong> die Dezentralisierung von Versorgungsangeboten,<br />
<strong>•</strong> neue Projektstrategien (z.B. unter verstärkter Einbeziehung von Betroffenen),<br />
<strong>•</strong> die Auswahl von neuen Orten <strong>für</strong> Gesundheitsförderungsmaßnahmen,<br />
usw.<br />
Sollte die Entscheidung darüber anstehen, ob Ihre Maßnahme fortgesetzt wird, bewerten Sie vor<br />
<strong>alle</strong>m, inwiefern Sie die Zielgruppe erreicht haben und ob sich z.B. das Gesundheitsverhalten<br />
der Betroffenen ändert.<br />
Wollen Sie eine <strong>Kinder</strong>tafel im Stadtteilzentrum auf Dauer einrichten, werden Sie in der<br />
Evaluation danach fragen, ob die <strong>Kinder</strong> das Angebot überhaupt annehmen, was es kostet, wie<br />
groß der organisatorische und planerische Aufwand ist und welche messbaren gesundheitlichen<br />
Effekte sich zeigen.<br />
Falls demnächst entschieden wird, ob der Geschäftsführer der Diskothek im sozialen Brennpunkt<br />
zusammen mit dem Stadtjugendring und Ihnen die Aktion „rauchfreie Zone“ nochmals<br />
Evaluationsziele<br />
117
118<br />
Die Prozessevaluation <strong>–</strong><br />
„Was läuft ab?“<br />
Die Ergebnisevaluation <strong>–</strong><br />
„Was kommt hinten raus?“<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
durchführen wird, obwohl das die Jugendlichen bislang wenig interessiert hat, dann zielt die<br />
Evaluation z.B. auf bisher (un)genutzte Möglichkeiten zur aktiven Einbindung von Betroffenen,<br />
auf die detaillierte und kritische Betrachtung einzelner Projektschritte, auf die Effektivität Ihres<br />
bisherigen methodischen Ansatzes und auf (un)genutzte Möglichkeiten kooperativen Vorgehens.<br />
Sind die Ziele der Evaluation festgelegt, dann überlegen Sie, was konkret untersucht werden<br />
soll und formulieren die Fragestellungen der Erhebung. Zum Beispiel: Wieviele Bewohner des<br />
Stadtteils haben an der Maßnahme teilgenommen? Wie hat sich der Gesundheitszustand der<br />
<strong>Kinder</strong> verändert? Welche Maßnahmen und Methoden sind von der Zielgruppe gut angenommen<br />
worden? Wie effizient hat die Arbeitsteilung in Ihrem Kooperationsverbund funktioniert?<br />
Eine umfassende Evaluation berücksichtigt die gesamte Maßnahme. D.h. Sie bewerten Ihr<br />
Projekt zu verschiedenen Zeitpunkten, nämlich am Anfang, während der Durchführung (Prozessevaluation)<br />
und am Ende (Ergebnisevaluation).<br />
Die Prozessevaluation stellt die qualifizierte Durchführung der Maßnahme sicher und hilft<br />
schließlich bei der Verbesserung des Programms. Im Rahmen einer Prozessevaluation stellen<br />
Sie sich z.B. folgende Fragen:<br />
<strong>•</strong> Was hindert oder fördert die Entwicklung?<br />
<strong>•</strong> Welche Veränderungen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt ergeben?<br />
<strong>•</strong> Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern?<br />
<strong>•</strong> Was muss ich jetzt am Projekt ändern, damit das Interesse steigt?<br />
Die Ergebnisevaluation weist die Effektivität des Programms nach. Folgende Fragen stellen Sie<br />
sich z.B.:<br />
<strong>•</strong> Welche Projektziele sind erreicht worden?<br />
<strong>•</strong> Haben sich neue Strukturen im Stadtviertel gebildet?<br />
<strong>•</strong> Wie sind die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung nach der Maßnahme?<br />
<strong>•</strong> Wieviele <strong>alle</strong>inerziehende Mütter haben eine <strong>Kinder</strong>betreuungsstelle gefunden?<br />
Mit der Formulierung von Zielen ist zwingend die Formulierung von Erfolgsindikatoren verbunden.<br />
Inwiefern Sie Ihr Ziel wirklich erreicht haben, können Sie nur anhand von Erfolgsindikatoren<br />
feststellen. Diese Indikatoren müssen Sie operationalisieren, d.h. messbar machen.<br />
Dazu ein einfaches Beispiel:
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Am Beispiel einer Präventionsmaßnahme im Stadtteil haben wir einmal eine Checkliste <strong>für</strong> Erfolgsindikatoren<br />
und Messinstrumente exemplarisch <strong>für</strong> Sie zusammengestellt <strong>–</strong> ein Gesundheitstag<br />
mit Aktionsständen zu den Themen Bewegung, Ernährung, Entspannung, Alkoholkonsum,<br />
Hautpflege...<br />
Ziele der Maßnahme<br />
Was wollen Sie<br />
erreichen?<br />
Durchführung einer<br />
Veranstaltung<br />
Die Maßnahme soll...<br />
...das Interesse der Bewohner<br />
am Thema Gesundheit<br />
wecken<br />
...den Bedarf an gesundheitlichen<br />
Themen ergeben<br />
...den gegenseitigen Austausch<br />
der Bewohner vor<br />
Ort fördern<br />
...der Imagepflege der eigenen<br />
Einrichtung dienen<br />
...Kooperationspartner<br />
finden und Vernetzung<br />
fördern<br />
... Anregungen <strong>für</strong> Themen<br />
weiterer Maßnahmen<br />
liefern<br />
...Strukturen im Stadtteil<br />
verändern (helfen)<br />
Erfolg Ihrer Maßnahme<br />
Was ist bewirkt worden?<br />
Durchführung, Abbruch,<br />
Nichtdurchführung<br />
Gute Akzeptanz des Gesundheitstags,<br />
positive<br />
Aussagen der Bewohner<br />
über das Angebot<br />
Gute Akzeptanz des<br />
Gesundheitstags,<br />
viele Besucher am jeweiligen<br />
Aktionsstand, großes<br />
Interesse an Informationsmaterial<br />
und Beratung, positive<br />
Aussagen der Bewohner<br />
über das Angebot<br />
Rege Unterhaltungen am Imbissstand<br />
Presseartikel erschienen, hohe<br />
Teilnehmerzahl am eigenen<br />
Stand, größere Inanspruchnahme<br />
der eigenen<br />
Einrichtung<br />
Geeignete Kooperationspartner<br />
wurden gefunden,Vernetzung<br />
wird auf- und ausgebaut<br />
Zukünftige Themen konnten<br />
gefunden werden<br />
Große Bereitschaft der ansässigen<br />
Einrichtungen zur<br />
Vernetzung untereinander<br />
Erfolgsindikatoren und zugehörige<br />
Messinstrumente<br />
Wie messen Sie?<br />
Verlaufsplan aufstellen<br />
Anzahl der Besucher<br />
insgesamt, Zufriedenheitsabfrage<br />
Anzahl Besucher am jeweiligen<br />
Aktionsstand, kleines<br />
Quiz mit Preisen, Anzahl der<br />
ausgegebenen Broschüren<br />
Anzahl der Besucher<br />
Zufriedenheitsabfrage<br />
Anzahl und Inhalt der Presseartikel,<br />
Zahl der Inanspruchnahme<br />
von Beratungsund<br />
Versorgungsangeboten<br />
in Zukunft<br />
Vereinbarungen über konkrete<br />
Zusammenarbeit, Zustimmung<br />
der Kooperationspartner<br />
<strong>für</strong> weitere Projekte<br />
Befragung der Bewohner<br />
Angebote der Einrichtungen<br />
vor Ort, Inanspruchnahme<br />
dieser Einrichtungen<br />
Sie formulieren<br />
Erfolgsindikatoren<br />
119
120<br />
Evaluation erfordert<br />
Knowhow<br />
Sie sammeln Daten und<br />
analysieren sie<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
... die Ressourcen der<br />
Bewohner nutzen<br />
...die Bewohner <strong>für</strong> den<br />
Konsum alkoholfreier Getränke<br />
motivieren<br />
Bewohner beteiligten sich<br />
aktiv an der Aktion<br />
Konsum alkoholfreier Getränke<br />
war höher als der<br />
Konsum von Bier und Wein<br />
Anzahl der beteiligten<br />
Bewohner<br />
Verkaufte Getränke in<br />
Litern, Befragung<br />
Übersicht in Anlehnung an: Landeszentrale <strong>für</strong> Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.<br />
(Hrsg.) (1997): Rund um die regionale Gesundheitskonferenz. Ein Leitfaden zur Handhabung<br />
regionaler Gesundheitskonferenzen. Mainz<br />
Auch mit der Evaluation verbinden sich Fragen der praktischen Durchführung. Wer hat das nötige<br />
Know-how? Wer verfügt über die erforderlichen Personal- und Zeitressourcen? Eine ernsthafte<br />
Evaluation ist keine Banalität, die sich so nebenbei erledigen lässt. Auch gewisse sozialwissenschaftliche<br />
Kenntnisse über die Erhebung von und den Umgang mit Daten sollten vorhanden<br />
sein. Bei größeren Projekten sollten Sie prüfen, ob Sie ein kompetentes Institut, eine<br />
Fachhochschule oder Universität in die wissenschaftlichen Betreuung Ihres Projekts <strong>–</strong> z.B. im<br />
Rahmen einer Diplom- oder Magisterarbeit <strong>–</strong> einbinden können. Aber auch bei selbstentworfenen<br />
Evaluationskonzepten sollten Sie versuchen, allgemein akzeptierte Standards nach Möglichkeit<br />
einzuhalten. Das Landesgesundheitsamt (in Baden-Württemberg) und das lögd (in<br />
Nordrhein-Westfalen) können Ihnen dabei beratend zur Seite stehen.<br />
Im Kapitel über die Bestandsaufnahme wurden bereits zwei Erhebungsmethoden vorgestellt,<br />
die sich auch <strong>für</strong> die Evaluation eignen <strong>–</strong> die schriftliche Befragung und das Interview. Aber<br />
auch die Beobachtung als Methode bietet sich an. Informationen z.B. über die Inanspruchnahme<br />
von Angeboten der Gesundheitsversorgung erhalten Sie durch das Zählen der Besucher. Das<br />
Interesse an Ihrem Thema zeigt sich etwa an der Anzahl der ausgegebenen Broschüren. Ob die<br />
sozialen Kompetenzen von Schulkindern durch Ihr Projekt gefördert wurden, beobachten Sie<br />
am gegenseitigen Miteinander in der Klasse. Solche Fragestellungen werden eher selten anhand<br />
eines Fragebogens untersucht.<br />
Das Instrument bzw. die Methode Ihrer Erhebung wählen Sie nach folgenden Kriterien aus:<br />
Wer soll evaluiert werden <strong>–</strong> Betroffene, Kooperationspartner, Einrichtungen,<br />
<strong>Kinder</strong> oder Erwachsene?<br />
Was wollen Sie erheben?<br />
Wie umfangreich ist Ihre Fragestellung? Reicht ein Instrument aus?<br />
Wo und wann soll evaluiert werden?<br />
Wieviel Zeit steht Ihnen <strong>für</strong> die Evaluation zur Verfügung?<br />
Was ist Hintergrund und Zweck der Evaluation und wie detailliert sollen die<br />
Ergebnisse sein?<br />
Für Evaluationsfragebögen gibt es viele Muster und Vorbilder. Manchmal passen die genau auf<br />
Ihre Fragestellung, und Sie können sie übernehmen. Es ist aber auch möglich, dass Sie erst einen<br />
Fragebogen erstellen müssen. Falls das <strong>für</strong> Sie Neuland ist, dann ziehen Sie einen Experten zurate.<br />
Denn die Qualität des Fragebogens ist ausschlaggebend <strong>für</strong> die Qualität und Aussagekraft<br />
Ihrer Daten und ganz besonders <strong>für</strong> die Zeit, die Sie <strong>für</strong> die Dateneingabe und -auswertung be-
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
nötigen. (Falls Sie dem ÖGD in NRW angehören, bietet Ihnen das lögd eine Beratung bei der Erstellung<br />
Ihres Fragebogens sowie eine automatisierte Auswertung und Ergebnisaufbereitung an.)<br />
Für Zufriedensheitsabfragen stehen mittlerweile eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung.<br />
Ein einfaches Beispiel ist die Punkteskala, bei der die Teilnehmer nur einen Punkt in das<br />
zutreffende Feld kleben müssen:<br />
Wie hat es Ihnen heute hier gef<strong>alle</strong>n?<br />
Bitte kleben Sie Ihren Punkt in die entsprechende Spalte<br />
J K L<br />
Achten Sie darauf, dass die Ergebnisevaluation sofort nach der Maßnahme in Angriff genommen<br />
wird (sofern Sie nicht den Anspruch haben, Langzeitwirkungen zu untersuchen). Bei<br />
schriftlichen Befragungen müssen Sie u.U. mehrmals an das Zurückschicken der Fragebögen erinnern.<br />
Dokumentieren Sie sowohl den Auslauf als auch den Rücklauf dieser Bögen.<br />
Zur Eingabe der Daten in den Computer und zur Auswertung sollten Sie einen Fachmann<br />
(oder eine Fachfrau) heranziehen <strong>–</strong> besonders dann, wenn bei größeren Fallzahlen statistische<br />
Berechnungen nötig werden.<br />
Für die Analyse Ihrer Ergebnisse ist eine Diskussion der vorhandenen Daten in einer internen<br />
Runde bzw. in einem speziellen Arbeitskreis hilfreich. Bringen Sie Ihre Ergebnisse „auf den<br />
Punkt“, und stellen Sie die Kernaussagen mit Hilfe von graphischen Aufbereitungen auch optisch<br />
heraus, damit das Wichtigste schnell erfasst und diskutiert werden kann.<br />
Die Dokumentation oder: Wie schreiben Sie einen Projektbericht?<br />
Natürlich gibt es <strong>für</strong> den guten Projektbericht nicht das eine Patentrezept. Es gibt aber ein paar<br />
Erfolgskriterien, an denen Sie sich orientieren können. Einige davon haben wir zu einer kleinen<br />
Checkliste zusammengefasst.<br />
Checkliste <strong>für</strong> die Erstellung eines Projektberichts<br />
Zielgruppe: Wer liest den Bericht (z.B. Politiker, Betroffene, Experten,<br />
Presseorgane, allgemeine Öffentlichkeit)? Wieviel „Lesezeit“<br />
haben diese Leute? Was ist ihr besonderes Interesse?<br />
Ressourcen: Wieviel Geld und Zeit haben Sie <strong>für</strong> das Erstellen des Berichts?<br />
Wer könnte Sie beim Schreiben unterstützen? Wieviel<br />
Exemplare benötigen Sie? Wie aufwendig dürfen Gestaltung<br />
und Druck sein?<br />
Ziel des Berichts: Dient der Bericht zur Rechtfertigung über Mittelverwendung?<br />
Zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit? Zur Sensibilisierung<br />
von Politik und Verwaltung? Als Entscheidungsgrundlage?<br />
121
122<br />
Vorüberlegungen <strong>für</strong><br />
Ihr „Marketing“<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Als neutrale „Allzweck-Dokumentation? Die Kernaussagen<br />
müssen einen klaren Bezug zur Zielsetzung haben.<br />
Inhalt des Berichts: Was sind die wichtigen Aussagen und wie ausführlich muss<br />
das Ganze sein? Wieviel Zeit haben die Leser <strong>für</strong> das Studium<br />
solcher Berichte? Welche Strukturierung ist gleichzeitig leserfreundlich<br />
und zielführend?<br />
Verständlichkeit des Ist Ihr Bericht klar strukturiert, auf die wesentlichen Aussagen<br />
Berichts:<br />
zugeschnitten und in verständlicher Sprache abgefasst? Wieviel<br />
„Wissenschaftlichkeit“ ist gefragt? Wieviel Fach- und Fremdwörter<br />
sind zumutbar? Animiert Ihr Text zum Weiterlesen?<br />
Sind die Graphiken und Tabellen übersichtlich und die darin<br />
enthaltenen Aussagen (möglichst) auf einen Blick erfassbar?<br />
Gute Beispiele <strong>für</strong> gelungene Projekt-Dokumentationen aus dem Bereich der Gesundheitsförderung<br />
bei sozial Benachteiligten sind:<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsamt Köln, Geschäftsstelle „Kommunale Gesundheitskonferenz Köln“, <strong>Kinder</strong>und<br />
Jugendgesundheitsdienst: Projektbericht: FAKIR (Förder-Angebote <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> in Regionen<br />
mit erhöhtem Hilfebedarf). Zu bestellen bei: Gesundheitsamt der Stadt Köln 535,<br />
Neumarkt 15 <strong>–</strong> 21, 50667 Köln<br />
<strong>•</strong> Landratsamt Ortenaukreis <strong>–</strong> Dienst <strong>für</strong> Gesundheitsförderung und soziale Prävention: Dokumentation<br />
des Projekts Gesundheitsförderung <strong>für</strong> sozial Benachteiligte „Gesund und<br />
preiswert leben durch cleveres Wirtschaften“. Zu beziehen bei: Andrea Blaser,<br />
Dienst <strong>für</strong> Gesundheitsförderung und Soziale Prävention, Landratsamt Ortenaukreis,<br />
Badstraße 20, 77652 Offenburg, Tel.: 0781/805-770<br />
<strong>•</strong> Stadtteilbüro Eidelstedt-Nord, Bezirksamt Eimsbüttel: Soziale Stadtteilentwicklung Eidelsstedt-Nord<br />
„Visitenkarte“. Zu beziehen bei: Conny Schubecker, Stadtteilbüro Eidelstedt-<br />
Nord, Projektentwicklung und Gemeinwesenarbeit, Hörgensweg 59 b, 22523 Hamburg,<br />
Tel. 040/577891<br />
Wie bringen Sie Ihre Ergebnisse in die Öffentlichkeit?<br />
Ist Ihr Bericht gedruckt, geht es darum, den Bericht und die gewünschten Adressaten und potenziellen<br />
Leser zusammenzubringen. Wenn dabei nicht nur eine eng begrenzte Zielgruppe gemeint<br />
ist, müssen Sie nach geeigneten Wegen der Verbreitung und Bekanntmachung suchen. Sie<br />
brauchen eine Marketing-Strategie.<br />
Da<strong>für</strong> bieten sich einige Vorüberlegungen an:<br />
<strong>•</strong> Die wichtigste Prämisse noch einmal zur Erinnerung: Armut und soziale Benachteiligung<br />
sind niemandes Lieblingsthemen. Eine sensible Öffentlichkeitsarbeit muss auf offenen oder<br />
versteckten Widerstand, Unwillen, Ressentiments u.ä. gefasst sein und geeignete Strategien<br />
parat haben.
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
<strong>•</strong> Erstellen Sie zu Ihrem Bericht eine Kurzfassung auf einigen Seiten <strong>für</strong> Eilige und eine<br />
Ultrakurzfassung auf maximal einer Seite, damit auch diejenigen, die permanent unter Zeitdruck<br />
stehen, wenigstens einen Überblick bekommen. Hier spielen die erwähnten Kernaussagen<br />
wieder eine große Rolle!<br />
<strong>•</strong> Denken Sie an die Bereitstellung von „neuen Medien“. Für die Presse sollten Sie Ihren Be<br />
richt nicht nur gedruckt zur Verfügung halten, sondern auch auf CD oder Diskette. Das erspart<br />
den Redakteuren viel Zeit, weil sie sich entsprechende Tabellen oder Textpassagen einfach<br />
nur kopieren müssen. Formulieren Sie Presseartikel vor! Eine Pressemappe sollte mit<br />
Unterlagen bestückt sein, die schnell überflogen werden können und sich auf die wichtigsten<br />
Fakten beschränken: Viel hilft hier nicht viel. Machen Sie sich einen Merkzettel <strong>für</strong> Interviews<br />
im Rundfunk, und sprechen Sie die Fragen vorher mit dem zuständigen Redakteur ab.<br />
<strong>•</strong> Erstellen Sie sich einen Verteiler von potenziellen Ansprechpartnern, Multiplikatoren und<br />
Schlüsselpersonen, die Sie erreichen möchten und die Sie auch bei Ihrem Vorhaben unterstützen<br />
könnten.<br />
<strong>•</strong> Denken Sie darüber nach, wie Sie das besondere Thema „Armut und Gesundheit von<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen“ so präsentieren, dass der größtmögliche Effekt erreicht wird.<br />
Unabhängig von einem eher emotionalen oder sachlich-nüchternen Stil gilt ein Grundprinzip:<br />
Zeigen Sie weitere Handlungsmöglichkeiten auf und halten Sie Lösungsvorschläge bereit.<br />
Jede(r) Leser(in) sollte nach Möglichkeit klar vor Augen haben, was der nächste Schritt<br />
ist und was <strong>–</strong> insbesondere die eigene Person oder Institution <strong>–</strong> konkret beitragen kann.<br />
Welche Methoden setzen Sie ein?<br />
<strong>•</strong> Sie verschicken Ihren Bericht mit der Kurzfassung an die wichtigsten Adressaten. Legen Sie<br />
einen Feedbackbogen bei, auf dem die Adressaten festhalten können, wie ihnen der Bericht<br />
gef<strong>alle</strong>n hat.<br />
<strong>•</strong> Sie lassen sich zum Vortrag einladen. Was <strong>für</strong> die Berichtsformulierung gut war, gilt in <strong>gleiche</strong>m<br />
Maße auch <strong>für</strong> die Gestaltung von Vortragsfolien. Konzentrieren Sie sich ganz auf die<br />
Kernaussagen <strong>–</strong> das Wesentliche sollte auf den ersten Blick erfassbar sein.<br />
<strong>•</strong> Sie laden selbst zu einer Gesprächsrunde ein <strong>–</strong> oder zu einem Workshop, einer Tagung,<br />
einem Arbeitskreis, einer Pressekonferenz, einer Podiumsdiskussion. Holen Sie gegebenenfalls<br />
einen externen und neutralen Moderator hinzu.<br />
<strong>•</strong> Sie verfassen einen Rundbrief an die Mitglieder der RAG oder Kommunalen Gesundheitskonferenz<br />
zum Thema <strong>Chancen</strong>gleichheit und Gesundheit.<br />
<strong>•</strong> Sie veranstalten eine Multiplikatorenschulung <strong>für</strong> Experten.<br />
Beispiel: Der Arbeitskreis „Armut und Gesundheit“ der regionalen Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong><br />
Gesundheit im Schwarzwald-Baar-Kreis lud die Sachbearbeiter des Sozialamts ein zu zwei<br />
123
124<br />
Teil IV. Die lokale Praxis oder »Wie gehen Sie vor?«<br />
Fortbildungen: „<strong>Gesunde</strong> Ernährung bei geringem Einkommen <strong>–</strong> wie geht das?“ und „Umgang<br />
mit Banken und Versicherungen <strong>–</strong> Haushaltsplanung“.<br />
<strong>•</strong> Sie geben kleine Pressemeldungen an Vereine und Institutionen <strong>für</strong> deren Mitteilungsblätter.<br />
<strong>•</strong> Kostenlose Wochenblätter bieten sich als Medium an, wenn Sie Betroffene informieren wollen.<br />
Legen Sie Faltblätter im Sozialamt, im Jugendamt oder bei der Schuldnerberatung aus.<br />
<strong>•</strong> Freie Journalisten leben davon, Geschichten zu verkaufen. Sie sind auf Neuigkeiten angewiesen<br />
und übernehmen <strong>für</strong> Sie das „Verkaufen“ des Beitrags an die Medien. Nehmen Sie<br />
Kontakt auf zu freien Mitarbeitern von Presse und Rundfunk in Ihrer Nähe.<br />
<strong>•</strong> Schlagen Sie der örtlichen Tageszeitung vor, wöchentlich eine Kolumne z.B. zum Thema:<br />
„Preiswerte Gesundheit“ zu veröffentlichen. Da<strong>für</strong> liefern Sie den Text.<br />
<strong>•</strong> Stellen Sie Ihren Bericht ins Internet und geben Sie einen Hinweis dazu auf der Homepage<br />
Ihrer Einrichtung. Bemühen Sie sich um die Aufnahme in Suchmaschinen und in Listen von<br />
Links anderer Institutionen.<br />
<strong>•</strong> Gehen Sie auf entsprechende überregionale oder bundesweite Tagungen und präsentierten<br />
Sie dort Ihre Ergebnisse.<br />
Zum Vertiefen:<br />
Auswertungs- und Informationsdienst <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (aid) e.V.<br />
(Hrsg.) (1997): Handbuch <strong>für</strong> die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bonn<br />
Christiansen, G. (2000): Evaluation <strong>–</strong> ein Instrument in der Gesundheitsförderung. Herausgegeben<br />
von der Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Reihe: Forschung und<br />
Praxis der Gesundheitsförderung; <strong>Band</strong> 8<br />
Knesebeck von dem, O.; Badura, B; Zamora, P.; Weihrauch, B.; Werse, W.; Siegrist, J. (2001):<br />
Evaluation einer gesundheitspolitischen Intervention auf kommunaler Ebene <strong>–</strong> Das Modellprojekt<br />
„Ortsnahe Koordinierung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung“ in Nordrhein-Westfalen.<br />
In: Gesundheitswesen 2001; 63: S. 35-41<br />
Landeszentrale <strong>für</strong> Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (Hrsg.) (1997): Rund um die<br />
regionale Gesundheitskonferenz. Ein Leitfaden zur Handhabung regionaler Gesundheitskonferenzen.<br />
Mainz<br />
Wengle E. (1995): Praxisnahe Evaluation. In: Krause, R. (Hrsg.): Gesundheitsförderung: Von<br />
der Projektplanung bis zur Evaluation. Handbuch zum Management in der Gesundheitsförderung.<br />
Oberhaching: Gesundheits-Dialog Verlag GmbH
Cattaryna B. Home<br />
Foto: www.offroadkids.de<br />
125
126<br />
Teil V. Anhang<br />
5. Anhang<br />
Tipps zum Recherchieren<br />
Die folgenden Tipps zum Recherchieren in der Literatur und im Internet stellen eine Auswahl<br />
an Quellen zu den Themen Armut, <strong>Kinder</strong>armut, Gesundheit und Gesundheitsförderung dar.<br />
Armut und von Armut bedrohte und betroffene Personengruppen<br />
Andreß, H.-J. (1999): Leben in Armut: Analysen der Verhaltensweisen armer Haushalte<br />
mit Umfragedaten. Opladen<br />
Cornelius, I.; Eggen, B.; Goeken, S.; Vogel, C., (1994): Alleinerziehende mit Kleinkindern.<br />
Untersuchung zum Programm „Mutter und Kind“ des Landes Baden-Württemberg. Bestandsaufnahme<br />
<strong>–</strong> Bewertungen <strong>–</strong> Auswirkungen. Hrsgg. vom statistischen Landesamt Baden-Württemberg.<br />
Stuttgart. Heft 26<br />
Eggen, B.; Vogel, C. (1994): Alleinerziehende mit Kleinkindern. Methodenbericht. Untersuchung<br />
zum Programm „Mutter und Kind“ des Landes Baden-Württemberg. Hrsgg. vom<br />
statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Stuttgart. Heft 27<br />
Eggen, B (1998): Privathaushalte mit Niedrigeinkommen. Familienwissenschaftliche Forschungsstelle<br />
im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Hrsg.: Der Bundesminister<br />
<strong>für</strong> Gesundheit. Baden-Baden<br />
Nestmann, F.; Stiehler, S. (1998): Wie <strong>alle</strong>in sind Alleinerziehende? Soziale Beziehungen<br />
<strong>alle</strong>inerziehender Frauen und Männer in Ost und West. Opladen<br />
Verband <strong>alle</strong>instehender Mütter und Väter e.V., Landesverband Baden-Württemberg (1992):<br />
Situationsanalyse Alleinerziehender in Baden-Württemberg. Stuttgart<br />
Walper, S. (1988): Familiäre Konsequenzen ökonomischer Deprivation. München, Weinheim<br />
Armut und soziale Ungleichheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
Beisenherz, H.G. (2002): <strong>Kinder</strong>armut in der Wohlfahrtsgesellschaft. Das Kainsmal der<br />
Globalisierung. Opladen<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1998): Zehnter <strong>Kinder</strong>-<br />
und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von <strong>Kinder</strong>n und die Leistungen<br />
der <strong>Kinder</strong>hilfe in Deutschland. Bonn<br />
Butterwegge, C. (Hrsg.) (2000): <strong>Kinder</strong>armut in Deutschland. Ursachen, Erscheinungsformen<br />
und Gegenmaßnahmen. Frankfurt am Main<br />
Die <strong>Kinder</strong>schutzzentren (Hrsg.) (1996): Armut und Benachteiligung von <strong>Kinder</strong>n. Köln<br />
Hock, B.; Holz, G. (1998): Arm dran? Lebenslagen und Lebenschancen von <strong>Kinder</strong>n und
Teil V. Anhang<br />
Jugendlichen. Erste Ergebnisse einer Studie im Auftrag des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt.<br />
Frankfurt am Main<br />
Hock, B. ; Holz, G.; Wüstendörfer, W. (1999): Armut <strong>–</strong> Eine Herausforderung <strong>für</strong> die verbandliche<br />
<strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe. Zweiter Zwischenbericht zu einer bundesweiten Befragung<br />
in den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt. Frankfurt am Main<br />
Hock, B.; Holz, G.; Wüstendörfer, W. (2000): Frühe Folgen <strong>–</strong> langfristige Konsequenzen?<br />
Armut und Benachteiligung im Vorschulalter. Vierter Zwischenbericht zu einer Studie im<br />
Auftrag des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Veröffentlicht vom Eigenverlag des Instituts<br />
<strong>für</strong> Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V., Frankfurt am Main<br />
Iben, G. (Hrsg.) (1998): Kindheit und Armut. Analyse und Projekte. Münster<br />
Kamensky, J.; Heusohn, L.; Klemm, U. (Hrsg.) (2000): Kindheit und Armut in Deutschland:<br />
Beiträge zur Analyse, Prävention und Intervention. Ulm<br />
Klocke, A.; Hurrelmann, K. (Hrsg.) (2001): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. Umfang,<br />
Auswirkungen und Konsequenzen. Opladen<br />
Lauterbach, W.; Lange, A.; Wüest-Rudin, D. (1999): Familien in prekären Einkommenslagen.<br />
Konsequenzen <strong>für</strong> die Bildungschancen von <strong>Kinder</strong>n in den 80er und 90er Jahren. In:<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> Erziehungswissenschaft, 2. Jg., H.3/1999, S. 361-383<br />
Mansel, J.; Neubauer, G. (Hrsg.) (1998): Armut und soziale Ungleichheit bei <strong>Kinder</strong>n.<br />
Opladen<br />
Mansel, J.; Brinkhoff, K.-P. (Hrsg.) (1998): Armut im Jugendalter. Soziale Ungleichheit,<br />
Gettoisierung und die psychosozialen Folgen. Weinheim/München<br />
Otto, U. (Hrsg.) (1997): Aufwachsen in Armut. Erfahrungswelten und soziale Lagen von<br />
<strong>Kinder</strong>n armer Familien. Opladen<br />
Richter, A. (2000): Wie erleben und bewältigen <strong>Kinder</strong> Armut? Eine qualitative Studie<br />
über die Belastungen aus Unterversorgungslagen und ihre Bewältigung aus subjektiver Sicht<br />
von Grundschulkindern einer ländlichen Region. Aachen<br />
Armut und Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
Altgeld, T.; Hofrichter P. (Hrsg.) (2000): Reiches Land <strong>–</strong> kranke <strong>Kinder</strong>? Frankfurt am Main<br />
Barlösius, E.; Feichtinger, E.; Köhler, B. M. (Hrsg.) (1995): Ernährung in der Armut. Gesundheitliche,<br />
soziale und kulturelle Folgen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin<br />
Bieligk, A. (1996): Die armen <strong>Kinder</strong> <strong>–</strong> Armut und Unterversorgung bei <strong>Kinder</strong>n, Belastungen<br />
und ihre Bewältigung. Essen<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (1998): Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n <strong>–</strong><br />
Epidemiologische Grundlagen <strong>–</strong> Dokumentation einer Expertentagung. Köln<br />
Haffner, J.; Esther, C.; Münch, H.; Parzer, P.; Raue, B.; Steen, R.; Klett, M.; Resch, F.<br />
(1998): Veränderte Kindheit <strong>–</strong> neue Wirklichkeiten. Verhaltensauffälligkeiten im Einschulungsalter.<br />
Ergebnisse einer epidemiologischen Studie. Beiträge zur regionalen Gesundheitsberichterstattung<br />
Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg. Eine Studie der Abteilung <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>- und<br />
Jugendpsychiatrie der Universität Heidelberg und des Gesundheitsamts Rhein-Neckar-Kreis.<br />
127
128<br />
Teil V. Anhang<br />
Hofrichter, P.; Altgeld, T. (Hrsg.) (2000): Suppenküchen im Schlaraffenland <strong>–</strong> Armut und<br />
Ernährung von Familien und <strong>Kinder</strong>n in Deutschland. Hannover<br />
Kaiser, C. (2001): Ernährungsweisen von Familien mit <strong>Kinder</strong>n in Armut. Eine qualitative<br />
Studie zur Bedeutung und Erweiterung des Konzepts der Ernährungsarmut. Stuttgart<br />
Kamensky, J.; Feichtinger, E.; Zenz, H. (2000): Essen und Einkommen. In: Deutsche Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Ernährung e.V., Sektion Thüringen (Hrsg.): Referate anlässlich der 8. Ernährungsfachtagung<br />
in Jena. S. 29-47<br />
Kamensky, J: (2000): <strong>Kinder</strong>armut: Folgen <strong>für</strong> die Ernährung. In: Kamensky, J.; Heusohn,<br />
L.; Klemm, U. (Hrsg.) (2000): Kindheit und Armut in Deutschland: Beiträge zur Analyse,<br />
Prävention und Intervention. Ulm. S. 86-106<br />
Klocke, A. (1995): Der Einfluss sozialer Ungleichheit auf das Ernährungsverhalten im<br />
<strong>Kinder</strong>- und Jugendalter. In: E. Barlösius; E. Feichtinger; B. M. Köhler (Hrsg.): Ernährung in<br />
der Armut. Gesundheitliche, soziale und kulturelle Folgen in der Bundesrepublik. Berlin. S.<br />
185-203<br />
Klocke, A.; Hurrelmann, K. (1995): Armut und Gesundheit. Inwieweit sind <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
betroffen? In: Zeitschrift <strong>für</strong> Gesundheitswissenschaften. 2. Beiheft S. 138-151<br />
Klocke A.; Hurrelmann K. (Hrsg.) (2001): <strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. 2. vollständig<br />
überarbeitete Auflage. Opladen<br />
Köhler, B.M.; Feichtinger, E. (Hrsg.) (1998): Annotierte Bibliographie Armut und Ernährung.<br />
Berlin<br />
Mielck, A. (1998): Armut und Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen: Ergebnisse der<br />
sozial-epidemiologischen Forschung in Deutschland. In: Klocke, A.; Hurrelmann, K. (Hrsg.):<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche in Armut. Opladen. S. 225-249<br />
Mielck, A. (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze,<br />
Interventionsmöglichkeiten.<br />
Robert-Koch-Institut (Hrsg.) (2001): Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 03/01:<br />
Armut bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Verfasst von Prof. Dr. Andreas Klocke. Berlin<br />
Settertobulte, W.; P<strong>alle</strong>ntin, Ch.; Hurrelmann, K. (Hrsg.) (1995): Gesundheitsversorgung<br />
<strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche. Ein Praxishandbuch, Heidelberg<br />
Settertobulte, W. (2002): Gesundheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen in NRW. Sonderbericht<br />
im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung NRW im Auftrag des Ministeriums <strong>für</strong> Frauen,<br />
Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (2000): <strong>Kinder</strong>gesundheit in Baden-Württemberg.<br />
Stuttgart<br />
Armutsberichte, diverse empirische Untersuchungen und gesammelte Daten<br />
AWO Bundesverband e.V. (2000): AWO-Sozialbericht 2000. Gute Kindheit <strong>–</strong> Schlechte<br />
Kindheit. Armut und Zukunftschancen von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen in Deutschland. Bonn<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (2001): Lebenslagen in Deutschland.<br />
Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn
Teil V. Anhang<br />
Busch-Geertsema, V.; Ruhstrat, E.-U. (1993): „Das macht die Seele so kaputt...“. Armut in<br />
Bremen. Bremen<br />
Deutscher <strong>Kinder</strong>schutzbund e.V., Hannover; Volkswagen AG, Kommunikation Wolfsburg<br />
(Hrsg.) (1998): Taschenbuch der <strong>Kinder</strong>presse. Remagen-Rolandseck<br />
Gruppe <strong>für</strong> sozialwissenschaftliche Forschung (GSF) (1996). Münchner Armutsbericht ´95.<br />
Hanesch, W.; Krause, P.; Bäcker, G.; Maschke, M.; Otto, B. (2000): Armut und Ungleichheit<br />
in Deutschland. Der neue Armutsbericht der Hans-Böckler-Stiftung, des DGB und des<br />
Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Reinbeck bei Hamburg<br />
Hank, K.; Kersting, V.; Langenhoff, G.; Strohmeier, K.P. (Ruhr-Universität Bochum <strong>–</strong> Zentrum<br />
<strong>für</strong> interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung) (2000): Armut in Nordrhein-Westfalen. Umfang<br />
und Struktur des Armutspotentials. Bochum.<br />
Hauser, R.; Hübinger, W. (1993). Arme unter uns. Teil 1: Ergebnisse und Konsequenzen der<br />
Caritas-Armutsuntersuchung. hrsgg. vom Deutschen Caritasverband. Freiburg im Breisgau<br />
Kamensky, J.; Zenz, H. (2001): Armut <strong>–</strong> Lebenslagen und Konsequenzen. Ursachen, Ausmaß<br />
und Bewältigung sozialer Ungleichheit am Beispiel des Landkreises Neu-Ulm. Ulm<br />
Landeshauptstadt München, Sozialreferat (Hrsg.) (1990): Lebenslage Alleinerziehender in<br />
München <strong>–</strong> Erfahrungen mit privaten, verbandlichen und staatlichen Hilfen. Beiträge zur Sozialplanung<br />
116<br />
Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt (Hrsg.) (2001): Armut in Stuttgart. Quantitative und<br />
qualitative Analysen. Sozialbericht 1. Stuttgart<br />
Magistrat der Universitätsstadt Gießen, Sozial- und Jugenddezernat (Hrsg.) (2002): Kommunaler<br />
Armutsbericht. Gießen<br />
Stock, L. (1999): Armut im Landkreis Merseburg-Querfurt: Untersuchung zur aktuellen<br />
Armutsentwicklung in einem Teilgebiet der ehemaligen DDR-Chemieregion. Berlin<br />
Gesundheitsförderung<br />
Altgeld, T.; Laser, I. ; Walter, U. (Hrsg.) (1997): Wie kann Gesundheit verwirklicht werden?<br />
Gesundheitsfördernde Handlungskonzepte und gesellschaftliche Hemmnisse. Weinheim<br />
Amann, G.; Wipplinger, R. (Hrsg.) (1998): Gesundheitsförderung <strong>–</strong> Ein multidimensionales<br />
Tätigkeitsfeld. Tübingen<br />
Beuels, F.-R.; Wohlfahrt, N. (1991): Gesundheit <strong>für</strong> die Region? Neue Konzepte der kommunalen<br />
und betrieblichen Gesundheitsförderung. Bielefeld<br />
Böhm, B.; Janßen, M.; Legewie, H. (1999): Zusammenarbeit professionell gestalten: Projektleitfaden<br />
<strong>für</strong> Gesundheitsförderung, Sozialarbeit und Umweltschutz. Freiburg im Breisgau<br />
Breitwieser, U.; Donauer, B.; Elsigan, G.; Grossmann, R. (1991): Gesundheitsförderung:<br />
Appelle sind zuwenig! Beispiele regionaler Bildungsarbeit. München<br />
Bundeszentrale f. gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (1996): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung<br />
<strong>–</strong> Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden in der Gesundheitsförderung.<br />
Schwabenheim a.d. Selz<br />
129
130<br />
Teil V. Anhang<br />
Bundesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit e.V. (Hrsg.) (1999): Gesundheit: Strukturen und Handlungsfelder.<br />
Neuwied<br />
Doorduijn, A.; Geiger, I.; Heinemann, H. (1996): Gesundheitsförderung <strong>–</strong> Vom alltäglichen<br />
Umgang mit der Utopie <strong>–</strong> Das Arbeitsbuch zum Handbuch. Frankfurt am Main<br />
Enkerts, V; Schweigert, I. (Hrsg.) (1987): Gesundheit ist mehr! <strong>–</strong> Soziale Netzwerke <strong>für</strong> eine<br />
lebenswerte Zukunft. Hamburg<br />
Franzkowiak, P.; Sabo, P. (1993): Dokumente der Gesundheitsförderung. Mainz<br />
GesundheitsAkademie e.V. (Hrsg.) (2001): Gesundheit gemeinsam gestalten <strong>–</strong> Allianz <strong>für</strong><br />
Gesundheitsförderung. Frankfurt am Main<br />
Grossmann, R; Scala, K. (1994): Gesundheit durch Projekte fördern <strong>–</strong> Ein Konzept zur Gesundheitsförderung<br />
durch Organisationsentwicklung und Projektmanagement. Weinheim<br />
Hamburger Projektgruppe Gesundheitsberichterstattung (1996): Praxishandbuch Gesundheitsberichterstattung.<br />
Düsseldorf: Akademie <strong>für</strong> öffentliches Gesundheitswesen<br />
Keil, A.; Milles, D.; Müller, R. (Hrsg.) (1991): Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsförderung.<br />
Bremerhafen<br />
Krause, R. (Hrsg.) (1995): Gesundheitsförderung: Von der Projektplanung bis zur Evaluation.<br />
Handbuch zum Management in der Gesundheitsförderung. Oberhaching<br />
Laaser, U; Gebhardt, K.; Kemper, P. (Hrsg.) (2001): Gesundheit und soziale Benachteiligung.<br />
Informationssysteme <strong>–</strong> Bedarfsanalysen <strong>–</strong> Interventionen. Lage<br />
Labisch, A. (Hrsg.) (1989): Kommunale Gesundheitsförderung <strong>–</strong> aktuelle Entwicklungen,<br />
Konzepte, Perspektiven. Frankfurt am Main<br />
Landeszentrale <strong>für</strong> Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (Hrsg.) (1997): Rund um<br />
die regionale Gesundheitskonferenz. Ein Leitfaden zur Handhabung regionaler Gesundheitskonferenzen.<br />
Mainz<br />
Lohaus, A. (1993): Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im <strong>Kinder</strong>- und Jugendalter.<br />
Göttingen<br />
Pelikan, J.M.; Demmer, H.; Hurrelmann, K. (Hrsg.) (1993): Gesundheitsförderung durch<br />
Organisationsentwicklung: Konzepte, Strategien und Projekte <strong>für</strong> Betriebe, Krankenhäuser<br />
und Schulen. Weinheim<br />
Röhrle, B.; Sommer, G. (Hrsg.) (1999): Prävention und Gesundheitsförderung. Fortschritte<br />
der Gemeindepsychologie und Gesundheitsförderung, <strong>Band</strong> 4. Tübingen<br />
Stark, W. (Hrsg.) (1989): Lebensweltbezogene Prävention und Gesundheitsförderung <strong>–</strong><br />
Konzepte und Strategien <strong>für</strong> die psychosoziale Praxis. Freiburg im Breisgau<br />
Stumm, B.; Trojan, A. (1994): Gesundheit in der Stadt <strong>–</strong> Modelle-Erfahrungen-Perspektiven.<br />
Frankfurt am Main<br />
Trojan, A.; Hildebrand, H. (Hrsg.) (1990): Brücken zwischen Bürgern und Behörden <strong>–</strong> Innovative<br />
Strukturen <strong>für</strong> Gesundheitsförderung. St. Augustin<br />
Trojan, A.; Legewie, H. (2001): Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung <strong>–</strong> Leitbilder, Politik<br />
und Praxis der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt- und Lebensbedingungen.<br />
Frankfurt am Main
Projektberichte und Dokumentationen<br />
Teil V. Anhang<br />
Gesundheitsamt Köln, Geschäftsstelle „Kommunale Gesundheitskonferenz Köln“, <strong>Kinder</strong>-<br />
und Jugendgesundheitsdienst: Projektbericht: FAKIR (Förder-Angebote <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> in<br />
Regionen mit erhöhtem Hilfebedarf) Zu beziehen bei: Gesundheitsamt Köln, Abt. 535, Neumarkt<br />
15-21, 50667 Köln<br />
Sozialministerium Baden-Württemberg (Hrsg.) (1996): Gesundheitsförderung mit sozial<br />
Benachteiligten: Eine Bestandsaufnahme von Initiativen, Projekten und kontinuierlichen<br />
Angeboten. Zu beziehen über: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, Wiederholdstr.15,<br />
70174 Stuttgart<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (2001): „Tackling Inequalities in<br />
Health“ <strong>–</strong> ein Projekt des „European Network of Health Promotion Agencies“ (ENHPA) zur<br />
Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten. Abschlussbericht <strong>für</strong> das deutsche Teilprojekt.<br />
Vorgelegt von Prof. Dr. Johannes Siegrist und Dr. Ljiljana Joksimovic (Universität Düsseldorf,<br />
Institut <strong>für</strong> Medizinische Soziologie)<br />
Stadtteilbüro Eidelstedt-Nord, Bezirksamt Eimsbüttel, Hörgensweg 59 b, 22523 Hamburg:<br />
Soziale Stadtteilentwicklung Eidelsstedt-Nord „Visitenkarte“<br />
Mielck. A.; Abel, M.; Heinemann, H.; Stender, K.-P. (Hrsg.) (2002): Auf dem Weg: „<strong>Gesunde</strong><br />
Städte“ <strong>–</strong> Projekte zur <strong>Chancen</strong>gleichheit. Lage<br />
Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit Niedersachsen e.V.; Zentrum <strong>für</strong> Angewandte Gesundheitswissenschaften<br />
der Fachhochschule Nordostniedersachsen und der Universität Lüneburg<br />
(Hrsg.) (2000): Armut und Gesundheit. Praxisprojekte aus Gesundheits- und Sozialarbeit in<br />
Niedersachsen. Hannover<br />
Saur, U.; Tilke, B. (Hrsg.) (2001): Jung, lässig & pleite? Konsumlust und Schuldenlast bei<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Dokumentation einer Fachtagung. Erhältlich bei: Aktion Jugendschutz,<br />
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg , Stafflenbergstr. 44, 70184 Stuttgart, Tel.:<br />
0711/237 37 0<br />
Tagungsberichte<br />
„Soziale Ungleichheit als Herausforderung <strong>für</strong> Gesundheitsförderung“ Dokumentation des<br />
Gesundheitspolitischen Symposiums in Baden-Württemberg, 1995. Hrsg. Sozialministerium<br />
Baden-Württemberg, Schellingstr.15, 70174 Stuttgart<br />
„Gesundheitsförderung mit sozial Benachteiligten“. Dokumentation einer Informationsveranstaltung<br />
<strong>für</strong> Fach- und Führungskräfte der Stadt- und Landkreise am 7. Dezember 1998, Landesgesundheitsamt<br />
Baden-Württemberg<br />
„Armut und Gesundheit in Düsseldorf.“ Fachtagung der „Düsseldorfer Gesundheitskonferenz“<br />
am 24. November 1999 im Rathaus der Landeshauptstadt. Erstellt von der Geschäftsstelle<br />
der „Düsseldorfer Gesundheitskonferenz“ (Herr Pöllen, Frau Kochhan)<br />
„Armut und Gesundheit“ von Franke, M.; Geene, R.; Luber, E., Gesundheit Berlin e.V., Landesarbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Gesundheitsförderung (1999)<br />
131
132<br />
Teil V. Anhang<br />
„<strong>Kinder</strong>armut <strong>–</strong> Gesundheit“. Dokumentation der Fachtagung des Landesverbands der Arbeiterwohlfahrt<br />
Mecklenburg-Vorpommern e.V. am 12. April 2000 in Schwerin. Zu beziehen bei:<br />
Landesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheitsförderung M-V, Zum Bahnhof 20, 19053 Schwerin<br />
„Stadtteilorientierte Familienhilfen <strong>–</strong> Balance zwischen individueller und struktureller Hilfe“.<br />
Dokumentation der Fachtagung am 10. Oktober 2000 im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Zu beziehen<br />
bei: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde <strong>für</strong> Schule, Jugend und Berufsbildung, Amt<br />
<strong>für</strong> Jugend, Abt. J4, Jugend- und Familienförderung, Postfach 76 06 08, 22056 Hamburg<br />
„Ernährung und Gesundheit: (k)ein Thema <strong>für</strong> Gesundheitsförderung und Verbraucherschutz?“.<br />
Materialien und Arbeitspapiere einer ÖGD-Infoveranstaltung am 21. Mai 2001 in<br />
Stuttgart, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg<br />
Ausstellungen und Ausstellungskataloge<br />
„Armut <strong>–</strong> Die einen stehen im Dunkeln, die anderen stehen im Licht“<br />
Wanderausstellung eines Schülerwettbewerbs mit 18 Plakaten, die Armut in Deutschland und<br />
der Welt anklagen und zum Handeln auffordern. Hrsg. Landeszentrale <strong>für</strong> politische Bildung<br />
Baden-Württemberg, Schülerwettbewerb, Sophienstr.28-30, 70178 Stuttgart (Monika Greiner,<br />
Tel. 0711/16 40 99 26)<br />
„Armut grenzt aus“ <strong>–</strong> Wanderausstellung<br />
Hrsg. Arbeitslosenselbsthilfe Osnabrück, Lotter Str. 6, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/47299<br />
„Ohne Arbeit kein Vergnügen. <strong>Kinder</strong>armut <strong>–</strong> arme Frauen in der BRD.“ Hrsgg. von DONNA<br />
45 e. V. (1997). Oldenburg<br />
„Kennen wir uns?“ Straßenkinder fotografieren ihre Welt<br />
Wanderausstellung Hrsg. Off-Road-Kids e.V. und Mannesmann Mobilfunk GmbH, Am Seestern<br />
1, 40547 Düsseldorf (Andrea Zinnlauf, Tel. 0211/533 3940)<br />
„Armut von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn dokumentiert in einer<br />
Fotoausstellung.“ hrsgg. vom Mieterverein Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und Arbeiterwohlfahrt<br />
Kreisverband Rhein-Sieg (1997): Siegburg<br />
„<strong>Kinder</strong> der Ausweglosigkeit.“ Von Kerstin Zillmer (1997). Münster<br />
Verzeichnis verleihbarer Ausstellungen zur Prävention & Gesundheitsförderung. Hrsgg. vom<br />
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, Wiederholdstr.15. 70174 Stuttgart
Tipps zum Recherchieren im Internet<br />
Daten und Fakten<br />
http://www.bma.bund.de<br />
(weiter mit: „Soziale Sicherheit“) Bundesministerium<br />
<strong>für</strong> Arbeit und Sozialordnung<br />
http://www.statistik.baden-württemberg.de<br />
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg:<br />
Böblinger Straße 68,<br />
70199 Stuttgart<br />
Tel.: 0711/641-2833<br />
http://www.lds.nrw.de<br />
Landesamt <strong>für</strong> Datenverarbeitung und Statistik<br />
Nordrhein-Westfalen:<br />
Mauerstraße 51,<br />
40476 Düsseldorf<br />
http://www.statistik-bw.de/bevoelkgebiet/fafo/<br />
Homepage der Familienwissenschaftlichen<br />
Forschungsstelle im Statistischen Landesamt<br />
Baden-Württemberg in Stuttgart<br />
http://www.ruhr-uni-bochum.de/zefir/<br />
Homepage des ZEFIR <strong>–</strong> Zentrum <strong>für</strong> interdisziplinäre<br />
Ruhrgebietsforschung<br />
Armut und Gesundheit<br />
http://www.gesundheitberlin.de<br />
Homepage der Gesundheit Berlin e.V. <strong>–</strong> Landesarbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Gesundheitsförderung<br />
Teil V. Anhang<br />
„Lebenslagen in Deutschland“<br />
Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der<br />
Bundesregierung<br />
Bericht und Materialband zum Runterladen.<br />
Überregionale und regionale Daten zu Gesundheit<br />
und Sozialer Sicherheit.<br />
Überregionale und regionale Daten zu Gesundheit<br />
und Sozialer Sicherheit.<br />
Umfangreiche Literaturliste zu Themen wie:<br />
Einkommensverhältnisse, Haushalt, Familie,<br />
Lebenslage von Alleinerziehenden, Familienpolitik,<br />
Sozialhilfe, sozial benachteiligte<br />
<strong>Kinder</strong> und Jugendliche.<br />
Texte und Projektberichte zu: Armut in<br />
Nordrhein-Westfalen und <strong>Kinder</strong>armut im<br />
Ruhrgebiet. Berichte zum Runterladen.<br />
Beiträge der Kongresse „Armut und Gesundheit“,<br />
die seit 1996 in Berlin stattfinden.<br />
Texte zu Themen wie Handlungsansätze,<br />
Projekte aus der Praxis der Gesundheitsförderung<br />
von sozial benachteiligten Menschen,<br />
Armut und Gesundheit von speziellen<br />
Zielgruppen, Stellungnahmen von Politikern<br />
zur sozialen Ungleichheit usw. Links zu Kooperationspartnern<br />
in anderen Bundesländern.<br />
133
134<br />
Teil V. Anhang<br />
http://www.bzga_stat/international/<br />
Homepage der Bundezentrale <strong>für</strong> gesundheitliche<br />
Aufklärung<br />
http://www.bmgesundheit.de<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit<br />
http://www.sozial-epidemiologie.de<br />
Arbeitsgruppe Sozialepidemiologie<br />
http://www.ohn.gov.uk/ohn/ohn.htm“<br />
Saving Lives: Our healthier Nation“.<br />
Armut und Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen<br />
http://www.weltkindergipfel.de<br />
Weltkindergipfel<br />
http://www.diakonie.de/publikationen/nak/1999/<br />
abschnitt01.htm<br />
Homepage der Diakonie<br />
Abschlussbericht „Tackling Inequalities in<br />
Health“ <strong>–</strong> ein Projekt des Europäischen<br />
Netzwerkes „European Network of Health<br />
Promotion Agencies“ (ENHPA) zur Gesundheitsförderung<br />
bei sozial Benachteiligten.<br />
PDF-Datei zum runterladen.<br />
Aktuelle Informationen und Veröffentlichungen<br />
des Bundesministeriums <strong>für</strong> Gesundheit,<br />
u.a. auch zu den Kongressen „Armut und<br />
Gesundheit“ in Berlin.<br />
Publikationen, Zeitschriftenliste und zahlreiche<br />
Links zu Sozialer Ungleichheit und Gesundheit.<br />
Soziale Ungleichheit und Gesundheitsförderung<br />
in Großbritannien. Sehr umfassend mit<br />
vielen Links (z.B. Acheson-Report, Black-<br />
Report).<br />
Beiträge über <strong>Kinder</strong>rechte<br />
Beiträge zu „Armut und Krankheit“ bei ausgewählten<br />
Zielgruppen.<br />
http://www.jugendbericht.de/nrw Kommentierter Datenband zum 7. <strong>Kinder</strong>und<br />
Jugendbericht der Landesregierung<br />
NRW, reichhaltige Datensammlung auch<br />
zum Themenkomplex Armut.<br />
http://www.awo.org<br />
Diverse Berichte zum Thema: <strong>Kinder</strong>, Ju-<br />
(weiter mit: „A <strong>–</strong> Z“)<br />
gendliche und Armut, u.a. Kurzfassung des<br />
Homepage der Arbeiterwohlfahrt<br />
Sozialberichts 2000: „Gute Kindheit <strong>–</strong><br />
schlechte Kindheit.“ Armut und Zukunftschancen<br />
von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen..<br />
http://www.nationale-armutskonferenz.de Diverse Publikationen: Nationaler Armutsbe-<br />
(weiter mit: „Publikationen“)<br />
richt, „Sozialpolitische Bilanz Armut von<br />
Nationale Armutskonferenz<br />
<strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen“ (mit Berücksichtigung<br />
von Gesundheit). Kontaktadressen<br />
von regionalen Armutskonferenzen.<br />
http://www.kindergartenpaedagogik.de/202.html Online-Handbuch „Armut und Benachteili-<br />
<strong>Kinder</strong>gartenpädagogik<br />
gung im Vorschulalter“, Bericht über die frühen<br />
Folgen von Armut und Handlungsansätze<br />
in der KiTa-Arbeit.
Gesundheit und Gesundheitsförderung<br />
http://www.bzga.de<br />
Bundeszentrale <strong>für</strong> gesundheitliche Aufklärung<br />
http://www.bfge.de<br />
Bundesvereinigung <strong>für</strong> Gesundheit<br />
http://www.kinderaerzte-lippe.de/22ma-3.htm<br />
<strong>Kinder</strong>ärzte Lippe<br />
http://www.gesundheits.de<br />
GesundheitsAkademie e.V.<br />
http://www.gesundheit-psychologie.de/<br />
Gesundheit & Psychologie im Internet<br />
http://www.frauengesundheit-nrw.de/<br />
Koordinationsstelle Frauen und Gesundheit<br />
NRW<br />
http://www.gesunde-staedte-netzwerk.de/<br />
<strong>Gesunde</strong> Städte-Netzwerk<br />
http://www.btonline.de/literatur/who/zieleho98.html<br />
Beratung und Therapie online<br />
http://www.who.int<br />
WHO, Genf<br />
http://www.bgvv.de<br />
Bundesinstitut <strong>für</strong> gesundheitlichem Verbraucherschutz<br />
und Veterinärmedizin, Berlin<br />
http://www.rki.de<br />
Robert Koch-Institut, Berlin<br />
Teil V. Anhang<br />
Infodienst <strong>für</strong> Fachmitarbeiter(innen). U.a.<br />
Studien und Medien zu unterschiedlichen<br />
Gesundheitsthemen.<br />
Informationen zu Themen und Projekten der<br />
BfGE (u.a. zu Weltgesundheitstagen, Gesundheitspolitik).<br />
Verschiedene Kongressbeiträge zum Thema<br />
Gesundheitsförderung <strong>–</strong> Theorie und Praxis<br />
(z.B. „Grundsätze einer jugendgemäßen Gesundheitsförderung“).<br />
Diverse Aufsätze zum Thema Gesundheit,<br />
Gesundheitsförderung (WHO-Texte, handlungsorientierte<br />
Texte).<br />
Diverse Beiträge zu Gesundheit, Gesundheitsförderung<br />
und Psychologie.<br />
Informationen zu Frauen und Gesundheit<br />
Informationen zum Programm, zu Netzwerk-Aktivitäten<br />
und <strong>–</strong> Mitgliedern.<br />
Gesundheitspolitische Ziele der WHO <strong>für</strong><br />
das 21.Jahrhundert.<br />
Informationen der WHO, u.a. zu Gesundheitsförderung<br />
(Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung)<br />
Informationen zu gesundheitlichem Verbraucherschutz<br />
und Veterinärmedizin<br />
Informationen zu Gesundheit, Krankheit,<br />
Gesundheitsberichterstattung und Forschung.<br />
135
136<br />
Teil V. Anhang<br />
Aktionen, Projekte, Medien<br />
http://www.kinder-jugendgesundheit.de<br />
<strong>Kinder</strong>-und Jugendgesundheitsdienst der Gesundheitsämter<br />
in NRW<br />
http://www.heidelberg.de/umwelt/gesundh.htm<br />
<strong>Gesunde</strong> Stadt Heidelberg<br />
http://www.stuttgart.de/sde<br />
(weiter mit: Themen: Gesundheit)Projekt „Forum<br />
<strong>Gesunde</strong> Stadt Stuttgart e.V.“<br />
http://www.gesundheitsparlament.net/<br />
Gesundheitsparlament<br />
http://www.bzga.de<br />
(weiter mit: „Marktbeobachtungen“)<br />
Das Gesundheitsinformationssystem der BZgA<br />
http://www.sozialestadt.de<br />
Bund-Länder Programm Soziale Stadt<br />
http://www.vse-essen.de<br />
Verein Schuldnerhilfe e.V. Essen (VSE)<br />
Forum <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>- und Jugendgesundheitsdienste<br />
im ÖGD. (U.a. Gesundheitsförderung<br />
im Gemeinwesen, Kooperation mit<br />
dem sozialen Netz einer Stadt).<br />
Allgemeines zur Gesundheitsförderung in<br />
Heidelberg, u.a. mit der Zielgruppe <strong>Kinder</strong>.<br />
Link zu „<strong>Gesunde</strong>-Städte-Netzwerk“.<br />
Ziele, Themen, Projektvorstellungen, Projektberatung<br />
und -förderung zum Projekt<br />
„<strong>Gesunde</strong> Stadt“. Angebote zur Gesundheitsförderung.<br />
Forum zu Vernetzung und Austausch <strong>alle</strong>r<br />
nicht regierungsgebundenen Organisationen<br />
(NGOs).<br />
Datenbank zur Gesundheitsförderung und<br />
Prävention im ÖGD Baden-Württemberg.<br />
Informationen zu Programmgrundlagen,<br />
Veröffentlichungen, Ansprechpartnern, Projektdatenbank.<br />
Informationen und Materialien <strong>für</strong> Fachkräfte<br />
aus Schule und Sozialarbeit zur Prävention<br />
von Überschuldung. Umfangreiche<br />
Link-Liste und Kontaktadressen zu anderen<br />
Institutionen.<br />
Online abrufbar: Faltblätter, Projektanleitungen,<br />
Materialien und Foliensätze aus dem<br />
„Schuldenkoffer“, einer Materialiensammlung<br />
zur Überschuldungsvorbeugung bei Jugendlichen<br />
und jungen Erwachsenen.
Die Öffentlicher Fotos Gesundheitsdienst<br />
http://www.loegd.nrw.de<br />
Homepage des Landesinstituts <strong>für</strong> den öffentlichen<br />
Gesundheitsdienst, Nordrhein-Westfalen.<br />
http://www.landesgesundheitsamt.de<br />
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg<br />
http://www.gesundheitsamt-bw.de<br />
Öffentlicher Gesundheitsdienst Baden-Württemberg<br />
http://www.afoeg.nrw.de<br />
Akademie <strong>für</strong> Öffentliches Gesundheitswesen,<br />
Düsseldorf<br />
http://www.afoeg.bayern.de/<br />
Akademie <strong>für</strong> das öffentliche Gesundheitswesen<br />
im Bayerischen Landesamt <strong>für</strong> Gesundheit<br />
und Lebensmittelsicherheit<br />
Teil V. Anhang<br />
Beschreibungen zu Aufgaben und Angeboten<br />
des Landesinstituts.<br />
Umfangreiche Daten z.B. zu Gesundheitsindikatoren,<br />
zur Schuleingangsuntersuchung.<br />
Links zu Themen wie Gesundheitsämter,<br />
Landesgesundheitskonferenz, Sozialversicherungsträger,<br />
Verfasste Ärzte- und Zahnärzteschaft,<br />
Wohlfahrtsverbände, Gesundheitliche<br />
Selbsthilfe, Kommunale Spitzenverbände,<br />
Einrichtungen und Projekte auf<br />
Landesebene und deutschlandweite Adressen<br />
.<br />
Informationen zu Aufgabenfeldern des LGA<br />
z.B. zu Gesundheit und Umwelt, Gesundheitsförderung,<br />
Prävention, Frühförderung,<br />
Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung,<br />
umfangreiche Link-Liste.<br />
Übersicht zu Angeboten des ÖGD Baden-<br />
Württemberg nach Themen und Orten (u.a.<br />
Gesundheitsförderung, <strong>Kinder</strong>- und Jugendgesundheit),<br />
Links zu den Gesundheitsämtern.<br />
Informationen zu Veranstaltungen, Forschungsvorhaben,<br />
Projekten und Veröffentlichungen.<br />
Informationen zu Gesundheitsberichterstattung,<br />
Gesundheitsförderung, Pädiatrie, umfangreiche<br />
Link-Liste.<br />
137
138<br />
Teil V. Anhang<br />
Die Fotos<br />
Die in diesem Heft abgedruckten Fotos sind Teil der Wanderausstellung „Kennen wir uns?<br />
Straßenkinder fotografieren ihre Welt“, einer Aktion von Off-Road-Kids e.V. und Vodafone. Die<br />
Fotos spiegeln eine besonders drastische Erscheinungsform von <strong>Kinder</strong>armut wieder und veranschaulichen<br />
die Dimension und Absurdität dieses Themas in unserer Wohlstandsgesellschaft<br />
nachhaltiger und lebensnäher als manche Beschreibung oder Reflexion. Wir haben die Fotos im<br />
Heft bewusst zwischen den Kapiteln platziert <strong>–</strong> um Ruhepunkte zu schaffen, um zwischen Zahlen<br />
und Daten, theoretischen und praxisbezogenen Ausführungen Gelegenheit zu geben, sich die<br />
praktische Konsequenz und die Dringlichkeit dieses Themas wieder neu bewusst zu machen.<br />
Die Wanderausstellung „Kennen wir uns? Straßenkinder fotografieren ihre Welt“ wurde inzwischen<br />
mehrfach prämiert und gewürdigt. Sie kann bei Vodafone D2 gebucht werden. Nähere<br />
Informationen erhalten Sie über www.offroadkids.de.
Zu guter Letzt...<br />
wollen wir das Signal <strong>für</strong> einen Aufbruch setzen.<br />
Teil V. Anhang<br />
Die Münchner Erklärung zu „Armut und Gesundheit <strong>–</strong> <strong>Chancen</strong>gleichheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche“<br />
scheint uns hier<strong>für</strong> in besonderem Maße geeignet zu sein. Zum einen ist sie das Ergebnis<br />
einer Gesundheitskonferenz und steht <strong>für</strong> die Sinnhaftigkeit der Bündelung der Kräfte<br />
gerade in diesem Bereich. Des Weiteren schlägt sie die Brücke zu anderen Politikfeldern, zu anderen<br />
Initiativen und Aktionen über kommunale und Landesgrenzen hinaus und betont die Bedeutung<br />
gesamtgesellschaftlicher Strategien auf <strong>alle</strong>n politischen Ebenen. Mehr aber noch ist sie<br />
uns ein eindrucksvolles Beispiel entschlossenen Engagements, das von Bürgern und Initiativen,<br />
Wissenschaftlern, Praktikern und politisch Verantwortlichen <strong>gleiche</strong>rmaßen getragen wird, Beispiel<br />
auch <strong>für</strong> die Bereitschaft von Politik und Verwaltung, verbindliche Strategien zu formulieren<br />
und die Verpflichtung zu verantwortlichem Handeln einzugehen.<br />
Zahlreiche solcher innovativen, sichtbaren und von vielen gesellschaftlichen Kräften getragenen<br />
Initiativen wünschen wir uns.<br />
139
140<br />
Teil V. Anhang<br />
Armut und Gesundheit <strong>–</strong> <strong>Chancen</strong>gleichheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche<br />
Münchner Erklärung<br />
Armut gibt es auch in München. Die Gesundheitschancen und damit die Entwicklungschancen<br />
von <strong>Kinder</strong>n- und Jugendlichen sind davon besonders betroffen. Zum Thema ''Armut und Gesundheit<br />
<strong>–</strong> <strong>Chancen</strong>gleichheit <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche“ fand am 07.02.2001 eine Gesundheitskonferenz<br />
in München statt. Die 'Münchner Erklärung' basiert auf der Entschließung der<br />
Gesundheitsministerkonferenz 2000, der Kölner Entschließung der '<strong>Gesunde</strong>n Städte' 1999 und<br />
der Münchner Gesundheitskonferenz.<br />
Alle müssen etwas tun: Armut ist ein gravierendes Gesundheitsrisiko. Die Verbesserung der<br />
<strong>Chancen</strong>gleichheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen bedarf einer ressortübergreifenden gesundheitsförderlichen<br />
Stadtentwicklungspolitik. Die Gesundheitskonferenz stimmt mit der Kölner<br />
Entschließung darin überein:<br />
„Alle müssen etwas tun. Gesamtgesellschaftliche Strategien auf kommunaler, Landes- und<br />
Bundesebene zur Bewältigung dieser Problematik sind notwendig.“<br />
Die Ursachen der Armut müssen bekämpft werden. <strong>Kinder</strong> dürfen kein Armutsrisiko sein, Erziehungsleistung<br />
muss neu bewertet und bezahlt werden.<br />
1. Armut und Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen zum Thema machen!<br />
Der Gesundheitsbeirat hat das Thema 'Armut und Gesundheit bei <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen'<br />
zum Jahresthema 2001 gemacht. Der Gesundheitsbeirat bietet an, die vorgeschlagenen Maßnahmen<br />
in seinen Arbeitskreisen fachlich zu beraten und eine Empfehlung zu verabschieden. Es<br />
ist notwendig, das Thema vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen, Diensten und Einrichtungen<br />
sowie dem Bezirksausschuss zu bearbeiten und in konkreten Maßnahmen umzusetzen.<br />
Damit einhergehend sind verstärkte Anstrengungen zur besseren Kooperation und Vernetzung<br />
vor Ort zwischen Gesundheitsbereich, Schule, Jugendhilfe /Jugendarbeit und Sozialbereich<br />
notwendig. Dazu bietet sich z.B. das Netzwerk REGSAM (Regionalisierung der sozialen<br />
Arbeit in München) an. Ziel ist es unter anderem ein wirksames Frühwarnsystem zu entwickeln.<br />
Sozial- und Gesundheitsberichterstattung sind zu vernetzen und ggf. zu regionalisieren. Eine<br />
Verbesserung der Datengrundlagen soll erfolgen, zusätzlich sollen Sozialmerkmale in die<br />
Dokumentation der schulärztlichen Untersuchungen aufgenommen werden.<br />
2. Verbesserung der Arbeit durch Fortbildungen und strukturelle Maßnahmen.<br />
Zur Verbesserung der <strong>Chancen</strong>gleichheit von benachteiligten <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen ist es<br />
wichtig, dass diese mehr als bisher von den vorhandenen gesundheitlichen und sozialen Diensten<br />
und Angeboten profitieren. Spezielle Fortbildungen sollen dazu beitragen,<br />
<strong>•</strong> dass <strong>alle</strong> Akteure die Zusammenhänge und Symptome von Armut und Krankheit <strong>–</strong> auch geschlechts-<br />
und kulturspezifisch <strong>–</strong> frühzeitig erkennen und darin geschult sind, die Kompetenzen<br />
der benachteiligten Mädchen und Jungen, sowie ihrer Eltern zu entdecken, zu respektieren<br />
und zu stärken (Salutogenese bzw. Primärprävention);<br />
<strong>•</strong> dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie die<br />
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>- und Jugendmedizin und andere Fach-
Teil V. Anhang<br />
gruppen das regionale Hilfesystem der Sozial-, <strong>Kinder</strong>- und Jugendhilfe kennen, es zum<br />
Wohle der benachteiligten <strong>Kinder</strong> besser nutzen können und sich im Bedarfsfall mit Mitarbeiter(inne)n<br />
dieser Institutionen besser rückkoppeln;<br />
<strong>•</strong> dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Kinder</strong>-, Jugend- und der Sozialarbeit sowie<br />
der Schulen über medizinische Vorsorgemöglichkeiten und gesundheitsförderliche Angebote<br />
und Hilfen informiert sind, um entsprechende Wegweisung geben zu können;<br />
<strong>•</strong> dass Erzieherinnen/ Erzieher und Lehrerinnen/ Lehrer sowie die Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter<br />
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und der offenen <strong>Kinder</strong>- und Jugendarbeit die<br />
Ansätze und Themen der Gesundheitsförderung speziell im Hinblick auf Benachteiligte<br />
verstärkt berücksichtigen und altersgemäß, geschlechts- und kulturspezifisch aufgreifen<br />
können;<br />
In diesem Sinne fordert die Gesundheitskonferenz:<br />
<strong>•</strong> Das Personal- und Organisationsreferat soll in Absprache mit dem Referat <strong>für</strong> Gesundheit<br />
und Umwelt, dem Sozialreferat und dem Schulreferat adäquate Fortbildungen konzipieren<br />
und diese in das städtische Fortbildungsangebot aufnehmen. Referatsinterne Fortbildungen<br />
sollten <strong>–</strong> je nach Eignung <strong>–</strong> <strong>für</strong> die jeweils anderen Referate und die Einrichtungen der<br />
Freien Wohlfahrtspflege geöffnet werden.<br />
<strong>•</strong> Die Wohlfahrtsverbände und freien Träger sollen analog im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich<br />
Fortbildungen <strong>für</strong> ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten.<br />
<strong>•</strong> Die Ärztekammer bzw. der Ärztliche Kreis- und Bezirksverband sollen ihre Mitglieder über<br />
die vorhandenen Hilfsmöglichkeiten verstärkt informieren.<br />
<strong>•</strong> Die gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungen sollen auf ihre Erreichbarkeit und Nutzbarkeit<br />
durch Benachteiligte überprüft werden. Nötige inhaltliche, methodische und organisatorische<br />
Veränderungen (z.B. Hausbesuche / Gehstruktur) sollen vorgenommen werden,<br />
um diese Zielgruppe besser zu erreichen.<br />
3. Gesundheitsförderung muss zielgenau und konkret sein<br />
Viele Münchener Projekte und Einrichtungen leisten bereits einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung<br />
der <strong>Chancen</strong>gleichheit von <strong>Kinder</strong>n und Jugendlichen. Einige Projekte wurden als gute<br />
Beispiele auf der Gesundheitskonferenz vorgestellt (wie z.B. die Gesundheitsberatungsstelle<br />
Hasenbergl).<br />
Die Gesundheitskonferenz fordert:<br />
<strong>•</strong> Sozial- und Gesundheitswegweiser müssen stadtteilbezogen erstellt werden. Die Auflistung<br />
der gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen und Dienste, Initiativen und Selbsthilfegruppen<br />
müssen Fachleuten und Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.<br />
<strong>•</strong> Öffentlich geförderte kinder- und jugendspezifische Freizeit- und Ferienangebote müssen<br />
ausgeweitet werden und <strong>für</strong> finanziell schwache Familien attraktiv bleiben.<br />
<strong>•</strong> 'Öffentliche Räume' <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> und Jugendliche, die diese sich aneignen können, müssen<br />
weiter ausgebaut werden. Fehlende Freizeiteinrichtungen sind zu ergänzen.<br />
141
142<br />
Teil V. Anhang<br />
<strong>•</strong> An <strong>alle</strong>n Schultypen muss Halbtagsbetreuung und Mittagstisch garantiert sein. Die Ganztagesschule<br />
muss sukzessive als Standard flächendeckend eingeführt werden.<br />
<strong>•</strong> Gesundheitsförderung an den Schulen muss ausgebaut werden, Gesundheitsbildung zum<br />
Pflichtfach werden; Kompetenzen der <strong>Kinder</strong> und Jugendlichen sind dabei einzubeziehen<br />
und zu fördern.<br />
<strong>•</strong> Zugang zum Schul- und Bildungssystem und zur medizinischen Versorgung <strong>für</strong> <strong>alle</strong> Flüchtlinge<br />
und deren <strong>Kinder</strong>, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, ist zu garantieren.<br />
<strong>•</strong> Die Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften müssen verbessert werden, z.B. durch<br />
aufsuchende Gesundheitshilfen, Abschaffung der Essenspakete. Begleitende Dolmetscherdienste<br />
müssen selbstverständlich sein.<br />
<strong>•</strong> Aufsuchende Gesundheitsvorsorge vom Säuglings- bis zum Jugendalter muss eingerichtet<br />
werden, Hausbesuche der <strong>Kinder</strong>krankenschwestern müssen ausgebaut werden.<br />
<strong>•</strong> Die medizinische Betreuung muss multidisziplinär und vor <strong>alle</strong>m präventiv ausgerichtet<br />
sein.<br />
<strong>•</strong> Niederschwellige Angebote (wie z.B. Gesundheitsberatungsstelle Hasenbergl) müssen ausgeweitet<br />
werden und in <strong>alle</strong>n Stadtteilen mit besonderem Bedarf angeboten werden.<br />
Die Münchner Erklärung wurde erarbeitet von<br />
Martin Eichner, Sozialamt <strong>–</strong> Rita Fehrmann-Brunskill, Referat <strong>für</strong> Gesundheit und Umwelt <strong>–</strong> Elly<br />
Geiger, Kreisjugendring München-Stadt <strong>–</strong> Dr. Hermann Gloning, Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband<br />
<strong>–</strong> Christian Groffik, Referat <strong>für</strong> Gesundheit und Umwelt <strong>–</strong> Klaus Hehl, Referat <strong>für</strong><br />
Gesundheit und Umwelt <strong>–</strong> Natascha Hermann, M.P.H., Public Health-Studiengang <strong>–</strong> Paul A.<br />
Hirschauer, Stadtjugendamt <strong>–</strong> Dr. Erwin Hirschmann, Vorstand Gesundheitsbeirat <strong>–</strong> Dr. Waltraud<br />
Knipping, Berufsverband der <strong>Kinder</strong>- und Jugendärzte <strong>–</strong> Ute Kratzer, Allgemeiner Sozialdienst<br />
<strong>–</strong> Ursula Latka-Kiel, Münchner Aktionswerkstatt G'sundheit <strong>–</strong> Dr. Andreas Mielck,<br />
M.P.H., GSF-medis <strong>–</strong> Rolf Romaus, Gruppe <strong>für</strong> Sozialforschung <strong>–</strong> Gabriele Spies, Referat <strong>für</strong><br />
Gesundheit und Umwelt <strong>–</strong> Karin Spörl, Schulreferat <strong>–</strong> Willibald Strobel-Wintergerst, Arbeitsgemeinschaft<br />
Freie Wohlfahrtspflege <strong>–</strong> Prof. Dr. Dr. h.c. Hubertus von Voss, <strong>Kinder</strong>zentrum<br />
München.<br />
Die Dokumentation der Gesundheitskonferenz ist (in begrenzter Stückzahl) erhältlich bei<br />
Klaus Hehl, Geschäftsführer des Gesundheitsbeirats Referat <strong>für</strong> Gesundheit und Umwelt,<br />
Implerstraße 9, 81371 München<br />
Bestellungen bitte nur schriftlich oder per e-mail Gesundheitsbeirat.rgu@muenchen.de<br />
Kontakt über: Klaus Hehl, Telefon 089 233 24911